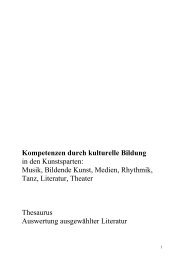4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diese Hoffnungen erwiesen sich als unrealistisch. Ende der sechziger Jahre wurden fast überall kritische Betrachtungen<br />
angestellt, was unter anderem zu einem zunehmenden Erkennen der Schwierigkeiten führte, mit denen die moderne Weit<br />
konfrontiert ist: das wachsende Ungleichgewicht zwischen Industrie- <strong>und</strong> Entwicklungsländern, neue Gefahren für die<br />
Vernichtung der menschlichen Rasse <strong>und</strong> ihrer Umwelt. Akzentuierung der Unterschiede, Vereinheitlichungen der<br />
Lebensweisen, Verfall, ja sogar Zerstörung kultureller Identitäten usw., Außerdem hat die Erringung oder Wiedererlangung der<br />
politischen Unabhängigkeit in den Entwicklungsländern, wenigstens in den meisten Fällen, nicht dazu geführt, daß sie ihre<br />
wirtschaftliche <strong>und</strong> kulturelle Zukunft selbst gestalten können.<br />
Und so ist es nicht überraschend, daß nationale <strong>und</strong> internationale Entwicklungsstrategien <strong>und</strong> -projekte, die systematisch<br />
wirtschaftliche <strong>und</strong> wissenschaftliche Merkmale in den Vordergr<strong>und</strong> stellen, auf Gleichgültigkeit der betreffenden Bevölkerung<br />
oder sogar auf Ablehnung gestoßen sind.<br />
Durch die Konfrontation mit der Realität setzte sich ein einfacher Gedanke durch: Wohlstand, Fortschritt <strong>und</strong> Glück können nicht<br />
nach einem vorher aufgestellten Plan <strong>und</strong> einem vereinheitlichten Muster eingeführt werden. Kein echtes Entwicklungsprojekt<br />
darf die wichtigsten Merkmale der natürlichen kulturellen Umwelt, die Bedürfnisse, Hoffnungen <strong>und</strong> Werte der entsprechenden<br />
Bevölkerung außer acht lassen.<br />
Nachdem der Begriff "Entwicklung“ erst einmal in das kulturelle Leben eingedrungen ist, kam er voll zum Tragen, weil er<br />
bestätigte, daß es notwendig ist, nicht nur die Arbeitskraft des Menschen, sondern auch seine kulturelle Identität in Betracht zu<br />
ziehen, die die Gr<strong>und</strong>lage seiner Weltanschauung bildet. Die aktive Teilnahme des Menschen an den sie betreffenden<br />
Entwicklungsvorhaben wurde daher nicht mehr nur als wünschenswert, sondern als unerläßliche Voraussetzung für den Erfolg<br />
solcher Projekte betrachtet.“ (Ebd.)<br />
Diese Diskussion wurde umgesetzt in der <strong>zur</strong> Zeit noch laufenden UNO - "Weltdekade <strong>zur</strong> kulturellen Entwicklung". (Vgl.<br />
Nationalkomitee 1988.)<br />
Diese internationale Diskussion, die - wie bei Hofmann gezeigt <strong>und</strong> wie sich an der gesamten Diskussion um Soziokultur in<br />
Deutschland belegen läßt - wesentlich die nationale kulturpolitische Diskussion seit den siebziger Jahren prägt (vgl. Sievers<br />
1988, Sievers/Wagner 1992), läßt sich wie folgt zusammenfassen:<br />
- Auf internationaler Ebene ist ein Kulturbegriff eingeführt, der sozial <strong>und</strong> politisch sensibel ist, der eindeutige demokratische<br />
Akzente setzt, der künstlerische Kreativität nicht vernachlässigt, aber in Kultur mehr als l’art pour l’art sieht.<br />
- Eine so verstandene Kultur wird als zentrales Element sowohl der individuellen als auch der gesellschaftlichen Entwicklung<br />
gesehen.<br />
- "Gesellschaftliche Entwicklung" meint hierbei gerade nicht einen an bloß quantitativen ökonomischen Indikatoren meßbaren<br />
"Fortschritt", sondern ein sozial <strong>und</strong> kulturell verträgliches Wachstum. Heute können wir "ökologisch" als Attribut des<br />
gewünschten Wachstums hinzufügen <strong>und</strong> wir erhalten Konzepte der "dauerhaften Entwicklung", wie sie etwa im Rahmen<br />
der internationalen Umweltkonferenzen diskutiert werden <strong>und</strong> die inzwischen auch in die b<strong>und</strong>esdeutsche kulturpolitische<br />
Diskussion eingebracht worden sind.<br />
- Diesen Überlegungen liegt ein prozeßorientiertes, dynamisches, sowohl auf das Individuum <strong>und</strong> auch auf soziale Gruppen<br />
bezogene Konzept von "kultureller Identität" zugr<strong>und</strong>e, das das "Kulturerbe" zwar einbezieht, aber offen ist für zukünftige<br />
kulturelle Entwicklungen.<br />
- Wir finden eine implizite <strong>und</strong> auch oft explizit vorgetragene Denkweise, die im Menschen den Schöpfer seiner Welt sieht,<br />
der also die Art <strong>und</strong> Weise seines Lebens als zentrale Gestaltungsaufgabe sowohl für den Einzelnen, als auch für Gruppen<br />
betrachtet.<br />
Diese Erweiterung des Kulturbegriffs war wichtig, allerdings auch nicht ohne Probleme.<br />
Eine bislang noch nicht erwähnte Tradition dieses weiten Kulturbegriffs war Ethnologie <strong>und</strong> Anthropologie, die einen weiten,<br />
bestandsaufnehmenden Kulturbegriff bei ihren Forschungen benötigen. Es wurde darauf hingewiesen, daß dieser weite<br />
anthropologische oder ethnologische Kulturbegriff daran krankte, daß er – wie aus seinem engeren wissenschaftlichen<br />
Anwendungsbereichen verständlich - zwar alle Lebensäußerungen erfaßt, allerdings von der Vorstellung einer kleinen,<br />
geschlossenen <strong>und</strong> einheitlichen (Stammes-)Gemeinschaft ausgeht.<br />
Einen solchen, auf den Gedanken von Gemeinschaft basierender Kulturbegriff diagnostiziert A. Göschel (1994) auch in der<br />
Kulturwissenschaft <strong>und</strong> Kulturpolitik der DDR <strong>und</strong> er führt diesen - als „deutschen Sonderweg" seit der Aufklärung - auf Herder<br />
<strong>zur</strong>ück (vgl. Bollenbeck 1994). Wie stark solche Gemeinschaftsvorstellungen auch in anderen westlichen Gesellschaften<br />
verankert sind, zeigt die aktuelle Kommunitarismus-Debatte (vgl. Brumlik/Brunkhorst 1993) sowie die Diskussion um die<br />
Zivilgesellschaft (vgl. etwa Das Argument 206).<br />
Ein zweiter Aspekt ist der, daß der weite Kulturbegriff zwar in polemischer Opposition gegen einen auf Kunst verengten,<br />
traditionell-normativen <strong>und</strong> elitären Kunstbegriff als wertfreies, alles in den Blick nehmendes Konzept eingeführt wird, aber<br />
letztlich doch eine normative Ausrichtung, meist implizit, seltener explizit im Hinblick auf eine in bestimmter Weise gestaltete<br />
Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Neben dem eher quantitativen Argument einer Demokratisierung von Kultur (im<br />
wesentlichen eine größere Partizipation aller Gesellschaftsschichten, vor allem der im Kunst-Kontext selten auftauchenden),<br />
kam dieser normative Anspruch in dem Konzept einer "kulturellen Demokratie" zum Ausdruck, das zwar Emanzipation,<br />
Menschenwürde etc. als oberste Ziele proklamierte, sich jedoch konkretisierender Vorstellungen über eine bestimmte<br />
Gesellschaftsordnung auch aufgr<strong>und</strong> der durch den internationalen Entstehungsprozeß bedingten Konsenspflicht enthalten<br />
mußte.<br />
Die Weite des Kultur- <strong>und</strong> Kulturpolitikkonzeptes führte ferner zu deutlichen Überforderungsproblemen, die durch<br />
Abgrenzungsprobleme des Kulturbegriffs entstehen: Wenn eine Kulturpolitik als eingreifende Gestaltungsaufgabe die<br />
Gesamtheit der im jeweiligen Bereich (Stadt, Land, B<strong>und</strong>, Verband etc.) vorfindlichen Lebensäußerungen zu ihrem