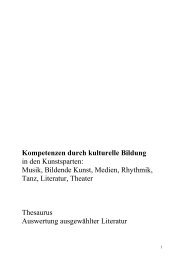4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
charakteristisch für die Moderne, zum Problem, weil die Antworten der Religion, der Tradition (Lebenssicherung <strong>und</strong><br />
Pflichterfüllung) <strong>und</strong> der politisch-sozialen Zukunftsentwürfe nicht genügen: die Frage wird dringlich, die Antworten werden<br />
relativ. Kurz, die Dissonanz zwischen empfindsamem <strong>und</strong> reflektierendem Ich <strong>und</strong> seinen Ansprüchen einerseits, der<br />
gesellschaftlichen Wirklichkeit andererseits wie die Identitäts- <strong>und</strong> Sinnprobleme dieses Ich selbst werden eine typisch moderne<br />
Erfahrung, die sich gerade in der Literatur ausspricht, sie ist nicht auf Deutschland beschränkt, denn sie ist europäisch, man<br />
kann sie nicht auf den bösen Kapitalismus <strong>zur</strong>ückführen, denn sie tritt lange vor diesem auf.<br />
Daß diese Erfahrung zu einem Gr<strong>und</strong>problem der Literatur wird, hängt damit zusammen, daß die Kunst in diesem Weitzustand<br />
problematisch wird. Die Wissenschaft beansprucht, die moderne gesellschaftliche Wirklichkeit zu erkennen, die Politik <strong>und</strong> die<br />
Ökonomie <strong>und</strong> Technik, sie zu gestalten. Vor solch konkurrierenden "Wahrheitsansprüchen“ wird Sache der Kunst eben das<br />
Individuelle <strong>und</strong> Private, <strong>und</strong> auch da können Wahrheitsanspruch <strong>und</strong> ästhetische Forderung auseinandertreten.<br />
Von daher läßt sich ein Stück des frappierenden Widerspruchs verstehen, der zwischen den literarisch laut werdenden<br />
Existenzerfahrungen <strong>und</strong> denen der Wissenschaft <strong>und</strong> der Politik wie des Alltags besteht, die doch vom Glauben an<br />
nachidealistische Humanität, an Fortschritt, Nation <strong>und</strong> Verfassung, Arbeit <strong>und</strong> Familie, kurz: an die Götter der Zeit geleitet<br />
sind'. (Nipperdey 1983, S. 574 f.). Es scheint, daß inzwischen auch diese von dem Leiden an der Moderne erfaßt worden sind.<br />
Kunst <strong>und</strong> die Kultur(waren)industrie<br />
Zwei (gesellschaftskritische) Diskussionsansätze diskutieren W. Grasskamp (am Beispiel der bildenden Kunst) <strong>und</strong> Lutz<br />
Winckler (am Beispiel der Literatur). Grasskamp (1989, S. 137 ff). zeigt, wie in der jungen B<strong>und</strong>esrepublik gerade die auch<br />
international überraschend gute Förderung moderner Kunst <strong>und</strong> speziell der Avantgarde auch auf das schlechte Gewissen<br />
wegen der Nazi-Verfolgung ("entartete Kunst") <strong>zur</strong>ückzuführen war <strong>und</strong> der Außendarstellung <strong>und</strong> Imagebildung des Landes<br />
diente, wenn etwa der im Inland äußerst umstrittene Joseph Beuys als offizieller Repräsentant der B<strong>und</strong>esrepublik bei<br />
internationalen Ausstellungen auftrat <strong>und</strong> dort als Beleg für Liberalität <strong>und</strong> Toleranz der neuen Republik wahrgenommen wurde.<br />
Eine Kulturpolitik der Förderung moderner Kunst diente also einem politischen Modernitätsnachweis zu einer Zeit, als die<br />
Republik diesen in anderen gesellschaftlichen Bereichen (etwa der Bildungspolitik) noch schuldig blieb. Die documenta 1955<br />
interpretiert Grasskamp daher konsequent als internationalen Beweis dafür, daß der von den Nazis verursachte strukturelle<br />
Rückstand inzwischen nachgeholt wurde.<br />
In traditionell kritisch-theoretischer Weise diskutiert Winckler (1973, v.a. S. 116 f.) Wirkungen <strong>und</strong> Funktionen der<br />
Kulturindustrie:<br />
1 . Kulturwarenproduktion dient unmittelbar der Verwertung des in diesem Bereich angelegten Kapitals.<br />
2. Verbesserung der Verwertungsbedingungen des Kapitals durch R<strong>und</strong>funk <strong>und</strong> Fernsehen.<br />
3. Leistungssteigerung <strong>und</strong> Desintegration in Betrieben durch offizielle Betriebszeitungen, Design am Arbeitsplatz <strong>und</strong> an<br />
Arbeitskleidung.<br />
<strong>4.</strong> Kulturwarenproduktion in Form von Reklame <strong>und</strong> ästhetisch vermittelten Werbetechniken dient der Beschleunigung von<br />
Zirkulationszeit.<br />
5. TV-Medien (Quiz etc.) erhöhen das verwertbare Wissen.<br />
6. Dabei entsteht ein Widerspruch zwischen der Weckung von Konsumbedarf <strong>und</strong> der Begrenztheit der Mittel.<br />
Auf ähnlicher theoretischer Gr<strong>und</strong>lage diskutieren Silke Wenk die Rolle von "Kunst im Betrieb“ <strong>und</strong> Peter Ulrich Hein (1982) die<br />
Rolle des "Künstlers als Sozialtherapeut", als Träger vor "Kunst als ideeller Dienstleistung in der entwickelten<br />
Industriegesellschaft" (so der Untertitel) die Kunst in ihrer Funktion <strong>zur</strong> Erhaltung der Loyalität <strong>und</strong>/oder der (sozialpolitischen<br />
Aufgabe der) Erhaltung des gesellschaftlichen Friedens betrachten. Diese Wirkungen ergeben sind dabei alleine aus der Art der<br />
gesellschaftlichen Organisation der Veranstaltung Kunst <strong>und</strong> der Art der Förderung ihrer Träger, der Künstler zum Teil in<br />
diametralem Gegensatz zu dem Bewußtsein der Künstler, die sich mehrheitlich gegen eine derartige soziale Indienstnahme <strong>und</strong><br />
Funktionalisierung wehren, wie entsprechende Befragungen zeigen (z.B. Künstler-Enquete; vgl. Fohrbeck/Wiesand 1975).<br />
Im Hinblick auf unsere Fragestellung liefert uns diese Diskussion die Sensibilisierung darauf, daß subjektive Absichten von<br />
objektiven, sich unter Umständen hinter dem Rücken der Beteiligten einstellende Wirkungen unterschieden werden müssen.<br />
Dieser sich aus dem Warencharakter von Kunst ergebende Mechanismus - bleibt man einmal in dieser<br />
gesellschaftstheoretischen Logik - ist nun einerseits total, weil eben die Warenförmigkeit in der Gesellschaft total ist. Er bedeutet<br />
jedoch keineswegs Ausweglosigkeit, da es - ebenfalls der gesellschaftlichen Ordnung immanent - keine Einheitlichkeit <strong>und</strong><br />
Einförmigkeit von Funktionen gibt. So zeigt etwa Heydorn in Bezug auf das in Grenzen mit dem Kunstbetrieb vergleichbare<br />
Bildungswesen den "Widerspruch zwischen Bildung <strong>und</strong> Herrschaft", der darin besteht, daß <strong>zur</strong> Aufrechterhaltung des Betriebes<br />
intellektuelle Leistungen benötigt werden, die aus politisch-ideologischen Gründen der Herrschaftssicherung unerwünscht sind.<br />
Trotz dieses Hoffnungsschimmers bleibt jedoch die Warenförmigkeit der Kunst dieser nicht bloß äußerlich wie insbesondere H.<br />
H. Holz (1972) gezeigt hat (vgl. auch Grasskamp 1989 <strong>und</strong> 1992 oder Weber 1981).<br />
Nicht die Wirkung von <strong>und</strong> auf Kunst im engeren Sinne, sondern die Wirkung von <strong>und</strong> auf Ästhetik in der doppelten Bedeutung<br />
des schönen Scheins der (Waren)-Welt <strong>und</strong> des Zustandes der von dieser anvisierten Sinnlichkeit diskutiert die Konzeption der<br />
Warenästhetik von W.F. Haug, wobei die im Nachwort <strong>zur</strong> achten Auflage formulierte Selbstkritik gegen einen zu starken<br />
ökonomischen Determinismus der ersten Fassungen den "Alptraum einer fatalen, nur noch warentausch-logisch bewirkten<br />
Handlungsunfähigkeit nimmt" (Haug 1983, S. 185 ff.). Haug hat konsequent seine anfangs ökonomisch geprägten<br />
Untersuchungen fortgeführt mit den - die relative Autonomie des Überbaus respektierenden - Untersuchungen <strong>zur</strong><br />
(gesellschaftlichen) Ideologie <strong>und</strong> diese für einzelne historische Etappen (Faschismus) konkretisiert. Dies ist insofern relevant<br />
auch für die Frage der Wirkungen, als hier die in bürgerlichen Gesellschaften ohnehin vorhandene (warenförmig organisierte)<br />
Bewußtseinsindustrie noch zusätzlich mit Staatsorganen verwoben, wenn nicht gar selbst Staatsorgan ist, so daß die<br />
Voraussetzungen für eine Beeinflussung der "gesellschaftlichen Psychologie" günstig wären. Ohne die Wirkungsmächtigkeit<br />
gerade der ästhetisch inszenierten Öffentlichkeit (L. Rieffenstahl; auch Reden von J. Göbbels; A. Breker) geringschätzen zu<br />
wollen, muß jedoch auch hier festgestellt werden, daß der von Haug erwähnte "Alptraum" einer ökonomisch, politisch <strong>und</strong><br />
organisatorisch gleichgeschalteten Beeinflussungsindustrie nicht funktioniert (vgl. die Texte des Projektes Ideologie-Theorie,<br />
v.a. Haug 1979). Diese <strong>Wirkungsanalyse</strong>n gehen über - wie auch an anderen Stellen der Untersuchung ästhetischer Wirkungen