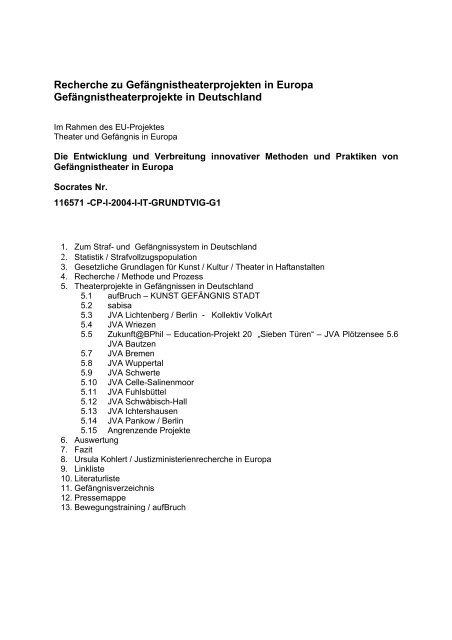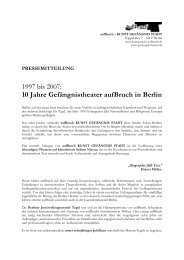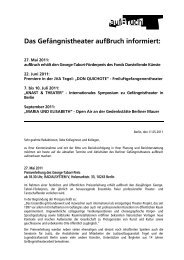EU- Recherche - Gefängnistheater aufBruch
EU- Recherche - Gefängnistheater aufBruch
EU- Recherche - Gefängnistheater aufBruch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Recherche</strong> zu <strong>Gefängnistheater</strong>projekten in Europa<br />
<strong>Gefängnistheater</strong>projekte in Deutschland<br />
Im Rahmen des <strong>EU</strong>-Projektes<br />
Theater und Gefängnis in Europa<br />
Die Entwicklung und Verbreitung innovativer Methoden und Praktiken von<br />
<strong>Gefängnistheater</strong> in Europa<br />
Socrates Nr.<br />
116571 -CP-l-2004-l-IT-GRUNDTVIG-G1<br />
1. Zum Straf- und Gefängnissystem in Deutschland<br />
2. Statistik / Strafvollzugspopulation<br />
3. Gesetzliche Grundlagen für Kunst / Kultur / Theater in Haftanstalten<br />
4. <strong>Recherche</strong> / Methode und Prozess<br />
5. Theaterprojekte in Gefängnissen in Deutschland<br />
5.1 <strong>aufBruch</strong> – KUNST GEFÄNGNIS STADT<br />
5.2 sabisa<br />
5.3 JVA Lichtenberg / Berlin - Kollektiv VolkArt<br />
5.4 JVA Wriezen<br />
5.5 Zukunft@BPhil – Education-Projekt 20 „Sieben Türen“ – JVA Plötzensee 5.6<br />
JVA Bautzen<br />
5.7 JVA Bremen<br />
5.8 JVA Wuppertal<br />
5.9 JVA Schwerte<br />
5.10 JVA Celle-Salinenmoor<br />
5.11 JVA Fuhlsbüttel<br />
5.12 JVA Schwäbisch-Hall<br />
5.13 JVA Ichtershausen<br />
5.14 JVA Pankow / Berlin<br />
5.15 Angrenzende Projekte<br />
6. Auswertung<br />
7. Fazit<br />
8. Ursula Kohlert / Justizministerienrecherche in Europa<br />
9. Linkliste<br />
10. Literaturliste<br />
11. Gefängnisverzeichnis<br />
12. Pressemappe<br />
13. Bewegungstraining / <strong>aufBruch</strong>
1. Zum Straf- und Gefängnissystem in Deutschland<br />
Die Grundprinzipien der Verhängung von Freiheitsstrafen weichen in den europäischen<br />
Ländern erheblich voneinander ab. In Deutschland geht man davon aus, dass Freiheitsstrafe<br />
das letzte Mittel der Bestrafung sein soll. So hat sich in Deutschland in den Jahren zwischen<br />
1882 und 1997 das Verhältnis von verhängten Freiheitsstrafen und Geldstrafen umgekehrt,<br />
1882 waren noch 76,8% aller verhängter Strafen Freiheitsstrafen.1997 waren dagegen<br />
81,7% aller verhängten Strafen Geldstrafen. Von den insgesamt 18,3% verhängten<br />
Freiheitsstrafen wurden 12,6% zur Bewährung ausgesetzt, so dass tatsächlich lediglich 5,7%<br />
der Freiheitsstrafen zu verbüßen waren. In den letzten Jahren ist allerdings eine leicht<br />
gegenläufige Tendenz festzustellen. So waren in Berlin im Jahr 1991 17% aller Strafen<br />
Freiheitsstrafen; im Jahr 2001 19,8%, bei zwischenzeitlichen Schwankungen in diesem<br />
Bereich ohne deutliche Tendenz.<br />
Ein weiteres Grundprinzip in Deutschland ist, dass eine kurze Freiheitsstrafe von unter sechs<br />
Monaten nur in Ausnahmefällen verhängt werden soll, nämlich wenn besondere Umstände<br />
die Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der<br />
Rechtsordnung unerlässlich machen, § 47 Abs. 1 StGB. In Deutschland gehen wir davon<br />
aus, dass eine kurze Freiheitsstrafe mehr schadet als nützt, weil der Täter aus seinem<br />
Umfeld gerissen wird, ggf. seine Arbeit verliert, in schädlichen Kontakt mit anderen<br />
Gefangenen gerät und zusätzlich wegen der Kürze der Dauer der Freiheitsstrafe auf ihn<br />
praktisch keine Einwirkungsmöglichkeit besteht. Dies wird indes in anderen europäischen<br />
Ländern grundsätzlich anders gesehen. Dort wird teilweise verstärkt versucht, über die<br />
Schockwirkung einer kurzen Freiheitsstrafe spezialpräventive Ergebnisse zu erzielen.<br />
Beispielsweise waren 1995 in den Niederlanden 79% aller Freiheitsstrafen kurz. gleichfalls<br />
im Jahr der Schweiz 79,6%, in Dänemark 77,3% und in Norwegen 75,2%. Allerdings sind in<br />
Deutschland in der Praxis trotz des großen Bemühens um die Zurückdrängung der<br />
Freiheitsstrafe ein relativ großer Prozentsatz aller Freiheitsstrafen kurze Freiheitsstrafen<br />
unter sechs Monaten. In Berlin waren es im Jahr 2001 32,54%. Hinzu kommen zusätzlich die<br />
Ersatzfreiheitsstrafen, die werden müssen, wenn eine Geldstrafe nicht bezahlt wird. Weil<br />
davon auszugehen ist, dass die Verbüßung einer kurzen Freiheitsstrafe wenig sinnvoll ist,<br />
aber relativ hohe Haftkosten verursacht, gibt es ein Gesetz, das bei uneinbringlichen<br />
Geldstrafen die gemeinnützige Arbeit als primäre Ersatzsanktion vorsieht.<br />
Eine Studie über die Wirkung der kurzen Freiheitsstrafe Niederlanden kommt zu dem<br />
Ergebnis, dass die für die kurze Freiheitsstrafe angeführte Schockwirkung wohl nicht<br />
generell eintritt. Dies hängt sehr stark von dem Vorleben des Täters ab. Handelt es sich<br />
beispielsweise um Drogenabhängige, so wird die Haftzeit sogar als teilweise positiv<br />
empfunden. Im Gefängnis erhalten sie Essen, medizinische Versorgung und Ruhe, die sie<br />
anderweitig nicht bekommen. Die Ergebnisse der Studie stimmen aber mit einer<br />
Beobachtung überein, die auch in Berlin hinsichtlich der Verbüßung der<br />
Ersatzfreiheitsstrafen verstärkt eintreten. Auch hier steht die medizinische und soziale<br />
Versorgung bei eingetretener Verelendung oft im Vordergrund, was entsprechende<br />
erhebliche Kosten verursacht und nicht Aufgabe des Strafvollzuges sein kann. Die oben<br />
ausgeführten Grundprinzipien des deutschen Rechts der Freiheitsstrafe sind der Grund für<br />
die relativ geringe Gefangenenpopulation in Deutschland. So hatte Deutschland 1999 eine<br />
Gefangenenrate von 95 auf 100.000 der nationalen Bevölkerung und lag damit im<br />
westeuropäischen Mittelfeld. Dieses liegt wesentlich unter den Gefangenenraten der<br />
osteuropäischen Länder oder den USA. So wies beispielsweise im Jahr 1999 Estland eine<br />
Gefangenenrate von 310 Gefangenen und Russland eine Gefangenenrate von 730<br />
Gefangenen pro 100.000 der Bevölkerung auf. Die USA hatten am 31. Dezember 2001 eine<br />
Gefangenenrate von 692 Gefangenen, die sich zwischenzeitlich nochmals erheblich erhöht<br />
hat. Trotz des in Westeuropa im Wesentlichen ähnlichen Niveaus der Gefangenenraten<br />
lassen sich im Sanktionenrecht sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und Trends bei den<br />
verschiedenen westeuropäischen Staaten feststellen. Während beispielsweise die<br />
Gefangenenrate der Niederlande in den Jahren von 1984 bis 1999 von einem sehr niedrigen
Niveau stark angestiegen ist und nunmehr der Deutschlands entspricht, hat Finnland seine<br />
Gefangenenrate vom Niveau Deutschlands 1984 auf lediglich 45 Gefangene pro 100.000 der<br />
Bevölkerung im Jahr 1999 gesenkt.<br />
Der Auftrag zur Resozialisierung von Straftätern hat nach der Rechtsprechung des<br />
Bundesverfassungsgerichts Verfassungsrang, Androhung und Vollstreckung der<br />
Freiheitsstrafe finden ihre verfassungsrechtlich notwenige Ergänzung in einem sinnvollen<br />
Behandlungsvollzug: Daraus ergibt sich, dass jedem zu einer Freiheitsstrafe Verurteilten die<br />
Chance und eine Hilfestellung dazu gegeben werden muss, ein straffreies Leben zu führen.<br />
Die Vollzugsanstalten sind verpflichtet, den schädlichen Auswirkungen des Freiheitsentzugs<br />
im Rahmen des Möglichen zu begegnen. Daraus folgt auch, dass Freiheitsentzug in allen<br />
geeigneten Fällen hinter anderen Alternativen - wie beispielsweise gemeinnütziger Arbeit –<br />
zurückstehen muss.<br />
Nun noch einige Worte zum Gefängnissystem in Deutschland. In Deutschland ist die<br />
Freiheitsstrafe eine einheitliche Freiheitsstrafe, die auf den Entzug der persönlichen in<br />
Bewegungsfreiheit gerichtet ist. Sonstige Belastungen der Gefangenen sind nicht legitimiert,<br />
§ 4 Abs. 2 StVollzG. Die Unterbringung im offenen Vollzug ist die Regelvollzugsform; die<br />
Unterbringung im geschlossenen Vollzug ist die Ausnahme, § 10StVollzG. Unter offenem<br />
Vollzug sind offene oder halb offene Anstalten zu verstehen, die verminderte Vorkehrungen<br />
gegen Entweichen vorsehen, § 141 Abs. 2 StVollzG. Es handelt sich dabei insbesondere um<br />
Anstalten, die Gefangene täglich zur Arbeit verlassen können, sofern sie Arbeit haben. Die<br />
Gefangenen müssen indes den besonderen Anforderungen des offenen Vollzugs genügen.<br />
Sie dürfen insbesondere nicht suchtgefährdet sein und es darf nicht zu befürchten sein, dass<br />
sie fliehen oder weitere Straftaten begehen. Die Praxis hinsichtlich der Verteilung der<br />
Gefangenen auf den offenen und den geschlossenen Vollzug ist in den einzelnen deutschen<br />
Bundesländern sehr unterschiedlich. So befanden sich 1995 nur 5% aller Gefangenen in<br />
Bayern, aber 29% in Hamburg im offenen Vollzug. In Berlin eigenen sich in der Praxis<br />
durchschnittlich 1/4 aller Gefangenen für den offenen Vollzug.<br />
Ein in Deutschland besonders großes Problem stellt die Schaffung von Arbeitsplätzen für<br />
Gefangene dar. Die Arbeit der Gefangenen ist ein zentrales Resozialisierungsmittel. Es ist<br />
gerade im Strafvollzug besonders wichtig und in Deutschland im Strafvollzugsgesetz auch<br />
vorgesehen, Gefangenen die Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu<br />
vermitteln bzw. diese zu erhalten und zu fördern. Es muss deshalb versucht werden, für die<br />
Gefangenen so viele Arbeitsplätze wie möglich bereitzustellen.<br />
Eine Sonderproblematik ist die Situation der Frauen im Strafvollzug. Frauen zeigen ein<br />
anderes Kriminalitäts- und Deliktsverhalten als Männer. Sie sind nur zu einem geringen Maß<br />
an der Gesamtkriminalität beteiligt und weitaus weniger gewalttätig. So belief sich der Anteil<br />
der Frauen an den Verurteilten im Jahr 1997 auf 15,6%. In der Konsequenz sind nur sehr<br />
wenige Strafgefangene weiblich, im Jahr 1998 waren es in Deutschland 4,2%. Ferner zeigen<br />
Frauen auch im Strafvollzug ein anderes Verhalten als Männer; weibliche Gefangene<br />
flüchten extrem selten. Weil sie nur einen verschwindend geringen Teil der Strafgefangenen<br />
ausmachen und in der Regel nur als Anhängsel des Männervollzugs betrachtet werden, wird<br />
im Vollzug auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen oft nur wenig eingegangen und sie<br />
sind vielfach viel zu hohen Sicherheitsvorkehrungen ausgesetzt. In Berlin existiert daher eine<br />
eigene Frauenvollzugsanstalt, deren Bedingungen auf die anderen Bedürfnisse von Frauen<br />
eingerichtet sind; so sind beispielsweise die Sicherheitsvorkehrungen erheblich geringer als<br />
in den Männerhaftanstalten.
2. Statistik:<br />
Tabelle 1 / Statistik über deutsche Gefangenenzahlen
3. Gesetzliche Grundlagen für Kunst / Kultur / Theater in Haftanstalten:<br />
1. Eine Vorschrift, die die Anstalten zwingt, Kunst und Kultur zuzulassen, gibt es nicht.<br />
2. Eine Vorschrift, wonach die Anstalten Kunst und Kultur anbieten s o l le n, ist § 67<br />
Absatz 2 StVollzG (Strafvollzugsgesetz). Dort steht unter dem Titel `Freizeit´ der<br />
Satz: „Er [der Gefangene] soll Gelegenheit erhalten, am Unterricht einschließlich<br />
Sport, an Fernunterricht, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen der<br />
Weiterbildung, an Freizeitgruppen, Gruppengesprächen sowie an<br />
Sportveranstaltungen teilzunehmen und eine Bücherei zu benutzen.“<br />
Kunst / Kultur ist dort also nicht wörtlich erwähnt. Das `soll´ bedeutet allerdings nicht<br />
gänzliche Beliebigkeit, sondern dass die Anstalten Angebote und Möglichkeiten eröffnen<br />
müssen, `die der Bedeutung der Freizeit gerecht werden´, sagt der Kommentator zum<br />
StVollzG; ebenso, dass kein unbedingter Anspruch eines Gefangenen auf eine ganz<br />
bestimmte Freizeitbeschäftigung besteht.<br />
– Mit der Auslegung etwa hinsichtlich bildender Kunst haben sich wohl u.a. Knapp 1988 und<br />
Voigt-Rubio in ZfStrVo 1988, 203 befasst [weitere Quellen in AK-StVollzG, Rdn.21 zu § 67]<br />
3. Zur Auslegung und zur Begründung, dass auch Theater- und sonstige<br />
Kunstaktivitäten in Anstalten angeboten werden sollten, kann noch eine gesetzliche<br />
Leitlinie herangezogen werden, nämlich § 3 Absatz 1 StVollzG: „Das Leben im<br />
Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen<br />
werden.“<br />
aber auch im `Alternativkommentar´ (AK-StVollzG) keine einschlägige Kommentierung<br />
In Einzelfällen könnte zur Entscheidung in einem Streitfall auch Absatz 3 des § 3<br />
StVollzG etwas hergeben: „Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er dem<br />
Gefangenen hilft, sich in das Leben ein Freiheit einzugliedern.“<br />
(Beispiel: wenn ein inhaftierter Schauspieler aus nicht sehr schwer wiegenden Gründen<br />
von der Theatergruppe ausgeschlossen werden soll, dann müsste seine Berufssituation<br />
und -planung in das dabei auszuübende Entscheidungsermessen einbezogen werden).<br />
4. Noch interessant in diesem Zusammenhang ist § 154 Absatz 2 Satz 2 StVollzG:<br />
„Die Vollzugsbehörden sollen mit Personen und Vereinen, deren Einfluss die<br />
Eingliederung der Gefangenen fördern kann, zusammenarbeiten.“<br />
- Die Vorschrift betrifft inhaltlich und traditionell Vollzugshelfer/innen,<br />
Gruppentrainer/innen und generell freiwillig in Haft für Gefangene tätige Personen oder<br />
Gruppen. - Das `Soll´ gibt auch hier keinen Anspruch darauf, dass jemand `von draußen´<br />
mit einem bestimmten Angebot vom Knast auch aufgenommen werden müsste. Es wird<br />
in der Praxis eher dann relevant, wenn Anstalten schon bestehende Angebote ohne<br />
nachvollziehbare sachliche oder finanzielle Gründe einstellen oder untersagen; das kann<br />
bis zu einem Anspruch der Anbieter auf gerichtliche Entscheidung gehen; wobei das<br />
Gericht dann nur prüfen wird, ob die Anstalt ihr Ermessen richtig ausgeübt hat – also<br />
nicht einen unbedingten Anspruch zuerkennen wird.<br />
5. Ob andere Gesetze als das StVollzG Förderungen für Kunstprojekte in Haftanstalten<br />
vorsehen oder vorschreiben, ist uns nicht bekannt.
4. <strong>Recherche</strong> / Methode und Prozess<br />
„Nach der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist der Vollzug der<br />
Untersuchungshaft und der Freiheitsstrafe Aufgabe der Bundesländer.“ Diese Maßgabe<br />
stand zu Beginn unserer <strong>Recherche</strong> nach <strong>Gefängnistheater</strong>projekten in Deutschland. Unsere<br />
erste Anfrage an das Bundesjustizministerium wurde mit dem Verweis auf die Zuständigkeit<br />
der Bundesländer beantwortet, so dass wir daraufhin in Kontakt mit den jeweiligen Ländern<br />
traten. Anlaufstelle hierfür wurden die Justizministerien der Bundesländer. Keines der<br />
Bundesländer konnte auf Anhieb eine Angabe über „Theater im Gefängnis“ geben.<br />
Verwiesen wurden wir auf die Webseiten der Ministerien und der JVAs. Eine Vielzahl der<br />
Justizvollzugsanstalten präsentiert sich dort der Öffentlichkeit und teilweise fanden wir hier<br />
Angaben über Theaterarbeiten. Die Presseabteilungen der Ministerien halfen uns weiter, in<br />
dem wir Listen der Justizvollzugsanstalten für die Kontaktaufnahmen erhielten.<br />
Wir sandten den Fragebogen an ca. 150 Justizvollzugsanstalten, an die Abteilungen<br />
Sozialpädagogik oder Öffentlichkeitsarbeit. Ca. 70 meldeten sich bisher daraufhin zurück.<br />
Eine Vielzahl der Schreiben die uns daraufhin erreichten, mussten uns eine Absage erteilen<br />
dahingehend, dass im dortigen Gefängnis keine Theaterarbeit stattfindet. Als Bestandteil des<br />
Vollzuges oder der Weiterbildung findet keine Theaterarbeit statt. In äußerst wenigen Fällen<br />
existieren Theaterprojekte, unter Beteiligung externer Darsteller und Organisatoren, die den<br />
kulturellen Veranstaltungen innerhalb des Gefängnisses zugezählt werden können.<br />
Einige der Befragten gaben uns Tipps und Anregungen, wie und wo wir welche<br />
Theatermacher ausfindig machen können. Ebenso wurden wir mit<br />
Dokumentationsmaterialien vergangener Projekte der Justizvollzugsanstalten Hamburg oder<br />
Schwäbisch Hall beschickt, um einen Einblick zu bekommen. Heute finden dort keine<br />
Theaterarbeiten mehr statt, obwohl die Arbeiten dort sehr große Erfolge und Aufmerksamkeit<br />
erzielt hatten. In Telefongesprächen konnten Fragen geklärt werden und nähere<br />
Informationen über die Theaterarbeiten in Erfahrung gebracht werden.<br />
4.1 Historische Entwicklungen von <strong>Gefängnistheater</strong> in Deutschland<br />
Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Gefangene seit den 20er Jahren in Gefängnissen<br />
Stücke geschrieben, geprobt und aufgeführt sowie so genannte Laienspielgruppen<br />
gegründet haben. Dies ist ein bis heute anhaltendes Phänomen und geschieht oft unter<br />
Leitung eines Lehrers, Pädagogen, Gefangenen, Sozialarbeiters oder eines externen Laien.<br />
Das Ergebnis wird vor anderen aufgeführt, manchmal sogar in anderen Gefängnissen oder<br />
außerhalb der Mauern vorgestellt, Z.B. in Kirchen oder Kultureinrichtungen. Ein Mitglied der<br />
Direktion des Gefängnisses Straubing (München) sagte 1930, dass „Theateraufführungen in<br />
Strafanstalten nichts Neues sind“. Er war der Meinung, diese Aktivität führe die Kriminellen<br />
zurück auf den rechten Weg und sei ein großer Erfolg. Dabei könnten nur Besserungsfähige<br />
und -willige in solchen Projekten mitmachen. In seinem Gefängnis hätten ebenfalls im Jahre<br />
1929 Häftlinge ein Stück geschrieben, inszeniert und vor einem größeren externen Publikum<br />
aufgeführt. Weiterhin sagte er, dass „die Bürger, die das gesehen haben, sich bereichert<br />
haben in der Einsicht, dass Verbrecher nicht gleich Verbrecher heißt und dass ihre<br />
Einstellung nicht nur Zurückstoßung sein kann.“<br />
1972 wurden von Michael Walter die Laienspielaktivitäten im deutschen Strafvollzug<br />
untersucht. Er kam zu dem Ergebnis, dass zu der Zeit in 36 Anstalten das Laienspiel<br />
gepflegt wurde, was einem Anteil von 28% der deutschen Anstalten entsprach. Seit 1948<br />
war die Zahl der Laienspielgruppen von einer auf neun im Jahre 1958 und weiter auf 25 im<br />
Jahre 1968 gestiegen.<br />
Andere Beispiele sind die Theaterprojekte von Angelika Brenner, die 1987 im Münchener<br />
Frauengefängnis mit Freundinnen eine Theatergruppe gründete.<br />
Sie spielten Stücke wie „Zeugin der Anklage“ von Agatha Christie, oder „Die ehrbare Dirne“<br />
von Jean Paul Sartre und gastierten mit diesen Stücken im Frauengefängnis in Stuttgart.<br />
In der Jugendanstalt Hameln wurden 1987 vom Pfarramt Laienspielveranstaltungen<br />
arrangiert, die über die Gefängnismauern hinausgingen.
Sie sollten den mitwirkenden Insassen Gelegenheit geben, ihre Probleme und die des<br />
Vollzuges in die Öffentlichkeit zu tragen und dabei aufzuarbeiten.<br />
Im Schweizer Gefängnis in Saxerriet leitete der 61jährige Gefangene Peter Zimmermann<br />
zwischen 1996-2002 eine selbst verwaltete Theatergruppe.<br />
Die Gruppe fand vor allem in religiösen Kreisen große Resonanz. Sie spielten such<br />
außerhalb der Mauern, meist in Kirchen, manchmal auch während des Gottesdienstes. Die<br />
Stücke wurden von Peter Zimmermann zusammen mit anderen Gefangenen geschrieben.<br />
Sie handelten von ihren Biographien, gemischt mit biblischen und ethischen Themen und<br />
Motiven.<br />
Angesichts der Bandbreite und Vielzahl dieser Projekte in den 70er und 80er Jahren muss<br />
man eindeutig feststellen, dass die <strong>Gefängnistheater</strong>aktivitäten heutzutage rückläufig sind.<br />
Von Seiten der Justiz ist eine massive Einschränkung dieses Sektors, vor allem durch<br />
Personalknappheit bedingt zu beobachten.<br />
5. Theaterprojekte in Gefängnissen in Deutschland<br />
5.1 <strong>aufBruch</strong> – KUNST GEFÄNGNIS STADT<br />
<strong>aufBruch</strong> KUNST GEFÄNGNIS STADT wurde 1997 von Roland Brus und Holger Syrbe<br />
gegründet und arbeitet seit dem hauptsächlich im größten deutschen Gefängnis, der JVA<br />
Tegel. <strong>aufBruch</strong> arbeitet nicht nur in der Strafanstalt, sondern wechselseitig mit den sozialen<br />
Topographien von Stadt und Gefängnis / Gefängnis soll als kulturelles und soziales Thema<br />
etabliert und wahrnehmbar gemacht werden. <strong>aufBruch</strong> ist das größte und am längsten<br />
arbeitende <strong>Gefängnistheater</strong>projekt in Deutschland.<br />
Die JVA Tegel entfaltet sich auf einer 130.000 qm großen Fläche, die von einer 1.327 m<br />
langen Mauer mit Stacheldraht und 13 Wachtürmen eingeschlossen ist. Es befinden sich hier<br />
sechs Teilanstalten, 15 eigene Arbeitsbetriebe mit ca. 1.300 Arbeitsplätzen (Bäckerei,<br />
Druckerei, Schlosserei etc.), ein Krankenhaus, eine Kirche, Sportplätze, eine Schule für 100<br />
Schüler. Die JVA bietet Platz für 1.536 Gefangene, derzeit sind ca. 1.700 inhaftiert, davon 35<br />
Prozent Ausländer aus insgesamt 62 Staaten. <strong>aufBruch</strong> versteht Tegel/Gefängnis als<br />
modernen Spiegel der heutigen westeuropäischen Gesellschaft.<br />
Neben den zahlreichen Projekten in der JVA Tegel, konnte im vergangenen Jahr erstmals in<br />
einem russischen Jugendlager, in der Nähe von Moskau, ein Projekt realisiert werden. Aus<br />
diesen Erfahrungen – der Arbeit mit Jugendlichen – gelang es <strong>aufBruch</strong> nun auch in Berlin in<br />
der hiesigen Jugendstrafanstalt eine Theaterarbeit umzusetzen.<br />
Zwei Projekte pro Jahr versucht <strong>aufBruch</strong> zu realisieren. Das Ensemble besteht jeweils aus<br />
ungefähr 20 bis 25 Männern. Jeder, der sich auf die Arbeit einlässt, kann mitspielen. Die<br />
Taten spielen bei der Auswahl keine Rolle.<br />
Ziel ist die Erarbeitung einer professionellen Theaterarbeit die einen Platz im kulturellen<br />
Leben der Stadt hat und vom Publikum als Kunst wahrgenommen wird.<br />
Thematische Ansätze sind sehr unterschiedlich. Sowohl klassische Literaturtexte (Schiller –<br />
Die Räuber, Beckett – Endspiel), dienen als Basis, aber auch nahe liegende<br />
Themenkomplexe (Biographien – Einaar Schleef, Werner Gladow), sowie zahlreiche<br />
biographische Elemente aus dem Leben der Mitspieler. Erste Hürde zu Beginn eines jeden<br />
Probenprozesses ist es, aus einer Vielzahl Unbekannter eine Gruppe zu formen.<br />
Vertrauensbildende Gruppenspiele mit Körperkontakt überbrücken die erste Annäherung der<br />
Gefangenen untereinander. Wichtig sind das Gespräch zu Probenbeginn, in dem der<br />
Probenablauf ebenso wie ständig auftretende Unvereinbarkeiten des Knastalltags mit der<br />
Theaterarbeit oder Probleme und Anliegen besprochen wird, und die gemeinsame<br />
Auswertung der Probe am Ende. Dazwischen liegen neben konkreter szenischer Arbeit eine<br />
Menge Körperarbeit, Sprechtraining und Improvisationsübungen. Da die Gefangenen sonst<br />
nicht viel oder keine Gelegenheit haben, sich in Gruppen zu treffen, lässt sich die Disziplin<br />
und Konzentration beim Arbeiten schwer aufrechtzuerhalten. Erstaunlich sind aber<br />
gleichzeitig die Freude, die die Darsteller am Spiel entwickeln, und die vielen Ideen, die sie in<br />
den Probenprozess einbringen. Was man in den Aufführungen später als Zuschauer sieht,
ist oft Schritt für Schritt aus gelenkter Improvisationsarbeit entstanden. Generell beträgt die<br />
Probenarbeit ca. sechs Wochen, in der täglich von Montag bis Freitag intensiv von 14.30 Uhr<br />
– 21 Uhr gearbeitet wird. Vor dieser Endphase liegen die so genannten „Casting-Proben“,<br />
das <strong>aufBruch</strong>-Team nutzt diese Termine um das kommende Projekt, das Team und die<br />
Arbeitsweise vorzustellen und neue Mitspieler zu werben. Gerade da die Mehrzahl der<br />
Ensemblemitglieder von Inszenierung zu Inszenierung wechselt, ist dieses gegenseitige<br />
Kennen lernen vor der anstrengenden und arbeitsintensiven Zeit für alle Beteiligten von<br />
drinnen, wie draußen wichtig. In der Anfangsphase wird eine Fülle an szenischem und<br />
Textmaterial gesammelt, das ausprobiert, ausgewählt und auf dem immer weiter aufgebaut<br />
wird. Ideen sollen von den Mitspielern gesammelt; Erfahrungen aufgeschrieben werden.<br />
Umgekehrt setzt sich das Draußen-Team ständig in Besprechungen zusammen, wertet<br />
Material und Proben aus, plant Probenabläufe, baut an Konzepten, bespricht Probleme und<br />
setzt Stück für Stück das Gesamtprojekt zusammen.<br />
Die Vorstellungen sind öffentlich, für externes und internes Publikum zugänglich. Es finden<br />
ca. 7 – 9 Vorstellungen für ca. 150 Zuschauer statt, meist alle ausverkauft. Es gibt eine<br />
immense öffentliche Aufmerksamkeit in den Medien. <strong>aufBruch</strong>-Projekte wurden zu<br />
zahlreichen Festivals eingeladen, konnten aber nur wenigen Fällen dem Wunsch folgen.<br />
Finanziert wird die Arbeit von der Senatsverwaltung für Kultur und von verschiedenen Kultur-<br />
Stiftungen. Die Arbeit wird nach wie vor nur Projektweise gefördert, es gibt keine<br />
Dauerförderung. Es gibt keine Sozial-Fördertöpfe für dieses Projekt. Prinzipiell findet die<br />
Arbeit auf Selbstausbeutungsbasis statt.<br />
5.2 Sabisa – Jugendanstalt Raßnitz<br />
Das Projekt „Hauptdarsteller im eigenen Leben“ wurde nach einer längeren Vorbereitungs-<br />
Phase im Juni 2004 in der Jugendanstalt (JA) Raßnitz, der größten Haftanstalt für<br />
Jugendliche und junge Heranwachsende in Sachsen-Anhalt, durchgeführt. Dem Netzwerk<br />
Theaterdialog ging es in ihrem Projekt, Freiräume innerhalb der Jugendstrafanstalt zu<br />
ermöglichen, in denen die Jugendlichen sich auf eine andere Art mit dem eigenen Leben<br />
auseinandersetzen – über Theater.<br />
Das Netzwerk Theaterdialog besteht aus den Kultur- und TheaterpädagogInnen Katrin Wolf,<br />
Katharina Lammerts, und Till Baumann. TheaterDialog ist ein kultur- und<br />
theaterpädagogischer Ansatz, den das Projekt DOMINO – Zivilcourage im Rampenlicht<br />
entwickelt hat. TheaterDialog-Projekte verbinden Fantasie und Realität, Reflexion und<br />
Handeln, Kreativität und Alltag. Anhand von TheaterDialog sollen kreative Kompetenzen im<br />
Umgang mit sozialen Konflikten, Gewalt und Intoleranz gefördert und eine lebendige,<br />
spielerische und gleichzeitig ernsthafte Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben möglich<br />
werden. Theater Dialog bedeutet<br />
• Keine vorgegebenen Theaterstücke zu spielen, sondern persönliche Alltags<br />
-Erfahrung gemeinsam zu inszenieren,<br />
• In der Spannung zwischen Alltagsrealität und Vision zu arbeiten,<br />
• Persönliche und gesellschaftliche Veränderungen im Schonraum Theater zu<br />
erproben<br />
TheaterDialog basiert u.a. auf dem Theater der Unterdrückten des brasilianischen<br />
Theatermachers Augusto Boal, das in den 70er Jahren in Lateinamerika entwickelt wurde<br />
und inzwischen weltweit in den unterschiedlichsten Bereichen praktiziert wird. TheaterDialog<br />
greift auch andere Ansätze auf (z.B. aus dem Bereich des Improvistationstheaters, der Arbeit<br />
mit Masken etc.).<br />
Das Projekt „Hauptdarsteller im eigenen Leben“ wurde durchgeführt von Katrin Wolf, Till<br />
Baumann, Ken Kupzok und Peter Igelmund. Katrin Wolf und Till Baumann leiteten die<br />
praktische Workshoparbeit.<br />
Die Jugendanstalt Raßnitz ist eine Anstalt des geschlossenen Vollzugs für männliche<br />
Jugendliche und Heranwachsende. Sie wurde im Jahr 2002 etwa 20 Kilometer von der Stadt<br />
Halle entfernt in Betrieb genommen und gilt als modernste Einrichtung ihrer Art in Europa.<br />
Sie verfügt über 398 Haftplätze und übernimmt den größten Teil des Jugendstrafvollzugs in<br />
Sachsen-Anhalt. Die JA Raßnitz ist zuständig für den Vollzug von Jugendstrafen an
männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden, die zum Zeitpunkt der Einweisung das 21.<br />
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ein Teil der Gefangenen geht zur (anstaltsinternen)<br />
Schule, andere arbeiten, manche haben die Möglichkeit, eine Lehre abzuschließen. Die<br />
Anstalt ist tendenziell überbelegt. Sowohl bei PsychologInnen als auch bei<br />
SozialarbeiterInnen besteht ein Betreuungsschlüssel von 1:120.<br />
Da weder die Jugendanstalt noch das sachsen-anhaltinische Justiz- bzw. Innenministerium<br />
über Mittel für Theaterprojekte in Haftanstalten verfügen, benötigte TheaterDialog Gelder aus<br />
externen Fördertöpfen. Das Netzwerk TheaterDialog reichte das Projekt beim Amt für<br />
Wirtschaftsförderung des Landkreises ein. Hierfür erhielten sie eine Zusage, die benötigten<br />
Fördermittel wurden durch den Europäischen Sozialfond abgesichert.<br />
Projektziele:<br />
In den konzeptionellen Diskussionen während des Vorbereitungsprozesses im Netzwerk<br />
TheaterDialog entstanden mehrere Zielstellungen. Als Schwerpunkte der<br />
theaterpädagogischen Arbeit identifizierten TheaterDialog – neben dem künstlerischen<br />
Inszenierungsprozess mit dem Ziel einer anregenden Präsentation spannender<br />
Theaterszenen – die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen, die<br />
Anregung zur Selbstreflexion und die Stärkung der Teamfähigkeit sowie – über den Rahmen<br />
der Gruppenarbeit hinaus – die Erprobung kulturpädagogischer Ansätze im Strafvollzug und<br />
die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Die eher pädagogischen Zielstellungen werden im<br />
Folgenden kurz aufgeschlüsselt:<br />
• Persönlichkeitsentwicklung<br />
- Entdeckung eigner kreativer Fähigkeiten<br />
- Stärkung der Kommunikationsfähigkeit<br />
- Stärkung von Eigenverantwortung<br />
• Selbstreflexion<br />
- Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie<br />
- Auseinandersetzung mit der eigenen Haftstrafe<br />
- Erprobung alternativer Handlungs- und Verhaltensmuster<br />
• Teamfähigkeit<br />
- Stärkung sozialer Komponenten, von Toleranz und Offenheit<br />
- Konfrontation und Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebenswirklichkeiten<br />
- Erfahrung der gemeinsamen Entwicklung eines kreativen Produkts<br />
• Erprobung kulturpädagogischer Ansätze im Strafvollzug<br />
• Außenwirkung/ Sensibilisierung der Öffentlichkeit<br />
- z.B. über Besuche bei den Aufführungen der Gefangenen<br />
5.3 JVA Lichtenberg / Berlin<br />
In der JVA Lichtenberg gibt es seit 1999 das Streben nach kontinuierlicher Theaterarbeit. Die<br />
Gruppe wurde von verschiedenen Künstlern und Studenten betreut (Petra Kelling, Christine<br />
Boyde, Anna Montanya). Im Rahmen des KNASTFESTIVAL 2000 wurde mit der<br />
italienischen Regiseurin Donatella Massimilla der Workshop „Rote Schuhe“ mit öffentlicher<br />
Präsentation realisiert.<br />
Kollektiv VolkArt<br />
Kollektiv VolkArt realisiert Theaterproduktionen im Knast und im öffentlichen Raum. Seit ihrer<br />
Gründung 2003, arbeiten sie kontinuierlich in der JVA für Frauen Berlin und haben dort<br />
verschiedene Produktionen erarbeitet. Bisher wurden zwei davon, darunter eine<br />
Uraufführung, einer Öffentlichkeit auch außerhalb der Gefängnismauern (HAU1 und HAU2)<br />
präsentiert - ein (soweit bekannt) Novum im deutschsprachigen „Frauenknasttheater“. Bis
Ende 2005 werden zwei weitere Produktionen sowohl „drinnen“, als auch „draußen“ über die<br />
Bühne gehen.<br />
Methode und Ästhetik<br />
Theater im Gefängnis arbeitet mit Laiendarstellern. Die in ihrer Unterschiedlichkeit sehr<br />
besonderen Charaktere erzeugen durch den Zustand des Freiheitsentzuges eine permanent<br />
kritische Probensituation. Am Anfang stehen Angstabbau und Vertrauensaufbau. Der<br />
geschützte Theaterraum muss sich erst gegen die knallharte, alltägliche Hierarchie der<br />
Insassinnen etablieren. Dann aber eröffnet er sich hin zu ungeahnten Möglichkeiten.<br />
Gemeinsam werden Szenen entwickelt. Aus der Angst sich zu blamieren wird die Lust am<br />
Spiel, am eigenen Ausdruck. Die Darsteller wachsen zu einem Ensemble zusammen. Die<br />
Mitglieder von Kollektiv VolkArt leiten zwar die Proben und strukturieren die Ergebnisse,<br />
bewegen sich aber menschlich auf Augenhöhe. Viele Frauen stehen zum ersten Mal in ihrem<br />
Leben auf der Bühne. Die Theaterarbeit hat sie in Bereiche geführt, von denen sie zwar<br />
fasziniert sind, die ihnen aber inklusive der Risiken noch größtenteils unbekannt sind.<br />
Die Ästhetik ist dem Schutz der Darstellerinnen kategorisch untergeordnet. Um der größten<br />
Gefahr, der Ausstellung, zu entgehen, werden sehr persönliche Berichte verfremdet,<br />
aufgeteilt auf verschiedene Rollen oder in Szenen dramatisiert, so dass der emotionale<br />
Impetus sich vollständig entfalten kann. Persönliche Dramen und intime Geständnisse<br />
werden zu abstrakten Bewegungen und Handlungen. Hinter Momenten von großer theatraler<br />
Bildkraft verschwinden die persönlichen Anteile, während sich die ursprüngliche Aussage<br />
performativ verstärkt dem Publikum mitteilt.<br />
Ziel ist immer eine - unter künstlerischen Kategorien betrachtet - wertvolle, interessante und<br />
nuancenreiche Inszenierung.<br />
Die bisherigen Erfahrungen, die Unterstützung und das Vertrauen von Seiten der HAU<br />
Leitung, von Seiten der Direktion der JVA für Frauen Berlin und von Kunst&Knast e.V.<br />
werden es auch in Zukunft ermöglichen die Theaterarbeit mit den Frauen einer breiteren<br />
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.<br />
5.4 JVA Wriezen<br />
Sabine Winterfeldt arbeitet dort seit einem Jahr (Herbst 2004) mit einem Team von sieben<br />
Freunden und Berufskollegen. Sie spielen mit den 14- bis 24-jährigen männlichen<br />
Strafgefangenen sowie mittlerweile vier Mitarbeitern der Anstalt Theater. Es begann mit einer<br />
losen Sketch-Folge. Im Frühjahr 2004 schlug die Berliner Schauspielerin und Regisseurin<br />
vor, das von dem 22-jährigen Schiller 1781, zum Ende der „Sturm und Drang-Zeit“<br />
geschriebene Drama „Die Räuber“ gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Die Dialoge,<br />
Handlungsstränge wurden zusammen mit den jugendlichen Inhaftierten in Gesprächen und<br />
Improvisationen entwickelt. Der Hauptort des Konflikts, dort wo Karl mit seiner Bande sein<br />
Unwesen treiben, spielt im Gefängnis. Fast neun Monate probten die professionellen<br />
Künstler mit den jungen Männern aus dem geschlossenen Vollzug. Auch hier wird gegen die<br />
hierarchischen Strukturen des Gefängnisalltages Theater gesetzt: Die Erfahrung, dass es<br />
möglich ist, die Rolle zu wechseln; das Muster von Täter und Opfer zu brechen. Die Künstler<br />
wagten mit ihrer Gruppe einen weiteren Schritt. Sie präsentieren die „Räuber von Wriezen“<br />
draußen vor einer geschlossenen Gesellschaft. Obwohl für diese erste Produktion die Zeit<br />
nicht ganz ausreichte, die Inszenierung zeigte nur den ersten Teil des Stücks frei nach<br />
Schiller, der Rest wurde erzählt, war die Öffentlichkeit begeistert. Leider ist die Finanzierung<br />
weiterhin nicht gesichert. Das Team um Sabine Winterfeldt möchte zu gern eine feste<br />
Theatergruppe in der JVA etablieren.<br />
5.5 Zukunft@BPhil – Education-Projekt 20 „Sieben Türen“ – JVA Plötzensee Berlin<br />
Alle drei Projektleiter haben langjährige Erfahrungen in Worksshops mit Inhaftierten<br />
gemacht, und sie kennen sich gut aus verschiedenen gemeinsamen Musiktheaterprojekten:<br />
Nigel Osborne, der Komponist und Musiker, Stephen Langridge, der Regisseur und Stephen
Plaice, der Librettist und Drehbuchautor. Die Idee zum Stück hatte man aus Béla Bartóks<br />
Oper „Herzog Blaubarts Burg“ abgeleitet. Allerdings ging es nicht darum die Geschichte<br />
einfach nachzuspielen, sondern etwas Neues zu schaffen, angestoßen von der Frage: Was<br />
sehen die Inhaftierten hinter den Türen? Anstoß zu diesem Projekt in der JVA Plötzensee im<br />
Bereich des offenen Vollzugs hatte der Gefängnisseelsorger Eckart Wragge gegeben. Zehn<br />
Inhaftierte meldeten sich für den Workshop. Bereits am ersten Abend verfügt diese zufällige<br />
zusammengestellte Gruppe über ein gemeinsames musikalisch-rhythmisches Material. In<br />
den darauf folgenden Tagen wird konsequent und systematisch in drei Gruppen gearbeitet.<br />
Die Trainer geben lediglich Arbeitsstrukturen vor, Ideen und Inhalte werden von den<br />
Inhaftierten entwickelt. Die Berliner Philharmoniker haben sich – wie alle anderen – auf<br />
Neuland begeben. Für dieses Projekt ließen sie sich darauf ein, die Musik über die<br />
Improvisation mit zu entwickeln, und sie haben als Darsteller mitgewirkt. (Zur Aufführung<br />
wird das Bühnenbild von einem Grafitti-Künstler gestaltet, der sich wiederum von einem<br />
Inhaftierten inspirieren ließ, der wegen Vandalismus im Gefängnis sitzt.)<br />
5.6 JVA Bautzen<br />
1998 entstand in Bautzen die Idee, mit Inhaftierten Theater zu spielen. Professionelle Hilfe<br />
bekommt das <strong>Gefängnistheater</strong> schnell - vor sieben Jahren führten die beiden Schauspieler<br />
Wigand Alpers und René Wolf im Freizeitbereich der JVA erste Szenestudien durch. Seit<br />
1999 unterstützen der Dramaturg Christoph Gerdes und seit 2001 die Schauspielerin Janina<br />
Brankatschk die Theatergruppe der JVA. Mit ihrer Hilfe lernen die Männer sich in<br />
unterschiedliche Rollen und Charaktere hineinzuversetzen. Gespielt wurde u.a. „Reif für die<br />
Insel?“ (2001), „Der Fehler“(2000). Im Jahr 2002 wurde der erste Kooperationsvertrag<br />
zwischen dem Deutsch-sorbischen Volkstheater und der JVA abgeschlossen, der eine<br />
umfangreiche Unterstützung bei Bühnenbild, Kostümen und Technik zusichert. Und nicht<br />
zuletzt beteiligten sich auch Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen National-Ensembles:<br />
Gemeinsam mit den Gefängnisdarstellern standen sie auch vor der Kamera. Mit<br />
Unterstützung durch das SAEK-Studio Bautzen wurde für die Theaterabende auch ein<br />
Videofilm produziert.<br />
5.7 JVA Bremen:<br />
In der JVA Bremen, in der momentan 685 Gefangenen inhaftiert sind, davon 652 männliche<br />
Inhaftierte und 33 weibliche Inhaftierte, wird derzeit eine Theatergruppe aufgebaut. Geplant<br />
ist hier eine wöchentliche Probenarbeit im Umfang von ca. 7 Stunden, die von einem<br />
Mitarbeiter geleitet werden soll. Die Mitspieler sollen durch die Leitung benannt werden.<br />
Geplantes Ziel des Probenprozesses soll in einer oder mehrer Aufführungen münden. Als<br />
Grundlage für das geplante Stück dient die Romanvorlage „Schuld und Sühne“. Ziele der<br />
Theaterarbeit sollen vor allem in der gemeinsamen Konfliktlösung liegen, Teamfähigkeit soll<br />
erarbeitet werden, Kreativität und darstellender Ausdruck gefördert werden. Die Arbeit wird<br />
aus den Mitteln der Landes Bremen finanziert werden. Da sich die Theaterarbeit momentan<br />
im Entstehung- und Aufbausprozess befindet konnten noch keine weitergehenden und<br />
detaillierteren Angaben gemacht werden.<br />
5.8 JVA Wuppertal:<br />
Auch in der JVA Wuppertal wird durch den evangelischen Gefängnispfarrer Herrn Schnitzus<br />
eine neue Theaterarbeit gerade aufgebaut. Gemeinsam mit einer externen Mitarbeiterin soll<br />
wieder <strong>Gefängnistheater</strong> stattfinden können. Bereits in frühern Jahren wurde durch den<br />
Schauspieler und Regisseur Burkhard Forstreuter mehrere Stücke mit Inhaftierten erarbeitet.<br />
In sechs Wochen wurde mit elf Häftlingen das Stück „Es ist, wie es ist“ über Verbrechen,<br />
Verhandlung und Vollzug erprobt. Gespielt wurde es u.a. in der Gefängniskappelle der JVA<br />
Bochum vor anderen Mitgefangenen. Weitere Gastspiele gab es u.a. in der JVA Köln-<br />
Ossendorf und der JVA Remscheid.<br />
5.9 JVA Schwerte:<br />
Zurzeit sind im geschlossenen Vollzug der JVA Schwerte ungefähr 270 männliche<br />
Gefangene inhaftiert. Der dortige Gefängnispfarrer und Theaterpädagoge Dirk Harms
erarbeitete mit einer Gruppe von 9 bis 12 Männern in der Kirche das Stück „Die Bibliothek<br />
von Babel“ nach Jorge Luis Borges. Herr Harms arbeitete zuvor neun Jahre im<br />
Jugendvollzug der JVA Iserlohn, von denen er in sieben Jahren eine dortige Theaterarbeit<br />
aufbaute. Das Projekt „Iserlohn jail productions“ ist dort entstanden und zu Ende geführt<br />
worden.<br />
Für die Projekte in der JVA Schwerte können sich die Schauspieler selbst melden und<br />
sollten die Bereitschaft zeigen mit der Gruppe gemeinsam die Arbeit über<br />
zusammenzubleiben. Das bedeutet, dass sich eine Gruppe auch noch im Proben- du<br />
Arbeitsprozess neu zusammensetzen kann. Die Motivation der Gruppe wird als „hoch“<br />
eingeschätzt, so dass Wechsel aufgefangen werden können. Der Probenzeitraum beginnt<br />
vor der Premiere vier Monate vorher, es wird zweimal wöchentlich à drei Stunden geprobt.<br />
Vier Wochen vor den Aufführungen wird nahezu täglich vier Stunden miteinander gearbeitet.<br />
Beschreibung des Probenprozesses: Am Anfang steht ein intensives physisches Training<br />
von 60-90 Minuten, danach folgt Stimmtraining. Im zweiten Teil folgen thematische<br />
Improvisationen über Motive des Themas. Grundlage ist die Arbeit an den physischen<br />
Handlungen. Es wird nicht an festen Rollen gearbeitet, sondern an Bildern, die bei den<br />
Improvisationen entstehen. Das entstehende Stück, eine Komposition aus den entstandenen<br />
Bildern, ist an den Stärken und Farben der einzelnen Schauspieler orientiert.<br />
5.10 JVA Celle-Salinenmoor:<br />
In den Jahren 1997 bis 2000 fand in der JVA Celle-Salinenmoor <strong>Gefängnistheater</strong> statt. Die<br />
beiden Regisseure Ralf Siebelt und Winfried Tobias erarbeiteten mit den Inhaftierten drei<br />
Projekte. 1997 wurde in einer Koproduktion mit dem Schlosstheater Celle Brechts „Arturo Ui“<br />
in einem siebenwöchigen Probenprozess auf die Bühne gebracht. Unter der Mitarbeit von 18<br />
Gefangenen konnte dieses erste Projekt einmalig, nicht öffentlich, vor Angehörigen und<br />
Gästen der JVA gezeigt werden. Allerdings gab es eine ausführliche Berichterstattung in den<br />
Printmedien und im Fernsehen. Zwei Jahre später wurde „Wie dem Herrn Mockinpott das<br />
Leiden ausgetrieben wird“ nach Peter Weiss in sechs Wochen erarbeitet. Die Produktion<br />
konnte mit Unterstützung der LAGS (Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen)<br />
sowie des Schlosstheaters Celle durchgeführt werden. Für dieses Projekt beteiligten sich<br />
auch Gefangene die Werkstattarbeiten für u.a. den Bühnenbau leisteten, insgesamt nahmen<br />
20 Gefangene teil. Es durften drei Aufführungen nicht nur vor Angehörigen und Gästen der<br />
JVA gezeigt werden, sondern auch Gäste des Theaters wurden zugelassen. 2000<br />
erarbeitete das gewachsene externe Team (Ralf Siebelt, Winfried Tobias, Otmar Wagner,<br />
Cordula Stummeyer) mit 16 Mitwirkenden „Mann ist Mann“. Diese Produktion wurde aus<br />
Mitteln der LAGS, der Niedersächischen Lottostiftung und der kirchlichen Hanns-Lillje-<br />
Stiftung ermöglicht. Für diese Arbeit wurde ein Probenprozess von acht Wochen ermöglicht.<br />
Wiederum wirkten neben Schauspielern auch technische Arbeiter an diesem Projekt mit.<br />
Erstmals konnte dieses Stück öffentlich gezeigt werden. Insgesamt konnten 500 Zuschauer<br />
das open-air Event im Gefängnishof der JVA verfolgen. Der Kartenverkauf und vorherigen<br />
Anmeldung wurde durch die Tourismus-Information unterstützt und durchgeführt. Auch<br />
dieses Projekt fand ein breites Echo in der Berichterstattung der Printmedien.<br />
5.11 JVA Fuhlsbüttel:<br />
Die Theaterarbeit hinter Gittern begann für die beiden Regisseure Ralf Siebelt und Winfried<br />
Tobias 1997 mit den Aufführungen in der Celler JVA. Der große Erfolg ermutigte sie, ihre<br />
Tätigkeit auch nach Hamburg zu erweitern. Zusammen mit 15 interessierten Häftlingen<br />
wurde in sieben Wochen Taboris Stück „Die Kannibalen“ erarbeitet. Das Stück bot für die<br />
Gefangenen eine Gelegenheit zur Reflektion des Lebens hinter Stacheldraht. Die<br />
Gefängniskapelle wurde dabei zur Bühne umfunktioniert. Auch die Gefängnisbetriebe<br />
wurden für das Projekt in Anspruch genommen. Unter der Leitung der Kostümbildnerin<br />
Marion Eiselé stellten sie Kostüme, Masken und Requisiten her. Realisiert wurde das Projekt<br />
des „Vereins zur Förderung des Strafvollzugs in der JVA Hasenberge“ mit Mitteln der<br />
Hamburgischen Kulturstiftung, der David-Jonas-Stiftung und der Zeit-Stiftung. Unterstützt
wurde diese Arbeit auch vom Thalia-Theater Hamburg und den Städtischen Bühnen Kiel.<br />
Gezeigt wurden sechs öffentliche Vorstellungen.<br />
5.12 JVA Schwäbisch Hall:<br />
Eine viel beachtete Theaterarbeit im damaligen Jugendgefängnis wurde vom Hebst 1994 bis<br />
Frühjahr 1995 erarbeitet. Die Regisseurin und Leiterin des Theaterprojekts „Diener zweier<br />
Herren“ war die Schauspielerin und Theaterpädagogin Monika Timme. Durch eine Förderung<br />
des Justizministeriums wurde diese Arbeit ermöglicht. Als Projektleiter, der die Projektarbeit<br />
zu koordinieren und als Ansprechpartner aufzutreten hatte, wurde der Leiter der „Abteilung<br />
für außerschulische Jugendbildung“ benannt. Das Projekt fand mit neun Vorstellungen vor<br />
insgesamt rund 650 Zuschauern statt.<br />
5.13JVA Ichtershausen<br />
Nahaufnahmen statt Fremdbilder – Uta Plate<br />
Vom November 1996 bis Mai 1999 arbeitete die Theaterpädagogin Uta Plate mit inhaftierten<br />
Jugendlichen der Jugendstrafanstalt Ichtershausen bei Erfurt. Das Projekt entstand aufgrund<br />
einer Initiative des Theaters Nordhausen und wurde vom Justizministerium zu 75% finanziell<br />
gefördert. Ein- bis zweimal die Woche wurde den inhaftierten Jungen und Männern im Alter<br />
von 14-24 Jahren die Theaterarbeit als Freizeitmaßnahme zwischen Arbeit und Einschluss<br />
angeboten. Es wurde jeweils mit einer Gruppe von ca. 15 Jugendlichen mehrere Stücke aus<br />
ihren Lebensgeschichten entwickelt und in der JSA vor externem Publikum und den<br />
Inhaftierten aufgeführt.<br />
Am Anfang<br />
Für die Entwicklung des Stücks gab es nur einen groben Rahmen für verschiedene Phasen:<br />
Improvisation, Materialsuche (ihre biografischen Geschichten, Film- und Literaturzitate),<br />
Strukturierung des Materials und Endproben des im Verlauf der Arbeit entstandenen<br />
Theaterstücks. Von Probe zu Probe änderten sich Zusammensetzung der Gruppe,<br />
Motivationen, Stimmungen, Machtverhältnisse.<br />
Improvisation<br />
Verschiedene Impulse wurden gegeben für szenische Improvisationen: über Fotos, die zur<br />
Ausgangsbasis wurden, über Kostüme, oder durch vorgegebene Konflikte. Einige Male<br />
waren Charaktere vorgegeben für das szenische Spiel andere Male Musik und Rhythmus<br />
oder Filmeszenen.<br />
Anlaufschwierigkeiten<br />
Eine Mischung von Aggression und Apathie existiert, die ein kreatives Spiel erschweren. Das<br />
heißt, immer wieder neue Spielimpulse geben, immer wieder die Situation in eine andere zu<br />
transformieren. Eine weitere Folge der Situation hinter Gittern ist die sog. Haftmacke. Wer<br />
auf den Status des Knackies reduziert ist und sich nur noch als Verbrecher definiert, nimmt<br />
sich nur noch eindimensional wahr.<br />
Rollenpanzer<br />
Der Rollenpanzer der inhaftierten Jugendlichen ist fester als irgendwo sonst. Denn die<br />
Position, die man in der Knasthierarchie einnimmt, ist entscheidend für das Schicksal hinter<br />
Gittern. Dem festgeschriebenen Rollengefüge mit der Einweglösung "Der Stärkere gewinnt"<br />
andere Wege entgegenzusetzen war die Hauptarbeit vieler Wochen. Wenn Improvisationen<br />
wieder mal auf einen gewaltvollen Machtkampf hinausliefen, wurde darauf hingewiesen,<br />
dass die Szenen einfach langweilig werden, wenn die Konflikte nur ein "auf die Fresse" zur<br />
Antwort haben. (Ein gut geprobter Kampf kann auf der Bühne spannend sein, aber nur einer<br />
und nicht immer.) Doch der Rollenpanzer für die Jugendlichen war so stark, dass Theater für<br />
die Jugendlichen oft zur Grenzen überschreitenden Herausforderung wurde. Ein<br />
Freischwimmen gelang über die Wochen immer häufiger, Figuren wurden entwickelt,<br />
angefüllt mit Eigenem und Neuem. Mittlerweile war es für einige sogar ein besonderes<br />
Vergnügen, aus sich heraus zu können und zeigen zu können, was man spielen und<br />
darstellen kann. Mit den verschiedenen Theaterübungen eröffnete sich ein Freiraum, ein<br />
Spiel mit ungewissem Ausgang. Die Arbeit auf der ästhetischen Ebene stand im engen<br />
Wechselspiel mit der sozialen Ebene. Indem auf der Bühne eine andere Begegnung möglich<br />
wurde, veränderte sich auch das Miteinander.
Materialsuche<br />
Ein weiterer Weg der Annäherung auf sozialer wie auf ästhetischer Ebene ist die<br />
Entwicklung der Figur. story-telling wurde zu einem festen Bestandteil der Proben gemacht.<br />
Jemand erzählte eine Geschichte aus seinem Leben. Bei der Erarbeitung des Stücks ging es<br />
um die Suche nach dem Kick und nach dem Glück. Ihre Geschichten offenbarten als<br />
Momentaufnahmen kurze Einblicke in ihre Biografien. Durch das Sammeln und Ordnen von<br />
biografischem Material und die anschließende bewusste Veränderung durch<br />
Theatertechniken wurde die Stückfassung erstellt.<br />
Aufführung<br />
Mit der Aufführung der Arbeit sollte dreierlei erreicht werden: den Jugendlichen der<br />
Theatergruppe das Live-Erlebnis von Theater zu verschaffen; allen Inhaftierten der JVA<br />
zeigen, dass Theater mindestens so aufregend wie ein Kinobesuch sein kann; und drittens<br />
einem Publikum von außen die politische Dimension von Gefängnis und Theater sichtbar zu<br />
machen. Mehrere Aufführungen, interne, wie auch externe, bildeten den Projekt-Abschluss.<br />
„Die Theaterarbeit hat mir gezeigt, dass ich noch etwas anderes kann, als nur im Knast zu<br />
sitzen."(ein Mitspieler)<br />
Die gefangenen Zuschauer wurden mit ungewöhnlichen Spielweisen, surrealen Momenten,<br />
die ihren bisherigen Sehgewohnheiten fremd waren, und einer Spiegelung der eigenen<br />
Geschichte konfrontiert. Das externe Publikum mit der Lebenswelt der Jugendlichen sowie<br />
Bildern aus der Knastwelt. Das Publikum hat durch diese Geschichten Nahaufnahmen aus<br />
der Gefängnisrealität erleben können. Die brutale Knastwelt, sowie die von den Jugendlichen<br />
oft ausgedrückte Perspektivlosigkeit waren die Grundlage für anschließende<br />
Podiumsdiskussionen zwischen den Jugendlichen, Justizangehörigen und dem Publikum.<br />
5.14 JVA Pankow / Berlin<br />
La Grande Vie - Gudrun Herrbold<br />
Von 1999 bis 2001 arbeitete die Regisseurin Gudrun Herrbold an 2 Theaterprojekten in der<br />
JVA für Frauen Pankow. Diese Arbeiten wurden öffentlich gezeigt, sowohl im Gefängnis (je 3<br />
x) als auch in der Volksbühne (je 2x). 10 bis 12 inhaftierte Darstellerinnen waren beteiligt.<br />
Befreiung, Tanz, Ekstase standen im Mittelpunkt der Arbeit. Das 2. Projekt wurde in<br />
Zusammenarbeit mit Jurastudenten durchgeführt. Neben den Inhaftierten standen<br />
Jurastudenten als Darsteller auf der Bühne.<br />
5.15 Angrenzende Projekte:<br />
In der Bundesrepublik Deutschland wird in den meisten Justizvollzugsanstalten ein<br />
kulturelles Programm angeboten. So wird in einer Vielzahl der Gefängnisse zwar keine<br />
aktive Theaterarbeit von Seiten der Mitarbeiter oder externer Gruppen erarbeitet, so finden<br />
aber neben Konzerten auch Theaterabende statt. Bei den Theateraufführungen handelt es<br />
sich um Arbeiten von festen Häusern oder auch Angebote von Schauspielschulen werden<br />
dann in geschlossenen Veranstaltungen für die Inhaftierten gespielt. Durchschnittlich finden<br />
solche Theaterabende ca. zweimal jährlich statt. Innerhalb der Haftanstalten haben die<br />
Gefangenen auch die Möglichkeit an anderen kulturellen Projekten mitzuwirken. So werden<br />
ebenfalls in zahlreichen Gefängnissen Literaturgruppen angeboten. Meist bieten sich hierfür<br />
externe MitarbeiterInnen an, die in regelmäßigen Sitzungen mit interessierten Gefangenen<br />
literarische Texte verfassen, zusammen lesen und über Texte in der Gruppe sprechen. Texte<br />
und Artikel werden u. a. auch für einige in der Bundesrepublik Deutschland erscheinende<br />
Gefängniszeitschriften verfasst. In der JVA Tegel wurde auf Initiative und in Kooperation mit<br />
<strong>aufBruch</strong> die erste Internetseite weltweit von Gefangenen erstellt und steht seit 1998 im<br />
Netz. Es werden auch Mal- und Zeichengruppen und teilweise sogar Bildhauerkurse<br />
angeboten.<br />
In der JVA Geldern beispielsweise werden seit vielen Jahren Sketche zu Veranstaltungen<br />
gemeinschaftlich erprobt.
6. Auswertung:<br />
Bis zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir weiterhin im Kontakt mit den verschiedenen und sehr<br />
zahlreichen Justizvollzugsanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Immer wieder erhalten<br />
wir neue Informationen über Theaterarbeiten in Gefängnissen. Es befinden sich neue<br />
Gruppen im Aufbau und stehen noch ganz am Anfang ihrer Arbeit. Daher konnte bisher nicht<br />
immer auf den gesamten Fragenkomplex der Studie geantwortet werden. Das Interesse sich<br />
an der Studie daher zu einem späteren Zeitpunkt zu äußern ist vorhanden. Daher sollte<br />
diese weitergeführt werden.<br />
In den vorgestellten kurzen Auszügen der unterschiedlichen Projekte lassen sich aber<br />
folgende zusammenfassende Bemerkungen und Aussagen treffen:<br />
Theater in deutschen Gefängnissen findet nur selten statt und ist keineswegs<br />
Selbstverständlichkeit. Theater in den Gefängnissen findet in sehr unterschiedlichen Formen<br />
statt. Sowohl die Arbeit mit vorgegebenen Stückvorlagen, als auch die Arbeit an Stücken, die<br />
aus Improvisationen entwickelt werden, sind beliebte und nahe liegende Methoden der<br />
Durchführung der Arbeit. Die künstlerischen Methoden (Gruppenarbeit, Kontaktarbeit,<br />
Bewegungs- und Vertrauensübungen, Improvisationen) sind relativ ähnlich. Der<br />
künstlerische Anspruch und die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Die Spannbreite reicht<br />
von sehr improvisierten Vorführungen bis hin zu hochprofessionellen und stilisierten<br />
Theaterarbeiten. Die Arbeit wird oft von freien Künstlern, Schauspielern, Theaterpädagogen<br />
oder Studenten durchgeführt. Eine Unterstützung und Partnerschaft zu<br />
staatlichen/kommunalen Theater besteht häufiger und ist förderlich.<br />
Des Weiteren sind Fragen der Finanzierung der Projekte sehr unterschiedlich. Wird die<br />
Theaterarbeit direkt von einer JVA angeboten, stehen hierfür Mittel der jeweiligen<br />
Landesregierungen zur Verfügung. Prinzipiell gibt es aber in den Haushalten der Justiz<br />
immer weniger Mittel für Kultur. Die Justiz muss Kosten sparen und schiebt die<br />
Verantwortung für Kunst und Kultur von sich und verweist auf externe Förderer und<br />
Sponsoren.<br />
Externe Gruppen bewerben sich um finanzielle Mittel aus ganz unterschiedlichen Bereichen<br />
so zum Beispiel Stiftungen oder Fördertöpfe der Länder (z.B. Lotto etc.). Es gibt aber keine<br />
gängigen oder Erfolg versprechenden Wege der Projektförderung, keine Zuständigkeiten.<br />
Ein Großteil der Projekte wird aus Gründen nicht vorhandener Finanzen nicht durchgeführt.<br />
Stiftungen, die sich direkt mit der Thematik Förderung der kulturellen Arbeit Inhaftierter<br />
beschäftigen gibt es nahezu nicht. In Berlin arbeitet der Verein Kunst & Knast e.V., dessen<br />
finanzielle Kräfte aber nur aus Spenden erwachsen und daher als Notgroschen zu<br />
betrachten sind. Die Gustav-Radbruch-Stiftung beschäftigt sich mit der Gefängnis-<br />
Problematik, von der Förderung von Theaterprojekten ist uns allerdings nichts bekannt.<br />
Auf die Frage nach den Möglichkeiten künstlerischen Ausbildungsmöglichkeiten innerhalb<br />
der Gefängnisse können wir folgende Aussage treffen. Künstlerische<br />
Ausbildungsmöglichkeiten werden in keiner der Haftanstalten in der BRD angeboten. Es wird<br />
lediglich schulischen Ausbildungen, Fernstudium und vor allem handwerklichen<br />
Ausbildungen ermöglicht.<br />
7. Fazit / <strong>aufBruch</strong><br />
Für uns stellt sich die Methode, mit künstlerischen Teams von außen unabhängig ins<br />
Gefängnis zu gehen und dort auf freiwilliger Basis Kunst-Produkte zu schaffen, die von<br />
internem und externem Publikum gesehen werden können, als die produktivste Methode von<br />
<strong>Gefängnistheater</strong> dar.
In sozial-politischer Hinsicht sind der künstlerische Anspruch und die Wahrnehmbarkeit<br />
dieser Arbeit im öffentlichen Kulturleben von immenser Bedeutung.<br />
Zur Methodik gehören unbedingt: Körpertraining/Bewegungsarbeit, Stimmtraining,<br />
Basiswissen zum Verhalten auf der Bühne, Gruppenarbeit, professionelle<br />
Inszenierungsarbeit, professioneller künstlerischer Rahmen (Bühne, Kostüme, Musik, Ton,<br />
Licht, Video), Herausarbeitung von künstlerisch wesentlichen und brisanten Thematiken.<br />
Die Formen der künstlerischen Arbeit und die Zeiträume sind variabel, natürlich sich<br />
langfristige Projekte von größerer Nachhaltigkeit.<br />
Dank<br />
Unser Dank gilt Allen, die sich an dieser Studie beteiligt haben und sie uns in ihrer<br />
Ausführlichkeit beantwortet haben. Des Weiteren bedanken wir uns bei allen, die uns<br />
weitergeholfen haben, uns Tipps gaben und uns bei unserer Arbeit an der Studie unterstützt<br />
haben.<br />
Unsere Hoffnung für die Zukunft ist das nun entstehende Netz zwischen den<br />
TheatermacherInnen von drinnen wir draußen zu verfestigen, damit ein Austausch<br />
ermöglicht und erleichtert wird. Wir wünschen uns weitere und wachsende Theaterprojekte<br />
im Justizvollzug, und hoffen auf eine breite Unterstützung, Offenheit und größere finanzielle<br />
Möglichkeiten für diese Arbeit.
8. Ursula Kohlert / Justizministerienrecherche in Europa<br />
Im Zusammenhang mit ihrer Diplomarbeit führte Ursula Kohlert eine <strong>Recherche</strong> über<br />
<strong>Gefängnistheater</strong>projekte bei europäischen Justiz- und Kulturministerien durch.<br />
Die Ergebnisse sind hier mit aufgeführt.
9. Linkliste<br />
www.kunstprojekt-aufbruch.de<br />
www.planet-tegel.de<br />
www.kollektiv-volkart.de<br />
www.sabisa.de<br />
www.domino-x.de<br />
www.knast.net<br />
www.strafvollzug-online.de<br />
www.knastforum.de<br />
www.hinter-gitter.de<br />
www.treffpunkt-nbg.de<br />
www.people.freenet.de/ash.ev<br />
www.haeftling.de<br />
www.gefaengnisseelsorge.de<br />
www.kath-gefaengnisseelsorge.de<br />
www.rote-hilfe.de<br />
www.freiehilfe-berlin.de<br />
www.soziales.freepage.de/zb-berlin<br />
www.zakk.de/ulmerecho<br />
www.comlink.de/blickpunkt<br />
www.freiabos.de
10. Literaturliste<br />
Boal, Augusto: Theater der Unterdrückten. Übungen für Schauspieler und Nicht-<br />
Schauspieler. Frankfurt am Main, 1979.<br />
Dinges, Martin: Michel Foucault. Justizphantasien und die Macht. In: Mit den Waffen der<br />
Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hg. v.<br />
Blauert, Andreas / Schwerthoff, Gerd. Frankfurt am Main, 1993.<br />
Döpfer, Ute: Die Ontologie der sozialen Rolle als Grundlage strafrechtlicher Entscheidungen.<br />
Baden-Baden, 1994.<br />
Dülmen, Richard van: Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen<br />
Neuzeit. München, 1985.<br />
Foucault, Michel: Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin. Berlin,<br />
1996.<br />
Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Paris, 1975.<br />
Goffman, Erving: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität.<br />
Englewood Cliffs, 1963.<br />
Goffman, Erving: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. New York, 1959.<br />
Heritage, Paul: Real Social Ties? The Ins and Outs of Making Theatre in Prisons, in Adams,<br />
D./ Goldbard, A.: Community, Culture and Globalization. New York, 2002.<br />
Kawamura, Gabriele: Strafe zu Hause? Elektronisch überwachter Hausarrest. In:<br />
Kriminalpolitik. Forum für Praxis, Politik und Wissenschaft., 2/ 1999.<br />
Rousseau, Jean-Jacques: Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts. 1762.<br />
Sandberger, Sabine: Theaterarbeit in einem Hochsicherheitsgefängnis, in Koch, G., Roth S.,<br />
Wrentschur, M. (alle Hrsg.): Theaterarbeit in sozialen Feldern. Frankfurt am Main, 2004.<br />
Schüler-Springorum, Horst: Kriminalpolitik für Menschen. Frankfurt am Main, 1991.<br />
Sennett, Richard: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. New York/ Berlin,<br />
1998.<br />
Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. New<br />
York, 1974.<br />
Thompson, James: Prison Theatre. Perspectives and Practices. London, 1998.<br />
Wagner, Georg: Das absurde System. Strafurteil und Strafvollzug in unserer Gesellschaft.<br />
Heidelberg, 1985.
Zelle, Carsten: Strafen und Schrecken. Einführende Bemerkung zur Parallele zwischen den<br />
Schauspielen der Tragödie und der Tragödie der Hinrichtung. In: Jahrbuch der deutschen<br />
Schillergesellschaft. (Bd. 28) Stuttgart, 1984.<br />
Bewegungstraining für Gefängnis / <strong>aufBruch</strong> Methode<br />
1. Teil: Spiel 10 Minuten<br />
Für Gruppendynamik, Aufwärmen<br />
z.B. Fangenspiel: Fänger fängt mit Gefangenem Hand in Hand, beide dürfen fangen, so daß<br />
die Kette immer größer wird.<br />
2. Teil: im Stand 10-15 Minuten<br />
Für Kraft, Beweglichkeit, Köperwahrnehmung und Haltung<br />
- Kombination für Dehnung, Kraft und Kondition<br />
Wiederholung rechts, links im Wechsel bis zu 8 mal mit Temposteigerung<br />
- Isolation der einzelnen Körperteile ( Kopf, Schultern, Arme, Brustkorb, Hüfte, Knie, Füße)<br />
für Körperwahrnehmung und Beweglichkeit<br />
- Sprünge zum Lockern, Kondition<br />
- Übung zur Koordination von Armen, Beinen, Kopf<br />
- Elemente mit Kontraction und Release<br />
- Elemente für Choreographie 10 Minuten<br />
einzelne Bewegungen: angefangen mit Beinen, dann Arme, Kopf<br />
Zusammensetzen von verschiedenen Bewegungen zu einem Bewegungsablauf<br />
Im Verlauf gezählt, dann auf Takt selber zählen lassen<br />
3. Teil: auf dem Boden 5-10 Minuten<br />
Für Kraft und Dehnung<br />
- auf den Boden kommen ( sinken, fallen..)<br />
- Rückendehnung- Rückenmuskeln<br />
- Bauchmuskeln<br />
- Seiten-, Oberkörperdehnung<br />
- Beindehnung<br />
- Übung für Körperhaltung<br />
4. Teil: durch den Raum 10-15 Minuten<br />
Für Präsenz, Spannung, Focus<br />
- Im Raum gehen, stop, Focus, gehen in Richtung von Focus,<br />
1. jeder im eigenen Tempo, 2. Auf Kommando, 3.einer führt ohne Ansage zu machen – für<br />
Gruppenempfinden<br />
- gleiches mit rennen<br />
- in Reihen hintereinander von eimen Raumende zum anderen 6 Taktschläge gehen,<br />
gesteigert bis rennen, stop- Focus rechts bzw. links- rückwärtsgehen<br />
6 Taktschläge<br />
- Elemente für Choreographie 10 Minuten<br />
in Reihen von einem Raumende zum anderen, beginnend mit Beinen, dann Arme und Kopf,<br />
im Verlauf gezählt, dann auf Takt selber zählen lassen<br />
Später Aneinanderreihen von schon bekannten Bewegungen<br />
5. Teil: Partnerübung oder Gruppenübung 10 Minuten
Für Verantwortung in der Gruppe, Wahrnehmen von Gewicht und Gegengewicht und als<br />
choreographische Teile<br />
- Gewicht abgeben- daraus Hebung<br />
zu fünft im Kreis, sechster in der Mitte läßt sich mit Körperspannung in die Hände der<br />
anderen fallen- daraus über Kopf Hebung, indem der Kreis aufgelöst wird.