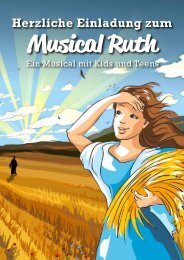Andreas Symank - FEG Zürich-Helvetiaplatz
Andreas Symank - FEG Zürich-Helvetiaplatz
Andreas Symank - FEG Zürich-Helvetiaplatz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4<br />
Alle diese Übertragungs-Vorgänge kann man unter dem Oberbegriff der Texttransformation<br />
zusammenfassen. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange bei den Unterbegriffen klar<br />
zwischen Übersetzung einerseits und Bearbeitung/Umformung andererseits unterschieden<br />
wird. Genau das ist heutzutage in manchen Wissenschaftskreisen nicht mehr der Fall. Man<br />
postuliert fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Kategorien; man hebt die klaren<br />
Grenzen auf. Letztlich hat das damit zu tun, dass man den Ausgangstext grundsätzlich als ein<br />
vieldeutiges Gebilde ansieht. Er enthält – so wird gesagt – keine eindeutige Botschaft, sein<br />
Sinn ist nicht festgelegt. Möglich, dass der Autor etwas mitteilen wollte, aber das ist nicht<br />
massgebend. Vielmehr entscheidet erst der einzelne Leser, welche Auslegung für ihn in seiner<br />
Situation die richtige ist.<br />
Es gibt einige durchaus richtige Beobachtungen bei dieser sogenannten reader-response-<br />
Kritik (oder Rezeptionsästhetik, wie sie auch genannt wird). So stimmt es natürlich, dass mein<br />
Zugang zum Bibeltext immer ein Stück weit subjektiv ist. Man hat beim Bibellesen immer<br />
eine Brille auf. Sinnvoll lesen heißt verstehen, und damit ich verstehe, muss ich interpretieren,<br />
und jeder interpretiert wieder ein wenig anders. Aber – und das ist entscheidend: Wir können<br />
miteinander über unser unterschiedliches Verständnis diskutieren! Wir können unsere<br />
Interpretations-Ergebnisse miteinander vergleichen, im Text nach Argumenten pro und contra<br />
suchen und so nach und nach zu einer einheitlichen Auffassung kommen. Der<br />
Sprachwissenschaftler, der eine Vorlesung über die Rezeptionsästhetik hält, erwartet ja auch,<br />
dass seine Zuhörer ihn verstehen. Wenn er davon ausgehen müsste, dass jeder wieder etwas<br />
ganz anderes aus seinem Vortrag heraushört, brauchte er ihn gar nicht erst zu halten. Nein,<br />
notfalls lässt er Rückfragen zu oder schiebt Erklärungen nach, um sicherzustellen, dass er<br />
richtig verstanden wird! Genauso darf auch ein biblischer Autor erwarten, dass man ihn so<br />
versteht, wie er es beabsichtigt hat.<br />
Übersetzen ist möglich<br />
Machen wir uns nun also daran, den Bibeltext so genau wie möglich zu übersetzen. Was sich<br />
dabei abspielt, lässt sich sehr schön veranschaulichen, wenn man auf den Doppelsinn des<br />
deutschen Wortes „übersetzen“ zurückgreift.<br />
Der Übersetzer ist gewissermaßen ein<br />
Fährmann; der die sprachliche Ladung vom<br />
einen Ufer des Flusses ans andere übersetzt.<br />
Er übersetzt, indem er übersetzt. Der Fluss<br />
Übersetzer = Fährmann<br />
von einer Sprache in die andere übersetzen<br />
von einem Ufer ans andere übersetzen<br />
stellt die Sprachgrenze dar – auf der einen Seite wird Griechisch gesprochen, auf der anderen<br />
Seite Deutsch. Und der Übersetzer vermittelt zwischen den beiden Sprachwelten.<br />
Ist eine solche Vermittlung überhaupt möglich? An dieser Stelle kommt eine grundlegende<br />
Beobachtung ins Spiel: Jede sprachliche Äußerung (egal, ob<br />
Form und Inhalt – die zwei<br />
mündlich oder schriftlich) lässt sich von zwei Seiten her<br />
Seiten der Sprach-Medaille<br />
betrachten – von ihrer Form und von ihrem Inhalt her.<br />
Beide Aspekte sind strikt auseinander zu halten und gehören doch untrennbar zusammen.<br />
Form und Inhalt, Ausdruck und Bedeutung – die zwei Seiten der Sprach-Medaille.<br />
Als ich mich für dieses Seminar vorbereitete, habe ich mir zunächst mal überlegt, worüber ich<br />
zu Ihnen sprechen könnte. Dann habe ich mir die verschiedensten Gedanken zu dem<br />
gewählten Thema gemacht. Und jetzt stehe ich hier. Ich könnte einfach stumm dastehen und<br />
mir weiterhin Gedanken machen. Mein Kopf wäre voll interessanter Inhalte. Aber davon<br />
hätten Sie rein gar nichts. Damit Sie was davon haben, muss ich meine Gedanken zum<br />
Ausdruck bringen. Und zwar muss ich ihnen eine Form geben (mündlich oder schriftlich), mit<br />
der Sie etwas anfangen können. Konkret heißt das: Ich muss Deutsch zu Ihnen sprechen.<br />
Damit habe ich dem Inhalt eine für Sie angemessene Form gegeben; Sie verstehen, was ich<br />
Ihnen sagen möchte. Nehmen wir mal an, ich würde plötzlich beschließen, die Form – also