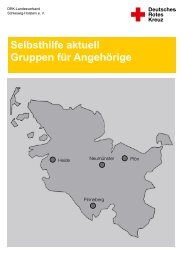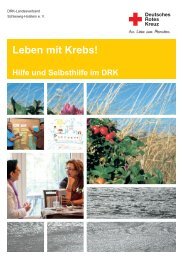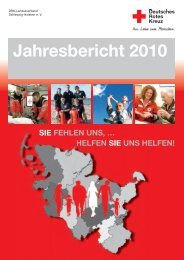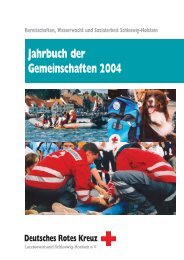Vortrag Frau Möllers - Deutsches Rotes Kreuz
Vortrag Frau Möllers - Deutsches Rotes Kreuz
Vortrag Frau Möllers - Deutsches Rotes Kreuz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deshalb möchte ich hier für eine inhaltliche Füllung der Bezeichnung „Offene Arbeit“<br />
plädieren und gleichzeitig dafür, den „Markennamen“, der sich inzwischen etabliert hat,<br />
beizubehalten.<br />
Zur Begriffsbildung „Offene Arbeit“:<br />
Sie wurde parallel zum „Offenen Unterricht“ gebildet, der in den frühen 80iger Jahren<br />
bereits in vielen Grundschulen praktiziert wurde. Die Vorstellung, dass Kinder und Eltern aus<br />
einem offenen Kindergarten weiter gehen würden in eine offene Grundschule, war nicht nur<br />
Zukunftsmusik und findet heute verstärkt statt. Die neuen Modelle einer offenen<br />
Eingangsstufe oder einem jahrgangsübergreifendem Lernen fußen auf den Prinzipien des<br />
Offenen Unterrichts.<br />
Die Bezeichnung Offene Arbeit enthielt aber auch von Beginn an ein Programm: Offene<br />
Arbeit ist offen für alle Kinder! Damit gehörte die Forderung nach Integration zentral zur<br />
Offenen Arbeit: Flexibilisierung von Strukturen, Differenzierung und Individualisierung<br />
wurden erprobt.<br />
Das Begriffspaar „Offene Arbeit“ erklärt sich nicht von selbst, das zeigt sich auch in<br />
Gesprächen mit Eltern und pädagogischen Laien immer wieder.<br />
„Offene Arbeit“ enthält gleich zwei wenig bildhafte Bezeichnungen: offen und Arbeit.<br />
Der Begriff „Arbeit“ ist vielschichtig aufgeladen und weckt, neben positiven auch negative<br />
Assoziationen (Acht-Stunden-Tag, Tarifvertrag, burn-out ..) Er ist eindeutig<br />
erwachsenenzentriert und wenig inspirierend in Bezug auf das Miteinander in einer offenen<br />
Kita.<br />
So wurden und werden immer wieder Umschreibungen gesucht oder neue Bezeichnungen<br />
kreiert, die das Wort „Arbeit“ umgehen: der offene Kindergarten, die offene<br />
Kindertageseinrichtung, das offene Haus, das offene Konzept, die offene Pädagogik.<br />
Am entschiedensten hat Gerd Regel eine neue Umschreibung versucht: er entfaltete die<br />
Vorstellung von den sichtbaren und unsichtbaren Seiten der Offenen Arbeit im Sinne von<br />
Öffnung und Offenheit und spricht in seinem gleichnamigen Buch von einer „offenen<br />
Pädagogik der Achtsamkeit“. (2)<br />
So klingt es ja auch im Titel Ihrer Fachtagung heute auf.<br />
Es geht nicht mehr nur um eine Kennzeichnung der äußeren Strukturen in einer Kita, sondern<br />
um einen veränderten Blick auf den Kern der Offenen Arbeit.<br />
Im Mittelpunkt eines offenen Hauses stehen nicht mehr die vorausplanenden und gestaltenden<br />
Erwachsenen. Im Zentrum steht das aktive, sich selbst bildende Kind in seiner Autonomie in<br />
einer gleichwürdigen Beziehung zu den Erwachsenen als Entwicklungsbegleiter(innen).<br />
Ausgehend vom Kern der Offenen Arbeit, der veränderten Beziehung zwischen Erwachsenen<br />
und Kindern, können dann die Fragen der praktischen Gestaltung eines offenen Hauses<br />
durchdacht werden.<br />
Die Unterscheidung zwischen einem Kern oder den leitenden Prinzipien, an denen Offene<br />
Arbeit sich orientiert, und einer vielfältigen, bunten Außenseite, die den jeweiligen<br />
Besonderheiten eines Hauses entspricht, war für unseren Austausch im NOA sehr klärend. Es<br />
geht nicht mehr darum, den Grad der Offenheit an standardisierten Auffassungen von<br />
Raumgestaltung oder Tagesablauf zu messen.<br />
Fragen wie: „Ihr habt keinen Bewegungs- oder Rollenspielraum? Kein Kinderrestaurant?<br />
Keinen regelmäßigen Morgenkreis? Wie verteilen sich die Kinder auf die Angebote – oder<br />
etwa: wie verteilt Ihr die Kinder auf die Angebote?“ erübrigen sich.<br />
3