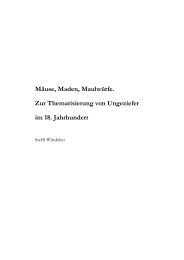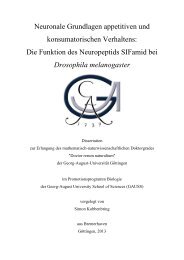Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Umgang mit Kinderarmut am Beispiel von <strong>Göttingen</strong><br />
Die ökonomische Situation ist im modernen Wohlfahrtsstaat durch Kinder immer<br />
erschwert, weil das Einkommen für den Lebensunterhalt weiterer Personen (des/der<br />
Kinde/s/r) ausreichen muss. Lohnzahlungen orientieren sich durch das freie<br />
Vertragsrecht nicht an der Lebenssituation. Kinderlosigkeit wird ökonomisch prämiert,<br />
denn staatliche Transferzahlungen können die Aufwendungen der Eltern nicht<br />
ausgleichen (vgl. Olk/ Mierendorff 1998: 244). Kinder sind ein ökonomischer<br />
Kostenfaktor, dessen Risiko die Eltern als Privatpersonen tragen müssen. Gleichzeitig<br />
erleben sie erschwerte Bedingungen am Arbeitsmarkt, weil Eltern weniger mobil und<br />
flexibel sind (vgl. Beisenherz 2002: 65, 74; Butterwegge/Klundt/Belke-Zeng 2008: 115).<br />
Der Zerfall des „Normalfamilienverhältnisses“ leistet einen Beitrag zur der Ausbreitung<br />
des Alleinerzieher/innen-Modells. Die Aushöhlung dieses Familienmodells entsteht aus:<br />
der (ökonomischen, gesellschaftlichen, beruflichen und sexuellen) Emanzipation der<br />
Frau (vgl. Butterwegge/Klundt/Belke-Zeng 2008: 74), zunehmender gesellschaftlicher<br />
Individualisierung und Veränderung der Lebensverhältnisse und Anpassungsstrategien<br />
der Betroffenen (vgl. Chassé 2007: 25), sowie durch „[…] ständige steigende Mobilitätsund<br />
Flexibilitätserwartung der globalisierten Wirtschaft“ […]“ (Butterwegge/Klundt/Belke-<br />
Zeng 2008: 65).<br />
Beisenherz argumentiert, dass es sich bei Kinderarmut faktisch primär um Mütterarmut<br />
handelt (vgl. Beisenherz 2002: 53 ff., 74). Die meisten Alleinerziehenden sind - mit<br />
großem Abstand - Frauen. Die ökonomisch schlechtere Situation von Müttern resultiert<br />
erstens aus einer benachteiligten Stellung von Frauen am Arbeitsmarkt, besonders von<br />
Frauen im gebärfähigen Alter. Zweites sind die meisten Beschäftigten im<br />
Niedriglohnsektor und in Teilzeitarbeit Frauen und sie sind durchschnittlich schlechter<br />
bezahlt als Männer (vgl. Butterwegge/Klundt/Belke-Zeng 2008: 115 ff.; Kampshoff 2005:<br />
228). Durch die ökonomisch schwierigere Situation betrifft die Verarmung durch<br />
Niedriglöhne Alleinerziehende und auch Familien mit vielen Kindern wesentlich stärker<br />
als Personen ohne Kinder (vgl. Stadt <strong>Göttingen</strong> 2008: 6-7).<br />
Auch der Faktor, dass viele Menschen gar nicht am Arbeitsmarkt gebraucht werden (vgl.<br />
Beisenherz 2002: 63; Hagen/Flatow 2007: 15), weil ihre Arbeitskraft nicht benötigt wird,<br />
trägt zur Verarmung bei und trifft selbstverständlich auch die Nachkommen der<br />
Betroffenen. Familien und Alleinerziehende sind, auf Grund der ökonomischen Last<br />
Kinder zu haben, auch einem Überschuldungsrisiko stärker ausgesetzt. Auch wenn sie<br />
nicht die einzige Risikogruppe sind, bleibt festzuhalten, dass 2008 bei 36% der<br />
überschuldeten Haushalte in Deutschland Kinder betroffen waren (vgl. 3. AR-Bericht<br />
2008: 52)<br />
19