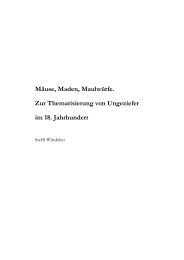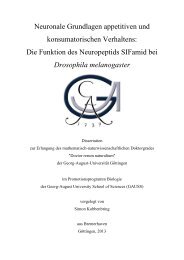Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Umgang mit Kinderarmut am Beispiel von <strong>Göttingen</strong><br />
„Resilienzförderung basiert auf einem Menschenbild, das – mehr oder weniger – allen<br />
Menschen die Fähigkeit zuspricht, mit tausend Widrigkeiten des Lebens – mit tiefen<br />
Verletzungen, traumatischen Erlebnissen, Schicksalsschlägen, Ungerechtigkeiten,<br />
Gemeinheiten – zurecht zu kommen“ (Zander 2010: 144). Diese Anforderungen erinnern<br />
stark an das, was von Erwerbslosen und Armen insgesamt gefordert wird. Sie sollen<br />
flexibel auf externe Anforderungen reagieren, anpassungsfähig und widerstandsfähig auf<br />
Belastungen und Lebensrisiken reagieren (vgl. Lessenich 2008: 74; 118) und sich von<br />
den „tausend Widrigkeiten“ nicht entmutigen lassen. Gegen Armut selbst können Kinder<br />
nicht resilient gemacht werden schreibt Zander – allerdings gegen die physiologischen,<br />
sozialen und psychologischen Folgen (vgl. Zander 2010: 143).<br />
Die Resilienzfähigkeit zielt folglich darauf Folgewirkungen zu verhindern, was für<br />
Menschen (nicht nur für Kinder) eine entscheidende Hilfe zur Bewältigung von schweren<br />
Schicksalsschlägen sein kann. Sie kann also Kindern helfen, deren Lage unabänderlich<br />
ist. Wieso nicht die Armut als Ursache der Beeinträchtigungen selbst bekämpft werden<br />
soll, bleibt allerdings offen. Außerdem bleibt undiskutiert, ob Armut als quasi natürlich<br />
akzeptiert werden soll. Die Bekämpfung von Armut wird jedenfalls von der<br />
Resilienzforschung nicht als Aufgabe gesehen.<br />
„In prekärer Lebenslage, bei erhöhtem Problemdruck besteht ein entsprechend erhöhter<br />
Bedarf an Handlungskompetenzen in den Haushalten […]“ (Kettschau 2005: 242.) Mit<br />
Bezug auf das Armutsprophylaxe-Programm des Bundesfamilienministerium verweist sie<br />
auf die Notwendigkeit der „Stärkung von Haushalts- und Familienkompetenzen“ für<br />
prekarisierte Familien (Kettschau 2005: 241) Kettschau stellt als Armutsprävention<br />
Schulungen für eine richtige Haushaltführung – also ein „Haushaltsmanagement“ - vor<br />
(vgl. Kettschau 2005: 337). Dabei soll es darum gehen, Ernährungserziehung und<br />
rationale Arbeitsplanung zu fördern, weil dies Kompetenzen seien, die armen Haushalten<br />
vermittelt werden müssen. Haushaltsführung kann auch unter<br />
Nutzenmaximierungsaspekten betrachtet werden, wobei es darum gehen muss mit<br />
knappen Ressourcen auszukommen. Diese Vorschläge verlangen vor allem eine<br />
Anpassung der betroffenen Haushalte, Bedarfsgemeinschaften und Familien, ohne<br />
jedoch die Ursachen für die Verarmung zu beleuchten. Eher wird den Haushalten die<br />
Verantwortung für ihre ökonomischen Zustände selbst überlassen und suggeriert, dass<br />
eine richtige Haushaltführung ein notwendiger Beitrag wäre, nicht in eine<br />
Überschuldungssituation zu geraten (vgl. Kettschau 2005: 338), wobei eine Beratung zur<br />
ökonomischen, ressourcensparenden Haushaltgestaltung eine mögliche Hilfestellung<br />
wäre. Ziel scheint es bei diesen Ansätzen zu sein, ökonomische Leistungsrechnungen in<br />
27