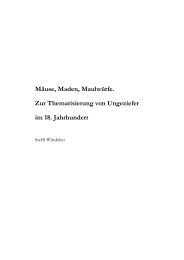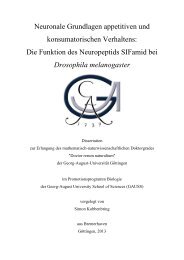Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Umgang mit Kinderarmut am Beispiel von <strong>Göttingen</strong><br />
zu gewährleisten nur darauf, dass Menschen sich mit ihrer „Leistungsfähigkeit“ am<br />
Arbeitsmarkt anbieten „dürfen“, damit keine Produktivkräfte verloren gehen (vgl.<br />
Beisenherz 2002: 9, Lessenich 2008: 106).<br />
Das Ideal der gleichen „Lebenschancen“ (S. 10) für alle Kinder wird dann reduziert auf<br />
die Chance, sich in der Aktivgesellschaft zu bewähren. Chancengleichheit als Problem<br />
der Marktwirtschaft zu betrachten und auch zu kritisieren, dass reichen Kinder eine<br />
bessere Ausbildung und damit bessere Ausgangsbedingungen für den Arbeitsmarkt zu<br />
teil werden, ist an sich nicht falsch. Es wäre aber zu kurz gedacht, den Schlüssel gegen<br />
Armut in einer Chancengleichheit im Wettbewerb um die besten Arbeitsplätze zu sehen.<br />
Selbst wenn „der Markt“ allen die Möglichkeit geben würde in einem guten oder<br />
schlechten Lohnverhältnis zu arbeiten – je nach „Leistungsfähigkeit“ der/des Betroffenen<br />
- gäbe es immer noch Verlierer/innen. Die Verlierer/innen wären wohl die am wenigsten<br />
„Leistungsfähigen“. Dann stellt sich allerdings die Frage, ob Menschen eine Abwertung<br />
erfahren dürfen, nur weil sie im Sinne der Wettbewerbslogik der Marktwirtschaft weniger<br />
leistungsfähig sind? Im Sinne der Menschenwürde wäre dies sicher nicht.<br />
Bildungsgerechtigkeit ist förderungswürdig, weil Chancengleichheit im Bildungssystem<br />
für mehr Chancengleichheit am Arbeitsplatz sorgt. Aber obwohl Bildung als so<br />
bedeutend empfunden wird, sollen Schulen sensibilisiert werden armen Familien keine<br />
unnötigen Kosten für „teure Fahrten, Taschenrechner, Lap-Tops, Kopierkosten oder<br />
Arbeitshefte“ (S. 23) aufzubürden. Die Möglichkeit, dass diese Kosten von der Kommune<br />
übernommen werden, steht nicht zur Diskussion.<br />
Die Bildungsbenachteiligung armer Kinder soll auch durch eine Änderung des<br />
individuellen Verhaltens bzw. der Lebensführung ihrer Eltern bekämpft werden.<br />
Elternbildung spielt hierbei eine entscheidende Rolle. „Eltern mit einem niedrigen<br />
Qualifikationsniveau fällt es aufgrund fehlender eigener Erfahrungen deutlich schwerer<br />
als anderen, ihre Kinder im Schulalltag zu unterstützen“ (Stadt <strong>Göttingen</strong> 2008: 11).<br />
Wenn die Qualifikationen der Eltern fehlen, können sie die Fördermöglichkeiten in<br />
Anspruch nehmen oder diese greifen von selbst, durch die von Merchel beschriebene<br />
Ausweitung von Kompetenzen der freien Träger (Merchel 2008: 15 ff.). Der<br />
Bildungsauftrag von Kindertagestädten wird in diesem Zusammenhang betont, weil hier<br />
eine Früherkennung von Problemfällen gewährleistet werden kann. Die Diskussion um<br />
die wachsende Erziehungsfunktion freier Träger hat gezeigt (vgl. Merchel 2008: 11 ff.),<br />
dass Eingriffe von Erziehungseinrichtungen besonders die armen Bevölkerungsteile<br />
treffen. In Verbindung mit dem Abwertungsdiskurs über die „Unterschicht“, den Chassé<br />
beschreibt, werden Eingriffe auf das Erziehungsverhalten des abgehängten Prekariats<br />
33