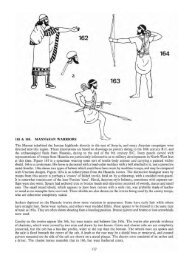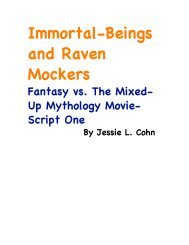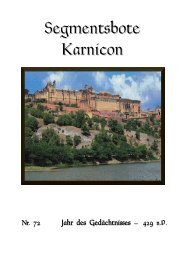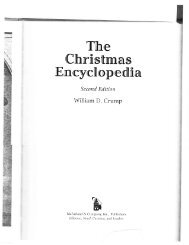Übersicht Inhalt - Wikia
Übersicht Inhalt - Wikia
Übersicht Inhalt - Wikia
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sozialen Schichten, Berufsgruppen und Geschlechter in der Bevölkerung bislang nur in<br />
totalitären Systemen erreicht wurde. Überall dort, wo die Auswahl der Kandidaten dem<br />
Wettbewerb innerhalb der Parteien und der freien Entscheidung der Wähler überlassen<br />
bleibt, kommt es zu einer erheblichen Überrepräsentanz bestimmter Berufsgruppen bzw.<br />
sozialer Schichten. Damit geht unvermeidlich die zu geringe Vertretung anderer<br />
Bevölkerungskreise und Berufe einher. Sie muss demnach hingenommen werden.“ Auch<br />
hier hat der WPA in einer anderen Beschlussempfehlung gegen weitere Einsprüche 43<br />
derselben Wahl gegenteiliges behauptet.<br />
BVERFGE 95 335 :<br />
„Aus dem Grundsatz der Wahlgleichheit (Art. 38 Abs. 1 GG) folgt für das Wahlgesetz, dass<br />
die Stimme eines jeden Wahlberechtigten den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche<br />
Erfolgschance haben muss. Maßgeblich ist hierbei eine Betrachtung ex ante. Dieses<br />
Gleichheitserfordernis wendet sich historisch gegen eine unterschiedliche Gewichtung der<br />
Stimmen nach der Person des Wählers, seiner Zugehörigkeit zu einer Klasse oder seinen<br />
Vermögensverhältnissen (vgl. BVerfGE 6, 84 [91]); es wahrt heute eine Chancengleichheit<br />
im strengen und formalen Sinne (vgl. zuletzt BVerfGE 82, 322 [337]; stRspr).“ Rn 78<br />
Entgegen dieser Rechtsprechung haben die Parteien das 2‐Klassen Wahlrecht wieder<br />
eingeführt. In diesen „Klassenwahlrecht“ wird in Bezug auf das passive Wahlrecht<br />
zwischen Geschlecht und beim Wahlvorschlagsrecht und beim aktiven Wahlrecht nach<br />
politischer Meinung unterschieden. Beim Wahlvorschlagsrecht und beim aktiven<br />
Wahlrecht trifft es Männer und Frauen gleichermaßen, alle nicht ihren Willen<br />
gleichermaßen umsetzen können.<br />
Bezüglich der weiteren Wahlgleichheit wird auf folgende Urteile Bezug genommen:<br />
BVerfGE 82 322<br />
„Der für die Wahl zum Deutschen Bundestag in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistete<br />
Grundsatz der gleichen Wahl ist nach der ständigen Rechtsprechung des<br />
Bundesverfassungsgerichts wegen des Zusammenhangs mit dem egalitären<br />
demokratischen Prinzip im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen (vgl.<br />
insbesondere BVerfGE 51, 222 [234] m.w.N.; 78, 350 [357 f.]). Die durch das Grundgesetz<br />
errichtete demokratische Ordnung gewichtet also im Bereich der Wahlen die Stimmen<br />
aller Staatsbürger unbeschadet der zwischen ihnen bestehenden Unterschiede gleich.<br />
Daher ist eine Differenzierung des Zählwertes und grundsätzlich auch ‐ bei der<br />
Verhältniswahl ‐ des Erfolgswertes der Wählerstimmen ausgeschlossen.“ Rn 48<br />
BVerfGE 11 266:<br />
„Die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl sind Anwendungsfälle des<br />
allgemeinen Gleichheitssatzes, der als Grundrecht des Einzelnen in Art. 3 Abs. 1 GG<br />
garantiert ist. Deshalb enthält ein Verstoß gegen die Grundsätze der Allgemeinheit und<br />
Gleichheit der Wahl zugleich auch eine Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG (BVerfGE 1, 208<br />
[242]; 3, 383 [390 ff.]; 6, 84 [91]; Bericht der vom Bundesminister des Innern eingesetzten<br />
Wahlrechtskommission, Grundlagen eines deutschen Wahlrechts, Bonn, 1955, S. 27 f.).<br />
Nur auf Art. 3 GG kann gemäß § 90 BVerfGG eine Verfassungsbeschwerde gegen ein<br />
Kommunalwahlgesetz gestützt werden.<br />
43<br />
BT‐Drucks. 13/3927,Anlage 15 und 21<br />
38