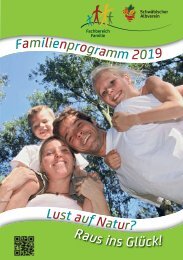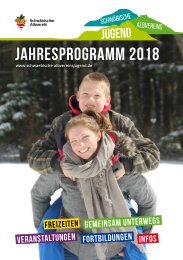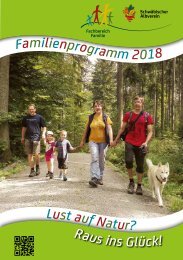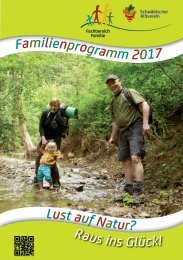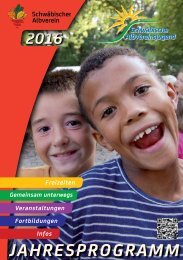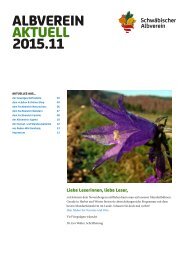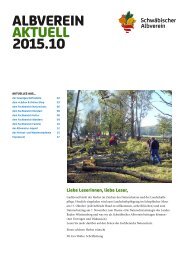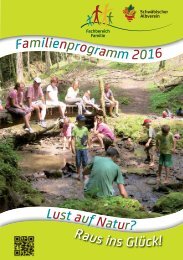Albvereinsblatt_2008-6.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auch Raben sind Singvögel<br />
Es mag schon etwas verwundern, dass die Rabenvögel mit ihrem<br />
Gekrächze zu den Singvögeln gehören sollen. Das fünf<br />
Gramm leichte Goldhähnchen und der 1,5 Kilogramm schwere<br />
Kolk rabe sollen näher mit einander verwandt sein? Dem ist tat -<br />
säch lich so! Denn schon die ersten Systematiker haben bei dieser<br />
Vogelgruppe Gemeinsamkeiten in Anatomie und Verhaltens -<br />
weisen festgestellt. Hauptmerkmale sind natürlich die mehr oder<br />
minder schönen Artgesänge zur Brutzeit. Was hat das aber mit<br />
den Rabenvögeln zu tun, mag sich mancher fragen? Das ist nun<br />
das Überraschende: Auch sie singen! Sie tun das nur nicht so öffentlich<br />
und so vollendet wie Nachtigall und Co. Die Männchen<br />
bezirzen ihre Partnerinnen mit leisen, krakelnden Tönen. Ihr Gesang<br />
hat auch weniger mit Revierbehauptung zu tun. Sie müssen<br />
nicht jährlich mit ihrer akustischen Werbung eine neue Le -<br />
bens abschnittsgefährtin gewinnen. Denn die Angehörigen dieser<br />
Familie leben meist in Einehe. Die meisten Rabenvögel sind<br />
dennoch gesellige Federtiere. Manche brüten sogar in Kolonien.<br />
Besonders im Herbst gesellt sich Gleiches gern zu Gleichem. Das<br />
täuscht dann fälschlicherweise ein Überhandnehmen dieser Vögel<br />
vor. Das wiederum fordert das Konkurrenzdenken des Menschen<br />
heraus. Denn im Nahrungs er werb stehen sie in einem gewissen<br />
Wettbewerb mit Landbau und Jägerschaft. Auch in unserer<br />
Zeit wird diesen intelligenten Vögeln noch mit Misstrauen<br />
begegnet. Die verständliche Angst der Landwirte vor Ernteschäden<br />
ist nachvollziehbar. Und wo untrag bare Einbußen entstehen<br />
könnten, ist Abwehr von nöten. Dennoch: diese Vögel<br />
gehören seit Anbeginn mit zum großen Ar tengefüge unseres Lebensraums.<br />
Da ist es auch naturgegeben, wenn bei der Jungenaufzucht<br />
auch Kleinsäuger und -vögel zum Beuteschema zählen.<br />
Sie selbst passen in das jenige größerer Beutegreifer. Logischerweise<br />
trifft es meist die häufigeren Arten, die damit in einem<br />
gewissen Gleichgewicht gehalten werden. Als Allesfresser helfen<br />
sie mit, Mäusekalamitäten zu vermeiden und halten die Landschaft<br />
von Aas sauber. Die Redensart von den bösartigen Rabeneltern<br />
ist übrigens eine üble Nachre de. Die Raben sorgen<br />
sich um ihren Nachwuchs genau so liebevoll wie andere Elterntiere.<br />
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren einige Rabenvogel -<br />
arten vogelfrei. Da ihre Verfolgung aber auch geschützte Arten<br />
traf, musste eine andere Lösung gefunden werden. Im Rahmen<br />
der Bundesartenschutzverordnung und der Vogelschutz richtlinie<br />
der EG wurden auch alle Rabenvögel<br />
geschützt. In Ausnahmefällen sind<br />
aber Bestandsregulierungen bei Rabenkrähe<br />
und Elster nach der Rabenvogelverordnung<br />
durch Bejagung<br />
möglich. Sieben Mitglieder der Raben -<br />
vogelfamilie leben in unserem Land.<br />
Es sind alles Arten, die das ganze Jahr<br />
über anzutreffen sind. Nur eine Art,<br />
die Saatkrähe, bekommt im Herbst<br />
Ver stärkung aus dem Osten. Zu Hunderten<br />
überwintert sie in der offenen<br />
Kultur land schaft auf Wiesen und Feldern.<br />
Brutkolonien gibt es nur in Oberschwaben<br />
und am Oberrhein. In den<br />
gleichen Lebensräumen lebt die Rabenkrähe.<br />
Beide Arten brüten auf höheren<br />
Bäumen. Das kleinste Familienmitglied,<br />
die kaum taubengroße Dohle<br />
mit dem grauen Hinterkopf, ist<br />
Höh len brüter an Felsen, hohen Gebäu -<br />
den und in hohlen Bäumen lichter Wälder und Park anlagen. Ein<br />
weiterer schwarzer Geselle ist der bussardgroße Kolk rabe. Er<br />
war in Süddeutschland schon einmal ausgerottet. Durch Schonung<br />
hat er sich wieder angesiedelt. Den Menschen meidet er<br />
und hält sich meist in felsigen Gegenden auf. Bei seinen Flugspielen<br />
ist sehr gut sein keilförmig zulaufender Schwanz zu sehen,<br />
in der Nähe der mächtige Schnabel. Er horstet gern in Felsnischen<br />
und auf hohen Bäumen. Auf der Schwäbischen Alb, in<br />
Oberschwaben und im Schwarzwald hat er wieder Fuß gefasst.<br />
Das schwarz-weiße Gefieder der Elster kennt wohl jeder. Sie wiederum<br />
liebt die strukturreiche Landschaft, hat sich aber auch in<br />
die Außenbezirke der Ortschaften und Städte verbreitet. In Hecken<br />
und Bäumen baut sie mehrere Nester, um dann doch nur<br />
in einem zu brüten. Am buntesten zeigt sich der Eichelhäher, ein<br />
Vogel der Mischwäl der und Parkgehölze. Seit Jahrtausenden<br />
pflanzt er Eichenwälder, weil er viele der vergrabenen Eicheln<br />
nicht mehr wieder findet. Den Waldwanderer narrt er mit dem<br />
täuschend imitierten Bussardruf und verrät ihn mit seinem lauten<br />
Warngeschrei. Die robusten Rabenvögel behaupten sich gut<br />
in unserer Kulturlandschaft. Und ohne die schwarzen Gesellen<br />
wäre die winterliche Landschaft um einiges ärmer.<br />
Kurt Heinz Lessig<br />
Die Saatkrähen-Altvögel<br />
sind an der weißen<br />
Schnabelbasis zu erkennen.<br />
Jungvögel und Ra -<br />
ben krähen haben einen<br />
rein schwarzen Schnabel.<br />
Schwäbische Pflanzennamen<br />
von Prof. Dr. Theo Müller<br />
Die Kleine Traubenhyazinthe (Muscari botryoides)<br />
Die besonders geschützte Kleine Traubenhyazinthe, eine<br />
bis 20 cm hoch werdende Pflanze mit 2 –3 Blättern ist ein<br />
Zwie belgewächs aus der Familie der Liliengewächse (heute<br />
öfters davon abgetrennt und als Familie der Spargelgewächse<br />
ausgewiesen). Die kugelförmigen blauen Blüten stehen in<br />
einer dichten Blütentraube. Die Pflanze war einst auf der<br />
Alb häufig und weit verbreitet, und die Wiesen im April oder<br />
Mai waren erfüllt von ihrem Blau. Wären die »Sieben Schwaben«<br />
nicht am Bodensee, sondern auf der Alb gewesen, dann<br />
wären sie nicht ins Flachsfeld, sondern in eine Baurabüebleswiese<br />
gefallen. »Baurabüeble« ist eine der vielen schwäbischen<br />
Bezeichnungen für die Kleine Taubenhyazinthe, die<br />
auf das Blauhemd mit dem weißen Saum zurückgeht, das<br />
Bauern, Fuhrleute und vor allem Buben trugen. Inzwischen<br />
fand infolge der Wiesenintensivierung ein dramatischer Rückgang<br />
der Kleinen Traubenhyazinthe statt, vielerorts ist sie<br />
25<br />
ganz verschwunden oder sehr selten<br />
geworden. Viele schwäbische<br />
Namen beziehen sich auf den Blütenstand<br />
(Träuble, Katzaträuble),<br />
die Form der Einzelblüten (Krügle,<br />
Wasserkrügle, Baurakrügle, Kessele,<br />
Maiaglunker, Schmalzhäfele,<br />
Schmerbäuch) oder auf die Blütezeit<br />
(Aprilaträuble, Aprilablümle,<br />
Aprilakrügle, Blaues Mailetztle,<br />
Gug gugsblümle, Georgele, hergeleitet<br />
vom Georgstag am 23. April).<br />
Von der Farbe abgeleitet sind die<br />
Namen Himmelsrös le, Tintaträuble,<br />
Tintafässle, Kaminfeger oder<br />
Kemich-kehrar le, Pfaffarösle, Kohlrö(ai)dle.<br />
Weil die Kleine Trau ben -<br />
hyazin the auf der Alb gerne auf Friedhöfen angepflanzt wurde,<br />
erhielt sie die Namen Kirchhofrösle und Gottsackerkrügle.<br />
Auf die angebliche Giftigkeit der Pflanze gehen die<br />
Namen Henne-Verrecker und Schaf-Schaicherle zurück.<br />
Thomas Pfündel