Wissenschaftlicher Aufsatz - des Verbundstudiengangs Technische ...
Wissenschaftlicher Aufsatz - des Verbundstudiengangs Technische ...
Wissenschaftlicher Aufsatz - des Verbundstudiengangs Technische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anforderungen an den wissenschaftlichen <strong>Aufsatz</strong><br />
(Seminararbeit, Diplomarbeit)<br />
1 Formelle Anforderungen an das wissenschaftliche Referat<br />
Wissenschaftliche Arbeiten haben sich an bestimmten formalen Anforderungen zu orientieren.<br />
Dennoch darf nicht der Eindruck entstehen, dass "die Form Alles und der Inhalt Nichts wäre". Aber<br />
auch bei wissenschaftlichen Arbeiten ist eine "anspruchsvolle Verpackung" nicht unwesentlich.<br />
1.1 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit<br />
Bei einer wissenschaftlichen Arbeit unterscheidet man zwischen zwingenden und fakultativen (freiwilligen)<br />
Bestandteilen:<br />
zwingende Bestandteile:<br />
− Titelblatt Bsp. s. Anlage 1<br />
− Inhaltsverzeichnis wesentlicher Bestandteil ist die Gliederung mit Seitenangaben, Bsp. s.<br />
Anlage 2<br />
− Text<br />
− Einleitung<br />
− Zusammenfassung/<br />
Fazit/Ausblick<br />
− Literaturverzeichnis<br />
− Abbildungsverzeichnis<br />
− Anhangsverzeichnis<br />
− Abkürzungsverzeichnis<br />
− Erklärung<br />
regelmäßige Bestandteile: Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung<br />
das Ziel der Arbeit (was soll der Leser am Ende verstanden haben, was<br />
soll das Unternehmen tun), die Begriffsbestimmung (falls notwendig),<br />
die Problemstellung und der Verlauf (methodische Aufbau) der Arbeit<br />
sollen hervorgehen<br />
Schlussteil: Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und kurzer<br />
Ausblick<br />
umfasst sämtliche in der Arbeit direkt oder indirekt zitierte Literatur<br />
soweit in der Arbeit Abbildungen/Anlagen existieren oder Abkürzungen<br />
verwendet werden (Regelfall)<br />
Erklärung, dass die Arbeit selbständig erstellt wurde;<br />
Bsp. s. Anlage 3<br />
fakultativer Bestandteil:<br />
− Vorwort<br />
Danksagung für besondere Unterstützung bei der Erstellung<br />
der Arbeit, z.B. dem betreuenden Unternehmen
Abbildungen<br />
Grafiken und Abbildungen bilden eine wesentliche Grundlage zur Veranschaulichung und Auflockerung<br />
einer wissenschaftlichen Arbeit und sind daher in den Text einzubinden. Der Text muss<br />
Bezüge zu den Abbildungen besitzen.<br />
Aufbau der Arbeit<br />
Das Inhaltsverzeichnis sowie ein eventuell vorhandenes Abkürzungsverzeichnis werden vor, das<br />
Abbildungsverzeichnis, das Literaturverzeichnis, der Anhang (mit Verzeichnis) und die Erklärung<br />
werden hinter den Textteil geheftet. Alle Seiten, ausgenommen die Titelseite, sind fortlaufend zu<br />
nummerieren.<br />
1.2 Schreibtechnische Anforderungen<br />
Die schreibtechnischen Anforderungen orientieren sich daran, dass Seminar- und Diplomarbeiten<br />
in der Regel mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt werden. Es gelten die folgenden<br />
formalen Anforderungen, wobei diese nicht „sklavisch“ zu übernehmen sind, sondern eher eine<br />
Orientierungsrichtlinie darstellen.<br />
− weißes Schreibpapier, Typ DIN A 4<br />
− Schriftgröße: 10 pt (bei Times New Roman 11 pt)<br />
− Abstand eineinhalbzeilig<br />
− Randbreiten einer Seite:<br />
oben<br />
2,5 cm<br />
links 3,5 cm Text rechts 2 cm<br />
unten<br />
2 cm<br />
Bitte beachten Sie, dass Texte, die in Serifenschrift geschrieben sind (d.h. mit Häkchen, wie z.B.<br />
Times New Roman), in einem Fließtext wesentlich besser lesbar sind, als serifenlose Schriften<br />
(z.B. Arial). Die serifenlosen Schriften eignen sich demgegenüber besonders für Überschriften und<br />
Folien.<br />
Absätze sind mit einer Leerzeile zu kennzeichnen. Moderne Textverarbeitungssysteme ermöglichen<br />
eine Fülle von Formatierungen, z.B. Kursiv- oder Fettschrift. Sie sollten damit sehr sparsam<br />
und einheitlich in der gesamten Arbeit umgehen.<br />
Für die Erstellung von Schaubildern in PowerPoint-Folien sollten Sie in jedem Fall eine größere<br />
Schrifttype (mind. 14 pt, besser 16 pt) wählen.<br />
2<br />
Stand: 25.5.2010
1.3 Gliederung <strong>des</strong> Inhaltsverzeichnisses<br />
Gliederungspunkte <strong>des</strong> Inhaltsverzeichnisses müssen wortgetreu als Überschriften der Kapitel<br />
erscheinen. Untergliederungen müssen einen übergeordneten Punkt erklären; z.B. erklären 3.1.1 –<br />
3.1.5 den Punkt 3.1. Aus der Logik <strong>des</strong> Gliederungssystems ist es unzulässig, einem Gliederungspunkt<br />
nur einen Unterpunkt zuzuordnen (d.h. wenn es einen Gliederungspunkt 3.1 gibt, muss es<br />
auch 3.2 geben!)<br />
2 Die Zitierweise in wissenschaftlichen Arbeiten<br />
2.1 Die Bedeutung und Form <strong>des</strong> Zitats<br />
Alle Gedanken einer Arbeit, die einer Literaturstelle wörtlich oder aber auch nur sinngemäß entnommen<br />
worden sind, sind mit einer Literaturangabe zu versehen (Bsp. bei allen Zahlenangaben<br />
in wissenschaftlichen Arbeiten muss erkennbar sein, woher diese Zahl stammt und aus welchem<br />
Jahr diese ist).<br />
Die wissenschaftliche Zitierweise ist Ausdruck der wissenschaftlichen Ehrlichkeit und damit„handwerkliche“<br />
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit. Niemand soll fremde Gedanken<br />
als seine eigenen ausgeben. Alle Gedanken einer Arbeit, die einer Literaturstellewörtlich oder<br />
aber auch nur sinngemäß entnommen worden sind, sind mit einer Literaturangabe zu versehen.<br />
Die wörtliche Übernahme („Abschreiben“, „Abkupfern“) von ganzen Blöcken oder Kapiteln aus<br />
Büchern oder anderen Arbeiten ist formal korrekt, wenn die Literaturquelle eindeutig angegeben<br />
ist, und wenn sinnfällige Zusammenhänge unter Berücksichtigung der vorliegenden Aufgabenstellung<br />
dargelegt werden. Es besteht dabei jedoch die Gefahr, dass die fundierte inhaltlicheAufarbeitung<br />
der wissenschaftlich – technischen Zusammenhänge und damit das Verständnis dafür leidet.<br />
Als eigenständige wissenschaftlich – technische Leistung kann dies zudem nur begrenzt gewertet<br />
werden. Es ist daher Wert auf eigenständige Formulierungen und auch auf darauf aufbauende<br />
Folgerungen zu legen.<br />
Um nicht das Lesen der Arbeit durch umfangreiche Einschübe zu behindern, werden die zitierten<br />
Literaturstellen durchnummeriert und es wird jeweils nur die betreffende Ziffer eingeschoben.,<br />
z.B.: Die Zugfestigkeit <strong>des</strong> Werkstoffes beträgt nach [7] σ = 400MPa.<br />
Im Literaturverzeichnis werden sie zusammengefasst dargestellt.<br />
Der Zitierpflicht unterliegen: Gesetzestexte, wissenschaftliche Literatur, Verordnungen, Richtlinien,<br />
Kommentare, Statistiken und Berichte, Daten aus Unternehmen (z.B. Geschäftsbericht..., interne<br />
Anweisung xy ...S. 7).<br />
3<br />
Stand: 25.5.2010
Die Literaturangabe muss eindeutig sein, d.h., anhand der Angabe muss es dem Leser möglich<br />
sein, das zitierte Buch, die zitierte Fachzeitschrift usw. bei Bedarf zu beschaffen.<br />
Darüber hinaus können Fußnoten verwendet werden. Diese verweisen auf wörtliche Zitate und<br />
können auch Randbemerkungen <strong>des</strong> Verfassers, die sonst den gedanklichen Fluss der Arbeit stören<br />
würden, widergeben. Fußnoten können durch einen waagerechten Strich unterhalb <strong>des</strong> letzten<br />
Satzes der schriftlichen Ausführung gekennzeichnet werden.<br />
Wörtliche Zitate werden am Anfang und Ende durch doppelte Anführungszeichen hervorgehoben.<br />
Eine hochgestellte Zahl, weist auf die Quelle in der Fußnote hin. Bsp.: „Aufgabe der Allgemeinen<br />
Betriebswirtschaftslehre ist die Beschreibung und Erklärung der betrieblichen Erscheinungen und<br />
Probleme“ 1 .<br />
In der Fußnote oder dem Literaturverzeichnis stehen dann:<br />
1. Name <strong>des</strong> Verfassers,<br />
2. Vorname (Anfangsbuchstabe) <strong>des</strong> Verfassers,<br />
3. Titel,<br />
4. Auflage,<br />
5. Verlag,<br />
6. Erscheinungsort,<br />
7. Erscheinungsjahr<br />
8. Seitenangabe<br />
Literatur, die den Prüfern nicht zugänglich ist, wie z.B. Firmenbroschüren, muss der Arbeit beigefügt<br />
werden.<br />
Besonderheit bei Internet-Angaben: Angabe der Adresse (URL), wenn vorhanden Titel der Seite,<br />
Datum <strong>des</strong> Zugriffs (Download).<br />
Arbeiten ohne Zitate und ohne Verwendung von Fachliteratur führen dazu, dass die Arbeit nicht<br />
anerkannt (= mit „mangelhaft“ bewertet) wird!<br />
1 Wöhe, G., Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 17. Aufl., Verlag Vahlen, München 1990, S. 19<br />
4<br />
Stand: 25.5.2010
2.2 Das Literaturverzeichnis<br />
An dieser Stelle müssen alle Titel und Verfasser aufgeführt werden, die auch im Textteil der Arbeit<br />
zitiert wurden.<br />
Beispiel: Textausschnitt aus einem Fachaufsatz und Literaturliste zu dem <strong>Aufsatz</strong><br />
5<br />
Stand: 25.5.2010
Literaturempfehlung<br />
Poenicke, K./Wodke-Repplinger, I. (1977): Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten?, Bibliogr.<br />
Inst. Mannheim, Mannheim/Wien/Zürich 1977.<br />
Rückriem, G./Strary, J./Franck, D. (1989): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, Schöningh<br />
UTB, München 1989.<br />
Keller, G. (1989): Lern- und Arbeitstechniken für Studierende, Verlag K.-H. Bock, Bad Honnef<br />
1989.<br />
Anhangsverzeichnis<br />
Anlage 1: Beispiel für das Deckblatt<br />
Anlage 2: Beispiel für das Inhaltsverzeichnis<br />
Anlage 3: Beispiel für eine Erklärung<br />
(Die Anlagen sind gestalterisch natürlich nur Beispiele für ein mögliches Deckblatt oder ein Inhaltsverzeichnis,<br />
dies kann bei Ihnen ganz anders aussehen)<br />
6<br />
Stand: 25.5.2010
Anlage 1<br />
Formelle Anforderungen an das<br />
wissenschaftliche Arbeiten<br />
Referat im Rahmen <strong>des</strong> Seminars<br />
"Betriebliche Grundfunktionen"<br />
WS 1998/99<br />
Verbundstudiengang<br />
<strong>Technische</strong> Betriebswirtschaft<br />
Prof. Dr. Gerd Uhe<br />
Erwin Mustermann<br />
Matrikelnummer: 233456<br />
Musterstr. 2<br />
59800 Musterstadt<br />
Tel.-Nr. 02331/9999999<br />
Hagen, den 12.06.1998<br />
7<br />
Stand: 25.5.2010
Anlage 2<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
1. Formelle Anforderungen an das wissenschaftliche Referat _________________________ 1<br />
1.1 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit ____________________________________ 1<br />
1.2 Schreibtechnische Anforderungen ____________________________________________ 2<br />
1.3 Gliederung <strong>des</strong> Inhaltsverzeichnisses _________________________________________ 3<br />
2. Die Zitierweise in wissenschaftlichen Arbeiten ___________________________________ 3<br />
2.1 Die Bedeutung und Form <strong>des</strong> Zitats ___________________________________________ 3<br />
2.2 Das Literaturverzeichnis ____________________________________________________ 5<br />
3. Allgemeine Hinweise _________________________________________________________ 6<br />
Literaturempfehlung ___________________________________________________________ 6<br />
Anhangsverzeichnis ___________________________________________________________ 6<br />
8<br />
Stand: 25.5.2010
Anlage 3: Muster einer Erklärung<br />
Erklärung<br />
Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen<br />
Hilfsmittel benutzt habe. Die den benutzten Hilfsmitteln wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen<br />
habe ich unter Quellenangaben kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher<br />
Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.<br />
(Ort), den ................ .......................................<br />
(Unterschrift)<br />
9<br />
Stand: 25.5.2010


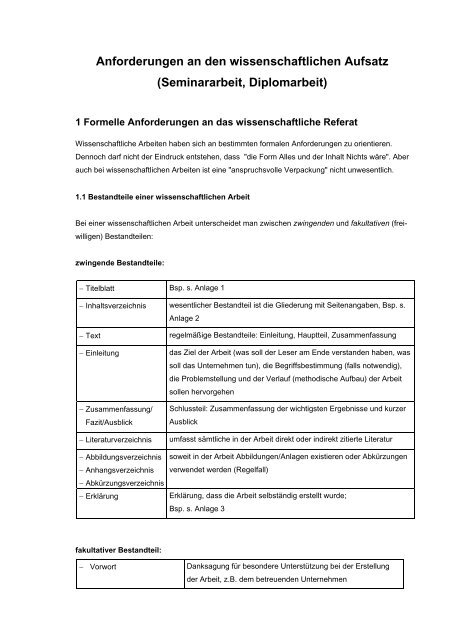






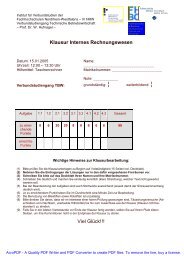

![Bilanzanalyse Druckvorlage.ppt [Schreibgeschützt]](https://img.yumpu.com/6737099/1/190x135/bilanzanalyse-druckvorlageppt-schreibgeschutzt.jpg?quality=85)




