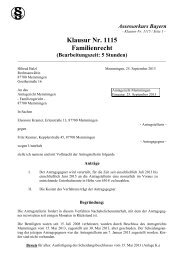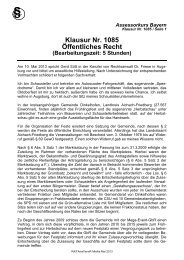1091_Loesung
1091_Loesung
1091_Loesung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Assessorkurs Bayern<br />
Klausur Nr. <strong>1091</strong> / Lösung Seite 3<br />
Eine Kündigungserklärung gegenüber der Beklagten<br />
zu 2 war dagegen nicht notwendig, da sie nicht Partei<br />
des Mietvertrags wurde. Diesen hat der Beklagte<br />
zu 1 alleine abgeschlossen, und die Beklagte zu 2<br />
als zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nichteheliche<br />
Lebensgefährtin war Dritte i.S.d. §§ 540, 553 I<br />
BGB. 9<br />
2. Im grds. maßgeblichen Zeitpunkt des Zugangs der<br />
Kündigung lag der Kündigungsgrund Eigenbedarf<br />
i.S.d. § 573 II Nr. 2 BGB vor.<br />
9<br />
Gemäß § 573 I BGB ist der Vermieter bei Wohnraum<br />
zur ordentlichen Kündigung berechtigt, wenn<br />
er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des<br />
Mietverhältnisses hat. Ein solches ist gemäß<br />
§ 573 II Nr. 2 BGB u.a. dann zu bejahen, wenn der<br />
Vermieter die Räume als Wohnung für seine Familienangehörigen<br />
benötigt.<br />
Der Kläger wollte mit der vermieteten Wohnung<br />
den Wohnbedarf seiner Mutter decken, die Familienangehöriger<br />
ist und diese Wohnung auch benötigte.<br />
Aufgrund der durch Art. 14 I 1 GG geschützten<br />
Freiheit des Eigentümers, sein Eigentum selbst<br />
zu nutzen, ist dessen Absicht, das Mietobjekt durch<br />
den in § 573 II Nr. 2 BGB privilegierten Personenkreis<br />
bewohnen zu lassen, im Falle eines Rechtsstreits<br />
von den Gerichten grds. zu akzeptieren.<br />
Dem steht vorliegend auch nicht die alleine mögliche,<br />
sich aus der Sozialbindung des Eigentum gemäß<br />
Art. 14 II GG ergebende Missbrauchskontrolle<br />
entgegen. Diese beschränkte gerichtliche Überprüfungsbefugnis<br />
bezieht sich lediglich auf die Fragen,<br />
ob der Eigennutzungswunsch überhaupt ernsthaft<br />
verfolgt wird und ob der Eigenbedarf sowohl bzgl.<br />
seiner Begründung (des „Warum“) als auch bzgl.<br />
Ausfüllung des Kündigungsgrundes auch noch im Prozess<br />
nachgeschoben werden (Pal./Weidenkaff § 573, RN 48).<br />
Liegt eine Mehrheit von Mietern (also nicht nur Mitnutzern!)<br />
vor, so ist nur ein einheitliches Verhalten von oder<br />
gegen alle möglich, § 425 BGB gilt hier also gerade nicht.<br />
Die Kündigung muss dann grds. an beide erklärt werden,<br />
sonst ist sie bereits formell unwirksam (Pal./Weidenkaff<br />
§ 542, RN 18; BGH NJW 2005, 1715). Dies gilt aber<br />
nicht für Dritte i.S.d. § 540 BGB, obwohl auch gegen solche<br />
Dritte ein Vollstreckungstitel erforderlich ist, für den<br />
dann der Anspruch aus § 546 II BGB ins Spiel gebracht<br />
werden muss (s.u.). Vorliegend kam es auch nicht auf die<br />
Streitfrage an, ob § 1357 BGB auf den Abschluss eines<br />
Mietvertrags anwendbar ist (richtigerweise abzulehnen,<br />
vgl. Pal./Brudermüller § 1357, RN 13), da die Beklagte<br />
zu 2 zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch gar nicht<br />
Ehefrau war.<br />
seines Umfangs (des „Wieviel“) vernünftig und<br />
nachvollziehbar ist. 10<br />
Am Selbstnutzungswille zu dem Zweck der erleichterten<br />
Betreuung der pflegebedürftigen Mutter kann<br />
vorliegend nicht gezweifelt werden, zumal deren<br />
Tod durch Herzversagen in näherer Zukunft nicht<br />
voraussehbar war.<br />
Auch liegt kein rechtsmissbräuchlich überzogener<br />
Wohnbedarf vor. Es ist grds. Sache des Vermieters,<br />
darüber zu entscheiden, welchen Raumbedarf er für<br />
sich oder seine Angehörigen als angemessen ansieht.<br />
11 Schädlich ist nur ein missbräuchlicher, weit<br />
überhöhter Wohnbedarf, doch kann davon bei einem<br />
Wohnraum von 75 qm für eine Einzelperson<br />
nicht die Rede sein. Hierbei muss zusätzlich berücksichtigt<br />
werden, dass es dem Kläger aufgrund der<br />
Rollstuhlabhängigkeit seiner Mutter gerade auf eine<br />
Erdgeschosswohnung ankam, und insoweit bestand<br />
gar keine alternative Möglichkeit innerhalb seines<br />
Eigentums.<br />
Hinweis: Der sog. Sozialwiderspruch des Mieters<br />
gemäß § 574 BGB wurde nicht vorgebracht und ist<br />
befristet (vgl. § 574b II BGB). Die Belange des<br />
Mieters und seiner Familie sind nicht im Rahmen<br />
des § 573 II BGB, sondern einzig über die §§ 574 ff<br />
BGB zu prüfen. 12<br />
3. Auch den Ablauf der Kündigungsfrist des § 573c I<br />
BGB zum Ende Februar 2013 hat der Kläger korrekt<br />
berechnet. 13<br />
Da die Kündigung am 26. November 2012 gemäß<br />
§ 130 I 1 BGB zuging, war auf den dritten Werktag<br />
des Folgemonats Dezember 2012 abzustellen, so<br />
dass der Ablauf des übernächsten Monats Februar<br />
2013 maßgeblich ist. Insbesondere lief das Mietverhältnis<br />
zu diesem Zeitpunkt noch keine fünf Jahre,<br />
so dass keine Verlängerung der Kündigungsfrist<br />
gemäß § 573c I 2 BGB einschlägig ist.<br />
4. Schließlich ist auch keine nachträgliche Unwirksamkeit<br />
der Kündigung wegen Wegfalls von Eigenbedarfs<br />
gegeben.<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
Zum Zeitpunkt des Todes der Mutter des Klägers<br />
am 4. Mai 2013 war das Mietverhältnis bereits für<br />
Vgl. BVerfG NJW 1988, 1075; 1990, 3259; BGH Z 103,<br />
91 [96]; Pal./Weidenkaff § 573, RN 28.<br />
Vgl. BGH Z 103, 91 [95].<br />
Vgl. etwa BGH Z 103, 91 [101].<br />
Dies sollte man vor dem Problem „Wegfall des Eigenbedarfs“<br />
prüfen, da dort die Kündigungsfrist eine ganz entscheidende<br />
Bedeutung bekommen wird (s.u.).<br />
© RA Ingo Gold / Juli 2013