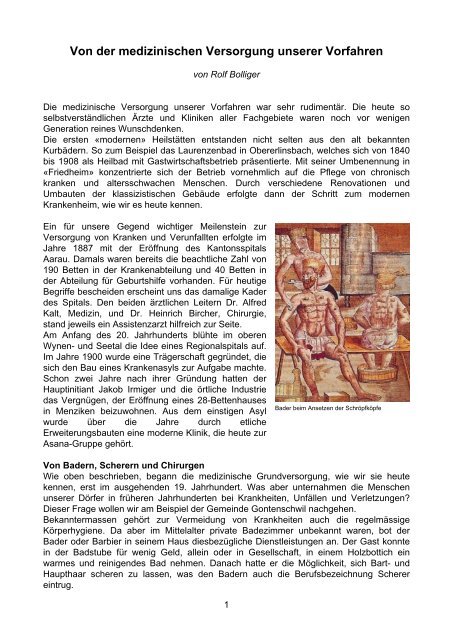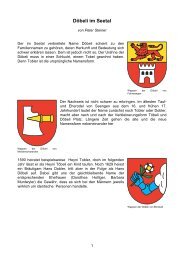Von der medizinischen Versorgung unserer Vorfahren - Historische ...
Von der medizinischen Versorgung unserer Vorfahren - Historische ...
Von der medizinischen Versorgung unserer Vorfahren - Historische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Von</strong> <strong>der</strong> <strong>medizinischen</strong> <strong>Versorgung</strong> <strong>unserer</strong> <strong>Vorfahren</strong><br />
von Rolf Bolliger<br />
Die medizinische <strong>Versorgung</strong> <strong>unserer</strong> <strong>Vorfahren</strong> war sehr rudimentär. Die heute so<br />
selbstverständlichen Ärzte und Kliniken aller Fachgebiete waren noch vor wenigen<br />
Generation reines Wunschdenken.<br />
Die ersten «mo<strong>der</strong>nen» Heilstätten entstanden nicht selten aus den alt bekannten<br />
Kurbä<strong>der</strong>n. So zum Beispiel das Laurenzenbad in Obererlinsbach, welches sich von 1840<br />
bis 1908 als Heilbad mit Gastwirtschaftsbetrieb präsentierte. Mit seiner Umbenennung in<br />
«Friedheim» konzentrierte sich <strong>der</strong> Betrieb vornehmlich auf die Pflege von chronisch<br />
kranken und altersschwachen Menschen. Durch verschiedene Renovationen und<br />
Umbauten <strong>der</strong> klassizistischen Gebäude erfolgte dann <strong>der</strong> Schritt zum mo<strong>der</strong>nen<br />
Krankenheim, wie wir es heute kennen.<br />
Ein für unsere Gegend wichtiger Meilenstein zur<br />
<strong>Versorgung</strong> von Kranken und Verunfallten erfolgte im<br />
Jahre 1887 mit <strong>der</strong> Eröffnung des Kantonsspitals<br />
Aarau. Damals waren bereits die beachtliche Zahl von<br />
190 Betten in <strong>der</strong> Krankenabteilung und 40 Betten in<br />
<strong>der</strong> Abteilung für Geburtshilfe vorhanden. Für heutige<br />
Begriffe bescheiden erscheint uns das damalige Ka<strong>der</strong><br />
des Spitals. Den beiden ärztlichen Leitern Dr. Alfred<br />
Kalt, Medizin, und Dr. Heinrich Bircher, Chirurgie,<br />
stand jeweils ein Assistenzarzt hilfreich zur Seite.<br />
Am Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts blühte im oberen<br />
Wynen- und Seetal die Idee eines Regionalspitals auf.<br />
Im Jahre 1900 wurde eine Trägerschaft gegründet, die<br />
sich den Bau eines Krankenasyls zur Aufgabe machte.<br />
Schon zwei Jahre nach ihrer Gründung hatten <strong>der</strong><br />
Hauptinitiant Jakob Irmiger und die örtliche Industrie<br />
das Vergnügen, <strong>der</strong> Eröffnung eines 28-Bettenhauses<br />
in Menziken beizuwohnen. Aus dem einstigen Asyl<br />
wurde über die Jahre durch etliche<br />
Erweiterungsbauten eine mo<strong>der</strong>ne Klinik, die heute zur<br />
Asana-Gruppe gehört.<br />
Ba<strong>der</strong> beim Ansetzen <strong>der</strong> Schröpfköpfe<br />
<strong>Von</strong> Ba<strong>der</strong>n, Scherern und Chirurgen<br />
Wie oben beschrieben, begann die medizinische Grundversorgung, wie wir sie heute<br />
kennen, erst im ausgehenden 19. Jahrhun<strong>der</strong>t. Was aber unternahmen die Menschen<br />
<strong>unserer</strong> Dörfer in früheren Jahrhun<strong>der</strong>ten bei Krankheiten, Unfällen und Verletzungen?<br />
Dieser Frage wollen wir am Beispiel <strong>der</strong> Gemeinde Gontenschwil nachgehen.<br />
Bekanntermassen gehört zur Vermeidung von Krankheiten auch die regelmässige<br />
Körperhygiene. Da aber im Mittelalter private Badezimmer unbekannt waren, bot <strong>der</strong><br />
Ba<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Barbier in seinem Haus diesbezügliche Dienstleistungen an. Der Gast konnte<br />
in <strong>der</strong> Badstube für wenig Geld, allein o<strong>der</strong> in Gesellschaft, in einem Holzbottich ein<br />
warmes und reinigendes Bad nehmen. Danach hatte er die Möglichkeit, sich Bart- und<br />
Haupthaar scheren zu lassen, was den Ba<strong>der</strong>n auch die Berufsbezeichnung Scherer<br />
eintrug.<br />
1
Den Beweis für die Existenz einer Badstube in Gontenschwil findet sich im Taufrodel des<br />
Jahres 1561. Dort werden erstmals Ruedi Bumann (Baumann) und seine Frau Margret<br />
von Mülinen genannt, die später eindeutig als Ba<strong>der</strong> bezeichnet werden. Ihr Beruf<br />
gereichte ihnen sogar fast zum Familiennamen, wurden sie doch öfters nur Ruedi und<br />
Margret Ba<strong>der</strong> genannt. <strong>Von</strong> den Nachkommen übernahm <strong>der</strong> Sohn Heinrich Beruf und<br />
Geschäft des Vaters. Mit Maria Hediger von Gontenschwil verehelicht, begegnet er uns<br />
1594 als «Heinricus Bumann <strong>der</strong> Ba<strong>der</strong>». Die Stätte seines Wirkens lag am Dorfbach im<br />
Kirchdorf. Das ehemalige «Ba<strong>der</strong>haus» unterhalb des Restaurant Waage wurde beim<br />
Ausbau <strong>der</strong> Dorfstrasse 1905 abgetragenen.<br />
Beinamputation um 1517<br />
Wie an<strong>der</strong>norts beschränkte sich vermutlich auch die<br />
Gontenschwiler Ba<strong>der</strong>familie Baumann nicht damit,<br />
ihre Kunden zu waschen und zu frisieren. Das<br />
Angebot umfasste in aller Regel auch die kleine o<strong>der</strong><br />
nie<strong>der</strong>e Chirurgie. Das heisst, dem leidenden Kunden<br />
wurden bei Bedarf eingewachsene Nägel<br />
ausgeschnitten, Hühneraugen entfernt und Abszesse<br />
geöffnet. Es wurden faule Zähne gezogen,<br />
Schröpfköpfe angesetzt o<strong>der</strong> zur Anregung des<br />
Kreislaufs zur A<strong>der</strong> gelassen. Auch das Einrenken von<br />
Gelenken und die <strong>Versorgung</strong> von Knochenbrüchen<br />
gehörte zu den Aufgaben eines Scherers. Mutige und<br />
geübte Wundärzte führten gar Starstiche, Blasensteinund<br />
Bruchoperationen durch. Ba<strong>der</strong> und Scherer<br />
erwarben sich mit <strong>der</strong> Zeit gute Kenntnisse und<br />
Fertigkeiten im Umgang mit chirurgischen<br />
Instrumenten. Ihr Können war beson<strong>der</strong>s in<br />
Kriegszeiten gefragt, wo sie als sogenannte<br />
Feldscherer unentbehrlich waren. Dort wurden zur<br />
Hauptsache Schuss und Stichverletzungen behandelt<br />
und Amputationen vorgenommen. Auf diese Weise<br />
avancierten die Scherer zu eigentlichen Wundärzten<br />
und Chirurgen.<br />
Zum Schutz ihres Berufsstandes vor Pfuschern und Scharlatanen und zur Sicherstellung<br />
ihrer qualitativ guten Arbeit wurden vornehmlich in den Städten Verbände mit<br />
Berufsordnungen gegründet, die so genannten «Schärer Societäten».<br />
Gänzlich getrennt von diesen handwerklichen Ärzten standen die akademischen<br />
Mediziner. Diese Trennung war durch einen Beschluss des IV. Laterankonzils bereits im<br />
Jahre 1215 erfolgt. Dadurch wurde die Chirurgie als min<strong>der</strong>e Medizin von den<br />
Universitäten ausgeschlossen. Die damals überwiegend klerikalen Ärzte konnten es mit<br />
ihrem Gewissen nicht vereinbaren, dass chirurgische Eingriffe oft zum Tod des Patienten<br />
führten. Die Verantwortung für diese Behandlungen wurde somit in die Hände <strong>der</strong> Ba<strong>der</strong><br />
und Scherer gelegt. Diese Trennung führte häufig zu gegenseitigen Vorwürfen <strong>der</strong><br />
Quacksalberei, denn die Ba<strong>der</strong> scheuten sich nicht, den gelehrten Herren Ärzten in die<br />
Kur zu pfuschen.<br />
Die Schererfamilie Rupp<br />
Der Familie Baumann gehörte das Haus mit Badstube im Kirchdorf bis zur Enkel-<br />
Generation. Im Jahre 1661 kaufte Hans Rupp, seines Zeichens Scherer von Seon, einen<br />
2
Anteil <strong>der</strong> Badstube. Zweifellos übte er dort sein medizinisches Handwerk aus. Rupp<br />
stammte aus einer grossen Scherer Dynastie <strong>der</strong>en Mitglie<strong>der</strong> in Seon, Reinach,<br />
Schöftland und Aarburg praktizierten. Hans Rupps gleichnamiger Sohn, <strong>der</strong> in<br />
Gontenschwil «Schärhansli» genannt wurde, konnte seinen Arbeitsbereich ausbauen,<br />
indem er 1677 einen weiteren Anteil <strong>der</strong> Badstube erwarb.<br />
Wie weit die Entdeckung <strong>der</strong> Heilquelle im Schwarzenberg um 1640 die damalige<br />
Gontenschwiler Bevölkerung beeinflusste und zum «Gesundbaden» animierte, ist nicht<br />
überliefert. Das heilversprechende Wasser wurde, wie es scheint, vor allem getrunken.<br />
<strong>Von</strong> einer Badeeinrichtung vernehmen wir erst im ausgehenden 18. Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
Schärhansli Rupp starb im Jahr 1717. <strong>Von</strong> seinen Nachkommen scheint keiner das<br />
Schererhandwerk weitergeführt zu haben. Die Badstube mit ihrer gesamten Ausstattung<br />
gelangte 1729 in den Besitz von Sebastian Giger. Ob er den Betrieb weiter aufrecht hielt,<br />
ist nicht bekannt.<br />
<strong>Von</strong> einem Scherer in Gontenschwil hören wir erst wie<strong>der</strong> 1736, als Daniel Rupp, <strong>der</strong><br />
«Schärer», einen Anteil am alten Schulhauses im Kirchdorf erwirbt. Daniel Rupp war mit<br />
seinen namensgleichen Vorgängern nicht näher verwandt. Er stammte zwar von Seon,<br />
war aber in Reinach aufgewachsen. Mit seiner Ehefrau Maria Giger übte Rupp zehn Jahre<br />
in Gontenschwil sein Handwerk aus und zog dann, wie es in einer Quelle heisst, in seine<br />
Heimat. Sehr zum Leidwesen <strong>der</strong> Gontenschwiler Bevölkerung, die sich nun zur<br />
Behandlung ihrer Gebresten an<strong>der</strong>swo Hilfe suchen musste.<br />
Der Fall Schobinger<br />
Einen Hoffnungsschimmer sah die Oberwynentaler<br />
Gemeinde aufkeimen, als sich 1752 Jakob<br />
Schobinger dort nie<strong>der</strong>liess. Der von St. Gallen<br />
stammende Chirurg war zuvor in Bern an<br />
verschiedenen Orten als Scherer in Stellung<br />
gewesenen. Offensichtlich verstand er sein<br />
Handwerk so gut, dass er bald über Gontenschwils<br />
Dorfgrenzen hinaus bekannt war und grossen Zulauf<br />
an Kunden hatte. Sein Ruf drang bis in die Städte<br />
Aarau, Lenzburg und Baden, von wo bald<br />
missgünstige Berufsgenossen gegen ihn<br />
opponierten. Die Gemeinden Gontenschwil und<br />
Zetzwil fühlten sich dadurch veranlasst, mittels einer<br />
Bittschrift an den Landvogt ihren Scherer als<br />
Hintersäss aufzunehmen und obrigkeitlich zu<br />
legalisieren («...dem Schobinger zum Trost dieser<br />
beyden und nächsteren Gemeinden die<br />
hochoberkeitliche Erlaubnus und Bewilligung zu<br />
erteilen, seine Kunst dahier zu treiben».)<br />
Wundarzt mit Instrumenten<br />
Neben den verschiedenen «glücklichen Curen», welche Schobinger bei ihnen und in <strong>der</strong><br />
Nachbarschaft durchgeführt habe, fügten die Bittsteller als Hauptargument die weite<br />
Entfernung zum nächsten Arzt an. Obwohl ihre Gemeinden zahlreich an Haushaltungen<br />
seien, müssten sie bei Unfällen bis zu drei Stunden nach einem Scherer schicken, o<strong>der</strong> in<br />
<strong>der</strong> Not sogar den Scherer vom luzernischen Pfeffikon bemühen. Unterzeichnet wurde die<br />
Bittschrift von den Pfarrern, Gerichtsuntervögten, Statthaltern und Chorrichtern <strong>der</strong><br />
Gemeinden Gontenschwil, Zetzwil und Reinach. Gesellschaftlicher Stand und Anzahl <strong>der</strong><br />
Unterzeichnenden unterstreicht, wie wichtig und unterstützungswürdig ihr Anliegen war.<br />
3
Aber auch die Herren <strong>der</strong> städtischen Scherer-Societät machten ihren Einfluss beim<br />
Landvogt geltend, und das Gesuch wurde am 2. April 1753 abgewiesen. <strong>Von</strong> Jakob<br />
Schobinger hören wir nichts mehr, er scheint weiter gezogen zu sein an einen Ort, wo<br />
seine Kunst geduldet war. Der ärztelose Zustand im oberen Wynental währte bis 1768, als<br />
<strong>der</strong> Chirurg Hans Heinrich Suter in Reinach sesshaft wurde.<br />
Vom Chirurgus zum akademischen Mediziner<br />
Einige Jahre später brachte Gontenschwil mit Christian Hunziker (1744-1804) einen<br />
eigenen Scherer hervor. Er war mit Maria Rupp verehelicht, die möglicherweise aus <strong>der</strong><br />
gleichnamigen Schererdynastie stammte. Das Ehepaar wohnte im Unterdorf (heute Ecke<br />
Bachstrasse-Steingasse) in Hunzikers Elternhaus, das seit 1686 in Familienbesitz war.<br />
Christian Hunziker wird verschiedene Male als Chirurgus o<strong>der</strong> Wundarzt bezeichnet. Er<br />
schein also eine richtige Ausbildung genossen zu haben.<br />
Der erste akademisch gebildete Doktor <strong>der</strong> Medizin kam im Dezember des Jahres 1903<br />
nach Gontenschwil. Dr. Carl Hassler (1876-1956), ein Sohn des Seenger Pfarrers Karl<br />
Jakob Hassler, hatte in Lausanne und Berlin studiert und war als Assistenzarzt am<br />
Kantonspital Aarau gewesen. Seine Privatpraxis richtete Dr. Hassler bei <strong>der</strong> Papierfabrik<br />
Frey & Wie<strong>der</strong>kehr im Kirchdorf ein; die Apotheke befand sich aber in einem Zimmer des<br />
Gasthofs Löwen. Eine Tuberkulose-Erkrankung zwang Carl Hassler 1906, seine Praxis für<br />
zwei Jahre zu schliessen. In dieser Zeit wurden die Gontenschwiler durch Dr. Berger von<br />
Reinach betreut.<br />
Zahnreissen<br />
Nach überstandener Krankheit konnte<br />
Carl Hassler 1912 ein geeignetes<br />
Wohnhaus in <strong>der</strong> Nähe des Bahnhofes<br />
kaufen, wo er in den folgenden 40<br />
Jahren seine Arztpraxis führte. Seine<br />
Hausbesuche besorgte Dr. Hassler mit<br />
Pferd und Wagen. Später pilotierte er<br />
eines <strong>der</strong> ersten Automobile im Dorf.<br />
Ältere Personen wissen noch aus<br />
eigener Erfahrung zu berichten, wie er<br />
kleine medizinische Eingriffe, ganz<br />
unzimperlich ohne Narkose durchführte.<br />
Dr. Carl Hassler und später sein Sohn<br />
Dr. Alfred Hassler waren für<br />
Generationen von Gontenschwilern die<br />
erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen<br />
Beschwerden und eine eigentliche<br />
Institution im Dorf.<br />
Quellen<br />
• Staatsarchiv Aargau AA 805 (Fall Schobinger)<br />
• Staatsarchiv Aargau, Depositum Gontenschwil, Gerichtsmanuale 1660-1815<br />
• Steiner/Bolliger, CD Kirchenbücher Gontenschwil<br />
• Jubiläumsschrift <strong>der</strong> Vereinigung Aargauischer Krankenhäuser VAKA, Aarau 1992<br />
4