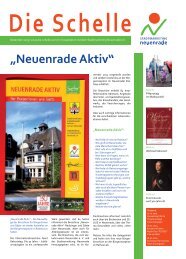August - die schelle
August - die schelle
August - die schelle
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Schelle<br />
Der Hexerei beschuldigt und zum Tode verurteilt<br />
– Das erschütternde Schicksal der Affelner Bürgermeisterfamilie Brune –<br />
von<br />
Dr. Rolf Dieter Kohl<br />
4<br />
B<br />
ereits im 12. und 13. Jahrhundert<br />
– zur Zeit der Grafen von<br />
Arnsberg – spielte Affeln als verwaltungsmäßiger<br />
und kirchlicher<br />
Zentralort, aber auch als Sitz eines<br />
gleichnamigen Adelsgeschlechts<br />
eine nicht unbedeutende Rolle. Am<br />
28. April 1492 erhob Erzbischof Hermann<br />
IV. von Köln den – wie zu vermuten<br />
steht – wirtschaftlich blühenden<br />
Ort in den Rang einer „ Freiheit“,<br />
wodurch das hart an der Grenze<br />
zur Grafschaft Mark gelegene und<br />
damit vielerlei Belastungen ausgesetzte<br />
alte Kirchdorf aus seinem<br />
ländlichen Umfeld herausgehoben<br />
wurde und kommunale Selbstverwaltungsrechte<br />
erhielt. Fortan war<br />
der durch Bürgermeister und Rat repräsentierte<br />
Ort Mitglied in der von<br />
Brilon angeführten, 34 Kommunen<br />
umfassenden Städtekurie des Herzogtums<br />
Westfalen und nahm dort<br />
– gefolgt von Bödefeld, Hachen,<br />
Langscheid und Hagen – den 30.<br />
Platz ein.<br />
Zu dem offenkundig kleinen Kreis<br />
der nunmehrigen Bürger, <strong>die</strong> zur<br />
Zeit der Stadterhebung und in den<br />
darauffolgenden 50 Jahren <strong>die</strong> Geschichte<br />
Affelns bestimmten, gehörten<br />
– wie wir aus zahlreichen<br />
urkundlichen Belegen wissen – <strong>die</strong><br />
Familien Wigger und Schmied<br />
( Schmidt). Bereits 1466 – anläßlich<br />
der Errichtung eines Benefiziums<br />
für <strong>die</strong> an der Affelner Pfarrkirche<br />
wenige Jahre zuvor eingerichtete Vikarie<br />
St. Antonius und St. Magdalena<br />
– wird als Zeuge ein Bürgermeister<br />
(proconsul) Johannes Wigger<br />
genannt, eine Nachricht , aus der<br />
Dieter Stievermann schließt, dass<br />
Affeln „ gewisse Selbstverwaltungsrechte…<br />
wohl schon vor der förmlichen<br />
Freiheitserhebung von 1492“<br />
ausgeübt haben müsse.<br />
Auch in der Folgezeit treten <strong>die</strong> Wigger<br />
wiederholt in führender Position<br />
in Erscheinung. Zwischen 1509<br />
und 1536 bekleidete Thöniß Wigger<br />
(Wygger) das einflussreiche Amt<br />
des kurkölnischen Richters in Affeln<br />
und für 1506 ist Bernhard Wygger<br />
– neben Rotger Smet – als Bürgermeister<br />
der Freiheit nachzuweisen.<br />
Bereits 1489 war <strong>die</strong> Familie, <strong>die</strong><br />
sich offenkundig kaufmännisch<br />
betätigte und wohl intensive Handelsbeziehungen<br />
zum Hansevorort<br />
Soest unterhielt, im Affelner Raum<br />
reich begütert und dürfte demnach<br />
in ausgezeichneten wirtschaftlichen<br />
Verhältnissen gelebt haben.<br />
Ein der „Hexerei“ Verdächtigter wird vom Schafrichter auf seine „peinliche“ Befragung vorbereitet.<br />
Holzschnitt um 1500.<br />
Auch <strong>die</strong> Familie Schmidt<br />
( Schmied, Smyt, Smet, Smede o.ä.)<br />
zählte – wie bereits bemerkt – zur<br />
Führungsschicht der Affelner Bevölkerung<br />
und zeichnete sich – vielleicht<br />
in noch größerem Maße als<br />
<strong>die</strong> Wigger – durch eine beeindruckende<br />
soziale Vorrangstellung aus.<br />
1461 ist Bernhard Smet als Affelner<br />
Richter bezeugt; in der gleichen<br />
Stellung finden wir zwischen 1487<br />
und 1489 Johann Smyt (Smede).<br />
1506 und 1509 saß Rotger Smet auf<br />
dem Bürgermeisterstuhl der „ Freiheit“<br />
und 1522 wurde Johann Smyt<br />
in das höchste und wichtigste Amt<br />
des sauerländischen Städtchens berufen.<br />
Auffälligerweise treten – ohne dass<br />
dafür konkrete Gründe ersichtlich<br />
würden – sowohl <strong>die</strong> Wigger als auch<br />
<strong>die</strong> Schmid spätestens seit der 2.<br />
Hälfte des 16. Jahrhunderts wieder<br />
in den Hintergrund, ja sie verschwinden<br />
geradezu aus dem öffentlichen<br />
Leben Affelns. Ihre Stelle nehmen<br />
<strong>die</strong> Habbel, <strong>die</strong> Helwig und <strong>die</strong> Duwenheuer<br />
ein, <strong>die</strong> zwischen 1536<br />
und 1550 wichtige Ämter besetzten<br />
und mehrfach auch <strong>die</strong> Bürgermeisterwürde<br />
erringen konnten.<br />
Zu den sozial aufsteigenden Familien<br />
<strong>die</strong>ser Zeit gehörten nicht zuletzt<br />
auch <strong>die</strong> Brune (Braun, Braune), als<br />
deren bedeutendste Vertreter der<br />
zwischen 1554 und 1575 regierende<br />
Bürgermeister Tonis (Anton) Brune<br />
und dessen mutmaßlicher jüngerer<br />
Bruder, der von 1558-1565 an der<br />
Antonius-Vikarie tätige Geistliche<br />
Georg Brune genannt werden müssen.<br />
Die Brune waren ausgesprochen<br />
wohlhabend, betätigten sich<br />
erfolgreich als private Geldverleiher<br />
und besaßen mindestens seit der<br />
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts<br />
ein nach ihnen benanntes, im östlichen<br />
Teil der „Freiheit“ gelegenes<br />
Gut, das an Umfang und Ausstattung<br />
alle anderen Anwesen des Ortes<br />
weit übertraf. Gegen Ende des<br />
16. Jahrhunderts traf <strong>die</strong> Familie<br />
ein fürchterlicher Schicksalsschlag.<br />
1596 wurde Jorgen Snyder gen. Brune,<br />
der Schwiegersohn des zuvor<br />
genannten Bürgermeisters Tonis<br />
Brune, im Zuge der ersten großen<br />
Hexenverfolgungswelle, <strong>die</strong> in <strong>die</strong>sen<br />
Jahren das Herzogtum Westfalen<br />
beunruhigte, der Zauberei bezichtigt<br />
und gemeinsam mit seiner<br />
Frau nach einem mehrmonatigen<br />
Prozess dem Balver Henker überantwortet.<br />
Erstaunlicherweise jedoch scheint<br />
<strong>die</strong>ser Vorfall das Ansehen der Familie<br />
kaum geschmälert zu haben.<br />
Bereits 1613 wählten <strong>die</strong> Affelner<br />
Bürger den älteren Sohn der Hingerichteten,<br />
Johann Brune, zum<br />
Bürgermeister ihrer Stadt; in <strong>die</strong>ser<br />
Funktion lässt er sich ebenfalls für<br />
<strong>die</strong> Jahre 1615, 1619, 1623, 1624, 1627<br />
und 1628 belegen. Doch damit nicht<br />
genug! Ein weiterer Sohn, Georg,<br />
wurde – ungeachtet, dass „sein Vater<br />
und seine Mutter als Zauberer…<br />
justifiziert und verbrannt (worden)<br />
seien“ – 1610 von der Patronatsfamilie<br />
v. Hatzfeld mit dem Amt des Ortsgeistlichen<br />
und Kirchspielpfarrers<br />
betraut; er wird als „würdiger und<br />
ver<strong>die</strong>nter Mann“ beschrieben, der<br />
– gemeinsam mit seinem Bruder –<br />
zahlreiche mildtätige und karitative<br />
Stiftungen tätigte.<br />
Im Frühjahr 1629 wiederholte sich,<br />
was bereits den Eltern der beiden<br />
widerfahren war. Georg und Johann<br />
Brune, aber auch ihre Schwester, gerieten<br />
– unter nicht bekannten Umständen<br />
– in den Verdacht der Zauberei.<br />
Während Georg Brune und<br />
seine Schwester sich dem Zugriff<br />
der Häscher durch Flucht entziehen<br />
konnten, wurde Johann Brune<br />
verhaftet und endete – allem Anschein<br />
nach – auf der Balver Richtstätte.<br />
Nach <strong>die</strong>ser Tragö<strong>die</strong> war<br />
der Niedergang der Familie Brune<br />
endgültig besiegelt! Sie verlor jeglichen<br />
politischen Einfluss und auch<br />
in wirtschaftlicher Hinsicht ging es<br />
unaufhaltsam bergab; das einst<br />
größte und reichste Gut der „Freiheit“<br />
wurde im Laufe der Zeit mehrfach<br />
geteilt und parzelliert. Noch<br />
in den 40er Jahren bemühten sich<br />
Anverwandte und Nachkommen<br />
des toten Bürgermeisters bei den<br />
kölnischen Justizbehörden um eine<br />
Rehabilitierung der Geächteten –<br />
freilich ohne jeden Erfolg! Auch der<br />
um Vermittlung gebetene, seit 1629<br />
amtierende Affelner Pfarrer Johannes<br />
Kemper gen. Elias, der Nachfolger<br />
seines geflohenen Amtsbruders,<br />
weigerte sich den Schuldspruch des<br />
Balver Hexentribunals in Frage zu<br />
stellen und wies alle an ihn gerichteten<br />
Hilfegesuche der Familie Brune<br />
als unberechtigt zurück.<br />
In der Folgezeit wird der Name Brune<br />
in der schriftlichen Überlieferung<br />
Affelns nicht mehr erwähnt, so dass<br />
man davon ausgehen kann, dass<br />
<strong>die</strong> Familie ihren angestammten<br />
Wohnsitz für immer verlassen hat.<br />
Das „Brunengut“ wurde parzelliert<br />
und geriet in fremde Hände; ein Güterverzeichnis<br />
aus dem Jahre 1699<br />
beziffert den Wert der Gebäude und<br />
Ländereien auf 2.688 Reichstaler,<br />
dem allerdings 2.090 Reichstaler an<br />
Schulden gegenüberstanden.<br />
Archive und Literatur<br />
Rolf Dieter Kohl: „ dei ersamer burgermester<br />
Tonis Bruine“. Zur Geschichte<br />
der Affelner Honoratiorenfamile Brune<br />
(Braune, Braun) im 16. und 17. Jahrhundert,<br />
in: Der Märker, Jg. 48, 1999, S.118-<br />
119. – Dort ausführliche Angaben über<br />
benutzte Archive und Literatur.