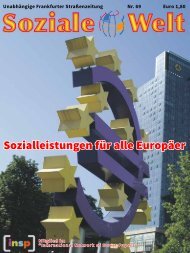Nr. 43 - Soziale Welt
Nr. 43 - Soziale Welt
Nr. 43 - Soziale Welt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4 FUSSBALL<br />
„Keiner verliert ungern“<br />
Fußball zwischen Leidenschaft, Kontrolle<br />
und banalem Tiefsinn<br />
„Linker“ und „rechter“ Fußball<br />
Über Größenphantasien, symbolische Konflikte und politische Okkupation einer populären Sportart<br />
Prof. Dr. Titus Simon<br />
Auch wenn bei aktuellen Betrachtungen<br />
des Phänomens Fußball immer mehr<br />
dessen Rolle als Wirtschaftsfaktor und<br />
eine zunehmende Entfremdung von<br />
seinen Wurzeln – worunter sehr Unterschiedliches<br />
verstanden werden kann<br />
– betont werden, sind dessen prägende<br />
Eigenschaften auf gesamtkulturelle Phänomene<br />
unstrittig. Fußball wirkt in Lebensbereiche<br />
hinein, in denen er wirklich<br />
nichts zu suchen hat. In dem Teil der<br />
Sprache, der in besonderer Weise mediale<br />
Beachtung und Verbreitung findet, macht<br />
sich eine deutliche „Fußballerisierung“<br />
breit, was ganz besonders für Politikerreden<br />
gilt, in die gerne zentrale Begriffe<br />
des Fußballs und der Fußballberichterstattung<br />
aufgenommen werden. Im<br />
Landtagswahlkampf 2006 warb die CDU<br />
Sachsen-Anhalt am häufigsten mit dem<br />
Slogan: „Wir bleiben am Ball“. Abgebildet<br />
war neben dem Schriftzug ein Lederball,<br />
der dem ähnelte, der 1954 in Bern<br />
getreten wurde. Und seit die deutschen<br />
Intellektuellen in den 1970er-Jahren den<br />
Fußball, dem sie bis dahin mehrheitlich<br />
ignorierend oder entschieden ablehnend<br />
gegenüberstanden, zumindest als Objekt<br />
skurriler Deutungen entdeckt haben,<br />
werden wir mit immer neuen Versuchen<br />
konfrontiert, den Fußball als Projektionsfläche<br />
für gesellschaftspolitische Fantasien<br />
oder gar als Abbild für alte und neue<br />
Klassenantagonismen zu benutzen.<br />
Bei einer analytischen Betrachtung des<br />
sozialen Phänomens Fußball können wenigstens<br />
fünf Herangehensweisen gewählt<br />
werden.<br />
Zum einen sind die objektiven Tatsachen,<br />
die realen Verhältnisse im Fußballgeschäft<br />
zu betrachten. Fußball ist ein Riesengeschäft<br />
geworden, in dem alle Entscheidungen<br />
- von der Vermarktung des Stadionnamens<br />
über das Transfergeschäft<br />
und das Merchandising bis hin zur medialen<br />
Inszenierung und den darin enthaltenen<br />
ökonomischen Dimensionen – im<br />
strengen Sinne den Regeln des Marktes<br />
unterworfen sind. Dieses Geschäft wird<br />
von Kaufleuten dominiert, unter denen<br />
es natürlich erfolgreiche und weniger erfolgreiche<br />
gibt, uns sie bleiben auch dann<br />
Kaufleute, wenn sie bei Aufstiegs- oder<br />
Meisterschaftsfeiern einen Fanschal über<br />
den Boss-Anzug legen. Die Gesetze des<br />
Marktes bestimmen alles. Selbst der Kultund<br />
Kiezclub FC St.Pauli muss im nationalen<br />
Pokalwettbewerb seine Auflaufhymne<br />
„Hells Bells“ auf eine Kurzfassung reduzieren<br />
– weil das Fernsehen, die Sponsoren<br />
und der Deutsche Fußballbund (DFB) es<br />
so wollen.<br />
In dem Maße, wie Fußball Attraktivität<br />
gewann und zu einem Massenphänomen<br />
heranwuchs, wurden Versuche unternommen,<br />
Fußball für politische Ziele und Zwecke<br />
zu instrumentalisieren. Diese Tradition<br />
wurde bereits im italienischen Faschismus<br />
der 1920er und 1939er Jahre begründet.<br />
Noch ehe sich das Konzept einer linken<br />
Hegemonie der Alltagskultur ausbreiten<br />
konnte – Antonio Gramsci entwickelte<br />
hierzu elementare Wesenszüge erst in den<br />
faschistischen Gefängnissen – eroberte die<br />
siegreiche Rechte erfolgreich die Orte der<br />
Volkskultur, zu denen in Italien bereits<br />
früh das Fußballgeschehen gehörte. Die<br />
faschistische Bewegung okkupierte Lazio<br />
Rom, was bis heute in deren Faninszenierungen<br />
fortwirkt, und erprobte am Beispiel<br />
des vormals linken Arbeitervereins<br />
AC Bologna den erfolgreichen Umbau zu<br />
einem stramm faschistisch ausgerichteten<br />
Fußballclub, der – wie in Deutschland der<br />
FC Schalke 04 – seine größten Erfolge<br />
als gleichgeschalteter Verein während des<br />
Faschismus erzielte. Die Instrumentalisierung<br />
für den NS-Staat hat der deutsche<br />
Fußball vor allem als Gleichschaltung und<br />
der Zerstörung der Kultur der Arbeitersportbewegung<br />
innerhalb und außerhalb<br />
des Fußballes erlebt. Der Fußball wurde<br />
aber nicht wie in Italien und auch in Spanien<br />
zu einem herausgehobenen Manipulationsinstrument.<br />
Während italienische<br />
Faschisten in ihrer Leidenschaft für den<br />
Fußball durchaus authentisch waren –<br />
Mussolini besuchte regelmäßig Spiele von<br />
Lazio Rom – hatten die führenden Köpfe<br />
der NSDAP keine ausgeprägte Affinität zu<br />
dieser Sportart. Dies unterschied den Fußball<br />
vom Film, der anderen aufstrebenden<br />
Massenkultur der Dreißigerjahre des letzten<br />
Jahrhunderts. Hinzu kam der Umstand<br />
dass der deutsche Fußball weder 1936 bei<br />
den Olympischen Spielen in Berlin noch<br />
1938 bei der <strong>Welt</strong>meisterschaft in Italien<br />
besonders erfolgreich war und sich zudem<br />
die Hoffnung zerschlug, dass nach dem<br />
„Anschluss“ Österreichs eine Kombination<br />
deutscher und österreichischer Spielkultur<br />
zur „Unbesiegbarkeit“ führen würde. Dieser<br />
gewaltsamen und radikalen politischen<br />
Okkupation hat Silvio Berlusconi in den<br />
letzten 20 Jahren ein neues Gesicht gegeben.<br />
Nachfaschistische Ideologie wurde<br />
gepaart mit gewaltiger Kampfkraft und<br />
zunehmender Medienkontrolle.<br />
Hiervon zu unterschieden ist die meist<br />
emotional unterlegte Bündelung politisch<br />
eingefärbter Projektionen, die sich innerhalb<br />
der Fangemeinden entwickeln können.<br />
Diese knüpfen meist an die Antagonismen<br />
früherer Klassenkämpfe an, wobei<br />
die Ausdrucksformen der linken wie der<br />
rechten Fankultur tradierte Symboliken<br />
mit höchst aktuellen Themenstellungen<br />
und modernen Choreografien mischen<br />
können.<br />
Eine vierte Dimension besteht in der Allgegenwärtigkeit<br />
des Fußballgeschehens,<br />
der Kritiker wohl zu Recht ein erhebliches<br />
Manipulationspotenzial zuschreiben.<br />
Die moderne Variation von „Brot und<br />
Spiele(n)“ ist in unserem Kulturraum eng<br />
mit dem Fußballgeschehen verbunden.<br />
Geht man aber den Folgen dieser in der<br />
Tat vorhandenen Omnipräsenz stärker<br />
nach, so wird keineswegs ein geschlossenes<br />
System manipulativer Mechanismen und<br />
Wirkungen sichtbar. Die Dominanz des<br />
Fußballs in der öffentlichen Berichterstattung<br />
hat ambivalente Folgen. Zum einen<br />
kann sehr wohl bei einem bestimmten Teil<br />
der RezipientInnen davon ausgegangen<br />
werden, dass sie der Fußball davon abhält,<br />
sich anderen wichtigen gesellschaftlichen<br />
Angelegenheiten und Konflikten<br />
in einer Weise zuzuwenden, die sogar bis<br />
zur aktiven Einmischung in das politische<br />
Geschehen führen könnte. Auf der anderen<br />
Seite führt die Überbetonung der<br />
Bedeutung des Fußballgeschehens zu zunehmenden<br />
Unmutsbekundungen derer,<br />
die als KonsumentInnen den Mehrwert<br />
produzieren sollen. Selbst eingefleischten<br />
Fußballfans missfällt, dass Banalitäten aus<br />
dem Fußballgeschehen zunehmend auf<br />
den Titelseiten seriöser Tageszeitungen<br />
platziert werden. Die in der Regel als unumkehrbar<br />
wahrgenommene Ökonomisierung<br />
des Fußballs erfährt gelegentlich<br />
Grenzen, löst kritische Diskurse aus, die<br />
auch auf andere politische Themenstellungen<br />
überspringen können.<br />
Noch stärker als die bislang genannten<br />
Aspekte wirken in unserem Kulturraum<br />
heute jene sozialen Dimensionen, die dem<br />
Spiel eigentümlich sind. Spannungsaufbau<br />
und Spannungsabfuhr sind ebenso möglich<br />
wie das Erleben von Erwartung, Hoffnung,<br />
Freude und Enttäuschung. Zu streiten<br />
wäre hier lediglich darüber, ob es sich<br />
dabei um authentische Gefühlswelten oder<br />
um „Emotionen aus der Dose“ handelt.<br />
In diesem Zusammenhang gehören auch<br />
jene identitätsbildenden Projektionen, die<br />
sich aus dem sozialpsychologisch begründeten<br />
Phänomen der Suche nach einem<br />
„Größenselbst“ ergeben.<br />
Fußball als Objekt kultureller Hegemonieversuche<br />
and als Projektionsfläche für<br />
Imaginationen<br />
Die Redaktion meint:<br />
Während diese Zeitung zum Verkauf<br />
auf der Strasse ist, fiebert eine ganze<br />
Nation mit der schönsten Nebensache<br />
der <strong>Welt</strong>. König Fußball regiert und<br />
hält Hof in Deutschland – und alle<br />
Nationen kommen, 48 davon zum<br />
Spiel um die <strong>Welt</strong>meisterschaft und<br />
eine ziemlich missgestaltete Trophäe,<br />
der Rest einzeln oder in kleinen Gruppen<br />
zum Zuschauen als – hoffentlich<br />
– ziemlich willkommener Tourist in<br />
Sachen Kicken und Tore treffen.<br />
Diese <strong>Welt</strong>meisterschaft, für viele von<br />
uns die letzte in Deutschland, die wir<br />
wohl in unserem Leben sehen werden,<br />
ist geeignet, sich die Fülle dessen, was<br />
international unter Fußball gesehen<br />
wird und gespielt wird, vor Augen zu<br />
führen.<br />
In vielen Ländern der Entwicklungsstaaten<br />
und der Dritten <strong>Welt</strong> hat Fußball<br />
noch heute eine Funktion, die er<br />
einstmals auch in Deutschland hatte:<br />
Aus einem schuhlosen, in Lumpen<br />
gehüllten kleinen Buben einen internationalen<br />
Star zu machen, mit Kohle<br />
reichlich und als nationale Ikone geehrt<br />
wie ein zweiköpfiger Elefant.<br />
Fußball ist eben nicht nur ein Spiel,<br />
sondern er hatte seit seinen Anfängen<br />
stets eine gesellschaftliche und<br />
politische Dimension. Fußballspiele<br />
zwischen Nationen haben nicht selten<br />
die Dimensionen eines Ersatzkrieges,<br />
es hat auch schon kriegerische Auseinandersetzungen<br />
wegen eines Fußballspieles<br />
gegeben. Allerdings wahrscheinlich<br />
nur deshalb, weil man einen<br />
vorgeschobenen Anlass braucht,<br />
sich gegenseitig an die Hälse zu fahren.<br />
Und was zwischen Nationen gilt, gilt<br />
auch zwischen Klassen und Schichten<br />
in einer Gesellschaft.<br />
Den vielfältigen Beziehungen zwischen<br />
Fußball, Klassen und Politik<br />
geht der Artikel nach und zeigt, dass<br />
es sich um eine Geschichte mit vielen<br />
Seiten handelt, denn auch aus dem<br />
Sport geht Einfluss auf die Mentalität<br />
der Politiker aus.<br />
„Der VFB grüßt den tapferen Vietcong<br />
– Borussia grüßt die Kumpels in Hanoi“<br />
(Transparent, gezeigt während des Spiels<br />
VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, im<br />
November 1967). Bis in die frühen 1970er<br />
Jahre war der deutsche Fußball keine Projektionsfläche<br />
für die politischen Diskurse<br />
der Zeit. Fankultur vollzog sich als konventionelle<br />
Interaktionen zwischen einem<br />
Ort und seinem Verein. Lebenslagen von<br />
Anhängern und Spielern waren noch miteinander<br />
vergleichbar. Fußball war Vehikel<br />
für die Entwicklung von totaler Identität,<br />
wobei die territoriale und symbolische Abgrenzung<br />
zum jeweiligen Lieblingsgegner<br />
immer eine große Bedeutung hatte. Vor<br />
allem in Italien und in Frankreich wurde<br />
das Fußballgeschehen weitaus früher in<br />
die Politisierungsprozesse einbezogen. Das<br />
Erstarken der Kommunistischen Partei<br />
Italiens und die größere Nähe zwischen<br />
linken Intellektuellen und politisierter Arbeiterklasse<br />
führten in diesem Land bereits<br />
in den 1990er Jahren zu einer Neuauflage<br />
des Versuches, eine linke kulturelle Hegemonie<br />
über relevante gesellschaftliche<br />
Bereiche herzustellen. Zumindest in den<br />
kommunistischen Hochburgen des Nordens<br />
gelang dies bis hinein in die städtische<br />
und dörfliche Festkultur, im Film und im<br />
Theater ohnehin, und nicht zuletzt auch<br />
im Fußball. Dies hatte zur Folge, dass in<br />
den 1970er Jahren die aktive Fanszene<br />
mehrheitlich links war – oder sich zumin-