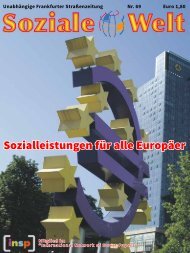Nr. 43 - Soziale Welt
Nr. 43 - Soziale Welt
Nr. 43 - Soziale Welt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 FUSSBALL / SOZIALES<br />
grüßt Cristiano Lucarelli, der sich bei<br />
schlechten Leistungen schon mal selbst<br />
das Gehalt kürzt, mit dem Kommunistengruß.<br />
Das „Centro <strong>Soziale</strong> Godzilla“, das<br />
Zentrum der organisierten Fans, sieht aus<br />
wie ein Parteibüro der PCI zu Zeiten Pepones:<br />
rote Fahnen, Hammer und Sichel,<br />
Stalinportraits. Alles in allem eine neue<br />
Variante des immer wieder auftretenden<br />
Versuchs der „magischen Rückgewinnung<br />
der Gemeinschaft“ durch Protagonisten<br />
expressiver Subkultur.<br />
Und auch die nach Abspaltung gierenden<br />
Linkskatalanen haben bei Barca ihr neues<br />
Idol in Oleguer. Er würde nur für eine katalanische,<br />
niemals aber für die spanische<br />
Nationalmannschaft auflaufen. In seiner<br />
Heimatstadt Sabadell unterstützt er Hausbesetzer<br />
und linke Kritiker der EU-Verfassung.<br />
Solche „Kerle“ sind in Deutschland<br />
weit und breit nicht zu sehen. Also doch<br />
nur ein Spiel?<br />
Über den Autor:<br />
Prof. Dr. Titus Simon, Jahrgang 1954, ist<br />
Hochschullehrer für <strong>Soziale</strong> Arbeit an der<br />
Hochschule und Beirat der SOZIALEX-<br />
TRA. Er spielte in der Kindheit sieben Tage<br />
in der Woche Fußball (ständiger Kampf um<br />
den Sonntag, und verfeinerte sein Kopfballspiel<br />
am Kopfballgalgen des SV Murrhardt.<br />
Nach erfolgreicher Zuwendung zu anderen<br />
Sportarten war er Gründer und Spieler der<br />
im Umkreis von zehn Kilometern gefürchteten<br />
„Wolfenbrücker Wölfe, für die er 1998 –<br />
im hohen Sportleralter von 44 Jahren – das<br />
letzte Mal gegen einen Fußball trat.<br />
(Dieser Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung<br />
des Verlages der Zeitschrift SO-<br />
ZIALEXTRA, VB Verlag, www.sozialextra.<br />
de erreichbar, entnommen).<br />
Hochglanz-<br />
Fankultur wird<br />
abgelehnt<br />
Das Bündnis aktiver Fußballfans (BAFF)<br />
will bei der WM mit „friedlichen<br />
Störmanövern“ Gegenpositionen<br />
beziehen. „Die Hochglanz-Fankultur,<br />
wie FIFA-Präsident Joseph Blatter sie<br />
sich wünscht, entspricht nicht unserer<br />
Vorstellung“, sagte BAFF-Sprecher<br />
Johannes Stender.<br />
Dem offiziellen WM-Motto „Zu Gast bei<br />
Freunden“ will die Fan-Initiative die Kampagne<br />
„Spielverderba 2006“ entgegen setzen.<br />
Das WM-Maskottchen „Goleo“ wird<br />
von BAFF in „Prolleo“ umbenannt und<br />
soll mit einer Flasche Bier in der Hand<br />
über die Fanmeilen marschieren, kündigte<br />
Stender an. Eines hat er dem Original-Löwen<br />
voraus: „Er wird eine Hose tragen“,<br />
verriet der BAFF-Sprecher. Zum „Spielverderba“-Programm<br />
sollen zudem Ausstellungen<br />
zur Korruption innerhalb der<br />
FIFA sowie zur weltweiten Migration von<br />
Fußballern gehören.<br />
Die Fan-Initiative befürchtet während der<br />
WM das verstärkte Ausbrechen nationalistischer<br />
Tendenzen in Deutschland. „Das<br />
Thema Rassismus ist gerade bei Länderspielen<br />
immer noch aktuell“, sagte Stender.<br />
Als Beispiel nannte er diskriminierende<br />
Rufe aus der deutschen Fankurve<br />
während des Länderspiels der Nationalmannschaft<br />
in Slowenien im vergangenen<br />
Jahr. Dort war es auch zu Ausschreitungen<br />
gekommen.<br />
Gerechtigkeit und sozialer Wandel<br />
„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine<br />
soziale und internationale Ordnung, in<br />
welcher die in der vorliegenden Erklärung<br />
verbrieften Rechte voll verwirklicht<br />
werden können“ (UNO-Menschenrechtskonvention<br />
Art. 28)<br />
Wir kennen sie vermutlich alle bis zum<br />
Überdruss, die Statistiken und Trendaussagen,<br />
die belegen, dass der Abstand zwischen<br />
Reich und Arm, Managern in den<br />
Chefetagen und mittleren und unteren<br />
Angestellten immer größer wird – und<br />
zwar sowohl in den westlichen wie in den<br />
vom Sovietkommunismus oder der Apartheit<br />
befreiten Nationen, sowohl national<br />
wie international. Ich will die LeserInnen<br />
deshalb nicht mit Zahlen langweilen. Aber<br />
gerade dieser Überdruss ist aus Sicht der<br />
UNO-Menschenrechtskonferenz von<br />
1993 in Wien das allergrößte, schockierende<br />
Problem. Der schalltote Raum, in dem<br />
die massive Verweigerung und Verletzung<br />
von Sozialrechten erfolgt, die Verletzung<br />
von Freiheits- und Bürgerrechten leitet<br />
einen konzertierten Aufschrei aller möglichen<br />
Gruppierungen, NGOs, Amnesty<br />
International und Massenmedien bewirkt<br />
und nach dem sofortigen Eingreifen verlangt.<br />
Obwohl die Sonntagsrhetorik die<br />
Unteilbarkeit der Menschen beschwört,<br />
zeigt sich im politischen Alltag, dass die<br />
Verletzung des individuellen Eigentums<br />
– Freiheit – und der politischen Rechte als<br />
etwas viel Gravierenderes betrachtet wird<br />
als die Verletzung der Sozialrechte. Die<br />
knappeste Form der Folgen dieses schalltoten<br />
Raumes brachte Mary Robinson, die<br />
ehemalige Menschenrechts-Kommissarin<br />
der UNO, in einem Vortrag über die <strong>Welt</strong><br />
nach dem 11. September auf den Punkt:<br />
„Die Verletzungen der Menschenrechte<br />
von heute führen zu den Kriegen – und zu<br />
dem Terror von morgen.“<br />
Vor diesem Hintergrund ist zunächst zu<br />
fragen, inwiefern das Gerechtigkeitsthema<br />
in die über hundertjährige Theorie- und<br />
Professionsgeschichte der <strong>Soziale</strong>n Arbeit<br />
Eingang gefunden hat. Als nächstes befasse<br />
ich mich mit einigen ungelösten Fragen im<br />
Verhältnis zwischen realwissenschaftlichem<br />
und sozialphilosophischem Zugang zur<br />
Thematik, um dann den Versuch zu wagen,<br />
die Elemente einer gerechten Gesellschaft<br />
zu bestimmen. Dieser wird ergänzt durch<br />
einen Vorschlag zur Frage, wer wem was<br />
schuldig ist.<br />
1. Etappen des Gerechtigkeitsdiskurses<br />
im Rahmen der sozialen Arbeit.<br />
Man darf aufgrund der Theoriebeiträge<br />
Ende des neunzehnten und Anfang<br />
des zwanzigsten Jahrhunderts davon<br />
ausgehen, dass Gerechtigkeit eine zentrale<br />
handlungstheoretische (normative)<br />
Leitidee der sozialen Arbeit war. Ich<br />
erwähne hier nur zwei herausragende<br />
TheoretikerInnen: Für Alice Salomon<br />
(1912) war soziale Arbeit die Bemühung,<br />
das Gemeinschaftsleben in stärkere<br />
Übereinstimmung mit den Forderungen<br />
der Gerechtigkeit zu bringen. <strong>Soziale</strong><br />
Arbeit ist daher nicht Güte, nicht<br />
Wohltun, sondern nur gerechtes Handeln.<br />
Gerechtigkeit kann aber nur verwirklicht<br />
werden, wenn die Starken an einem<br />
Missbrauch ihrer Macht gehindert werden.<br />
Und auch die Freiheit der Schwachen<br />
kann nur gesichert werden, wenn das<br />
Silvia Staub-Bernasconi<br />
Gesetz sie vor der Übermacht der Starken<br />
schützt. Im Denken von Jane Addams<br />
und den Frauen von Hull House in den<br />
Universitätsniederlassungen in den Slums<br />
von Chicago stand der Zusammenhang<br />
zwischen Verteilungsrecht und Demokratie<br />
im Zentrum. Addams befasste sich in<br />
ihrem Buch „Demokratie und soziale<br />
Ethik“ im Besonderen mit der unter<br />
demokratischen Vorzeichen bestehenden<br />
Doppelmoral der Ober- und Mittelschicht<br />
in Bezug auf die Unterschicht. Ein Beispiel:<br />
Mit welcher Legitimation fordere eine<br />
freundliche Besucherin als Wohltäterin<br />
aus der Mittelschicht, die ohne jede<br />
Eigenleistung vom Einkommen ihres<br />
Mannes lebe, dass die alleinerziehende<br />
Wäscherin mit kleinen Kindern in<br />
unmenschlichen Arbeitsverhältnissen<br />
ihr Brot verdiene? Oder: Die Forderung<br />
zu sparen sei kriminell in einem Milieu,<br />
wo Menschen fast nichts zum Leben<br />
hätten und auch in Geldangelegenheiten<br />
auf gegenseitige Hilfe angewiesen seien.<br />
Für J. Addams gab es keinen konkreten<br />
Interaktionszusammenhang in unserer<br />
modernen Gesellschaft, der so klar das<br />
Fehlen von demokratischer Gleichheit und<br />
Verteilungsgerechtigkeit sichtbar macht,<br />
wie die soziale Arbeit. Entsprechend forderte<br />
sie die durchgehende Demokratisierung<br />
sozialer Arbeit sowohl in praktischer als<br />
auch theoretischer Hinsicht.<br />
Zwischen 1930 und 1970 haben wir einerseits<br />
Rassendiskurse, die nicht nur Gerechtigkeit,<br />
sondern auch eine pervertierte<br />
Rechtsstaatlichkeit auf die weiße, insbesondere<br />
arische Rasse beschränken. Andererseits<br />
ist sowohl in den USA als auch in<br />
Europa, mit eingeschlossen Deutschland,<br />
ein theoretischer Rückzug auf das Individuum,<br />
genauer auf Innerpsychisches,<br />
festzustellen. Es ist die Phase der Psychologisierung,<br />
Therapeutisierung und – in<br />
Deutschland – teilweise Pädagogisierung<br />
der sozialen Arbeit.<br />
Man hoffte, das fehlende Ansehen, das<br />
man sich mit den Schmuddelkindern der<br />
Gesellschaft einhandelte, würde sich mit<br />
einer Orientierung an Medizin, Psychiatrie<br />
und klinischer Psychologie einstellen. Es<br />
kam zu geradezu grotesken Vorstellungen,<br />
dass man mit einer bestimmten Klientel<br />
sozialer Arbeit nicht arbeiten könne, weil<br />
sie zuviel reale Probleme habe. Ein Beispiel:<br />
Eine junge Frau, die dringend eine<br />
Wohnung suchte, weil man ihr gekündigt<br />
hatte, wurde daraufhin gefragt, welche<br />
emotionale Bindung bzw. Ablösungsprobleme<br />
sie mit ihrer Mutter habe und ob<br />
sie nicht zuerst diese bearbeiten sollte.<br />
In Deutschland gab es den Beitrag von<br />
Hans Fassenberger, der festhielt, dass die<br />
Armutsprobleme eigentlich gelöst seien.<br />
Darum sei soziale Arbeit, auch psychosoziale<br />
Arbeit, nicht mehr auf ökonomische<br />
Probleme auszurichten.<br />
Die nach dem zweiten <strong>Welt</strong>krieg einsetzende<br />
Hochkonjunktur hatte die Version<br />
vom immerwährenden Aufschwung aufblühen<br />
lassen. Vor diesem Hintergrund<br />
entstanden 1960 die hoffnungsvollen<br />
großen Bürgerrechts- und Wohlfahrtsbewegungen<br />
und -programme in den USA,<br />
gesellschaftstheoretisch begründet durch<br />
die Theorie der fehlenden strukturellen<br />
Chancen von Clovard und Ohlin. Man<br />
nahm damals auch in der sozialen Arbeit<br />
Kenntnis von den sozialen Bewegungen<br />
in der Dritten <strong>Welt</strong> mit Bezug auf Paolo<br />
Freires – „Pädagogik der Unterdrückten“<br />
– und schließlich gab es die Studentenbewegung<br />
und Heimkampagne in Deutschland.<br />
Allerdings dominierte nicht die Verteilungs-<br />
sondern die ökonomisch-kapitalistisch<br />
determinierte Herrschafts- und<br />
Ausbeutungsthematik. Im Unterschied<br />
zur ersten Theoriephase entstanden all<br />
diese Beiträge in einer Zeit der Hochkonjunktur.<br />
Das jähe Ende dieser Bewegung in den<br />
USA wie in Europa zu Beginn der ersten<br />
Wirtschaftskrise ab 1980 ist bekannt. Im<br />
Schatten des Abschieds von Herrschafts–,<br />
Schichtungs- und Gerechtigkeitsfragen<br />
konnte sich ab etwa 1980 eine neue<br />
Leitidee – ohne große Parolen, fast<br />
unbemerkt – in der Ausbildung und Praxis<br />
sozialer Arbeit ausbreiten und festsetzen.<br />
Sie hat die soziale Arbeit auf kaum<br />
vorstellbare Art und Weise revolutioniert:<br />
Es ist die in fast alle gesellschaftspolitischen<br />
Bereiche importierte Idee der<br />
markt- und wettbewerbsorientierten,<br />
personenbezogenen Dienstleistung mit<br />
der Forderung nach Flexibilisierung von<br />
Bildungs-, Arbeits-, Rentenverhältnissen,<br />
von Gesetzesauslegungen und<br />
Vorschriften.<br />
Die Adressaten in der Sozialarbeit werden<br />
wieder neu als unwirtschaftlich definiert,<br />
weshalb sie so schnell wie möglich einem<br />
ausgetrockneten Arbeitsmarkt zugeführt<br />
werden sollen. Da dies wegen fehlender<br />
Stellen sowie der derzeitigen schwierigen<br />
Situation nicht gelingt und deshalb Sozialhilfe<br />
ansteht, kommt eine alte Denkfigur<br />
wieder zum Tragen: Wer Hilfe und<br />
Obhut benötigt, braucht keine Rechte<br />
bzw. Gerechtigkeit, sondern Kontrolle.<br />
Manche halten die großen Einkommensunterschiede<br />
zwischen Individuen und<br />
zwischen Ländern für notwendig und gerecht,<br />
da sie die Intelligenten und Tüchtigen<br />
belohnen und die Dummen und<br />
Leistungsscheuen bestrafen. Interessant ist<br />
in diesem Zusammenhang die Tatsache,<br />
dass in denjenigen Ländern, z. B. in den<br />
USA, in denen die Verteilungsfrage öffentlich-politisch<br />
gestellt werden darf und<br />
kann, sich sehr streitbare Gerechtigkeitsund<br />
Verteilungsdiskurse in die Organisationen<br />
verlagert haben. Dies hat zur Folge,<br />
dass diejenigen Menschen, die in keiner<br />
existenzsichernden Bildungs- oder Wirtschaftsorganisation<br />
Mitglied sind, so u. a.<br />
Schuldner, Lehrstellen- und Erwerbslose,<br />
Betagte, Kranke, Behinderte, SozialhilfeempfängerInnen<br />
und Papierlose, also die<br />
meisten AdressatInnen sozialer Arbeit, von<br />
diesem Diskurs und seinen Wirkungen<br />
ausgeschlossen sind.<br />
Was in letzter Zeit – aber ebenfalls kaum<br />
bemerkt – entstanden ist, sind dezidierte<br />
sozialpolitische Papiere der internationalen<br />
Professionsverbände, so z.B. das in<br />
Oslo verabschiedete Papier über Sozialarbeitsprinzipien<br />
von 1997. Dort heißt es u.<br />
a.:<br />
„Sozial Arbeitende sind den Prinzipen der<br />
sozialen Gerechtigkeit verpflichtet. Sozial<br />
Arbeitende haben die bestmögliche Unterstützung<br />
ohne Diskriminierung aufgrund<br />
der Basis des Geschlechts, des Alters, der