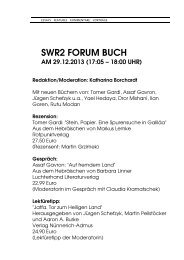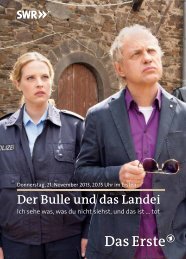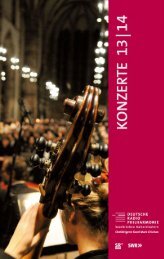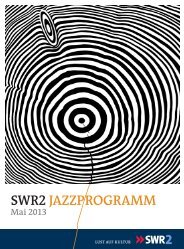Manuskript zum Download
Manuskript zum Download
Manuskript zum Download
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
kommt, dass Phrasierung und Artikulation sich auf vielschichtige Weise mit anderen<br />
Parametern verflechten - sowohl solchen der Komposition als auch solchen der darstellenden<br />
Gestaltung; ihre Sinnhaftigkeit entscheidet sich erst im Zusammenspiel vielfältiger Aspekte<br />
und kann in den seltensten Fällen ausschließlich aus sich heraus begründet werden.<br />
Auch hier gründet sich Hermann Kellers Darstellung wieder auf stillschweigende<br />
Voraussetzungen: Selbst wenn man seine Unterscheidung von ihrer theoretischen Systematik<br />
her akzeptiert, so macht sie doch in erster Linie Sinn für Musik, die einen deutlichen Hang zur<br />
Sprache hat. Für die Wiener Klassik, das romantische Lied, mag diese Sichtweise eine<br />
gewisse Stringenz besitzen, trotz ihres wenig praxisnahen Ansatzes. Für sehr viele Musik -<br />
Chopin, Debussy, Skrjabin, zeitgenössische oder gar außereuropäische Musik - hat sie wenig<br />
Erkenntnischarakter. In dem Moment, in dem Aspekte der Bewegung, des Raumes und des<br />
Bildes wichtiger werden als das Formulieren von Themen und musikalischen Gedanken,<br />
greift Kellers Unterscheidung nicht mehr wirklich, obwohl auch hier Artikulation und<br />
Phrasierung eine genauso wichtige Rolle spielen.<br />
Ebenso wie Dichtung weist aber auch jede Musik, die man intuitiv als ‚sprachnah‟ bezeichnen<br />
würde, über ihre sprachliche Struktur hinaus. Die Imagination musikalischer Charaktere lässt<br />
sich nicht auf ihre strukturellen Aspekte reduzieren - sei es im Fall der kompositorischen<br />
Formulierung des Textes, sei es im Fall der Darstellung durch den Interpreten. Das ist der<br />
entscheidende Unterschied zwischen Grammatik, die allgemein formuliert, und Handwerk,<br />
das sich in der Ausarbeitung des Details, angesichts eines vorliegenden Materials entfaltet.<br />
Musikbeispiel 4:<br />
Franz Schubert: Winterreise Nr. 16, Letzte Hoffnung 2‟17“<br />
Christoph Prégardien, Tenor<br />
Andreas Staier, Klavier<br />
Teldec 0630-18824-2<br />
Sprecher 2:<br />
Das Gedicht handelt vom Stehenbleiben in Gedanken, das „oftmals“ stattfindet, immer dann,<br />
wenn der Blick des Wanderers auf Bäume fällt, an denen noch einzelne Blätter hängen. Es<br />
entsteht die Vorstellung einer Bewegung, die immer wieder durch meditative Momente<br />
gebremst oder unterbrochen wird.<br />
…<br />
Dass das Schicksal der Hoffnung dem Zufall des vielleicht fallenden Blattes überlassen wird,<br />
ist der Verzicht, aus der Unsicherheit, in der das Leben suspendiert ist, aus eigener Kraft<br />
herauszukommen. Daher auch der unentschiedene Wechsel von Gehen und Stehen. Die<br />
11