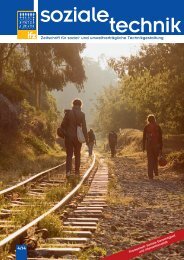SOZIALE TECHNIK 1/14
SOZIALE TECHNIK ist die einzige Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, die über umwelt- und sozialwissenschaftliche Technikforschung berichtet. Die Themen umfassen Technologie & Politik, Umwelt & Energie, Neue Biotechnologien und Frauen & Technik. SOZIALE TECHNIK informiert seit mehr als 20 Jahren über aktuelle Themen in den Bereichen umwelt- und sozialverträgliche Technikgestaltung, Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung.
SOZIALE TECHNIK ist die einzige Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, die über umwelt- und sozialwissenschaftliche Technikforschung berichtet. Die Themen umfassen Technologie & Politik, Umwelt & Energie, Neue Biotechnologien und Frauen & Technik.
SOZIALE TECHNIK informiert seit mehr als 20 Jahren über aktuelle Themen in den Bereichen umwelt- und sozialverträgliche Technikgestaltung, Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Neue Biotechnologien<br />
Vom Nutzen neuer Technologien der<br />
Genomforschung in der klinischen Praxis<br />
Genetische Sequenziertechnologien: Chancen für die Tumordiagnostik<br />
Die Genomforschung hat nicht nur bahnbrechende Erkenntnisse in der Wissenschaft<br />
des Lebens hervorgebracht, sondern es wurden auch Technologien<br />
von enormer Leistungsfähigkeit entwickelt. Das Potenzial dieser Entwicklungen<br />
ist noch lange nicht ausgeschöpft. Die Hoffnung, dass sie sich für die<br />
Diagnose von Krebserkrankungen nutzen lassen, ist besonders hoch.<br />
Michaela Theresia Mayrhofer<br />
ist promovierte Politikwissenschaftlerin, Soziologin<br />
und Historikerin mit Abschlüssen von den Hochschulen<br />
der Universität Wien und dem Ecole des Hautes<br />
Etudes en Sciences Sociales Paris. Mitarbeit an nationalen<br />
und internationalen Projekten mit dem Forschungsschwerpunkt<br />
Biobanken und Governance.<br />
Nach Forschungsaufenthalten in Belgien, Frankreich<br />
und der Schweiz seit 2008 wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
an der Medizinischen Universität Graz.<br />
E-Mail: michaela.mayrhofer@medunigraz.at<br />
Bernhard Wieser<br />
habilitierte sich an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt<br />
im Fach Technik- und Wissenschaftsforschung.<br />
Seit 1999 forscht er am IFZ mit internationaler<br />
Erfahrung aus Forschungsaufenthalten in<br />
Dänemark, USA und Großbritannien. Bernhard<br />
Wieser ist Assoziierter Professor am Institut für<br />
Technik- und Wissenschaftsforschung der Alpen-<br />
Adria-Universität Klagenfurt. Arbeitsschwerpunkte:<br />
ethische, legale und soziale Aspekte der Genomforschung<br />
und ihrer Anwendung im Bereich der genetischen<br />
Diagnostik.<br />
E-Mail: bernhard.wieser@aau.at<br />
Todesursache Krebs<br />
Krebs ist nach Herz-Kreislauferkrankungen<br />
die zweithäufigste Todesursache in Österreich<br />
und fordert jedes Jahr mehr als<br />
20.000 Todesopfer (Statistik Austria 2012).<br />
Bei Frauen kommt Brustkrebs am häufigsten<br />
vor, bei Männern Prostatakrebs. An<br />
zweiter Stelle steht bei beiden Geschlechtern<br />
das Dickdarmkarzinom. Insgesamt<br />
werden in Österreich jedes Jahr bis zu 4.600<br />
Fälle von Dickdarmkarzinomen diagnostiziert.<br />
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund<br />
wird die Dringlichkeit deutlich, mit der medizinische<br />
Forschung nach besseren Diagnose-<br />
und Therapiemöglichkeiten sucht.<br />
Gerade die Genomforschung hat hier verheißungsvolle<br />
Versprechen gemacht. Der<br />
Grund dafür liegt darin, dass Tumore aus<br />
Zellen mit mutierter DNA bestehen.<br />
Heterogene Tumore<br />
Die Krebserkrankung entsteht nach heutigem<br />
Wissen aus einer einzigen mutierten<br />
Krebsstammzelle, die sich immer wieder<br />
teilt. Ein daraus entstehender, bösartiger<br />
Tumor ist jedoch nicht notwendigerweise<br />
ein homogener Zellklumpen, sondern vielmehr<br />
ein Mosaik aus unterschiedlich hoch<br />
differenzierten Tumorzellen mit einer Vielzahl<br />
an weiteren genetische Veränderungen<br />
in den betroffenen Zellen. Aus dieser<br />
relativ neuen Erkenntnis schließen ForscherInnen,<br />
dass die Heterogenität des Tumorgewebes<br />
ein maßgeblicher Grund dafür<br />
ist, warum Therapien mitunter nicht<br />
zum gewünschten Heilungserfolg führen.<br />
Für die Behandlung von Krebserkrankungen<br />
ist es daher von größtem Interesse,<br />
mehr über die genetische Heterogenität<br />
von Tumoren herauszufinden (Anonymus,<br />
Der Standard 2012).<br />
Genau hier liegt der zentrale Ansatzpunkt<br />
eines neuen Forschungslabors am Institut<br />
für Pathologie der Medizinischen Universität<br />
Graz. In diesem Labor wird modernste<br />
Sequenziertechnik (Next-Generation-Sequenzing)<br />
1 zur Erforschung und Diagnose<br />
von Tumorheterogenität eingesetzt.<br />
Prof. Höfler, Projektleiter eines einschlägigen<br />
Forschungsprojektes, ist überzeugt,<br />
dass es die genaue Kenntnis über Homooder<br />
Heterogenität eines Tumors sowie<br />
über dessen genetische Stabilität ermöglichen<br />
kann, auf eine Chemo- oder Strahlentherapie<br />
zu verzichten – eine für viele PatientInnen<br />
mit großen Nebenwirkungen<br />
verbundene Therapie. Bislang war der Erfolg<br />
einer Chemo- oder Strahlentherapie<br />
recht ungewiss, wie Dr. Kashofer, ein weiterer<br />
Forscher des Grazer Teams, ergänzt.<br />
„Auf Basis der neuen, erwarteten Ergebnisse<br />
hoffen wir, über die Gefahr von Tochtergeschwüren,<br />
den Metastasen, bessere Voraussagen<br />
treffen zu können“, zeigt sich Prof.<br />
Höfler im Steiermark Report vorsichtig optimistisch<br />
(Fröhlich 2012). Diese neuen<br />
Perspektiven in der Diagnose von Krebserkrankungen<br />
können als Ergebnisse des Humangenomprojektes<br />
gesehen werden.<br />
Vom Humangenomprojekt zur<br />
klinischen Anwendung<br />
Innerhalb der letzten Jahre führten neue Sequenziertechnologien<br />
zu einer enormen Effizienzsteigerung<br />
der Genomsequenzierung.<br />
Dies wurde einerseits durch das Humangenomprojekt<br />
bedingt, welches eine wesentliche<br />
Katalysatorrolle in der Entwicklung der<br />
Sequenziertechnologie spielte. Zudem sanken<br />
die Kosten der Genomsequenzierung<br />
durch technischen Fortschritt um mehr als<br />
das 10.000-fache. Diese Kostenreduktion<br />
und die verbesserten Technologien ermöglichten<br />
es in der Folge, dass in der Zwischenzeit<br />
die Sequenzierung von über 60<br />
Säugetierarten abgeschlossen werden<br />
konnte (vgl. UCSC). Ebenso gelang es, auf<br />
Basis dieser technologischen Entwicklungen<br />
im HapMap-Projekt (2002-2005) einen Katalog<br />
der häufigsten Genomvariationen des<br />
Menschen innerhalb von nur drei Jahren<br />
anzulegen (Collins 2010). Die enorme Beschleunigung<br />
und Verbilligung des geneti-<br />
Soziale Technik 1/20<strong>14</strong><br />
17