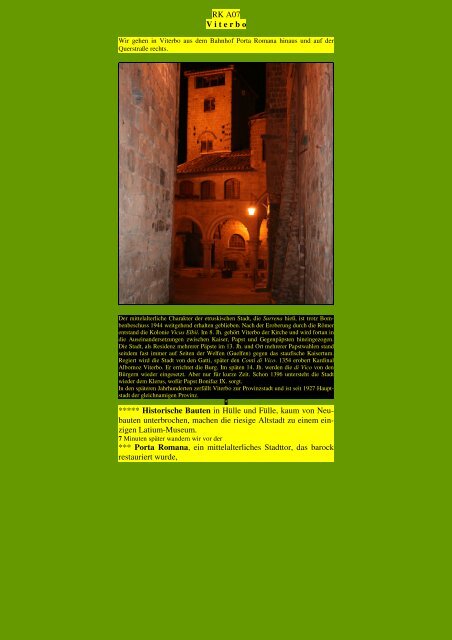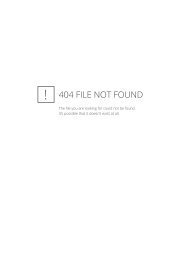Viterbo - Kunstwanderungen
Viterbo - Kunstwanderungen
Viterbo - Kunstwanderungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
RK A07<br />
V i t e r b o<br />
Wir gehen in <strong>Viterbo</strong> aus dem Bahnhof Porta Romana hinaus und auf der<br />
Querstraße rechts.<br />
Der mittelalterliche Charakter der etruskischen Stadt, die Surrena hieß, ist trotz Bombenbeschuss<br />
1944 weitgehend erhalten geblieben. Nach der Eroberung durch die Römer<br />
entstand die Kolonie Vicus Elbii. Im 8. Jh. gehört <strong>Viterbo</strong> der Kirche und wird fortan in<br />
die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser, Papst und Gegenpäpsten hineingezogen.<br />
Die Stadt, als Residenz mehrerer Päpste im 13. Jh. und Ort mehrerer Papstwahlen stand<br />
seitdem fast immer auf Seiten der Welfen (Guelfen) gegen das staufische Kaisertum.<br />
Regiert wird die Stadt von den Gatti, später den Conti di Vico. 1354 erobert Kardinal<br />
Albornoz <strong>Viterbo</strong>. Er errichtet die Burg. Im späten 14. Jh. werden die di Vico von den<br />
Bürgern wieder eingesetzt. Aber nur für kurze Zeit. Schon 1396 untersteht die Stadt<br />
wieder dem Klerus, wofür Papst Bonifaz IX. sorgt.<br />
In den späteren Jahrhunderten zerfällt <strong>Viterbo</strong> zur Provinzstadt und ist seit 1927 Hauptstadt<br />
der gleichnamigen Provinz.<br />
*<br />
***** Historische Bauten in Hülle und Fülle, kaum von Neubauten<br />
unterbrochen, machen die riesige Altstadt zu einem einzigen<br />
Latium-Museum.<br />
7 Minuten später wandern wir vor der<br />
*** Porta Romana, ein mittelalterliches Stadttor, das barock<br />
restauriert wurde,
*** S. Sisto. Der romanische Bau der Sixtus-Kirche des 12.<br />
Jhs. besitzt einen Chor des 13. Jhs., auf der Stadtmauer einen<br />
Glockenturm des 12. Jhs. sowie einen Turm des Vorgängerbaus<br />
aus dem 9. Jh., also langobardischer Zeit.<br />
Die Langobarden<br />
links auf die „Via delle Fortezze“ und gehen nun außen entlang an der<br />
***** Ringmauer. Die 5 km lange Stadtbefestigung, begonnen<br />
1095 und im 13. Jh. vollendet, besitzt eine Menge Türme und<br />
lässt durch sieben Tore ein.<br />
Später wandern wir vorbei an der Ruine der Kirchs<br />
*** S. Leonardo. Erhalten sind von der Renaissancekirche auf<br />
mittelalterlichem Grund lediglich noch der Ostbau und der<br />
Ringmauerturm. Die Anlage dient heute als Freilichttheater.<br />
Später wandern wir links treppauf in die Kirche<br />
*** S. Pietro. Das (fast immer geschlossene) barocke Gotteshaus<br />
wurde im 17. Jh. errichtet.<br />
Wir gehen aus der Kirche hinaus, steigen treppab und wandern durch die<br />
*** Porta San Pietro der Stadtmauer, ein Tor aus dem 16. Jh.<br />
Wir kommen vorbei am sofort rechts stehenden<br />
*** Palazzo dell’Abbate aus dem 13. Jh., auch „Palazzo<br />
Pamphili“ genannt, weil er im 17. Jh. für Olimpia Pamphili umgestaltet<br />
wurde.
Die Langobarden waren ein germanischer Stamm, der um das<br />
Jahr Null beiderseits der Elbe beheimatet war. Im Laufe der<br />
folgenden Jahrhunderte wanderte der Stamm mit großen Teilen<br />
nach Österreich, Ungarn und in slawische Gebiete. 568 fielen<br />
die Langobarden über die Lombardei und Mittelitalien her. Viele<br />
Zeugnisse hier künden von hoher Kunst im 9. Jh. 951 kam<br />
die langobardische Krone unter die deutsche.<br />
*<br />
Das Innere. Beachtlich sind die Kapitelle auf den Säulen, besonders<br />
am ersten Paar mit seinen außergewöhnlichen Formen.<br />
– Zum Chor leitet die große Treppe aus 17 Stufen hinauf. –<br />
Zum rechten Querhaus führt ein fein gearbeitetes Renaissance-<br />
Portal.<br />
Das Chorhaus. Altar aus Steinstücken des 4. und 5. Jhs. – Am<br />
zum Raum verhältnismäßig hohen Triumphbogen befinden sich<br />
zwei romanische Kanzeln des 12. Jhs.<br />
Rechte Frontwand: Muttergottes, Goldgrundgemälde des Neri<br />
di Bicci, 1459.<br />
Die Krypta schließt eine halbkreisförmige Apsis. Hier steht ein<br />
romanischer Altartisch.<br />
Wir gehen aus der Kirche hinaus und richtunghaltend weiter auf der „Via G.<br />
Garibaldi“. – Später wandern wir auf der „Piazza Fontana Grande“ mit der<br />
*** Fontana Grande von 1212, geschaffen von Pietro di Giovanni<br />
Bertoldo Giovanni, mit einer Schale in Form eines griechischen<br />
Kreuzes,<br />
*** Palazzo Gatti des 14. Jhs. Der Palast gleicht einer mit Zinnen<br />
bekrönten Festung, ist dreigeschossig, hat Doppelfenster<br />
und Arkaden.<br />
Kurz darauf biegen wir links ab auf die „Via Grotti“, kurz danach wandern<br />
wir auf der Quergasse rechts und kurz darauf links in die an der Ecke erbaute<br />
Kirche<br />
*** San Pellegrino. Die Kirche des 11. Jhs. wurde vom 13. bis<br />
20. Jh. mehrfach verändert, besonders im Jahre 1889. Das Gotteshaus<br />
besitzt keine nennenswerten Kunstschätze.<br />
Wir gehen aus der Kirche hinaus und Richtung haltend über den Platz durch<br />
***** San Pellegrino. Der Platz des heiligen Pilgers gilt als<br />
das besterhaltene einheitliche Ensemble in der Stadt und zeigt<br />
sich im Gewand des 13. Jhs. Das gesamte, sich anschließende<br />
Viertel schaut über weite Teile hinweg noch so aus wie zur
Bauzeit: romanische und gotische Wohnhäuser, zwölf Geschlechtertürme,<br />
Paläste sorgen dafür. Die Quergassen haben<br />
ein ähnliches Flair.<br />
Wir wandern vorbei am rechts erbauten<br />
*** Palazzo degli Alessandri aus dem 12. Jh., mit großem<br />
Balkon.<br />
Später wandern wir auf der „Piazza S. Carluccio“ rechts, auf der Quergasse<br />
abermals rechts und auf der „Piazza S. Maria Nuova“ links in die Kirche<br />
*** S. Maria Nuova. Das Gotteshaus, einst Ordenskirche der<br />
Dominikaner, erstrahlt nach der Kriegszerstörung 1944 wieder<br />
im ursprünglichen Gewand des 12. Jhs. Über dem Portal<br />
schwebt ein Jupiterkopf; außerdem ist außen eine Kanzel des<br />
13. Jhs. angebracht, von der um 1267 Thomas von Aquin predigte.<br />
Das Innere schmücken auf den Säulen schöne Kapitelle. Die<br />
Deckendekoration stammt aus dem 15. Jh.<br />
Linkes Seitenschiff: Apsisaltar: Thronender Jesus mit Lamm<br />
Gottes, Johannes und Maria, 15. Jh. –<br />
Matteo Giovannetti<br />
Der Maler wird um 1300 in <strong>Viterbo</strong> geboren. Er schließt sich<br />
der senesischen Schule um Simone Martini und Ambrogio Lorenzetti<br />
an. Matteo arbeitet außer in <strong>Viterbo</strong> u. a. an der<br />
Karthause von Villeneuve, im Papstpalast zu Avignon und im<br />
Vatikan zu Rom. Er stirbt 1369.<br />
*<br />
3. Hieronymus zwischen Laurentius und Johannes dem Täufer,<br />
von Pastura, um 1500.<br />
Rechtes Seitenschiff. Apsisaltar mit einer Madonna des 15. Jhs.<br />
– Die Fresken in den Wandkapellen: 1. Kreuzigung, mit Heiligen,<br />
von 1293; 2. Kruzifixus zwischen Maria, Johannes und<br />
Heiligen, von Francesco d’Antonio; 3. Muttergottes zwischen<br />
Bartholomäus und Stephanus, Gemälde von Matteo<br />
Giovannetti. – Säule aus Marmor, von 1081.<br />
Wir gehen aus der Kirche hinaus, halten uns rechts und betreten durch die Gitterpforte<br />
den<br />
*** Kreuzgang aus dem elften Jahrhundert.<br />
Wir gehen aus dem Kreuzgang hinaus, auf der Gasse rechts und auf der Quergasse<br />
links leicht bergauf. Wir bleiben nun immer auf dieser „Via San Lorenzo“,<br />
schreiten auf ihr über die „Piazza della Morte“ mit dem Brunnen ** Fontane<br />
della Morte des 14. Jhs., und kommen hier vorbei am links erbauten<br />
*** Palazzo S. Tommaso. Der Palast besitzt mächtige Doppelfenster<br />
und Erdgeschossarkaden sowie eine Loggia und einen<br />
romanischem Geschlechterturm, der um die hohen Stockwerke<br />
gekappt wurde (der Wohnturm von geächteten Geschlechtern<br />
wurde regelmäßig um die oberen Stockwerke gekürzt).<br />
Wir wandern weiter auf der „Via S. Lorenzo“, gehen schließlich über den<br />
*** Ponte del Duomo, eine Brücke,<br />
von der wir malerische *** Ansichten haben, und vorbei am rechts stehenden<br />
*** Palazzo Farnese. Der Palast besitzt antikes Mauerwerk des<br />
13. und 14. Jhs., erscheint aber überwiegend im gotischen Stil
des 15. Jhs. und mehrfach restauriert. Hier soll Papst Paul III.,<br />
das ist Alessandro Farnese, 1468 geboren worden sein. Der Palast<br />
besitzt eine hölzerne zweigeschossige Loggia. Die Ansicht<br />
des Innenhofes wird von einer wuchtigen Treppe bestimmt.<br />
Wir gelangen auf die Piazza S. Lorenzo. Hier steht links der Palazzo,<br />
*** Casa di Valentino della Pagnotta. Der Palast ist im Wesentlichen<br />
aus dem 15. Jh., allerdings sichtlich in romanischen<br />
Teilen des 13. Jhs. errichtet, mit zweibogiger Loggia sowie reichem<br />
Maßwerkdekor.<br />
An der gegenüber liegenden Seite des Platzes steht der<br />
*** Palazzo dei Papi (Palazzo papale = Papstpalast). Zwischen<br />
1257 und 1287 residierten hier sage und schreibe acht Päpste.<br />
Von der Loggia aus hat man eine<br />
**** Ansicht über das Land bis Montefiascone.<br />
Viterbesen und Päpste<br />
<strong>Viterbo</strong> besitzt seit dem Jahre 1095 eine republikanische Verfassung.<br />
Im Bewusstsein dieses Vorzugs muss man sich die nun<br />
ergebende Geschichte der Viterbesen einmal vor Augen führen.<br />
<strong>Viterbo</strong> war viermal Stätte von Konklaven (streng abgeschlossener<br />
Versammlungsraum der Kardinäle bei Papstwahlen). Heraus<br />
kamen: Gregor X, Johannes XXI., Martin IV. und Urban<br />
IV.<br />
Letzterer hat Rom nie gesehen, ein Schönheitsfehler, der ihn sicher<br />
gekümmert hat. Dafür verfügte Urban den Fronleichnamstag,<br />
was ihm im Gedächtnis der Nachfahren einen Platz einräumte,<br />
besonders den Deutschen, denen jährlich ein arbeitsfreier<br />
Tag ins Haus steht und Kurzurlaubern meistens ein verlängertes,<br />
freies Wochenende.<br />
1144 vertreiben Volk und Senat Papst Lucius II. aus Rom. Die<br />
Viterbesen empfangen ihn mit offenen Armen, um Rom eins<br />
auszuwischen, denn Rom hasst seine Päpste, <strong>Viterbo</strong> liebt sie –<br />
und liebt die staufischen Herrscher. Daher ist die Stadt Operationsbasis<br />
des waiblinger Heeres. Das nutzt den Papst aber gar<br />
nichts, wird er doch bei einer kriegerischen Auseinandersetzung<br />
„totgeworfen“.<br />
Wie könnte es anders sein, bekämpfen sich die Kontrahenten<br />
mit dem Segen ihrer geistlichen Beistände. Das ist auf römischer<br />
Seite ab 1159 Rolando Bandinelli aus Siena, besser bekannt<br />
als Papst Alessandro III., und auf viterbischer der vier<br />
Jahre residierende Gegenpapst Paschalis III., der 1165 Karl den<br />
Großen heilig spricht. Der tote Kaiser wird’s ihm danken, weilte<br />
er ansonsten doch immer noch unheilig im Himmel. Der<br />
viterbische Beistand wird erhöht durch den geistlichen Kölner<br />
Reinald von Dassel, der für Rotbart Friedrich I. das Umland<br />
Roms verwüstet. 1167 dankt Friedrich den Viterbesen für ihre<br />
Hilfe mit einem neuen Stadtwappen: der Kaiseradler in den<br />
Pranken des Löwen. Man sieht, die Viterbesen sind geschickt.<br />
Für nicht minder schlitzohrig halten sich die Stadtväter von<br />
Ferento in Latium. 1169 verbünden sie sich mit <strong>Viterbo</strong>, wer
hätte eine solche Stadt nicht gern zum Partner, gegen die Stadt<br />
Nepi. Die Viterbesen rücken gegen Nepi und gedenken sich am<br />
Monte Cimino mit den Ferentinern zu vereinigen. Diese jedoch<br />
vollbringen das Schurkenstück, das von jeder Verteidigung entblößte<br />
<strong>Viterbo</strong> zu überfallen und zu plündern. Die Rache soll<br />
fürchterlich sein. 1170 fällt Ferento in Asche, und die Palme in<br />
dessen Wappen wird der viterbischen hinzugefügt.<br />
Mit der Palme hielt der Teufel Einzug in die Stadt, denn kaisertreue<br />
(ghibellinische = staufisch-waiblingische) Bürger und<br />
päpstliche (guelfische = welfische) Bürger schlagen sich die<br />
Köpfe ein. Da weiß Papst Innozenz IV. Rat. Kurzerhand vermählt<br />
er zwei junge Männer mit zwei jungen Mädchen aus den<br />
rivalisierenden Parteien miteinander. Von da an darf man<br />
<strong>Viterbo</strong> päpstlich nennen, wovon der Papstpalast zeugt. Ihre rüden<br />
Sitten aber halten die Viterbesen bei, wie die Geschichte<br />
fürderhin beweisen wird.<br />
Nach dem Tod Clemens des IV. im Jahre 1268 können sich die<br />
Kardinäle drei Jahre lang nicht für einen Kandidaten entscheiden.<br />
Bonaventura da Bagnoregio empfiehlt daraufhin der Stadtverwaltung<br />
von <strong>Viterbo</strong> drakonische Maßnahmen: zuerst<br />
schließt man die Herren Kardinäle ein. Es hilft nichts. Dann<br />
kürzt man den Inhalt des Futtertrogs. Es hilft nichts. Schließlich<br />
deckt man das Dach ab und setzt die Herren unter Regen, Wind<br />
und Sonne. Es hilft, möglicherweise aber aus einem anderen<br />
Grund: man hatte lange genug der Frauen entbehrt. Man wählt<br />
den auf Pilgerreise im Heiligen Lande befindlichen Bischof von<br />
Lüttich zum Papst. Er, Gregor X., hätte sich auch im Falle des<br />
Dabeiseins nicht wehren können. Immerhin bewirkte die<br />
Papstwahl neue Konklavebestimmungen.<br />
Von Stund’ an entwickeln die Viterbesen ein merkwürdiges<br />
Verhältnis zu hiesigen Papstwahlen. Allerdings steht das<br />
Schicksal ihnen nicht gerade günstig bei.<br />
Der 1276 zum Papst gewählte Hadrian flüchtet aus dem von<br />
Malaria verseuchten Rom hinter seinem Ruf als Geizkragen her,<br />
der vorher schon in <strong>Viterbo</strong> eingetroffen war. Das hat den<br />
Viterbesen gerade noch gefehlt, dass ihnen ein – auch noch in<br />
Rom gekrönter – Papst die Krankheit anschleppt. Hadrian muss<br />
den Unmut gespürt und nicht verwunden haben, denn er schläft<br />
hier nach 40 Tagen Regierungszeit amtsmüde, wie er war, für<br />
immer ein. Daraufhin wird ein gewisser Herr Dante so dreist<br />
sein und den Stellvertreter Gottes ins Fegefeuer schicken. Er<br />
dichtet: „Meine Bekehrung, wehe mir, kam spät. Erst als ich<br />
Oberhirte war in Rom, durchschaute ich die Täuschungen des<br />
Lebens. Vorher war meine Seele heimatlos, Ferne von Gott und<br />
ganz in Geiz befangen.“<br />
Nicht genug des Ungemachs für die Viterbesen. Papst Johannes<br />
der XXI. wird nicht nur in <strong>Viterbo</strong> gewählt, sondern auch noch<br />
im Jahre 1276 im hiesigen Papstpalast unter den Wänden seines<br />
Studierzimmers begraben, das von Büchern überlastet war. Da<br />
der Papst aber passionierter Hobbychemiker ist, mag es wohl<br />
sein, dass er unvorsichtig rumgewerkelt hat. Jedenfalls ist auch<br />
von einer Explosion die Rede.<br />
1277 soll ein Orsini Papst werden – und zwar in Rom. Pfui Teufel.<br />
Prompt bestellt man in <strong>Viterbo</strong> einen Orsini zum Bürgermeister<br />
und preist die Stadt mit ihren Vorzügen dem vermutlichen<br />
neuen Papst an. In diesem Brief aus dem Jahre 1278 verspricht<br />
man den Inquisitoren freie Hand. Bei Auseinandersetzungen<br />
um Immobilien solle die päpstliche Seite stets Recht erhalten.<br />
Ja, gar die Huren wolle man aus der Stadt vertreiben.<br />
Der Orsinipapst Nikolaus III. nutzt dergleichen Angebote ausgiebig<br />
und versorgt seine Familie mit Besitztümern um <strong>Viterbo</strong><br />
herum, ohne jedoch in die Stadt zu ziehen. Möglicherweise hat<br />
ihn die ein wenig übertriebene Offerte mit den auszuweisenden<br />
Huren abgeschreckt. Um über einen Umzug nachzudenken hat<br />
Nikolaus bis 1281 Zeit, dann ist er plötzlich um die Ecke ge-
acht. In der Folge jagen die Viterbesen die Orsini wie die Hasen.<br />
Am folgenden Ereignis tragen die Viterbesen jedoch selbst<br />
Schuld. 1281 brechen sie ins Konklave ein, verhaften zwei ihnen<br />
unbeliebte Kardinäle und sperren den Kardinal Matteo Rosso<br />
Orsini in den Hungerturm, allerdings nicht, ohne ihn vorher<br />
gehörig durchgeprügelt zu haben. Drei Wochen später wählt<br />
man Martin IV. zum Papst. Dieser befreit Orsini aus dem Bau,<br />
vergewissert sich dessen Blessuren und verlässt <strong>Viterbo</strong> wutschnaubend,<br />
tut dies allerdings nicht, ohne die Stadt in Bann zu<br />
schlagen.<br />
Sechsundneunzig Jahre lang wagt kein Papst mehr einen Fuß in<br />
die Stadt <strong>Viterbo</strong> zu setzen. Was die Viterbesen tun, tun sie<br />
gründlich, und sie pflegen an ihrem Brauchtum zu hängen. An<br />
eben dergleichen Bräuche gewohnt, bedrohen sie Urban V. mit<br />
tumultartigen Aufständen, als er im Jahre 1376 den Ort durchreist,<br />
so dass das geistliche Oberhaupt die Stadt fluchtartig verlässt.<br />
Dass sich daraufhin in <strong>Viterbo</strong> überhaupt noch Päpste blicken<br />
lassen, hängt damit zusammen, dass die Zustände in Rom noch<br />
schlimmer sind.<br />
*<br />
Wir wandern weiter in die Kathedrale<br />
**** S. Lorenzo. Der Dom des 12. Jhs. wurde auf Fundamenten<br />
der etruskischen Akropolis errichtet, im 14. Jh. gotisch verändert<br />
und 1560 mit neuer Fassade versehen. Der gotischtoskanische<br />
Campanile stammt aus dem 14. Jh. Im 2. Weltkrieg<br />
hat das Gotteshaus großen Schaden genommen. – Neben<br />
dem Bau steht das Baptisterium aus romanischer Zeit.<br />
Im Inneren teilen zwanzig Monolithsäulen mit beachtenswerten<br />
Kapitellen die drei Schiffe.<br />
Linkes Seitenschiff. Apsis: Madonna della Carbonara, 12. Jh.<br />
(Kopie; Original im Dommuseum). –<br />
5. Laurentius speist Arme, Gemälde von Carlo Maratta.
Rückwand: Freskenrest des 15. Jhs.: Muttergottes.<br />
Rechtes Seitenschiff. Außenwand: 1. Laurentius empfängt die<br />
Kommunion, von Marco Benefial, 18. Jh.; 2. (in der Kapelle)<br />
Altarblatt: Martyrium der Valentinus und Diarius, von Morandi,<br />
1697, sowie links wie rechts an den Wänden: Martyrium zweier<br />
Heiliger, von Ansanti; 3. Gemälde der Heiligen Familie mit<br />
Bernardino von Siena, von Giovanni Francesco Romanelli;
4. Gemälde der Enthauptung Johannes des Täufers, von Francesco<br />
d’Ancona, 1470;<br />
5. Davor: Taufbrunnen von 1470;
6. Kapelle mit der Vermählung der Katharina von Siena mit Jesus,<br />
zuzüglich zweier Heiliger, 13. Jh. sowie Freskenrest der<br />
Muttergottes (über dem Eingang), 14. Jh.<br />
Das Mittelschiff. Rest des ursprünglichen Bodenbelags aus dem<br />
12. Jh.<br />
Wir gehen aus dem Dom hinaus und rechts ins<br />
*** Dommuseum (10-13, 15-20 Uhr).
Stephanus und Laurentius, 14. Jh.<br />
Im Ticket ist drin: Sakrale Schätze des Museums (lohnend, auch, weil man<br />
dort ohne Führung durchgehen darf) sowie eine Führung in den Barockchor<br />
(wird aber nur gemacht, falls keine Messe ist), Führung in den Konklavesaal<br />
(nicht lohnend, da der Raum von innen total kahl sowie sehensunwert ist,<br />
auch nichts bringt und man einen halbstündigen Vortrag über sich ergehen<br />
lassen muss) und Führung in die Loggia (nicht lohnend, da die von außen viel<br />
schöner ist und von innen genauso aussieht). Empfehlung: Man gehe ins Museum<br />
und spare sich die Zeit der Führung.<br />
*** Torre di Borgognone, ein imposanter Turm,<br />
links über die „Piazza del Gesù“, vorbei an einer ** Fontana aus alten Teilen,<br />
z. B. des 14. Jhs., doch soll die Schale romanisch sein, und in die Kirche<br />
*** Il Gesù (bzw. San Silvestro). Das Gotteshaus ist ein romanischer<br />
Bau des 11. Jhs., dessen Fassade an den Dachschrägen<br />
von Tierskulpturen bekrönt wird.<br />
Das Innere. Das Holzkruzifix wurde im 17. Jh. geschnitzt. –<br />
Das Fresko Noli me tangere ist von 1540.<br />
Guido von Monfort<br />
Kronprinz Eduard I. von England tötete in einer Schlacht den<br />
Oppositionellen Earl of Leicester, letzterer ein Spross aus dem<br />
Hause Monfort war. Das hatte zur Folge, dass die Beziehung<br />
zwischen den beiden Geschlechtern arg belastet wurde. Um nun<br />
die schlechte Stimmung zwischen den beiden Adelsfamilien<br />
aufzulockern, sandte Eduard I. seinen Bruder, den Prinzen<br />
Heinrich von Cornwall, nach <strong>Viterbo</strong>, dort nämlich weilte Guido<br />
de Monfort, Sohn des Earl of Leicester, welcher von Karl<br />
von Anjou hier als Vikar eingesetzt worden war. Heinrich von<br />
Cornwall hatte die Aufgabe, Frieden zu stiften.<br />
Leider kam es nicht dazu. Während einer Messe in der Kirche Il<br />
Gesù am 14.3.1272 stürmte Guido in die heilige Handlung hinein,<br />
um sich Heinrich vorzunehmen. Dieser, unbewaffnet, konnte<br />
noch bis zum Altar flüchten, sich, den Herrn um Hilfe anflehend,<br />
daran festhalten, was ihm jedoch nichts nutzte. Guido<br />
schlug mit seinem Schwert auf ihn ein, hieb ihm einfach die<br />
Hand ab, packte ihn und schleifte den an der Angelegenheit völlig<br />
unschuldigen Heinrich aus der Kirche hinaus. Auf dem<br />
Kirchplatz angekommen, war Heinrich schon im Himmel. Guido<br />
flüchtete vor den Viterbesen, die Prinz Heinrich sehr gemocht<br />
hatten.
Papst Gregor X. versprach Eduard eine gründliche Untersuchung<br />
des Vorfalles; anstatt einer Bestrafung handelte sich<br />
Guido 1277 die Verzeihung des Papstes ein, avancierte und<br />
vergnügte sich schließlich als Kommandant der vatikanischen<br />
Truppen.<br />
*<br />
Wir gehen aus der Kirche hinaus, auf dem Platz nach links in die „Via del<br />
Gesù“, auf der Quergasse rechts und vorbei am links erbauten<br />
*** Palazzo Chigi, ein Renaissance-Bauwerk, neben mittelalterlichem<br />
Turm, mit beachtenswertem Innenhof, darin Loggia,<br />
Portale, Treppenaufgänge und Holzdecken eine Einheit bilden.<br />
Auf der quer verlaufenden Via S. Lorenzo wandern wir links. – Später wandern<br />
wir auf die<br />
***** Piazza del Plebiscito, das historische Zentrum <strong>Viterbo</strong>s.<br />
Die Gebäude aus der Zeit zwischen 1450 und 1550 bilden ein<br />
einheitliches Ensemble.<br />
Hier wandern wir zum links erbauten<br />
*** Palazzo del Prefettura, der ursprünglich aus dem 15. Jh.<br />
stammt, auch Palazzo Comunale heißt und 1771 neu konstruiert<br />
wurde, mit erholsamem Hof (nicht mehr zugänglich; Polizei) samt<br />
Loggia und Brunnen. – Die Ratskapelle im Inneren wurde 1610<br />
barock stuckiert. Die berühmten Persönlichkeiten im Ratssaal<br />
wurden 1558 gemalt. Baldassare Croce schuf 1588 die Bilder<br />
aus der viterbischen Geschichte im Parlamentssaal.<br />
Johann Caspar Goethe<br />
Mai 1740: „Lassen Sie mich nun berichten, dass ich auf dem<br />
Weg nach Florenz über Storta, Bracciano, Monterosi,<br />
Ronciglione und Montagna nach <strong>Viterbo</strong> reisen musste; alle<br />
diese Orte sind Poststationen, das kleine Dorf Ronciglione ausgenommen,<br />
das der Familie Borghese gehört, wie das Wappen<br />
an den Türen anzeigt. Schließlich erreichte ich <strong>Viterbo</strong>, das die<br />
Hauptstadt von der Gräfin Mathilde dem päpstlichen Stuhl geschenkten<br />
Gebietes und zugleich die Vaterstadt des verlogenen<br />
Dominikanermönchs und Geschichtsschreibers Giovanni Annio<br />
ist. <strong>Viterbo</strong> ist von mittlerer Größe, überwiegend aus Stein erbaut<br />
und wird von einer Mauer umgeben. Außerdem ist es mit<br />
viereckigem Felsgestein gepflastert.<br />
Einst war <strong>Viterbo</strong> eine namhafte Stadt, dennoch genießt es heute,<br />
trotz seiner vielen Bewohner kein großes Ansehen mehr. Die<br />
Kürze meines Aufenthaltes gestattete mir zwar keine langen<br />
Besichtigungen, aber ich konnte immerhin dem Rathaus einen<br />
flüchtigen Besuch abstatten...“<br />
*<br />
Diesem Palast rechtwinklig angebaut ist der<br />
*** Palazzo dei Priori, aus dem 15./16. Jh.
Hier befinden sich im schönen Innenhof
ein Brunnen des 17. Jhs., stehen etruskische Sarkophage.<br />
*** Palazzo del Podestà, ein Gebäude des 13. Jhs., das vielfach<br />
umgebaut wurde.<br />
Dort steht auch die<br />
*** Stadtsäule mit den Wahrzeichen Löwe, Palme und Adler.<br />
Östlich steht die Kirche<br />
*** Sant’Angelo. Der schlichte romanisch-lombardische Bau<br />
aus dem 11. Jh. wurde immer wieder umgebaut. An der Mauer<br />
der romanischen Kirche ist der Sarkophag der Galiana (Kopie)<br />
angebracht.<br />
Galiana.<br />
Eine Legende belegt die Rivalität zwischen Rom und <strong>Viterbo</strong>.<br />
Die Viterbesin Galiana soll im 12. Jahrhundert gelebt haben<br />
und von einem Römer zur Frau erwählt worden sein. Sie verweigerte<br />
sich diesem jedoch hartnäckig. Daraufhin war der stolze<br />
Römer so unfreundlich, die Stadt zu belagern. Als ihm sein<br />
Unterfangen jedoch keinen Erfolg beschied, entschloss er sich,<br />
wieder abzuziehen, vorausgesetzt, die von ihm geliebte Galiana<br />
verabschiede ihn von der Höhe der Stadtmauer herab. Die Bedingung<br />
wurde erfüllt. Als Galiana hoch oben auf den Zinnen<br />
stand, holte sie ein Pfeil vom Bogen des heimtückischen Römers<br />
von dort herunter.<br />
*<br />
Wir verlassen die Piazza durch den Bogen zwischen dem Palazzo del Podestà<br />
und dem Palazzo dei Priori. Sollte der Zugang hier möglich sein, so gelangt<br />
man in den ersten Stock des Podestà-Palastes. Dort könnte man das soeben<br />
beschriebene Innenleben bestaunen. Ansonsten kommen wir zur links unterhalb<br />
der Straße erbauten, über die Treppe zu erreichenden Kirche<br />
*** S. Maria della Salute. Die Kirche der Maria der Rettung/des<br />
Heils aus dem 14. Jh. ist ein Zentralbau und besitzt eine<br />
Fassade im Schachbrettmuster aus rotem und weißem Marmor,<br />
darin eingelassen ein gotisches Portal von 1320, auf dem<br />
Weinlaub und Reben die Barmherzigkeit darstellen; außerdem<br />
sieht man u. a. den thronenden Jesus, Maria sowie die Höllenfahrt,<br />
Kreuzigung und Heilige.<br />
Wir gehen aus der Kirche hinaus, links treppauf, auf der „Via Ascenzi“ links,<br />
dann über den Platz, daraufhin vor der Rotunde<br />
*** S. Maria della Peste, der Pestkirche von 1494, jetzt
Wir gehen aus der Kirche hinaus und halten Richtung auf die „Via Maria SS.<br />
Liberatrice“. – Später wandern wir auf der „Piazza S. Faustino“ in die Kirche<br />
*** SS. Faustino e Giovita. Zurückgehend auf das 13. Jahrhundert<br />
wurde die Kirche bis ins 18. Jh. immer wider verändert<br />
und zeigt sich daher im klassizistischen Gewande. Der Turm ist<br />
aus dem 17. Jh.<br />
Das Innere. Links des Hauptaltars befindet sich ein Bild byzantinischer<br />
Schule des 16. Jhs.: Die Jungfrau von Konstantinopel.<br />
Wir gehen aus der Kirche hinaus und auf der Piazza links auf die „Via S.<br />
Faustino“. – Kurz darauf wandern wir links ins Museum in der Burg
*** Rocca Albornoz. Der Komplex ist eine päpstliche Zwingburg<br />
von 1357, die vielfach umgebaut wurde.<br />
Aegidius Albornoz<br />
Um 1310 geboren, 1467 gestorben erreichte es der Spanier zu<br />
den Ersten seiner Zeit zu zählen. Besonders die Städte Latiums<br />
und Umbriens sind mit seinem Namen verbunden. Albornoz<br />
brachte es bis zum kastilischen Erzbischof und königlichen<br />
Kanzler. Als er mit dem König in Konflikt geriet, floh er zum<br />
Hof des Papstes, der zu jener Zeit in Avignon weilen musste.<br />
1350 wurde er dort zum Kardinal erhoben. Der Papst sandte ihn<br />
als Legaten nach Mittelitalien, wo er die dem Klerus abtrünnigen<br />
Städte, die an der Kaisertreue festgehalten hatten oder von<br />
Signori regiert wurden, zurückeroberte. So die Herrschaft wieder<br />
an die in Avignon lebenden Päpste bringend, bereitete er<br />
den Boden für die Rückkunft des Heiligen Vaters nach Rom.<br />
*<br />
*** Museo Nazionale Etrusco. (Mi-Mo 9-19.30 Uhr). Das Archäologische<br />
Museum informiert per Schautafeln und Modellen<br />
über das Leben der Etrusker, es stellt deren gefundene Tonwaren<br />
und Grabbeilagen aus, zeigt den ersten etruskischen Zweiradwagen<br />
sowie Säulen und römische Musen.<br />
Wir gehen aus dem Museum hinaus, nach links, auf der „Piazza di Rocca“ her<br />
zwischen rechts stehendem<br />
*** Brunnen von 1575<br />
und links erbauter<br />
*** Porta Fiorentina<br />
auf die „Via S. Francesco“. – Später wandern wir in die Kirche<br />
*** S. Francesco alla Rocca. Der gotische Bau der Burgkirche<br />
von 1236 mit Veränderungen von 1373, der im Zweiten Weltkrieg<br />
fast völlig zerstört worden war, besitzt ein Portal von<br />
1372 und eine Außenkanzel des 15. Jhs., von der 1426 Bernardino<br />
von Siena predigte.
Das Innere ist einschiffig. Die Holzdecke wird von fünf Spitzbögen<br />
getragen.<br />
Rechter Querhausarm, Rückwand: Grabmal des Pietro di Vico<br />
(+1268) mit Marmorintarsien.<br />
Frontwand: Von Cosmaten geschmücktes Grabmal. mit liegendem<br />
Hadrian V. (+1276).<br />
Die Cosmaten<br />
Cosmaten nannte sich ein Zusammenschluss mehrerer Künstlerfamilien<br />
zwischen 1150 und 1350, die Cosmas als Vornamen
evorzugten. Sie schufen Mosaiken in Anlehnung an die arabischen<br />
Vorbilder Süditaliens.<br />
*<br />
Die Figur des Hadrian schuf Arnolfo di Cambio.<br />
Arnolfo di Cambio<br />
Arnolfo di Cambio, dessen Geburtsdatum um 1245 in Colle di<br />
Val d’Elsa angesetzt ist, gilt als der Hauptmeister der italienischen<br />
Gotik. Zunächst war er in Rom und in Perugia als Bildhauer<br />
tätig, unterhielt gegen Ende seines Lebens Werkstätten in<br />
Rom und Florenz. Die ersten Pläne für den Palazzo Vecchio,<br />
für den Dom und für S. Croce, sämtlich in Florenz, werden ihm<br />
zugeschrieben. Als Schüler von Niccolò Pisano arbeitete er<br />
auch an der Domkanzel in Siena mit. Ähnlich anderen Bildhauern<br />
trat er, wie oben gesehen, auch als Baumeister auf. Arnolfo<br />
starb in Florenz um 1302.<br />
*<br />
Linker Querhausarm: 1. Grabmal Clemens’ IV. (+1268) von<br />
P. Oderisi; davor liegend: Kardinal Pierre Le Gros de Saint-<br />
Gilles; 2. Grabmal für Gerardo Landriano (+1445).<br />
*** Theater, ein Bau von Virgino Vespignani im Stil des Klassizismus,<br />
von 1855,<br />
steht, zu Gunsten der „Via S. Rosa“. – Kurz darauf gelangen wir in die Kirche<br />
*** S. Rosa. Die Wallfahrtskirche ist aus dem 19. Jh., mit einer<br />
Fassade von 1908 und gewaltiger Kuppel aus derselben Zeit.<br />
Rosa.<br />
Rosa, die Franziskanerterziarin, ist die Stadtpatronin <strong>Viterbo</strong>s.<br />
Die Klarissinnen verweigerten die Aufnahme Rosas in ihren<br />
Orden aus wohlbedachten Gründen. Man kann es auch so ausdrücken:<br />
...wegen ihrer Armut verweigerten ihr die Klarissinnen<br />
die Aufnahme. Rosa lebte zwischen 1233 und 1252 und war militante<br />
Papstgängerin, die zum Kampf gegen den waiblinger<br />
Stauferkaiser aus Sizilien, Friedrich II., aufrief. Man kann es<br />
auch so ausdrücken: ...rief in öffentlichen Predigten die Mitbürger<br />
zur Treue zum Papst auf. Mit acht Jahren soll sie schon auf<br />
den Zinnen der Stadt gestanden und den Kaiser geschmäht haben.<br />
Fanatisch ging sie gegen angebliche Häretiker vor.<br />
Irrwitzigerweise wurde sie von den Viterbesen 1249 aus der<br />
Stadt gejagt.<br />
Viel mehr verbrachte sie zu Lebzeiten nicht, vor allem keine<br />
Wunder. Diese stellten sich angeblich erst nach ihrem Tode ein.<br />
Da ihr Körper nicht verweste – man kann es auch so ausdrücken:<br />
...den wollten weder Erd’ noch Himmel –, fanden auch<br />
prompt wundersame Heilungen an ihrem Grabe statt – aber nur<br />
angeblich. So schrieb man vor allem die Ausmerzung der Pest<br />
im Jahre 1643 ihrer Fürbitte zu. Fehlender messbarer Wunder<br />
wegen wurde sie zum Verrecken nicht heilig gesprochen. Das<br />
wohl einzige Wunder stellte sich im 17. Jh. ein. Von nun an<br />
nämlich rechnete sie die Volksseele zur Heiligen – aus Versehen.<br />
Und das ist wirklich ein Wunder.<br />
*<br />
Der Chor. Das Hochaltarbild malte Francesco Modesti, um<br />
1900: Rosa, die Angehörige des Dritten Ordens.<br />
Der Dritte Orden<br />
Nach den Bettelorden kamen im 13. Jh. diese so genannten<br />
Dritten Orden auf. Der erste Orden waren die männlichen<br />
Geistlichen, Mönche, die im Kloster lebten. Der zweite Orden<br />
waren die weiblichen Geistlichen, Nonnen, die in Klöstern lebten.<br />
Der dritte Orden waren die Laien, Tertiäre, die weltlich<br />
oder im Berufsleben tätig wurden und sich bedingungslos den<br />
beiden ersten Orden unterstellten.<br />
*<br />
Linkes Seitenschiff. 2. Kapelle: Polyptychon (vielteiliger Flügel)<br />
von Ballatta, 1441: Muttergottes.<br />
Malerschule von <strong>Viterbo</strong>
Die Malerschule errang in der Zeit des 14. bis 16. Jhs. höchste<br />
Bedeutung. Ihre größten Vertreter waren die zugleich größten<br />
Maler Latiums im 15. Jahrhundert: Lorenzo da <strong>Viterbo</strong> und<br />
Matteo Giovannetti. Aber auch Pastura (Antonia da <strong>Viterbo</strong>)<br />
und Ballatta (Francesco d’Antonio) gehören dazu.<br />
*<br />
3. Kapelle: Muttergottes und Heilige, Gemälde des 19. Jhs.<br />
Rechtes Seitenschiff: 2. Kapelle: Hinter verziertem Gitter im<br />
Schrein: Gebeine der Rosa.<br />
*** S. Giovanni in Zoccoli. Dem romanischen Raum des 12.<br />
Jhs. der Sockel-Johannes-Kirche wurde in der Fassade ein Rosenfenster<br />
mit Evangelistensymbolen und Adlern verliehen.<br />
Im Inneren befindet sich ein Polyptychon (vielflügeliger Altar)<br />
von Ballatta (1441): Muttergottes mit Heiligen.<br />
Wir wandern Richtung haltend über die Piazza und durch den Hausbogen. –<br />
Kurz darauf wandern wir links auf die „Via Niccolo della Tuccia“, halten uns<br />
links durchs Mauertor, gehen in der Unterführung unter der Straße her und ins<br />
*** Museo Civico (Mi-Mo 9-19). Die Exponate werden in den<br />
Räumlichkeiten des aufgelassenen Klosters gezeigt.<br />
, in der Pinakothek Werke von, Vitale da Bologna, Pastura,<br />
Andrea della Robbia u. a. gezeigt sowie eine Pietà von 1524<br />
des Piombo.<br />
Wir gehen aus dem Museum hinaus, nach links und in die Kirche<br />
*** S. Maria della Verità. Die Wahrheitskirche aus dem 14.<br />
Jh. wurde in der Renaissancezeit des 15. Jhs. radikal vergrößert,<br />
im 2. Weltkrieg zerbombt und danach wieder aufgebaut.<br />
Linkes Querhaus: 1. Nährende Maria, 14. Jh.;<br />
2. Fabian, zwischen Sebastian und Rochus, aus dem Umkreis<br />
von Antoniazzo Romano, 15. Jh.; 3. Dreifaltigkeit, aus der<br />
Schule des L. da <strong>Viterbo</strong>, 16. Jh.; 4. Stigmatisation des Franz<br />
von Assisi.<br />
Das Schiff: Linke Wand: Thronende Muttergottes zwischen Johannes<br />
dem Täufer und Dominikus, von 1611.
Rechte Kapelle: Fresken der Zeit vor 1500: 1. Geburt Mariens<br />
(rechte Wand), 2. Darstellung Mariens im Tempel (linke<br />
Wand), 3. Vermählung der Jungfrau Maria, von Lorenzo da<br />
<strong>Viterbo</strong> (linke Wand).<br />
Lorenzo da <strong>Viterbo</strong><br />
Der Stil des Malers, ein Zeitgenosse des Piero della Francesca,<br />
verrät umbrische Einflüsse.<br />
*<br />
*** Casa di Giovanni di Antonio Baciocchi, das Haus des<br />
Barbiers von Papst Paul III., 1540,<br />
und rechts die Nr. 34,<br />
*** Palazzo dei Mazzatosta.<br />
Später wandern wir auf der „Via Saffi“ links. – Später steigen wir treppab und<br />
gelangen ins<br />
*** Museo della Ceramica (Apr.-Sept. Do-So 10-13, 16-19).<br />
Wir gehen aus dem Museum hinaus, steigen treppauf und wandern vor der<br />
*** Casa Poscia, ein mittelalterlicher Palast des 14. Jhs. mit<br />
fein strukturiertem Treppenaufgang,<br />
rechts. – Auf der „Piazza Fontana Grande“ wandern wir Richtung haltend auf<br />
der „Via G. Garibaldi“ weiter.<br />
5 Minuten später wandern wir hinter der Porta Romana rechts.<br />
2 Minuten später wandern wir an der Gabelung links.<br />
3 Minuten später wandern wir zur Stazione Porta Romana in <strong>Viterbo</strong>.
<strong>Viterbo</strong><br />
RK 07<br />
Ende<br />
*
Diese Kirche liegt außerhalb der Stadt im Nordosten!<br />
(*** Madonna della Quercia. Die Wallfahrtskirche der Muttergottes<br />
an der Eiche wurde zwischen 1470 und 1525 als das<br />
vielleicht harmonischste Renaissance-Bauwerk des gesamten<br />
Latium errichtet. Von der einstigen Vorhalle der quaderverblendeten<br />
Fassade von 1509 sind noch vier Säulen und Pilaster<br />
erhalten. Im Dreiecksgiebel bewachen zwei Löwen das an einer<br />
Eiche aufgefundenen Gnadenbild. In den Lünetten der Portale<br />
stehen Majoliken von 1508 des Andrea della Robbia.<br />
Das dreischiffige Innere besitzt eine Kassettendecke der Renaissance,<br />
nach einem Entwurf des Antonio di Sangallo d. J.,<br />
1518; sie zeigt das Wappen des Farnese-Papstes, Paul III.<br />
Im Apsisgewölbe befindet sich ein Rundbild der Madonna della<br />
Quercia von Truffetta (1519). - Die Bilder hinter dem Hochaltar<br />
stammen von Frau Bartolomeo 1543 (Gottvater), Marietto<br />
Albertinelli (Marienkrönung, Himmelfahrt). - Den Hochaltartabernakel<br />
aus Marmor schuf Andrea Bregno 1490. - Das Chorgestühl<br />
mit seinen Intarsien ist von 1514. - Die Orgel stammt<br />
aus barocker Zeit. Vom Kreuzgang schuf Daniele da <strong>Viterbo</strong><br />
das Untergeschoß, wohingegen das Obergeschoß, um 1500, einem<br />
Bramante-Schüler zugeschrieben wird. Der Ort war einst<br />
wundertätige Stätte.<br />
Michel de Montaigne<br />
„Die Kirche ist schön, voll von heiligem Schmuck und unzähligen<br />
Weihegeschenken. Die lateinische Inschrift besagt, dass vor<br />
ungefähr hundert Jahren ein Mann, von Räubern verfolgt und<br />
halbtot, sich zu einer Eiche geflüchtet habe, an der sich dieses<br />
Bild der Madonna befand; er flehte sie an und wurde durch ein<br />
Wunder für die Räuber unsichtbar und entkam so der nahen<br />
Gefahr. An dieses Wunder knüpft sich die besondere Verehrung<br />
der Madonna.“<br />
Carlo Borromeo<br />
So steht es im Führer. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht<br />
abgelaufen. Gott sei Dank, können wir Nachgeborenen sagen.<br />
Erbauen wir uns also.<br />
Unglücklicherweise muss dem Kardinal Giovanni Francesco<br />
Gambara mitten in seine in Ausführung stehende Planung ein<br />
seltsamer Heiliger in die Quere kommen: Carlo Borromeo. Jener<br />
bis zur Selbstaufgabe sich für Reformen hingebende<br />
Milanese liest dem Kardinal die Leviten und reibt ihm Vergeudung<br />
unter die Nase. Statt solch unchristlicher Verschwendung<br />
soll Giovanni Francesco doch bitte ein Nonnenkloster bauen.<br />
Auch das noch. Da war nichts zu machen. Der hl. Karl Borromäus,<br />
wie er so schön deutsch geheißen wird und somit wie ein<br />
germanischer Heiliger wirkt, führt eine Spesenkontrolle ein, der<br />
sich der Kardinal zu unterwerfen hat, und prompt ist der Bauherrlichkeit<br />
erst einmal ein Ende gesetzt. Aber gewiefte Katholiken<br />
wären keine gewieften, wenn sie keinen Ausweg fänden.<br />
Und der Schlauesten aller dürfte der Herr im Himmel sein. Der<br />
nämlich nahm den hl. Borromäus aus dem Leben. Das muss den<br />
Bauherrn zu neuer und noch eifrigerer Tätigkeit angeregt haben,<br />
denn im Todesjahr des Heiligen schreibt jemand der zu eben jener<br />
Zeit dort weilt und der es wissen muss:<br />
Michel de Montaigne,<br />
„Vor allem kommt das Wasser frisch aus der Quelle...und zwar<br />
in solchem Überfluss ..., dass es für tausend Wasserkünste<br />
reicht. Neben den tausend Teilen jenes kunstreichen Körpers<br />
erblickt man eine hohe Pyramide, welche in zahlreichen Abwechslungen<br />
das Wasser in die Höhe spritzt...Die Teiche und<br />
die Pyramiden vermag man auf schönen Wegen zu umschreiten,<br />
welche von hübschen, kunstreich in Stein gearbeiteten Geländern<br />
gefasst sind.
Im Westen von San Martino:<br />
Castello di Vignanello<br />
***** Giardino all’italiana. Der Anlage sind zwei Palazzini<br />
mit Loggien, vier Mohren (von Taddeo Landini), eine Fontana<br />
dei Lumini, also ein Brunnen der Lichter, Grotten, die Fontana<br />
dei Giganti, also ein Brunnen von Flusspersonifikationen, ein<br />
Delphinbrunnen und ein Sintflutbrunnen eingeplant.<br />
Liegt nahe <strong>Viterbo</strong>, allerdings außerhalb der Stadt im Osten.<br />
Bagnaia<br />
*** Villa Lante. 1477 begonnen wird der Bau der Villa unter<br />
Kardinal Giovanni Francesco Gambara zwischen 1566 und<br />
1578 von Vignola vollendet. Kardinal Alessandro Montalto<br />
lässt dann zwischen 1585 und 1590 einen weiteren Pavillon und<br />
die Brunnen des Parks anlegen.<br />
RK A07<br />
<strong>Viterbo</strong><br />
Ende<br />
*