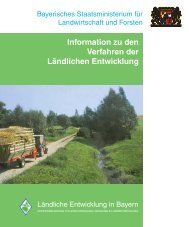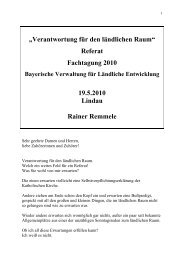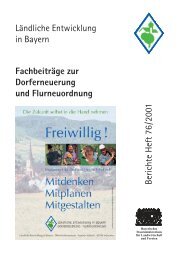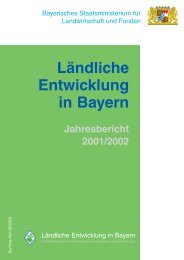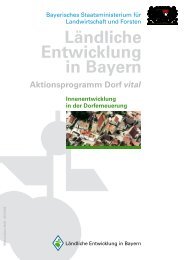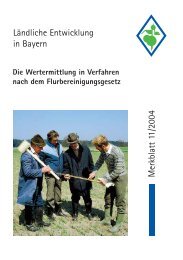Naturnahe Hecken durch Verwendung autochthoner Gehölze
Naturnahe Hecken durch Verwendung autochthoner Gehölze
Naturnahe Hecken durch Verwendung autochthoner Gehölze
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sträucher für die naturnahe Pflanzung häufig<br />
erhebliche Probleme auftreten. Eine Lösung ist<br />
die Anzucht dieser Arten aus autochthonem, im<br />
Gebiet gesammelten Samenmaterial. Voraussetzung<br />
ist eine relativ langfristige Planung der<br />
Pflanzung.<br />
(7) Nicht alle Standorte bieten gleichermaßen<br />
Lebensraum für strauchförmige Formationen, wie<br />
sie für <strong>Hecken</strong> typisch sind. Auf sauren Böden<br />
fallen die basiphilen eigentlichen Straucharten<br />
zunehmend aus (vgl. REIF, SCHULZE, ZAHNER<br />
1982) und auf den entsprechenden Rainen finden<br />
sich im Extremfall nur noch Saumgesellschaften.<br />
Hier muß zwischen einer Förderung der Strauchvegetation<br />
und der von Krautformationen<br />
(Anlage von Saumstandorten bzw. Rainen)<br />
abgewogen werden.<br />
Ähnliche Gedanken zur Anlage naturnaher <strong>Hecken</strong><br />
wurden auch in Südbayern (PFADENHAUER und<br />
WIRTH 1988), der Schweiz (VOGEL 1975) und Österreich<br />
(GRABHERR und WRBKA 1988) geäußert, und<br />
entsprechende Ansätze werden auch in Schleswig<br />
Holstein verfolgt (LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ<br />
UND LANDSCHAFTSPFLEGE 1983). Nur so können<br />
Fehler, wie beispielsweise die Anpflanzung einer<br />
wärmeliebenden Liguster-Hartriegel-Hasel-Hecke<br />
in den kühlen Hochlagen des Bayerischen Waldes<br />
(vgl. REIF 1985), vermieden werden. Die Berücksichtigung<br />
dieser Kriterien ist wichtig, um die Besonderheit<br />
eines jeden Gebietes bezüglich seiner <strong>Hecken</strong>vegetation<br />
auch nach Umgestaltungsmaßnahmen<br />
erhalten zu können.<br />
(8) Alle Formationen der <strong>Hecken</strong> verdanken ihre<br />
Existenz letztlich den Menschen. Bereits bei der<br />
Neuanlage einer Hecke müssen Fragen der Vegetationsentwicklung,<br />
der auftretenden Sukzessionen<br />
und ihrer Steuerung überlegt werden.<br />
Daher sind auch in der Folgezeit Bewirtschaftungsmaßnahmen<br />
unterschiedlicher Intensität<br />
vorzusehen. Nur <strong>durch</strong> eine spätere Bewirtschaftung<br />
wird sich ein von der Pflanzung unabhängiges<br />
Gleichgewicht zwischen den Arten einstellen<br />
können, und ihr heckentypischer »Stockausschlagcharakter«<br />
bleibt gewahrt. Das Durchwachsen<br />
der Baumarten zu Bäumen, die die<br />
lichtliebenden Sträucher zunehmend verdrängen,<br />
kann nur <strong>durch</strong> regelmäßigen Hieb verhindert<br />
werden. Die Lichtphasen nach einem Hieb ermöglichen,<br />
daß von Natur aus neu eingebrachte<br />
Keimlinge anderer Arten, etwa von Holunder oder<br />
den verschiedenen Brombeeren, keimen und aufwachsen<br />
können.<br />
Eine Bewirtschaftung ist also nötig, um aus dem<br />
»Kunstprodukt« schließlich »Natur« werden zu<br />
lassen. Zukünftig sollten Konzepte entwickelt<br />
werden, die echte Komponenten einer <strong>Hecken</strong>bewirtschaftung,<br />
und nicht nur -pflege, enthalten.<br />
Diese Konzepte müßten im wesentlichen auf eine<br />
Nutzung des anfallenden Holzes hin ausgerichtet<br />
sein.<br />
(9) Aus landschaftspflegerischen und ökologischen<br />
Gründen ist eine gebietsspezifische, landschaftstypische<br />
Anordnung der Neupflanzungen<br />
im Gelände anzustreben (vgl. MÜLLER 1989,<br />
1990). Beispielsweise sollten in Gebieten mit<br />
<strong>Hecken</strong> radial zum Hang keine Querhecken angelegt<br />
werden, und umgekehrt.<br />
30 Materialien zur Ländlichen Entwicklung 33/1995