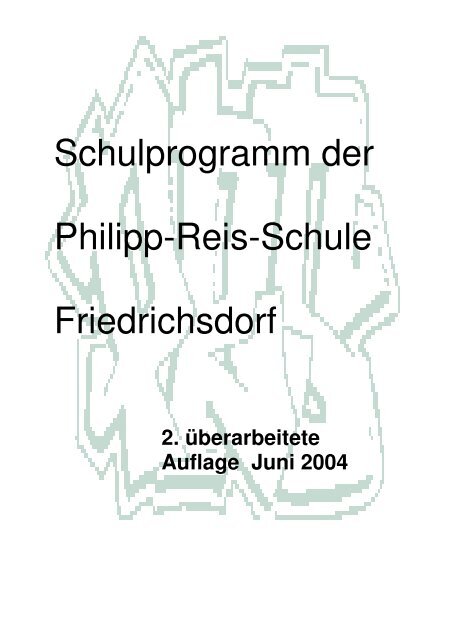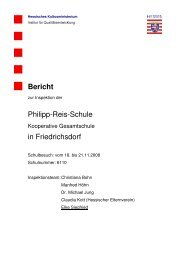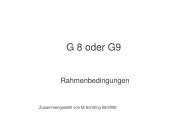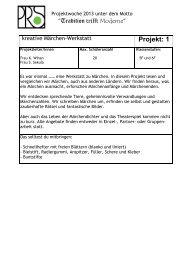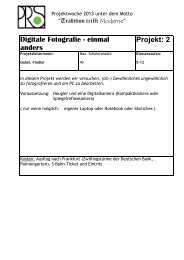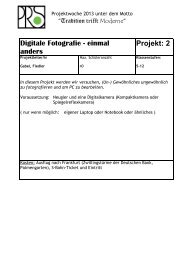Ziel - Philipp-Reis-Schule
Ziel - Philipp-Reis-Schule
Ziel - Philipp-Reis-Schule
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schulprogramm der<br />
<strong>Philipp</strong>-<strong>Reis</strong>-<strong>Schule</strong><br />
Friedrichsdorf<br />
2. überarbeitete<br />
Auflage Juni 2004
PRÄAMBEL UND PÄDAGOGISCHE LEITLINIEN 4<br />
1 ENTWICKLUNG DER PHILIPP-REIS-SCHULE 5<br />
2 DIE PRS UND IHR UMFELD 6<br />
3 ORGANISATIONSFORM IM ÜBERBLICK 8<br />
4 SCHULZWEIGE 9<br />
4.1 Förderstufe 9<br />
4.2 Hauptschule 10<br />
4.3 Realschule 11<br />
4.4 Gymnasium 12<br />
4.5 Gymnasiale Oberstufe 13<br />
4.6 Gemeinsame Unterrichtsprojekte in den Klassen 5 und 6 14<br />
5 SCHULLEITUNG UND PÄDAGOGISCHES TEAM 15<br />
6 ZUSAMMENSETZUNG DER KLASSEN 17<br />
7 ZUSAMMENSETZUNG DES KOLLEGIUMS 18<br />
8 WAS HAT DIE PRS BISHER ERREICHT? 19<br />
8.1 Fachunterricht 19<br />
8.2 Medieneinsatz 20<br />
8.3 Fächerübergreifende Projekte 21<br />
8.4 Klassen- und Kursfahrten 22<br />
8.5 Schülervertretung 22<br />
8.6 Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern 23<br />
8.7 Öffnung der <strong>Schule</strong>/Zusammenarbeit außerschulischen Institutionen 24<br />
9 EVALUATION DER SCHULENTWICKLUNG SEIT 2002 25<br />
9.1 Was bisher erreicht wurde 25<br />
9.2 Problemfelder 27<br />
9.3 Konsequenzen für die Formulierung der neuen Vorhaben 31<br />
2
10 WAS STREBT DIE PRS AN? 31<br />
10.1 Allgemeine <strong>Ziel</strong>e 31<br />
10.1.1 Öffnung 35<br />
10.1.2 Konflikte 36<br />
10.1.3 Pädagogische Grundlagen 39<br />
10.1.4 Neubau 41<br />
10.2 Vorhaben im Prozess der Umsetzung 43<br />
10.2.1 Vorhaben 1: Teambildung 43<br />
10.2.2 Vorhaben 2: Konflikte demokratisch lösen 44<br />
10.2.3 Vorhaben 3: Lernen lernen 47<br />
10.2.4 Vorhaben 4: Umgang mit dem Schulgebäude 48<br />
10.2.5 Vorhaben 5: Vielfalt der Kulturen stärken 49<br />
10.2.6 Vorhaben 6: Wahlmöglichkeiten bieten 50<br />
10.2.7 Vorhaben 7: Eigenverantwortlicher Unterricht 51<br />
10.2.8 Vorhaben 8: Motivation für musische Fächer 52<br />
10.3 Neue Arbeitsvorhaben 53<br />
10.3.1 Vorhaben 9: Steuergruppe 53<br />
10.3.2 Vorhaben 10: Ganztageskonzeption 54<br />
10.3.3 Vorhaben 11: Spanisch in der Realschule 56<br />
10.3.4 Vorhaben 12: Konzept für Schulschwänzer 57<br />
10.3.5 Vorhaben 13 Förderung von Deutsch als Zweitsprache 58<br />
10.3.6 Vorhaben 14: Förderung leistungsschwacher SchülerInnen 59<br />
10.3.7 Vorhaben 15: Erarbeitung einer Schulvereinbarung 60<br />
10.4 Zukunftsperspektiven 61<br />
11 ENTSTEHUNGSPROZESS DES SCHULPROGRAMMS 62<br />
12 ANHANG 63<br />
12.1 Die Arbeit an dem Ganztagskonzept für die PRS 63<br />
12.2 Medienkonzept -Curriculum für die neuen Medien 65<br />
12.3 Lernen Lernen Konzept 68<br />
12.4 Öffnung nach außen – die PRS und ihre Kooperationspartner 70<br />
12.5 Zuständigkeiten und Aufgaben 73<br />
12.5.1 Schulleitung und Verwaltung 73<br />
12.5.2 Gremien 73<br />
12.5.3 Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben 74<br />
12.5.4 Zukunftsperspektive„Besondere Aufgabengebiete“ 75<br />
12.6 Fortbildungsplan 77<br />
3
Präambel und pädagogische Leitlinien<br />
Die <strong>Philipp</strong>-<strong>Reis</strong>-<strong>Schule</strong> (PRS) ist eine kooperative Gesamtschule, die einen Beitrag zur<br />
persönlichen Entfaltung von SchülerInnen und LehrerInnen leistet. Unser <strong>Ziel</strong> ist es, allen<br />
SchülerInnen entsprechend ihrer individuellen Begabung und individuellen<br />
Leistungsbereitschaft eine bestmögliche Schulausbildung zu bieten. Sie sollen nicht nur<br />
Fachkenntnisse aufnehmen, sondern auch Schlüsselqualifikationen erwerben. Die<br />
pädagogische Arbeit erfolgt in einem vielfältigen Zusammenwirken von Eltern, SchülerInnen<br />
und LehrerInnenn, das für alle Teile der Schulgemeinde Zugewinn, Chance und Bereicherung<br />
bedeutet.<br />
Im Rahmen dieser <strong>Ziel</strong>setzung ergeben sich daraus als pädagogische Leitlinien:<br />
Vielfalt:<br />
Verantwortung:<br />
Identifikation:<br />
Leistung:<br />
Die PRS bietet eine Vielfalt von Lern- und<br />
Erfahrungsfeldern an, um den unterschiedlichen<br />
Voraussetzungen und Bedürfnissen der SchülerInnen<br />
gerecht zu werden. Wir sind Neuem gegenüber<br />
aufgeschlossen und gehen innovative Wege, um bei der<br />
Gestaltung des schulischen Miteinanders auch<br />
gesellschaftlichen Veränderungen und pädagogischen<br />
Entwicklungen Raum zu geben.<br />
Wir verstehen die Befähigung zur Übernahme von<br />
Verantwortung für die eigene Person und für Mitmenschen<br />
und Umwelt als einen fundamentalen Erziehungsauftrag.<br />
Die PRS legt Wert auf die Entwicklung und Förderung<br />
eines Wir-Gefühls zur Stärkung der Schulgemeinschaft.<br />
Basis des Zusammenlebens sind Miteinander und<br />
Toleranz, die Ausgrenzung erschweren. Wir wollen ein<br />
Klima schaffen, in dem Wohlbefinden und angstfreies<br />
Miteinander möglich ist.<br />
Die PRS ist ein Ort, an dem Leistungsbereitschaft<br />
gefördert wird und sich bewähren kann. Individuelle<br />
Leistung wird hier ebenso gefordert und findet ihren<br />
Raum wie kooperative Leistungen, die im Bezugsrahmen<br />
einer Gruppe erbracht werden.<br />
4
1 Entwicklung der <strong>Philipp</strong>-<strong>Reis</strong>-<strong>Schule</strong><br />
Von der "Maison d’éducation" zu einer schulformbezogenen (kooperativen)<br />
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe<br />
Die PRS ist benannt nach <strong>Philipp</strong> <strong>Reis</strong>, dem Erfinder des Telefons, der zunächst als<br />
wissbegieriger SchülerInnen und später als Lehrer am Institut Garnier, dem Vorläufer der<br />
PRS, tätig war.<br />
<strong>Philipp</strong> <strong>Reis</strong> war ein „Selfmademan“. Als elfjähriger Vollwaise zog er von Gelnhausen nach<br />
Friedrichsdorf, um am Institut Garnier seine Schulausbildung fortzusetzen.<br />
In seiner Person vereinen sich vielfältige Interessen (er lernte privat neben den im Institut<br />
Garnier unterrichteten Sprachen Englisch und Französisch auch noch Latein und Italienisch)<br />
ein von Wissensdurst getriebenes selbstständiges Arbeiten und eine außerordentliche<br />
Leistung auf einem Gebiet, die der Welt des 19. Jahrhunderts ungeahnte<br />
Kommunikationsmöglichkeiten bescherte. Ohne die Erfindung des Telefons wäre heute die<br />
weltweite Kommunikation, die sich uns durch E-mail und Internet erschlossen hat, nicht<br />
möglich.<br />
Kurzer Abriss der Entstehungsgeschichte der PRS<br />
1956 Einzug der <strong>Philipp</strong>-<strong>Reis</strong>-Realschule in das Gebäude des ehemals von L.F.<br />
Garnier gegründeten „Maison d´éducation“ (1836 - 1924)<br />
1970 Umzug der damaligen <strong>Philipp</strong>-<strong>Reis</strong>-Mittelschule in das Gebäude am Hohen<br />
Weg (Grund- und Hauptschule sowie Realschule unter eigener Leitung)<br />
ab 1971<br />
Errichtung einer Dépendance der Kaiserin-Friedrich-<strong>Schule</strong>,<br />
Bad Homburg (5 – 10. Klasse)<br />
1975 / 76 Hauptschule und Realschule mit eigener Leitung (die Grundschule erhielt<br />
ein neues Gebäude)<br />
1977 Einführung eines eigenständigen Gymnasialzweiges (20. Mai 1977: PRS -<br />
Gesamtschule des Hochtaunuskreises) und Einführung der Förderstufe<br />
1983 Einrichtung der gymnasialen Oberstufe<br />
1990/91 Einrichtung von gymnasialen Eingangsklassen 5 und 6 neben der<br />
Förderstufe und Aufbau des Pädagogischen Teams<br />
2000/2001 Erweitertung des Musikunterrichts mit „Musikklassen“<br />
seit 2002<br />
Einrichtung von Teamklassen, Unterricht in Jahrgangsteams,<br />
Erarbeitung von Konzepten zum Unterricht mit Ganztagesangeboten,<br />
Erprobung des Konzeptes der Ganztagesangebotsschule<br />
5
2 Die PRS und ihr Umfeld<br />
In den zurückliegenden Jahren hat die PRS in Friedrichsdorf ein Profil entwickelt als<br />
weiterführende <strong>Schule</strong> vor Ort, die durch ihre Unterrichtsarbeit und ihr Profil an die<br />
Bedürfnisse des Umfeldes anknüpft. In direkter Nähe Frankfurts hat sich die Region zu einem<br />
attraktiven Wohngebiet entwickelt, der Ausbau neuer Wohngebiete fördert den Zuzug nach<br />
Friedrichsdorf.<br />
Die SchülerInnen der PRS kommen in der Regel aus Friedrichsdorf und Umgebung. Nahezu<br />
alle nicht gymnasial geeigneten SchülerInnen der Region besuchen die Förderstufe der PRS,<br />
dazu kommen eine kleine Zahl SchülerInnen aus Bad Homburg und dem Usinger Land. Den<br />
Gymnasialzweig der PRS besuchen ca. 60% der gymnasial geeigneten SchülerInnen aus<br />
Friedrichsdorf. Hier ist eine traditionelle Abwanderung an die benachbarten Bad Homburger<br />
Gymnasien festzustellen. Im Laufe der Sekundarstufe I nimmt die PRS im geringen Umfang<br />
Seiteneinsteiger auf, überwiegend SchülerInnen, die von benachbarten <strong>Schule</strong>n zur PRS<br />
wechseln.<br />
Im Bereich der gymnasialen Oberstufe zeigt sich, dass das Einzugsgebiet der PRS weiter<br />
gefasst ist. Zwei Drittel der SchülerInnen der Klasse 11 kommen aus dem eigenen Haus, ca.<br />
40 SchülerInnen pro Jahr wechseln von den benachbarten <strong>Schule</strong>n, vor allem von der<br />
Gesamtschule am Gluckenstein, der Maria-Ward-<strong>Schule</strong> Bad Homburg und den umliegenden<br />
Gymnasien.<br />
Mit den umliegenden <strong>Schule</strong>n gibt es vielfältige Kooperationsformen mit dem <strong>Ziel</strong> den<br />
Schulwechsel zu erleichtern.<br />
Für den Übergang in die Klasse 5:<br />
o enge Zusammenarbeit mit den Friedrichsdorfer Grundschulen, wobei die Kooperation<br />
mit der Peter-Härtling-<strong>Schule</strong> noch weiter zu verbessern ist.<br />
o pädagogische Treffen der KlassenlehrerInnen der abgebenden Grundschulen mit den<br />
KlassenlehrerInnen der PRS zum Informationsaustausch<br />
o regelmäßige Treffen mit Vertretern der Grundschulen und LehrerInnen der PRS zur<br />
Absprache über gemeinsame schulische Bereiche<br />
o Besuch der Klassen 4 der Grundschulen mit Information über die PRS und<br />
dreistündiger Teilnahme am Unterricht einer 5. oder 6. Klasse<br />
o ständiger Kontakt der Leiterinnen der Grundschulen mit dem Leiter der Klassen 5/6<br />
der PRS mit gegenseitigen Konsultationen.<br />
Mit der Grundschule Seulberg verbindet die PRS darüber hinaus das gemeinsame Projekt<br />
Frühfranzösisch, das dort von Lehrkräften der PRS angeboten wird.<br />
Für den Übergang in die Klasse 11:<br />
Kooperation mit dem <strong>Ziel</strong> der Orientierung, Information und Beratung besteht zur Zeit mit<br />
folgenden <strong>Schule</strong>n:<br />
Gesamtschule am Gluckenstein, Bad Homburg: regelmäßige Informationsveranstaltungen,<br />
Konrad-Lorenz-<strong>Schule</strong>, Usingen: "Praktikanten"-System - interessierte SchülerInnen kommen<br />
für 2 Wochen in den Unterricht der 11. Klassen<br />
6
Eine Zusammenarbeit mit den umliegenden <strong>Schule</strong>n gibt es im Fachbereich Sport.<br />
SchülerInnen der PRS wird - je nach Bedarf - die Teilnahme an Sportkursen von <strong>Schule</strong>n im<br />
Kreis ermöglicht. Es gibt erste Vorgespräche für ein gemeinsames Projekt des<br />
Schüleraustausches mit Argentinien zwischen der Humboldtschule, Bad Homburg, dem<br />
Gymnasium Oberursel und der PRS, Friedrichsdorf.<br />
Schon seit langer Zeit befasst sich die PRS mit der Beratung der SchülerInnen nach Ende<br />
Ihrer Schulzeit und bereitet diese Orientierung durch ein vielfältiges Netz an Kooperationen<br />
mit <strong>Schule</strong>n, Betrieben und Institutionen in der Region vor.<br />
Für die Sekundarstufe I zählen hierzu die verschiedenen Praktika, die in Zusammenarbeit mit<br />
Betrieben in Friedrichsdorf und Umgebung vor- und nachbereitet werden. Ein zentraler<br />
Baustein in diesem Zusammenhang ist die Veranstaltung „<strong>Schule</strong> ade“, eine<br />
Informationsbörse für SchulabgängerInnen aus dem Hauptschul-, Realschul- und<br />
Gymnasialzweig, die aber auch zunehmend angenommen wird von den AbiturientInnen.<br />
Diese Veranstaltung wird von einer Kollegin in Zusammenarbeit mit dem Förderverein<br />
organisiert.<br />
Die Kooperation mit dem Arbeitsamt, regelmäßige Besuche beim Berufsinformationszentrum<br />
in Frankfurt, Betriebsschnuppertage am Arbeitsplatz der Eltern und der wöchentliche<br />
Praxistag in Klasse 9 des Hauptschulzweiges komplettieren die Angebote der<br />
Berufsorientierung in der Sekundarstufe I.<br />
Die Lehrkräfte der PRS beraten SchülerInnen auch zum Teil in schwierigen Situationen.<br />
Dabei spielt die Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe, der Schulpsychologien am<br />
Staatlichen Schulamt und anderen Beratungsstellen eine wichtige Rolle.<br />
In der Sekundarstufe II ist die Vor- und Nachbereitung des Berufspraktikums in der<br />
Jahrgangsstufe 12 wesentlicher Baustein der Berufsorientierung der SchülerInnen. Dazu<br />
kommen eine enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Frankfurt und das Angebot<br />
regelmäßiger Termine individueller Beratung für SchülerInnen an der PRS. Die PRS arbeitet<br />
mit den umliegenden Hochschulen zusammen, insbesondere mit Gießen und Darmstadt. Dazu<br />
gehören Besuche an den Hochschulen im Rahmen der Hochschulinformationstage und<br />
anderer Projekte, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich. Zusammenarbeit mit<br />
außerschulischen Institutionen gibt es auch im sprachlichen Bereich, bspw. mit dem Institut<br />
Français. Die PRS eröffnet den SchülerInnen auch die Möglichkeit, externe Sprachdiplome<br />
abzulegen und sich dadurch europaweit anerkannte Zusatzqualifikationen zu erwerben.<br />
Die Frage des langfristigen Erfolges der Berufsorientierung der SchülerInnen durch die<br />
vielfältigen Kooperationsformen kann nicht mit quantifizierbaren statistischen Daten geklärt<br />
werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele AbsolventInnen des Haupt- und<br />
Realschulzweiges eine Ausbildungsstelle erhalten. Nur in geringem Maß gehen<br />
RealschülerInnen in die gymnasiale Oberstufe über. Die SchülerInnen der Klasse 10 G gehen<br />
bis auf wenige Ausnahmen in die Sekundarstufe II. Die AbiturientInnen der PRS beginnen in<br />
der Mehrzahl ein Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule, nur der geringere Teil<br />
wählt eine Lehre als Alternative zum Studium.<br />
7
3 Organisationsform im Überblick<br />
Förderstufe (Klasse 5/6):<br />
Differenzierung nach einem halben Jahr (A-B-C-Kurse) in den Fächern<br />
Mathematik und Englisch.<br />
Koordination von A-Kursen und Gymnasialklassen<br />
Die Koordination aller Klassen eines Jahrgangs stellt sicher, dass die<br />
SchülerInnen bei entsprechender Eignung in den jeweiligen Schulzweigen<br />
mitarbeiten können.<br />
Schulzweigübergreifendes Orchestermusizieren<br />
Hauptschule (Klasse 7 - 9):<br />
Englisch als Fremdsprache (durchgehend)<br />
Zwei Betriebspaktika<br />
Ein Praxistag in Klasse 9<br />
Hauptschulabschluss nach Klasse 9<br />
Realschule (Klasse 7 - 10):<br />
Englisch als 1. Fremdsprache; ab Klasse 7 Wahl zwischen<br />
Französisch als 2. Fremdsprache und Arbeitslehre<br />
Angebot der 3. Fremdsprachen (s. Gymnasialzweig) gilt auch für<br />
Realschüler<br />
Betriebspraktikum in Klasse 9<br />
Mittlerer Bildungsabschluss am Ende von Klasse 10 (Mittlere Reife)<br />
Gymnasium (Klasse 5 - 10):<br />
Schulzweigübergreifendes Orchestermusizieren in Klasse 5/6<br />
Englisch oder Französisch als 1. Fremdsprache ab Klasse 5<br />
Englisch, Französisch oder Latein als 2. Fremdsprache ab Klasse 7<br />
Spanisch oder Russisch als 3. Fremdsprache oder weiteres<br />
Wahlpflichtangebot (schulformübergreifend) ab Klasse 9<br />
Betriebspraktikum in Klasse 9<br />
Schulformübergreifende Kurse:<br />
Wahlpflichtunterricht der Klassen 9 und 10<br />
Arbeitsgemeinschaften<br />
Sport Klasse 10<br />
Musikprojekt: Bläsergruppe in Klasse 5/6<br />
Gymnasiale Oberstufe:<br />
Orientierungsphase (Jahrgangsstufe 11):<br />
neu eingerichtete Klassenverbände mit Orientierungskursen, die auch die<br />
SchülerInnen von außerhalb integrieren.<br />
Qualifikationsphase (Jahrgangsstufe 12/13):<br />
Unterricht in zwei Leistungskursen (5 Std.) und mindestens sechs Grundkursen<br />
(4 Std. in den Fächern Deutsch und Mathematik, 3 Std. in allen übrigen<br />
Fächern)<br />
Leistungskursangebot: Deutsch, Englisch, Französisch, Kunst, Geschichte,<br />
Politik und Wirtschaft, Mathematik, Biologie, Physik, Chemie<br />
8
4 Schulzweige<br />
Auch wenn die Schulzweige eine eigene Leitung haben und in den Zweigen (bis auf die oben<br />
genannten Angebote) getrennt unterrichtet wird, bildet die <strong>Schule</strong> eine Einheit; dies wird u.a.<br />
deutlich durch die wöchentlich stattfindende Schulleitungskonferenz, den Unterrichtseinsatz<br />
von LehrerInnen in verschiedenen Zweigen und die gemeinsamen Projektwochen und Feste.<br />
Gemeinsames Konzept in allen Schulzweigen ist eine verstärkte Koordination im Bereich der<br />
schriftlichen Lernkontrollen durch Vergleichsarbeiten gemäß der Verordnung bzw.<br />
Verfügung des Staatlichen Schulamtes in allen Schulzweigen und durch halbjährlich<br />
vorausgeplante Termine.<br />
Dennoch soll hier auf einige Besonderheiten der Zweige hingewiesen werden.<br />
4.1 Förderstufe<br />
Die PRS bietet als Einstieg ins 5. Schuljahr Eingangsklassen im Gymnasialzweig und in der<br />
Förderstufe an. Die Förderstufe steht allen Kindern offen, deren Eltern am Ende der<br />
Grundschule eine Entscheidung über den weiteren Bildungsweg noch nicht fällen können,<br />
dies noch nicht wollen oder sich bewusst für die Betonung des sozialen Lernens in der<br />
Förderstufe entscheiden. Mit dem Eintritt in die Förderstufe werden alle Möglichkeiten<br />
hinsichtlich des weiteren Bildungsweges bis zum Ende des 6. Schuljahres offen gehalten.<br />
Der Unterricht in der Förderstufe gliedert sich in:<br />
Kernunterricht<br />
Er umfasst die Fächer Deutsch, Erdkunde und Geschichte und wird vom Klassenlehrer, von<br />
der Klassenlehrerin erteilt. Das Fach Deutsch unterliegt keiner äußeren Differenzierung, da<br />
der/die KlassenlehrerIn als wichtige Bezugsperson möglichst viel Unterricht in seiner/ihrer<br />
Klasse haben sollte. Den verschiedenen Begabungen und Leistungen tragen die<br />
DeutschlehrerInnen durch andere, binnendifferenzierende Maßnahmen Rechnung.<br />
Kursunterricht<br />
Er umfasst die Fächer Mathematik und Englisch. Hier wird zu Beginn des zweiten<br />
Schulhalbjahres der Klasse 5 eine äußere Differenzierung mit drei Ebenen (A-, B-, C-Kurse)<br />
vorgenommen. Diese Dreigliederung soll eine Zuordnung zu den drei Schulzweigen beim<br />
Übergang von der Klasse 6 in die Schulzweige der Klasse 7 erleichtern. Um geeigneten<br />
SchülerInnen den Übergang in den Gymnasialzweig zu sichern, wird der A – Kurs von einer<br />
Lehrkraft geleitet, die gleichzeitig eine parallele Gymnasialklasse unterrichtet. Der<br />
Kursunterricht dient in besonderem Maße der Orientierung der SchülerInnen sowie deren<br />
Eltern in Bezug auf die Wahl des weiteren Bildungsweges nach der Förderstufe.<br />
Musisch–technischer Unterricht<br />
Er umfasst die Fächer Biologie, Religion, Ethik, Kunst, Musik und Sport. Es wird angestrebt,<br />
dass eines dieser Fächer noch dem Klassenlehrer übertragen wird, um leichter fächerübergreifend<br />
und projektorientiert arbeiten zu können.<br />
Die Identifikation mit der <strong>Schule</strong> wird durch die gemeinsame Gestaltung des Klassenraums,<br />
gemeinsames Frühstück, Ausflüge und "Spieletonnen" (Sammlung von Pausenspielgeräten<br />
und Bewegungsspiele) für jede Klasse angestrebt. Die Klassen übernehmen für die Sauberkeit<br />
ihrer Klassenräume selbst Verantwortung und achten dabei auf Mülltrennung.<br />
9
Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten den einzelnen Begabungen zu entsprechen. Deshalb ist<br />
die Schullaufbahnberatung in der Förderstufe besonders wichtig. Verschiedene<br />
Informationsveranstaltungen, wie ein Informationsabend für Grundschuleltern an der PRS,<br />
die Vorstellung der PRS an den Friedrichsdorfer Grundschulen, der Tag der offenen Tür an<br />
der PRS, sowie ein Informationsabend zum Übergang von der Klasse 6 in die Klasse 7 dienen<br />
ebenso wie die Elterngespräche, die in den zwei Jahren geführt werden, der Beratung der<br />
Eltern über die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder nach der Förderstufe.<br />
Ende Oktober finden für die Klassen 5 pädagogische Konferenzen statt, in denen eine erste<br />
Beurteilung der SchülerInnen vorgenommen wird. Die Einteilung in Kurse wird für die<br />
Fächer Mathematik und Englisch am Ende des ersten Halbjahres der Klasse 5 vorgenommen<br />
und erfolgt auf drei Ebenen, da sich so am besten der Übergang in die drei Schulzweige<br />
vorbereiten lässt. Aufgrund von Leistungsveränderungen kann die Kurszugehörigkeit<br />
jederzeit individuell angepasst werden.<br />
Ausgehend von Beurteilungsbögen werden die SchülerInnen, sowie deren Eltern, im 2.<br />
Halbjahr der Klasse 6 in Beratungsgesprächen über den Lernfortschritt informiert und den<br />
Schulzweigen zugeordnet.<br />
4.2 Hauptschule<br />
Die Hauptschule umfasst die Klassen 7–9. In der Regel besuchen SchülerInnen der C-Kurse<br />
der Förderstufe und solche, deren Leistungsniveau im B-Kurs am Ende der Förderstufe noch<br />
sehr niedrig ist, die 7. Klasse der Hauptschule. Die Hauptschule hat sich der Förderung von<br />
Spätentwicklern und langsam lernenden SchülerInnen verschrieben, denen durch die Anlage<br />
der PRS als Gesamtschule auch der spätere Übergang in die Realschule möglich ist. Am Ende<br />
der Klasse 9 steht der Hauptschulabschluss, der den SchülerInnen den Eintritt in eine<br />
qualifizierte Berufsausbildung ermöglicht. Der Abschluss wird mit erfolgreicher Teilnahme<br />
an der Projektprüfung, den Abschlussarbeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik,<br />
eventuell Englisch und den Leistungsbewertungen aus Klasse 9 erreicht.<br />
Die in der Hauptschule erteilten Unterrichtsfächer sind der Stundentafel zu entnehmen.<br />
Ein Schwerpunkt der Arbeit in der Hauptschule besteht in der ständigen Festigung und Übung<br />
von grundlegenden Kulturtechniken, um SchülerInnen zu ermöglichen, im Berufsleben zu<br />
bestehen. Durch das Fach Arbeitslehre, zwei Berufspraktika und einen wöchentlichen<br />
Praxistag in der Jahrgangsstufe 9 werden den SchülerInnen die Anforderungen des<br />
Berufslebens deutlich, womit sie schließlich an die eigenständige Berufswahl herangeführt<br />
werden.<br />
An dem seit 2001 eingeführten Praxistag gehen die SchülerInnen der 9. Klasse einen Tag in<br />
der Woche in örtliche Betriebe und werden dabei von ihren KlassenlehrerInnen betreut. Dies<br />
dient zur Berufsvorbereitung, eigenständiger, individueller Informationenbeschaffung über<br />
Leistungsanforderungen, aber auch zur Kontaktaufnahme und als Hilfe zur Berufswahl. Hinzu<br />
kommen weitere Schullaufbahn- und Berufsberatungen durch LehrerInnen, die Schulleitung,<br />
das Arbeitsamt und eine alle zwei Jahre an der <strong>Schule</strong> stattfindende Berufsinformationsbörse,<br />
an der örtliche Betriebe teilnehmen. Zu den benachbarten Berufschulen bestehen intensive<br />
Kontakte durch Informationsveranstaltungen und Besuche der SchülerInnen.<br />
Die multikulturelle Vielfalt ist gerade in der Hauptschule eine Herausforderung, die besonders<br />
hohe Anforderungen an die Integrationskraft der <strong>Schule</strong> stellt. Aus Ermangelung an<br />
geeigneten Maßnahmen, die z.B. Migrantenkinder durch gezielte Sprachkurse auf die<br />
Mitarbeit im Unterricht vorbereiten, werden zurzeit auch solche SchülerInnen im allgemeinen<br />
Unterricht unterrichtet, die noch keine oder ungenügende Sprachkenntnisse und Defizite in<br />
anderen Bereichen – z.B. auch in Mathematik – aufweisen. Deutschkurse, denen diese<br />
10
SchülerInnen zugeführt werden, konnten inzwischen intensiviert werden, so dass Defizite<br />
schnellstmöglich ausgeglichen und für diese SchülerInnen die Integrationschancen erhöht<br />
werden.<br />
Der Unterricht in „Deutsch als Zweitsprache“ bedarf allerdings noch eines konsequenten und<br />
langfristigen Aufbaus an der PRS<br />
Ein gepflegtes schulisches Umfeld mit neuem Mobiliar und einigen Computerarbeitsplätzen<br />
speziell für einige Hauptschulklassen nimmt die SchülerInnen in die Pflicht, mehr<br />
Verantwortung für ihren Klassenraum zu übernehmen. Ein „Wohlfühlprogramm“ dient der<br />
Erhöhung der Identifikation mit der Klasse und soll in Zukunft durch spezielle Lehrerteams,<br />
die einen Großteil ihrer Stunden in diesen Klassen unterrichten, weiter gefestigt und<br />
unterstützt werden.<br />
Der Wechsel der Unterrichtsmethoden - von lehrerzentriertem Unterricht über<br />
Projektunterricht zu gezielter Heranführung an die Arbeit mit Computern, die im<br />
Klassenraum installiert sind - soll nicht nur motivierend und leistungssteigernd wirken,<br />
sondern auch den Übergang ins Berufsleben erleichtern.<br />
4.3 Realschule<br />
Die Realschule umfasst die Klassen 7-10 und endet mit dem Realschulabschluss Dieser<br />
„Mittlere Bildungsabschluss“ wird erreicht durch die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht<br />
der Klasse 10 und das Bestehen der verbindlichen Abschlussprüfungen. Letztere gliedern sich<br />
in eine schriftliche Prüfung mit Arbeiten in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik<br />
durch landesweit einheitlich gestellte Aufgaben und einen Wahlpflichtteil, bei dem die<br />
SchülerInnen wählen können zwischen einer mündlichen Prüfung und einer Hausarbeit mit<br />
Präsentation.<br />
Der Übergang von der Klasse 6F in die weiterführenden Schulzweige bestimmt die<br />
Klassenkonferenz am Ende des 6. Schuljahres.<br />
Am Ende des vierjährigen Realschulbesuchs können qualifizierte SchülerInnen mit der<br />
Durchschnittsnote von 2,5 oder besser in die Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen Oberstufe<br />
überwechseln. Für fleißige und intelligente „Spät- und Langsamentwickler“ hat es sich in der<br />
Vergangenheit gezeigt, dass die Realschule die geeignete Schulform ist um den Übergang in<br />
die gymnasiale Oberstufe und später das Abitur zu erreichen. Der Vorteil der PRS als<br />
Gesamtschule ist, dass diese an der PRS (wie an jeder anderen gymnasialen Oberstufe)<br />
absolviert werden kann, wobei ein Schulwechsel und eine neue Eingewöhnungszeit<br />
vermieden werden können, zumal die SchülerInnen schon in der Mittelstufe einige<br />
LehrerInnen durch Vertretungsunterricht, schulformübergreifenden Lehrereinsatz und<br />
Projektwochen etc. kennen gelernt haben. Natürlich ermöglicht der Realschulabschluss bei<br />
entsprechender Eignung es, eine Fachoberschule zu besuchen, an deren Ende nach 2 Jahren<br />
ein Fachabitur steht, das zum Studium an einer Fachhochschule befähigt.<br />
An der PRS machen jährlich etwa 10 ehemalige RealschülerInnen das Abitur.<br />
Die in der Realschule erteilten Unterrichtsfächer sind der Stundentafel zu entnehmen. Ab<br />
Klasse 7 können SchülerInnen zwischen Französisch als 2. Fremdsprache und Arbeitslehre<br />
wählen. Dabei zeigt sich, dass der Unterricht in der zweiten Fremdsprache Französisch<br />
besondere Anforderungen an die RealschülerInnen stellt. In der Klasse 7 beginnen in der<br />
Regel zwei Lerngruppen mit Französisch, durch die Abwahl der SchülerInnen zu Beginn der<br />
Klasse 9 ergibt sich in der Regel nur noch eine Lerngruppe.<br />
11
Ab der 9. Klasse finden verstärkt Schullaufbahn- und Berufsberatung statt. Gerade für<br />
RealschülerInnen ist die an der PRS jährlich stattfindende Schullaufbahnberatung sehr<br />
wichtig, da Berufsschulen ein vielfältiges Angebot machen für SchülerInnen mit mittlerem<br />
Bildungsabschluss.<br />
Das dreiwöchige Betriebspraktikum in der Klasse 9 weist auf die Anforderungen im Beruf<br />
und die eigenständige Berufswahl in der Klasse 10 hin und verzahnt durch verstärkten<br />
Arbeitslehreunterricht schulische und berufsvorbereitende Bildung.<br />
4.4 Gymnasium<br />
Der Gymnasialzweig umfasst die Klassen 5–10. Das oberste <strong>Ziel</strong> des Gymnasiums ist die<br />
Studierfähigkeit, die mit dem Erreichen des Abiturs erlangt wird. Der Gymnasialzweig der<br />
Mittelstufe bereitet auf die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der Oberstufe vor.<br />
Der gymnasiale Anteil der PRS ist mit seinen 9 Jahrgangsstufen von Klasse 5-13 und<br />
unterschiedlichen Altersstufen ein besonders vielfältiger Zweig der PRS. Viele LehrerInnen<br />
unterrichten sowohl in Klasse 5 und 6 als auch in Mittel- und Oberstufe. (Besonders dadurch<br />
unterscheiden sich deutsche LehrerInnen von LehrerInnen im internationalen Vergleich.)<br />
Sowohl von GymnasiallehrerInnen als auch von GymnasialschülerInnen werden besondere<br />
Leistungen verlangt. LehrerInnen wird ein hohes Maß an Anpassungsvermögen, Fach- und<br />
Methodenwissen abverlangt.<br />
Von GymnasialschülerInnen werden besondere kognitive Leistungen erwartet, z.B. das<br />
Dargebotene und Erklärte selbstständig in vielfältigen Variationen geistig zu vernetzen, von<br />
dem Einzelphänomen zu abstrahieren und auf verschiedene Fachgebiete zu übertragen.<br />
Darüber hinaus tragen sie durch die Forderungen nach Selbstständigkeit und Sozialkompetenz<br />
in besonderer Weise Verantwortung nicht nur für ihre eigene Leistung, sondern auch die der<br />
Arbeitsgruppe, der Klasse und für die gesamte <strong>Schule</strong>, wodurch auch ein Gefühl der<br />
Identifikation entsteht.<br />
Fremdsprachen<br />
In der Klasse 5, 7 und 9 werden die Fremdsprachen gewählt. Neben Englisch kann in der<br />
Hugenottenstadt Friedrichsdorf auch Französisch als erste Fremdsprache gewählt werden, es<br />
gibt aber keine reinen „Französischklassen“, sondern die Kinder einer Klasse werden im<br />
Fremdsprachenunterricht getrennt unterrichtet.<br />
Zur Zeit haben 13 SchülerInnen in Klasse 5 und 14 SchülerInnen in Klasse 6 Französisch als<br />
erste Fremdsprache gewählt.<br />
Die Fremdsprachenwahl ab der Jahrgangsstufe 7 erläutern folgende Zahlen :<br />
Die zweite Fremdsprache (Stand 2003/2004)<br />
Jahrgangsstufe Englisch Französisch Latein<br />
7 20 57 21<br />
8 14 55 22<br />
9 20 67 23<br />
10 13 57 11<br />
Die dritte Fremdsprache (Stand 2003/2004)<br />
In der Klasse 9 können die dritten Fremdsprachen aus dem Wahlpflichtangebot der PRS<br />
gewählt werden. Die Zahlen stellen den augenblicklichen Stand des Wahlverhaltens dar:<br />
Jahrgangsstufe Latein Spanisch Russisch<br />
9 -- 28 --<br />
10 11 21 5<br />
12
Der Fremdsprachenunterricht wird durch mehrere Austauschprogramme (Englisch: USA,<br />
Französisch: Bordeaux, Spanisch: Argentinien, Russisch: Russland.) unterstützt, an dem in<br />
der Mehrzahl GymnasialschülerInnen teilnehmen.<br />
Betriebspraktikum<br />
Das dreiwöchige Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 soll den SchülerInnen Einblicke<br />
in die Berufs- und Arbeitswelt geben und ist mit dem Unterrichtsfach Politik und Wirtschaft<br />
der Stufe eng verbunden.<br />
4.5 Gymnasiale Oberstufe<br />
Die gymnasiale Oberstufe umfasst die Klassen 11–13. Das oberste <strong>Ziel</strong> der gymnasialen<br />
Oberstufe ist die Studierfähigkeit, die mit dem Erreichen der allgemeinen Hochschulreife<br />
erlangt wird.<br />
Die schon genannten Anforderungen bezüglich Leistungsvermögen, Leistungsbereitschaft<br />
und Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lernfortschritt gelten in diesem<br />
Schulabschnitt in besonderem Maße. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit im Rahmen der<br />
jeweils gültigen Verordnung Schwerpunkte zu setzen und somit selbst zu entscheiden, in<br />
welchen Fächern und damit an Hand welcher Unterrichtsinhalte sie den Nachweis der<br />
Hochschulreife erbringen.<br />
Die Unterrichtsorganisation an der PRS orientiert sich selbstverständlich wie alle anderen<br />
gymnasialen Oberstufen in Hessen an den Vorgaben der „Verordnung zur Gestaltung der<br />
gymnasialen Oberstufe“ (VGO). Bei der Nutzung des Gestaltungsspielraums, den die VGO<br />
bietet, legt die PRS seit Einführung der gymnasialen Oberstufe besonderen Wert darauf,<br />
SchülerInnen die nicht aus dem eigenen Gymnasialzweig kommen, die Integration in diese<br />
Schulform zu ermöglichen. Dies gilt zum einen für RealschülerInnen, für deren Übergang wir<br />
uns als Gesamtschule besonders verpflichtet fühlen. Andererseits kommen in jedem Jahr<br />
SchülerInnen von anderen <strong>Schule</strong>n, die teilweise keine eigene Oberstufe haben, in die<br />
Oberstufe der PRS.<br />
Um den Einstieg durch die Organisationsform zu unterstützen, wird die Einführungsphase<br />
(Stufe 11) deshalb an der PRS weitgehend im Klassenverband unterrichtet. Die<br />
Zusammenstellung der Klassen orientiert sich an einem der beiden Orientierungsfächer, das<br />
die SchülerInnen gewählt haben. Dieses Fach wird dann im Klassenverband mit einer<br />
zusätzlichen Wochenstunde unterrichtet und bereitet methodisch auf die Arbeit im<br />
Leistungskurs der Qualifikationsphase vor. In einem weiteren Fach gewinnen die<br />
SchülerInnen Einblick in die Arbeitsweise eines Leistungsfaches durch die Wahl eines<br />
Zusatzkurses, der außerhalb des Klassenverbandes unterrichtet wird. Sowohl zum Halbjahr<br />
als auch zum Ende des Schuljahres können die SchülerInnen die Orientierungsfächer bzw.<br />
Leistungsfächer wechseln, wenn das bisher gewählte Fach ihren Neigungen oder Fähigkeiten<br />
nicht entspricht.<br />
Das Lernen als Unterrichtsgegenstand wird in der Stufe 11 an vier Projekttagen zum Thema<br />
„Lernen lernen“ in den Mittelpunkt gestellt. Die Projekttage „Lernen lernen“ haben an der<br />
PRS bereits eine längere Tradition und sind der Ausgangspunkt für den Aufbau einer Reihe<br />
von Bausteinen zur Lernmethodik, die in der Stufe 5 beginnt. In der Stufe 11 liegt ein<br />
Schwerpunkt bei der Erstellung und dem Vortrag einer Präsentation, um auf das 5.<br />
Prüfungsfach vorzubereiten. Die Vorbereitung auf diese Form der Prüfung wird laut<br />
13
Konferenzbeschluss in der Qualifikationsphase durch mindestens eine bewertete Präsentation<br />
für jeden Schüler, jede Schülerin und die Auseinandersetzung mit den Bewertungskriterien<br />
fortgesetzt. Die Neuartigkeit dieser Prüfungsform bedingt einen erhöhten Fortbildungsbedarf<br />
im Kollegium, damit unsere SchülerInnen angemessen vorbereitet und adäquat beurteilt<br />
werden können.<br />
Die in der gymnasialen Oberstufe neu beginnenden Fremdsprachen (Spanisch - bei Bedarf<br />
auch Russisch) werden im ersten Jahr mit 5 Wochenstunden unterrichtet. Dies ermöglicht<br />
einerseits einen intensiven Einstieg in die neue Fremdsprache, andererseits besteht damit die<br />
Möglichkeit, die Sprache als Abiturprüfungsfach zu wählen.<br />
Beim Übergang in die Qualifikationsphase (Stufe 12/13) entscheiden die SchülerInnen sich<br />
endgültig für zwei Leistungskurse (zum Angebot vgl. Kapitel 3). Das an den Klassenverband<br />
der Stufe 11 angegliederte Leistungsfach wird in der Regel in gleicher Besetzung in Stufe<br />
12/13 weiter geführt. Zu Beginn der Qualifikationsphase nehmen alle SchülerInnen an einem<br />
zweiwöchigen Berufspraktikum unmittelbar vor den Herbstferien teil. Drei Jahre nach dem<br />
Betriebspraktikum in Stufe 9 hat sich in vielen Fällen die Interessenlage verändert. Außerdem<br />
können die SchülerInnen aufgrund ihres Alters praxisbezogener in den Arbeitsprozess<br />
einbezogen werden.<br />
Ein neues Fach wird seit dem Schuljahr 2001/2002 in der Oberstufe der PRS unterrichtet:<br />
Darstellendes Spiel. Durch die Teilnahme an diesem Fach erfüllen die SchülerInnen ihre<br />
Belegverpflichtung in einem musischen Fach an Stelle von Kunst oder Musik. Die seit vielen<br />
Jahren mit großem Erfolg geleistete Arbeit im Bereich des Sprech- und des Musiktheaters in<br />
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und im Wahlpflichtunterricht der Mittelstufe findet<br />
damit seine Fortführung im Unterricht der Oberstufe. Bereits nach dem ersten Durchlauf ist<br />
erkennbar, dass dieses Fach ein fester Bestandteil des Kursangebots der PRS bleiben wird.<br />
Das Abitur steht bei erfolgreichem Verlauf am Ende der Schullaufbahn: Hier unterliegt die<br />
PRS wie alle <strong>Schule</strong>n Hessens den Bestimmungen der VGO und der Fachaufsicht der<br />
Staatlichen Schulämter, wodurch vergleichbare Leistungsanforderungen landesweit<br />
gewährleistet sind.<br />
4.6 Gemeinsame Unterrichtsprojekte in den Klassen 5 und<br />
6<br />
Das Projekt „Lernen lernen“, das in den Klassen 5 und 6 beider Schulzweige durchgeführt<br />
wird, fördert ebenso die Verantwortung der SchülerInnen für ihre Lernentwicklung wie neue<br />
Lernformen z. B. Stationenlernen. Eine Übersicht über die einzelnen Bausteine findet sich im<br />
Anhang 12.2.<br />
Eine ähnliche pädagogische <strong>Ziel</strong>richtung verfolgt der Aufbau der Medienkompetenz (vgl.<br />
Medienkonzept in der Anlage 12.1),. Zentrale <strong>Ziel</strong>setzung ist der systematische Aufbau der<br />
Fertigkeiten und Kenntnisse der SchülerInnen im Umgang mit den neuen Medien.<br />
Auf soziales und interkulturelles Lernen wird in den 5. und 6. Klassen besonderer Wert<br />
gelegt. In einer „Einführungswoche“ zu Beginn der 5. Klasse lernen die SchülerInnen ihre<br />
neue (Lern-)Umgebung kennen. Das zweijährige Eingangsprogramm „Konstruktive<br />
Konfliktkultur“ und das Seminar „Kooperation und Ich-Stärkung“ bilden die Grundlage für<br />
die Entwicklung eines kooperativen und konstruktiven Umgangs. Wichtige Schritte dabei<br />
sind die Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls der Einzelnen, die Entwicklung<br />
von Verständnis und Anteilnahme für die anderen und das Kennenlernen von<br />
14
Konfliktlösungsstrategien. (vgl. 10.2.2 Vorhaben 2: Konflikte Demokratisch lösen)<br />
MentorInnen , d.h. SchülerInnen der Klassen 10 und 11, betreuen die 5. und 6. Klassen und<br />
geben auch Hilfen für die SV-Arbeit.<br />
Die Förderung des musischen Bereichs ist die <strong>Ziel</strong>setzung des erweiterten Musikunterrichts in<br />
den „Bläserklassen“. In jedem Schuljahr haben SchülerInnen der Klasse 5 die Möglichkeit,<br />
sich für den erweiterten Musikunterricht anzumelden. Für die Dauer der Klassen 5 und 6<br />
erlernen die SchülerInnen dann im Musikunterricht grundlegende Fertigkeiten auf einem<br />
Orchesterblasinstrument.<br />
Der Orchesterunterricht findet als regulärer Musikunterricht statt. Hierzu bilden die<br />
SchülerInnen einer Förderstufen- und einer Gymnasialklasse während der Musikstunden eine<br />
Lerngruppe: die Bläserklasse. Die SchülerInnen, die nicht am Bläserklassen-Projekt<br />
teilnehmen, haben zeitgleich „normalen“ Musikunterricht. In einer Zusatzstunde erhalten die<br />
SchülerInnen in kleinen Gruppen Instrumentalunterricht bei Lehrkräften der Musikschule<br />
Friedrichsdorf. Im Anschluss an die zwei Jahre des erweiterten Musikunterrichts haben die<br />
SchülerInnen die Möglichkeit, in Musikensembles der <strong>Schule</strong> weiter zu musizieren.<br />
Musikalisches Basiswissen und spielerische Fertigkeiten werden durch aktives und<br />
kontinuierliches Handeln in und mit der Musik entwickelt. Der schulische Musikunterricht<br />
schafft somit eine Grundlage für die weitere Ausbildung in <strong>Schule</strong>, im Musikverein und/oder<br />
an der Musikschule. Der Unterricht wird intensiver und lebendiger und damit erfolgreicher in<br />
allen Lernaspekten. Mittelpunkt des Projekts ist die Zusammenstellung eines spielfähigen und<br />
gut klingenden Klassenblasorchesters mit allen notwendigen Instrumenten, die von der <strong>Schule</strong><br />
gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden.<br />
5 Schulleitung und Pädagogisches Team<br />
Die Schulleitung der PRS ist in allen Funktionsstellen besetzt. Herr Karner, der neue<br />
Schulleiter nahm seinen Dienst an der PRS zum 01.02.2004 auf. Bis auf den<br />
Hauptschulzweig, der mit dem Realschulzweig zusammen verwaltet wird, leiten<br />
Schulzweigleiter die Arbeit in den Schulzweigen.<br />
Es ist wünschenswert, dass der Hauptschulzweig, der besonders viel Beachtung und<br />
pädagogische Intervention verlangt, mit den Kapazitäten eines Hauptschulzweigleiters, bzw.<br />
einer Hauptschulzweigleiterin versorgt wird. Die Schulleitung arbeitet als Team<br />
vertrauensvoll mit allen anderen Gremien der Schulgemeinde zusammen.<br />
Eine Übersicht über die Zuständigkeiten der Schulleitung findet sich im Anhang, Kapitel<br />
12.5.1.<br />
Eine Besonderheit der Schulleitung der PRS ist das Pädagogische Team, das seit 1990 die<br />
Aufgaben des Pädagogischen Leiters wahrnimmt.<br />
Das Pädagogische Team an der PRS ist eine Einrichtung, deren oberste Aufgabe die<br />
Formulierung und Bearbeitung der pädagogischen Belange an der PRS ist. Darüber<br />
hinausgehende Arbeitsaufträge werden entweder durch das Pädagogische Team selbst, durch<br />
die Gesamtkonferenz oder die Schulleitung der PRS formuliert. KollegInnen, die ein zeitlich<br />
begrenztes Projekt vorhaben, dessen <strong>Ziel</strong>e und Inhalte in das Arbeitsfeld des Pädagogischen<br />
Teams passen, können sich für die Zeit des Projekts als assoziiertes Mitglied anschließen.<br />
Das Pädagogische Team setzt sich zusammen aus Mitgliedern der Gesamtkonferenz. Das<br />
Team besteht zurzeit aus vier Mitgliedern. Wer im Pädagogischen Team Mitglied werden<br />
möchte, stellt sich der Gesamtkonferenz zur Wahl und benötigt die einfache Mehrheit zur<br />
Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft im Pädagogischen Team ist unbefristet und sollte<br />
15
mindestens drei Jahre lang andauern. Sie kann durch Rücktritt oder durch Abwahl durch die<br />
Gesamtkonferenz beendet werden. Dazu ist eine einfache Mehrheit nötig.<br />
Das Pädagogische Team berichtet in der Gesamtkonferenz über seine Tätigkeiten und stellt<br />
künftige Vorhaben zur Diskussion. Ein Mitglied des Pädagogischen Teams nimmt an der<br />
Schulleitungskonferenz teil. Die Mitglieder des Pädagogische Teams bereiten jährlich einen<br />
Pädagogischen Tag vor und organisieren die Durchführung. Dieser Pädagogische Tag wird<br />
seit 1998 durchgeführt und hat inzwischen Tradition. Themen waren:<br />
Lernen mit Kopf und Hand – Neue Lehr- und Lernmethoden (1998)<br />
Projektunterricht (1999)<br />
Zukunftswerkstatt (2000)<br />
Die gesunde <strong>Schule</strong> (2001)<br />
Die kreative <strong>Schule</strong> (2002)<br />
Lernen lernen (2003)<br />
Mediation und Partizipation an der PRS ( 2004)<br />
Aktuelle Aufgabenschwerpunkte sind:<br />
• Weiterentwicklung und Etablierung eines Mediationskonzepts<br />
• Leitung des Projekts „Demokratie lernen und leben“ der Bund-Länder-Komission<br />
(BLK)<br />
• Gewaltprävention und Gewaltintervention, z.B. Teilnahme am Kriminalpräventionsrat<br />
der Stadt Friedrichsdorf<br />
• Beratung von SchülerInnen und LehrerInnen in Problemsituationen<br />
• Betreuung des Raums C 123<br />
• Wahlpflichtunterricht<br />
• Kooperation mit außerschulischen Institutionen und den Grundschulen Friedrichsdorfs<br />
• Unterstützung des Projekts „Kennenlerntage“ am Anfang der Klasse 5<br />
• Förderung und Betreuung der Teamarbeit<br />
• Unterstützung des Projekts „Lernen lernen“<br />
• Fortbildung des Kollegiums in pädagogischen Problemfragen<br />
• Erarbeitung der „Lehrer-Info-Mappe“ für neue LehrerInnen<br />
• Initiierung und Leitung des Ausschusses „Ganztagsschule“<br />
• Mitarbeit am Schulprogramm<br />
• Mitarbeit bei der Erarbeitung einer Schulvereinbarung<br />
16
6 Zusammensetzung der Klassen<br />
Schülerzahlen<br />
Im Schuljahr 2003/04 besuchen 830 Schüler und 753 Schülerinnen die PRS; das sind<br />
insgesamt 1583 SchülerInnen (Stichtag 28.4.04). Während in der Mittelstufe die Zahl der<br />
männlichen Schüler überwiegt, wird die Oberstufe in der Mehrzahl von Schülerinnen besucht.<br />
Die Schülerzahlen setzen sich wie folgt zusammen:<br />
Schulform<br />
Schülerzahl insgesamt<br />
(Jungen/Mädchen)<br />
Davon ausländische<br />
Kinder (Ju/Mä)<br />
Förderstufe (5 - 6) 200 (112/88) 53 (30/23)<br />
Hauptschule (7 - 9) 140 (79/61) 54 (31/23)<br />
Realschule (7 - 10) 318 (181/137) 49 (24/25)<br />
Gymnasium (5 - 10) 548 (289/259) 32 (19/13)<br />
Gymn. Oberstufe (11 - 13) 376 (169/207) 25 (7/18)<br />
Die 111 ausländischen Schüler und 102 ausländischen Schülerinnen haben einen Anteil von<br />
13,5 %, wobei die türkischen SchülerInnen die größte Gruppe bilden (41), gefolgt von der<br />
italienischen Gruppe (37).<br />
Die Schülerzahlen entwickelten sich in den letzten 12 Jahren wie folgt:<br />
Schulzweige/Klassenstufen Schulj. 91/92 Schulj. 03/04 Differenz<br />
Förderstufe (5 - 6) 242 200 -42<br />
Gymnasium (5 - 6) 199 167 -32<br />
Hauptschule (7 - 9) 110 140 +30<br />
Realschule (7 - 10) 340 318 -22<br />
Gymnasium (7 - 10) 412 381 -31<br />
Gymnasiale Oberstufe (11 - 13) 297 376 +79<br />
17
7 Zusammensetzung des Kollegiums<br />
An der PRS unterrichten zurzeit 68 Lehrerinnen und 50 Lehrer. Davon haben 34 Lehrkräfte<br />
das Lehramt an Haupt- und Realschulen und 68 das Lehramt für Gymnasien. Dazu kommen<br />
Referendare ( zur Zeit 2 ReferendarInnen für das Lehramt der Sekundarstufe I und 7<br />
ReferendarInnen für das Lehramt der Sekundarstufe II), eine Pastoralreferentin und<br />
LehrerInnen für den muttersprachlichen Unterricht.<br />
Zurzeit unterrichten:<br />
a) 10 der LehrerInnen mit Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen (GHR/HR)<br />
zweigübergreifend im Gymnasialzweig.<br />
b) 35 der LehrerInnen mit gymnasialem Lehramt zweigübergreifend<br />
in Förderstufe, Haupt- und Realschulzweig.<br />
c) LehrerInnen mit Lehramt an Haupt- und Realschulen unterrichten mit 7,5 % ihrer<br />
Pflichtstundenzahl im Gymnasialzweig.<br />
LehrerInnen mit gymnasialem Lehramt unterrichten mit 15,6 % ihrer Pflichtstunden<br />
im Realschulzweig.<br />
Lehrerversorgung<br />
Die <strong>Schule</strong> ist zur Zeit mit 85 Vollzeitstellen besetzt, die sich auf 118 LehrerInnen verteilen.<br />
a) 70,5 % der LehrerInnen mit GHR/HR- Lehramt sind Frauen .<br />
b) 42,6 % der Lehrkräfte mit gymnasialem Lehramt sind Frauen .<br />
(Angaben ohne Referendare, Vertretungsverträge und herkunftssprachlichen Unterricht)<br />
Besonderer Fachbedarf besteht in Deutsch, Englisch, Musik und Religion für den Haupt- und<br />
Realschulbereich.<br />
18
8 Was hat die PRS bisher erreicht?<br />
8.1 Fachunterricht<br />
Inhalte<br />
Entsprechend der Aufteilung in der Oberstufe werden auch hier die einzelnen<br />
Unterrichtsfächer in drei verschiedene Fachbereiche eingeteilt: in den musisch-sprachlichen<br />
Fachbereich I (Musik, Kunst, Fremdsprachen, Deutsch), den gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Fachbereich II (zu dem neben Erdkunde, Politik und Wirtschaft, Geschichte auch Religion,<br />
Ethik und Philosophie gehören), den mathematisch – naturwissenschaftlichen Fachbereich III<br />
(Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie, Physik) und Sport.<br />
In allen Fächern wird nach den 2002 aktualisierten Lehrplänen des Hessischen<br />
Kultusministeriums unterrichtet, wobei die Schwerpunkte der PRS in den einzelnen Fächern<br />
durch ein innerschulisches Curriculum festgelegt werden. Anwendungsbezüge und<br />
Schwerpunktsetzungen der Curricula werden darin formuliert. So wurde der von den TIMMSund<br />
Sinusstudien geforderte Anwendungsbezug der Aufgaben schon in die innerschulischen<br />
Mathematik-Lehrpläne eingearbeitet.<br />
Soweit es geht, wird in allen Fachbereichen auch auf aktuelle Themen Bezug genommen, die<br />
zunehmend handlungsorientiert unterrichtet werden (z.B. Gestaltung von Flächen durch den<br />
Kunstunterricht oder fächerübergreifende Aufbereitung von Unterrichtsmaterial mit modernen<br />
Präsentationsmethoden und Darstellung desselben in der Öffentlichkeit, etwa durch die Schul-<br />
Homepage etc.). Aktualität wird besonders in den Fächern der Gesellschaftswissenschaften<br />
(Politik und Wirtschaft und Erdkunde) betont, da diese Fächer in besonderem Maße zur<br />
politischen Willensbildung und zur Erlangung eines historischen Bewusstseins beitragen. In<br />
Erdkunde steht die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Raum im Vordergrund. In<br />
Religion sind Informationen über religiös-kulturelle Sachverhalte und die Begleitung bei der<br />
Identitätsfindung von Kindern und Jugendlichen zentrales Anliegen. Identitätssuche und –<br />
findung sind auch häufig Themen der Jugend- und Erwachsenenliteratur, die bei<br />
zunehmenden sprachlichen Kenntnissen immer häufiger auch im Fremdsprachenunterricht<br />
behandelt werden. In Philosophie gibt es in besonderem Maße kursübergreifende<br />
Schwerpunktbildungen (s.u.).<br />
Im Sport finden neue Sportarten wie Baseball, Flag Football, Skating etc. immer mehr<br />
Anhänger - übrigens auch unter LehrerInnen.<br />
Sozialformen und Unterrichtmedien<br />
Neben lehrerzentriertem Unterricht kommen immer mehr Einzel-, Partner-, Gruppen- und<br />
Projektarbeit zum Einsatz.<br />
Den spezifischen Anforderungen der Fächer entsprechend werden Sachverhalte mit Hilfe von<br />
unterschiedlichen Medien erarbeitet: im Sprachenunterricht stehen eher lineare Texte<br />
(Geschichten, Romane, Sachtexte), im gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereich nichtlineare<br />
Texte (Tabellen, Grafiken, Statistiken ...), in Mathematik anwendungsbezogene<br />
Aufgaben und in den Naturwissenschaften das Experiment im Vordergrund. Leider sind die<br />
Experimente aufgrund der Gruppengröße oft nur Demonstrationsversuche, bei denen die<br />
SchülerInnen über die Beobachterrolle nicht hinaus kommen.<br />
Vielfältige und offene Unterrichtsformen wie Zeitzeugengespräche, Autorenlesungen,<br />
darstellendes Spiel und Lyrikvorträge und Projektarbeit finden Eingang in den<br />
Regelunterricht.<br />
19
8.2 Medieneinsatz<br />
Bewährte Medien<br />
Den SchülerInnenn stehen zahlreiche Lehrbücher zur Verfügung, die in den letzten Jahren<br />
teilweise neu angeschafft wurden, zum Teil aber noch ersetzt werden müssen. Darüber hinaus<br />
wird vielfältiges, aktuelles Material in den Unterricht einbezogen. Besonders der Unterricht<br />
im Fach „Politik und Wirtschaft“, aber auch der Deutsch- und der Fremdsprachenunterricht<br />
kann heute auf aktuelle Medien wie Zeitungen, Kassetten oder Videos nicht mehr verzichten.<br />
Die Klassenräume sind weitgehend mit Overheadprojektor und Kassettenrekorder<br />
ausgestattet. Die Bibliothek ist mit Material für die Einzelarbeit und Recherche von<br />
SchülerInnenn gut ausgestattet. Hier sind auch mehrere Computerarbeitsplätze mit<br />
Internetanschluss und verschiedenen elektronischen Nachschlagwerken vorhanden.<br />
Die Ausstattung der <strong>Schule</strong> mit Videorekorden ist zufriedenstellend, da zumindest im Altbau<br />
jeder Stock ein Videogerät hat, so dass Videos nun in einen modernen Unterricht eingebettet<br />
werden können. Einige der vorhandenen Videogeräte sind geeignet für NTSC und<br />
Secam(West) Kassetten, so dass auch die für den Fremdsprachenunterricht notwendigen<br />
Originalvideos verwendet werden können. Die Anschaffung einzelner DVD-Spieler hat die<br />
bestehenden Kapazitäten ergänzt, die breiteren didaktischen Möglichkeiten des Einsatzes von<br />
DVDs bereichern den Unterricht. Hier besteht künftig noch weiterer Anschaffungsbedarf.<br />
Der Fachbereich Musik verfügt über vielfältiges Material. Das gleiche gilt für den<br />
Fachbereich Sport, der vor allem mit Kleingeräten gut ausgestattet ist, was einen<br />
abwechslungsreichen und schülerzentrierten Unterricht ermöglicht. Dies ist großenteils auf<br />
die Aktivitäten des Sport-Fachbereichs zurückzuführen, der durch die Einnahmen der alle drei<br />
Jahre stattfindenden Sport-Show für ein attraktives Materialangebot gesorgt hat.<br />
Neue Medien<br />
Die neuen Medien tragen wesentlich zum modernen Profil der PRS bei. Sie werden an<br />
unserer <strong>Schule</strong> mehr und mehr zu einem selbstverständlichen Werkzeug im Unterricht. In den<br />
verschiedenen Multimedia-, Klassen- und Fachräumen stehen unseren SchülerInnenn über<br />
120 Computerarbeitsplätze mit Internetanschluss und Peripheriegeräten zur Verfügung. Nach<br />
der Teilnahme an verschiedenen Modellprojekten kann die quantitative und qualitative<br />
Ausstattung unserer <strong>Schule</strong> als weit überdurchschnittlich beschrieben werden. Die Wartung<br />
der Computeranlage ist einem IT-Team übertragen worden, das aus vier Kollegen besteht.<br />
Bei der Einrichtung von Teamklassen achten wir auf eine umfassende Ausstattung mit PCs.<br />
Für den Fachunterricht kann die PRS neben der einschlägigen Standardsoftware ein breites<br />
Angebot an Lernsoftware bereit stellen. Außerdem haben große Teile des Kollegiums in den<br />
letzten Jahren an verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen. Die Fortsetzung<br />
dieser Bemühungen bleibt jedoch notwendig, um die Arbeit mit den neuen Medien noch<br />
stärker in der Breite des Kollegiums zu verankern. Die Mitwirkung der PRS im<br />
Medienverbund „Hochtaunus“ kann hier ihren Beitrag leisten.<br />
Das Medienkonzept der PRS sieht vor, dass alle SchülerInnen den Umgang mit den neuen<br />
Medien systematisch erlernen. Dazu wurden verschiedene Lernsequenzen an die Inhalte<br />
einzelner Fächer angebunden und mit unserem Konzept zum Methodenlernen abgestimmt<br />
(vgl. Anhang 12.2.):<br />
In den Jahrgangstufen 5/6 lernen die SchülerInnen im Rahmen des Deutschunterrichts die<br />
Handhabung des Computers und das Arbeiten mit einer Textverarbeitung. Im<br />
Fremdsprachenunterricht setzen sie sich mit Lernsoftware auseinander.<br />
20
In den Jahrgangsstufen 7/8 werden die bereits erworbenen Grundkenntnisse im<br />
Mathematik- und Kunstunterricht erweitert. Jetzt beschäftigen sich die SchülerInnen mit<br />
einer Tabellenkalkulation und mit digitaler Bildbearbeitung.<br />
In den Jahrgangsstufen 9/10 werden Recherchen im Internet und Darstellungen mit Hilfe<br />
eines Präsentationsprogramms thematisiert. Als Fächer kommen hierbei vor allem<br />
Geschichte, Erdkunde oder Politik und Wirtschaft in Frage.<br />
In der Jahrgangsstufe 11 erarbeiten die SchülerInnen in ihren Vorleistungskursen eine<br />
inhaltlich wie formal anspruchsvolle Präsentation. Die Erarbeitung beginnt im Rahmen<br />
von „Lernen lernen“ und wird danach selbstständig weitergeführt.<br />
Über diese Grundbausteine hinaus werden an der PRS verschiedene Wahlpflichtkurse und<br />
AGs mit einer Schwerpunktsetzung im Bereich der neuen Medien angeboten (u. a. Betreuung<br />
der Schulhomepage, digitaler Videoschnitt, Erstellung von Multimedia-CD-ROMs etc.).<br />
8.3 Fächerübergreifende Projekte<br />
In den vergangenen Jahren hat sich der Anteil an Angeboten fächerübergreifenden Lernens<br />
an der PRS deutlich erhöht. Vor 2002 erfolgte fächerübergreifendes Lernen in Einzelfällen,<br />
vor allem in den Fachbereichen des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenbereichs und in<br />
den musischen Fächern. Inzwischen, vor allem durch den neuen und deutlichen Auftrag der<br />
Lehrpläne für die Sekundarstufe I und II sind fächerübergreifende Projekte zu einem festen<br />
Bestandteil der Arbeit an der PRS geworden. In der Sekundarstufe II ist es nach wie vor das<br />
Aufgabenfeld II, das in jedem Jahr ein Thema anbietet, das in verschiedenen Fächern unter<br />
unterschiedlichem Schwerpunkt bearbeitet wird. Die Themen der letzten Jahre waren:<br />
• Globalisierung/Migration<br />
• Utopien<br />
• Millennium<br />
• Kulturlandschaften<br />
Im Aufgabenfeld III ist die Bereitschaft zu fächerübergreifenden Projekten nach dem Verbot<br />
des fächerübergreifenden naturwissenschaftlichen Unterrichts in der Sekundarstufe I<br />
weiterhin gering. Dennoch werden in der PRS in jedem Schuljahr Ausstellungen zu<br />
naturwissenschaftlichen Themen gezeigt, in denen die SchülerInnen interdisziplinäres<br />
Arbeiten erfahren können: „Die Naturwissenschaften sind feminin“ (2000); „<strong>Reis</strong>e zum<br />
Urknall“ (2001); „Gesunde Ernährung“ (2002); „Wale“ (2003); „Wer war Professor<br />
Wagner?“ (2003); „Klima“ (für 2004/2005 vorgesehen). Außerdem ist eine gemeinsame<br />
Vortragsreihe zu Themen wie „Natur- und Umweltschutz“, „Materialwissenschaften“,<br />
„Raumfahrt“, „neue Entwicklungen in der Kommunikationstechnik“ in Planung ( siehe neue<br />
Vorhaben).<br />
In der Sekundarstufe I zeigt sich, dass sowohl der Auftrag der Lehrpläne, wie die<br />
Anforderungen der Projektprüfungen im Realschulzweig durch den Beitrag der Neuen<br />
Medien zu einer langsamen Veränderung des Unterrichts führt und größere und kleinere<br />
fächerübergreifende Projekte durchgeführt werden, so z.B. zum Thema<br />
„Nationalsozialismus“ in Klasse 10 oder „Zeitung in der <strong>Schule</strong>“ in der Klasse 9. Angestrebt<br />
werden zudem Projekte zum Thema Islam, Leben in einer Welt, und zum Vorhaben 5<br />
„Vielfalt der Kulturen stärken“. Die Teamstruktur in der Sekundarstufe I erleichtert hierbei<br />
die Arbeit. So fand in der Jahrgangsstufe 8 eine fächerübergreifende Projektwoche zum<br />
Thema „Mittelalter“ statt.<br />
21
8.4 Klassen- und Kursfahrten<br />
Die Durchführung von Schulwanderungen, Lehrausflügen und mehrtägigen Klassen- und<br />
Studienfahrten wird an der PRS aus pädagogischen und didaktischen Gründen gefördert. Die<br />
eintägigen Veranstaltungen finden verteilt über das Schuljahr statt und orientierten sich z.B.<br />
am Angebot an Ausstellungen und Museen in der Umgebung und den unterrichtlichen<br />
Zusammenhängen. Die mehrtägigen Fahrten finden in den Klassenstufen 6,8,10 und 13 statt,<br />
in der Regel in den 8-10 Tagen vor den hessischen Herbstferien. Wenn sich die Klassen eines<br />
Jahrgangs und Schulzweigs gemeinsam für einen anderen Termin entscheiden, z.B. für eine<br />
Abschlussfahrt in den Klassen 10R im Frühjahr oder einen Schulskikurs, so sind andere<br />
Termine möglich.<br />
Die neuen fünften Klassen führen zu Beginn des Schuljahres drei Einzelwandertage durch,<br />
um das Kennenlernen untereinander auch außerhalb des Unterrichts zu fördern.<br />
In den sechsten Klassen führt eine Wanderwoche in hessische Jugendherbergen.<br />
In den achten Klassen sind die <strong>Ziel</strong>e schon etwas weiter gesteckt.<br />
Die zehnten Klassen haben als beliebte <strong>Ziel</strong>e größere deutsche Städte wie Berlin und<br />
München oder es finden Abschlussfahrten ins europäische Ausland statt.<br />
Die Studienfahrten der Jahrgangsstufe 13 führen in der Regel ins europäische Ausland<br />
(Frankreich, England, Tschechien, Italien u.a.).<br />
In der Jahrgansstufe 12 wird für naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler<br />
eine zweitägige Studienfahrt zum Besuch des Deutschen Museums nach München angeboten,<br />
an der in jedem Jahr etwa 50 Jugendliche teilnehmen.<br />
Die PRS hat in den letzten Jahren den Kontakt zu <strong>Schule</strong>n im Ausland ausgebaut. Es kann<br />
allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einem<br />
Schüleraustauschprogramm angeboten werden.<br />
8.5 Schülervertretung<br />
1. Die SV unterstützt die Aussprache zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen bei<br />
Problemen. (Vermittlungstätigkeit)<br />
2. Zwischen SV und den Lehrer/innen besteht eine gute Verständigung und ein gutes<br />
Verhältnis.<br />
3. Die SV nimmt an den <strong>Schule</strong>lternbeiratssitzungen teil und ist Ansprechpartner für die<br />
Eltern.<br />
4. Die SV setzt sich für eine gute Behandlung der Schüler/innen bei Klassenkonferenzen<br />
ein.<br />
5. Die SV ist bei fast jeder Konferenz anwesend, die für Schüler/innen zugänglich ist.<br />
6. In der Schulkonferenz gehen die, vom Schülerrat gewählten,<br />
Schulkonferenzmitglieder ernsthaft mit der Stimmberechtigung um und versuchen<br />
immer im Sinne der Schüler/innen zu entscheiden.<br />
7. Die SV vertritt die Schülerschaft in Ausschüssen (z.B: Bauausschuss,<br />
Cafeteriaausschuss, Ausschuss für Sauberkeit, Schulfestausschuss, etc.) und arbeitet in<br />
Projektgruppen (z.B. Steuergruppenprojekt BLK) mit.<br />
22
8. Durch Rundbriefe und SR-Sitzungen in angemessenen Zeitabständen übermittelt die<br />
SV alle anfallenden Informationen an die Schüler/innen. Auch werden die<br />
Schüler/innen in den Rundbriefen dazu angeregt, eigene Meinungen und Ideen an die<br />
SV weiterzutragen.<br />
9. Am 1. April 2004 fanden für alle Klassensprecher/innen und deren Vertreter der 5.<br />
und 6. Klassen zwei Informationsstunden statt. Die Schüler/innen lernten, welche<br />
Aufgaben ihr Amt mit sich bringt und wie sie sich als Klassensprecher/innen zu<br />
verhalten haben, falls z.B. ein/e Lehrer/in nicht zum Unterricht erscheint oder wie man<br />
sich am besten Gehör bei seinen Mitschüler/innen verschafft, wenn über die Klasse<br />
betreffende Themen gesprochen werden muss.<br />
10. An einem Abend fand im Forum eine SV-Party statt, bei der sich alle interessierten<br />
Schüler/innen über die SV und ihre Arbeit informieren konnten.<br />
11. Die SV hat sich dieses Jahr erstmals beim Schreiben von Artikeln für die<br />
Schülerzeitung beteiligt.<br />
12. Die SV hat die Vorbereitungen für eine Schülerversammlung zur Abstimmung über<br />
die Einführung einer Urwahl getroffen und sich auch schon über den Ablauf einer<br />
eventuellen Urwahl Gedanken gemacht.<br />
13. Die SV hat begonnen, erste Kontakte mit anderen Schulsprecher/innen und<br />
Vertreter/innen von <strong>Schule</strong>n im Umkreis zu knüpfen, um sich über die jeweilige SV-<br />
Arbeit auszutauschen und weitere Erfahrungen und neue Ideen zu sammeln.<br />
14. Wie im vorherigen Schuljahr wurden für das Schuljahr 04/05 wieder Schulplaner für<br />
alle Schüler/innen der 10. – 13. Jahrgangsstufen bestellt, welche pünktlich zum<br />
Schuljahresbeginn verteilt werden.<br />
15. Die SV hat jetzt ein eigenes Logo. (siehe oben)<br />
8.6 Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern<br />
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrkräften der <strong>Schule</strong> ist<br />
für die pädagogische Arbeit von zentraler Bedeutung.<br />
Die Erziehung zu Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl und Toleranz kann nicht allein von der<br />
<strong>Schule</strong> geleistet werden, sondern muss unbedingt auch vom Elternhaus getragen werden. Regeln<br />
des menschlichen und gesellschaftlichen Miteinanders können in der <strong>Schule</strong> nur vertieft und<br />
erweitert, aber nicht mehr als Grundlage erarbeitet werden.<br />
Im Rahmen der Schulgemeinde sind Eltern diejenigen, die am weitesten vom eigentlichen Ort<br />
des Geschehens entfernt sind. Eltern wollen mitwirken und deshalb informiert und integriert<br />
sein. Doch Vieles, was an täglicher Arbeit zu leisten ist, bleibt Sache der LehrerInnen.<br />
Daher können viele der elterlichen <strong>Ziel</strong>e nur zusammen mit den LehrerInnen und durch deren<br />
tägliche Bemühungen erreicht werden.<br />
Unentbehrlich für Kooperation ist das Gespräch. Eltern suchen das Gespräch mit<br />
LehrerInnen, LehrerInnen suchen das Gespräch mit Eltern. Basis dieser<br />
Erziehungspartnerschaft sind gegenseitige Wertschätzung und gegenseitiger Respekt. Daraus<br />
erwächst eine Zusammenarbeit, die von Verständnis und Vertrauen geprägt ist und die nach<br />
dem Motto arbeitet: Schatzsuche statt Defizitfahndung.<br />
In kooperativer Arbeit werden Kinder gemeinsam von LehrerInnen und Eltern gefördert, wird<br />
von beiden Seiten weitergedacht, wird eine <strong>Schule</strong> entwickelt, die jungen Menschen das beste<br />
Rüstzeug für ihre Zukunft bieten. Sowohl Eltern, als auch Lehrkräfte sind dafür<br />
verantwortlich, dass die SchülerInnen nicht nur Fachkenntnisse aufnehmen, sondern auch<br />
23
Schlüsselqualifikationen erwerben, von denen sie in der Zukunft Gebrauch machen können.<br />
Sie müssen mithelfen den SchülerInnen zu vermitteln, wie komplex die moderne Welt ist und<br />
wie wichtig es für jeden einzelnen ist, reflektiertes und vernetztes Denken zu entwickeln.<br />
Die Erfahrung der Arbeit der letzten Jahre zeigte, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern,<br />
Lehrkräften und SchülerInnen positive Veränderungen bewirken konnte. Die Vorhaben des<br />
<strong>Schule</strong>lternbeirat ( Verteilung der Klassenarbeiten, mehr Zusammenarbeit, Einrichtung eines<br />
Ruheraums, Verbesserung der Kommunikation) konnten angegangen und zum Teil umgesetzt<br />
werden. Die gemeinsame <strong>Ziel</strong>setzung darf nicht aus den Augen verloren werden (vgl. Kapitel<br />
10.1 ).<br />
8.7 Öffnung der <strong>Schule</strong>/Zusammenarbeit außerschulischen<br />
Institutionen<br />
Es herrscht allgemeine Übereinkunft, dass Lernen auch außerhalb der <strong>Schule</strong> nicht nur<br />
möglich und notwendig, sondern unerlässlich ist. So werden seitens der PRS vielfältige<br />
Schritte unternommen, SchülerInnen auch außerhalb der <strong>Schule</strong> Erfahrungen zu ermöglichen.<br />
Dazu zählen sowohl die von der <strong>Schule</strong> durchgeführten Betriebs- und Sozialpraktika als auch<br />
Exkursionen oder Kooperationen mit außerschulischen Institutionen (Stadt, Betriebe,<br />
Asylbewerberheim, Altersheim, Kirchengemeinden, Hessenpark und Museen etc.). Die PRS<br />
ist kein isolierter Lernort mehr. Sie ist eine offene <strong>Schule</strong>, die die Kooperation mit<br />
außerschulischen Partnern sucht. Die Öffnung nach außen wird in vielfältiger Weise realisiert,<br />
ist aber durchaus noch ausbaufähig. Öffnung ist in allen Fachbereichen und Zweigen<br />
erkennbar und ergibt sich oft direkt aus dem Unterricht.<br />
Im Anhang (Kapitel 12.4.) informiert eine Übersicht über Außenkontakte und<br />
Kooperationspartner der PRS.<br />
24
9 Evaluation der <strong>Schule</strong>ntwicklung seit 2002<br />
Die erste Fassung des Schulprogramms aus dem Jahre 2002 gab der <strong>Schule</strong> einen vielfältigen<br />
Auftrag zur <strong>Schule</strong>ntwicklung. Iinsgesamt 19 Vorhaben sollten realisiert und koordiniert<br />
werden. In der Zusammenschau der Vorhaben zeigte sich bald, dass<br />
• Schwerpunkte und Prioritäten gesetzt werden müssen, wenn sich die Vielzahl der<br />
Vorhaben nicht gegenseitig blockieren soll,<br />
• einige Vorhaben ( Förderung leistungsschwacher SchülerInnen, Teambildung,<br />
Eigenverantwortliches Arbeiten u.a.) dann nachhaltig umgesetzt werden können,<br />
wenn an der PRS Ganztagesangebote gemacht werden, die den organisatorischen und<br />
pädagogischen Rahmen für diese Arbeit bieten.<br />
Von diesen Prämissen ausgehend setzte die Schulleitungskonferenz Prioritäten bei der<br />
<strong>Schule</strong>ntwicklung für drei Vorhaben: die Teamentwicklung, das BLK-Projekt Demokratie<br />
lernen und leben und bei der Entwicklung der Ganztagesangebote.<br />
Um die Trennung zwischen den allgemeinen <strong>Ziel</strong>setzungen der Eltern und der Lehrkräfte<br />
aufzuheben, koordinierte die Schulprogrammgruppe beide Kapitel. Die Eltern konzentrierten<br />
ihre Anliegen auf 6 Vorhaben, die vom <strong>Schule</strong>lternbeirat bestätigt wurden. Außerdem wurde<br />
ein Fortbildungsplan erarbeitet, auf der Gesamtkonferenz vom 2.6.2004 verabschiedet und<br />
dem Schulprogramm beigefügt.<br />
9.1 Was bisher erreicht wurde<br />
Vorhaben der Eltern, <strong>Schule</strong>lternbeirat (SEB):<br />
Kommunikation verbessern, nach innen und außen<br />
Die gesetzten <strong>Ziel</strong>e, das Erscheinen eines Elternbriefes und die Einrichtung eines<br />
Schaukastens mit aktuellen Informationen des SEB wurden erreicht. Zu wünschen lässt noch<br />
die Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Beiträge von SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern in<br />
dem Elternbrief und die regelmäßige Aktualisierung des Schaukastens. Letzteres übernimmt<br />
nun Frau Golinski-Wöhler, die Zusammenarbeit mit der Presse koordiniert Herr<br />
Ulmschneider.<br />
Eine regelmäßige Kontrolle des Schaukastens, die verbesserte und intensivierte<br />
Kommunikation zwischen Eltern, Lehrkräften und SchülerInnen sollen zur Verbesserung des<br />
Schulklimas an der PRS beitragen.<br />
Stressabbau, Schaffung eines Ruheraums<br />
Der Ruheraum wurde in der Projektwoche März 2003 eingerichtet, seine Nutzung geregelt,<br />
der Raum wird wöchentlich von ca. 10 - 15 SchülerInnen genutzt, eine stärkere Nutzung wäre<br />
wünschenswert (ebenso eine klarere Kontrolle und Dokumentation der Nutzung durch eine<br />
Liste im Sekretariat.<br />
Die Nutzungsliste im Sekretariat soll konsequenter beachtet werden um die Nutzung des<br />
Raumes zu optimieren.<br />
25
Mehr Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kollegium<br />
Seit Juli 2002 haben Fortbildungen und Workshops für Eltern und Lehrer zum Thema<br />
Leserechtschreibschwäche (LRS) und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) stattgefunden.<br />
Am Pädagogischen Tag 2004 haben Eltern an einigen Workshops teilgenommen.<br />
Auch in Zukunft sollen gemeinsame Veranstaltungen angeboten werden, wenn eine<br />
ausreichende Nachfrage für Themen besteht, die von externen Bildungseinrichtungen im<br />
Umfeld nicht angeboten werden.<br />
Vorhaben der Schülervertretung, SV<br />
SV-Stunden regeln<br />
Eine Neuregelung zum Ablauf der SV-Stunden wurde eingeführt, die allerdings noch auf<br />
wenig Akzeptanz bei den KollegInnen trifft und auf deren Kooperation angewiesen ist. Die<br />
Erfahrung der SV zeigt, dass bereits jetzt viel Konfliktstoff an der <strong>Schule</strong> durch diese<br />
Neuregelung entfällt.<br />
Die Regelung muss noch klarer gemacht werden, insbesondere bei Ferien- und<br />
Feiertagen. Den Lehrkräften sollen die neuen Regeln noch einmal deutlich gemacht werden.<br />
Mehr SV-Veranstaltungen organisieren<br />
Es fanden mehr Veranstaltungen statt: Faschingsdisko, Weihnachtsdisko, Sportturnier. Das<br />
Vorhaben soll beibehalten und weiter beobachtet werden, da es die Identifikation der<br />
SchülerInnen mit der <strong>Schule</strong> fördert. Allerdings will sich die SV auf Angebote für die Klassen<br />
5 – 10 beschränken, da die OberstufenSchülerInnen vielfältige andere Interessen und auch<br />
Veranstaltungsangebote haben.<br />
Auch in der Fortschreibung des Schulprogramms soll an einem verstärkten<br />
Veranstaltungsangebot fest gehalten werden.<br />
Information der 5.+6. Klassen verbessern<br />
Die SV-Information in den 5.+6. Klassen wurde verbessert.<br />
Vorhaben der Lehrkräfte<br />
Lehrer: 3. Sportstunde<br />
Das Vorhaben wurde insoweit – begrenzt - umgesetzt, als die Klassen 5-8 zur Zeit 3<br />
Sportstunden haben.<br />
Durch beengte Hallenkapazitäten findet der Sportunterricht nicht immer in der Halle statt und<br />
es besteht die Gefahr des Ausfalls der 3. Sportstunde durch Erkrankungen von KollegInnen.<br />
Die neue Oberstufenverordnung brachte auch eine Organisationsänderung im<br />
Sportunterricht mit sich. Die Fachkonferenz Sport empfiehlt in Zukunft auch in der Oberstufe<br />
3-stündige Sportkurse für alle anzubieten. Über die Machbarkeit soll die Schulleitung eine<br />
Entscheidung treffen.<br />
26
9.2 Problemfelder<br />
Äußere Faktoren<br />
Probleme bei der Umsetzung der Vorhaben bereiten die Raumkapazitäten. Die Vorhaben<br />
„Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA) sind nur schwer realisierbar, wenn Räume und<br />
Ressourcen dafür nicht ausgelegt sind. Sehr große Schülergruppen machen<br />
Schülerexperimente oder die Arbeit mit Neuen Medien sehr problematisch.<br />
Die Ganztagesbetreuung und Förderung von SchülerInnen in Kleingruppen braucht auch eine<br />
ausreichende Infrastruktur ( Cafeteria, Mittagsverpflegung, Aufenthaltsräume), die die PRS<br />
im Moment noch nicht bieten kann. Erst mit dem Neubau kann hier grundlegend Abhilfe<br />
geschaffen werden.<br />
Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte steigt. Zunehmend problematischere SchülerInnen,<br />
Projekte der <strong>Schule</strong>ntwicklung und Qualitätssicherung, die Anforderungen zentraler<br />
Abschlussprüfungen, Pädagogische Projekte und Teambildung erfordern breiten und<br />
vielfältigen personellen Einsatz. Ohne dass die tatsächliche Arbeitszeit der KollegInnen, exakt<br />
erhoben wurde, muss festgestellt werden, dass die individuell erlebte Arbeitsbelastung in den<br />
letzten Jahren enorm gestiegen ist und sich negativ auf die Innovationsfreude auswirkt. Dazu<br />
kommt, dass die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gestiegen ist, bei gleichzeitiger<br />
Reduzierung der Anrechnungsstunden für das vielfältige pädagogische Engagement auf der<br />
einen Seite und die gestiegenen Erwartungen an den Lehrerberuf auf der anderen Seite. Zu<br />
diesem letzten Punkt sei auf die neuen Lehrpläne verwiesen, die den zeitlichen Druck auf die<br />
Arbeit im Klassenzimmer so erhöhen, dass Projektarbeit leidet, und dies obwohl nun gerade<br />
das fächerübergreifende projektorientierte Element in den Lehrplänen so deutlich<br />
hervorgehoben wird.<br />
Interne Lösungsstrategien<br />
Die Umsetzung der einzelnen Vorhaben erwies sich dann als problematisch, wenn in der<br />
Formulierung im Schulprogramm 2002 die Zuständigkeiten unklar oder die<br />
Überprüfungsmodi zu vage angeben waren. Im Ganzen betrachtet, hätte eine Beschränkung<br />
auf eine kleinere Zahl an Vorhaben ihre Umsetzung sicher gefördert. Die Analyse der<br />
Evaluationsbögen zu den einzelnen Projekten zeigte aber auch einige hemmende Faktoren<br />
auf, die in Zukunft veränderbar erscheinen.<br />
Das Vorhaben „Förderung leistungsschwacher SchülerInnen“ , das auch die Förderung der<br />
SchülerInnen mit Migrationshintergrund und Deutsch als Zweitsprache (DAZ) umfasst,<br />
wurde nur zu einem kleinen Teil umgesetzt. Die KollegInnen benennen als erschwerende<br />
Faktoren die Tatsache, dass wir an der PRS keine ausgebildete Lehrkraft für das Fach DAZ<br />
haben. Dementsprechend fehlt ein konsequentes Curriculum, es fehlt eine Bezugsperson für<br />
die SchülerInnen, eine Lehrkraft, die sich auch um die Raumausstattung (OHP, Tafel,<br />
Computer, Lernprogramme etc. ) kümmert und diese einfordert. Zur Zeit wird DAZ<br />
unterrichtet von KollegInnen, die sich mit Engagement in das Fach einarbeiten, aber dann<br />
auch wieder abgezogen werden, wenn sie in ihrem „eigentlichen“ Fach gebraucht werden.<br />
Eine Schwerpunktsetzung der <strong>Schule</strong> bei der Personalplanung, der Fortbildung und der<br />
Ressourcen erscheint hier notwendig.<br />
Bei der Umsetzung des Vorhabens „Lernen lernen – Curriculum für die Klassen 5-10“<br />
erwies es sich als problematisch, dass bspw. in der Klasse 5 die Lehrkräfte, insbesondere die<br />
Klassenlehrer mit einer Anhäufung von Projekten und Aktivitäten konfrontiert waren<br />
27
(„Lernen lernen“, Medienkompetenz, BLK-Projekt - Eingangsprogramm). Hier ist eine<br />
bessere Koordination, eine Absprache zwischen den einzelnen Projekten wünschenswert um<br />
den <strong>Schule</strong>ntwicklungsprozess nachhaltiger und zielgerichteter zu gestalten. Bei der<br />
Implementierung der Baussteine von „Lernen lernen“ im Hauptschul- und im Realschulzweig<br />
zeigte es sich, dass die KollegInnen dort durch die neuen Abschlussprüfungen und<br />
Projektprüfungen überlastet waren. In den nächsten Jahren sollte die Last dieser<br />
Abschlussprüfungen auf mehr Schultern verteilt werden.<br />
Die Faktoren Zeit und Raum wurden bei einigen Vorhaben als grundlegende Voraussetzung<br />
für deren Realisierung genannt. Die Deputatsstundenverordnung, die Stundentafel und andere<br />
Größen liegen nicht im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten der <strong>Schule</strong>. Es ist aber zu<br />
prüfen, inwieweit die <strong>Schule</strong> bspw. die dringend benötigten Klassenratsstunden oder<br />
Klassenlehrerstunden einrichten kann. In diesem Zusammenhang wäre auch auf eine bessere<br />
Verteilung der Förderstunden zu achten, die bisher vornehmlich in den 6. oder 7. Stunden<br />
liegen.<br />
Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA) im Fachunterricht, Aufgabenfeld I und III<br />
Da beide Vorhaben die gleiche <strong>Ziel</strong>richtung haben, d.h. die Stärkung eigenverantwortlicher<br />
Unterrichts- und Arbeitsformen verfolgen, sollten sie als ein Gesamtvorhaben angesehen<br />
werden.<br />
In vielen Fachkonferenzen wurden erste Schritte unternommen. Dazu gehören z.B. das<br />
Hauscurriculum Deutsch oder die Anschaffung von Materialien für projektorientiertes<br />
Arbeiten im AF I und III. In den Fachkonferenzen ENG, FRZ und DEU wurden einzelne<br />
Unterrichtsprojekte vorgestellt.<br />
Im AF III haben sich Arbeitsgruppen gebildet, die für alle Jahrgangsstufen im Fach<br />
Mathematik und im Fach Chemie für die Klassen 8 und 9 vollständige Themen und<br />
Experimentalkataloge vorlegten. Die entsprechenden Ordner für die Klassen 10 sind zur Zeit<br />
in Arbeit. Ähnliches gilt für die Fächer Physik und Biologie.<br />
Hier zeigte sich insbesondere auch das Problem der Klassen- und Kursgrößen (s.o.) und das<br />
Fehlen von Ressourcen in ausreichendem Maße, um SchülerInnen mehr an<br />
eigenverantwortliches Arbeiten heranzuführen.<br />
Der Pädagogische Tag 2002 befasste sich mit dem Thema „<strong>Schule</strong> kreativ“, mit dem <strong>Ziel</strong>,<br />
Anleitung zu eigenverantwortlichem und kreativem Arbeiten im Unterricht zu geben.<br />
Die Voraussetzungen der Einrichtung einer Kulturwerkstatt wurden sondiert, wobei die Frage<br />
der Ressourcen und der Anrechnungsstunden für diese Arbeit eine Rolle spielte. Herr Meier,<br />
Herr Dr. Schnöbel und Frau Schilling erarbeiteten ein Konzept, das aber noch seiner<br />
Umsetzung in den nächsten Jahren bedarf.<br />
Die Einrichtung einer Kulturwerkstatt im Sinne einer Schreibwerkstatt, damit die<br />
Schüler Raum für kreative Eigenproduktionen, auber auch Hilfestellungen für das Verfassen<br />
von Referaten, Protokollen etc. bekommen können, erwies sich als notwendig. In die<br />
Neufassung dieses Vorhabens sollte dieser Auftrag mit einfließen.<br />
Lernen Lernen<br />
Die Planungsphase ist abgeschlossen, ein hausinternes Curriculum wurde entwickelt.<br />
Die Umsetzung eines Teils der Bausteine in den Klassen 5 , 7 und 9 lief an, wobei für die<br />
Klassen 7 noch eine Fortbildung der FachLehrerInnen erfolgen wird.<br />
Die Umsetzungsphase ist im Moment noch eine Erprobungsphase, in der die neu entwickelten<br />
Bausteine überprüft werden.<br />
Der Pädagogische Tag 2003 befasste sich mit dem Thema „Lernen lernen“. Die dort<br />
angebotenen Workshops gaben nachhaltige Impulse für die Weiterarbeit im Unterricht.<br />
28
In den nächsten Jahren steht eine Überarbeitung einzelner Bausteine an und die<br />
Ausweitung des Lernen lernen Projekts auf die Jahrgangsstufen 6,8 und 10.<br />
Auf eine bessere Koordination mit anderen Projekten ist in Zukunft zu achten.<br />
BLK-Projekt „Demokratie lernen und leben“<br />
Das Vorhaben hat sich verändert, konsolidiert und ausgeweitet. Die Projektsteuergruppe tagt<br />
regelmäßig unter Leitung von Herrn Dr. Wahab. Zur Zeit liegt die erste Rückmeldung, die<br />
Auswertung des Fragebogens des DIPF (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische<br />
Forschung) vor, das noch ausgewertet werden muss. Die in den folgenden Jahren zu<br />
leistenden Maßnahmen werden sein: Basis- und Aufbautraining für weitere KollegInnen,<br />
weitere spezielle Fortbildungen für die einzelnen Bausteine und Beratung bei der<br />
Entwicklung, Erprobung und Verzahnung der Bausteine.<br />
Teambildung<br />
In den letzten beiden Jahren haben sich Teams von LehrerInnen (7G+R, 8G, 8+9H) gebildet,<br />
die die Arbeit in den Klassen stark koordinieren. Nach einiger Vorlaufzeit konnten auch die<br />
Teambereiche baulich abgetrennt und jeweils von den Teams ausgestaltet werden.<br />
Allerdings scheinen wie oben schon erwähnt, die Grenzen der baulichen Kapazitäten erreicht<br />
zu sein, insbesondere auch in Verbindung mit dem neuen Konzept zum „entzerrten Untericht“<br />
für die Jahrgangsstufe 7.<br />
Das derzeitige, in Stufe 7 erprobte Modell ist zu personalintensiv, um es auf weitere<br />
Lerngruppen auszuweiten. Verstärkt wird dieses Problem durch die begrenzten Möglichkeiten<br />
für Aufenthalt und Verpflegung in der Mittagszeit, was zusätzliche Aufsichten in den<br />
Klassenräumen erfordert.<br />
Neue Teams können daher kaum noch auf einen abgegrenzten Teambereich hoffen. Dazu<br />
kommt, dass die zusätzlichen zeitlichen Belastungen abschreckend wirken für die<br />
KollegInnen angesichts deutlich angestiegener Belastungen.<br />
Die Evaluation des Teambildungsprozesses zeigt die positiven Auswirkungen der<br />
Kooperation im Team für die SchülerInnen, aber auch für die Lehrkräfte und das Schulklima.<br />
Ein Gesamtkonzept der Teambildung muss daher erstellt werden. Die räumlichen und<br />
personellen Ressourcen, insbesondere bei den AG- Angeboten und bei der Mittagsbetreuung,<br />
bedürfen einer besonderen Beachtung. Die Information der Lehrkräfte und die Vermittlung<br />
der positiven Auswirkungen der Teamarbeit auf die individuelle Arbeitssituation sollten dazu<br />
beitragen für die Mitarbeit in Teams zu werben.<br />
Wahlmöglichkeiten für die SchülerInnen erweitern<br />
Einiges wurde hier bisher schon erreicht, unter anderem die Projektwoche 2003 mit<br />
reichlichen Projektangeboten. Auch auf Elternabenden wurde Werbung gemacht für die<br />
Mitarbeit von Eltern bei Projekten<br />
Engpässe in der Lehrerversorgung, mangelnde Kapazitäten (Hallenversorgung) und<br />
Schwierigkeiten bei der Mitarbeit der Eltern (Cafeteria) erschweren allerdings die Forderung<br />
nach Ausweitung des Wahlangebotes für SchülerInnen.<br />
Eine größere Vielfalt von AGs und Wahlmöglichkeiten für SchülerInnen soll als<br />
Vorhaben beibehalten werden, der Schwerpunkt der Arbeit wird auf der Klärung förderlicher<br />
Rahmenbedingen liegen.<br />
Umgang mit dem Schulgebäude<br />
Der Umgang mit dem Schulgebäude war in den letzten beiden Jahren immer wieder<br />
Gegenstand eingehender Beschäftigung. Für die neuen Teams wurden die Räume renoviert<br />
und Teamräume geschaffen. Eine Arbeitsgruppe erarbeitete ein neues Sauberkeitskonzept, das<br />
inzwischen verabschiedet wurde und in der Phase der Umsetzung ist.<br />
29
Andere Teilvorhaben bleiben aber noch auf der Tagesordnung für die Neufassung des<br />
Schulprogramms. Dies gilt insbesondere die Einbindung der Hausmeister und die Gestaltung<br />
der Schulhöfe.<br />
Förderung leistungsschwacher SchülerInnen<br />
Bei der Umsetzung dieses Vorhabens lag der Schwerpunkt vor allem auf der Förderung der<br />
SchülerInnen mit Migrationshintergrund und mangelnden Deutschkenntnissen. Es wurden<br />
zusätzliche Sprachkurse für Ausländerkinder gebildet. Ein C-Kurs wurde in zwei Kurse zu je<br />
13 SchülerInnen geteilt. Problematisch ist die ungünstige Verteilung der Förderstunden auf<br />
den Vormittag ( 6./7.Std.) Eingerichtet wurde darüber hinaus ein DAZ-Kurs mit inzwischen<br />
16 Förderstunden (d.h. vier mal so viele Stunden wie 2000/2001). Die Überarbeitung dieses<br />
Vorhabens für 2004 wird auch die Förderung von leistungsschwachen SchülerInnen im<br />
Fachunterricht, die Förderung der Lesekompetenz für deutsche SchülerInnen mit aufgreifen.<br />
Vielfalt der Kulturen stärken<br />
Hier wurde auf die ursprünglich intendierte Beteiligung an der Initiative "<strong>Schule</strong> ohne<br />
Rassismus" zugunsten des BLK-Projektes verzichtet. Bisher wurden interkulturelle Kalender<br />
ist in jedem Klassenraum ausgehängt, Arbeitsmaterialien in der Bibliothek hinterlegt und ein<br />
Curriculum " soziales und interkulturelles Lernen " erstellt, das aber noch nicht komplett<br />
umgesetzt ist. Die Einbeziehung der LehrerInnen, die Herkunftssprachen unterrichten, die<br />
Herausbildung eines Unterrichtsschwerpunktes Migration, die bessere Förderung von<br />
Migranten und eine Sammlung von Kompetenzen zur interkultureller Bildung werden in den<br />
nächsten Jahren umgesetzt werden.<br />
Als problematisch wurde hier erlebt, dass Zuständigkeiten unklar waren (Grenzziehung zum<br />
BLK-Projekt, Zuständigkeit in der SL) und dass ein Mangel an Resonanz für das Vorhaben<br />
im Kollegium zu beobachten ist.<br />
Motivation für musische Fächer stärken<br />
Das Konzept der Bläserklasse hat sich konsolidiert, das Instrumentarium ist erweitert worden.<br />
Positiv hat sich auch die Akzeptanz des Weihnachtskonzertes entwickelt, das zu einem festen<br />
Bestandteil des Schullebens wurde. Quantitativ relativ schwach besetzt ist der Schulchor und<br />
das PRS Ensemble. Wenig zufriedenstellend ist nach wie vor die räumliche Situation. Mit<br />
einer Musikfreizeit im Sommer 2004 soll versucht werden, eine bessere Grundlage für ein<br />
Schulorchester zu schaffen. Dabei soll vor allem versucht werden, Streicher mit einzubinden.<br />
Die FK Musik sieht unter dem Leitsatz Identifikation Arbeitsbedarf für die ganze<br />
<strong>Schule</strong>. Es sollten mehrere Initiativen versuchen, die Identifikation mit der <strong>Schule</strong> zu<br />
verstärken (Internet-Auftritt, Jahrbuch) etc. Die Stärkung der Musikensembles kann nur ein<br />
Element im Gesamtkonzept sein.<br />
30
9.3 Konsequenzen für die Formulierung der neuen Vorhaben<br />
Aus den Rückmeldungen zur Entwicklung der einzelnen Vorhaben des Schulprogramms<br />
ergab sich als Forderung an die Überarbeitung 2004:<br />
• keine Trennung mehr zwischen Eltern- , LehrerInnen- und SchülerInnenbeiträgen im<br />
Schulprogramm<br />
• genauere Fassung der Überprüfungsmodi<br />
• genauere Festlegung der Verantwortlichen, bei einzelnen Projekten<br />
• genaue Fassung von Indikatoren, um eine spätere Überprüfung genauer beobachtbar<br />
zu machen<br />
10 Was strebt die PRS an?<br />
10.1 Allgemeine <strong>Ziel</strong>e<br />
Das Schulprogramm 2002 basierte noch auf einer Unterteilung in <strong>Ziel</strong>e aus der Sicht der<br />
Lehrkräfte und der Eltern, die inzwischen aufgehoben werden konnte. Die Eltern und die<br />
Lehrkräfte der PRS haben an der Integration der beiden Sichtweisen gearbeitet und legen<br />
2004 gemeinsame <strong>Ziel</strong>setzungen vor.<br />
Die Leitlinien Vielfalt, Leistung, Verantwortung und Identifikation finden ihren Niederschlag<br />
in den <strong>Ziel</strong>vorstellungen der einzelnen Fächer bzw. Fächergruppen.<br />
Vielfalt<br />
Die Kooperation zwischen den Fächern wird verbessert. Fächerübergreifendes Arbeiten soll<br />
selbstverständlich werden. Ein möglichst breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften wird<br />
angestrebt.<br />
Sprachen<br />
Die Vielfalt im Unterrichtsangebot an der PRS, bspw. in den Fremdsprachen, soll beschützt<br />
und ausgebaut werden. Es sollen attraktive Unterrichtsangebote in den dritten Fremdsprachen,<br />
gemacht werden, um der Rückläufigkeit der Schülerzahlen (vor allem in Russisch, Latein,<br />
Französisch als 3. Fremdsprache) entgegen zu wirken. Falls die Schülerzahlen für Französisch<br />
als erste Fremdsprache, Russisch als 3.Fremdsprache weiterhin trotz aller Bemühungen um<br />
Attraktivität und Akzeptanz rückläufig sein sollte, muss das Fremdsprachenangebot an der<br />
PRS neu überdacht und strukturiert werden.<br />
Im Bereich der Schüleraustauschprogramme sollten noch mehr SchülerInnen für längerfristige<br />
Auslandsaufenthalte motiviert werden, auch für Länder außerhalb Nordamerikas.<br />
Ein verstärkter Kontakt mit <strong>Schule</strong>n in England und Spanien ist anzustreben.<br />
Der Fremdsprachenunterricht an der PRS sollte sich mehr nach Europa öffnen durch eine<br />
Beteiligung an Sokrates/Comeniusprogrammen, die Mitarbeit an Europäischen<br />
Bildungsprojekten. Internetprojekte mit ausländischen <strong>Schule</strong>n sollen durchgeführt und auch<br />
für jüngere Jahrgangsstufen zugänglich gemacht werden.<br />
31
Das Fach Deutsch zielt auf eine Erweiterung des methodischen Repertoires ab, besonders<br />
durch projektartige Unterrichtskonzepte und durch die verstärkte Einbindung der neuen<br />
Medien. Im Medienkonzept nimmt das Fach Deutsch für die Jahrgangsstufe 5 eine<br />
Schlüsselstellung ein. Die Umsetzung der im Hauscurriculum festgelegten Vereinbarungen<br />
muss erfolgen.<br />
Kunst, Musik, Theater<br />
Die Motivation für musische Fächer und außerunterrichtliche musische Angebote könnte bei<br />
den SchülerInnen noch verstärkt werden. Dazu zählt der Aufbau des Orchesters aus den<br />
Jahrgangsstufen, die an dem Projekt „Klassenmusizieren“ teilgenommen haben, ebenso wie<br />
die Stärkung der Chorarbeit. Die Theaterarbeit soll durch das Fach „Darstellendes Spiel“ in der<br />
Gymnasialen Oberstufe gestärkt und vertieft werden.<br />
Gesellschaftswissenschaften<br />
Es sollen eine Vielfalt von Methoden und Medien zum Einsatz kommen. In Interaktion<br />
zwischen LehrerInnen und SchülerInnen und durch die Beteiligung der SchülerInnen an der<br />
Unterrichtsplanung und –gestaltung sollen fächerübergreifende Projekte und<br />
handlungsorientiertes Lernen außerhalb der <strong>Schule</strong> durch Praktika, Erkundungen,<br />
Zusammenarbeit mit Betrieben und sozialen Institutionen gefördert werden.<br />
Mathematik und Naturwissenschaften<br />
Im Fach Mathematik werden verstärkt Unterrichtsformen entwickelt und eingesetzt, die<br />
Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der SchülerInnen in den Mittelpunkt stellen. In den<br />
Fachkonferenzen findet ein Erfahrungsaustausch über den Einsatz und die Effizienz dieser<br />
Unterrichtsformen statt.<br />
Der Unterricht in Physik und Biologie in der Jahrgangsstufe 7 ist in den schulinternen<br />
Stoffplänen stark vernetzt und soll möglichst in einer Hand liegen, um fächerübergreifend<br />
arbeiten zu können. Das Experiment steht im Vordergrund des methodischen Vorgehens. Wo<br />
immer möglich, steht grundsätzlich das Schülerexperiment vor dem Lehrerexperiment. Zur<br />
Erkenntnisgewinnung chemischer Prozesse wird auch die Historie der Chemie bearbeitet.<br />
Chemie versteht sich als ein fächerübergreifendes Fach mit vordergründig<br />
naturwissenschaftlichen Themen.<br />
Sport<br />
Die PRS bietet eine breit gefächerte Grundausbildung in möglichst vielen Sportarten auch<br />
durch die Einbindung von „neuen Sportarten“ in den Unterrichtsalltag. Notwendig wird<br />
hierbei die Anschaffung des benötigten Materials in ausreichender Anzahl.<br />
Hierbei soll ein Schwerpunkt gesetzt werden bei „neuen Sportarten“, um die Attraktivität und<br />
Aktualität des Sportangebotes zu erhöhen. Eine Fortbildung der KollegInnen in den „neuen<br />
Sportarten“ wird dabei notwendig sein. Die PRS ist Schwerpunktschule für „Pitch, Hit &<br />
Run“, „Safer Skating“ und „Flag Football“. Darüber hinaus gibt es Klassenfahrten mit<br />
sportlichem Schwerpunkt, Schulskikurse, Paddelfahrten etc.<br />
Das sportliche Angebot der PRS in AGs, im Wahlpflichtunterricht und in Projektwochen geht<br />
über das curriculare Angebot hinaus und bietet ein breit gefächertes Angebot unter<br />
Berücksichtigung von Randsportarten (Reiten, Golf, Squash, Tennis, Biking, Baseball,<br />
Radwandern).<br />
Ebenso wichtig ist uns ein attraktives und vielfältiges Bewegungsangebot in den Pausen,<br />
Spieletonnen in Klassen 5 und 6. Ausstattung der Schulhöfe mit Tischtennisplatten,<br />
Basketballkörben, Kletterwand etc. sowie ein breitgefächertes Sportangebot zu besonderen<br />
Anlässen und die regelmäßige Durchführung von Schulsporttag, Sportshow und Sport-Festival<br />
sind zentrale Anliegen des Fachbereichs Sport.<br />
32
Verantwortung<br />
Sprachen, Kunst, Musik, Theater<br />
Freiwillige Nachmittagsangebote, wie z.B. eine offene Kulturwerkstatt sollen sprachliche und<br />
musische Neigungen fördern, die kreative Arbeit an der PRS stärken und SchülerInnen<br />
einladen, Verantwortung zu übernehmen. Mehr Projektarbeit in den Fremdsprachen soll zu<br />
einem Mehr an Eigenverantwortung der SchülerInnen beitragen.<br />
Gesellschaftswissenschaften<br />
Zunehmende Selbstständigkeit soll zu mehr Verantwortung jedes Einzelnen für das eigene<br />
Handeln und für die Gemeinschaft führen. Dieses beinhaltet die Verantwortung für die<br />
Anwendung von Menschen- und Bürgerrechten, Verantwortung für die Umwelt durch<br />
Kennenlernen der Wechselbeziehung zwischen Mensch und Raum, aber auch die<br />
selbstständige Organisation der eigenen Schullaufbahn.<br />
Mathematik und Naturwissenschaften<br />
Im Fach Physik wird das eigenständige Experimentieren der SchülerInnen vermehrt eingesetzt.<br />
Ein Erfahrungsaustausch dazu erfolgt in der Fachkonferenz.<br />
Im Schülerexperiment sollen SchülerInnen praktische und soziale Elemente erfahren.<br />
Die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und der Natur (z.B. Entsorgung und<br />
Gefahrstoffproblematik) sollen erlebt werden. Ein hohes Maß an Praxisorientierung wird dabei<br />
angestrebt, wobei auch wirtschaftliche Faktoren erörtert werden. Chemieunterricht soll zu<br />
Ordnung, Systematik und zum Arbeitsschutz erziehen.<br />
Die Stärkung eines Verantwortungsbewusstseins im Umgang mit Natur und Umwelt wird in<br />
allen Teilbereichen der Physik, besonders aber beim Thema „Energie“ in Jahrgangsstufe 10<br />
gefördert.<br />
Die regelmäßige Durchführung verschiedener Exkursionen zu GSI, Kraftwerken und<br />
Energieversorgungsunternehmen (OVAG/Maingas) erschließt den SchülerInnen neue<br />
Erfahrungsfelder.<br />
Sport<br />
Der Sportunterricht soll das Verantwortungsgefühl in Sportarten mit erhöhtem Risiko bewusst<br />
machen und stärken durch die Durchführung von Klassenfahrten mit sportlichem Schwerpunkt<br />
(z.B.: Wandern, Paddeln, Klettern, Ski- und Snowboardfahren, Radwandern).<br />
SchülerInnen mit erheblichen sportmotorischen Defiziten sollen gefördert werden und in<br />
klassenübergreifenden Lerngruppen Schulsonderturnen durchgeführt werden.<br />
Der Fair-play–Gedanken soll gestärkt werden durch die Hervorhebung besonders<br />
gemeinschaftlichen Schülerverhaltens und auch durch die Vergabe einer „Fair-play-Medaille“<br />
am Ende des Schuljahres.<br />
Identifikation<br />
Sprachen<br />
Durch Teambildung und mehr Kooperation und Kommunikation sollen Inseln der<br />
Identifikation geschaffen werden für SchülerInnen und LehrerInnen. <strong>Ziel</strong> sollte es sein, dass<br />
möglichst viele SchülerInnen möglichst viele Sprachen sprechen und leben. Dazu gehören<br />
aber nicht nur die Fremdsprachen.<br />
33
Gerade auch das differenzierte Ausdrucksvermögen im Deutschen muss entwickelt werden,<br />
um den Schülern die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und die Identifikation damit<br />
zu erleichtern. Der Lernort zum Sprachenlernen kann nicht nur die <strong>Schule</strong> sein.<br />
Eine SchülerInnenzeitung soll fest etabliert werden, eventuell im Rahmen einer AG.<br />
Musik<br />
Um den Zeitgeschmack der SchülerInnen stärker zu berücksichtigen, soll das musische<br />
Angebot ausgeweitet werden. Die Entwicklung im Bereich der Bläserklassen lässt auf den<br />
Aufbau einer Big Band oder einer Rockgruppe hoffen, auf eine größere Identifikation der<br />
SchülerInnen mit dem musikalischen Angebot der <strong>Schule</strong>.<br />
Gesellschaftswissenschaften<br />
Die Fächer des Fachbereichs bemühen sich in besonderer Weise darum, die Identitätsfindung<br />
der Jugendlichen zu unterstützen. Dazu zählen in erster Linie: Ich-Stärkung, die Empathie mit<br />
dem Anderen/Fremden, die Auseinandersetzung mit dem eigenen und dem anderen<br />
Geschlecht, die Thematisierung der Geschichte und verschiedenartiger kultureller Traditionen<br />
und deren Relevanz für die Gegenwart, die Auseinandersetzung mit religiösen Einflüssen<br />
sowie die Reflexion ethisch-moralischer Vorstellungen. Dabei soll das eigene Engagement für<br />
Demokratie und Menschenrechte gefördert werden und eine Auseinadersetzung mit der Zeit<br />
des Nationalsozialismus bzw. mit dem Rechtsradikalismus der Gegenwart, aber auch mit<br />
anderen aktuellen totalitären Ideologien stattfinden. Der Einsatz neuer Medien soll verstärkt im<br />
Unterricht erfolgen. Gleichzeitig sollen die SchülerInnen angeregt werden, den Umgang mit<br />
Medien in ihrer eigenen Lebensweise kritisch zu reflektieren.<br />
Mathematik und Naturwissenschaften<br />
Das Erleben der Chemie im Experiment soll zur kritischen Selbsttätigkeit und Ernsthaftigkeit<br />
führen. Eine Orientierung auf die Wissenschaft Chemie soll dabei selbstverständlich werden.<br />
Aktuelle Einflüsse aus der Lebensumwelt sollen dabei berücksichtigt werden.<br />
Im Mathematikunterricht sollten immer wieder Phasen des spielerischen Umgangs mit den<br />
Lerninhalten konzipiert und verwirklicht werden. Dies ist denkbar entweder in Form von<br />
konkreten Spielen, die Selbst – oder Gruppenerfahrung in der Auseinandersetzung mit dem<br />
Lernstoff ermöglichen oder in Form eines eher haptischen Erfahrungsfeldes. Hier ist der<br />
Lernprozess geknüpft an die reale Umsetzung in mathematische Objekte. Durch solche<br />
kreativen Herausforderungen kann der logische Erkenntnisweg aufgebrochen und erweitert<br />
werden und sie können den SchülerInnen individuellen Identifikationsraum bieten.<br />
Bei der Evaluation von Unterrichtsprojekten sollte ein Austausch von im Unterricht<br />
eingesetzten Spielen, Folien, Bastelanleitungen usw. erfolgen.<br />
Leistung<br />
Sprachen<br />
An einen Ausbau des Angebots an dritten Fremdsprachen (z.B. Italienisch) wäre zu denken.<br />
Die Beteiligung von Lehrer und n an Wettbewerben und externen fachübergreifenden<br />
Projekten soll gefördert werden. Im Deutsch- und im Fremdsprachenunterricht wird eine<br />
Förderung kreativer Leistungen angestrebt. Dies soll sich in Form kreativer Schreibaufträge im<br />
Unterricht, aber auch in Form einer Schreibwerkstatt unter dem Dach der Kulturwerkstatt<br />
niederschlagen.<br />
Gesellschaftswissenschaften<br />
Durch Individualisierung des Unterrichts und Einsatz vielfältiger, moderner und aktueller<br />
34
Recherchemöglichkeiten in der Bibliothek (Hausarbeiten/Internetrecherche) soll den<br />
Interessen und dem Leistungswillen des einzelnen Schülers Rechnung getragen werden. Er<br />
soll sich damit selbstständig mit seiner Lebenswelt kritisch auseinandersetzen, seine Rolle als<br />
politisches und soziales Wesen begreifen und sein historisches Bewusstsein heranbilden.<br />
Durch Betriebspraktika sollen SchülerInnen an verschiedenen Stellen ihrer Schullaufbahn auf<br />
die Anforderungen in der Arbeitswelt vorbereitet werden und sich mit der Berufs- und<br />
Arbeitswelt auseinandersetzen. Fächerübergreifende Projekte, Erkundungen vor Ort,<br />
Zeitzeugengespräche und praktische Arbeiten in sozialen Institutionen sollen den Horizont<br />
erweitern.<br />
Mathematik und Naturwissenschaften<br />
Die Teilnahme an Wettbewerben im Fach Physik soll unterstützt werden.<br />
Eine Verbindlichkeit in Inhalt und Leistungsbild soll durch die Erstellung von Stoffplänen<br />
gewährleistet werden. Wissenschaftlich-systematisches Arbeiten soll sich als roter Faden<br />
durch den Experimentalunterricht ziehen.<br />
Lernkontrollen sollen hinsichtlich der Lerngruppen einer Jahrgangsstufe vergleichbar sein.<br />
Zur Vernetzung der Themengebiete soll in einer Arbeit pro Halbjahr ein Aspekt aus einer<br />
weiter zurückliegenden Unterrichtseinheit aufgegriffen werden.<br />
Sport<br />
Unterrichtliche und außerunterrichtliche sportliche Angebote sollen ein möglichst hohes<br />
Niveau aufweisen. Dies kann dann gelingen, wenn der individuelle Leistungswillen jedes<br />
einzelnen Schülers gesteigert wird. WPU-Kurse in Sport sollen mit angemessenem<br />
Theorieanteil versehen werden. SchülerInnen mit besonderen sportlichen Fähigkeiten sollen<br />
auch im Rahmen des Schulsports gefördert und gefordert werden, z.B. indem<br />
Jahrgangsturniere durchgeführt werden. Leistungsanreize für sportbegabte SchülerInnen sollen<br />
vermehrt geschaffen werden durch Schulauswahlmannschaften in möglichst vielen Sportarten.<br />
Qualifizierte SchülerInnen können Teile der Unterrichtsgestaltung übernehmen in Absprache<br />
und Koordination mit der Lehrkraft.<br />
10.1.1 Öffnung<br />
Öffnung und Öffentlichkeit hängen eng zusammen. Eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit<br />
dient auch der Identifikationsbildung aller Beteiligten, der Eltern, der LehrerInnen und der<br />
SchülerInnen, weil dadurch die Rolle der <strong>Schule</strong> im öffentlichen Leben der Stadt<br />
Friedrichsdorf unterstrichen wird.<br />
Öffnung heißt aber auch, dass die <strong>Schule</strong> für die Bevölkerung der Stadt geöffnet wird, so dass<br />
die Rolle der <strong>Schule</strong> als einem Ort aktiven Lernens unterstrichen wird. Die <strong>Schule</strong> soll dabei<br />
ihren Charakter als Werkstätte zeigen, in der an einem Produkt gearbeitet, dessen Herstellung<br />
beobachtet werden kann und das ins seiner Endform öffentlich zugänglich ist (Ausstellung,<br />
Präsentation, Theater ...).<br />
Dies hat weit reichende Konsequenzen:<br />
Das jeweilige Wissen des einzelnen Schülers wird durch aktive Teilnahme erweitert.<br />
Auch das Wissen und die Kenntnisse von Eltern und anderen Experten (z.B. Übungsleiter)<br />
werden in das Lernen einbezogen.<br />
Die Angebote, die die Umgebung macht, werden aufgegriffen, z.B. werden Betriebe,<br />
Werkstätten und Institutionen als außerschulische Lernorte genutzt.<br />
35
Die <strong>Schule</strong> steht aktiven SchülerInnen als Werkstatt auch in ihrer Freizeit offen (offene<br />
<strong>Schule</strong>), soll in Zukunft auch bspw. Kunsträume für freies Gestalten nach individueller<br />
Neigung und ohne Unterrichtsbezug zur Verfügung stelle. Das Konzept der Kulturwerkstatt,<br />
das anders als institutionalisierte Arbeitsgemeinschaften vielfältige Angebote machen kann,<br />
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Durch fremdsprachige Filmvorführungen soll das<br />
städtische Filmangebot erweitert und Internationalität und fremdsprachliche Kompetenz<br />
gefördert werden.<br />
Durch Veröffentlichung der Lernergebnisse in neuen Medien oder Printmedien wird die<br />
Öffentlichkeit über die Arbeit in der <strong>Schule</strong> informiert, Lerninhalte werden aktualisiert und<br />
Lebens- und Gesellschaftsbezug werden deutlich.<br />
Um dieses zu erreichen sollten<br />
• Klassen im Laufe eines Schuljahrs möglichst an einem öffentlich zu präsentierenden<br />
Projekt (in einem Fach oder fächerübergreifend) arbeiten.<br />
• Die Projekte außerschulische Lernorte und Experten (Museen, Betriebe, Fachleute,<br />
Eltern, Großeltern, Institutionen ...) einbeziehen,<br />
• im Rahmen einer Kulturwerkstatt, Fachräume SchülerInnen und LehrerInnen zum<br />
gemeinsamen freien Arbeiten zur Verfügung gestellt und<br />
• die Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Landessportbund etc. intensiviert werden.<br />
10.1.2 Konflikte<br />
Der Umgang mit Konflikten ist zentraler Bestandteil der Unterrichts- und Lebenswirklichkeit<br />
jeder <strong>Schule</strong>. Die PRS sieht hier zentrale Aufgaben. In Bezug auf die Leitlinien der PRS<br />
ergeben sich dabei folgende Thesen und Konsequenzen für den Umgang mit Konflikten:<br />
Leitlinie Vielfalt<br />
These 1:<br />
Ein Konflikt hat nicht nur störenden Charakter, sondern birgt auch ein konstruktives Potenzial<br />
und einen verborgenen Reichtum.<br />
These 2:<br />
Konflikt, als Hinweis und Quelle verstanden, kann als Innovationsfaktor genutzt werden, um<br />
eingefahrene Gleise aufzubrechen und Vielfältigkeit zu fördern.<br />
These 3:<br />
Eine gehobene Konfliktkultur setzt voraus, dass die Konfliktpartner sich in die Lage des<br />
Gegenübers versetzen können, ohne ihr Anliegen zu verleugnen.<br />
These 4:<br />
Als Konfliktpartner brauche ich eine gewisse Grundneugier, wirklich etwas darüber erfahren<br />
zu wollen, was mein Gegenüber bewegt.<br />
These 5:<br />
Vielfalt und Konflikt verbinden sich positiv nur auf der Basis eines „gesunden" Misstrauens<br />
gegenüber allem Eingefahrenen mit der Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten.<br />
36
These 6:<br />
Wir brauchen eine Balance zwischen Bekanntem, Sicherem und Neuem, Frischem, damit<br />
Konflikt als Bereicherung und nicht als Bedrohung erlebt werden kann.<br />
Maßnahmen zur Umsetzung der Leitlinien:<br />
• Formulierungs- und Sprachfähigkeit fördern beim Thematisieren von Konflikten, zum<br />
Beispiel im Deutschunterricht<br />
• In den geeigneten Fächern (Sprachen, Religion, Sozialkunde) das Äußern von Gefühlen<br />
anregen und üben<br />
• Trainieren der Ich-Sprache<br />
• Nichtsprachgebundene Ausdrucksformen der Identitätsbeschreibung entwickeln, zum<br />
Beispiel in den musischen Fächern oder in Religion<br />
Leitlinie Verantwortung<br />
These 1:<br />
Verantwortungsfähigkeit, verstanden als die Bereitschaft, für die Folgen meiner Handlungen<br />
einzustehen, ist gerade in Konflikten eine Basisqualität, da hier oft gegenläufige Interessen<br />
und Absichten aufeinanderprallen.<br />
These 2:<br />
Da bei entsprechender Vorgeschichte im Konfliktfall hoch aufgeladene aggressive Potenziale<br />
zusammenstoßen können, ist die Fähigkeit zu Gelassenheit und dem Übernehmen von<br />
Verantwortung dringend nötig, um den zerstörerische Kräften keine freien Lauf zu lassen.<br />
These 3:<br />
Verantwortlicher Umgang mit Konflikten beginnt bei einem möglichst frühzeitigen<br />
Aufspüren sich abzeichnender Problemsituationen, um einen Gestaltungsspielraum für die<br />
Konfliktbearbeitung zu erhalten. Wenn man schon den Anfängen nicht wehren kann, so doch<br />
wenigstens, vermeidbarer Eskalation.<br />
These 4:<br />
Verantwortliches Verhalten im Konfliktfall bringt es mit sich, die eigene Rolle kritisch zu<br />
überdenken, einerseits kein Einzelkämpfertum zu praktizieren, andererseits aber daran zu<br />
arbeiten, eine gewisse Festigkeit auch in kritischen Situationen entwickeln zu können, frei<br />
nach dem Motto: "Mit mir müsst ihr rechnen, auch wenn es euch nicht gefällt.".<br />
These 5:<br />
Verantwortlichkeit im Konfliktfall bedeutet, nicht einer Harmoniesucht zu erliegen, denn<br />
diese begünstigt in der Regel einen schwelenden Brand, der sich irgendwann eruptiv entlädt.<br />
Maßnahmen zur Umsetzung der Leitlinie:<br />
• Teilnahme von Schülern und Lehrer an Mediationskursen, evtl. mit einer Ausbildung zum<br />
Mediator<br />
• Vernetzung der Unterrichtsinhalte in den Fächern Religion, Ethik, Geschichte und<br />
Sozialkunde, in denen die Fragen des zwischenmenschlichen Umgangs zum Thema<br />
gemacht werden<br />
37
Leitlinie Identifikation<br />
These 1:<br />
Identifikation mit einer Institution bedeutet, diese als einen Wert zu empfinden und dass es<br />
einen Wert darstellt, selbst ein Teil von ihr sein zu dürfen.<br />
These 2:<br />
Da Konflikt meistens mit dem Moment der Angst und Ungewissheit über den<br />
Konfliktausgang verbunden ist, kann die "Liebe zur Institution" helfen, diese eher belastenden<br />
Begleitumstände auf sich zu nehmen, um der Förderung und Weiterentwicklung der<br />
Institution zu dienen.<br />
These 3:<br />
Die Erzeugung und Pflege eines Wir-Gefühls ist gekoppelt an eine gewisse<br />
Konfliktfreudigkeit, zumindest an eine stabile Konfliktbereitschaft. Diese wiederum ist eng<br />
verbunden mit Toleranz. Toleranz ist eine Haltung, die Spielraum lässt für Abweichungen<br />
von dem, was man selbst möchte und für richtig erachtet. Die dafür nötige innere Elastizität<br />
hat als Basis das eigene Wertgefühl. Außerdem spielt noch hinein, wieviel man selbst von<br />
sich weiß und bereits erfahren hat.<br />
These 4:<br />
Identifikation mit der Institution ist verbunden mit dem Maß, in dem die Institution sich zu<br />
schützen weiß gegen schwere Regelverletzungen, die das Toleranzgebot überstrapazieren.<br />
Dies kann auch notfalls bis zum administrativen Ausschluss aus der Schulgemeinde gehen.<br />
These 5:<br />
Nur durch klare Grenzsetzung wird die <strong>Schule</strong> zu einem Ort von Sicherheit und<br />
Geborgenheit, unumgängliche Attribute einer funktionierenden Gemeinschaft und einer<br />
Identifikation mit dieser.<br />
Maßnahmen zur Umsetzung der Leitlinie:<br />
• Öffentliches Lob bei Sportereignissen (z.B. Bundesjugendspielen), ebenso bei gutem<br />
Verhalten (z.B. Mitgliedschaft im Schulsanitätsdienst)<br />
• Den Eltern auch einmal positive Briefe schreiben<br />
• Gegenseitiges Benoten der SchülerInnen durch Kopfnoten<br />
• Drogen- und Gewaltdelikte sind unter allen Umständen der Schulleitung zu melden, hier<br />
darf es keinen pädagogischen Entscheidungsspielraum geben<br />
Leitlinie Leistung<br />
These 1:<br />
Unter bestimmten Begleitumständen können Konflikte sehr leistungsmindernd wirken. So<br />
sind Leistung und Lernbereitschaft sehr eng verkoppelt. Viele der heutigen SchülerInnen<br />
leiden unter Lebensumständen, die eher schädigend auf die Förderung von Lernbereitschaft<br />
wirken.<br />
These 2:<br />
Leistung und soziale Kompetenz bedingen einander, gerade wenn Leistung im Bezugsrahmen<br />
der Gruppe erbracht werden soll. Soziale Kompetenz wird erworben im pfleglichen Umgang<br />
38
mit sich selbst und den anderen. Auch hier treffen wir heute auf schwere Defizite, die ein<br />
leistungsorientiertes Miteinander erschweren.<br />
These 3:<br />
Leistungsminderung bis hin zur Leistungsverweigerung kann verstanden werden als Hinweis<br />
auf zum Teil äußerst desolate Innenlandschaften. Grundlage für Leistungsbereitschaft oder<br />
gar Leistungsfreude ist in vielen Fällen ein positives Selbstgefühl und ein Mindestmaß an<br />
Optimismus in Bezug auf die eigenen Chancen und Fähigkeiten. Vielerorts treffen wir dies<br />
heute nicht mehr oder nur sehr schwach ausgebildet an.<br />
These 4:<br />
Ein Lernraum ist ein zerbrechliches Gebilde, das Lernen und die damit einher gehende<br />
Leistungserhöhung ist ein empfindliches Geschehen. Dieses zu schützen, ohne dass dabei die<br />
Lebendigkeit und Freude Schaden nimmt, ist ein schwieriges Unterfangen. Es ist ein<br />
Balanceakt, Störungen und daraus erwachsende Konflikte von ihrem destruktiven Gehalt zu<br />
befreien und für den Lernprozess nutzbar zu machen.<br />
These 5:<br />
Im Überdenken meiner eigenen Rolle und Wirkung im leistungsmindernden Prozess gebe ich<br />
mir und den anderen eine Chance, aus leistungsmindernden leistungsfördernde Faktoren zu<br />
machen. Dabei habe ich meine momentanen persönlichen Grenzen und die Grenzen der<br />
Institution im Auge.<br />
Maßnahmen der Umsetzung der Leitlinie Leistung:<br />
• Gerade in Gruppen mit SchülerInnen, die es schwer habe, den schulischen<br />
Leistungskanon zu erfüllen, sollte die Betonung der Leistungserbringung als solcher<br />
abgemildert werden zu Gunsten einer Betonung des individuellen Lernfortschritts. Als<br />
Maßstab gilt mehr das individuelle Potenzial und weniger ein objektiver, unpersönlicher<br />
Leistungsanspruch<br />
• Die Freude am Lernen sollte durch kleinschrittiges, sehr transparent gemachtes Loben<br />
(wieder) geweckt werden, gerade bei leistungsschwachen SchülerInnen, die sich "in ihr<br />
Schneckenhaus verkrochen haben" oder ins aggressive Stören gehen<br />
• Es sollten Angebote, in denen keine Benotung bedrücken und verunsichern kann,<br />
ausgebaut werden, z.B. die Arbeitsgemeinschaften.<br />
10.1.3 Pädagogische Grundlagen<br />
Die PRS ist ein Ort, der für Kinder und Jugendliche ein breites Lehr- und Lernangebot bereit<br />
hält und ein großes soziales Spektrum abdeckt. Letzteres bedeutet, dass unsere Schülerschaft<br />
aus recht unterschiedlichen sozialen Umgebungen kommt und mit daraus resultierenden<br />
unterschiedlichen sozialen Erfahrungen. Wir sehen darin eine Chance für unsere<br />
pädagogische Arbeit.Als Gesamtschule setzen wir uns - entgegen dem aktuellen<br />
gesellschaftlichen Trend - für den Gedanken der sozialen Integration ein. Der Umgang mit<br />
Unterschieden beinhaltet für uns die Aufforderung, diese nicht noch durch ein Mehr an<br />
Trennung zu verschärfen, sondern Defizite auszugleichen.Die Organisationsform von<br />
Unterricht kann dazu einen erheblichen Beitrag leisten, z.B. durch jede Form von<br />
schulzweigübergreifendem Unterrichten, sei es in den Bläserklassen der Stufen 5/6, in Kursen<br />
des Wahlpflichtunterrichts, in Sportkursen oder in einem vielfältigen AG-Angebot. Der<br />
39
Einsatz der Lehrkräfte in allen Schulzweigen und die räumliche Zusammenlegung von<br />
Klassen gleicher Jahrgangsstufe entsprechen diesem Grundgedanken.<br />
Andererseits votieren wir für ein klares Nein gegenüber Gleichmacherei. Unser<br />
übergeordnetes Anliegen gibt uns vor, alles dafür zu tun, dass die Einzelnen ihr ganzes<br />
Potenzial entfalten können. Dazu gehört aber auch die Entwicklung von sozialer und<br />
emotionaler Kompetenz. Ein geeigneter Entwicklungsraum ist die Zusammenarbeit und das<br />
Zusammenspiel unterschiedlicher Schülerinnen und Schüler.<br />
Auch in Aktivitäten, die vom normalen Schulalltag abweichen, kann dieser Brückenschlag<br />
gefestigt werden: so z.B. bei unseren Projektwochen und Schulfesten oder bei Ereignissen wie<br />
den Sport-Shows, Theateraufführungen, Lesungen, Kunstausstellungen und vieles mehr. Hier<br />
kann sich unsere <strong>Schule</strong> als ein Ort bewähren, der ein vielfältiges kulturelles Angebot mit der<br />
Möglichkeit verbindet , Begegnungs- und Lernraum für alle zu sein.<br />
Trotz der Betonung gemeinsamer Lerngelegenheiten für unterschiedliche SchülerInnen hat<br />
der Unterricht in homogenen Lerngruppen, in denen SchülerInnen ähnlicher Leistungsniveaus<br />
zusammengefasst sind, einen bedeutenden Platz an unserer <strong>Schule</strong>. Eine Nivellierung von<br />
Leistungsunterschieden zu Ungunsten der Leistungsstarken ist nicht in unserem Sinn.<br />
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für dieses schülergerechte Lernen ist eine gute<br />
Lernatmosphäre. Wir sind uns darüber im Klaren, dass störungsfreies Lernen sich nur in<br />
einer Atmosphäre des ruhigen und förderlichen Unterrichts entwickeln kann. Daher halten wir<br />
es für notwendig, Grenzen zu setzen und auf die Einhaltung gemeinsamer Regeln zu achten.<br />
Diese Entschiedenheit soll dazu beitragen, dass die <strong>Schule</strong> für unsere Schülerschaft ein<br />
gewisses Maß an Geborgenheit und Sicherheit zur Verfügung stellt. Dies ist unseres<br />
Erachtens nach eine unumgängliche Bedingung für ein gutes Lernklima.<br />
Unser <strong>Ziel</strong> ist die Entwicklung einer demokratischen Schulkultur. Dafür nimmt unsere <strong>Schule</strong><br />
seit 2003 an dem BLK-Projekt „Demokratie lernen und leben“ mit dem hessischen<br />
Schwerpunkt „Mediation und Partizipation“ teil. In einzelnen Bausteinen werden<br />
SchülerInnen und LehrerInnen für eine konstruktive Konfliktbearbeitung qualifiziert. (s.<br />
Vorhaben 2)<br />
Für das Nacharbeiten von Konfliktsituationen stehen an unserer <strong>Schule</strong> speziell geschulte<br />
KollegInnen bereit, die mit Hilfe von Mediationsverfahren den Konfliktparteien dabei helfen<br />
selber Lösungen zu entwickeln. Die Unparteilichkeit der MediatorInnen sorgt dafür, dass sich<br />
beide Konfliktparteien„gesehen fühlen“. ( zum positiven Konfliktbegriff s. auch das Kapitel<br />
10.1.2)<br />
Neben der Geborgenheit genießt an unserer <strong>Schule</strong> die Partizipation einen hohen Stellenwert.<br />
Damit ist gemeint, dass wir es für wichtig und lohnend erachten, wenn in und außerhalb des<br />
Unterrichts unsere Schülerinnen und Schüler teilhaben an möglichst vielen Entscheidungen<br />
und Prozessen, die ihr schulisches Leben betreffen. Sei es die Planung und Gestaltung des<br />
Unterrichts, sei es die Arbeit der Schülervertretung oder die Mitgestaltung anderer<br />
Aktivitäten. In jedem Fall möchten wir nicht „an den SchülerInnen vorbei“ arbeiten, sondern<br />
diese möglichst umfangreich mit einbeziehen. Wir fühlen uns dabei der demokratischen Idee<br />
verpflichtet, dass die <strong>Schule</strong> im wesentlichen für die SchülerInnen da ist und deren<br />
erfolgreiches Lernen. Unsere Rolle als Erwachsene und Lehrkräfte sehen wir dabei nicht im<br />
Widerspruch zu dem Selbst- und Mitbestimmungsrecht der SchülerInnen. Wir verstehen uns<br />
als Wegbereiter und „Begünstiger“ der Lernbewegungen der Kinder, Jugendlichen und<br />
jungen Erwachsenen an unserer <strong>Schule</strong>.<br />
40
Partizipation gilt auch für das Verhältnis von Schulleitung und Kollegium. Damit meinen wir<br />
nicht ein Einebnen notwendiger hierarchischer Strukturen, aber Entscheidungsfindungen auf<br />
der Basis von Kollegialität und Transparenz. Ein Beispiel hierfür ist die kollegiale Leitung der<br />
Gesamtkonferenzen. Ebenso definiert sich für uns im Rahmen der <strong>Schule</strong>ntwicklung die Rolle<br />
der Schulleitung als anregender Ideengeber einerseits und Bewahrer angemessener und<br />
attraktiver Arbeitsbedingungen andererseits. In einer kooperativen Gesamtschule von der<br />
Größe der PRS ist Kooperation der Schulleitung unabdingbar. Zweigleiter,<br />
Aufgabenfeldleiter, pädagogisches Team und Schulleiter arbeiten vertrauensvoll miteinander.<br />
Wichtige Entscheidungen werden in den wöchentlich stattfindenden<br />
Schulleitungskonferenzen getroffen.<br />
Auch die Hausmeister, Sekretärinnen und die Bibliothekarin werden durch regelmäßige<br />
Informationen in die Kooperation mit einbezogen.<br />
Auf freiwilliger Basis arbeiten LehrerInnen verstärkt zusammen in klassen- und<br />
zweigübergreifenden Teams, wobei möglichst viele LehrerInnen Unterrichtserfahrung auch<br />
außerhalb ihres „normalen Schulzweiges“ sammeln. In den letzten Jahren konnte der<br />
Unterricht im Team ausgebaut werden (vgl. Kapitel 9). Wir bedauern, dass kooperative<br />
Unterrichtsformen und zweigübergreifendes Arbeiten zunehmend durch äußere Hindernisse<br />
wie divergierende Stoffpläne und die absehbare Schulzeitverkürzung im Gymnasialzweig<br />
erschwert werden<br />
In der Frage der Unterrichtsmethodik kennzeichnen unsere <strong>Schule</strong> Aufgeschlossenheit<br />
gegenüber pädagogischen und fachdidaktischen Neuerungen und fächerübergreifendes<br />
Denken (vgl. hierzu auch das Kapitel 10.1). Dem <strong>Ziel</strong>, mehr Selbständigkeit und<br />
Selbstverantwortung bei den SchülerInnen zu wecken dienen mehrere pädagogische Ansätze,<br />
wie z.B. „Lernen lernen“ , die Kulturwerkstatt u.a.<br />
Ein Ganztagsschulkonzept mit Pflichtunterricht am Vormittag und am Nachmittag wird es<br />
uns erlauben, die oben genannten <strong>Ziel</strong>setzungen besser zu verwirklichen. Noch fehlen an der<br />
PRS ein organisatorischer Rahmen und die notwendigen baulichen Voraussetzungen.<br />
10.1.4 Neubau<br />
Der innerhalb der nächsten Jahre zu erwartende Neubau der PRS muss bereits in der<br />
Konzeption so angelegt sein, dass die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um<br />
die mittel- und längerfristigen Entwicklungsschritte der PRS zu unterstützen und nicht durch<br />
bauliche Gegebenheiten einzuschränken.<br />
Die Situation am derzeitigen Standort hat dies im Schuljahr 2003-2004 deutlich aufgezeigt:<br />
Das in der Jahrgangstufe 7 (Team7) neu eingeführte Unterrichtsmodell eines entzerrten<br />
Unterrichts mit Einbezug von Hausaufgabenbetreuung und Teilnahmemöglichkeit an AGs hat<br />
sich aufgrund baulicher und personeller Grenzen nur mit großen Schwierigkeiten umsetzen<br />
lassen. Ein für dieses Projekt dringend notwendiger Ausbau des Cafeteria- und<br />
Schüleraufenthaltsbereichs, ließ sich aus Kostengründen nicht realisieren. Die<br />
Weiterentwicklung der Ganztagesangebote stößt am bisherigen Standort auf sehr enge<br />
Grenzen. Aus dieser und weiteren Erfahrungen ergeben sich für die Planung des Neubaus<br />
Vorgaben, die aus unseren pädagogischen Schwerpunktsetzungen und dementsprechend in<br />
die Planung einbezogen werden müssen:<br />
• Ausbau der Ganztagesbetreuung:<br />
o ausreichend Möglichkeiten für die Verpflegung der SchülerInnen<br />
o Schüleraufenthaltsbereiche für Zeiten außerhalb der Unterrichtszeit mit<br />
unterschiedlicher Nutzung (Arbeitsräume, Freizeiträume, Sportflächen)<br />
41
o Lehrerarbeitsplätze außerhalb der Lehrerzimmer<br />
• Ausbau der Teambildung<br />
o kleinere abgeschlossene Einheiten<br />
o Lehrerteamstützpunkte in den Bereichen der Sekundarstufe I<br />
• eigenverantwortliches Lernen<br />
o Bibliothek und Medienzentrum mit ausreichender Anzahl von<br />
Schülerarbeitsplätzen<br />
o Möblierung und ausreichend Raum für unterschiedliche Arbeitsformen<br />
o EDV-Arbeitsplätze in allen Klassenräumen<br />
• Motivation für musische Fächer<br />
o Arbeitsplätze für die Kulturwerkstatt, auch nutzbar außerhalb der<br />
Unterrichtszeit<br />
o Probenräume für Musikklassen und die Musikschule (auch für Schülerbands<br />
etc.)<br />
o Probenraum und ausreichend dimensionierte Aufführungsstätte für den<br />
Bereich Darstellendes Spiel<br />
42
10.2 Vorhaben im Prozess der Umsetzung<br />
10.2.1 Vorhaben 1: Teambildung<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Identifikation<br />
<strong>Ziel</strong>: Förderung von Teambildung<br />
Maßnahmen:<br />
1. Einrichtung von mindestens einem neuen Team pro Schuljahr<br />
2. Prioritätensetzung bei Unterrichtsverteilung und Ausstattung mit Ressourcen<br />
3. Information des Kollegiums über Vorteile und Belastungen der Teamarbeit<br />
4. Kontaktaufnahme mit anderen <strong>Schule</strong>n, die Erfahrung mit Teamarbeit haben<br />
5. Erarbeiten eines Gesamtkonzeptes der Teambildung<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1:<br />
zu 2:<br />
zu 3+4:<br />
zu 5:<br />
Zweigleiter<br />
Schulleitungskonferenz, Haushaltsausschuss<br />
Pädagogisches Team + Schulleitung<br />
neu zu bildende Steuergruppe, Schulleiter<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1+2:<br />
zu 3 +4:<br />
zu 5:<br />
Bericht der Schulleitung, Stundenplan<br />
Bericht auf der Gesamtkonferenz, Teambildung ist Tagesordnung<br />
mindestens einer Gesamtkonferenz, Einladung von externen Experten<br />
Bericht auf der Gesamtkonferenz und der Schulkonferenz,<br />
Einbindung des Konzepts der Teambildung in das pädagogische Konzept<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
jeweils jährlich in den angegebenen Gremien<br />
43
10.2.2 Vorhaben 2: Konflikte demokratisch lösen<br />
Zugeordneter Leitsatz: Verantwortung und Identifikation<br />
<strong>Ziel</strong>: Konstruktive Konfliktkultur in einer demokratischen<br />
<strong>Schule</strong><br />
Bundesweit BLK: „Demokratie lernen und leben“<br />
Hessisches Projekt: „Mediation und Partizipation“<br />
18 <strong>Schule</strong>n: 6 <strong>Schule</strong>n Sek I, 6 Grundschulen, 6 Berufsschulen<br />
Fachberatung<br />
Beratung bei Einzelbausteinen<br />
Ich und mein Körper Kl.7 / 8<br />
SV-Training<br />
Fortbildung, Training<br />
Evaluation<br />
SLK<br />
PSG<br />
SV<br />
SEB<br />
Kennenlernen<br />
Kl.5<br />
Eingangsprogramm<br />
Konstruktive<br />
Konfliktkultur Kl.5 / 6<br />
Kollegiale Beratung<br />
Kooperation und<br />
Ich-Stärkung Kl.6<br />
Arbeitsgruppe Mediation<br />
Legende:<br />
- PSG = Projektsteuergruppe<br />
- SLK = Schulleitungskonferenz<br />
- SV = Schülervertretung<br />
- SEB = <strong>Schule</strong>lternbeirat<br />
44
Maßnahmen zur Entwicklung, Erprobung und Durchführung der Bausteine –<br />
<strong>Ziel</strong>gruppen:<br />
Eingangsprogramm Konstruktive Konfliktkultur Kl. 5/6:<br />
Gestufte Einführung: Fortsetzung der Erprobung in einer Klasse 6F und 6G (Schj. 03/04),<br />
zweiter Durchgang in 5 Klassen 5/6 (Schuljahr 03/4 und 04/05), Durchführung in allen<br />
Klassen 5/6 (Beginn: Schuljahr 04/05 und 05/06)<br />
Einführung einer Klassenratstunde<br />
Zeitrahmen: je 3 Projekttage im Verlauf des Schuljahres Kl. 5 und 6, zusätzlich<br />
Klassenratstunde<br />
Verantwortlich: LehrerInnen aus dem Mediationspool Kl. 5/6 und KlassenlehrerInnen<br />
Kennenlernen Kl. 5:<br />
Fortsetzung des angepassten Programms<br />
Verantwortlich: KlassenlehrerInnen<br />
Zeitrahmen: 3 Tage (inkl. Tag der Einschulung)<br />
Kooperation und Ich-Stärkung Kl. 6:<br />
Fortsetzung des weiterentwickelten Programms<br />
Verantwortlich: Stadt Friedrichsdorf i.V.m. KlassenlehrerInnen<br />
Zeitrahmen: 3 zusammenhängende Projekttage<br />
Ich und mein Körper Kl. 7/8:<br />
Gestufte Einführung: Beginn mit der Erprobung in einer Klasse 7R und 8H (Schuljahr 03/04)<br />
Geplant: Verzahnung mit dem Unterricht (Sport, Biologie, Kunst, PoWi, Religion/Ethik);<br />
Erweiterung des Programms um partizipative Elemente (Demokratietraining)<br />
Verantwortlich: LehrerInnen aus dem Mediationspool Kl. 7/8 und KlassenlehrerInnen (1.<br />
und 3. Projekttag), Pro Familia bzw. Jugendberatung und Suchthilfe i.V.m.<br />
KlassenlehrerInnen (2. Projekttag)<br />
Zeitrahmen: 3 zusammenhängende Projekttage in Kl. 7 und 8<br />
SV-Training:<br />
Beginn der Erprobung: Pädagogischer Tag der PRS 2004<br />
Verantwortlich: Verbindungslehrerin und Verbindungslehrer mit entsprechender Fortbildung<br />
Zeitrahmen: 3-4 Projekttage pro Schuljahr<br />
Kollegiale Beratung:<br />
Beginn der Erprobung: Schuljahr 2004/05<br />
Verantwortlich: Fortgebildete KollegInnen der Arbeitsgruppe Mediation<br />
Maßnahmen - Fortbildung und Beratung von LehrerInnen:<br />
Basistraining und Aufbautraining für weitere KollegInnen<br />
Weitere spezielle Fortbildungen (extern und intern) von KollegInnen für die einzelnen<br />
Bausteine<br />
Beratung bei der Entwicklung, Erprobung und Verzahnung der Bausteine<br />
45
Kooperationspartner:<br />
Hessisches BLK-Projekt „Mediation und Partizipation“: HELP<br />
Institut für interkulturelle Mediation und Konfliktbearbeitung<br />
Stadt Friedrichsdorf<br />
Jugendberatung und Suchthilfe HTK<br />
Pro Familia Friedrichsdorf<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
Externe Evaluation: Durchführung einer Wirkungsevaluation für das Gesamtprogramm durch<br />
das DIPF<br />
Schulinterne Evaluation: Kontinuierliche Begleitung des Prozesses durch die<br />
Projektsteuergruppe mit externer Beratung (Dr. Lukas Wahab)<br />
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Einzelbausteine auf der Grundlage von<br />
Beobachtungen der Durchführenden und Rückmeldungen der Teilnehmenden sowie externer<br />
Beratung (z.Zt. Renate Britz, Regine Lindner)<br />
Verantwortliche:<br />
Für das Gesamtprogramm: Frau von Oettingen und Frau Fiedler i.V.m. der<br />
Projektsteuergruppe<br />
Für die Einzelbausteine: die jeweils Beauftragten (z.Zt.: Klassenprogramme 5/6: Frau<br />
Werneken-Carlton; Klassenprogramme 7/8: Frau Fiedler und Herr Steinke; SV-Training: Frau<br />
von Oettingen; Kollegiale Beratung: Frau Jost-von Hayn)<br />
In der Schulleitung: Herr Schmidt für die Klassenprogramme 5/6; Frau Creutz für die<br />
Klassenprogramme 7/8 und schulzweigübergreifende Aspekte; Frau Schilling für das<br />
Gesamtprogramm<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
Externe Evaluation / DIPF: 2006<br />
Schulinterne Evaluation: am Ende jedes Schuljahres<br />
46
10.2.3 Vorhaben 3: Lernen lernen<br />
Zugeordneter Leitsatz: Leistung<br />
<strong>Ziel</strong>: Systematische Einführung in alle methodischen Aspekte des<br />
Lernens, Ausbau der Bausteine „Lernen lernen“ für die<br />
Sekundarstufe I<br />
Diese Aspekte sind:<br />
1. Grundlagen des Lernens (z.B. Lerntypen, Gedächtnis)<br />
2. Unterrichtsbezogene Arbeits- und Lernformen (z.B. Gruppenarbeit, Referate,<br />
Rollenspiele)<br />
3. Elementare Lern- und Arbeitstechniken (z.B. Markieren, Strukturieren, Nachschlagen)<br />
4. Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit (Argumentieren, Vortragen, Feedback)<br />
Maßnahmen:<br />
1. Erarbeitung von Bausteinen für die Klassen 6, 8, 10<br />
2. Dokumentation in den schon angelegten Ordnern „Lernen lernen“<br />
3. Umsetzung der Planung durch Einbettung in den Fachunterricht gemäß des<br />
Gesamtkonzeptes Lernen lernen.<br />
4. kontinuierliche Vermittlung der Themen und <strong>Ziel</strong>setzungen an die Eltern<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1+2:<br />
zu 2:<br />
zu 3:<br />
zu 4:<br />
Frau Bögel und Arbeitsgruppe Lernen lernen<br />
Zweigleiter<br />
Zweigleiter, KlassenlehrerInnen und FachlehrerInnen<br />
laut Konzept für „Lernen lernen“<br />
Schulleitung, Zweigleiter (Elterninfo), Bericht über die Elternarbeit<br />
von Frau Bögel in der Arbeitsgruppe Lernen lernen<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1+2+3:<br />
zu 3:<br />
zu 4:<br />
Beschluss der Jahrgangskonferenzen zu Beginn jedes Schuljahres<br />
Rückmeldung der KollegInnen in den Ordnern „lernen lernen“<br />
Bericht auf der Sitzung der Arbeitsgruppe Lernen lernen<br />
Elterninfo, Informationsbroschüre PRS, Elternabende zur Vorstellung der PRS<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1+2: Ende 2. Halbjahr 2004/2005<br />
zu 3: jährlich zu Beginn des Schuljahres<br />
zu 4: Ende 2. Halbjahr 2004/2005<br />
47
10.2.4 Vorhaben 4: Umgang mit dem Schulgebäude<br />
Zugeordneter Leitsatz: Identifikation und Verantwortung<br />
<strong>Ziel</strong>: Pfleglicher Umgang mit dem Raum <strong>Schule</strong>;<br />
Verschönerung der Schulhöfe, Gänge, Klassenräume,<br />
Konsequente Einhaltung des Sauberkeitskonzeptes<br />
Maßnahmen:<br />
1. Ergänzung der Hausordnung durch Regelungen zur Verbesserung der Sauberkeit<br />
2. Erstellung von Sauberkeits- und Reinigungskonzepten in den Klassen zu Beginn eines<br />
Schuljahres (werden in den Klassenräumen ausgehängt und ein Exemplar beim<br />
Zweigleiter abgegeben)<br />
3. Mitwirkung der Klassen und Kurse beim Reinigen der Flure und des Außenbereichs der<br />
<strong>Schule</strong> (Organisation durch den Zweigleiter)<br />
4. getrennte Müllsammlung (in den Kassen nur noch Papier, in den Fluren<br />
Verpackungen und Restmüll)<br />
5. Ausstattung aller Räume mit Besen, Kehrschaufel und Handfeger<br />
Verantwortliche:<br />
Schulleitung, Zweigleiter, KlassenlehrerInnen<br />
Überprüfung der Maßnahmen und Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
1. laufend: KlassenlehrerInnen (Einhaltung des Sauberkeitskonzeptes in den Klassen)<br />
2. gelegentlich: Begehung der <strong>Schule</strong> durch Mitglieder der Schulleitung<br />
3. jährlich: Abgabe der Sauberkeitskonzepte der Klassen zu Beginn des Schuljahres<br />
48
10.2.5 Vorhaben 5: Vielfalt der Kulturen stärken<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Vielfalt<br />
<strong>Ziel</strong>: Vielfalt der Kulturen in der Schulgemeinde stärken<br />
Maßnahmen:<br />
1. Einrichtung eines „Kulturerzählcafés“<br />
2. Erarbeitung eines neuen Konzepts für ein fächerübergreifendes Projekt in den Klasse 10<br />
mit dem Thema „Identität, Geschichte und Selbstverständnis in Deutschland“<br />
3. Sammlung von Ansätzen zum Unterrichtsschwerpunkt Migration<br />
4. Aufbau von außerschulischen Kontakten zur interkulturellen Bildung<br />
5. Thematisierung von Festtagen des interkulturellen Kalenders in den Klassen 5 und 6<br />
6. Thematisierung von Festtagen des interkulturellen Kalenders in der Schulgemeinde<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1:<br />
zu 2:<br />
zu 3:<br />
zu 4:<br />
zu 5:<br />
zu 6:<br />
Herr Schauer, Aufgabenfeldkonferenz AF II, Herr Ulmschneider<br />
Herr Schauer<br />
Aufgabenfeldkonferenz AF II, Herr Ulmschneider<br />
Herr Ulmschneider<br />
Herr Schauer, Herr Schmidt<br />
Arbeitsgruppe Interkultureller Kalender zusammen mit SEB, SV<br />
und KollegInnen für muttersprachlichen Unterricht<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1:<br />
zu 2:<br />
zu 3:<br />
zu 4:<br />
Bericht auf der Aufgabenfeldkonferenz, Veröffentlichung in Presse und<br />
Elterninfo<br />
Evaluation nach Durchführung des Projektes<br />
Einrichtung eines Ordners in der Bibliothek<br />
Bericht über Kontakte und Besuche bei außerschulischen Institutionen,<br />
Protokoll der Aufgabenfeldkonferenz AF II<br />
zu 5: Klassenkonferenzen der Klassen 5 und 6<br />
zu 6: Bericht im Elterninfo und auf der Gesamtkonferenz, Schulkonferenz<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1+6: jährlich am Ende des Schuljahres<br />
zu 2: jährlich im Laufe des 2. Halbjahres<br />
zu 3+4: jährlich bei der Aufgabenfeldkonferenz AF II<br />
zu 5: bis 2. Halbjahr 2004/2005<br />
49
10.2.6 Vorhaben 6: Wahlmöglichkeiten bieten<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Vielfalt<br />
<strong>Ziel</strong>: Wahlmöglichkeiten für SchülerInnen bieten<br />
Maßnahmen:<br />
1. Angebot von Arbeitsgemeinschaften und Themen für Projektwochen verbessern<br />
2. Mitwirkung von Eltern bei Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen durch Information<br />
und Werbung ausweiten<br />
Verantwortliche:<br />
SEB in Zusammenarbeit mit Herrn Karner (mit Schulleitung und päd. Team)<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1+2:<br />
AG-Angebot und Themen der Projektwoche<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1:<br />
zu 2:<br />
AGs jährlich<br />
Themen der Projektwoche nach Durchführung<br />
50
10.2.7 Vorhaben 7: Eigenverantwortlicher Unterricht<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Leistung<br />
<strong>Ziel</strong>: Die SchülerInnen sollen zunehmend eigenverantwortlich<br />
arbeiten und lernen, für den Unterricht sollen verstärkt<br />
eigenverantwortliche Unterrichtsformen entwickelt werden.<br />
Maßnahmen:<br />
1. Einrichtung einer Kulturwerkstatt (Angebote zur künstlerischen und musikalischen<br />
Arbeit, Computerangebote, Betreuung beim Schreiben von Referate und beim Umgang<br />
mit Texten etc.)<br />
2. Feststellung, Begleitung und Evaluation methodischer Fertigkeiten der SchülerInnen (vor<br />
allem AF II)<br />
3. Komplettierung der Materialsammlungen im AF III (Ordner für Experimentalunterricht,<br />
Stationenlernen und Freiarbeit)<br />
4. Anschaffung von Unterrichts- und Versuchsmaterialien, Komplettierung der<br />
Fachressourcen (AF I und AF III)<br />
5. Verbindliche Absprachen auf den Fachkonferenzen zur Nutzung der Ordner und<br />
Materialsammlungen bzw. Einplanen von mind. einem Unterrichtsprojekt pro Schuljahr<br />
zur Einübung eigenverantwortlichen Arbeitens<br />
6. Externe Beratung im Bereich Fremdsprachen zur Umsetzung der neuen Lehrpläne<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1: Herr Meier, Herr Dr. Schnöbel, Herr Schauer, Herr Steinke,<br />
zusammen mit Herrn Schwarz<br />
zu 2: Herr Schauer, Herr Steinke<br />
zu 3+ 4: Fachsprecher AF I, II und III<br />
zu 5: Fachkonferenzen in Zusammenarbeit mit der Schulleitung<br />
zu 6: Frau Schilling<br />
Überprüfung der Maßnahmen<br />
zu 1: Bericht auf der Gesamtkonferenz<br />
zu 2: Bericht in der Aufgabenfeldkonferenz AF II, Erhebung durch Fragebogen<br />
zu 3+4: Bericht auf den Fachkonferenzen und Fachbereichskonferenzen<br />
zu 5: Komplettierung der Sammlungen, Protokolle der Fachkonferenzen<br />
zu 6: Durchführung von Informationsveranstaltungen, Bericht auf der<br />
Aufgabenfeldkonferenz AF I<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1: 1. Halbjahr 2004/2005<br />
zu 2+3+ 4: 2. Halbjahr 2004/2005<br />
zu 5: regelmäßiger Tagesordnungspunkt auf den Fachkonferenzen<br />
zu 6: bis Ende Schuljahr 2004/2005<br />
51
10.2.8 Vorhaben 8: Motivation für musische Fächer<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Identifikation<br />
<strong>Ziel</strong>: Motivation für musische Fächer stärken<br />
Förderung von musisch begabten SchülerInnen<br />
Maßnahmen:<br />
1. Einrichtung eines Förderpreises<br />
2. Ausbau der Musikensembles<br />
3. Veranstaltungen von Workshops mit Musikern, Künstlern, Schauspielern, Autoren<br />
4. Theaterpädagogische Angebote in allen Jahrgangsstufen<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1:<br />
zu 2+3+4:<br />
Förderpreis: Förderverein in Zusammenarbeit mit Fachbereichen Kunst/Musik<br />
Frau Käberich, Herr Hollenstein, Herr Meier<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1:<br />
zu 2+3+4:<br />
Einrichtung des Förderpreises<br />
Dokumentation der Angebote (z.B. im Internet)<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
Jährliche Evaluation in den Fachkonferenzen<br />
52
10.3 Neue Arbeitsvorhaben<br />
10.3.1 Vorhaben 9: Steuergruppe<br />
zugeordneter Leitsatz: Vielfalt, Verantwortung<br />
<strong>Ziel</strong>e: stärkere Koordination des <strong>Schule</strong>ntwicklungsprozesses<br />
Einbindung aller Verantwortlichen für Projekte<br />
und Teams in Entscheidungen<br />
Maßnahmen:<br />
1. Klärung der Rahmenvoraussetzungen<br />
a) rechtlicher Rahmen,<br />
b) organisatorischer Rahmen , Klärung von Aufgabenbereichen, Zuständigkeiten<br />
c) Zusammensetzung der Gruppe<br />
2. Diskussion und Beschluss der Maßnahme in der Schulleitungskonferenz,<br />
Gesamtkonferenz, Schulkonferenz<br />
3. Wahl der Mitglieder der Steuergruppe<br />
4. Verankerung der Steuergruppe im Organisationsaufbau der PRS<br />
Verantwortliche:<br />
Schulleitungskonferenz<br />
Art der Überprüfung:<br />
zu 1+2:<br />
zu 3+4:<br />
Bericht und Beschluss auf der Schulleitungskonferenz, Gesamtkonferenz<br />
und der Schulkonferenz<br />
Verankerung der Steuergruppe im Geschäftsverteilungsplan<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1+2: Ende Halbjahr 2004/2005<br />
zu 3+4: Schuljahrsbeginn 2005/2006<br />
53
10.3.2 Vorhaben 10: Ganztageskonzeption<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Vielfalt:<br />
Ein Ganztagskonzept kann den unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen der<br />
SchülerInnen durch ein Nachmittagsangebot gerecht werden. Dabei ist besonders das AG-<br />
Angebot dazu geeignet, die individuellen Interessen und Talente zu fördern.<br />
Leistung:<br />
Ein Angebot von Förderkursen für leistungsschwache und leistungsstarke SchülerInnen<br />
ermöglicht eine bessere schulische Leistung. Eine besondere Bedeutung kommt der<br />
Hausaufgabenbetreuung zu.<br />
Verantwortung:<br />
Eigenverantwortliches Arbeiten kann durch freiwillige Nachmittagsangebote in Form von<br />
Projekten in den Bereichen Computer, Sprachen, Kunst, Musik und Theater gestärkt werden.<br />
Identifikation:<br />
In einem Ganztagskonzept erleben SchülerInnen ihre <strong>Schule</strong> nicht nur als Ort des Lernens,<br />
sondern in unterschiedlichen Erfahrungsbereichen, z. B. bei Spiel- und Sportangeboten, in<br />
Projektarbeit und gemeinsamen Unternehmungen. Die erweiterte Lern- und Betreuungszeit<br />
fördert das soziale Zusammenleben und die Toleranz.<br />
<strong>Ziel</strong>:<br />
Ein erneuter Antrag zur Erweiterung der Pädagogischen Mittagsbetreuung auf 2 1/2<br />
Lehrerstellen bzw. Geldmittel soll an das Kultusministerium am 1.10.2004 gestellt werden.<br />
Die <strong>Ziel</strong>gruppe sind die SchülerInnen der Klassen 5 im Schuljahr 2005/2006, für die das<br />
Ganztagskonzept zunächst ausgestaltet werden soll. Aufbauend auf der bereits bestehenden<br />
Hausaufgabenbetreuung und dem Arbeitsgemeinschaftenangebot sollen folgende Projekte<br />
realisiert werden.<br />
1. ein verlässliches Schulangebot bis ca. 16.00 Uhr, in der die Kinder Hausaufgaben machen,<br />
Förderung erhalten und Spiel- und Freizeitangebote nutzen können (incl.<br />
Mittagsverpflegung).<br />
2. Einrichtung von Förderkursen z.B. im Fach Deutsch, in denen auf individuelle Schwächen<br />
und Stärken eingegangen werden kann.<br />
3. Erweiterung der Hausaufgabenbetreuung von 2 auf 4 Tage.<br />
4. Einrichtung einer Kulturwerkstatt mit der Möglichkeit von eigenverantwortlichem<br />
Arbeiten.<br />
5. Erweiterung des AG-Angebotes<br />
Bewegungsförderung, Naturwissenschaften, PC-Führerschein<br />
Für die Planung, Organisation und Leitung dieser Ganztagsangebote soll ein<br />
„Ganztagskoordinator“ durch 4 Lehrstunden aus dem vom Kultusministerium bereitgestellten<br />
Stundenkontingent entlastet werden.<br />
54
Maßnahmen:<br />
Die Entwicklung dieses Ganztagsschulmodells ist derzeit von folgenden Bedingungen<br />
abhängig:<br />
1. mehr Lehrerstellen<br />
2. Mittagsverpflegung (In Zusammenarbeit mit dem Betrieb „Cook and Chill“ soll ein<br />
Konzept erarbeitet werden.)<br />
Verantwortliche:<br />
Herr Karner , Frau Hedderich-Cöster und Frau Heinzelmann<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
Rechenschaftsbericht des Ausschusses Ganztagsschule vor der Gesamtkonferenz<br />
letzte Gesamtkonferenz im Schuljahr 2004/05<br />
55
10.3.3 Vorhaben 11: Spanisch in der Realschule<br />
Zugeordneter Leitsatz: Vielfalt, Leistung<br />
<strong>Ziel</strong>e: Verstärkung eines eigenständigen Profils des<br />
Realschulzweiges, Angebot einer zweiten Fremdsprache<br />
für RealschülerInnen, um einen erfolgreichen Übergang in<br />
die gymnasiale Oberstufe und das Berufsleben zu<br />
erleichtern<br />
Maßnahmen:<br />
1. Klärung der Rahmenvoraussetzungen<br />
a) rechtlicher Rahmen (SSA – Abgrenzung zum gymnasialen Zweig<br />
b) Bedarfsanalyse ( Umfrage bei den SchülerInnen und Eltern)<br />
c) sächliche und personelle Ressourcen (Lehrerversorgung, geeignete Lehrwerke)<br />
2. Diskussion und Beschluss der Maßnahme in der Schulleitungskonferenz,<br />
Gesamtkonferenz, Schulkonferenz<br />
3. Verankerung von Spanisch als zweiter Fremdsprache im Realschulzweig, Information der<br />
SchülerInnen und der Eltern, Erarbeitung des Stoffverteilungsplans Spanisch<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1:<br />
zu 2+3:<br />
Frau Creutz, Frau Schilling, Schulleitungskonferenz, Fachkonferenz Spanisch<br />
Frau Creutz, Schulleitungskonferenz<br />
Art der Überprüfung:<br />
Bericht und Beschluss auf der Gesamtkonferenz und der Schulkonferenz<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1+2: Ende Schuljahr 2004/2005<br />
zu 3: Ende 1. Halbjahr 2005/2006, Beginn des Unterrichts Spanisch als<br />
2. Fremdsprache im Realschulzweig zum Schuljahrsbeginn 2006/2007<br />
56
10.3.4 Vorhaben 12: Konzept für Schulschwänzer<br />
Zugeordnete Leitsätze:<br />
Verantwortung und Identifikation<br />
<strong>Ziel</strong>: „Schulschwänzen“ minimieren – den Anfängen wehren<br />
und vorbeugen durch verstärkten praktischen Unterricht in<br />
der Klasse 7 H<br />
Maßnahmen:<br />
1. Abarbeiten des Maßnahmenkatalogs mit Hilfestellung durch Soziale Dienste bis hin<br />
zum Bußgeldverfahren<br />
2. Zwei Hauptschulklassen werden im Wahlpflichtunterricht in drei Lerngruppen aufgeteilt.<br />
Die Schüler können sich in folgende Gruppen einwählen: Einführung in die Arbeit mit<br />
dem PC/ Arbeiten mit Holz oder Stoff/ Kochen und Backen.<br />
Die Einwahl ist jeweils verpflichten für 1/3 Schuljahr.<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1+ 2:<br />
KlassenlehrerInnen, Frau Creutz als Zweigleiterin zur Kontrolle<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1:<br />
Zahl der eingeleitenden Bußgeldverfahren<br />
Evaluation der Handhabung des Maßnahmenkatalogs<br />
zu 2: Vergleich der Zahlen der „Schulschwänzer“ von alter und neuer 7H,<br />
insbesondere bei den Wiederholern<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1: jeweils am Endes des Schulhalbjahres<br />
zu 2: Ende Schuljahr 2004/2005<br />
57
10.3.5 Vorhaben 13 Förderung von Deutsch als Zweitsprache<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Leistung<br />
<strong>Ziel</strong>: Förderung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund<br />
und noch nicht ausreichenden Deutschkenntnissen<br />
Maßnahmen:<br />
1. Erarbeitung eines Konzeptes zur Förderung leistungsschwacher SchülerInnen im<br />
Fachunterricht<br />
2. Erarbeitung eines Curriculums für das Fach „Deutsch als Zweitsprache“,<br />
Kontaktaufnahme mit anderen <strong>Schule</strong>n und außerschulischen Institutionen (HeLP,<br />
Universität Frankfurt, SSA, HKM)<br />
3. Fortbildung oder Einstellung eines Kollegen, einer Kollegin für das Unterrichtsfach DAZ<br />
4. Ausstattung eines für Förderunterricht geeigneten Raumes<br />
5. Anschaffung und Installation von geeigneten Lernprogrammen für Fördermaßnahmen im<br />
Fach Deutsch und anderen Fächern.<br />
6. Feste Bezugspersonen einrichten für einzelnen Niveaustufen<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1:<br />
zu 2:<br />
zu 3:<br />
zu 4:<br />
zu 5:<br />
zu 6:<br />
Fachsprecher (1.+2. FS, DEU, MAT)<br />
in Zusammenarbeit mit Herrn Schmidt, Herrn Müller<br />
Fachkonferenz Deutsch, Herr Dr. Schnöbel<br />
Schulleitung, Herr Karner<br />
Herr Müller in Zusammenarbeit mit Herrn Karner, IT-Team<br />
Herr Dr. Schnöbel, IT-Team<br />
Fachkonferenz Deutsch, SLK<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1:<br />
zu 2+6:<br />
zu 3+4:<br />
zu 5:<br />
Vorlage eines Konzeptes an die Schulleitungskonferenz<br />
Vorlage eines Curriculums bzw. Bericht über die unternommen Schritte<br />
Bericht der Schulleitung auf der Gesamtkonferenz<br />
Bericht der KollegInnen, die Förderunterricht erteilen, an die Schulleitung<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
zu 1+2+5+6: Ende Schuljahr 2004/2005<br />
zu 3+4: 1. Halbjahr 2004/2005<br />
58
10.3.6 Vorhaben 14: Förderung leistungsschwacher<br />
SchülerInnen<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Leistung<br />
<strong>Ziel</strong>: Aufarbeiten von Lücken in Deutsch, Englisch, Mathematik<br />
aus vorangegangenen Schuljahren in 7H, Vermeiden von<br />
Wiederholen von Schuljahren, Erlangen des<br />
Hauptschulabschlusses an der PRS<br />
Maßnahmen:<br />
1. Der FachlehrerInnen für Deu, ENG, Mat stellt Lücken bei einzelnen SchülerInnen fest<br />
2. Es werden Stunden ( aus der Nachmittagsbetreuung, 3. Sportstunde oder Ethik) von den<br />
FachlehrerInnen aus den Klassen genutzt ( eine Stunde pro Woche und Fach), um<br />
fehlendes Wissen in Kleingruppen aufzuarbeiten und um den Anschluss an die Klasse<br />
herzustellen.<br />
3. Wenn der Schüler, die Schülerin den Anschluss an das Niveau der Klasse erreicht hat,<br />
nach Feststellung des unterrichtenden Lehrers, der unterrichtenden Lehrerin entfällt für<br />
den Schüler, die Schülerin der Zusatzunterricht.<br />
Verantwortliche:<br />
Frau Creutz<br />
Überprüfung der Maßnahmen:<br />
zu 1+2:<br />
zu 3:<br />
Frequenz der Nutzung des Zusatzunterrichts erfassen,<br />
Effektivität durch veränderte Leistung überprüfen<br />
Gründe, warum SchülerInnen der Klasse 7 trotzdem wiederholen müssen,<br />
abfragen<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
jedes Halbjahr<br />
59
10.3.7 Vorhaben 15: Erarbeitung einer Schulvereinbarung<br />
Zugeordneter Leitsatz:<br />
Verantwortung<br />
<strong>Ziel</strong>: Übernahme von Verantwortung für das soziale<br />
Miteinander an der <strong>Schule</strong><br />
Maßnahmen:<br />
1. Formulierung einer Schulvereinbarung in drei unterschiedlichen Ausführungen ( für<br />
SchülerInnen der Klasse 5, 8 und 11)<br />
2. Verabschiedung der Schulvereinbarung durch SV, SEB, Gesamtkonferenz und<br />
Schulkonferenz,<br />
3. Information und Diskussion über die Schulvereinbarung in den Klassen<br />
4. Unterzeichnung der Schulvereinbarung von allen Schülern der PRS<br />
5. Klassenweise Archivierung der unterschriebenen Schulvereinbarungen<br />
Verantwortliche:<br />
zu 1:<br />
zu 2:<br />
zu 3+4:<br />
zu 5:<br />
Gremium Schulvereinbarung in Zusammenarbeit mit SEB, SV, SLK, IT-Team<br />
SLK<br />
KlassenlehrerInnen, IT-Team, Herr Dr. Schnöbel<br />
SLK, KlassenlehrerInnen<br />
Überprüfung der Maßnahmen<br />
zu 1+2:<br />
zu 3-6:<br />
Vorlage und Beschluss der Schulvereinbarung, Bericht auf der Schulkonferenz<br />
Bericht auf der Schulkonferenz<br />
Zeitpunkt der Überprüfung:<br />
Ende Schuljahr 2004/2005<br />
60
10.4 Zukunftsperspektiven<br />
Das vorliegende Schulprogramm zeigt die Linien der <strong>Schule</strong>ntwicklung auf, die sich die<br />
Schulgemeinde der PRS gesetzt hat.<br />
Die Schwerpunkte Unterrichtsentwicklung, Teamstrukturen, pädagogische Angebote und<br />
Stärkung der Arbeit im Realschul- und Hauptschulzweig zeigen die große Vielfalt und Breite<br />
der auf uns zu kommenden Aufgaben.<br />
<strong>Schule</strong>ntwicklung steht aber immer auch in Zusammenhang mit der äußeren, der politischen<br />
und bildungspolitischen Entwicklung, den allgemeinen Anforderungen, die von außen an die<br />
<strong>Schule</strong> herangetragen werden. In den nächsten Jahren werden daher auch noch weitere<br />
Problemstellungen die Entwicklung der PRS prägen:<br />
o Maßnahmen der Qualitätsentwicklung in Zusammenhang mit dem Landesabitur ab<br />
2007.<br />
o Die Auswirkungen der Schulzeitverkürzung im gymnasialen Zweig auf 12 Jahre wird<br />
Konsequenzen haben für das System der kooperativen Gesamtschule, die<br />
auszuwerten sein werden. Hier können sich u.U. erhebliche Änderungen der<br />
Stundentafel, der Curricula und der Übergänge ergeben. Es zeichnet sich ab, dass die<br />
Durchlässigkeit nicht mehr in der bisherigen Form aufrecht erhalten werden kann. Die<br />
Kooperation zwischen den Schulzweigen – u.U. auch zwischen den Lehrämtern - und<br />
der Aspekt des sozialen Lernens könnten erschwert werden. Die Schulform der<br />
kooperative Gesamtschule sollte sich bemühen, für ihre Leistungen und für ihre<br />
Tradition öffentlich Verständnis zu wecken und Akzeptanz zu fördern.<br />
o Die steigenden Anforderungen an die Ausbildung im Hauptschul- und<br />
Realschulzweig, die mittel- und langfristigen Konsequenzen der Abschluss- und<br />
Projekt- und Präsentationsprüfungen, werden den Unterricht und die Motivationslage<br />
der SchülerInnen verändern. Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die<br />
Arbeits- und Berufswelt wird in Form von verstärkten Praktika oder der Einführung<br />
von Praxisklassen im H-Zweig immer mehr Raum in Anspruch nehmen.<br />
o Der geplante Neubau schließlich wird – so die Hoffnung der Schulgemeinde der PRS<br />
– die Umsetzung einiger Vorhaben erlauben, insbesondere die Realisierung von<br />
Ganztagesangeboten, Nachmittagsbetreuung einschließlich der Versorgung in einer<br />
Kantine.<br />
o Eine einschneidende Veränderung zum Jahreswechsel 2004/2005 wird die<br />
Pensionierung von Frau Baumert, der Schulbibliothekarin, sein. Bisher gibt es noch<br />
keine Zusage, dass diese wichtige Position wieder besetzt wird. Angesichts der<br />
gestiegenen Anforderungen, die an die <strong>Schule</strong> herangetragen werden ( Leseförderung,<br />
Eigenverantwortung, Fächerübergreifendes Lernen ) braucht eine <strong>Schule</strong> unserer<br />
Größe dringend eine funktionierende Schüler- und Lehrerbibliothek.<br />
61
11 Entstehungsprozess des Schulprogramms<br />
Seit der Vorlage der ersten Ausgabe des Schulprogramms arbeitete die Schulprogrammgruppe<br />
kontinuierlich weiter. Nachdem Frau Dr. Hesse im Frühjahr 2003 die PRS verlassen hatte,<br />
übernahmen zunächst Frau Creutz und Frau Schilling gemeinsam die Leitung der Gruppe.<br />
Seit 8/2003 leitet Frau Schilling die Arbeit der Schulprogrammgruppe.<br />
Zusammensetzung der Schulprogrammgruppe<br />
Als LehrerInnenvertreter: Frau Creutz, Frau Euler, Herr Grell-Kamutzki , Frau Dr.Hesse<br />
(bis 04/2003), Herr Meier, Herr Schauer, Frau Schilling, Herr Schott, Herr Schwarz, Herr<br />
Ulmschneider, seit 02/2004 Herr Karner und Herr Ramos<br />
Als Elternvertreterinnen: Frau Kaltschnee, Frau Golinski-Wöhler (seit 11/2003)<br />
Als SchülerInnenvertreterin: Martina Knapp (bis 07/2003), Sophie Günster (seit 09/2003)<br />
Erster Arbeitsschwerpunkt war nach der Verteilung der gebundenen Exemplare des<br />
Schulprogramms von 2002 die Synopse der <strong>Ziel</strong>setzungen des Elternteils und des Teils der<br />
Lehrkräfte. Es zeigte sich, dass sich viele <strong>Ziel</strong>setzungen überschnitten und dass die Eltern aus<br />
ihren <strong>Ziel</strong>setzungen konkrete Vorhaben herauskristallisieren konnten<br />
(Kommunikationsstruktur innerhalb der <strong>Schule</strong> und nach außen verbessern /<br />
Wahlmöglichkeiten für SchülerInnen bieten / Förderung von kunstinteressierten und –<br />
begabten SchülerInnen / Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Eltern und LehrerInnen /<br />
Einrichtung eines Ruheraums / Regelung der Verteilung der Klassenarbeiten über das Jahr).<br />
Diese Vorhaben wurden in die Arbeit der Schulprogrammgruppe aufgenommen.<br />
Das gemeinsame Betrachten der verschiedenen Vorhaben im November 2002 zeigte, dass<br />
eine Vielzahl von Entwicklungsvorhaben auf die <strong>Schule</strong> zukamen und dass Aufgaben wie der<br />
Schulneubau, die neuen Lehrpläne, die Auswirkungen der PISA-Studie noch nicht in das<br />
Schulprogramm Eingang gefunden hatten. Hierbei wurde deutlich, dass eine Strukturierung<br />
der Vorhaben und eine Prioritätensetzung gemeinsam mit der Schulleitung dringend<br />
notwendig wurde, die auf der Sitzung der Schulleitungskonferenz vom 26.11.2002 erfolge.<br />
(BLK-Projekt, Teamentwicklung, Ganztagesangebote).<br />
Nach Rückmeldung vom Staatlichen Schulamt im Februar 2003 wurde das Schulprogramm<br />
ergänzt durch den Fortbildungsplan, der auf der Gesamtkonferenz vom 30.06.2003<br />
abgestimmt wurde.<br />
Im Frühjahr 2003 erhob die Schulprogrammgruppe in einer ersten Evaluationsrunde mit Hilfe<br />
eines Fragebogens den Stand der Umsetzung der Vorhaben. Ein Zwischenbericht wurde auf<br />
der Gesamtkonferenz vom 30.6.2003 dem Kollegium vorgestellt.<br />
Ab November 2003 erfolgte eine zweite Evaluationsrunde, bei der ebenfalls mit Hilfe eines<br />
Fragebogens ermittelt wurde, inwieweit die Vorhaben umgesetzt werden konnten und welche<br />
Hindernisse und Probleme auftauchten. Mit einer Analyse der Stärken und Schwächen des<br />
<strong>Schule</strong>ntwicklungsprozesses evaluierte die Schulprogrammgruppe dann auf ihrer Sitzung am<br />
10.02.04 die Ergebnisse der Erhebung.<br />
Diese Analyse ist Basis für die Aktualisierung des vorliegenden Schulprogramms (vgl.<br />
Kapitel 9). Auf der Gesamtkonferenz vom 30.3.2004 wurde das Ergebnis der Evaluation und<br />
die Überarbeitung der Gliederung dem Kollegium vorgestellt.Die bis dahin formulierten<br />
neuen Vorhaben wurden einzeln diskutiert und zur Abstimmung gestellt.<br />
Auf dieser Basis erfolgte dann die Aktualisierung des Schulprogramms im Frühjahr 2004. Die<br />
aktualisierte Form des Schulprogramms wird auf der Gesamtkonferenz vom 02.06.2004 der<br />
Gesamtkonferenz vorgelegt, der Schulkonferenz am 15.06.2004 und dem <strong>Schule</strong>lternbeirat<br />
am 07.06.2004.<br />
62
12 Anhang<br />
12.1 Die Arbeit an dem Ganztagskonzept für die PRS<br />
Aufgrund der PISA- Ergebnisse wird die Ganztagsschule im Rahmen von <strong>Schule</strong>ntwicklung<br />
diskutiert . Sowohl der Hochtaunuskreis als auch das Hessische Kultusministerium<br />
unterstützen Versuche von <strong>Schule</strong>n Ganztagskonzepte zu entwickeln mit dem Programm<br />
„Ganztagsschule nach Maß“. Im September 2002 wurde auf einer Gesamtkonferenz ein<br />
Ausschuss „Ganztagsschule“ initiiert. Dieser entwickelte Leitlinien, die zentrale pädagogische<br />
Forderungen des Schulprogramms enthalten. Dazu gehören die Forderungen,<br />
• leistungsschwache, aber auch besonders leistungsstarke SchülerInnen zu fördern,<br />
• eigenverantwortlichen Lehr- und Lernformen mehr Platz einzuräumen,<br />
• Raum, Zeit und Motivation für musische Angebote zu schaffen,<br />
• Stress abzubauen, Ruhezeiten und –zonen bereitzustellen.<br />
Gleichzeitig wurde festgehalten, dass ein Ganztagskonzept der PRS keine grundsätzliche<br />
Trennung von Unterricht bei LehrerInnen am Vormittag und der Gestaltung des Nachmittags<br />
vornehmen sollte. Pädagogisch sinnvoll und lernpsychologisch wichtig wird heute erachtet,<br />
Erholungsphasen, ein Sport- und Freizeitangebot und die Hausaufgabenbetreuung in den<br />
Unterricht einzugliedern., um so bessere Lernerfolge zu erreichen. Die Umsetzung dieser<br />
Leitlinien, die von allen schulischen Gremien verabschiedet wurden, basiert auf der<br />
Schaffung der notwendigen personellen und sachlichen Voraussetzungen (Neubau,<br />
Zuweisung zusätzlicher Lehrerstellen).<br />
Im Ausschuss wurden in sehr offener Form verschiedene Modelle diskutiert und schließlich<br />
<strong>Ziel</strong>e entwickelt, sowohl kurzfristige als auch langfristig auf den Neubau bezogene.<br />
Modell 1, das kurzfristig zu verwirklichen sein sollte, geht von einer Erweiterung der bereits<br />
bestehenden pädagogischen Mittagsbetreuung aus. <strong>Ziel</strong>gruppen sollten die<br />
SchülerInnen der Klassen 5 und 6 sein, deren Eltern von Montag bis Donnerstag<br />
eine verlässliche Nachmittagsbetreuung wollen. Es gibt an diesen Tagen<br />
Betreuungsangebote (Hausaufgabenbetreuung, Spiel-und Freizeitgestaltung),<br />
Fördermaßnahmen und Wahlangebote aus den Bereichen Sport, Musik, Kunst Theater,<br />
Naturwissenschaften und Lernen am Computer Ein einfaches Mittagessen wird angeboten .<br />
Voraussetzungen dieses Modells sind<br />
• mehr Lehrerstellen<br />
• die bauliche Erweiterung der Cafeteria<br />
• eine personelle Verstärkung der Hilfskräfte in der Cafeteria<br />
• ein kostengünstiges Mittagessen für die SchülerInnen<br />
Modell 2 nimmt reformpädagogische Vorstellungen auf: Der Pflichtunterricht wird auf den<br />
Vor- und Nachmittag verteilt. Es hat sich lernpsychologisch als wichtig und pädagogisch<br />
sinnvoll erwiesen, Erholungsphasen, ein Sport- und Freizeitangebot und die<br />
Hausaufgabenbetreuung in den Unterricht einzugliedern. Ein gemeinsames Mittagessen ist<br />
ebenfalls vorgesehen. Sowohl die Nutzung der Sport- und Freizeitangebote, die<br />
Hausaufgabenbetreuung als auch das Mittagessen sollen freiwillig sein.<br />
Beide Modelle wurden im September 2003 in einer Umfrage an allen Kindergärten und<br />
Grundschulen Friedrichsdorfs und den Klassen 5 und 6 der PRS den Eltern vorstellt, um ein<br />
63
Meinungsbild zu erhalten. Es wurde deutlich, dass für eine pädagogische Mittagsbetreuung<br />
ein großes Interesse besteht und dass Schwerpunkte der Mittagsbetreuung von den Eltern in<br />
Arbeitsgemeinschaften, den Förderkursen und der Hausaufgabenbetreuung gesehen werden.<br />
Auch Modell 2 stieß auf große Zustimmung.<br />
Um Modell 1, unser kurzfristig zu erreichendes <strong>Ziel</strong> zu verwirklichen , wurden im oktober<br />
2003 Anträge auf die Erweiterung der pädagogischen Mittagsbetreuung beim<br />
Kultusministerium und die bauliche Erweiterung der Cafeteria beim Bauamt des<br />
Hochtaunuskreises gestellt. Beide Anträge wurden abgelehnt, die Ablehnung der<br />
Umbaumaßnahmen wurde mit dem Hinweis auf den geplanten Neubau begründet.<br />
Der Antrag soll erneut im September 2004 gestellt werden, das Konzept der Mittagsbetreuung<br />
soll überarbeitet werden.<br />
Die Entwicklung eines konkreten Modells , das den Vorgaben der Leitlinien entspricht und<br />
die Einführung von G8 mit einbezieht , bleibt wichtige Aufgabe der <strong>Schule</strong>ntwicklung der<br />
PRS. Wir werden unsere pädagogischen Vorstellungen eines Ganztagskonzepts in die<br />
Planung des Neubaus einbringen.<br />
64
12.2 Medienkonzept -Curriculum für die neuen Medien<br />
Das vorliegende Medienkonzept ist für alle Schulzweige und die angegebnenen Fächer<br />
verpflichtend wobei weitere Medienprojekte möglich sind.<br />
5 6 7 8 9 10 11<br />
Deutsch<br />
1. Fremdsprache<br />
(Englisch<br />
oder<br />
Französisch)<br />
Umgang mit<br />
dem<br />
Computer,<br />
Textverarbeitung<br />
Arbeiten mit<br />
Lernsoftware<br />
vertiefende<br />
Wiederholung<br />
vertiefende<br />
Wiederholung<br />
Kunst<br />
Digitale Bildbearbeitung<br />
Mathematik<br />
(vertiefende<br />
Wiederholung)<br />
Tabellenkalkulation<br />
vertiefende<br />
Wiederholung<br />
Geschichte,<br />
Politik und<br />
Erdkunde<br />
nach<br />
Vereinbarung<br />
H-Zweig:<br />
Recherchieren,<br />
Präsentieren<br />
alle Zweige:<br />
Recherchieren,<br />
Präsentieren<br />
R- & G-<br />
Zweig<br />
(vertiefende<br />
Wiederholung)<br />
Orientierungs<br />
-kurs im<br />
Klassenverband<br />
Recherchieren,<br />
Präsentieren<br />
Grundgedanken des Medienkonzepts<br />
1. Die SchülerInnen soll bis zur Abschlussklasse grundlegende Medienkompetenzen<br />
erwerben.<br />
2. Die Medienkompetenzen müssen während der Sek. I sukzessiv und systematisch<br />
aufgebaut werden.<br />
3. Diese Aufgabe übernehmen die Fächer.<br />
4. Die Arbeit mit den neuen Medien soll in den Fachunterricht sinnvoll eingebunden werden.<br />
5. Medien- und Methodenkompetenzen sollen zusammenhängend wachsen und sich<br />
ergänzen (z. B. Gestaltung der Präsentation und Vortragstechniken).<br />
65
Inhalte in Jahrgangsstufe 5<br />
In Jahrgangsstufe 5 lernen bzw. wiederholen die SchülerInnen die Handhabung des<br />
Computers. Im Fach Deutsch sollen sie den Umgang mit der Tastatur und den<br />
Peripheriegeräten erlernen. Den Umgang mit einer Textverarbeitung eignen sie sich im<br />
Rahmen eines Unterrichtsthemas an. In der ersten Fremdsprache sollen sie das Arbeiten mit<br />
Lernsoftware kennen lernen.<br />
Verbindliche Inhalte:<br />
• Handhabung des Computers: Computer starten und herunterfahren, Programme starten<br />
und beenden, Umgang mit dem Explorer<br />
• Lernsoftware: Computer als Arbeits-, Übungs- und Lernmittel selbständig und in<br />
Zusammenarbeit mit MitSchülerInnen nutzen<br />
• Umgang mit der Tastatur und den Peripheriegeräten: Tastatur und Maus als<br />
Eingabeinstrumente nutzen, Dokumente ausdrucken<br />
• Textverarbeitung: einfache Zeichen- und Absatzformatierungen zuweisen (Schriftart,<br />
Zeilenabstand etc.), Bilder einfügen, einfache Tabellen erstellen, kleine Zeichnungen<br />
anfertigen (Rechtecke, Pfeile)<br />
Inhalte in Jahrgangsstufe 7<br />
In Jahrgangsstufe 7 werden die vorhandenen Grundkenntnisse mit Blick auf den<br />
mathematisch-naturwissenschaftlichen und den musischen Bereich erweitert. In Mathematk<br />
sollen die SchülerInnen das Arbeiten mit einer Tabellenkalkulation, in Kunst die digitale<br />
Bildverarbeitung kennen lernen.<br />
Verbindliche Inhalte:<br />
• Umgang mit Formeln: einfache Formeln eingeben können, den Funktionsassistent kennen<br />
lernen<br />
• Bezüge: relative und absolute Bezüge unterscheiden und anwenden<br />
• Grafikerstellung: Grafiken für einfache Beispiele erstellen (z. B. Balken- und<br />
Kreisdiagramme)<br />
• Einfügen der selbst erstellten Grafiken in ein Textverarbeitungprogramm<br />
• Bilder in den Computer einlesen: Arbeiten mit einer Digitalkamera und dem Scanner<br />
• Bilder verarbeiten: Bilder vergrößern, verkleinern, zuschneiden, bearbeiten<br />
• Bilder speichern: Farbtiefen und Auflösungen beurteilen, gängige Dateiformate kennen<br />
lernen<br />
Inhalte in Jahrgangsstufe 9<br />
In Jahrgangsstufe 9 (Hauptschule: Jahrgangsstufe 8) werden das Arbeiten mit dem Internet<br />
und Darstellungen mit einem Präsentationsprogramm thematisiert. Dafür kommen<br />
Geschichte, Politik und Wirtschaft oder Erdkunde in Frage. Die FachlehrerInnen sprechen<br />
sich zu Beginn der Jahrgangsstufe ab. Die Durchführung eines Projekttages wird empfohlen.<br />
66
Verbindliche Inhalte:<br />
• Recherchieren: Mit Internetadressen, Katalogen und Suchmaschinen arbeiten, gefundene<br />
Inhalte speichern und in andere Programme übertragen<br />
• Präsentieren: In einem Präsentationsprogramm „Folien“ erstellen und verbinden,<br />
Integration verschiedener Medien (Texte, Grafiken, Musik), „Folien“ ausdrucken, Vortrag<br />
vor der Klasse üben, Vortrag und Gestaltung der „Folien“ kritisch bewerten<br />
Inhalte in Jahrgangsstufe 11<br />
In Jahrgangsstufe 11 sollen die SchülerInnen eine inhaltlich wie formal anspruchsvolle<br />
Präsentation selbstständig erarbeiten. Der Kursleiter des im Klassenverband arbeitenden<br />
Orientierungskurses (Vorleistungskurses) stellt fachbezogene Themen zur Auswahl und<br />
integriert die entstandenen Präsentationen in seinen Unterricht. Die Erarbeitung der<br />
Präsentation beginnt im Rahmen von „Lernen lernen“.<br />
Verbindliche Inhalte:<br />
• Recherchieren: selbstständige Recherche in Digital- und Printmedien, korrekter Umgang<br />
mit Zitaten und Quellenangaben<br />
• Präsentieren: Vortrag vor der Klasse üben, Vortrag und Gestaltung der „Folien“ kritisch<br />
bewerten, Kolloquium mit den MitSchülerInnen und dem Kursleiter trainieren<br />
67
12.3 Lernen Lernen Konzept<br />
Modell für die PRS<br />
- Unterrichtsbausteine -<br />
Die bereits ausgearbeiteten Bausteine sind in dieser Übersicht grau gekennzeichnet. Sie<br />
werden von einem Lehrer/ einer Lehrerin des jeweils zugeordneten Faches eingeführt.<br />
September Oktober November/<br />
Dezember<br />
5. Klasse<br />
6.<br />
Klasse<br />
7. Klasse<br />
8. Klasse<br />
9. Klasse<br />
10. Klasse<br />
3 Einführungstage<br />
Hefte/ Ordner<br />
Mo 2. Woche:<br />
Mein Arbeitsplatz<br />
Hausaufgaben<br />
HF/ KL<br />
Wiederholungs-<br />
Zyklus<br />
Wiederholungszyklus<br />
Wiederholungs<br />
-zyklus<br />
Wiederholungs<br />
-zyklus<br />
***<br />
Wiederholungs<br />
-zyklus<br />
Effektiv üben<br />
Vorbereitung auf<br />
Klassenarbeiten<br />
(v. d. ersten Arb.)<br />
HF/ KL<br />
Lesetechniken<br />
Notizen<br />
D (alle)<br />
Informationsbeschaffung<br />
Präsentationstechniken<br />
I<br />
FB I<br />
Selbstreflexion<br />
Berufsfindung<br />
Selbstreflexion<br />
in Bezug auf mittl.<br />
Bildungsabschluss oder<br />
Ausblick auf Oberstufe<br />
Gruppenarbeit<br />
Markieren/<br />
Strukturieren<br />
PoWi<br />
Präsentationstechniken<br />
II<br />
FB I oder III<br />
Mind-Mapping III<br />
E<br />
*** aktuell anstelle des Wiederholungszyklusses Zusammenfassung Mind-Mapping I&II<br />
Die in der Übersicht vorkommenden Abkürzungen haben folgende Bedeutung:<br />
HF = Hauptfach, KL = KlassenlehrerIn, D = Deutsch, PoWi = Politik und Wirtschaft, AF I =<br />
Aufgabenfeld I (sprachlich-literarisch-künstlerischer Bereich), AF II = Aufgabenfeld II<br />
(Gesellschaftswissenschaften), AF III = Aufgabenfeld III (Naturwissenschaften), E =<br />
Englisch, F = Französisch.<br />
68
Januar<br />
Februar-<br />
Osterferien<br />
Osterferien-<br />
Sommerferien<br />
11.Klasse<br />
10. Klasse 9. Klasse 8. Klasse 7. Klasse 6. Klasse 5. Klasse<br />
Stationenlernen (in<br />
Verbindung mit<br />
Lerntypen und<br />
mehrkanaligem Lernen)<br />
Biologie<br />
Mind-Mapping II<br />
D, E, F, Bio<br />
Gruppenarbeit<br />
Reflexion<br />
Selbstüberprüfung:<br />
Stärken und Schwächen<br />
KL<br />
Kritik und Selbstkritik<br />
Mind-Mapping I<br />
KL/ FB I oder II<br />
Klassenarbeiten II<br />
Visualisierungstechniken<br />
KL (alle)<br />
Zeitplanung<br />
KL<br />
Gedächtnistraining/<br />
Mentales Visualisieren<br />
KL/ FB I oder II<br />
Arbeit mit<br />
Nachschlagewerken<br />
Brainstormingtechniken<br />
KL (alle)<br />
Stationenlernen (in<br />
Verbindung mit<br />
Lerntypen und<br />
mehrkanaligem Lernen)<br />
Projektarbeit<br />
KL, FB I<br />
5 Bausteine an 5 Tagen im 1. Halbjahr<br />
• Präsentation<br />
Vortrag und Erstellung PC-gestützten Präsentationen<br />
• Informationsbeschaffung<br />
Nutzung von Bibliothek, Lexika, Internetrecherche<br />
• Protokoll<br />
• Textanalyse<br />
• Reflexion<br />
Lerntypen, Selbstbild und Motivation<br />
*** aktuell anstelle des Wiederholungszyklusses Zusammenfassung Mind-Mapping I&II<br />
69
12.4 Öffnung nach außen – die PRS und ihre<br />
Kooperationspartner<br />
Außenkontakte und Kooperationspartner der PRS<br />
Beteiligte/<br />
Inhalt<br />
Durchführende<br />
Naturwissenschaften Exkursionen in die Natur der<br />
näheren Umgebung<br />
z.B. ökologische Untersuchungen<br />
am Erlenbach,<br />
technische Einrichtungen wie<br />
Kraftwerke, Erdfunkstelle Usingen,<br />
Industriebetriebe,<br />
Besichtigung von Forschungsstätten<br />
Ausstellungen mit<br />
naturwissenschaftlichem<br />
Schwerpunkt in der <strong>Schule</strong><br />
Fachvorträge der Preisträger des<br />
Johann-<strong>Philipp</strong>-<strong>Reis</strong>-Preises u.a.<br />
Praktika von SchülerInnen im<br />
Grundpraktikum Physik in<br />
Frankfurt<br />
verschiedene Museen<br />
Beteiligung am Girls-Day und Tag<br />
des Telefons<br />
Erntedankfest für die 5.-7. Klassen<br />
Adressat/Partner<br />
Forstämter<br />
Deutsches Museum in<br />
München und Bonn,<br />
Fachhochschulen und<br />
Universitäten in Darmstadt,<br />
Frankfurt, Friedberg, Gießen<br />
Pro Familia,<br />
Kernkraftwerk Biblis,<br />
Gesellschaft für<br />
Schwerionenforschung (GSI)<br />
Aventis,<br />
Senckenbergmuseum,<br />
Zoo, Palmengarten,<br />
Explora, Mathematikum,<br />
Schloss Freudenberg,<br />
Stadt Friedrichsdorf<br />
Landwirte, BUND, NABU<br />
Mathematik<br />
Mathematikwettbewerbe der<br />
Jahrgänge 8 und 11, Teilnahme am<br />
Tag der Mathematik in der Stufe 12,<br />
Projekte: IMMIS, SINUS<br />
Zentrum für Mathematik in<br />
Lautertal<br />
Mathematikum in Gießen<br />
Informatik<br />
Sport<br />
Grundwissen EDV (durch IKG u.a.)<br />
Info-Schul-Projekt<br />
Intel-II<br />
Sportshow<br />
Sportfestival<br />
Sporttag<br />
Stundenlauf<br />
Arbeitsgemeinschaften<br />
Jugend trainiert für Olympia<br />
(z.B. Tennis)<br />
BmBF, <strong>Schule</strong>n ans Netz,<br />
Verbund der am<br />
Infoschulprojekt beteiligten<br />
<strong>Schule</strong>n im Hochtaunus- und<br />
Wetteraukreis<br />
Studienseminar Frankfurt<br />
Sportvereine Betriebe,<br />
Verbände,<br />
Eltern,<br />
Betriebe<br />
Sportvereine (z.B. TSG<br />
Friedrichsdorf),<br />
Tennisclubs der Region, bes.<br />
TC Friedrichsdorf, Seulberg,<br />
Bad Homburg<br />
70
Deutsch<br />
Fremdsprachen<br />
Theater-AG Theatergastspiele<br />
Themenabende (Heine ...)<br />
Lesungen<br />
Veranstaltungen im<br />
Skulpturengarten<br />
Lesenacht<br />
Zeitung in der <strong>Schule</strong><br />
Vorlesewettbewerb<br />
Theaterbesuche<br />
Lesungen<br />
English Drama Club<br />
Book Review Group<br />
Fremdsprachenwettbewerbe<br />
Theatergastspiele<br />
Schüleraustausch<br />
(Gruppen/individuell)<br />
mit Partnerschulen<br />
Projekt "voneinander lernen..."<br />
Email-Projekte<br />
(USA/Frankreich /Australien /<br />
Argentinien / Irland)<br />
Projektorientierte<br />
Schülerbegegnung mit<br />
Frankreich/USA<br />
Ausstellungen<br />
Jugendbuchausstellung<br />
Bibliotheken<br />
Stiftung Lesen<br />
IZOP<br />
Börsenverein<br />
Theater der Umgebung<br />
Amerikahaus,<br />
Buchhandlungen<br />
Verlage, Lehrerfortbildungseinrichtungen<br />
Bundeswettbewerb<br />
Fremdsprachen<br />
Verlage<br />
English Theater, International<br />
Theater, FIS, American<br />
Drama Group<br />
<strong>Schule</strong>n der Welt,<br />
Partnerschulen<br />
Robert-Bosch-Siftung,<br />
Lehrerfortbildungszentrum<br />
Lipezk/Russland<br />
Partnerschulen<br />
Partnerschulen<br />
Rathaus<br />
Institut français<br />
Kunst<br />
Ausstellungen in der Schulgalerie<br />
und der Stadt<br />
Skulpturengarten<br />
Gestaltung des Schulraums und des<br />
Schulgeländes,<br />
des öffentlichen Raums in der Stadt,<br />
von Kindergärten<br />
Wettbewerbe<br />
Werkstatt (s.o.), AGs, WPU<br />
Ausstellungs- und Museumsbesuche<br />
Künstler an der <strong>Schule</strong><br />
Postkartengestaltung und Verkauf<br />
Rathaus<br />
Artlantis<br />
bei Privatfirmen<br />
Hugenottenmarkt<br />
Stadt Friedrichsdorf<br />
Landkreis<br />
Museen und Ateliers der<br />
Umgebung<br />
Hilfe für krebskranke Kinder<br />
Frankfurt e.V.<br />
71
Musik<br />
Gesellschaftswissenschaften<br />
Plakataktionen<br />
Konzerte in der <strong>Schule</strong><br />
Hochtaunus-Schulkonzert<br />
Instrumentalunterricht,<br />
Klassenmusizieren<br />
Weihnachtssingen<br />
Wettbewerbe (Henninger-<br />
Musikpreis)<br />
Veranstaltungen zu<br />
Menschenrechten<br />
Versicherungswesen<br />
Praktika<br />
Berufsorientierung<br />
"<strong>Schule</strong> Ade"<br />
Gespräche mit Zeitzeugen<br />
Unterrichtsbesuche<br />
Politikergespräche<br />
z.B. Amnesty International<br />
Hochtaunuskreis, andere<br />
<strong>Schule</strong>n<br />
Musikschule / Verband der<br />
Musikinstrumentehersteller<br />
Stadt, Weihnachtsmarkt<br />
Henninger-Stiftung<br />
amnesty international<br />
Arbeitskreis Asyl<br />
Krankenkassen<br />
Betriebe<br />
Betriebsbesichtigungen<br />
Weiterführende <strong>Schule</strong>n<br />
Ausbildungsberatung, IHK;<br />
BIZ, Fachmessen,<br />
Berufsbildungsmesse<br />
Gericht, Landtag, HR,<br />
Bundestag, Synagoge,<br />
Moschee, christl. Kirchen,<br />
diakonische Einrichtungen<br />
Schulleben allg.<br />
SV<br />
Arbeitsplatzbeschaffung<br />
Sozialpraktikum<br />
Besuch von Museen und<br />
Gedenkstätten<br />
Schulsanitätsdienst<br />
Sicherheitstraining: Aktion Auto<br />
Wandertage /-fahrten<br />
Schulfest<br />
Projektwoche<br />
Nachmittagsbetreuung:<br />
pm-action +<br />
Hausaufgabenbetreuung<br />
Cafeteria<br />
Kirchen- und Katholikentage<br />
Reflexionstage<br />
Rock Night<br />
BetreuungsSchülerInnen<br />
Beratungssystem<br />
Arbeitsamt<br />
Altersheime<br />
Gedenkstätte Buchenwald<br />
Johanniter<br />
ADAC Hessen-Thüringen<br />
Eltern<br />
Eltern<br />
Eltern, Sportvereine, Künstler<br />
etc.<br />
Verein zur Pausenbetreuung,<br />
Eltern, insbesondere ca. 100<br />
Mütter<br />
Kirchen<br />
72
12.5 Zuständigkeiten und Aufgaben<br />
12.5.1 Schulleitung und Verwaltung<br />
Schulleiter<br />
Stellv. Schulleiter<br />
Vom Kollegium gewählter ständiger Vertreter<br />
des Stellvertreters des Schulleiters<br />
Leiter der Förderstufe (Kl 5-6)<br />
Leiterin H/R - Zweig<br />
Leiter G-Zweig<br />
Oberstufenleiter<br />
Fachbereich Deutsch/<br />
Fremdsprachen/Kunst/Musik<br />
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften<br />
Fachbereich Mathematik/<br />
Naturwissenschaften<br />
Schulsportleiter<br />
Pädagogisches Team<br />
Sekretariat<br />
Hausmeister<br />
AV-Medien<br />
Herr Karner<br />
Herr Schwarz<br />
Herr Müller<br />
Herr Schmidt<br />
Frau Creutz<br />
Herr Rosenstock<br />
Herr Schott<br />
Frau Schilling<br />
Herr Ulmschneider<br />
Frau Euler<br />
Herr Schütz<br />
Herr Grell-Kamutzki, Frau Hedderich-Cöster,<br />
Frau Heinzelmann, Frau von Oettingen<br />
Frau Neumann, Frau Schreiber, Frau Sturm<br />
Herr Schmitt<br />
Herr Nitsch<br />
12.5.2 Gremien<br />
Schulsprecherin<br />
<strong>Schule</strong>lternbeiratsvorsitzende<br />
Personalratvorsitzende<br />
Förderverein<br />
Verein zur Pausenbetreuung<br />
Ausschüsse und deren Sprecher:<br />
Gesundheitsausschuss<br />
Haushaltsausschuss<br />
Konferenzvorbereitungsausschuss<br />
Schulprogrammausschuss<br />
Schulfestausschuss<br />
Bauausschuss<br />
IT-Team<br />
Malvina Schunk<br />
Frau Kaltschnee<br />
Frau Seeling-Spröde<br />
Herr Ditterich<br />
FrauVorrath, Herr Karber, Herr Schauer<br />
Herr Dietrich, Herr Dr. Finger<br />
Herr Schott<br />
Frau Weber, Frau Pöschl, Herr Berk, Herr<br />
Schulz<br />
Frau Schilling<br />
Herr Maurer, Frau Hedderich-Cöster,<br />
Herr Schott<br />
Herr Finger, Frau Heuser, Herr Käberich,<br />
Herr Dr. Schnöbel<br />
73
12.5.3 Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben<br />
Schüleraustausch<br />
Beratung für SchülerInnen, die für längere<br />
Zeit<br />
ins Ausland gehen<br />
Sicherheitsbeauftragter<br />
Datenschutzbeauftragter<br />
Energiebeauftragter und Verkehrsobmann<br />
Netzwerkadministrator<br />
Suchtprävention<br />
VerbindungslehrerInnen<br />
BeratungslehrerInnen<br />
Betriebspraktikum ( 8-10)<br />
Nachmittagsbetreuung<br />
Hausaufgabenbetreuung<br />
Betreuung der Cafeteria<br />
<strong>Schule</strong> und Gesundheit<br />
Schulseminarleiterin/Referendarbetreuung<br />
Koordination der Theaterarbeit<br />
Kooperation mit Grundschulen<br />
Schulkoordinator „Medienbildung im<br />
Schulverbund Hochtaunus“<br />
Frau Buggert-Fehn, Frau Schilling<br />
n.n. ( Frau Buggert-Fehn)<br />
Herr Reiniger<br />
Herr Dr. Denk, Herr Geisz<br />
Herr Saltenberger<br />
Herr Käberich<br />
Herr Schulz<br />
Herr Meier, Frau v. Oettingen<br />
Herr Grell-Kamutzki, Frau v. Oettingen, Frau<br />
Fiedler<br />
Frau Creutz, Herr Rosenstock<br />
Frau Hedderich-Cöster<br />
Frau Plüntsch, Herr Müller<br />
Herr Schauer<br />
Herr Dietrich<br />
Frau Weber<br />
Frau Käberich<br />
Frau Heinzelmann<br />
Herr Dr. Schnöbel<br />
74
12.5.4 Zukunftsperspektive„Besondere Aufgabengebiete“<br />
Aus den Erfordernissen der im Schulprogramm der PRS skizzierten<br />
<strong>Schule</strong>ntwicklungsvorhaben erwachsen spezifische Anforderungen an die<br />
Personalentwicklung. Es entstehen neue Anforderungen an die Lehrkräfte zur Übernahme von<br />
besonderen Aufgabengebieten, damit die Vorhaben zielgerichtet umgesetzt werden können. In<br />
den Folgejahren sollen daher neue A-14-stellen vorangig mit den folgenden<br />
Aufgabengebieten ausgeschrieben werden. Die vorliegende Liste stellt noch keine zeitliche<br />
Priorisierung dar. Diese soll jeweils dann vorgenommen werden, wenn der PRS neue A-14-<br />
Stellen zugeteilt werden.<br />
Aufgabenbereich<br />
Lernen lernen:<br />
Implementierung und Weiterentwicklung des schulinternen Curriculums, Organisation<br />
schulinterner Fortbildung und Organisation der Projekttage (in Zusammenarbeit mit den<br />
Zweigleitern und der Oberstufenleitung)<br />
Öffnung der <strong>Schule</strong> nach außen:<br />
Entwicklung von Konzepten zur Zusammenarbeit der <strong>Schule</strong> mit Betrieben und städtischen<br />
Gremien in Friedrichsdorf,<br />
Organisation der Betriebspraktika für die Sekundarstufe I<br />
Organisation der Veranstaltung „<strong>Schule</strong> ade“<br />
Förderung der Lesekultur:<br />
Organisation von Autorenlesungen, Initiierung und Organisation von (thematischen)<br />
Kulturabenden, Lesewettbewerben, Zusammenarbeit mit der Bibliothek<br />
Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung:<br />
Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und Universitäten, Organisation von Praktika für<br />
SchülerInnen in der Sekundarstufe II , Betreuung von Praktikanten für das Lehramt<br />
Deutsch als Zweitsprache:<br />
Erarbeitung eines Curriculums für Deutsch als Zweitsprache, Betreuung der SchülerInnen mit<br />
Migrationshintergrund und noch nicht ausreichenden Deutschkenntnissen, Zusammenarbeit<br />
mit der Fachkonferenz Deutsch<br />
Teambildung:<br />
Koordination der Teamentwicklung an der PRS, Zusammenarbeit mit der Stundenplanung,<br />
Entwicklung von spezifischen pädagogischen Konzepten<br />
Ganztagesangebote:<br />
Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts der Ganztagsangebote, Implementierung und<br />
Organisation, Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung<br />
Umgang mit dem Schulgebäude:<br />
Weiterentwicklung und Betreuung eines Reinigungskonzeptes für die PRS, ggF<br />
Energiekonzept bzw. Ökologie<br />
Eigenverantwortlicher Unterricht:<br />
Komplettierung der Materialsammlungen und Fachressourcen für Eigenverantwortlichen<br />
Unterricht im AF III, Betreuung von Konzepten für Experimentalunterricht und<br />
75
Computereinsatz in den Naturwissenschaften, Initiierung von schulinternen<br />
Fortbildungsmaßnahmen, Betreuung von Wettbewerben wie „Jugend forscht“<br />
Cafeteria:<br />
Organisatorische und konzeptionelle Betreuung der Cafeteria. Einbindung des Konzepts der<br />
Cafeteriabetreuung und Mittagsverpflegung in das Modell der Ganztagesangebotsschule<br />
Fächerübergreifende Projekte:<br />
Organisation der bestehenden fächerübergreifenden Projekte im<br />
gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereich, Ausdehnung auf andere Fachbereiche, Weiterund<br />
Fortentwicklung der Projekte, Evaluation<br />
76
12.6 Fortbildungsplan<br />
An der PRS werden bis Ende des Schuljahres 2004/2005 folgende Fortbildungsmaßnahmen<br />
geplant:<br />
Arbeitsvorhaben Inhalt Adressaten Schulinterne<br />
Fortbildung<br />
möglich<br />
Teambildung<br />
Demokratie<br />
lernen und leben<br />
Mediation und<br />
Partizipation<br />
begleitendes Coaching<br />
der Teams<br />
Eingangsprogramm<br />
5/6<br />
Kennenlernen des<br />
Programms<br />
schulintern learning by<br />
doing<br />
Teammitglieder Klasse<br />
7/8/9<br />
KollegInnen, die am EP<br />
teilnehmen (wollen)<br />
xxx<br />
xxx<br />
Externe<br />
Fortbildung<br />
nötig –<br />
Kooperationspartner<br />
BLK<br />
Help<br />
Vorhaben<br />
Steuergruppe<br />
Lernen lernen<br />
Vor-/Nachbereitung der<br />
Projekttage 5+6,<br />
Weiterentwicklung des<br />
Programms<br />
Ich und mein Körper<br />
7/8<br />
Vor-/Nachbereitung der<br />
Projekttage 7/8,<br />
Weiterentwicklung des<br />
Programms<br />
Abenteuerpädagogik<br />
KollegInnen, die das<br />
Projekt durchführen<br />
xxx<br />
xxx<br />
xxx<br />
BLK<br />
Help<br />
BLK<br />
BLK<br />
SV-Training SV-LehrerInnen Help und<br />
andere<br />
Kollegiale Beratung KollegInnen der<br />
Arbeitsgruppe Mediation,<br />
die kollegiale Beratung<br />
anbieten wollen<br />
BLK<br />
Aufbautraining<br />
Mediation<br />
Basistraining<br />
Mediation<br />
Organisationsmodell -<br />
Aufbau einer<br />
Steuergruppe<br />
Jahrgangsspezifische<br />
Themenstellungen laut<br />
schulinternem<br />
Curriculum, Klassen<br />
6,8,10<br />
KollegInnen der AG<br />
Mediation<br />
interessierte KollegInnen<br />
SLK,<br />
Schulprogrammgruppe,<br />
andere Projektgruppen?<br />
FachlehrerInnen /<br />
KlassenlehrerInnen<br />
Klassen 6, 8, 10<br />
xxx, Bildung<br />
von<br />
Jahrgangsteams<br />
BLK/Help<br />
BLK/Help<br />
BLK<br />
77
Medien im<br />
Fachunterricht<br />
Vorhaben 7 EVA<br />
Methodik und<br />
Didaktik des<br />
Musikunterrichts<br />
Computereinsatz<br />
im<br />
Musikunterricht<br />
Laut Medienkonzept:<br />
Einbindung der neuen<br />
Medien in den<br />
Fachunterricht<br />
Umsetzung des EVA-<br />
Vorhabens ( Nr.7)<br />
Klassenmusizieren auf<br />
Orchesterblasinstrumenten<br />
Computer und<br />
Musiksoftware im<br />
Musikunterricht<br />
FachlehrerInnen xxx Schulverbund<br />
Medienbildung<br />
im<br />
Hochtaunuskreis<br />
FachlehrerInnen<br />
FchlehrerInnen<br />
xxx ( Herr<br />
Reimers)<br />
Verband<br />
Deutscher<br />
Schulmusiker -<br />
Bläserklassen-<br />
Kongress ( Herr<br />
Hollenstein<br />
Fortbildungsbedarf für die nächsten Jahre:<br />
Neue Lehrpläne,<br />
Neue Prüfungsanforderungen<br />
Landesabitur<br />
Fachspezifische<br />
Bedingungen, neue<br />
Aufgabenarten,<br />
Präsentationsprüfungen<br />
FachlehrerInnen<br />
XXX<br />
HeLP, SSA,<br />
Fachverbände<br />
(Stand: Konferenzbeschluss vom 02.06.2004)<br />
78