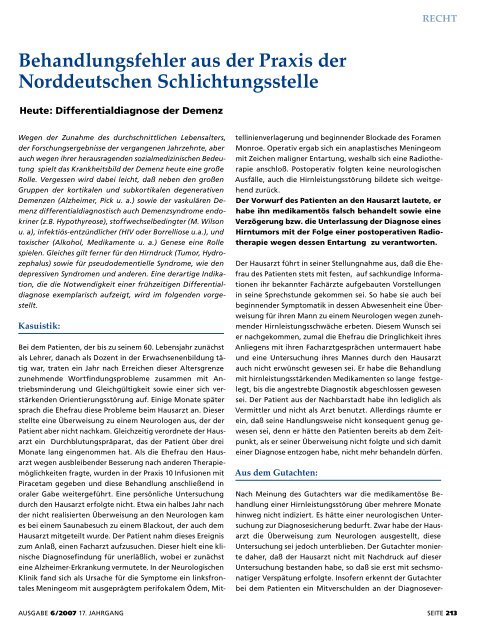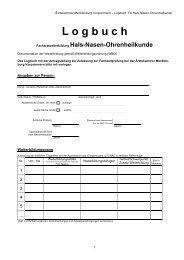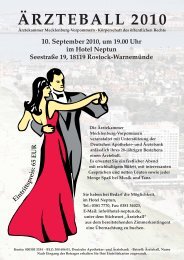Ärzteblatt Juni 2007 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Juni 2007 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Juni 2007 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Behandlungsfehler aus der Praxis der<br />
Norddeutschen Schlichtungsstelle<br />
Heute: Differentialdiagnose der Demenz<br />
Wegen der Zunahme des durchschnittlichen Lebensalters,<br />
der Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte, aber<br />
auch wegen ihrer herausragenden sozialmedizinischen Bedeutung<br />
spielt das Krankheitsbild der Demenz heute eine große<br />
Rolle. Vergessen wird dabei leicht, daß neben den großen<br />
Gruppen der kortikalen und subkortikalen degenerativen<br />
Demenzen (Alzheimer, Pick u. a.) sowie der vaskulären Demenz<br />
differentialdiagnostisch auch Demenzsyndrome endokriner<br />
(z.B. Hypothyreose), stoffwechselbedingter (M. Wilson<br />
u. a), infektiös-entzündlicher (HIV oder Borrelliose u.a.), und<br />
toxischer (Alkohol, Medikamente u. a.) Genese eine Rolle<br />
spielen. Gleiches gilt ferner für den Hirndruck (Tumor, Hydrozephalus)<br />
sowie für pseudodementielle Syndrome, wie den<br />
depressiven Syndromen und anderen. Eine derartige Indikation,<br />
die die Notwendigkeit einer frühzeitigen Differentialdiagnose<br />
exemplarisch aufzeigt, wird im folgenden vorgestellt.<br />
Kasuistik:<br />
Bei dem Patienten, der bis zu seinem 60. Lebensjahr zunächst<br />
als Lehrer, danach als Dozent in der Erwachsenenbildung tätig<br />
war, traten ein Jahr nach Erreichen dieser Altersgrenze<br />
zunehmende Wortfindungsprobleme zusammen mit Antriebsminderung<br />
und Gleichgültigkeit sowie einer sich verstärkenden<br />
Orientierungsstörung auf. Einige Monate später<br />
sprach die Ehefrau diese Probleme beim Hausarzt an. Dieser<br />
stellte eine Überweisung zu einem Neurologen aus, der der<br />
Patient aber nicht nachkam. Gleichzeitig verordnete der Hausarzt<br />
ein Durchblutungspräparat, das der Patient über drei<br />
Monate lang eingenommen hat. Als die Ehefrau den Hausarzt<br />
wegen ausbleibender Besserung nach anderen Therapiemöglichkeiten<br />
fragte, wurden in der Praxis 10 Infusionen mit<br />
Piracetam gegeben und diese Behandlung anschließend in<br />
oraler Gabe weitergeführt. Eine persönliche Untersuchung<br />
durch den Hausarzt erfolgte nicht. Etwa ein halbes Jahr nach<br />
der nicht realisierten Überweisung an den Neurologen kam<br />
es bei einem Saunabesuch zu einem Blackout, der auch dem<br />
Hausarzt mitgeteilt wurde. Der Patient nahm dieses Ereignis<br />
zum Anlaß, einen Facharzt aufzusuchen. Dieser hielt eine klinische<br />
Diagnosefindung für unerläßlich, wobei er zunächst<br />
eine Alzheimer-Erkrankung vermutete. In der Neurologischen<br />
Klinik fand sich als Ursache für die Symptome ein linksfrontales<br />
Meningeom mit ausgeprägtem perifokalem Ödem, Mit-<br />
AUSGABE 6 / <strong>2007</strong> 17. JAHRGANG<br />
tellinienverlagerung und beginnender Blockade des Foramen<br />
Monroe. Operativ ergab sich ein anaplastisches Meningeom<br />
mit Zeichen maligner Entartung, weshalb sich eine Radiotherapie<br />
anschloß. Postoperativ folgten keine neurologischen<br />
Ausfälle, auch die Hirnleistungsstörung bildete sich weitgehend<br />
zurück.<br />
Der Vorwurf des Patienten an den Hausarzt lautete, er<br />
habe ihn medikamentös falsch behandelt sowie eine<br />
Verzögerung bzw. die Unterlassung der Diagnose eines<br />
Hirntumors mit der Folge einer postoperativen Radiotherapie<br />
wegen dessen Entartung zu verantworten.<br />
Der Hausarzt führt in seiner Stellungnahme aus, daß die Ehefrau<br />
des Patienten stets mit festen, auf sachkundige Informationen<br />
ihr bekannter Fachärzte aufgebauten Vorstellungen<br />
in seine Sprechstunde gekommen sei. So habe sie auch bei<br />
beginnender Symptomatik in dessen Abwesenheit eine Überweisung<br />
für ihren Mann zu einem Neurologen wegen zunehmender<br />
Hirnleistungsschwäche erbeten. Diesem Wunsch sei<br />
er nachgekommen, zumal die Ehefrau die Dringlichkeit ihres<br />
Anliegens mit ihren Facharztgesprächen untermauert habe<br />
und eine Untersuchung ihres Mannes durch den Hausarzt<br />
auch nicht erwünscht gewesen sei. Er habe die Behandlung<br />
mit hirnleistungsstärkenden Medikamenten so lange festgelegt,<br />
bis die angestrebte Diagnostik abgeschlossen gewesen<br />
sei. Der Patient aus der Nachbarstadt habe ihn lediglich als<br />
Vermittler und nicht als Arzt benutzt. Allerdings räumte er<br />
ein, daß seine Handlungsweise nicht konsequent genug gewesen<br />
sei, denn er hätte den Patienten bereits ab dem Zeitpunkt,<br />
als er seiner Überweisung nicht folgte und sich damit<br />
einer Diagnose entzogen habe, nicht mehr behandeln dürfen.<br />
Aus dem Gutachten:<br />
RECHT<br />
Nach Meinung des Gutachters war die medikamentöse Behandlung<br />
einer Hirnleistungsstörung über mehrere Monate<br />
hinweg nicht indiziert. Es hätte einer neurologischen Untersuchung<br />
zur Diagnosesicherung bedurft. Zwar habe der Hausarzt<br />
die Überweisung zum Neurologen ausgestellt, diese<br />
Untersuchung sei jedoch unterblieben. Der Gutachter monierte<br />
daher, daß der Hausarzt nicht mit Nachdruck auf dieser<br />
Untersuchung bestanden habe, so daß sie erst mit sechsmonatiger<br />
Verspätung erfolgte. Insofern erkennt der Gutachter<br />
bei dem Patienten ein Mitverschulden an der Diagnosever-<br />
SEITE 213