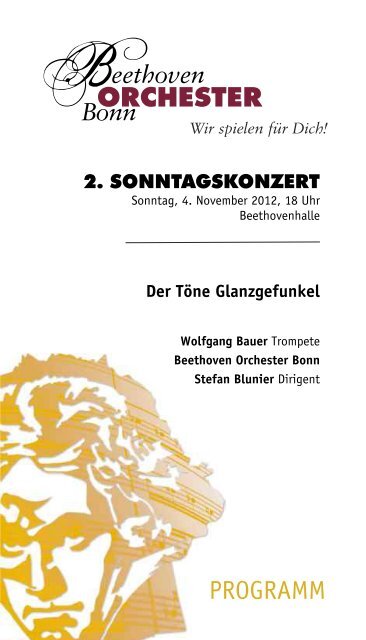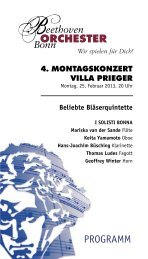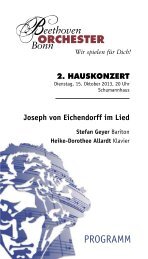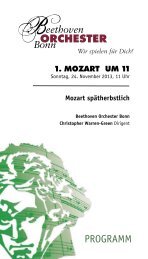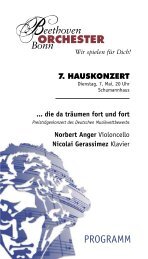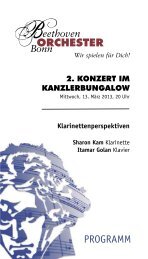Wir spielen für Dich! - Das Beethoven Orchester Bonn
Wir spielen für Dich! - Das Beethoven Orchester Bonn
Wir spielen für Dich! - Das Beethoven Orchester Bonn
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wir</strong> <strong>spielen</strong> <strong>für</strong> <strong>Dich</strong>!<br />
2. SONNTAGSKONZERT<br />
Sonntag, 4. November 2012, 18 Uhr<br />
<strong>Beethoven</strong>halle<br />
Der Töne Glanzgefunkel<br />
Wolfgang Bauer Trompete<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Stefan Blunier Dirigent<br />
PROGRAMM
<strong>Wir</strong> <strong>spielen</strong> <strong>für</strong> <strong>Dich</strong>!<br />
Klingt gut!<br />
Immer wissen, was gespielt wird:<br />
Kostenlos unseren Newsletter abonnieren!<br />
www.beethoven-orchester.de<br />
Besuchen Sie uns doch mal bei facebook!<br />
Foto: Barbara Aumüller
Programm<br />
Der Töne Glanzgefunkel<br />
Joseph Haydn (1732-1809)<br />
Sinfonie Nr. 6 D-Dur Hob. I/6 „Le matin“ (1761)<br />
Adagio – Allegro<br />
Adagio – Andante<br />
Menuetto – Trio<br />
Finale – Allegro<br />
Arvo Pärt (*1935)<br />
Concerto Piccolo über B-A-C-H<br />
<strong>für</strong> Trompete, Streichorchester, Cembalo<br />
und Klavier (1964/94)<br />
Preciso – Lento –<br />
Deciso<br />
PAUSE<br />
<strong>Das</strong> Konzert<br />
wird am 21.11.2012<br />
um 20.05 Uhr<br />
auf WDR 3 (Hörfunk)<br />
übertragen.<br />
Joseph Haydn<br />
Sinfonie Nr. 7 C-Dur Hob. I/7 „Le midi“ (1761)<br />
Adagio – Allegro<br />
Recitativo<br />
Adagio<br />
Menuetto – Trio<br />
Finale. Allegro
4<br />
Arvo Pärt<br />
Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte ...<br />
(1976/1994/2001)<br />
Joseph Haydn<br />
Sinfonie Nr. 8 G-Dur Hob. I/8 „Le soir“ (1761)<br />
Allegro molto<br />
Andante<br />
Menuetto – Trio<br />
Presto: „La Tempesta”<br />
Günter Valléry Flöte<br />
Mikhail Ovrutsky Violine<br />
Maria Geißler Violine<br />
Grigory Alumyan Violoncello<br />
Ingo Klatt Kontrabass<br />
Wolfgang Bauer Trompete<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Stefan Blunier Dirigent<br />
17.25 Uhr: Einführung mit Stefan Blunier<br />
Haydn, der bahnbrechende Sinfoniker<br />
NachKlang mit Stefan Blunier und Wolfgang Bauer<br />
im Anschluss an das Konzert, Nordfoyer der<br />
<strong>Beethoven</strong>halle
Besetzung<br />
Joseph Haydn Sinfonie Nr. 6 D-Dur Hob. I/6 „Le matin“<br />
Entstanden: 1761 in Eisenstadt<br />
1 Flöte 2 Hörner<br />
2 Oboen<br />
1 Fagott<br />
Cembalo<br />
Streicher<br />
Arvo Pärt Concerto Piccolo über B-A-C-H<br />
<strong>für</strong> Trompete, Streichorchester, Cembalo und Klavier<br />
Entstanden: 1964/1994<br />
Cembalo, Klavier<br />
Streicher<br />
Piccolo-Trompete<br />
Joseph Haydn Sinfonie Nr. 7 C-Dur Hob. I/7 „Le midi“<br />
Entstanden: 1761 in Eisenstadt<br />
2 Flöten 2 Hörner<br />
2 Oboen<br />
1 Fagott<br />
Cembalo<br />
Streicher<br />
Arvo Pärt Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte ...<br />
Entstanden: 1976/1994/2001<br />
1 Flöte (auch Picc) 1 Horn<br />
1 Oboe<br />
1 Klarinette<br />
1 Fagott<br />
Klavier<br />
Schlagzeug<br />
Streicher<br />
Joseph Haydn Sinfonie Nr. 8 G-Dur Hob. I/8 „Le soir“<br />
Entstanden: 1761 in Eisenstadt<br />
1 Flöte 2 Hörner<br />
2 Oboen<br />
1 Fagott<br />
Cembalo<br />
Streicher<br />
5
6<br />
Caspar David Friedrich, Der Morgen (um 1821)<br />
Haydns Sonne –<br />
geistvoll und herzerwärmend<br />
Joseph Haydn, Sinfonien Nr. 6 - 8 Hob. I/6-8<br />
Als Joseph Haydn am 1. Mai 1761 von Paul Anton Fürst<br />
Esterházy als Vizekapellmeister angestellt wurde und damit <strong>für</strong><br />
die nächsten dreißig Jahre die musikalischen Geschicke des<br />
Hofes in Eisenstadt bestimmte, war er bereits 29 Jahre alt.<br />
Selbstverständlich hatte Haydn bis dahin schon aussagekräfti-<br />
ge Empfehlungsschreiben komponiert, darunter fanden sich<br />
Klaviertrios und Streichquartette, aber auch erste Sinfonien.<br />
Bevor Haydn jedoch bei seinem neuen Dienstherrn ganz offi-<br />
ziell seinen Einstand als Komponist gab, durfte er zunächst das<br />
Hoforchester umstrukturieren, was dem eigentlichen Hofka-<br />
pellmeister Gregor Joseph Werner wohl gar nicht geschmeckt<br />
haben mag. Ihm blieb immerhin noch bis 1766 die alleinige<br />
Leitung der <strong>für</strong>stlichen Kirchenmusik. Doch die Instrumental-<br />
musik lag ab sofort fest in den Händen von Haydn. Für die
Feuertaufe des zum Teil neu besetzten <strong>Orchester</strong>s komponierte<br />
er auf einen Schlag gleich drei Sinfonien, die den Titel „Die<br />
Tageszeiten“ tragen.<br />
Die Bezeichnung geht aber<br />
nicht auf Haydn zurück,<br />
sondern auf einen seiner<br />
ersten Biographen. So<br />
schrieb Albert Christoph<br />
Dies 1810 über die Entste-<br />
hung der Sinfonien: „Dieser<br />
Herr [gemeint ist Paul Anton<br />
Fürst Esterházy] gab Haydn<br />
die vier Tageszeiten zum<br />
Thema einer Komposition: er<br />
setzte dieselben in Form von<br />
Quartetten in Musik.“ <strong>Das</strong> ist natürlich nicht ganz korrekt, denn<br />
Haydn hatte keine Quartette geschrieben, sondern Sinfonien.<br />
Ein viertes „Tageszeiten“-Werk, das sich ganz um die Nacht<br />
drehen müsste, existiert nicht. <strong>Das</strong>s der Fürst den Anstoß zu<br />
dem sinfonischen Zyklus gegeben hat, darf zumindest als<br />
glaubhaft gelten, denn vergleichbare Programmmusiken wie<br />
Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und sogar der von Gregor Joseph<br />
Werner stammende „Instrumental-Calender“ über die zwölf<br />
Monate hatten Esterházys Geschmack getroffen.<br />
Joseph Haydn, Ölgemälde<br />
von Thomas Hardy (1791)<br />
Haydn gab 1761 mit den Sinfonien „Le matin“ (Der Morgen),<br />
„Le midi” (Der Mittag) und „Le soir“ (Der Abend) seinen<br />
Einstand am Hofe und schlug mit ihnen gleich zwei Fliegen mit<br />
einer Klappe: Neben dem gewünschten musikalischen Tages-<br />
ablauf konnte Haydn die Qualität seiner <strong>Orchester</strong>musiker<br />
7
8<br />
begutachten. Schließlich sind die drei Sinfonien auch gespickt<br />
mit Solo-Passagen <strong>für</strong> unterschiedliche Instrumente. So wird<br />
Haydn dem italienischen Konzertmeister Luigi Tomasini<br />
speziell die langsamen Sätze der Sinfonie Nr. 6 D-Dur Hob. I/6<br />
„Le matin“ und Sinfonie Nr. 7 C-Dur Hob. I/7 „Le midi“ in die<br />
Finger geschrieben haben. Die markanten Cello-Stellen, die<br />
sich durch alle drei Sinfonien ziehen, galten wohl jenem<br />
Joseph Weigl, dem Haydn auch ein Cello-Konzert widmen soll-<br />
te. Darüber hinaus bedachte Haydn mit ausgeprägten Stellen<br />
<strong>für</strong> Fagott, Oboen und Hörner die Musiker, die er kurz zuvor<br />
engagiert hatte.<br />
Wenngleich sich einzelne Instrumente aus dem Tutti heraus-<br />
schälen, miteinander konzertieren und damit an das Prinzip<br />
des barocken Concerto grosso anknüpfen, weht durch die<br />
Sinfonien jedoch der Geist der Aufklärung. Feinster Humor<br />
blitzt da ebenso in den Gesprächen zwischen den Musikern auf<br />
wie gelöste Stimmung und intellektueller Gedankenaustausch.<br />
Nichts knüpft hier mehr schematisch an Traditionen an, viel-<br />
mehr wird man Ohrenzeuge von der Einladung, die Welt mit<br />
seinem eigenen Geist neu zu erkunden.<br />
Kein Wunder, dass Haydn daher kaum auf die musikalisch<br />
plakative Ausmalung von Natur zurückgriff, wie es noch Vivaldi<br />
oder gar der Franzose Jean-Féry Rebel mit seiner Weltenste-<br />
hungsmusik „Les Eléments“ zu tun pflegten. „Jede Mahlerey,<br />
nachdem sie in der Instrumentalmusik zu weit getrieben,<br />
verliert“ – diesen Satz, der Ludwig van <strong>Beethoven</strong> während der<br />
Arbeit an seiner „Pastorale“ durch den Kopf ging, hatte Haydn<br />
schon in Grundzügen in seinen „Tageszeiten“-Sinfonien<br />
beherzigt.
Dennoch löst so manche Passage sofort „inhaltliche“ Assozia-<br />
tionen aus: So kann man die langsame Einleitung der „Mor-<br />
gen“-Sinfonie als „Sonnenaufgang“ hören. <strong>Das</strong> „La Tempesta”-<br />
Finale der „Abend“-Sinfonie Nr. 8 G-Dur Hob. I/8 könnte als<br />
schnittige Vorstudie zur „Gewitter“-Szene gelten, die Haydn<br />
1801 in seinem Oratorium „Die Jahreszeiten“ inszenierte, und<br />
mit dem langsamen Satz von „Le matin“ mag Haydn sogar eine<br />
kleine Parodie auf die morg-<br />
endlichenMusikunter- richtsstunden hinterlassen<br />
haben, in denen Gesangs-<br />
lehrer ihren Schülern eine<br />
bestimmte Harmoniefolge<br />
eintrichtern. So sehr sich<br />
diese Deutung in der<br />
Haydn-Rezeption etabliert<br />
hat, so ist sie doch weiter-<br />
hin nur Spekulation. Gesi-<br />
chert hingegen ist, dass Haydn <strong>für</strong> den Eröffnungssatz von „Le<br />
soir“ eine damals weit verbreitete Volks-Melodie verarbeitet<br />
hat, die kurz zuvor Christoph Willibald Gluck in seiner Opéra<br />
comique „Le diable à quatre“ neu vertont hatte. Für den Gluck-<br />
Connaisseur Paul Anton Fürst Esterházy muss allein diese klei-<br />
ne Haydn-Überraschung nicht nur ein großes Vergnügen gewe-<br />
sen sein. Esterházy war wohl danach endgültig überzeugt, mit<br />
Haydn genau den Richtigen angestellt zu haben.<br />
Paul II. Anton Esterházy<br />
de Galantha<br />
9
10<br />
Mit Bach im Klanggarten<br />
Arvo Pärt, Concerto Piccolo über B-A-C-H und<br />
„Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte ...“<br />
Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die Musikland-<br />
schaften des ehemaligen Imperiums vollends wieder aufge-<br />
blüht, z. B. in Georgien, in der Ukraine oder im Baltikum. Und<br />
besonders Estland, dieser nördlichste und kleinste Flecken<br />
unter den drei baltischen Staaten, macht seit seiner zurück<br />
gewonnenen Souveränität im Jahr 1991 international mehr<br />
denn je von sich reden, auch dank Komponisten wie Erkki-Sven<br />
Tüür und Helena Tulve, die sich stilistisch zwischen Mikrotona-<br />
lität, Rock- und estnischer Volksmusik längst vollkommen frei<br />
bewegen. <strong>Das</strong>s der mächtige Arm des sowjetischen, in Moskau<br />
agierenden Komponistenverbandes über Jahrzehnte aber eben<br />
auch bis in die estnische Hauptstadt Tallinn hinein reichte,<br />
musste Arvo Pärt immer wieder erleben. So wurden in den<br />
1960er Jahren seine avantgardistischen Techniken wie Dode-<br />
kaphonie und Serialität als „westlich dekadent“ gebrandmarkt<br />
und auch seine Hinwendung zur geistlichen Musik rief sofort<br />
die staatlichen Kulturrichter auf den Plan.<br />
Im Gegensatz etwa zu einem Dmitrij Schostakowitsch blieb<br />
Pärt zwar von Gängeleien und Repressionen verschont.<br />
Dennoch entschied er sich 1980, nach Westeuropa zu emigrie-<br />
ren. Seit 1981 lebt und arbeitet er weiterhin unermüdlich in<br />
Berlin. Und wenngleich Pärt es mit seinen meditativen,<br />
oftmals schmucklos schlichten Kompositionen nie in den<br />
Kreis der westlichen Neue Musik-Szene schaffte, verdankt sich<br />
sein Ruhm in der breiten Öffentlichkeit auch solchen
Star-Interpreten wie Violinist Gidon Kremer und dem Kronos<br />
Quartet.<br />
Der strenge Katholik hat in den letzten beiden Jahrzehnten<br />
stets auch mit groß angelegten Vokalwerken sein Credo unter-<br />
mauert, dass jede Musik eigentlich religiös sei. Für Pärt stand<br />
gerade in den 1960er Jahren die Beschäftigung mit alten und<br />
aktuellen Kompositions-<br />
modellen im Mittelpunkt,<br />
und bei seinen polystilis-<br />
tisch angelegten, mit<br />
Klangzitaten <strong>spielen</strong>den<br />
Werken tauchte vor allem<br />
immer wieder der Name<br />
„Bach“ auf. 1968 machte er<br />
ein Präludium aus dem<br />
„Wohltemperierten Klavier“<br />
zum Fundament <strong>für</strong> sein<br />
„Credo“ <strong>für</strong> Klavier, Chor und <strong>Orchester</strong>. Gleichzeitig verewigte<br />
Pärt den Thomaskantor auch namentlich in manchen Werken,<br />
wie z. B. in seiner „Collage zu B-A-C-H“ <strong>für</strong> Kammerorchester<br />
von 1964, auf der sein drei Jahrzehnte später entstandenes<br />
„Concerto Piccolo über B-A-C-H“ <strong>für</strong> Trompete, Streichorches-<br />
ter, Cembalo und Klavier basiert.<br />
Arvo Pärt in Dublin (2008)<br />
Pärt baute in seiner Collage aber nicht nur den ersten Satz auf<br />
den vier Bach-Buchstaben auf. Für die Melodie des langsamen<br />
Satzes wählte er ein Zitat aus der 6. Englischen Suite von Bach,<br />
und im Finalsatz bearbeitete er das B-A-C-H-Thema in bester<br />
kontrapunktischer Tradition. Über seinen schöpferischen<br />
11
12<br />
Umgang mit der abendländischen Musikgeschichte hat Pärt<br />
einmal rückblickend geschrieben: „Meine Collagen waren ein<br />
Versuch, eine Blume in fremder Umgebung neu einzupflanzen<br />
(das Problem der Gewebeanpassung: wenn sie miteinander<br />
verwachsen, so war die Transplantation der richtige Eingriff).<br />
Hierbei stand jedoch die Idee der Verpflanzung nicht im Vorder-<br />
grund – vielmehr wollte ich eine einzige Blume selber züchten.“<br />
Schon die Urfassung des „Concerto Piccolo“ entpuppte sich als<br />
solch eine Züchtung, denn trotz ihrer barocken Züge pflanzte<br />
Pärt dem Getriebe minimalistisch keimende Kraftzellen ein,<br />
und in den 2. Satz mischen sich über plötzliche Akkordballun-<br />
gen gar Fremdkörper, die die sanfte Aria-Stimmung geradezu<br />
schockierend stören.<br />
<strong>Das</strong> Grundgefüge dieser Bach-Collage behielt Pärt 1994 bei, als<br />
er von dem estnischen Dirigenten Neemi Järvi gebeten wurde,<br />
das Werk <strong>für</strong> die Göteburger Symphoniker und den schwedi-<br />
schen Trompeter Håkan Hardenberger zu einem Konzert auszu-<br />
arbeiten. In das unerbittlich motorisch vorantreibende Getrie-<br />
be steigt der Trompeter mit atemberaubendem Skalenspiel ein.<br />
Die wunderschöne Melodie des „Lento“, die in der 1. Fassung<br />
noch von der Oboe gespielt wurde, veredelt jetzt das Blech-<br />
blasinstrument. Im Finale führt die Trompete fast ein Eigenle-<br />
ben, denn eine Lücke, um sich in die vom <strong>Orchester</strong> gestaltete<br />
Fugen-Prozession einzureihen, wird sie nirgends finden.<br />
Pärt sollte Johann Sebastian Bach aber auch 1976 noch ein<br />
weiteres Denkmal setzen. Mit einem Werk <strong>für</strong> Bläser, Cembalo<br />
und Tonband, das den sonderlichen Titel „Wenn Bach Bienen<br />
gezüchtet hätte ...“ trägt. 1984 überarbeitete Pärt das Stück
zum ersten Mal und 2001<br />
schließlich <strong>für</strong> die Beset-<br />
zung „Klavier, Bläserquin-<br />
tett und Streicher“. Grund-<br />
lage <strong>für</strong> dieses zweigeteilte<br />
Werk bildete erneut das<br />
B-A-C-H-Motiv, aber auch<br />
das h-Moll-Präludium aus<br />
dem „Wohltemperierten<br />
Klavier“.<br />
Im ersten Teil scheint man<br />
tatsächlich in den Streichern einen umhersausenden Bienen-<br />
schwarm auszumachen, doch das minimalistische Geschehen<br />
nimmt regelrecht dramatische Züge über einen stoischen<br />
Marsch-Rhythmus sowie Klangmetamorphosen an, die einen<br />
sogar an Wagner denken lassen. Mit dem zweiten Teil kippt die<br />
Stimmung völlig um. Über einen Schreit-Bass erreicht das<br />
<strong>Orchester</strong> einen magischen Schwebezustand, in dem sich<br />
Schmerz, Leid und Vergänglichkeit ausdrücken. Auch wenn<br />
Pärt später sagen sollte, dass jene Musik keinen Sinn mehr<br />
macht, in der man nur noch zitiert, ist ihm mit dieser Bach-<br />
Hommage eine zeitgemäße wie bewegende Annäherung<br />
gelungen.<br />
Johann Sebastian Bach (1746)<br />
Guido Fischer<br />
13
14<br />
Wolfgang Bauer Trompete<br />
Foto: Risch<br />
Wolfgang Bauer<br />
Wolfgang Bauer studierte an der Karajan-Stiftung der Berliner<br />
Philharmoniker bei Konradin Groth, sowie bei Lutz Köhler und<br />
Edward H. Tarr. Seit er 1993 den ARD-Wettbewerb in München<br />
und den Deutschen Musikwettbewerb in <strong>Bonn</strong> gewann, zählt<br />
er zu den führenden Trompetern seiner Generation. Er hatte<br />
aufeinander folgende Verträge als Solotrompeter der Münch-<br />
ner Philharmoniker, dem RSO Frankfurt und dem Symphonie-<br />
orchester des Bayerischen Rundfunks. Als Solist, <strong>Orchester</strong>-<br />
und Kammermusiker reiste er durch weite Teile Europas,<br />
Asiens, Nord- und Südamerikas und gastierte bei zahlreichen<br />
renommierten Festivals, wie dem Schleswig-Holstein-<br />
Festival. Wolfgang Bauer trat als Solist u. a. mit dem Royal<br />
Philharmonic Orchestra London, dem Orchestre National de<br />
France, dem London Philharmonic Orchestra, den Radiosinfo-<br />
nieorchestern des SWR Stuttgart, des hr Frankfurt, des WDR
Köln, des Bayerischen Rundfunks München auf, u. a. als Part-<br />
ner von Lorin Maazel, Fabio Luisi, Eliahu Inbal, Maurice André,<br />
Oleg Maisenberg und Evelyn Glennie.<br />
Etablierter Bestandteil seiner künstlerischen Arbeit sind die<br />
von ihm ins Leben gerufenen Ensembles <strong>für</strong> Barockmusik<br />
„Wolfgang Bauer Consort“ und Blechbläserkammermusik „CITY<br />
BRASS Stuttgart“, das 2007 mit dem hoch dotierten Förder-<br />
preis der Bruno-Frey-Stiftung der Baden-Württembergischen<br />
Landesakademie ausgezeichnet wurde. Seit 2000 ist er Pro-<br />
fessor <strong>für</strong> Trompete an der Stuttgarter Musikhochschule, zuvor<br />
leitete er die Trompetenklasse an der Musikhochschule der<br />
Basler Musikakademie. Sein Schaffen wurde auf zahlreichen<br />
CD-Produktionen dokumentiert. <strong>Das</strong> Internetforum „Sound-<br />
stage“ zeichnete ihn mit der „Best Recording of 2008“ aus,<br />
2009 erhielt er den ECHO Klassik als Instrumentalist des<br />
Jahres.<br />
15
16<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Foto: Thilo Beu<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Den Ruf der Stadt <strong>Bonn</strong> im Geiste <strong>Beethoven</strong>s bei Konzerten in<br />
die Welt zu tragen, ist den Musikerinnen und Musikern des<br />
<strong>Orchester</strong>s ein wesentliches Anliegen. Die Präsentation ausgefal-<br />
lener Programme ist dabei ein Hauptgedanke der künstlerischen<br />
Arbeit. Exemplarisch hier<strong>für</strong> stehen die CD- und SACD-<br />
Aufnahmen der „Leonore 1806“ – einer Frühfassung von Beet-<br />
hovens Oper „Fidelio“, die SACD-Produktionen des Oratoriums<br />
„Christus“ von Franz Liszt und der Oper „Der Golem“ von Eugen<br />
D’Albert, beide mit einem ECHO Klassik-Preis ausgezeichnet. Der<br />
„Preis der deutschen Schallplattenkritik“ sowie ein weiterer ECHO<br />
Klassik 2012 <strong>für</strong> die Einspielung der Oper „Irrelohe“ von Franz<br />
Schreker ist eine schöne Bestätigung <strong>für</strong> dieses Engagement.<br />
Was Richard Strauss als einer der ersten Gastdirigenten des<br />
<strong>Orchester</strong>s begann, setzten später Max Reger, Sergiu Celibidache,
Dennis Russell Davies und Kurt Masur fort: Sie führten das<br />
<strong>Orchester</strong> zur Spitzenklasse in Deutschland. Seit der Saison<br />
2008/2009 ist Stefan Blunier Generalmusikdirektor. Mit großer<br />
Leidenschaft berührt er das Publikum und begleitet es auf der<br />
überwältigenden musikalischen Reise. Neben der Opern- und<br />
Konzerttätigkeit (ca. 40 Konzerte und 120 Opernaufführungen<br />
pro Saison) bildet die Kinder- und Jugendarbeit unter dem Titel<br />
„Bobbys Klassik“ einen wichtigen Schwerpunkt. Thomas Honi-<br />
ckel, Konzertpädagoge des <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong>, steht<br />
dabei als Garant <strong>für</strong> musikalische Bildung, Entertainment und<br />
Kreativität. 2009 und 2011 wurde das erfolgreiche Education-<br />
Programm mit dem begehrten ECHO Klassik-Preis ausgezeichnet.<br />
Über das Neujahrsfest 2012 erlebte das <strong>Orchester</strong> seine erste<br />
China-Tournee. Sechs ausverkaufte Konzerte, ca. 10.000 Besu-<br />
cher, mehrere TV- und Radio-Übertragungen und ein hingerisse-<br />
nes Publikum zeigten: <strong>Das</strong> <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> konnte<br />
seinen Ruf als exzellentes <strong>Orchester</strong> weit über <strong>Bonn</strong> hinaus<br />
bestätigen.<br />
Foto: Felix von Hagen<br />
<strong>Das</strong> <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> in Guangzhou (China), 31.12.2011<br />
17
18<br />
Stefan Blunier<br />
Foto: Barbara Aumüller<br />
Stefan Blunier<br />
Der 1964 in Bern geborene Dirigent Stefan Blunier studierte in<br />
seiner Heimatstadt und an der Folkwang Hochschule Essen<br />
Klavier, Horn, Komposition und Dirigieren. Nach Stationen in<br />
Mainz, Augsburg und Mannheim, war er bis 2008 Generalmusik-<br />
direktor am Staatstheater Darmstadt. Am 1. August 2008 über-<br />
nahm Stefan Blunier die Position des Generalmusikdirektors der<br />
<strong>Beethoven</strong>stadt <strong>Bonn</strong>. Stefan Blunier gastierte bei über 90<br />
Sinfonieorchestern in Europa und Asien. Gastdirigate übernahm<br />
er an den Opernhäusern in London, München, Hamburg, Leipzig,<br />
Stuttgart und Berlin sowie in Montpellier, Oslo und Bern.<br />
Seine Konzertprogrammgestaltungen haben das Publikum in<br />
den vergangenen Spielzeiten begeistert. Unter seiner charis-<br />
matischen Führung zog ein neues musikalisches Bewusstsein
im <strong>Orchester</strong> und Publikum ein. Der Erfolg des Dirigenten mit<br />
dem <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> hat überregionales Interesse<br />
an der Musik aus <strong>Bonn</strong> geweckt. Stefan Blunier produziert CDs<br />
<strong>für</strong> SONY, CPO und MDG. Seine CD-Einspielungen mit dem<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> (Arnold Schönberg, Franz Schmidt,<br />
Eugen d’Albert, Anton Bruckner u. a.) offenbaren musikalische<br />
Raritäten und werden von der Fachpresse in höchsten Tönen<br />
gelobt. Für die CD-Einspielungen der Opern „Der Golem“ von<br />
Eugen d´Albert und „Irrelohe“ von Franz Schreker wurde er<br />
gemeinsam mit dem <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> jeweils mit<br />
dem ECHO Klassik-Preis ausgezeichnet. Seinen Vertrag als Gene-<br />
ralmusikdirektor in der <strong>Beethoven</strong>stadt <strong>Bonn</strong> hat Stefan<br />
Blunier bis 2016 verlängert.<br />
Mit Beginn der Saison 2010/2011 wurde Stefan Blunier zum<br />
„Premier Chef Invité” des Orchestre National de Belgique in<br />
Brüssel ernannt.<br />
Über die Jahreswende 2011/2012 reiste GMD Blunier mit dem<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> nach China, und gab u. a. in den<br />
Metropolen Hong Kong, Shanghai und Peking umjubelte<br />
Konzerte.<br />
19
THEATER- UND KONZERTKASSE<br />
Tel. 0228 - 77 8008<br />
Windeckstraße 1, 53111 <strong>Bonn</strong><br />
Fax: 0228 - 77 5775, theaterkasse@bonn.de<br />
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr, Sa von 9.00 - 16.00 Uhr<br />
Tel. Vorbestellung: Mo - Fr 10.00 - 15.30 Uhr, Sa 9.30 - 12.00 Uhr<br />
Kasse in den Kammer<strong>spielen</strong><br />
Am Michaelshof 9, 53177 Bad Godesberg<br />
Tel. 0228 - 77 8022<br />
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr,<br />
Sa 9.00 - 12.00 Uhr<br />
print@home: Karten buchen & drucken von zu Hause aus<br />
BONNTICKET: 0228 - 50 20 10, www.bonnticket.de<br />
Fax: 0228 - 910 41 914, order@derticketservice.de<br />
IMPRESSUM<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Generalmusikdirektor<br />
Stefan Blunier<br />
Wachsbleiche 1<br />
53111 <strong>Bonn</strong><br />
Tel. 0228 - 77 6611<br />
Fax 0228 - 77 6625<br />
info@beethoven-orchester.de<br />
www.beethoven-orchester.de<br />
Redaktion<br />
Markus Reifenberg<br />
Brigitte Rudolph<br />
Texte<br />
Guido Fischer<br />
Gestaltung<br />
res extensa, Norbert Thomauske<br />
Druck<br />
Druckerei Scholl, <strong>Bonn</strong><br />
Bildnachweise:<br />
Für die Überlassung der Fotos<br />
danken wir den Künstlern und<br />
Agenturen.<br />
HINWEISE<br />
<strong>Wir</strong> möchten Sie bitten, während des<br />
gesamten Konzertes Ihre Mobiltelefone<br />
ausgeschaltet zu lassen.<br />
<strong>Wir</strong> bitten Sie um Verständnis, dass<br />
wir Konzertbesucher, die zu spät<br />
kommen, nicht sofort einlassen<br />
können. <strong>Wir</strong> bemühen uns darum,<br />
den Zugang zum Konzert so bald<br />
wie möglich – spätestens zur Pause<br />
– zu gewähren. In diesem Fall<br />
besteht jedoch kein Anspruch auf<br />
eine Rückerstattung des Eintrittspreises.<br />
<strong>Wir</strong> machen darauf aufmerksam,<br />
dass Ton- und/oder Bildaufnahmen<br />
unserer Aufführungen durch jede<br />
Art elektronischer Geräte strikt<br />
untersagt sind. Zuwiderhandlungen<br />
sind nach dem Urheberrechtsgesetz<br />
strafbar.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
behält sich notwendige Programm-<br />
und Besetzungsänderungen vor.
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Wachsbleiche 1<br />
53111 <strong>Bonn</strong><br />
Tel: +49 (0) 228-77 6611<br />
Fax: +49 (0) 228-77 6625<br />
info@beethoven-orchester.de<br />
www.beethoven-orchester.de<br />
Kulturpartner des<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong>