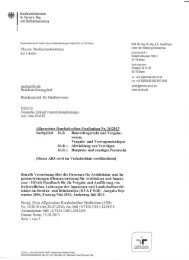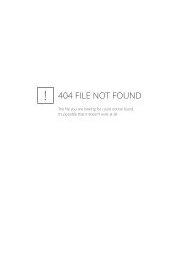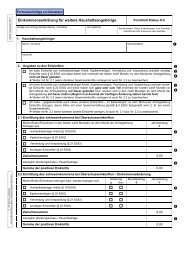Abschlussbericht des Modellvorhabens - Bayerisches ...
Abschlussbericht des Modellvorhabens - Bayerisches ...
Abschlussbericht des Modellvorhabens - Bayerisches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.9 Welche Finanzierungsaspekte sind zu berücksichtigen?<br />
Typisches Beispiel der Förderung durch<br />
Fehlbedarfsfinanzierung:<br />
Marktplatz 13 in Stadtlauringen vor dem Umbau<br />
nanzierungsaspekte in Beziehung setzt<br />
und daraus einen Fehlbetrag errechnet:<br />
Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen,<br />
Finanzierungskosten, geschätzte<br />
Erträge und Bewirtschaftungskosten.<br />
Grundprinzip ist wie bei der Pauschalförderung,<br />
dass der unrentierliche Teil<br />
einer Maßnahme berechnet wird und<br />
der Eigentümer für diesen unrentierlichen<br />
Teil eine Entschädigung erhält,<br />
weil die Investition in ihrer Gesamtheit<br />
im Interesse der Allgemeinheit liegt.<br />
Beide Berechnungsformen gelten unabhängig<br />
davon, wer Eigentümer <strong>des</strong><br />
Gebäu<strong>des</strong> ist.<br />
Förderung von ausgewählten<br />
Fördertatbeständen als Pauschalbeträge<br />
durch kommunale Förderprogramme<br />
Die Gemeinde kann in Erneuerungsgebieten<br />
zur vereinfachten Förderung kleinerer<br />
privater Maßnahmen kommunale<br />
Förderprogramme z. B. zu Fassadeninstandsetzungen<br />
oder Hofbegrünungen<br />
auflegen. Die Gemeinde entscheidet<br />
dabei im Rahmen eines bewilligten<br />
Jahresbudgets über den Mitteleinsatz.<br />
Beispiele für diese Finanzierungsspielart<br />
sind kommunale Fassaden-, Hofflächen-<br />
und Geschäftsflächenprogramme.<br />
Im Hinblick auf die Förderung gilt<br />
es weiterhin zu berücksichtigen, dass<br />
vielfältige Formen der Investitionsvorbereitung<br />
wie z. B. Gutachten, Konzepte<br />
und Pläne unterstützt werden.<br />
Förderung von Eigentumsübergang<br />
In bestimmten Fällen ist der Erwerb<br />
von Gebäuden und Grundstücken<br />
durch die Kommune im Rahmen der<br />
Städtebauförderung förderfähig. Allerdings<br />
wurde dieser Tatbestand in der<br />
Vergangenheit relativ restriktiv behandelt,<br />
weil Erwerb meist einen hohen<br />
Fördermittelverbrauch mit sich bringt.<br />
Wie „Ort schafft Mitte“ zeigt, kann –<br />
gerade in strukturschwachen Räumen<br />
mit niedrigen Immobilienpreisen und<br />
bei andauernden Stillstandssituationen<br />
– vielfach bereits ein begrenzter Mitteleinsatz<br />
für den Ankauf von Gebäuden<br />
und Grundstücken durch die Kommune<br />
den Impuls für einen nachhaltigen Revitalsierungsprozess<br />
darstellen.<br />
Förderung von Neubau<br />
Bei der Förderung von Neubau und<br />
Ersatzneubau wird ein unabweisliches<br />
städtebauliches Interesse zur Sicherung<br />
der Erneuerungsziele voraussetzt.<br />
Grundlage stellt eine Berechnung <strong>des</strong><br />
städtebaulich bedingten Mehraufwands<br />
dar. Im Falle von Wohngebäuden wird<br />
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung<br />
gefordert, im Falle von Nicht-Wohngebäuden<br />
ist für die Förderung eine<br />
Genehmigung <strong>des</strong> Bayerischen Staatsministeriums<br />
<strong>des</strong> Innern, für Bau und<br />
Verkehr erforderlich. Im Hinblick auf<br />
Nachnutzungsperspektiven leerstehender<br />
Gebäude in Ortsmitten ist weiterhin<br />
die Regelung zu Gemeinbedarfs- und<br />
Folgeeinrichtungen (§ 148 BauGB) von<br />
Bedeutung: Auch hier werden Modernisierung<br />
und Instandsetzung bevorzugt.<br />
Erfahrungen aus „Ort schafft Mitte“<br />
Grundsätzlich belegen die vielfältigen<br />
Fortschritte in den Modellkommunen,<br />
dass sich der bestehende Förderrahmen<br />
der Städtebauförderung auch im<br />
Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“<br />
bewährt hat. Dennoch lassen sich auch<br />
Weiterentwicklungspotenziale herausarbeiten,<br />
die den besonderen strukturellen<br />
Rahmenbedingungen der Mehrzahl<br />
der Modellkommunen geschuldet<br />
sind:<br />
Gerade in Regionen mit ausgeprägter<br />
Nachfrageschwäche auf den Immobilienmärkten<br />
ist die erste Leitfrage, wie<br />
die Rolle der Kommune bei der Aufbereitung<br />
von Brachen und Leerständen<br />
gestärkt werden kann. Zu einer nachhaltigen<br />
Nachnutzung solcher Flächen<br />
28