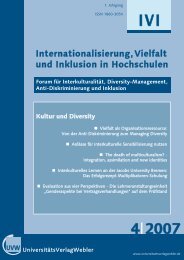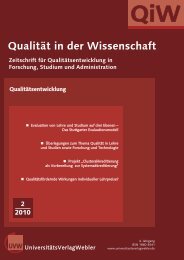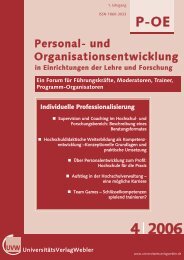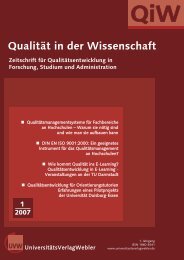Heft 1 + 2 / 2011 - UniversitätsVerlagWebler
Heft 1 + 2 / 2011 - UniversitätsVerlagWebler
Heft 1 + 2 / 2011 - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fo<br />
W.-D. Webler • Konzepte und Prozesse britischer Forschungsförderung (1986-2014). Teil II<br />
kung der Bibliometrie werden Relevanzen und Einflüsse<br />
verschoben, die negativ zu bewerten sind.<br />
Die Lockerung der strikten Bindung an Disziplinarität,<br />
Erweiterung zu einer stärkeren Interdisziplinarität und<br />
zur Berücksichtigung ganzer Forschungsfelder im Teil b)<br />
der Ziele ist sicherlich zu begrüßen.<br />
Die Einführung des impact ist ambivalent, weil sie zwar<br />
positive Perspektiven eröffnet (sie wurden schon dargestellt),<br />
aber mit ihr die Gefahr der Einseitigkeit wirtschaftlicher<br />
Verwertung sowie der Unterschätzung und<br />
Benachteiligung der Grundlagenforschung einzieht. Zu<br />
hoffen bleibt zunächst, dass die gemischte Zusammensetzung<br />
der Panels diese Ambivalenz austariert.<br />
B) Beurteilung der Ziele eines solchen Bewertungssystems<br />
I. Konsens mit einzelnen Zielen<br />
1.) Das generelle Ziel, eine höhere Verantwortlichkeit der<br />
Hochschuleinrichtungen und der einzelnen Forscher<br />
für die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten,<br />
erheblichen Mittel zu erreichen als in der Vergangenheit,<br />
ist zweifellos berechtigt. Dazu gibt es zu<br />
viele Beispiele mangelnden Kostenbewusstseins, von<br />
Gleichgültigkeit und Missbrauch. Aus eigenen zahlreichen<br />
Kontakten mit britischen Wissenschaftlern<br />
ist zu vermuten, dass es ähnliche Verhältnisse gibt<br />
wie in Deutschland: Die Überlegung, ob ein eigenes<br />
Vorhaben den Einsatz von Steuermitteln in der beabsichtigten<br />
Höhe rechtfertigt (auch ein Aspekt der<br />
accountability) ist den Beteiligten i.d.R. völlig fremd.<br />
(“Die Mittel stehen doch im Hochschulhaushalt zur<br />
Verfügung – also warum nicht ausgeben?”).<br />
2.) Auch der Wunsch nach einer Steigerung der Qualität<br />
der damit finanzierten Forschung ist einleuchtend<br />
(value for money). Das bedeutet als eine von<br />
mehreren Folgen, dass die knappen Mittel bei denen<br />
konzentriert werden, die diese Qualität zu liefern<br />
im Stande sind (und sie tatsächlich liefern). Insofern<br />
erscheinen Selektivität und Schwerpunktbildung zunächst<br />
als folgerichtige Schritte.<br />
II. Weitere Ziele erscheinen zumindest ambivalent<br />
1. Die Erwartung, dass Forschung an Hochschulen in<br />
erster Linie kurzfristig erkennbaren (noch dazu zugespitzt:<br />
wirtschaftlichen) Nutzen erbringen soll (Creation<br />
of wealth), ist höchst problematisch. Das erinnert<br />
stark an den Utilitarismus, der bis zum 18. Jh.<br />
herrschte und erst (als späte Folge der Aufklärung)<br />
mit dem Oberziel der Suche nach Erkenntnis und<br />
der Humboldt´schen Idee des Staates als Mäzen der<br />
Wissenschaft abgelöst wurde. Erst dieser Paradigmenwechsel<br />
ermöglichte die moderne Wissenschaftsentwicklung<br />
– einschließlich der breiten Verwertungsmöglichkeiten,<br />
die sich dann doch vielfach aus<br />
Grundlagenforschung ergaben. Gerade die Geschichte<br />
der Grundlagenforschung hat viele Male gezeigt, dass<br />
Forschungsergebnisse erst deutlich später als bahnbrechend<br />
für neue Erkenntnisse erkannt wurden –<br />
aber auch überraschende Verwertungsmöglichkeiten<br />
boten. Diese Verwertungsmöglichkeiten zu verfolgen<br />
ist natürlich legitim. Alles andere wäre realitätsfern.<br />
Aber die Wege der Erkenntnis haben sich häufig als<br />
verschlungener erwiesen, als zunächst erwartet. Für<br />
viele Antworten muss prinzipieller nachgefragt werden,<br />
als den Interessenten zunächst lieb ist; auch in<br />
der Auftragsforschung lassen sich die erhofften Ergebnisse<br />
nicht so geradlinig erzielen wie gewünscht.<br />
2. Ähnlich sieht es mit dem erkennbaren impact der<br />
Forschungen aus. Auf der einen Seite sicherlich eine<br />
lohnende Anstrengung, die Aufmerksamkeit auf diese<br />
Folgen zu lenken. Hier kann sowohl ein höheres Verantwortungsbewusstsein<br />
durch intensivere Reflexion<br />
der Folgen auf Seiten der Wissenschaft entstehen als<br />
auch höhere Anerkennung und höheres Verständnis<br />
für Wissenschaft auf Seiten der Gesellschaft. Auf der<br />
anderen Seite besteht die Gefahr, zu kurz zu greifen<br />
und – wie oben ausgeführt – Forschung allzu leicht<br />
nach ihrem (noch dazu bereits im jeweiligen Erhebungszeitpunkt<br />
des REF erkennbaren) Nutzen zu<br />
beurteilen. Hier wird sowohl Kurzatmigkeit der Forschungsperioden<br />
gefördert als auch tendenziell ein<br />
Forschungstyp, der solche Wirkungen überhaupt<br />
(bald) erkennen lässt. Wie soll die Wirkung Zusammenhänge<br />
erklärender, Sinn stiftender Forschungsergebnisse<br />
(z.B. in Soziologie und Politikwissenschaft),<br />
das verbesserte, gezielt geförderte Aufwachsen von<br />
Kindern durch Pädagogik und Psychologie, Steigerung<br />
des Glücks von Menschen durch zahlreiche geistesund<br />
sozialwissenschaftliche Beiträge, wie die Steigerung<br />
der Lebensqualität durch Kulturwissenschaften,<br />
wie der Beitrag der Literaturwissenschaft zur Ästhetik,<br />
wie die identitätsstärkende Wirkung der Geschichtswissenschaft<br />
erfasst, geschweige denn gemessen und<br />
gestuft werden?<br />
Der Ansatz erinnert an Lothar Späth, der als badenwürttembergischer<br />
Ministerpräsident die Vertreter der<br />
Altorientalistik und Sinologie an den Landesuniversitäten<br />
zu einem Dienstgespräch einlud. Dort eröffnete er den<br />
staunenden Wissenschaftlern, dass Baden-Württemberg<br />
ein Exportland sei und man von ihrer profunden Kenntnis<br />
des Orients und Chinas einen Beitrag zur Exportförderung<br />
erwarte!<br />
C) Wichtige Ziele bzw. Maßnahmen fehlen<br />
1. Mit dem Wettbewerb soll – statt der pauschalen<br />
Gleichheitsannahme – derjenige Teil der Forschung<br />
erkennbar werden, auf den bei knappen Ressourcen<br />
wegen mangelnder Qualität verzichtet werden kann.<br />
Auch dem kann grundsätzlich zugestimmt werden.<br />
Welche Legitimation hätte “schwache” Forschung,<br />
finanziert zu werden? Dieses Verfahren muss also im<br />
Stande sein, Leistungsprofile festzustellen und entsprechend<br />
zu handeln. Aber zum einen müssen dabei<br />
die Qualitätsmaßstäbe stimmen, und zwar im Sinne<br />
langfristiger und nicht allein kurzfristiger Erfolge und<br />
nicht durch einseitige Interessen verfälscht. An der<br />
Geltung solcher Maßstäbe darf jedoch gelegentlich<br />
gezweifelt werden. Zum anderen geht es nicht nur um<br />
Schwäche oder Stärke, die über die Fortführung entscheiden.<br />
In dem Vorgehen fehlt die Frage nach der<br />
inhaltlichen Relevanz in Zukunft. Es muss auch eine<br />
Entwicklungsperspektive für noch zu entwickelnde<br />
Fo 1+2/<strong>2011</strong><br />
45