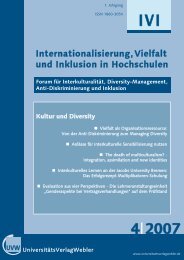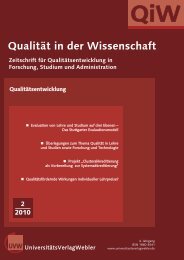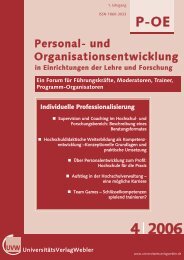Heft 1 + 2 / 2011 - UniversitätsVerlagWebler
Heft 1 + 2 / 2011 - UniversitätsVerlagWebler
Heft 1 + 2 / 2011 - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fo<br />
W.-D. Webler • Konzepte und Prozesse britischer Forschungsförderung (1986-2014). Teil II<br />
spektive; indem sie sich auf Publikationen konzentriert,<br />
bewertet sie immer Vergangenheiten (s.u.).<br />
E) Strukturebene: Gibt es andere, aussichtsreichere Systeme,<br />
deren Einführung versäumt wurde?<br />
US-amerikanische Forschungsfördersysteme werden hier<br />
nicht diskutiert, weil das dortige Mäzenatentum in Großbritannien<br />
in dieser Form nicht existiert und somit die<br />
Systeme nicht übertragbar sind. Aber die Forschungspolitiken<br />
der Schweiz und Deutschlands bzw. deren Förderstrategien<br />
wären es Wert gewesen, hier herangezogen<br />
und geprüft zu werden (s.o.). Durch und durch vorbildlich<br />
zu sein, kann für das deutsche System allerdings auch<br />
nicht reklamiert werden – zu erinnern ist an das Debakel<br />
zunächst fehlender Gesamtplanung für die kleinen Fächer,<br />
das zumindest mit einer Bestandsaufnahme (Karte<br />
kleiner Fächer) aufzuarbeiten begonnen wurde.<br />
F) Aktionsebene: Sind innerhalb des gewählten Systems<br />
Optimierungsmöglichkeiten nicht genutzt worden?<br />
Selbstverständlich bedeutet es eine wichtige Ergänzung<br />
bisheriger Informationsgrundlagen für die Förderentscheidung,<br />
nun auch die Lebendigkeit der Forschungsumgebung<br />
einzubeziehen. Es macht einen Unterschied,<br />
ob einem Autor inmitten vielen Stillstands einmal eine<br />
gute Publikation gelungen ist, oder ob es sich um eine<br />
pulsierende Forschergemeinschaft handelt, aus deren<br />
Mitte heraus Publikationen zustande kommen.<br />
Aber dem System fehlt es an Entwicklungsdynamik, an<br />
Zukunftsbezogenheit. Verknüpft mit den infrastrukturellen<br />
Folgen des Systems besteht ein Schwachpunkt des<br />
Vorgehens darin, dass die bewerteten Leistungen (als<br />
Publikationen) immer solche der Vergangenheit sind.<br />
Von ihr wird auf die Zukunft geschlossen im Sinne der<br />
Verlängerung der Finanzierung, des “weiter so”. Aber<br />
weder scheint es eine Zukunfts-(Infrastruktur-)Planung<br />
gegeben zu haben, noch eine Bewertung überzeugender<br />
Zukunftskonzepte einzelner Hochschulen oder “units of<br />
assessment” innerhalb der Hochschulen. Dazu hätte es<br />
eines Selbstberichts bedurft, wie im Peer Review der<br />
Lehrevaluation. In ihm können Zukunfstkonzepte entwickelt<br />
werden, deren Einlösung dann in den folgenden<br />
Verfahren nachgehalten werden könnte.<br />
Der Bewertungsspunkt “lebendige Forschungsumgebung”<br />
könnte zu einer Gelegenheit ausgebaut werden,<br />
bei der junge, bisher wenig bedeutsame Forscher/innen<br />
mit Hilfe überzeugender Zukunftskonzepte (im Rahmen<br />
der Prozentanteile dieses Bewertungspunktes) eine<br />
Aufbesserung ihrer Forschungsinfrastruktur bekommen<br />
könnten. Im Fall positiver Begutachtung hätten sie bessere<br />
Chancen, sich bis zum nächsten Verfahren mit weiteren,<br />
förderwürdigen Leistungen auszuweisen. (Zu weiteren<br />
Details s.u. Ziff. 6.3).<br />
G) Aktionsebene: Einschätzung des legitimatorischen<br />
bzw. partizipatorischen Prozesses bei Neuaufbau und<br />
Einführung – ein partizipatives Modell für Deutschland?<br />
Die Abfolge von Beratungsvorlagen, Anhörungen, Überarbeitungen,<br />
Informationen über den Sachstand und<br />
deren Transparenz sowie öffentliche Zugänglichkeit<br />
können vorbildlich genannt werden. Großbritannien<br />
besticht ausländische Beobachter immer wieder durch<br />
stärker ausgeprägte partizipative Verfahren als im Herkunftsland<br />
der Beobachter. Sie sind natürlich Ergebnis<br />
historischer Erfahrungen – auch jüngster Erfahrungen<br />
– mit der Entwicklung, Entscheidung und Durchführung<br />
von Neuerungen und den mit ihrer Einführung verbundenen<br />
Konflikten. Das galt für Großbritannien sowohl<br />
für die Erfahrungen mit der Lehrevaluation im Wege des<br />
zweistufigen Peer Review seit Mitte der 80er Jahre, als<br />
auch praktisch zeitgleich für das RAE, bei denen immer<br />
wieder der Vorwurf mangelnder Aufklärung und Einbeziehung<br />
von Betroffenen erhoben wurde. Ähnlich negative<br />
Erfahrungen sind (relativ wenig spektakulär) in den<br />
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Deutschland mit<br />
der Sanierung von Stadtteilen gemacht worden, medial<br />
sichtbar eher nur bei Hausbesetzungen bzw. deren Räumung.<br />
Kaum wahrgenommen wurde aber die Einführung<br />
von Partizipationsformen, wie Stadtteil- bzw. Bürgerbüros<br />
und von Zukunftswerkstätten, die eine prominent<br />
gewordene Form der Bürgerbeteiligung geworden sind<br />
neben vielen anderen, wenig bekannten, wie der “Planungszelle”<br />
usw. In Deutschland sind neue, spektakuläre<br />
Formen der Partizipation erst wieder im Zusammenhang<br />
mit dem Projekt Stuttgart 21 entwickelt worden.<br />
Das britische Partizipationsverfahren ist teilweise an<br />
feste Regeln gebunden, teilweise frei gestaltbar. Das<br />
Vorgehen kann an der Entwicklung des REF erneut studiert<br />
werden. Relativ normal bei Regierungshandeln sind<br />
“green papers” und “white papers” (etwa unserem Referentenentwurf<br />
und 1. Gesetzesentwurf vergleichbar, verbunden<br />
mit gezielten Anhörungen von Betroffenen und<br />
externen Experten). Viele Elemente sind durchaus auch<br />
in Deutschland anzutreffen. Aber sie werden in Großbritannien<br />
intensiver, konsequenter und damit wirksamer<br />
eingesetzt. Im Zeitalter elektronischer Möglichkeiten<br />
werden – über die sorgfältige Einbindung diverser inund<br />
ausländischer Experten und Gesellschaften hinaus<br />
– breite Veröffentlichungschancen und offene Einladungen<br />
zu Stellungnahmen in dem hier betrachteten Entwicklungsprozess<br />
des REF in zwei Konsultationen eingesetzt,<br />
die 534 Antworten nicht nur sorgfältig ausgewertet,<br />
sondern alle Antworten sogar wieder öffentlich zugänglich<br />
gemacht haben (“A summary of the responses<br />
is now available at www.hefce.ac.uk/ref alongside the<br />
consultation document (HEFCE 2009/38)”). Besonders<br />
bemerkenswert ist am britischen Verfahren:<br />
- die sorgfältige, höchst partizipative Vorgehensweise<br />
bei der Entwicklung von Kriterien und Verfahren (stärker<br />
als in D),<br />
- frühzeitige Nominierungsmöglichkeiten (breit, öffentlich)<br />
für die Gremien,<br />
- frühzeitige Ernennung der Prüf- und Entscheidungsgremien<br />
(insbesondere Vorsitz), damit sie noch als Experten<br />
in den Entwicklungsprozess eingreifen können,<br />
- Pilotstudien mit einer Fülle von Universitäten, um die<br />
Methoden und das Instrumentarium zu erproben und<br />
Ergebnisse zu verwerten,<br />
- u.a. befördert von den sehr negativen Erfahrungen, die<br />
das UK mit dem Peer Review Verfahren zur Qualität<br />
von Lehre und Studium ab 1985 z.T. gemacht hatte.<br />
Alle Formen der Partizipation werfen allerdings auto-<br />
Fo 1+2/<strong>2011</strong><br />
47