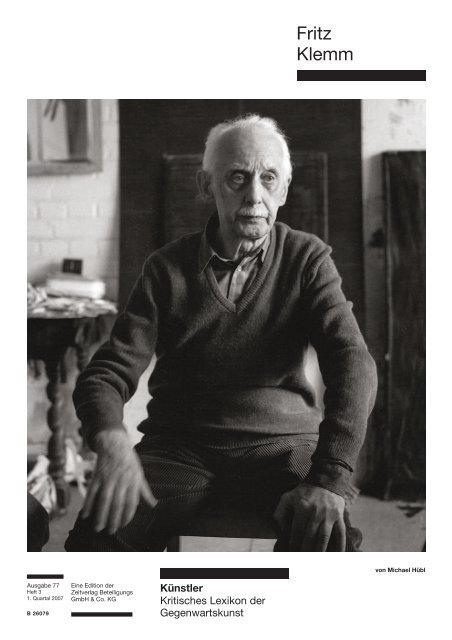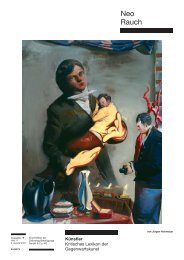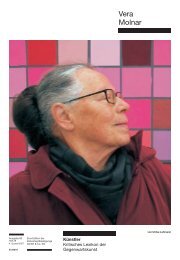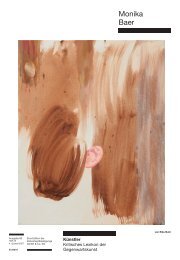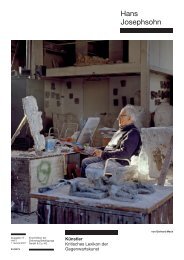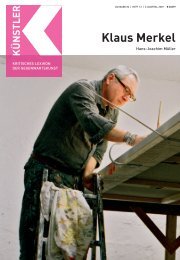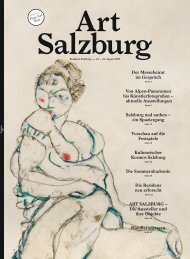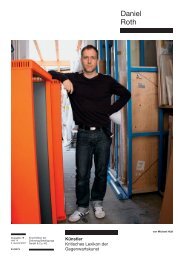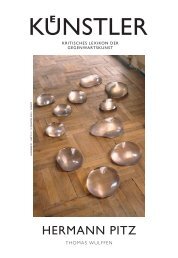Fritz Klemm - Zeit Kunstverlag
Fritz Klemm - Zeit Kunstverlag
Fritz Klemm - Zeit Kunstverlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
von Michael Hübl<br />
Ausgabe 77<br />
Heft 3<br />
1. Quartal 2007<br />
B 26079<br />
Eine Edition der<br />
<strong>Zeit</strong>verlag Beteiligungs<br />
GmbH & Co. KG<br />
Künstler<br />
Kritisches Lexikon der<br />
Gegenwartskunst
1 Wald, ca. 1968<br />
Tusche, Kreide, Stift<br />
48,8 x 60 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
»Aber mein Realismus bildet nicht nur ab, ich meine<br />
ihn als Weltsicht. Da bin ich eher Menzel oder Pissaro<br />
nahe. Mir geht es aber nicht um einen Stil. Mein Realismus<br />
ist Schopenhauers Denken nahe: fest in der<br />
Anschaulichkeit, trocken in der Durchführung, lapidar<br />
in der Aussage: Sie wissen, wie schwer es mir fällt,<br />
dies spielerisch leicht zu machen.«<br />
<strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> (Juni 1989 im einem Gespräch mit Gert Reising)
Michael Hübl<br />
über <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong><br />
»Ich bin das erste Material,<br />
woran ich arbeite«<br />
Reduktion der formalen Mittel ist ein wiederkehrendes Anliegen<br />
in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Dabei war das Bemühen um<br />
Einfachheit mit unterschiedlichen Zielen und Intentionen verbunden:<br />
Die Selbstbeschränkung auf geometrische Grundformen<br />
hat im Suprematismus eine andere Bedeutung als in der<br />
Minimal Art. Während Kasimir Malewitsch sein Schwarzes Quadrat<br />
auf weißem Grund als komprimierte Zusammenfassung der<br />
Welt und ihres Zukunftspotenzials verstand, waren die minimalistischen<br />
Bestrebungen eines Donald Judd oder Sol Le Witt darauf<br />
angelegt, frei zu bleiben von jedweden semantischen Überlagerungen,<br />
die nicht unmittelbar aus dem exakt bemessenen<br />
gestalterischen Aufbau begründet sind. Die Moderne brachte<br />
noch einen dritten Weg der Vereinfachung hervor: die Abstraktion,<br />
bei der die Darstellung einer Figur oder eines Gegenstandes<br />
auf ihre begriffliche Basis, sozusagen auf ihren Kern zurückgeführt,<br />
reduziert wird.<br />
Als Mitte der siebziger Jahre ein neues Interesse an den Arbeiten<br />
von <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> einsetzte, fanden sie nicht zuletzt deshalb<br />
Beachtung, weil sich in ihnen ästhetische Stringenz und Askese<br />
der Form verbanden. <strong>Klemm</strong> konzentrierte sich damals auf Papierarbeiten,<br />
die durch horizontale, vertikale und einzelne diagonal<br />
ausgerichtete Linien großflächig gegliedert waren. Oft wurden<br />
die klar gegeneinander abgegrenzten Bildpartien mit<br />
parallel verlaufenden Lineaturen strukturiert, die <strong>Klemm</strong> mit dem<br />
Bleistift – selten auch mit Kreide – zeichnete, mit der Tuschfeder<br />
zog oder mit dem Messer in das Papier schnitt. So entstand ein<br />
lamellenartiger Effekt, der zum auffälligen Merkmal seiner Arbeiten<br />
wurde.<br />
Klarheit und Kargheit bestimmten das künstlerische Vorgehen<br />
von <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>. Damit traf er, ohne dass es je seine Intention<br />
gewesen wäre, den Nerv einer <strong>Zeit</strong>, die nach Antworten auf einen<br />
wachsenden Konsumismus und die durch ihn generierte<br />
Schwemme an visuellen Reizen suchte. Mit materieller Selbstbeschränkung<br />
wie in der Arte povera und mit minimalistischen<br />
oder konzeptuellen Methoden unternahm es eine Reihe von<br />
Künstlern, einen autonomen Bereich ästhetischer Reflexion zu<br />
wahren oder herzustellen. In einem Prozess beschleunigten<br />
Massenkonsums, der durch bunte, laute, grelle und erotisierende<br />
Werbebotschaften fortlaufend stimuliert wurde, schien<br />
Zurückhaltung in den Gestaltungsmitteln das Gebot der Stunde.<br />
<strong>Klemm</strong> entsprach ihm insofern, als er den formalen Aufbau seiner<br />
Arbeiten strikter Linearität unterordnete und bei der malerischen<br />
Behandlung von Flächen auf alle Farben verzichtete, die<br />
bunter waren als Schwarz, Grau oder Braun. Aus der zeitgeschichtlichen<br />
Perspektive der siebziger Jahre ließen sich<br />
<strong>Klemm</strong>s Papierarbeiten demnach als eine eigene Art von Minimal<br />
deuten – und waren doch nichts weniger als das. So prinzi<br />
pienfest <strong>Klemm</strong> in seiner Lebensführung war, so wenig stützte<br />
er seine künstlerische Praxis auf ein bloßes Prinzip. Die weitgehend<br />
regelmäßige, manchmal dichte Abfolge von Parallelen,<br />
die seine späten Arbeiten kennzeichnet, ist aus keiner Formel<br />
abgeleitet, noch folgt sie strenger Systematik. <strong>Klemm</strong> hielt sich<br />
an das, was er sah. Seine Kunst ist von ihrem Ursprung her realistisch.<br />
Der Gegenstand seiner Darstellungen ist im Titel angegeben:<br />
Wand nennt <strong>Klemm</strong> die großen gestreiften Blätter, und abgesehen<br />
von sporadischen Ergänzungen wie Wand mit Rahmen<br />
(1972) oder Wand im Atelier (1975) bleibt diese Angabe für<br />
sämtliche Arbeiten, die bis zu seinem Tod entstehen, verbindlich.<br />
Die Ausschließlichkeit, mit der sich der Künstler seinem<br />
Bildthema widmet, hat einen biographischen Anlass. Mit dem<br />
Sommersemester 1970 endete <strong>Klemm</strong>s Lehrtätigkeit an der<br />
Kunstakademie Karlsruhe. 22 Jahre lang hatte <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> dort<br />
die Werkklasse geleitet, hatte die räumlichen, technischen oder<br />
auch kommunikativen Möglichkeiten der Hochschule genutzt.<br />
Jetzt war er hinsichtlich seiner Arbeit mit einem Schlag auf sich<br />
selbst zurückgeworfen. Sein Dienstatelier in einem umgebauten<br />
Barockschloss außerhalb der Stadt, wo die Akademie ihre<br />
Außenstelle Scheibenhardt unterhält, stand ihm nicht mehr zur<br />
Verfügung. <strong>Klemm</strong> musste sich einen neuen Ort zum Arbeiten<br />
suchen, und fand einen Raum, der die Radikalität der neuen Lebenssituation<br />
baulich auf den Punkt brachte. Im Herbst 1970<br />
bezog <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> seine künftige Wirkungsstätte in einem Atelierhaus<br />
der Stadt Karlsruhe, einem Stück Betonarchitektur.<br />
Jetzt öffnete sich der Blick nicht mehr auf Wiesen, Weiden, Felder<br />
und den Wald, der sich in einiger Entfernung erstreckt. Wohl<br />
war eine Seite des neuen Ateliers komplett verglast, wies nach<br />
Norden und durfte von daher für Maler, die auf gleichmäßige<br />
Lichtverhältnisse Wert legen, als ideal gelten. Doch die Aussicht<br />
war eng, verstellt von alten Bäumen, die man zwischen faden,<br />
architektonisch uninspirierten Mietsbauten hatte stehen lassen.<br />
Durch das Blattwerk ringsum war das Licht im Sommer grünlich.<br />
Ohnehin glich es mehr einem Dämmer, denn es fiel in einen<br />
Raum, der nicht wie draußen in Schloss Scheibenhardt weiß gestrichene<br />
Unbeschwertheit abstrahlte, sondern bestimmt wurde<br />
durch nackten Sichtbeton und die Struktur der Schalbretter, die<br />
man beim Bau verwendet hatte. Eine Klause mit Stromversorgung<br />
und Wasser-Anschluss. Wie er selbst die geänderte Lage<br />
empfand, hat <strong>Klemm</strong> später in einen knappen Satz gefasst:<br />
»Jetzt steh ich da und hab’ nichts mehr, nur noch die Wand«1.<br />
Die Wand bleibt von da an das visuelle Bezugsobjekt, an dem<br />
<strong>Klemm</strong> für seine Arbeit Maß nimmt. Die Linien, die er Strich um<br />
3
2<br />
3 4<br />
4
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
5<br />
2 Haus, ca. 1948<br />
Aquarell<br />
41,5 x 54,5 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
3 Wand, ca 1972<br />
Collage, Farbe<br />
64 x 54 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
4 Hausgiebel, ca. 1948<br />
Aquarell<br />
51 x 37 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
5 Gelber Sessel, ca. 1962<br />
Caparol, Aquarell<br />
36,7 x 50,2 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
6 Bäume (Villa Massimo), 1985<br />
Bleistift<br />
49,8 x 38 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
6<br />
5
Strich in weitgehend gleichen, aber nie völlig identischen Abständen<br />
zu Papier bringt, geben das wieder, was er tagtäglich<br />
vor sich sieht: Betonwände mit schmalen horizontalen Graten,<br />
wie sie sich an den Fugen der Bretter bilden, wenn der Beton in<br />
die Schalung gepresst wird. <strong>Klemm</strong> hat die gründlich geänderten<br />
Gegebenheiten nicht zuletzt durch seine Lebensführung gemeistert,<br />
die auch bisher schon festen Regeln und Ritualen unterworfen<br />
gewesen war. Wenn er morgens sein Atelier betrat,<br />
hatte er bereits ein exakt eingeteiltes Programm inklusive Gymnastik,<br />
Rohkost und <strong>Zeit</strong>ungslektüre absolviert. Sein Freund und<br />
Sammler, der später ermordete Münchner Jurist Bernd Mittelsten<br />
Scheid, hat in einem höchst lebendigen Aufsatz das Procedere<br />
geschildert, mit dem sich <strong>Klemm</strong> langsam fit machte: »Er<br />
stand um vier Uhr auf, machte intensiv Atemübungen, vor allem<br />
Kopfstand, die kein jüngerer ihm nachmachen konnte, trank<br />
nach dem Aufstehen einen ungewürzten Gemüsesud »mit Verachtung«,<br />
und erst dann frühstückte er gegen acht Uhr2. Die<br />
ungewohnte Umgebung, mit der sich der Künstler nach seinem<br />
Ausscheiden aus der Akademie plötzlich konfrontiert sah, hat<br />
diese bei aller Strenge von serener Heiterkeit begleitete Haltung<br />
zusätzlich verstärkt: Der kahle Raum wird zum Resonanzkörper<br />
der existenziellen Askese, die sich <strong>Klemm</strong> auferlegt hat und aus<br />
der die außergewöhnliche Kongruenz von Kunst und Leben in<br />
seinem Spätwerk resultiert.<br />
Noch in den frühen achtziger Jahren, als <strong>Klemm</strong>s Wand-Ansichten<br />
an Bekanntheit gewannen, hätte der Begriff Spätwerk Befremden<br />
ausgelöst. Lange herrschte die Meinung, <strong>Klemm</strong> habe<br />
erst nach Abschluss seiner Dienstjahre begonnen, sich ernsthaft<br />
einer eigenen künstlerischen Produktion zu widmen. Folglich<br />
hätte er zwar sein Werk spät entwickelt, aber damit noch kein<br />
Spätwerk geschaffen. <strong>Klemm</strong> hat diesen Eindruck unterstützt.<br />
Lange hat er es selbst in privaten Situationen tunlichst vermieden,<br />
frühe Zeichnungen oder Malereien zu zeigen. Allenfalls<br />
sprach er davon, dass er in der Nachkriegszeit an der Alb, einem<br />
Flüsschen, das sich durch Karlsruher Gemarkung schlängelt,<br />
Landschaftsstudien aquarelliert hatte. Und vielleicht erwähnte<br />
er beiläufig, dass ihn der Blick aus den hohen Fenstern<br />
seines Ateliers in Scheibenhardt animiert hat, mit Kreide, Tusche<br />
und Gouache graphische Paraphrasen auf den nahe gelegenen<br />
Wald zu Papier zu bringen. Mehr gab er nicht preis. Nach<br />
und nach erst kam heraus, dass der Künstler allein das Motiv<br />
»Wald« weit über 200 Mal bearbeitet hatte3.<br />
<strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> verstand seine distanzierte Haltung gegenüber<br />
zurückliegenden Werkphasen als Ausdruck eines avancierten<br />
Qualitätsanspruchs. Entsprechend skrupulös ging er bei seinen<br />
Papierarbeiten vor, die oft verworfen wurden, auf einem Stapel<br />
mit vermeintlichem Ausschuss landeten und später als Rohstoff<br />
wieder Eingang fanden in den Gestaltungsprozess. Einzelne<br />
Partien, die <strong>Klemm</strong> für gut gelungen erachtete, wurden ausgeschnitten<br />
und probeweise mit Stecknadeln oder Tesafilm auf<br />
Blättern fixiert, an denen er gerade arbeitete. Durch das Verfahren<br />
gewann er die nötige <strong>Zeit</strong>, um zu beobachten und um abzuwägen,<br />
wie die Teile des Bildes zusammenwirken und welche<br />
Interferenzen sich zwischen ihnen einstellen. Dabei ging es<br />
<strong>Klemm</strong> wesentlich darum, das Papier, wie er sagte, zu »entmaterialisieren«4.<br />
Diesem ästhetischen Axiom versuchte er gerecht<br />
zu werden, indem er etwa schwarzen Fotokarton mehrmals mit<br />
Tusche übermalte, bis sich die Pappe zu wellen begann und einen<br />
fast fettigen dunklen Glanz erhielt. Oder er überzog billiges<br />
Einwickelpapier mit Tusche, um anschließend die Rückseite als<br />
sichtbare Fläche zu verwenden, weil hier das Schwarz der Tusche<br />
als malerisch ungleichmäßiges Grau durchschimmerte.<br />
<strong>Klemm</strong> strebte danach, seine Arbeiten so weit zu treiben, bis ihre<br />
Materialität überwunden war. Bis er das rein Stoffliche transzendiert<br />
hatte und sich – nach seinen Worten – »ein<br />
Geheimnis«5 bemerkbar machte. Um diesen Zustand zu erlangen,<br />
wandte er äußerste Sorgfalt auf. Bevor <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> ein Bild<br />
öffentlich machte, hatte er es wiederholter kritischer Begutachtung<br />
unterzogen, hatte er Änderungen, Ergänzungen, Korrekturen<br />
vorgenommen und nicht selten komplette Blätter als unvollkommen<br />
beiseite gelegt oder für nichtig erklärt. Insofern liegt<br />
hier ein entscheidender Grund für die erst in den letzten Lebensjahren<br />
langsam aufgegebene Scheu des Künstlers, Arbeiten<br />
zu zeigen, die doch immerhin zu einer <strong>Zeit</strong> entstanden waren,<br />
als er bereits an der Karlsruher Kunstakademie lehrte. Der<br />
späte <strong>Klemm</strong> meinte offenbar, seine früheren Arbeiten würden<br />
den eigenen hohen Maßstäben nicht standhalten.<br />
Ein weiteres Motiv für seine Zurückhaltung in Sachen Frühwerk<br />
(ein relativer Begriff bei einem, der, als er an der Alb aquarelliert,<br />
bereits auf die 50 zugeht) liegt wohl wieder in seiner Biographie<br />
begründet. Als <strong>Klemm</strong> 1948 das Angebot erhielt, die Leitung<br />
des Werkunterrichts an der damaligen Badischen Akademie der<br />
Bildenden Künste zu übernehmen, hatte er sich bis dahin weder<br />
als Maler noch als Zeichner bemerkbar gemacht. Seit dem Jahr<br />
1925, das den Abschluss seines Studiums an der Badischen<br />
Landeskunstschule, der späteren Akademie, markierte, war<br />
<strong>Klemm</strong> – außer während einiger kurzer kriegsbedingter Unterbrechungen<br />
– als Kunsterzieher oder nach dem Sprachgebrauch<br />
der <strong>Zeit</strong>: als Zeichenlehrer tätig gewesen. Selbst nachdem<br />
er begonnen hatte, an der Kunstakademie zu lehren,<br />
gehörte <strong>Klemm</strong> bis 1956 offiziell weiterhin dem Kollegium des<br />
Karlsruher Bismarck-Gymnasiums an, von wo aus er an die<br />
6
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
Hochschule abgeordnet war. Aus dieser Vorgeschichte heraus<br />
mag sich ein besonderer Respekt gegenüber jenen Akademielehrern<br />
ergeben haben, die sich wie Karl Hubbuch, Otto Laible<br />
oder Wilhelm Schnarrenberger schon in der Weimarer Republik<br />
als Künstler einen Namen gemacht hatten. Beeindruckt war<br />
<strong>Klemm</strong> von der Persönlichkeit des expressionistischen Malers<br />
und Graphikers Erich Heckel, der 1949 nach Karlsruhe berufen<br />
worden war. Heckel hatte als Mitbegründer der »Brücke« für<br />
Aufsehen gesorgt, hatte als Sanitäter das Grauen des Ersten<br />
Weltkriegs durchlebt, hatte Ruhm erlangt, war von den Nationalsozialisten<br />
diffamiert und in seinen existenziellen Möglichkeiten<br />
massiv eingeschränkt worden und zeigte sich nun in Karlsruhe<br />
als abgeklärte, altersweise Figur, die umfangen wurde von einer<br />
Aura fernöstlicher Entrücktheit. Ein Eindruck, der, wie <strong>Klemm</strong><br />
mit einer Mischung aus Schmunzeln und Verehrung schilderte6,<br />
gleichsam unterstrichen wurde durch den gelblichen Teint des<br />
bei seiner Berufung bereits 66-jährigen Heckel.<br />
Dort die renommierten Maler mit ihren Erfahrungen und Erfolgen,<br />
hier der »Zeichenlehrer«, der Neuling, der im gymnasialen<br />
Schulalltag möglicherweise die Auffassung verinnerlicht hatte,<br />
lediglich Teil eines Beamtengefüges mit begrenztem Handlungsspielraum<br />
zu sein: In dieser Divergenz hat <strong>Klemm</strong>s Befangenheit<br />
im Umgang mit seinen Arbeiten der fünfziger und sechziger<br />
Jahre sicher ebenso ihre Ursache wie in seinen<br />
ausgeprägten Qualitätsvorstellungen. Ein Drittes kommt hinzu.<br />
Denkbar ist, dass <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>, und sei es unbewusst, vermeiden<br />
wollte, in die Ecke des Ewiggestrigen gestellt zu werden,<br />
der auf den Exerzitien des Naturstudiums beharrt, während<br />
ringsum experimentiert und die Lust der Freiheit geprobt wird.<br />
<strong>Klemm</strong> war einer der Protagonisten in dem inzwischen notorischen,<br />
ursprünglich nur hochschulinternen Streit, der HAP<br />
Grieshaber veranlasste, seine Lehrtätigkeit an der Kunstakademie<br />
Karlsruhe aufzugeben. Grieshaber hatte 1955 die Nachfolge<br />
Heckels angetreten und tat seither alles, um innerhalb des Lehrbetriebs<br />
für frischen Wind zu sorgen. Als »Charismatiker, der<br />
zur Gemeindebildung anregte«7 polarisierte er – und das in einem<br />
kulturpolitischen Klima, das durch den Kalten Krieg ideologisch<br />
extrem aufgeladen war. Die rüden Polemiken, die der<br />
Kunstkritiker Will Grohmann und der Maler Karl Hofer, Direktor<br />
der Hochschule für bildende Künste Berlin, als wechselseitige<br />
Angriffe Mitte der fünfziger Jahre in der Tagespresse veröffentlichten,<br />
verweisen – ähnlich wie zuvor das erste Darmstädter<br />
Gespräch zum Thema »Das Menschenbild in unserer <strong>Zeit</strong>«<br />
(1950) – auf die Heftigkeit, wenn nicht Verbissenheit, mit der damals<br />
um die Freiheit, die gesellschaftliche Funktion, die ethischen<br />
Maximen von Kunst und deren formale Umsetzung gestritten<br />
wurde. Dieser Grundsatzstreit erreichte Karlsruhe nicht<br />
zuletzt anlässlich der Staatsexamensprüfung vom 18. Dezember<br />
1959, die sich zu einem Affront für Grieshaber auswuchs:<br />
Die Prüfungskommission verweigerte den Arbeiten von zwei<br />
seiner Schülerinnen die Anerkennung und begründete die Entscheidung<br />
damit, dass den vorgelegten Zeichnungen – Bildgegenstand:<br />
Hühner – die geforderte Erkennbarkeit fehle8. <strong>Klemm</strong><br />
war zu dieser <strong>Zeit</strong> Prorektor, und laut Wilhelm Loth, der damals<br />
gerade eine Klasse für Bildhauerei übernommen hatte, soll es<br />
just er, <strong>Klemm</strong>, gewesen sein, der die Angelegenheit erst richtig<br />
ins Rollen brachte9.<br />
<strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> hat die Position, die er bei der Beurteilung der umstrittenen<br />
Blätter einnahm, nie geleugnet; die Prinzipienfestigkeit,<br />
die er als Grundgerüst seiner Lebensführung ansah, legte<br />
eine solche Haltung nahe. Er hat aber auch erkennen lassen,<br />
dass die Forderung nach naturgetreuer Wiedergabe nur als letzter<br />
Funke in einem seit langem schwelenden Konflikt wirkte. Eine<br />
Fotografie10, aufgenommen beim Akademiefasching 1956,<br />
liefert ein Indiz für das, was <strong>Klemm</strong> Jahre danach gesprächsweise<br />
erwähnte. Zu sehen ist ein Tisch, auf dem (welch ein Exzess!)<br />
eine einzelne Flasche Bier mit übergestülptem Bierkrug steht.<br />
Hinter dem Tisch zwei Damen, flankiert von zwei Herren. Links<br />
sitzt Grieshaber, maskiert als arabischer Potentat mit dunklem<br />
Turban, falschem Bart und mit dem stilisierten Brustschmuck eines<br />
Pharaonen auf dem hellen Gewand. Rechts <strong>Klemm</strong>:<br />
schwarzes Hemd, weißer Umhang, dunkler Hut mit aufgesteckten<br />
Flügeln aus kantig gefaltetem Papier – eine Mischung aus<br />
Pierrot und Hermes, dem Götterboten, mit brennender Zigarette<br />
in der Rechten (weil Regeln für ihn auch mal Ausnahmen haben<br />
durften). Hier der Herrscher, dort der skeptische Beobachter: Im<br />
Rückblick auf die Auseinandersetzung mit Grieshaber betonte<br />
<strong>Klemm</strong>, dass ihm der Holzschneider von der Achalm anfangs<br />
durchaus sympathisch gewesen sei, dass ihn aber dessen diktatorische<br />
Ader gestört habe, die nach und nach zutage getreten<br />
sei. Insofern eignet dem Streit eine gewisse Tragik: Einer, der<br />
von der Reichskulturkammer mit Berufsverbot belegt wurde und<br />
sich als Antifaschist begreift, weckt durch sein dominantes,<br />
egozentrisches, womöglich aber einfach nur ungeniert-genialisches<br />
Wesen11 die Aversion von einem, der sich zwar nie in irgendeine<br />
Richtung politisch exponiert hat, dem jedoch die Anmaßung<br />
von Macht und das Anmaßende der Macht zutiefst<br />
gegen den Strich gingen (von den Zumutungen des Militärdienstes<br />
etwa hat <strong>Klemm</strong> nur mit Abscheu gesprochen). In der Kontroverse<br />
um die Hühner-Zeichnungen zweier Examens-Kandidatinnen<br />
haben sich mithin mehrere Faktoren überlagert. Durch die<br />
oft verbrämten, aber de facto extremen ideologischen Spannun-<br />
7
7 9<br />
8 10<br />
8
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
11<br />
7 Wand, 1988<br />
Zeichnung/Collage<br />
140 x 100 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
8 Alter Sessel, 1952<br />
Caparol auf Karton<br />
80 x 58 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
10 Frühe Wand, ca. 1970<br />
Collage/Gouache<br />
65 x 50 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
11 Atelier, ca. 1948/50<br />
Aquarell, Bleistift<br />
42,1 x 48,8 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
9 Frühe Wand, ca. 1970<br />
Tusche/Gouache<br />
69,5 x 49,5 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
9
gen der Adenauer-Ära wurde das Aufeinandertreffen zweier gegensätzlicher<br />
Charaktere ebenso weiter aufgeheizt wie durch<br />
die damals virulente Debatte um den Gegensatz von gegenständlich<br />
und abstrakt – Attribute, die als Synonyme galten für<br />
reaktionär und modern.<br />
Die Frage, ob eine figurative oder eine ungegenständliche Kunst<br />
die angemessene Antwort auf die moderne Gegenwart sei, hat<br />
sich heute erledigt. Im Falle von <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> wäre sie absurd.<br />
Denn <strong>Klemm</strong> war beides: dem Gegenstand und der Moderne<br />
verpflichtet. Zunächst einmal ist da der Umstand, dass er den<br />
Bezug zum realen Objekt nie aufgegeben hat: Noch in den vom<br />
Grundton Schwarz getragenen Bildern aus den Monaten vor<br />
seinem Tod bleiben die Schatten, Streifen und Strukturen der<br />
Wand nachvollziehbar, die ihn über beinahe drei Jahrzehnte hinweg<br />
beschäftigt hat. Angesichts des hohen Alters, das <strong>Klemm</strong><br />
bereits erreicht hatte, stellen sich diese Bilder wie die Summe,<br />
die Zusammenfassung, das geistige Konzentrat eines oft<br />
schweren und widerspenstigen, oft wieder glücklichen, lässigen<br />
Lebens dar – entfernt vergleichbar jener letzten Mauer in einer<br />
Reihe von Pariser Abrisshäusern, die Rainer Maria Rilke in seinem<br />
Tagebuchroman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids<br />
Brigge als ein rohes, rücksichtslos entblößtes Schaubild der<br />
existenziellen Bedingungen des Menschen beschreibt. »Das<br />
zähe Leben dieser Zimmer hatte sich nicht zertreten lassen«,<br />
heißt es da, und einige Sätze weiter: »Es war in jedem Streifen,<br />
der abgeschunden war... «12. Eine vergleichbare ästhetische<br />
Verdichtung von den Erfahrungen des Lebens und den Spuren,<br />
die es hinterlässt, mag man in den späten dunklen Wand-Arbeiten<br />
<strong>Klemm</strong>s auch deshalb vermuten, weil der Künstler sogar<br />
noch als Über-80-Jähriger auf eine Brandmauer zu sprechen<br />
kam, die hinter den von seinem Vater betreuten Lauerschen<br />
Gärten13 seiner Geburtsstadt Mannheim aufragte. Das Motiv<br />
der Mauer hat <strong>Klemm</strong> folglich von der Kindheit bis ins Alter hinein<br />
begleitet, und so könnte es zu einem Zeichen geworden<br />
sein für die Widerstände, die er im Laufe seines Lebens zu bewältigen<br />
hatte. Faktum bleibt jedoch, dass er ganz nach der<br />
Manier eines gegenständlich arbeitenden Künstlers durchweg<br />
an der Realität seiner betonierten Atelierumgebung Maß nahm.<br />
»Ich bin Realist«, bekannte <strong>Klemm</strong> im Juni 1989 während eines<br />
Gesprächs mit Gert Reising, »Aber mein Realismus bildet nicht<br />
nur ab, ich meine ihn als Weltsicht. Da bin ich eher Menzel oder<br />
Pissaro nahe. Mir geht es aber nicht um einen Stil. Mein Realismus<br />
ist Schopenhauers Denken nahe: fest in der Anschaulichkeit,<br />
trocken in der Durchführung, lapidar in der Aussage: Sie<br />
wissen, wie schwer es mir fällt, dies spielerisch leicht zu machen«14.<br />
<strong>Klemm</strong> war auch sonst in manchem Traditionalist; beispielsweise<br />
hatte für ihn ein formales Kriterium wie das der Valeurs, über<br />
die sich eine Feinabstimmung der Farbwirkung erreichen lässt,<br />
große Bedeutung. Das war die eine Seite. Die andere konstituierte<br />
sich durch fortgesetzte Nähe zur Moderne. Sie reicht von<br />
der familiären Alltagspraxis und die Lebensführung über seine<br />
pädagogischen Leitgedanken bis hin zur Entwicklung der eigenen<br />
künstlerischen Arbeit. <strong>Klemm</strong> war seit 1931 mit Antonia<br />
Gräfin von Westfalen (1902-1989) verheiratet, die wie er an der<br />
Badischen Landeskunstschule studiert hatte und als überaus<br />
sensible und begabte Malerin gelten darf. Ihr Œuvre blieb<br />
schmal, denn sie musste sich als Hausfrau betätigen. Das Ehepaar<br />
hatte sechs Kinder, mit denen es in ausgesprochen progressiven,<br />
wenngleich beengten Verhältnissen lebte: Antonia<br />
und <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> gehörten zu den ersten Mietern der Werkbund-<br />
Siedlung Dammerstock, die Walter Gropius mit Walter Haessler<br />
1928-29 errichtet hatte und die in der Bevölkerung ähnlichen<br />
Spott auslöste wie die kurz zuvor in Stuttgart unter der künstlerischen<br />
Oberleitung von Ludwig Mies van der Rohe fertiggestellte<br />
Weißenhof-Siedlung. <strong>Klemm</strong> berichtete gerne, wie der<br />
Straßenbahnschaffner manchmal als nächste Haltestelle » Jammerstock«<br />
statt » Dammerstock« ausrief.<br />
<strong>Klemm</strong>s Affinität zu modernen Formen tat das keinen Abbruch;<br />
er hegte auch später eine Vorliebe für klares funktionalistisches<br />
Design15. Modern war auch sein Interesse an einer reformerischen<br />
Lebensweise, mit der ihn seine Frau bekannt machte,<br />
modern war die Einstellung, mit der er seinen Werkunterricht<br />
gestaltete: Es sollten dort mit einfachen Materialien grundlegende<br />
formale Probleme durchgespielt werden. <strong>Klemm</strong> forderte<br />
seine Studenten dazu heraus, noch aus der armseligsten, bedürftigsten<br />
Situation heraus freie und erfindungsreiche Arbeiten<br />
anzugehen. Einer seiner letzten Studenten, der Bildhauer Michael-Peter<br />
Schiltsky, hat diesen Unterricht so beschrieben:<br />
»Die Einfachheit von Werkzeug und Material war ein wesentlicher<br />
Bestandteil der Lehre <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>s im Fach Werken an der<br />
Akademie: Papier (Buchbinden und alles was sich daraus entwickeln<br />
läßt), Holz in einfachen Ver- und Bearbeitungsformen<br />
und die Aufforderung, man solle, auch um Kosten zu sparen,<br />
Abfallprodukte, Pappen, Tüten, Stoffreste sammeln, eine Ästhetik<br />
aus Abfall entwickeln«16. In diesem Punkt traf sich <strong>Klemm</strong><br />
mit der Arte Povera, obschon die Maximen, auf die er seinen<br />
Unterricht stützte, aus den Ideen abgeleitet waren, die man am<br />
Bauhaus umgesetzt hatte. Auch hier eine Anbindung an die Moderne,<br />
auf die er sich in seinen Malereien, Zeichnungen, Papierarbeiten<br />
kontinuierlich zubewegte. Beharrlich wie in der kompakten<br />
Werkgruppe buchstäblich gewichtiger Malereien, die<br />
10
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
vom Ende der fünfziger Jahre bis weit in die sechziger hinein<br />
aus unzähligen, durch den Kunstharzbinder Caparol ausgehärteten<br />
Farbschichten entstehen, hat <strong>Klemm</strong> den Gegenstand umkreist,<br />
hat ihn – statt die absolute Gültigkeit einer bestimmten<br />
Form zu behaupten – eins um andere Mal neu befragt, weil jede<br />
Festlegung immer auch Ausklammern, Ausblenden heißt. Dieser<br />
Befragungsprozess schloss die eigene Person ausdrücklich mit<br />
ein. Die zuletzt zeichenhaft reduzierten Selbstporträts, die eine<br />
Konstante bilden im Werk des Künstlers, zeigen, wie sehr er seine<br />
Arbeit aus der Relation Subjekt-Objekt definierte und wie er<br />
sich dabei selbst als Teil der objektiven Welt verstand – bearbeitbar<br />
wie alles andere um ihn herum. Als Konsequenz daraus<br />
galt für <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>: » Ich bin das erste Material, woran ich arbeite«17.<br />
15 vgl. Mittelsten Scheid wie Anm. 2, S. 51.<br />
16 Michael Peter Schiltsky: Für <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>, in:<br />
<strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>. Bilder, Zeichnungen, Aquarelle,<br />
Gouachen, Collagen 1948 bis 1985, Katalog zur<br />
Ausstellung im Badischen Kunstverein, Karlsruhe<br />
1985, S. 10-13, hier S. 10.<br />
17 Mittelsten Scheid, a.a.O., S. 49.<br />
Fotonachweis<br />
Cover<br />
Alle anderen<br />
Abbildungen<br />
Barbara <strong>Klemm</strong><br />
Courtesy Galerie A. Baumgarten,<br />
Freiburg<br />
Anmerkungen:<br />
1 So berichtete der Bildhauers Wilhelm Loth, zit.<br />
nach Eva Studinger: Biografie, in: <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>.<br />
Retrospektive 1992. Katalog zur Ausstellung in<br />
der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe u.a. 1993,<br />
S. 177-184, hier S. 182.<br />
2 Bernd Mitttelsten Scheid: <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> - Notizen<br />
eines Freundes, ebenda S. 47-51, hier S. 48.<br />
3 vgl. ebenda S. 98, Nr. 35.<br />
4 Gespräch mit dem Autor im Dezember 1982.<br />
5 ebenda<br />
6 ebenda<br />
7 Manfred Schneckenburger: Ein Mythos kehrt in<br />
die <strong>Zeit</strong> zurück, in: Grieshaber. Ein Lebenswerk<br />
1909-1981, Katalog zur Ausstellung der Staatsgalerie<br />
Stuttgart, der Galerie der Stadt Stuttgart,<br />
des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart<br />
und des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg,<br />
Stuttgart 1984, S. 10-19, hier S. 11.<br />
8 vgl. hierzu Margot Fürst: Stolperdrähte. HAP<br />
Grieshaber im Staatsdienst, in: grieshaber<br />
schüler heute, Katalog zur Ausstellung im<br />
Spendhaus Reutlingen, Reutlingen 1991, S. 79-<br />
90, sowie Brigitte Baumstark: Grieshaber in<br />
Karlsruhe, in: HAP Grieshhaber. Figuren-Welten,<br />
Katalog zur Aussstellung in der Städtischen Galerie<br />
Karlsruhe, Karlsruhe 2003, S. 19-27.<br />
9 So jedenfalls Studinger unter Berufung auf Loth,<br />
s. <strong>Klemm</strong>, 1993, a.a.O., S. 181.<br />
10 Abgebildet bei Baumstark, Grieshaber, a.a.O., S.<br />
21.<br />
11 Zur Charakterisierung Grieshabers vgl. Ludwig<br />
Greve: Versuch eines Porträts mit verteilten Rollen,<br />
in: Grieshaber, Stuttgart 1984, a.a.O., S.20-<br />
25.<br />
12 Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte<br />
Laurids Brigge, zit. nach der Ausgabe Frankfurt<br />
am Main 1978, S. 46.<br />
13 Zu der Parkanlage und dem Gartenrest der<br />
Mannheimer Fabrikantenfamilie Lauer s. Der<br />
Brockhaus Mannheim. 400 Jahre Quadratestadt<br />
- das Lexikon, Mannheim 2006, S. 188f.<br />
14 Gert Reising: Wenn ich alleine bin, rede ich.<br />
Wand-Bilder bei <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong>, in: <strong>Klemm</strong>, 1993,<br />
a.a.O., S. 13-24, hier S. 20.<br />
Michael Hübl, geboren 1955,<br />
studierte Kunst, Kunstgeschichte<br />
und Germanistik an der Kunstakademie<br />
Karlsruhe und an den Universitäten<br />
Heidelberg, Karlsruhe<br />
und Hamburg. Seit 1981 zahlreiche<br />
Texte zur Kunst der Gegenwart.<br />
Leiter des Kulturressorts der<br />
Badischen Neuesten Nachrichten.<br />
11
12<br />
13<br />
14<br />
12
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
15<br />
12 Frühe Wand, ca. 1970 – 1972<br />
Bleistift/Farbstift/Gouache<br />
49,5 x 69,5 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
13 Wand, 1988<br />
Zeichnung/Collage<br />
140 x 100 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
14 Wand, 1984<br />
Bleistift, Collage<br />
140 x 100 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
15 Wand, 1989<br />
Tusche, Kreide, Collage<br />
99 x 139 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
16 Frühe Wand, ca. 1972<br />
Gouache, Bleistift<br />
69,4 x 49,8 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
16<br />
13
Notizen von einem Besuch bei <strong>Fritz</strong> <strong>Klemm</strong> am<br />
4.12.82 (Michael Hübl)<br />
Ich steckte zu sehr in Erwartungen, um beurteilen zu<br />
können, ob es wirklich fast schüchtern war, wie er<br />
mir sein Geschenk anbot. Wir waren über drei Stunden<br />
dagesessen, in der kleinen engen Nische, er mit<br />
dem Rücken zum großen Atelierraum hinter ihm, sodaß<br />
ich das dünne, feine hochstehende weiße Haar<br />
als eine Art Lichtkranz um seinen Kopf sehen konnte.<br />
Vielleicht saßen wir wirklich wie zwei Jünger vor<br />
ihm, hörten ihm zu: seinen Episoden, seinem Stolz,<br />
seiner wie auch immer zu bewertenden Philosophie,<br />
von der er ausdrücklich betont, daß sie nur für ihn<br />
zwingende Gültigkeit habe; jeder andere wisse wohl<br />
seinen eigenen Weg.<br />
Er spricht von den Ereignissen um Grieshabers<br />
Rücktritt: Grieshaber sei ihm anfangs nicht unsympathisch<br />
gewesen, habe es später aber immer mehr<br />
auf Machtdemonstration angelegt. Zum Krach kam<br />
es, als zwei Studenten beim Examen anstelle einer<br />
realistischen Zeichnung eines Hasen und eines Huhnes<br />
etwas à la Foutrier ablieferten, nur Fell, wirr gezeichnet.<br />
Das ging anfangs durch, weil der Ministerialbeamte<br />
liberal und unsicher war, ja mehr noch, er<br />
wollte etwas Gutes tun und meinte bei der Begutachtung<br />
der sogenannten Dreitagesarbeit, wie gut<br />
hier doch der Hase getroffen sei, worauf Grieshaber<br />
entrüstet reagiert haben soll: Das sei doch ein Huhn.<br />
Darauf wurde den beiden Studenten nahegelegt,<br />
diesen Teil der Prüfung zu wiederholen. Grieshaber<br />
protestierte, wollte die Autorität seiner Person und<br />
seines Amtes in die Waagschale werfen und verlor –<br />
die Alternative, entweder die Studenten bestehen<br />
so, oder er legt sein Amt als Professor nieder, wurde<br />
vom Ministerium gegen ihn entschieden. <strong>Klemm</strong>, der<br />
in dieser Sache gegen Grieshaber war, erhielt dadurch<br />
den Ruf, den Holzschneider » abgesägt « zu<br />
haben.<br />
Er lese gerade den Grünen Heinrich, nicht so wie<br />
früher, schnell drüber weg, sondern Zeile für Zeile<br />
auskostend. Und Keller beschreibe ja ähnliche Zustände<br />
wie an den Akademien. Wir sprechen darüber,<br />
wie jemand etwas wird als Künstler, daß oft die<br />
Stillen, die Nichtbeachteten auf einmal ganz hoch<br />
kommen (und er meint damit auch sich, der sich als<br />
Kunsterzieher durchgeschlagen hatte, später als<br />
Werklehrer eher zu den Randzonen des kunstakademischen<br />
Lehrkörpers gehörte). Schüler von großen<br />
Namen würden oft gar nichts, selbst bei Trübner, der<br />
seinen Schülern wirklich eine solide Ausbildung gegeben<br />
habe, die nicht auf flottes Imitieren der Eigenart<br />
des Lehrers gezielt habe, sei auch niemand herausgekommen,<br />
der einen eigenen Weg gefunden<br />
hätte. Ständige Selbstkritik sei nötig, das Arbeiten<br />
an sich selbst. Deswegen sei er so fit und vital. Er<br />
habe erkannt, daß seine Arbeit nur dann etwas werden<br />
könne, wenn er sich asketisch darauf vorbereitet.<br />
Er spricht von der » Heilung «, die in den Bildern<br />
stecke und sieht darin einen Grund, warum sie so<br />
hoch gehandelt würden. <strong>Klemm</strong> ist Vegetarier und<br />
Asket. Freitag ist sein Fastentag und nur sonntags<br />
bleibt er morgens länger liegen – bis sieben. Dennoch<br />
ist er nicht humorlos oder vertrocknet. Er hat<br />
seine Lieblingsbäckereien und ergötzt sich gerne an<br />
Süßigkeiten, die er sich in der Schweiz oder Belgien<br />
besorgen läßt. »Aber das Café Kongress hat fast<br />
noch bessere als dort.«<br />
Er erzählt von den Cafes aus der <strong>Zeit</strong> vor dem Zweiten<br />
Krieg, als Karlsruhe noch Charme hatte, Künstler<br />
und Juristen hätten sich dort getroffen, wiewohl<br />
überhaupt die Juristen die Kunst oft gerechter beurteilten<br />
als die Kunsthistoriker (einer seiner ersten begeisterten<br />
und treuen Käufer, Bernd Mittelsten<br />
Scheid, ist Jurist).<br />
Nach meinem Besuch in seinem Atelier verstehe ich,<br />
was ich vorher aus seiner künstlerischen Entwicklung<br />
vom halb-abstrakten, besser stark abstrahiert<br />
Gegenständlichen zum ganz Abstrakten herausgelesen<br />
habe: Daß <strong>Klemm</strong>s Kunst realistische Kunst ist.<br />
Es ist der Realismus der Zen-Malerei. Er malt und<br />
zeichnet (»Eine gute Zeichnung muss auch gemalt<br />
sein «), was er ständig um sich herum sieht: Die kahlen<br />
grauen Betonwände seines Ateliers, an denen<br />
das einzig Lebendige das Muster der Holzverschalung<br />
ist und die feinen, liniendünnen Grate, die dort<br />
entstanden sind, wo Bohle an Bohle stieß und der<br />
Beton in die Fugen sickerte. Aber <strong>Klemm</strong> malt nicht<br />
ab, er übersetzt. Es geht ihm um minimale Tonwerte<br />
in seiner reichen Schwarz-Skala. Er nimmt schwarz-<br />
14
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
en Fotokarton als Malgrund und » entmaterialisiert«<br />
ihn, indem er ihn immer und immer wieder mit Tusche<br />
übermalt, Matte, wellige Flächen entstehen.<br />
Überall liegen Arbeiten. Fertige, fast fertige, angefangene,<br />
unbewältigte. Flächen sind mit Tesa probegeklebt,<br />
bei manchen Blättern ist ihm schon klar, wie<br />
es weiter geht, die müssen nur noch in Kleinigkeiten<br />
korrigiert werden. Bei einer großen weißen Zeichnung<br />
will er noch mit Sepia drübergehen – da weiß<br />
er noch nicht, ob das glückt, oder ob er dann das<br />
Blatt wegwerfen muß (obwohl er fast nichts wegwirft).<br />
Aber alle Arbeiten müssen, wenn sie fertig<br />
sind, ein »Geheimnis « enthalten – das betont er wiederholt.<br />
Berg will gehen will gehen. Sein Kopf bereut den Alkohol<br />
vom Abend zuvor. Wir reden noch eine Weile<br />
weiter. <strong>Klemm</strong> meint, es sei wichtig für mich, in »die<br />
Küchen« zu gucken, das sei die Kunstgeschichte,<br />
die man sonst nirgends lesen könne und die vielleicht<br />
auch nicht geschrieben werden müsse. (Wir<br />
hatten am Anfang unseres Gesprächs über die Ausstellung<br />
im Prinz-Max-Palais gesprochen; ich erzählte<br />
Arnolds Anekdote über das Christbaumkugeln-<br />
Bild von Schnarrenberger, und <strong>Klemm</strong> wendet ein,<br />
dass solches Hintergrundswissen nicht unbedingt<br />
notwendig sei: Denn diese Kunst habe als Kunst<br />
eben nichts <strong>Zeit</strong>typisches. Für sich betrachtet sei sie<br />
eben nicht mehr als gut gemachte Malerei).<br />
Künstler<br />
Kritisches Lexikon der<br />
Gegenwartskunst<br />
erscheint viermal jährlich mit insgesamt<br />
28 Künstlermonografien auf über 500 Text- und<br />
Bild-Seiten und kostet im Jahresabonnement<br />
einschl. Sammelordner und Schuber € 148,–,<br />
im Ausland € 158,–, frei Haus.<br />
www.weltkunst.de<br />
Postanschrift für Verlag und Redaktion<br />
<strong>Zeit</strong>verlag Beteiligungs GmbH & Co. KG<br />
Nymphenburger Straße 84<br />
D-80636 München<br />
Tel. 0 89/12 69 90-0 · Fax 0 89/12 69 90-11<br />
Bankkonto: Commerzbank Stuttgart<br />
Konto-Nr. 525 55 34, BLZ 600 400 71<br />
›Künstler‹ erscheint in der<br />
<strong>Zeit</strong>verlag Beteiligungs GmbH & Co. KG<br />
Gründungsherausgeber<br />
Dr. Detlef Bluemler<br />
Prof. Lothar Romain †<br />
Redaktion<br />
Hans-Joachim Müller<br />
Dokumentation<br />
Andreas Gröner<br />
Geschäftsführer<br />
Dr. Rainer Esser<br />
Verlagsleiter<br />
Boris Alexander Kühnle<br />
Grafik<br />
Michael Müller<br />
Abonnement und Leserservice<br />
<strong>Zeit</strong>verlag Beteiligungs GmbH & Co. KG<br />
Nymphenburger Straße 84 · Postfach 19 09 18<br />
D-80609 München<br />
Tel. 0 89/12 69 90-0<br />
›Künstler‹ ist auch über den<br />
Buchhandel erhältlich<br />
Prepress<br />
Franzis print & media GmbH,<br />
München<br />
Druck<br />
Aumüller Druck KG,<br />
Regensburg<br />
Die Publikation und alle in ihr<br />
enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede<br />
Verwertung, die nicht ausdrücklich vom<br />
Urheberrechtsgesetz zugelassen ist,<br />
bedarf der vorherigen Zustimmung des<br />
Verlages. Dies gilt insbesondere für<br />
Vervielfältigungen, Bearbeitungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und<br />
die Einspeicherung und Verarbeitung<br />
in elektronischen Systemen.<br />
© <strong>Zeit</strong>verlag Beteiligungs GmbH & Co. KG,<br />
München 2007<br />
ISSN 0934-1730<br />
15
<strong>Fritz</strong><br />
<strong>Klemm</strong><br />
17 Frühe Wand, ca. 1968<br />
Gouache, Bleistift<br />
69 x 49,5 cm<br />
Courtesy Galerie Baumgarten, Freiburg<br />
16