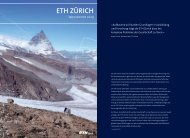PhYsik und Industrie - Felix Wuersten
PhYsik und Industrie - Felix Wuersten
PhYsik und Industrie - Felix Wuersten
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AKTUELLE ZUSAMMENARBEITEN<br />
Aufmerksamkeitsmodelle verfeinern <strong>und</strong> so die Entwicklung von<br />
aktiven künstlichen Seh-Systemen vorantreiben.<br />
ETH: Dr. Wolfgang Einhäuser, Peter König<br />
<strong>Industrie</strong>: Honda RI Europe GmbH<br />
Unüberwachte Datenklassifizierung («Clustering»)<br />
Wie können neue Arzneimittel möglichst günstig entwickelt werden?<br />
Eine neue Methode ist die kombinatorische Chemie. Hier werden<br />
nicht einzelne Substanzen synthetisiert, sondern Experimente<br />
gemacht, in denen eine Vielzahl von Produkten entstehen. Um diese<br />
effizient auf ihre Wirkung zu prüfen, werden nach gr<strong>und</strong>legenden<br />
physikalischen <strong>und</strong> chemischen Eigenschaften Klassen gebildet, aus<br />
denen nur noch der typische Vertreter getestet werden muss. Dazu<br />
werden Algorithmen entwickelt <strong>und</strong> verfeinert, welche autonom<br />
eine möglichst unvoreingenommene Klassifizierung vornehmen.<br />
ETH: PD Dr. Ruedi Stoop, Thomas Ott<br />
<strong>Industrie</strong>: Novartis, Basel<br />
Hörgeräte <strong>und</strong> Hörverständnis<br />
Mit einem herkömmlichen Hörgerät kann das ehemalige Hörverständnis<br />
nicht zurückgewonnen werden. Um herauszufinden,<br />
weshalb das so ist, muss zuerst verstanden werden, wie das Ohr<br />
funktioniert. Dazu wurde der biologische Hörvorgang in Form einer<br />
Differentialgleichung nachgebildet. Für deren Integration wurde<br />
dann eine elektronische Version des Modells entwickelt. Diese<br />
erlaubt, den Hörvorgang in ausserordentlicher Detailtreue nahezu<br />
in Echtzeit wiederzugegeben.<br />
ETH: PD Dr. Ruedi Stoop<br />
<strong>Industrie</strong>: Phonak AG, Stäfa<br />
Ein Gerät als Fre<strong>und</strong> des Physiologen<br />
Der «Pysiologist‘s Friend Chip» ist eine elektronische Schaltung, eine<br />
Art Bildsensor samt optischer Linse. Er dient zur Modellierung des visuellen<br />
Systems im Gehrin des Menschen. Dabei werden die künstlich<br />
erzeugten Nervenimpulse hörbar wiedergegeben <strong>und</strong> erlauben<br />
somit einen Einblick in die Datenverarbeitung. Das Gerät wird im<br />
Unterricht als Anschauungsmaterial eingesetzt wie auch im Labor<br />
der Physiologen zur Kallibrierung des Messgeräte-Parks verwendet.<br />
ETH: Dr. Tobi Delbrück<br />
<strong>Industrie</strong>: Internal Commercial Project<br />
Weiterentwicklung von interaktiven Bodenplatten<br />
Der intelligente Boden erkennt die Position von Personen <strong>und</strong> kann<br />
durch Lichteffekte in Interaktion mit ihnen treten. Damit lassen<br />
sich eine Vielzahl von Anwendungen realisieren, wie Spiele, Animationen<br />
oder Leitsysteme. Der Boden kann zusätzlich mit Kameras<br />
<strong>und</strong> Leinwandprojektionen gekoppelt werden. Die Bodenplatten<br />
von «Ada – the intelligent space», welche an der Expo.02 in Neuchâtel<br />
zum Einsatz kamen, werden zusammen mit der Westiform AG<br />
weiterentwickelt.<br />
ETH: Gerd Dietrich, Adrian Whatley<br />
<strong>Industrie</strong>: Westiform AG, Bern<br />
Neutronenstreuung<br />
http://lns.web.psi.ch/<br />
Herstellung <strong>und</strong> Charakterisierung von Neutronenleitern<br />
Neutronenstrahlen werden häufig verwendet, um auf atomarer<br />
Ebene Diffusionsprozesse, Magnetismus oder Gitterschwingungen<br />
in Festkörpern zu untersuchen. Da die Experimente einen hohen<br />
Platzbedarf haben, müssen die Neutronen über Strecken von<br />
bis zu 100 Metern transportiert werden. Der Transport erfolgt in<br />
Glas-Röhren, den Neutronenleitern, die mit h<strong>und</strong>erten aufeinander<br />
liegenden hauchdünnen Filmen beschichtet sind. Das Leiterdesign<br />
<strong>und</strong> die Beschichtungen sollen optimiert werden.<br />
ETH: Dr. Jochen Stahn<br />
<strong>Industrie</strong>: SwissNeutronics AG<br />
Kompensierter Magnet für Neutronenstreuexperimente<br />
Eigenschaften von Substanzen können mit Hilfe von Neutronenstreuung<br />
in starken Magnetfeldern untersucht werden. Soll diese<br />
Methode jedoch vermarktbar sein, muss der Magnet zwei Bedingungen<br />
erfüllen: Zunächst dürfen dort, wo die Probe ist, keine mechanische<br />
Teile die einfallenden <strong>und</strong> gestreuten Neutronen stören.<br />
Ausserdem soll das Magnetfeld ausserhalb des Magneten möglichst<br />
klein sein. Wenn der Hauptmagnet in zwei einzelne Spulen<br />
aufgeteilt <strong>und</strong> das äussere Feld mit Zusatzspulen kompensiert wird,<br />
scheint dieses Ziel erreichbar zu sein.<br />
ETH: Dr. Peter Allenspach<br />
<strong>Industrie</strong>: Bruker-Biospin, Fällanden<br />
Diffraktometrie an beschichteten Implantaten<br />
In der Medizinaltechnik ist die Qualitätskontrolle der Prothesenoberflächen<br />
wichtig. Damit sich zementlos implantierbare Hüft- <strong>und</strong><br />
Kniegelenke rasch <strong>und</strong> dauerhaft durch Knochengewebe verankern,<br />
werden die Implantate in einem Vakuum-Plasma-Spritzverfahren<br />
mit einer bioaktiven Beschichtung aus Calciumphosphat (Hydroxylapatit)<br />
überzogen. Eine langzeitstabile Fixation nach der Implantation<br />
setzt jedoch eine hohe Phasenreinheit dieser Beschichtung voraus.<br />
Mit Hilfe der Diffraktometrie kann sie überprüft werden.<br />
ETH: Prof. Hans Grimmer<br />
<strong>Industrie</strong>: Medicoat AG, Mägenswil<br />
Quantenelektronik<br />
www.iqe.ethz.ch/<br />
Spurengasnachweis in der petrochemischen <strong>Industrie</strong><br />
Aethylen ist die Basis für die Herstellung vieler Produkte der Kunststoffindustrie.<br />
Kleinste Mengen von verunreinigenden Gasen können<br />
unerwünschte chemische Reaktionen hervorrufen. Um diese<br />
Spurengase nachzuweisen, wird ein empfindlicher Gassensor erforscht<br />
<strong>und</strong> entwickelt.<br />
ETH: Prof. Markus W. Sigrist<br />
<strong>Industrie</strong>: ABB Corporate Research, Baden-Dättwil<br />
Atemluftanalyse zur medizinischen Diagnostik<br />
Das Wohlbefinden hängt nicht zuletzt auch von der Ges<strong>und</strong>heit der<br />
Leber ab. Ist dieses Organ krank, zeigt sich das unter anderem in der<br />
Ausatmungsluft. In dieser hat es jedoch über 400 Substanzen in<br />
teilweise sehr kleinen Konzentrationen – unter ihnen Methylamine,<br />
die sich für die Diagnostik von Leberfunktionsstörungen eignen. Für<br />
ihren Nachweis wird ein laserspektroskopisches Verfahren erforscht,<br />
das eine hohe Empfindlichkeit <strong>und</strong> Nachweisselektivität besitzt.<br />
ETH: Prof. Markus W. Sigrist<br />
<strong>Industrie</strong>: Roche Forschungsstiftung, Basel<br />
Faser-optische Sensoren<br />
Anspruchsvolle industrielle Prozesse müssen gesteuert <strong>und</strong> überwacht<br />
werden. Dazu braucht es Sensoren, die eine hohe Messempfindlichkeit<br />
aufweisen. Eine Machbarkeitsstudie befasst sich mit der<br />
Entwicklung neuartiger Sensoren, deren Messprinzip auf spektroskopischen<br />
Untersuchungen mit faser-optischen Kavitäten beruht.<br />
ETH: Prof. Markus W. Sigrist<br />
<strong>Industrie</strong>: ABB Corporate Research, Baden-Dättwil<br />
26