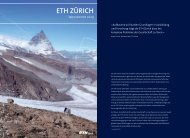PhYsik und Industrie - Felix Wuersten
PhYsik und Industrie - Felix Wuersten
PhYsik und Industrie - Felix Wuersten
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
STANDPUNKT<br />
Eine fruchtbare Beziehung<br />
Physik ist eine Naturwissenschaft.<br />
Sie fragt, wie die Welt beschaffen<br />
ist, welche Grenzen es gibt <strong>und</strong> was<br />
möglich sein könnte. Anders als etwa<br />
Ingenieure suchen Physiker nicht primär<br />
nach Lösungen für konkrete Probleme,<br />
sondern nach gr<strong>und</strong>legenden<br />
Zusammenhängen. Deshalb erstaunt<br />
es nicht, dass wichtige technische Entwicklungen<br />
immer wieder auf Einsichten<br />
in der Physik zurückgehen.<br />
Die moderne Kommunikationstechnik<br />
etwa wäre ohne die Arbeiten über<br />
Elektromagnetismus, Elektronik,<br />
Quantenmechanik <strong>und</strong> Quantenoptik<br />
im 19. <strong>und</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>ert schlicht<br />
<strong>und</strong>enkbar. Das Internet, das unseren<br />
Alltag in den letzten Jahren stark<br />
verändert hat, ist letztlich entstanden,<br />
weil Teilchenphysiker das World-<br />
Wide-Web entwickelten, um die gewaltigen<br />
Datenmengen ihrer Forschung<br />
effizient verarbeiten zu können. Umgekehrt<br />
können praktische Fragestellungen<br />
zu f<strong>und</strong>amental Neuem führen.<br />
Der Transistor als ein gezielt gesuchter<br />
Ersatz für die Verstärkerröhre oder<br />
die Entdeckung der Wellennatur des<br />
Elektrons beim Verbessern der Elektronenröhre<br />
sind gute Beispiele.<br />
Zürich für die <strong>Industrie</strong> nach wie vor<br />
attraktive Partner. Wer als technisch<br />
orientierter Hochschulphysiker Erfolg<br />
haben will, muss weit über den heutigen<br />
Stand der Technik hinaus denken<br />
<strong>und</strong> Probleme ansprechen, die sich<br />
für die <strong>Industrie</strong> vielleicht erst am<br />
Horizont abzeichnen.<br />
Grosse Herausforderung<br />
Ein solches Thema ist etwa die<br />
Taktrate von Computern. Diese lässt<br />
sich in herkömmlichen Mikroprozessoren<br />
ab einem gewissen Punkt nur<br />
noch mit grossem Aufwand steigern.<br />
Optische Taktgeber sind eine mögliche<br />
Alternative; die heute bekannten<br />
Konzepte überzeugen allerdings noch<br />
nicht, es fehlen nach wie vor wichtige<br />
«Puzzleteile». Ein Durchbruch kann<br />
nur mit zusätzlicher Forschung erreicht<br />
werden. Für die <strong>Industrie</strong> ist<br />
diese Phase eine grosse Herausforderung:<br />
Kurzfristig soll ein weites Spektrum<br />
von möglichen Lösungswegen<br />
ausgelotet werden. Physiker an Hochschulen<br />
sind geeignete Partner, da sie<br />
gwohnt sind, sich auf unbekanntes<br />
Terrain vorzuwagen <strong>und</strong> über spezifische<br />
Qualitifkationen verfügen.<br />
Für die <strong>Industrie</strong> zahlt sich eine solche<br />
langfristig orientierte Zusammenarbeit<br />
mehrfach aus. Erstens kann sie<br />
mit Hilfe der Hochschule Probleme<br />
lösen, die mittel- bis langfristig die<br />
technische Entwicklung behindern.<br />
Zweitens kann sie – je nach Vertrag<br />
– zu wertvollem geistigem Eigentum<br />
kommen. Und drittens werden durch<br />
solche Projekte Nachwuchsforscher<br />
ausgebildet, die später als qualifizierte<br />
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.<br />
Absolventen eines Studiums in Physik<br />
sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt,<br />
weil sie dank ihrer Vielseitigkeit <strong>und</strong><br />
der Fähigkeit, Probleme selbständig<br />
zu lösen, in unterschiedlichen Bereichen<br />
erfolgreich wirken können.<br />
Eine Hochschule wie die ETH Zürich<br />
hat die Aufgabe, Erkenntnisse zu<br />
gewinnen <strong>und</strong> sie der Gesellschaft zugänglich<br />
zu machen. In der <strong>Industrie</strong><br />
wird dieses Wissen umgesetzt. Erfolgreiche<br />
Firmen pflegen die Zusammenarbeit<br />
mit der Hochschule nicht nur,<br />
um als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten,<br />
sondern auch, um ihre Innovationskraft<br />
zu stärken.<br />
Bertram Batlogg, Ursula Keller<br />
<strong>und</strong> Gert Viertel<br />
Die drei Autoren sind Professoren am Departement<br />
Physik der ETH Zürich.<br />
Verändertes Umfeld<br />
Physik <strong>und</strong> <strong>Industrie</strong> bilden seit langem<br />
eine fruchtbare Partnerschaft. In<br />
den letzten Jahren hat sich das Umfeld<br />
dieser Beziehung aber verändert.<br />
Die Firmen stehen unter Druck, ihre<br />
Mittel möglichst zielgerichtet einzusetzen.<br />
Nur noch wenige der ehemals<br />
grossen industriellen Forschungslabors<br />
haben den Umbau der <strong>Industrie</strong><br />
überstanden. Die Produktzyklen<br />
werden immer kürzer, doch bleibt<br />
es das Ziel, Forschungsresultate zum<br />
kompetitiven Vorteil auszunützen. Bis<br />
die Erkenntnisse der Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
in Produkte umgesetzt werden,<br />
verstreicht aber oft etliche Zeit.<br />
Gerade weil sich das wirtschaftliche<br />
Umfeld verändert hat, sind die Physikerinnen<br />
<strong>und</strong> Physiker der ETH<br />
«Für die <strong>Industrie</strong> zahlt sich eine solche<br />
Zusammenarbeit mehrfach aus.»<br />
2