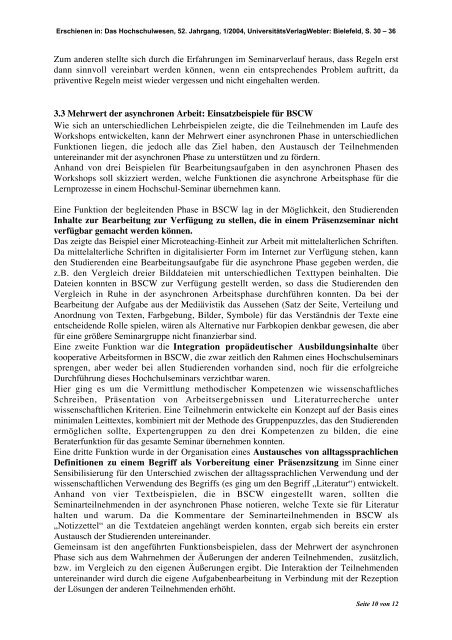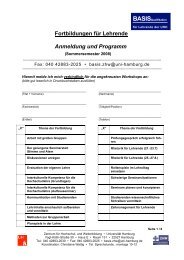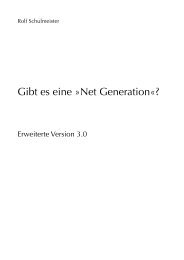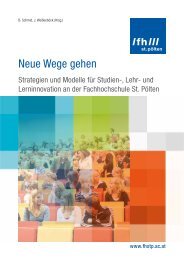"Den Austausch organisieren" - Der didaktische Einsatz von Online ...
"Den Austausch organisieren" - Der didaktische Einsatz von Online ...
"Den Austausch organisieren" - Der didaktische Einsatz von Online ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erschienen in: Das Hochschulwesen, 52. Jahrgang, 1/2004, UniversitätsVerlagWebler: Bielefeld, S. 30 – 36<br />
Zum anderen stellte sich durch die Erfahrungen im Seminarverlauf heraus, dass Regeln erst<br />
dann sinnvoll vereinbart werden können, wenn ein entsprechendes Problem auftritt, da<br />
präventive Regeln meist wieder vergessen und nicht eingehalten werden.<br />
3.3 Mehrwert der asynchronen Arbeit: <strong>Einsatz</strong>beispiele für BSCW<br />
Wie sich an unterschiedlichen Lehrbeispielen zeigte, die die Teilnehmenden im Laufe des<br />
Workshops entwickelten, kann der Mehrwert einer asynchronen Phase in unterschiedlichen<br />
Funktionen liegen, die jedoch alle das Ziel haben, den <strong>Austausch</strong> der Teilnehmenden<br />
untereinander mit der asynchronen Phase zu unterstützen und zu fördern.<br />
Anhand <strong>von</strong> drei Beispielen für Bearbeitungsaufgaben in den asynchronen Phasen des<br />
Workshops soll skizziert werden, welche Funktionen die asynchrone Arbeitsphase für die<br />
Lernprozesse in einem Hochschul-Seminar übernehmen kann.<br />
Eine Funktion der begleitenden Phase in BSCW lag in der Möglichkeit, den Studierenden<br />
Inhalte zur Bearbeitung zur Verfügung zu stellen, die in einem Präsenzseminar nicht<br />
verfügbar gemacht werden können.<br />
Das zeigte das Beispiel einer Microteaching-Einheit zur Arbeit mit mittelalterlichen Schriften.<br />
Da mittelalterliche Schriften in digitalisierter Form im Internet zur Verfügung stehen, kann<br />
den Studierenden eine Bearbeitungsaufgabe für die asynchrone Phase gegeben werden, die<br />
z.B. den Vergleich dreier Bilddateien mit unterschiedlichen Texttypen beinhalten. Die<br />
Dateien konnten in BSCW zur Verfügung gestellt werden, so dass die Studierenden den<br />
Vergleich in Ruhe in der asynchronen Arbeitsphase durchführen konnten. Da bei der<br />
Bearbeitung der Aufgabe aus der Mediävistik das Aussehen (Satz der Seite, Verteilung und<br />
Anordnung <strong>von</strong> Texten, Farbgebung, Bilder, Symbole) für das Verständnis der Texte eine<br />
entscheidende Rolle spielen, wären als Alternative nur Farbkopien denkbar gewesen, die aber<br />
für eine größere Seminargruppe nicht finanzierbar sind.<br />
Eine zweite Funktion war die Integration propädeutischer Ausbildungsinhalte über<br />
kooperative Arbeitsformen in BSCW, die zwar zeitlich den Rahmen eines Hochschulseminars<br />
sprengen, aber weder bei allen Studierenden vorhanden sind, noch für die erfolgreiche<br />
Durchführung dieses Hochchulseminars verzichtbar waren.<br />
Hier ging es um die Vermittlung methodischer Kompetenzen wie wissenschaftliches<br />
Schreiben, Präsentation <strong>von</strong> Arbeitsergebnissen und Literaturrecherche unter<br />
wissenschaftlichen Kriterien. Eine Teilnehmerin entwickelte ein Konzept auf der Basis eines<br />
minimalen Leittextes, kombiniert mit der Methode des Gruppenpuzzles, das den Studierenden<br />
ermöglichen sollte, Expertengruppen zu den drei Kompetenzen zu bilden, die eine<br />
Beraterfunktion für das gesamte Seminar übernehmen konnten.<br />
Eine dritte Funktion wurde in der Organisation eines <strong>Austausch</strong>es <strong>von</strong> alltagssprachlichen<br />
Definitionen zu einem Begriff als Vorbereitung einer Präsenzsitzung im Sinne einer<br />
Sensibilisierung für den Unterschied zwischen der alltagssprachlichen Verwendung und der<br />
wissenschaftlichen Verwendung des Begriffs (es ging um den Begriff „Literatur“) entwickelt.<br />
Anhand <strong>von</strong> vier Textbeispielen, die in BSCW eingestellt waren, sollten die<br />
Seminarteilnehmenden in der asynchronen Phase notieren, welche Texte sie für Literatur<br />
halten und warum. Da die Kommentare der Seminarteilnehmenden in BSCW als<br />
„Notizzettel“ an die Textdateien angehängt werden konnten, ergab sich bereits ein erster<br />
<strong>Austausch</strong> der Studierenden untereinander.<br />
Gemeinsam ist den angeführten Funktionsbeispielen, dass der Mehrwert der asynchronen<br />
Phase sich aus dem Wahrnehmen der Äußerungen der anderen Teilnehmenden, zusätzlich,<br />
bzw. im Vergleich zu den eigenen Äußerungen ergibt. Die Interaktion der Teilnehmenden<br />
untereinander wird durch die eigene Aufgabenbearbeitung in Verbindung mit der Rezeption<br />
der Lösungen der anderen Teilnehmenden erhöht.<br />
Seite 10 <strong>von</strong> 12