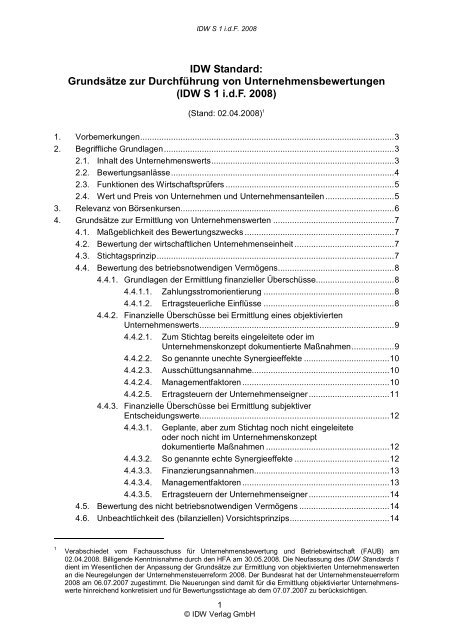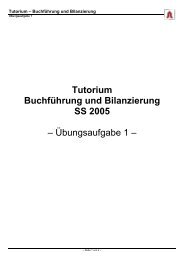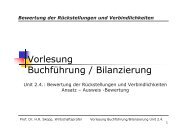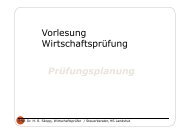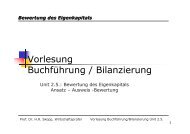IDW S 1 idF 2008 - Prof-skopp.de
IDW S 1 idF 2008 - Prof-skopp.de
IDW S 1 idF 2008 - Prof-skopp.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
<strong>IDW</strong> Standard:<br />
Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen<br />
(<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong>)<br />
(Stand: 02.04.<strong>2008</strong>) 1<br />
1. Vorbemerkungen ........................................................................................................... 3<br />
2. Begriffliche Grundlagen ................................................................................................. 3<br />
2.1. Inhalt <strong>de</strong>s Unternehmenswerts ............................................................................. 3<br />
2.2. Bewertungsanlässe .............................................................................................. 4<br />
2.3. Funktionen <strong>de</strong>s Wirtschaftsprüfers ....................................................................... 5<br />
2.4. Wert und Preis von Unternehmen und Unternehmensanteilen ............................. 5<br />
3. Relevanz von Börsenkursen .......................................................................................... 6<br />
4. Grundsätze zur Ermittlung von Unternehmenswerten ................................................... 7<br />
4.1. Maßgeblichkeit <strong>de</strong>s Bewertungszwecks ............................................................... 7<br />
4.2. Bewertung <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Unternehmenseinheit .......................................... 7<br />
4.3. Stichtagsprinzip .................................................................................................... 7<br />
4.4. Bewertung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens ................................................. 8<br />
4.4.1. Grundlagen <strong>de</strong>r Ermittlung finanzieller Überschüsse ................................. 8<br />
4.4.1.1. Zahlungsstromorientierung ....................................................... 8<br />
4.4.1.2. Ertragsteuerliche Einflüsse ....................................................... 8<br />
4.4.2. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung eines objektivierten<br />
Unternehmenswerts .................................................................................. 9<br />
4.4.2.1. Zum Stichtag bereits eingeleitete o<strong>de</strong>r im<br />
Unternehmenskonzept dokumentierte Maßnahmen .................. 9<br />
4.4.2.2. So genannte unechte Synergieeffekte .................................... 10<br />
4.4.2.3. Ausschüttungsannahme.......................................................... 10<br />
4.4.2.4. Managementfaktoren .............................................................. 10<br />
4.4.2.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner .................................. 11<br />
4.4.3. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung subjektiver<br />
Entscheidungswerte................................................................................ 12<br />
4.4.3.1. Geplante, aber zum Stichtag noch nicht eingeleitete<br />
o<strong>de</strong>r noch nicht im Unternehmenskonzept<br />
dokumentierte Maßnahmen .................................................... 12<br />
4.4.3.2. So genannte echte Synergieeffekte ........................................ 12<br />
4.4.3.3. Finanzierungsannahmen ......................................................... 13<br />
4.4.3.4. Managementfaktoren .............................................................. 13<br />
4.4.3.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner .................................. 14<br />
4.5. Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens ...................................... 14<br />
4.6. Unbeachtlichkeit <strong>de</strong>s (bilanziellen) Vorsichtsprinzips .......................................... 14<br />
1<br />
Verabschie<strong>de</strong>t vom Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) am<br />
02.04.<strong>2008</strong>. Billigen<strong>de</strong> Kenntnisnahme durch <strong>de</strong>n HFA am 30.05.<strong>2008</strong>. Die Neufassung <strong>de</strong>s <strong>IDW</strong> Standards 1<br />
dient im Wesentlichen <strong>de</strong>r Anpassung <strong>de</strong>r Grundsätze zur Ermittlung von objektivierten Unternehmenswerten<br />
an die Neuregelungen <strong>de</strong>r Unternehmensteuerreform <strong>2008</strong>. Der Bun<strong>de</strong>srat hat <strong>de</strong>r Unternehmensteuerreform<br />
<strong>2008</strong> am 06.07.2007 zugestimmt. Die Neuerungen sind damit für die Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte<br />
hinreichend konkretisiert und für Bewertungsstichtage ab <strong>de</strong>m 07.07.2007 zu berücksichtigen.<br />
1<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
4.7. Nachvollziehbarkeit <strong>de</strong>r Bewertungsansätze ...................................................... 15<br />
5. Prognose <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse ....................................................... 15<br />
5.1. Informationsbeschaffung .................................................................................... 15<br />
5.2. Vergangenheitsanalyse ...................................................................................... 16<br />
5.3. Planung und Prognose (Phasenmetho<strong>de</strong>) .......................................................... 16<br />
5.4. Plausibilitätsbeurteilung <strong>de</strong>r Planungen .............................................................. 17<br />
5.5. Verwendung verlässlicher Bewertungsunterlagen .............................................. 18<br />
6. Kapitalisierung <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse ............................................... 18<br />
6.1. Grundlagen ........................................................................................................ 18<br />
6.2. Berücksichtigung <strong>de</strong>s Risikos ............................................................................. 18<br />
6.3. Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern im Kapitalisierungszinssatz .......... 19<br />
6.4. Berücksichtigung wachsen<strong>de</strong>r finanzieller Überschüsse..................................... 20<br />
6.5. Brutto- o<strong>de</strong>r Nettokapitalisierung ........................................................................ 21<br />
7. Bewertungsverfahren .................................................................................................. 21<br />
7.1. Anwendung von Ertragswert- o<strong>de</strong>r DCF-Verfahren ............................................ 21<br />
7.2. Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts nach <strong>de</strong>m Ertragswertverfahren ................. 22<br />
7.2.1. Grundsätzliches Vorgehen ...................................................................... 22<br />
7.2.2. Ermittlung <strong>de</strong>r Ertragsüberschüsse aus <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen<br />
Vermögen ............................................................................................... 22<br />
7.2.2.1. Bereinigung <strong>de</strong>r Vergangenheitserfolgsrechnung.................... 22<br />
7.2.2.2. Planung <strong>de</strong>r Aufwendungen und Erträge ................................ 22<br />
7.2.2.3. Finanzplanung und Zinsprognose ........................................... 23<br />
7.2.3. Ermittlung <strong>de</strong>r Überschüsse aus nicht betriebsnotwendigem<br />
Vermögen ............................................................................................... 23<br />
7.2.4. Ermittlung <strong>de</strong>s Kapitalisierungszinssatzes .............................................. 23<br />
7.2.4.1. Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter<br />
Unternehmenswerte ................................................................ 23<br />
7.2.4.2. Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver<br />
Entscheidungswerte ................................................................ 25<br />
7.3. Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts nach <strong>de</strong>n DCF-Verfahren ........................... 25<br />
7.3.1. Überblick ............................................................................................... 25<br />
7.3.2. Das Konzept <strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten (WACC-Ansatz) .................. 26<br />
7.3.2.1. Grundsätzliches Vorgehen ...................................................... 26<br />
7.3.2.2. Bestimmung <strong>de</strong>r künftigen Free Cashflows ............................. 26<br />
7.3.2.3. Ermittlung <strong>de</strong>s Residualwerts .................................................. 27<br />
7.3.2.4. Wert <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens .................... 27<br />
7.3.2.5. Ermittlung <strong>de</strong>r Kapitalkosten ................................................... 27<br />
7.3.3. Das Konzept <strong>de</strong>s angepassten Barwerts (APV-Ansatz) .......................... 28<br />
7.3.4. Das Konzept <strong>de</strong>r direkten Ermittlung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>s Eigenkapitals<br />
(Equity-Ansatz) ....................................................................................... 28<br />
7.3.5. Berücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen Ertragsteuern <strong>de</strong>r<br />
Unternehmenseigner .............................................................................. 28<br />
7.4. Ermittlung von Liquidationswerten ...................................................................... 28<br />
7.5. Anhaltspunkte für Plausibilitätsbeurteilungen ..................................................... 29<br />
7.5.1. Börsenpreis ............................................................................................ 29<br />
7.5.2. Vereinfachte Preisfindungen ................................................................... 29<br />
2<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
8. Beson<strong>de</strong>rheiten bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung ....................................................... 29<br />
8.1. Bewertung wachstumsstarker Unternehmen ...................................................... 29<br />
8.2. Bewertung ertragsschwacher Unternehmen ....................................................... 30<br />
8.2.1. Grundsätzliches ...................................................................................... 30<br />
8.2.2. Unternehmen mit nicht vorrangig finanzieller Zielsetzung ....................... 30<br />
8.3. Bewertung kleiner und mittelgroßer Unternehmen ............................................. 31<br />
8.3.1. Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts ....................................................... 31<br />
8.3.2. Bestimmung <strong>de</strong>s Unternehmerlohns ....................................................... 32<br />
8.3.3. Eingeschränkte Informationsquellen ....................................................... 32<br />
8.3.3.1. Bereinigung <strong>de</strong>r Vergangenheitsergebnisse............................ 32<br />
8.3.3.2. Analyse <strong>de</strong>r Ertragskraft.......................................................... 32<br />
8.3.4. Vereinfachte Preisfindungen ................................................................... 33<br />
8.4. Substanzwert ..................................................................................................... 33<br />
9. Dokumentation und Berichterstattung.......................................................................... 34<br />
9.1. Arbeitspapiere .................................................................................................... 34<br />
9.2. Bewertungsgutachten ......................................................................................... 34<br />
1. Vorbemerkungen<br />
1 Dieser <strong>IDW</strong> Standard legt vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r in Theorie, Praxis und Rechtsprechung<br />
entwickelten Standpunkte die Grundsätze dar, nach <strong>de</strong>nen Wirtschaftsprüfer<br />
Unternehmen bewerten. Die Ausführungen stellen wesentliche allgemeine<br />
Grundsätze dar. Je<strong>de</strong>r Bewertungsfall verlangt seine eigene fachgerechte Problemlösung.<br />
Insoweit können die Grundsätze nur <strong>de</strong>n Rahmen festlegen, in <strong>de</strong>m die<br />
eigenverantwortliche Lösung im Einzelfall liegen muss.<br />
2 Fälle vertraglicher o<strong>de</strong>r auftragsgemäßer Wertfeststellungen, die sich nach abweichen<strong>de</strong>n<br />
vorgegebenen Regelungen richten, bleiben von diesem <strong>IDW</strong> Standard unberührt.<br />
So können beispielsweise durch <strong>de</strong>n Bewertungsauftrag an<strong>de</strong>re Bewertungsverfahren,<br />
die Berücksichtigung nicht finanzieller Ziele, Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>s<br />
Prognoseverfahrens o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re von diesem <strong>IDW</strong> Standard abweichen<strong>de</strong> Vorgaben<br />
umschrieben sein.<br />
3 Dieser <strong>IDW</strong> Standard ersetzt <strong>de</strong>n <strong>IDW</strong> Standard: Grundsätze zur Durchführung von<br />
Unternehmensbewertungen (<strong>IDW</strong> S 1) i.d.F. vom 18.10.2005. 2<br />
2. Begriffliche Grundlagen<br />
2.1. Inhalt <strong>de</strong>s Unternehmenswerts<br />
4 Der Wert eines Unternehmens bestimmt sich unter <strong>de</strong>r Voraussetzung ausschließlich<br />
finanzieller Ziele durch <strong>de</strong>n Barwert <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Eigentum an <strong>de</strong>m Unternehmen<br />
verbun<strong>de</strong>nen Nettozuflüsse an die Unternehmenseigner (Nettoeinnahmen als<br />
Saldo von Ausschüttungen bzw. Entnahmen, Kapitalrückzahlungen und Einlagen).<br />
Zur Ermittlung dieses Barwerts wird ein Kapitalisierungszinssatz verwen<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r die<br />
Rendite aus einer zur Investition in das zu bewerten<strong>de</strong> Unternehmen adäquaten<br />
2<br />
WPg 2005, S. 1303, FN-<strong>IDW</strong> 2005, S. 690.<br />
3<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
Alternativanlage repräsentiert. Demnach wird <strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>s Unternehmens allein aus<br />
seiner Ertragskraft, d.h. seiner Eigenschaft, finanzielle Überschüsse für die Unternehmenseigner<br />
zu erwirtschaften, abgeleitet.<br />
5 Dieser Wert ergibt sich grundsätzlich aus <strong>de</strong>n finanziellen Überschüssen, die bei<br />
Fortführung <strong>de</strong>s Unternehmens und Veräußerung etwaigen nicht betriebsnotwendigen<br />
Vermögens erwirtschaftet wer<strong>de</strong>n (Zukunftserfolgswert). Nur für <strong>de</strong>n Fall, dass<br />
<strong>de</strong>r Barwert <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse, die sich bei Liquidation <strong>de</strong>s gesamten<br />
Unternehmens ergeben (Liquidationswert), <strong>de</strong>n Fortführungswert übersteigt, kommt<br />
<strong>de</strong>r Liquidationswert als Unternehmenswert in Betracht.<br />
6 Dagegen kommt <strong>de</strong>m Substanzwert bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts keine<br />
eigenständige Be<strong>de</strong>utung zu.<br />
7 Der Unternehmenswert wird grundsätzlich als Zukunftserfolgswert ermittelt. In <strong>de</strong>r<br />
Unternehmensbewertungspraxis haben sich als gängige Verfahren das Ertragswertverfahren<br />
(vgl. Abschn. 7.2.) und die Discounted Cash Flow-Verfahren<br />
(vgl. Abschn. 7.3.) herausgebil<strong>de</strong>t.<br />
2.2. Bewertungsanlässe<br />
8 Die Anlässe für Unternehmensbewertungen können sich im Zusammenhang mit<br />
unternehmerischen Initiativen, aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r externen Rechnungslegung, aus<br />
gesellschaftsrechtlichen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren gesetzlichen Vorschriften bzw. vertraglichen<br />
Vereinbarungen o<strong>de</strong>r aus sonstigen Grün<strong>de</strong>n ergeben.<br />
9 Unternehmensbewertungen wer<strong>de</strong>n bei vielfältigen Anlässen unternehmerischer<br />
Initiativen, wie z.B. Kauf o<strong>de</strong>r Verkauf von Unternehmen, Fusionen, Zuführungen<br />
von Eigen- o<strong>de</strong>r Fremdkapital, Sacheinlagen (einschließlich <strong>de</strong>r Übertragung <strong>de</strong>s<br />
ganzen Gesellschaftsvermögens), Börsengang, Management Buy Out o<strong>de</strong>r im<br />
Rahmen von wertorientierten Managementkonzepten vorgenommen.<br />
10 Unternehmen sind ferner ggf. unter Anwendung spezieller Bewertungsstandards 3<br />
regelmäßig für Zwecke <strong>de</strong>r externen Rechnungslegung (z.B. Kaufpreisallokation<br />
und Impairmenttest) und aus steuerrechtlichen Grün<strong>de</strong>n (z.B. konzerninterne Umstrukturierung)<br />
zu bewerten.<br />
11 Bewertungen aufgrund gesellschaftsrechtlicher Regelungen ergeben sich insbeson<strong>de</strong>re<br />
aus <strong>de</strong>n aktienrechtlichen Regelungen zum Abschluss von Unternehmensverträgen<br />
bzw. zur Einglie<strong>de</strong>rung o<strong>de</strong>r zum Squeeze Out (Ermittlung <strong>de</strong>s angemessenen<br />
Ausgleichs, <strong>de</strong>r Abfindung in Aktien sowie <strong>de</strong>r Barabfindung). Darüber hinaus<br />
sieht z.B. das Umwandlungsgesetz die Ermittlung von Barabfindungen sowie von<br />
Umtauschverhältnissen im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Prüfung <strong>de</strong>s Verschmelzungsbzw.<br />
Spaltungsberichts vor.<br />
3<br />
Vgl. <strong>IDW</strong> Stellungnahme zur Rechnungslegung: Anwendung <strong>de</strong>r Grundsätze <strong>de</strong>s <strong>IDW</strong> S 1 bei <strong>de</strong>r Bewertung<br />
von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen für die Zwecke eines han<strong>de</strong>lsrechtlichen Jahresabschlusses<br />
(<strong>IDW</strong> RS HFA 10), WPg 2005, S. 1322, FN-<strong>IDW</strong> 2005, S. 718 sowie <strong>IDW</strong> Stellungnahme zur Rechnungslegung:<br />
Bewertungen bei <strong>de</strong>r Abbildung von Unternehmenserwerben und bei Werthaltigkeitsprüfungen<br />
nach IFRS (<strong>IDW</strong> RS HFA 16), WPg 2005, S. 1415, FN-<strong>IDW</strong> 2005, S. 721.<br />
4<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
Bewertungen auf vertraglicher Grundlage erfolgen insbeson<strong>de</strong>re beim Eintritt und<br />
Austritt von Gesellschaftern aus einer Personengesellschaft, bei Erbauseinan<strong>de</strong>rsetzungen<br />
und Erbteilungen sowie bei Abfindungsfällen im Familienrecht. 4<br />
2.3. Funktionen <strong>de</strong>s Wirtschaftsprüfers<br />
12 Bei <strong>de</strong>r Bewertung von Unternehmen kann <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer in verschie<strong>de</strong>nen<br />
Funktionen tätig wer<strong>de</strong>n:<br />
· Neutraler Gutachter<br />
In <strong>de</strong>r Funktion als neutraler Gutachter wird <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer als Sachverständiger<br />
tätig, <strong>de</strong>r mit nachvollziehbarer Methodik einen von <strong>de</strong>n individuellen<br />
Wertvorstellungen betroffener Parteien unabhängigen Wert <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
– <strong>de</strong>n objektivierten Unternehmenswert – ermittelt.<br />
· Berater<br />
In <strong>de</strong>r Beratungsfunktion ermittelt <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer einen subjektiven Entscheidungswert,<br />
<strong>de</strong>r z.B. angeben kann, was – unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen<br />
individuellen Möglichkeiten und Planungen – ein bestimmter Investor<br />
für ein Unternehmen höchstens anlegen darf (Preisobergrenze) o<strong>de</strong>r ein Verkäufer<br />
min<strong>de</strong>stens verlangen muss (Preisuntergrenze), um seine ökonomische Situation<br />
durch die Transaktion nicht zu verschlechtern.<br />
· Schiedsgutachter/Vermittler<br />
In <strong>de</strong>r Schiedsgutachter-/Vermittlerfunktion wird <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer tätig, <strong>de</strong>r in<br />
einer Konfliktsituation unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen subjektiven<br />
Wertvorstellungen <strong>de</strong>r Parteien einen Einigungswert als Schiedsgutachter feststellt<br />
o<strong>de</strong>r als Vermittler vorschlägt.<br />
2.4. Wert und Preis von Unternehmen und Unternehmensanteilen<br />
13 Während sich <strong>de</strong>r Unternehmenswert als Gesamtwert <strong>de</strong>s Unternehmens auf alle<br />
Unternehmenseigner bezieht, entspricht <strong>de</strong>r Wert eines Unternehmensanteils <strong>de</strong>m<br />
jeweiligen Anteil eines Unternehmenseigners am Unternehmen.<br />
Der Wert für einen Unternehmensanteil kann direkt o<strong>de</strong>r indirekt ermittelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>r direkten Anteilsbewertung wird <strong>de</strong>r Anteilswert direkt aus <strong>de</strong>n Zahlungsströmen<br />
zwischen <strong>de</strong>m Unternehmen und <strong>de</strong>m einzelnen Anteilseigner abgeleitet.<br />
Bei <strong>de</strong>r indirekten Anteilsbewertung wird <strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>s Unternehmensanteils aus<br />
<strong>de</strong>m Gesamtwert <strong>de</strong>s Unternehmens abgeleitet.<br />
Der objektivierte Wert <strong>de</strong>s Unternehmensanteils entspricht <strong>de</strong>m quotalen Wertanteil<br />
am objektivierten Gesamtwert <strong>de</strong>s Unternehmens. Der subjektive Wert eines Unternehmensanteils<br />
beinhaltet die Einschätzung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>r Beteiligung an einem<br />
Unternehmen unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r individuellen persönlichen Verhältnisse<br />
und Ziele <strong>de</strong>s (jeweiligen) Anteilseigners; Bewertungsparameter sind <strong>de</strong>shalb neben<br />
4<br />
Vgl. <strong>IDW</strong> Stellungnahme HFA 2/1995: Zur Unternehmensbewertung im Familien- und Erbrecht, WPg 1995,<br />
S. 522, FN-<strong>IDW</strong> 1995, S. 309.<br />
5<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
<strong>de</strong>r Anteilsquote insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>ne Einfluss <strong>de</strong>s Anteilseigners<br />
auf die Unternehmenspolitik sowie erwartete Synergieeffekte.<br />
Der Preis für Unternehmen und Unternehmensanteile bil<strong>de</strong>t sich auf freien Kapitalmärkten<br />
aus Angebot und Nachfrage. Er wird wesentlich von <strong>de</strong>r Nutzenschätzung<br />
(Grenznutzen) <strong>de</strong>r jeweiligen Käufer und Verkäufer bestimmt und kann je nach <strong>de</strong>m<br />
mengenmäßigen Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sowie <strong>de</strong>n Einflussmöglichkeiten<br />
<strong>de</strong>r Unternehmenseigner auf die Unternehmenspolitik (Alleineigentum,<br />
qualifizierte o<strong>de</strong>r einfache Mehrheit, Sperrminorität o<strong>de</strong>r Streubesitz) mehr o<strong>de</strong>r<br />
weniger stark von <strong>de</strong>m Wert <strong>de</strong>s gesamten Unternehmens o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m quotalen Anteil<br />
am Unternehmensgesamtwert abweichen.<br />
Tatsächlich gezahlte Preise für Unternehmen und Unternehmensanteile können –<br />
sofern Vergleichbarkeit mit <strong>de</strong>m Bewertungsobjekt und hinreichen<strong>de</strong> Zeitnähe gegeben<br />
sind – zur Beurteilung <strong>de</strong>r Plausibilität von Unternehmenswerten und Anteilswerten<br />
dienen, sie ersetzen aber keine Unternehmensbewertung.<br />
3. Relevanz von Börsenkursen<br />
14 Der nach <strong>de</strong>n in diesem <strong>IDW</strong> Standard dargestellten Grundsätzen ermittelte Unternehmenswert<br />
bzw. Wert von Unternehmensanteilen ist zu unterschei<strong>de</strong>n von Börsenkursen<br />
bzw. einer auf Basis von Börsenkursen ermittelten Börsenkapitalisierung<br />
(Anzahl <strong>de</strong>r Aktien multipliziert mit <strong>de</strong>m Börsenkurs): So beruhen Unternehmensbewertungen<br />
auf <strong>de</strong>tailliert analysierten Daten zum Bewertungsobjekt, insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>r i.d.R. <strong>de</strong>m Kapitalmarkt und einer breiteren Öffentlichkeit nicht zugänglichen<br />
Planungsrechnung und <strong>de</strong>m Unternehmenskonzept.<br />
15 Sofern für Unternehmensanteile Börsenkurse zur Verfügung stehen, sind diese bei<br />
Unternehmensbewertungen zur Plausibilitätsbeurteilung <strong>de</strong>s nach <strong>de</strong>n Grundsätzen<br />
dieses <strong>IDW</strong> Standards ermittelten Unternehmens- o<strong>de</strong>r Anteilswerts heranzuziehen.<br />
Hierbei sind beson<strong>de</strong>re Einflüsse, die sich möglicherweise auf die Börsenpreisbildung<br />
ausgewirkt haben, sorgfältig zu analysieren und darzustellen (z.B. geringer<br />
Anteil börsengehan<strong>de</strong>lter Anteile, beson<strong>de</strong>re Marktsituationen).<br />
Sachlich nicht begründbare wesentliche Abweichungen zwischen <strong>de</strong>m ermittelten<br />
Zukunftserfolgswert und <strong>de</strong>m Börsenkurs sollten zum Anlass genommen wer<strong>de</strong>n,<br />
die <strong>de</strong>r Bewertung zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Ausgangsdaten und Prämissen kritisch zu<br />
überprüfen.<br />
16 Bei einigen speziellen Unternehmensbewertungsanlässen (z.B. Abfindung und Ausgleich<br />
gemäß §§ 304, 305 AktG, § 320b AktG sowie §§ 327a f. AktG) ist <strong>de</strong>r Verkehrswert<br />
von börsennotierten Aktien nach <strong>de</strong>r höchstrichterlichen Rechtsprechung<br />
nicht ohne Rücksicht auf <strong>de</strong>n Börsenkurs zu ermitteln. 5 Grundsätzlich ist das Ertragswertverfahren<br />
auch in diesen Bewertungsanlässen höchstrichterlich anerkannt. Sofern<br />
in diesen Fällen <strong>de</strong>r Ertragswert aber unter <strong>de</strong>m Börsenkurs liegt, ist <strong>de</strong>r Börsenkurs<br />
als Min<strong>de</strong>stgröße heranzuziehen. Dies gilt jedoch nicht, wenn <strong>de</strong>r Börsenkurs –<br />
z.B. bei fehlen<strong>de</strong>r Marktgängigkeit o<strong>de</strong>r Manipulation <strong>de</strong>s Börsenkurses – nicht <strong>de</strong>m<br />
5<br />
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 27.04.1999 – 1 BvR 1613/94, DB 1999, S. 1693.<br />
6<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
Verkehrswert <strong>de</strong>r Aktien entspricht. 6 Stets ist beim Heranziehen <strong>de</strong>s Börsenkurses<br />
auf einen geeigneten Durchschnittskurs abzustellen.<br />
4. Grundsätze zur Ermittlung von Unternehmenswerten<br />
4.1. Maßgeblichkeit <strong>de</strong>s Bewertungszwecks<br />
17 In Abhängigkeit vom zu ermitteln<strong>de</strong>n Unternehmenswert (objektivierter Unternehmenswert,<br />
subjektiver Entscheidungswert, Einigungswert) ergeben sich<br />
i.d.R. unterschiedliche Annahmen über die Prognose und Diskontierung <strong>de</strong>r künftigen<br />
finanziellen Überschüsse, Art und Umfang einzubeziehen<strong>de</strong>r Synergien sowie<br />
zu persönlichen Verhältnissen <strong>de</strong>r Anteilseigner bzw. <strong>de</strong>ren anlassbezogener Typisierung.<br />
Daher setzt eine sachgerechte Unternehmenswertermittlung voraus, dass<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Auftragserteilung festgelegt wird, in welcher Funktion <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />
tätig wird, um daraus die <strong>de</strong>m jeweiligen Bewertungszweck entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Annahmen und Typisierungen herleiten zu können.<br />
4.2. Bewertung <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Unternehmenseinheit<br />
18 Unternehmen sind zweckgerichtete Kombinationen von materiellen und immateriellen<br />
Werten, durch <strong>de</strong>ren Zusammenwirken finanzielle Überschüsse erwirtschaftet<br />
wer<strong>de</strong>n sollen. Der Wert eines Unternehmens wird <strong>de</strong>shalb nicht durch die Werte<br />
<strong>de</strong>r einzelnen Bestandteile <strong>de</strong>s Vermögens und <strong>de</strong>r Schul<strong>de</strong>n bestimmt, son<strong>de</strong>rn<br />
durch das Zusammenwirken aller Werte.<br />
19 Bei <strong>de</strong>r Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts ist die Gesamtheit aller zusammenwirken<strong>de</strong>n<br />
Bereiche eines Unternehmens, wie z.B. Beschaffungs- und Absatzbeziehungen<br />
bzw. -märkte, Forschung und Entwicklung, Organisation, Finanzierung und<br />
Management zu erfassen, da alle Unternehmensbereiche gemeinsam zu <strong>de</strong>n zukünftigen<br />
finanziellen Überschüssen beitragen (Gesamtbewertung). Das Bewertungsobjekt<br />
muss nicht mit <strong>de</strong>r rechtlichen Abgrenzung <strong>de</strong>s Unternehmens i<strong>de</strong>ntisch<br />
sein; zugrun<strong>de</strong> zu legen ist vielmehr das nach wirtschaftlichen Kriterien <strong>de</strong>finierte<br />
Bewertungsobjekt (z.B. Konzern, Betriebsstätte, strategische Geschäftseinheit).<br />
20 Zu <strong>de</strong>n Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>r Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts bei <strong>de</strong>r Bewertung<br />
von kleinen und mittelgroßen Unternehmen vgl. Abschn. 8.3.1.<br />
21 Bei <strong>de</strong>r Bewertung von Unternehmen ist grundsätzlich zwischen betriebsnotwendigem<br />
Vermögen und nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu unterschei<strong>de</strong>n.<br />
4.3. Stichtagsprinzip<br />
22 Unternehmenswerte sind zeitpunktbezogen auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag zu ermitteln.<br />
23 Die Erwartungen <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Bewertung interessierten Parteien über die künftigen<br />
finanziellen Überschüsse sowohl <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts als auch <strong>de</strong>r bestmögli-<br />
6<br />
Vgl. BGH, Beschluss vom 12.03.2001 – II ZB 15/00, DB 2001, S. 969.<br />
7<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
chen Alternativinvestition hängen von <strong>de</strong>m Umfang <strong>de</strong>r im Zeitablauf zufließen<strong>de</strong>n<br />
Informationen ab. Bei Auseinan<strong>de</strong>rfallen <strong>de</strong>s Bewertungsstichtags und <strong>de</strong>s Zeitpunkts<br />
<strong>de</strong>r Durchführung <strong>de</strong>r Bewertung ist daher nur <strong>de</strong>r Informationsstand zu berücksichtigen,<br />
<strong>de</strong>r bei angemessener Sorgfalt zum Bewertungsstichtag hätte erlangt<br />
wer<strong>de</strong>n können. Dies gilt auch für <strong>de</strong>n Informationsstand über die Ertragsteuerbelastung<br />
<strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse, d.h. maßgeblich ist das am Bewertungsstichtag<br />
gelten<strong>de</strong> bzw. das mit Wirkung für die Zukunft vom Gesetzgeber beschlossene<br />
Steuerrecht.<br />
4.4. Bewertung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens<br />
4.4.1. Grundlagen <strong>de</strong>r Ermittlung finanzieller Überschüsse<br />
4.4.1.1. Zahlungsstromorientierung<br />
24 Die zur Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts abzuzinsen<strong>de</strong>n Nettoeinnahmen <strong>de</strong>r<br />
Unternehmenseigner ergeben sich vorrangig aufgrund <strong>de</strong>s Anspruchs <strong>de</strong>r Unternehmenseigner<br />
auf Ausschüttung bzw. Entnahme <strong>de</strong>r vom Unternehmen erwirtschafteten<br />
finanziellen Überschüsse abzüglich von zu erbringen<strong>de</strong>n Einlagen <strong>de</strong>r<br />
Eigner. Ferner sind weitere mit <strong>de</strong>m Eigentum am Unternehmen verbun<strong>de</strong>ne Zahlungsstromverän<strong>de</strong>rungen<br />
zu berücksichtigen.<br />
25 Die Nettoeinnahmen <strong>de</strong>r Unternehmenseigner hängen in erster Linie von <strong>de</strong>r Fähigkeit<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens ab, finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften. Eine Unternehmensbewertung<br />
setzt daher die Prognose <strong>de</strong>r entziehbaren künftigen finanziellen<br />
Überschüsse <strong>de</strong>s Unternehmens voraus. Wertbestimmend sind aber nur diejenigen<br />
finanziellen Überschüsse <strong>de</strong>s Unternehmens, die als Nettoeinnahmen in <strong>de</strong>n<br />
Verfügungsbereich <strong>de</strong>r Eigentümer gelangen (Zuflussprinzip).<br />
26 Zur Ermittlung <strong>de</strong>r Nettoeinnahmen <strong>de</strong>r Unternehmenseigner sind die Thesaurierungen<br />
finanzieller Überschüsse <strong>de</strong>s Unternehmens sowie die Verwendung nicht<br />
ausgeschütteter Beträge zu berücksichtigen. Diese Beträge können zur Investition,<br />
zur Tilgung von Fremdkapital o<strong>de</strong>r zur Rückführung von Eigenkapital verwen<strong>de</strong>t<br />
wer<strong>de</strong>n. Dabei sind die Nebenbedingungen <strong>de</strong>r gesellschaftsrechtlichen Ausschüttungsfähigkeit<br />
und <strong>de</strong>r Finanzierung <strong>de</strong>r Ausschüttungen zu beachten.<br />
27 Eine ordnungsgemäße Unternehmensbewertung setzt aufeinan<strong>de</strong>r abgestimmte<br />
Plan-Bilanzen, Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Finanzplanungen voraus.<br />
Hierbei können ergänzen<strong>de</strong> Rechnungen zur Ermittlung <strong>de</strong>r steuerlichen Bemessungsgrundlagen<br />
notwendig wer<strong>de</strong>n.<br />
4.4.1.2. Ertragsteuerliche Einflüsse<br />
28 Der Wert eines Unternehmens wird durch die Höhe <strong>de</strong>r Nettozuflüsse an <strong>de</strong>n Investor<br />
bestimmt, die er zu seiner freien Verfügung hat. Diese Nettozuflüsse sind unter<br />
Berücksichtigung <strong>de</strong>r inländischen und ausländischen Ertragsteuern <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
und grundsätzlich <strong>de</strong>r aufgrund <strong>de</strong>s Eigentums am Unternehmen entstehen<strong>de</strong>n<br />
persönlichen Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner zu ermitteln.<br />
8<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
4.4.2. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts<br />
29 Der objektivierte Unternehmenswert stellt einen intersubjektiv nachprüfbaren Zukunftserfolgswert<br />
aus Sicht <strong>de</strong>r Anteilseigner dar. Dieser ergibt sich bei Fortführung<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens auf Basis <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n Unternehmenskonzepts und mit allen<br />
realistischen Zukunftserwartungen im Rahmen <strong>de</strong>r Marktchancen, -risiken und<br />
finanziellen Möglichkeiten <strong>de</strong>s Unternehmens sowie sonstigen Einflussfaktoren.<br />
Wegen <strong>de</strong>r Wertrelevanz <strong>de</strong>r persönlichen Ertragsteuern sind zur Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten<br />
Unternehmenswerts anlassbezogene Typisierungen <strong>de</strong>r steuerlichen<br />
Verhältnisse <strong>de</strong>r Anteilseigner erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
30 Häufig ist <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer als neutraler Gutachter zur Ermittlung eines objektivierten<br />
Unternehmenswerts im Rahmen unternehmerischer Initiativen tätig, bei <strong>de</strong>nen<br />
die Bewertung als objektivierte Informationsgrundlage (z.B. für Kaufpreisverhandlungen,<br />
Fairness Opinions, Kreditwürdigkeitsprüfungen) dient. Im Hinblick auf<br />
das Informationsbedürfnis und die Informationserwartungen <strong>de</strong>r Adressaten <strong>de</strong>r<br />
Bewertung sowie vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r Internationalisierung <strong>de</strong>r Kapitalmärkte<br />
und <strong>de</strong>r Unternehmenstransaktionen ist in diesen Fällen eine mittelbare Typisierung<br />
<strong>de</strong>r steuerlichen Verhältnisse <strong>de</strong>r Anteilseigner sachgerecht. Hierbei wird die Annahme<br />
getroffen, dass die Nettozuflüsse aus <strong>de</strong>m Bewertungsobjekt und aus <strong>de</strong>r Alternativinvestition<br />
in ein Aktienportfolio auf <strong>de</strong>r Anteilseignerebene einer vergleichbaren<br />
persönlichen Besteuerung unterliegen. Im Bewertungskalkül wird dann auf eine<br />
explizite Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse und <strong>de</strong>s Kapitalisierungszinssatzes verzichtet.<br />
31 Bei gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Bewertungsanlässen (z.B. Squeeze<br />
Out) wird <strong>de</strong>r objektivierte Unternehmenswert im Einklang mit <strong>de</strong>r langjährigen Bewertungspraxis<br />
und <strong>de</strong>utschen Rechtsprechung aus <strong>de</strong>r Perspektive einer inländischen<br />
unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person als Anteilseigner ermittelt.<br />
Bei dieser Typisierung sind <strong>de</strong>mgemäß zur unmittelbaren Berücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen<br />
Ertragsteuern sachgerechte Annahmen zu <strong>de</strong>ren Höhe sowohl bei <strong>de</strong>n finanziellen<br />
Überschüssen als auch beim Kapitalisierungszinssatz zu treffen.<br />
4.4.2.1. Zum Stichtag bereits eingeleitete o<strong>de</strong>r im Unternehmenskonzept dokumentierte<br />
Maßnahmen<br />
32 Die Bewertung eines Unternehmens basiert auf <strong>de</strong>r am Bewertungsstichtag vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Ertragskraft. Grundsätzlich beruht die vorhan<strong>de</strong>ne Ertragskraft auf <strong>de</strong>n zum<br />
Bewertungsstichtag vorhan<strong>de</strong>nen Erfolgsfaktoren. Die bewertbare Ertragskraft beinhaltet<br />
die Erfolgschancen, die sich zum Bewertungsstichtag aus bereits eingeleiteten<br />
Maßnahmen o<strong>de</strong>r aus hinreichend konkretisierten Maßnahmen im Rahmen <strong>de</strong>s<br />
bisherigen Unternehmenskonzepts und <strong>de</strong>r Marktgegebenheiten ergeben. Mögliche,<br />
aber noch nicht hinreichend konkretisierte Maßnahmen (z.B. Erweiterungsinvestitionen/Desinvestitionen)<br />
sowie die daraus vermutlich resultieren<strong>de</strong>n finanziellen<br />
Überschüsse sind danach bei <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte<br />
unbeachtlich.<br />
9<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
4.4.2.2. So genannte unechte Synergieeffekte<br />
33 Unter Synergieeffekten versteht man die Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse,<br />
die durch <strong>de</strong>n wirtschaftlichen Verbund zweier o<strong>de</strong>r mehrerer Unternehmen entstehen<br />
und von <strong>de</strong>r Summe <strong>de</strong>r isoliert entstehen<strong>de</strong>n Überschüsse abweichen.<br />
34 So genannte unechte Synergieeffekte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich<br />
ohne Durchführung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Bewertungsanlass zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Maßnahme<br />
realisieren lassen. Im Rahmen <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts<br />
sind die Überschüsse aus unechten Synergieeffekten zu berücksichtigen; jedoch<br />
nur insoweit, als die Synergie stiften<strong>de</strong>n Maßnahmen bereits eingeleitet o<strong>de</strong>r im Unternehmenskonzept<br />
dokumentiert sind.<br />
4.4.2.3. Ausschüttungsannahme<br />
35 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts ist von <strong>de</strong>r Ausschüttung<br />
<strong>de</strong>rjenigen finanziellen Überschüsse auszugehen, die nach Berücksichtigung <strong>de</strong>s<br />
zum Bewertungsstichtag dokumentierten Unternehmenskonzepts und rechtlicher<br />
Restriktionen (z.B. Bilanzgewinn, ausschüttbares Jahresergebnis) zur Ausschüttung<br />
zur Verfügung stehen.<br />
36 Soweit die Planung zwei Phasen unterschei<strong>de</strong>t, ist die Aufteilung <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse auf Ausschüttungen und Thesaurierungen für die erste Phase <strong>de</strong>r<br />
Planung (Detailplanungsphase) (vgl. Abschn. 5.3.) auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s individuellen<br />
Unternehmenskonzepts und unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r bisherigen und geplanten<br />
Ausschüttungspolitik, <strong>de</strong>r Eigenkapitalausstattung und <strong>de</strong>r steuerlichen Rahmenbedingungen<br />
vorzunehmen. Sofern für die Verwendung thesaurierter Beträge keine<br />
Planungen vorliegen und auch die Investitionsplanung keine konkrete Verwendung<br />
vorsieht, ist eine sachgerechte Prämisse zur Mittelverwendung zu treffen. Unterliegen<br />
die thesaurierungsbedingten Wertzuwächse einer effektiven Veräußerungsgewinnbesteuerung,<br />
so ist dies bei <strong>de</strong>r Bewertung zu berücksichtigen.<br />
37 Im Rahmen <strong>de</strong>r zweiten Phase (vgl. Abschn. 5.3.) wird grundsätzlich angenommen,<br />
dass das Ausschüttungsverhalten <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens äquivalent<br />
zum Ausschüttungsverhalten <strong>de</strong>r Alternativanlage ist, sofern nicht Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
<strong>de</strong>r Branche, <strong>de</strong>r Kapitalstruktur o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten<br />
sind. Für die thesaurierten Beträge wird die Annahme einer kapitalwertneutralen<br />
Verwendung getroffen.<br />
4.4.2.4. Managementfaktoren<br />
38 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts ist die <strong>de</strong>m Unternehmen<br />
innewohnen<strong>de</strong> und übertragbare Ertragskraft zu bewerten. Diese kann auch davon<br />
abhängig sein, ob das bisher für die Unternehmensentwicklung verantwortliche Management<br />
auch in Zukunft für das Unternehmen tätig wird.<br />
39 Das Verbleiben <strong>de</strong>s Managements o<strong>de</strong>r ein gleichwertiger Ersatz wird zur Ermittlung<br />
<strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts i.d.R. unterstellt, sodass eine Eliminierung<br />
personenbezogener Einflüsse auf die finanziellen Überschüsse grundsätzlich nicht<br />
notwendig ist.<br />
10<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
40 Bei personenbezogenen Unternehmen sind jedoch in <strong>de</strong>r Person <strong>de</strong>s Eigentümers<br />
begrün<strong>de</strong>te positive o<strong>de</strong>r negative Erfolgsbeiträge, die losgelöst vom bisherigen Eigentümer<br />
nicht realisiert wer<strong>de</strong>n können, bei <strong>de</strong>r Prognose künftiger finanzieller<br />
Überschüsse außer Betracht zu lassen. Soweit für die Mitarbeit <strong>de</strong>r Inhaber in <strong>de</strong>r<br />
bisherigen Ergebnisrechnung kein angemessener Unternehmerlohn berücksichtigt<br />
wor<strong>de</strong>n ist, sind die künftigen finanziellen Überschüsse entsprechend zu korrigieren.<br />
Die Höhe <strong>de</strong>s Unternehmerlohns wird nach <strong>de</strong>r Vergütung bestimmt, die eine nichtbeteiligte<br />
Geschäftsführung erhalten wür<strong>de</strong>. Neben <strong>de</strong>m Unternehmerlohn kann<br />
auch fiktiver Lohnaufwand für bislang unentgeltlich tätige Familienangehörige <strong>de</strong>s<br />
Eigentümers zu berücksichtigen sein.<br />
41 Zu <strong>de</strong>n zu eliminieren<strong>de</strong>n Managementfaktoren gehören auch Einflüsse aus einem<br />
Unternehmensverbund o<strong>de</strong>r aus sonstigen Beziehungen personeller o<strong>de</strong>r familiärer<br />
Art zwischen <strong>de</strong>m Management <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens und dritten Unternehmen,<br />
die im Rahmen eines Eigentümerwechsels nicht mit übergehen wür<strong>de</strong>n.<br />
42 Steht die bisherige Unternehmensleitung künftig nicht mehr zur Verfügung und ist<br />
eine Unternehmensfortführung ohne die bisherige Unternehmensleitung nicht möglich,<br />
so ist regelmäßig davon auszugehen, dass <strong>de</strong>r Unternehmenswert <strong>de</strong>m Liquidationswert<br />
entspricht. Dies gilt auch, wenn <strong>de</strong>r Ertragswert aufgrund <strong>de</strong>r Berücksichtigung<br />
eines angemessenen Unternehmerlohns <strong>de</strong>n Liquidationswert unterschreitet.<br />
Im Familien- und Erbrecht können dagegen auch personenbezogene,<br />
nicht übertragbare Faktoren bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s Ertragswerts einzubeziehen<br />
sein 7 .<br />
4.4.2.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner<br />
43 Von <strong>de</strong>r Unternehmensbewertungstheorie und -praxis sowie <strong>de</strong>r Rechtsprechung ist<br />
die Notwendigkeit <strong>de</strong>r Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern allgemein anerkannt<br />
(vgl. Tz. 28 – 31). Daher sind die wertrelevanten steuerlichen Verhältnisse <strong>de</strong>r<br />
Anteilseigner bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswertes im Bewertungskalkül<br />
sachgerecht zu typisieren.<br />
44 Die künftigen Nettozuflüsse wer<strong>de</strong>n bei unmittelbarer Berücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen<br />
Ertragsteuern um diese gekürzt und mit einem ebenfalls durch die persönlichen<br />
Ertragsteuern beeinflussten Kapitalisierungszinssatz diskontiert. Die praktische<br />
Umsetzung <strong>de</strong>r Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern im Rahmen <strong>de</strong>r objektivierten<br />
Unternehmensbewertung erfor<strong>de</strong>rt daher grundsätzlich Typisierungen hinsichtlich<br />
<strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>s effektiven persönlichen Steuersatzes <strong>de</strong>s Anteilseigners als<br />
Ausfluss seiner steuerlich relevanten Verhältnisse und Verhaltensweisen. So sind<br />
bei <strong>de</strong>r Bewertung von Kapitalgesellschaften bei differenzierter Effektivbesteuerung<br />
von Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n und Veräußerungsgewinnen zusätzliche Annahmen, z.B. über <strong>de</strong>n<br />
Zeitraum <strong>de</strong>s Haltens <strong>de</strong>r Unternehmensanteile, zu treffen.<br />
45 Bei Unternehmensbewertungen im Rahmen von Unternehmensveräußerungen und<br />
an<strong>de</strong>ren unternehmerischen Initiativen ist eine mittelbare Typisierung (vgl. Tz. 30)<br />
sachgerecht, die davon ausgeht, dass im Bewertungsfall die persönliche Ertrag-<br />
7<br />
Vgl. <strong>IDW</strong> Stellungnahme HFA 2/1995, Abschn. III.4.<br />
11<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
steuerbelastung <strong>de</strong>r Nettozuflüsse aus <strong>de</strong>m zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmen <strong>de</strong>r persönlichen<br />
Ertragsteuerbelastung <strong>de</strong>r Alternativinvestition in ein Aktienportfolio entspricht.<br />
Entsprechend dieser Annahme kann in diesen Fällen auf eine unmittelbare<br />
Berücksichtigung persönlicher Steuern bei <strong>de</strong>n finanziellen Überschüssen verzichtet<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
46 Für Unternehmensbewertungen aufgrund gesellschaftsrechtlicher o<strong>de</strong>r vertraglicher<br />
Vorschriften, insbeson<strong>de</strong>re zur Ermittlung eines Abfindungsanspruchs bei Verlust<br />
von Eigentums- und Gesellschafterrechten, z.B. Squeeze Out, sind wegen <strong>de</strong>r Typisierung<br />
einer inländischen unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person als<br />
Anteilseigner (vgl. Tz. 31) weitergehen<strong>de</strong> Analysen zu <strong>de</strong>n effektiven Auswirkungen<br />
<strong>de</strong>r persönlichen Steuern auf die künftigen Nettozuflüsse und <strong>de</strong>n Kapitalisierungszinssatz<br />
erfor<strong>de</strong>rlich. Die dabei getroffenen Annahmen sind in <strong>de</strong>r Berichterstattung<br />
zu erläutern.<br />
47 Die Bewertung eines Einzelunternehmens o<strong>de</strong>r einer Personengesellschaft erfor<strong>de</strong>rt<br />
stets eine Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern, wenn – wie im Fall <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rzeitigen<br />
Steuersystems – die persönliche Einkommensteuer teilweise o<strong>de</strong>r ganz an<br />
die Stelle <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Alternativrendite bereits berücksichtigten Unternehmensteuer<br />
tritt.<br />
4.4.3. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte<br />
48 Im Rahmen <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte ersetzt <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />
in <strong>de</strong>r Beratungsfunktion die bei <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte<br />
erfor<strong>de</strong>rlichen Typisierungen durch individuelle auftraggeberbezogene Konzepte<br />
bzw. Annahmen.<br />
4.4.3.1. Geplante, aber zum Stichtag noch nicht eingeleitete o<strong>de</strong>r noch nicht im Unternehmenskonzept<br />
dokumentierte Maßnahmen<br />
49 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung eines subjektiven Entscheidungswerts für <strong>de</strong>n potenziellen Erwerber<br />
eines Unternehmens sind auch solche strukturverän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Vorhaben sowie<br />
bereits erkannte und realisierbare Möglichkeiten zu berücksichtigen, die (noch)<br />
nicht Bestandteil <strong>de</strong>s zum Bewertungsstichtag dokumentierten Unternehmenskonzepts<br />
sind. Dies können z.B. vom Erwerber beabsichtigte Erweiterungsinvestitionen,<br />
Desinvestitionen, Bereinigungen <strong>de</strong>s Produktprogramms o<strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />
strategischen Geschäftsfel<strong>de</strong>r sein, <strong>de</strong>ren Auswirkungen auf die künftigen finanziellen<br />
Überschüsse <strong>de</strong>n Grenzpreis eines Erwerbers beeinflussen. Der Barwert <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse aus <strong>de</strong>r rentabelsten Nutzung <strong>de</strong>s Betriebs, die unter <strong>de</strong>n<br />
voraussichtlichen individuellen Verhältnissen <strong>de</strong>s Erwerbers möglich ist, bestimmt<br />
üblicherweise <strong>de</strong>ssen subjektiven Wert.<br />
4.4.3.2. So genannte echte Synergieeffekte<br />
50 Für die Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte potenzieller Käufer ist es unerheblich,<br />
ob zu erwarten<strong>de</strong> Synergieeffekte und die zu ihrer Erschließung erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Maßnahmen bereits eingeleitet sind o<strong>de</strong>r nicht. In <strong>de</strong>n subjektiven Entschei-<br />
12<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
dungswert eines Kaufinteressenten sind sowohl unechte als auch echte, sich erst<br />
mit Durchführung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Bewertungsanlass zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Maßnahme ergeben<strong>de</strong>,<br />
Synergieeffekte in vollem Umfang einzubeziehen.<br />
51 Für <strong>de</strong>n subjektiven Entscheidungswert <strong>de</strong>s Verkäufers bzw. <strong>de</strong>r bisherigen Unternehmenseigner<br />
sind mögliche Synergieeffekte für die Ermittlung <strong>de</strong>r Preisuntergrenze<br />
nur insoweit relevant, als sie ohne die Veräußerung realisierbar sind<br />
(sog. unechte Synergieeffekte) und für <strong>de</strong>n Verkäufer nach <strong>de</strong>r Transaktion wegfallen<br />
wür<strong>de</strong>n.<br />
4.4.3.3. Finanzierungsannahmen<br />
52 Für <strong>de</strong>n Unternehmenseigner o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n potenziellen Erwerber <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
können vom maßgeblichen Unternehmenskonzept zum Bewertungsstichtag abweichen<strong>de</strong><br />
Finanzierungsmöglichkeiten (Kapitalstruktur) <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts zu einer<br />
Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts führen.<br />
53 Falls <strong>de</strong>r Eigentümer o<strong>de</strong>r Erwerber beispielsweise Fremdkapital zu günstigeren<br />
Konditionen erhalten kann, als sie <strong>de</strong>n laufen<strong>de</strong>n Krediten zugrun<strong>de</strong> liegen, wird er<br />
soweit wie möglich Altkredite tilgen und zinsgünstigere Neukredite aufnehmen, sodass<br />
sein subjektiver Entscheidungswert gegenüber <strong>de</strong>m objektivierten Wert infolge<br />
geringerer Zinsbelastungen höher ist.<br />
54 Aufgrund einer an<strong>de</strong>ren Risikoeinstellung o<strong>de</strong>r infolge <strong>de</strong>r Einbringung <strong>de</strong>s Zielunternehmens<br />
in einen Unternehmensverbund kann eine verän<strong>de</strong>rte Kapitalstruktur<br />
(Verschuldungsgrad) angestrebt wer<strong>de</strong>n. Neben <strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>n subjektiven Finanzierungsannahmen<br />
<strong>de</strong>s Auftraggebers entstehen<strong>de</strong>n Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse sind auch die Auswirkungen eines verän<strong>de</strong>rten Finanzierungsrisikos<br />
auf <strong>de</strong>n Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte<br />
zu beachten.<br />
55 Ausgehend von <strong>de</strong>r individuell getroffenen Ausschüttungsannahme ist ferner insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>r vom Auftraggeber geplante Umfang <strong>de</strong>r Innenfinanzierung durch Einbehaltung<br />
finanzieller Überschüsse sowie die Kapitalzuführung durch die Eigenkapitalgeber<br />
zu berücksichtigen.<br />
4.4.3.4. Managementfaktoren<br />
56 Aus <strong>de</strong>r Sicht eines Käufers ist allein ausschlaggebend, welche finanziellen Überschüsse<br />
mit <strong>de</strong>r von ihm tatsächlich geplanten Besetzung <strong>de</strong>r Geschäftsführung voraussichtlich<br />
erzielt wer<strong>de</strong>n. Dabei sind soweit wie möglich alle künftigen finanziellen<br />
Auswirkungen, z.B. auch aufgrund <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Geschäftsführungsorganisation,<br />
zu berücksichtigen.<br />
57 Der Grenzpreis eines potenziellen Verkäufers berücksichtigt nicht nur die übertragbare<br />
Ertragskraft <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts, son<strong>de</strong>rn z.B. auch persönliche Erfolgsfaktoren.<br />
13<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
4.4.3.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner<br />
58 Der Bewertung ist die tatsächliche Steuerbelastung <strong>de</strong>r Unternehmenseigner zugrun<strong>de</strong><br />
zu legen, soweit diese bekannt ist. Im Einzelfall kann auch eine Typisierung<br />
<strong>de</strong>r steuerlichen Verhältnisse sachgerecht sein.<br />
4.5. Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens<br />
59 Neben <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen Vermögen verfügt ein Unternehmen häufig auch<br />
über nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Solche Vermögensteile können frei veräußert<br />
wer<strong>de</strong>n, ohne dass davon die eigentliche Unternehmensaufgabe berührt wird<br />
(funktionales Abgrenzungskriterium).<br />
60 Bei <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>s gesamten Unternehmens zum Zukunftserfolgswert müssen<br />
die nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenstän<strong>de</strong> einschließlich <strong>de</strong>r dazugehörigen<br />
Schul<strong>de</strong>n unter Berücksichtigung ihrer bestmöglichen Verwertung und unter<br />
Berücksichtigung <strong>de</strong>r Verwendung freigesetzter Mittel geson<strong>de</strong>rt bewertet wer<strong>de</strong>n.<br />
Sofern <strong>de</strong>r Liquidationswert dieser Vermögensgegenstän<strong>de</strong> unter Berücksichtigung<br />
<strong>de</strong>r steuerlichen Auswirkungen einer Veräußerung <strong>de</strong>n Barwert ihrer finanziellen<br />
Überschüsse bei Verbleib im Unternehmen übersteigt, stellt nicht die an<strong>de</strong>renfalls<br />
zu unterstellen<strong>de</strong> Fortführung <strong>de</strong>r bisherigen Nutzung, son<strong>de</strong>rn die Liquidation die<br />
vorteilhaftere Verwertung dar. Für die Ermittlung <strong>de</strong>s Gesamtwerts ist dann <strong>de</strong>r Liquidationswert<br />
<strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens <strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens hinzuzufügen.<br />
61 Bei <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens mit <strong>de</strong>m Liquidationswert<br />
sind die Kosten <strong>de</strong>r Liquidation von <strong>de</strong>n Liquidationserlösen abzusetzen<br />
sowie die steuerlichen Folgen auf Unternehmensebene zu berücksichtigen. Inwieweit<br />
Steuern auf <strong>de</strong>r Eigentümerebene zu berücksichtigen sind, hängt von <strong>de</strong>r beabsichtigten<br />
Verwendung <strong>de</strong>r erzielten Erlöse ab. Soweit nicht mit einer sofortigen<br />
Liquidation zu rechnen ist, muss ein Liquidationskonzept entwickelt, ein angemessener<br />
Liquidationszeitraum angesetzt und <strong>de</strong>r Liquidationserlös abzüglich <strong>de</strong>r Kosten<br />
<strong>de</strong>r Liquidation auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag abgezinst wer<strong>de</strong>n.<br />
62 Soweit <strong>de</strong>n nicht betriebsnotwendigen Vermögensteilen Schul<strong>de</strong>n zuzurechnen<br />
sind, müssen die aus <strong>de</strong>r Veräußerung <strong>de</strong>r Vermögensteile zu erzielen<strong>de</strong>n Liquidationserlöse<br />
um die bei <strong>de</strong>r Ablösung <strong>de</strong>r zugehörigen Schul<strong>de</strong>n anfallen<strong>de</strong>n Ausgaben<br />
gekürzt wer<strong>de</strong>n.<br />
63 Wird Vermögen, das <strong>de</strong>r Kreditsicherung dient, als nicht betriebsnotwendiges Vermögen<br />
ausgeson<strong>de</strong>rt, ist zu beachten, dass eine Entnahme zur Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Finanzierungssituation (z.B. <strong>de</strong>r Finanzierungskonditionen) <strong>de</strong>s Unternehmens führen<br />
kann.<br />
4.6. Unbeachtlichkeit <strong>de</strong>s (bilanziellen) Vorsichtsprinzips<br />
64 In <strong>de</strong>r Funktion als neutraler Gutachter o<strong>de</strong>r als Schiedsgutachter hat <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />
das Gebot <strong>de</strong>r Unparteilichkeit zu beachten. Das für die han<strong>de</strong>lsrechtliche<br />
Bilanzierung verbindliche Vorsichtsprinzip bringt eine ungleiche Gewichtung<br />
<strong>de</strong>r z.T. gegenläufigen Interessen von Gläubigern (Kapitalerhaltung durch Ausschüt-<br />
14<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
tungssperren) und Unternehmenseignern (Ausschüttung erwirtschafteter Gewinne)<br />
zugunsten <strong>de</strong>s Gläubigerschutzes zum Ausdruck und darf <strong>de</strong>shalb nicht berücksichtigt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Die ungewisse künftige Entwicklung darf nicht in einer Weise in <strong>de</strong>n ermittelten Unternehmenswert<br />
einfließen, die eine <strong>de</strong>r beteiligten Parteien – das wären bei „vorsichtiger<br />
Schätzung“ <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse <strong>de</strong>r Verkäufer bzw. die<br />
abzufin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Gesellschafter – einseitig benachteiligt.<br />
65 Die Unbeachtlichkeit <strong>de</strong>s (bilanziellen) Vorsichtsprinzips be<strong>de</strong>utet nicht, dass von<br />
einer Risikoneutralität <strong>de</strong>s Investors auszugehen ist (vgl. Abschn. 6.2.).<br />
4.7. Nachvollziehbarkeit <strong>de</strong>r Bewertungsansätze<br />
66 Gutachtlich ermittelte Unternehmenswerte basieren regelmäßig auf einer Vielzahl<br />
von Prämissen, die erheblichen Einfluss auf das Bewertungsergebnis haben. Dem<br />
Grundsatz <strong>de</strong>r Klarheit <strong>de</strong>r Berichterstattung entsprechend hat <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />
in seinem Bewertungsgutachten <strong>de</strong>utlich zu machen, auf welchen wesentlichen Annahmen<br />
und Typisierungen <strong>de</strong>r von ihm ermittelte Unternehmenswert beruht<br />
(vgl. Abschn. 9.2.).<br />
67 Aus <strong>de</strong>r Berichterstattung muss hervorgehen, ob es sich bei <strong>de</strong>n getroffenen Annahmen<br />
um solche <strong>de</strong>s Gutachters, <strong>de</strong>s Managements <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens<br />
o<strong>de</strong>r sachverständiger Dritter han<strong>de</strong>lt.<br />
5. Prognose <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse<br />
68 Kernproblem einer je<strong>de</strong>n Unternehmensbewertung ist die Prognose <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse aus <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen Vermögen. Sie erfor<strong>de</strong>rt eine umfangreiche<br />
Informationsbeschaffung und darauf aufbauen<strong>de</strong> vergangenheits-, stichtagsund<br />
zukunftsorientierte Unternehmensanalysen, die durch Plausibilitätsüberlegungen<br />
im Hinblick auf ihre Angemessenheit und Wi<strong>de</strong>rspruchsfreiheit zu überprüfen<br />
sind.<br />
5.1. Informationsbeschaffung<br />
69 Die inhaltliche Qualität einer Unternehmensanalyse wird durch Qualität und Umfang<br />
<strong>de</strong>r verfügbaren Informationen bestimmt.<br />
70 Für die Prognose <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse sind grundsätzlich unternehmensund<br />
marktorientierte zukunftsbezogene Informationen erfor<strong>de</strong>rlich. 8 Vergangenheitsund<br />
stichtagsbezogene Informationen sind nur insoweit von Be<strong>de</strong>utung, als sie als<br />
Grundlage für die Schätzung künftiger Entwicklungen o<strong>de</strong>r für die Vornahme von<br />
Plausibilitätsbeurteilungen dienen können.<br />
8<br />
Bei <strong>de</strong>r Informationsbeschaffung kann <strong>de</strong>r vom Arbeitskreis „Unternehmensbewertung“ entwickelte Erhebungsbogen<br />
zur Unternehmensbewertung herangezogen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r <strong>IDW</strong> Verlag GmbH, Postfach<br />
320580, 40420 Düsseldorf, erhältlich ist.<br />
15<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
71 Als unternehmensbezogene Informationen sind vor allem interne Planungsdaten<br />
sowie daraus entwickelte Plan-Bilanzen, Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen sowie<br />
Plan-Kapitalflussrechnungen heranzuziehen. Als marktbezogene Daten können<br />
insbeson<strong>de</strong>re Informationen über branchenspezifische Märkte und volkswirtschaftliche<br />
Zusammenhänge verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n.<br />
5.2. Vergangenheitsanalyse<br />
72 Die Vergangenheitsanalyse bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Ausgangspunkt für die Prognose künftiger<br />
Entwicklungen und für die Vornahme von Plausibilitätsüberlegungen.<br />
73 Zur Beurteilung <strong>de</strong>r bisherigen leistungs- und finanzwirtschaftlichen Entwicklungen<br />
<strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens, sind in aller Regel Gewinn- und Verlustrechnungen,<br />
Kapitalflussrechnungen, Bilanzen und interne Ergebnisrechnungen heranzuziehen.<br />
Um die in <strong>de</strong>r Vergangenheit wirksamen Erfolgsursachen erkennbar zu<br />
machen, sind die Vergangenheitsrechnungen zu bereinigen.<br />
74 Da die bisherige leistungs- und finanzwirtschaftliche Entwicklung <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
Resultat <strong>de</strong>r Geschäftstätigkeit in bestimmten Märkten ist, müssen unternehmensbezogene<br />
Informationen über die erwiesene Ertragskraft sowie die Vermögens- und<br />
Finanzverhältnisse vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r vergangenen Markt- und Umweltentwicklungen<br />
(z.B. politische, gesamtwirtschaftliche und technische Entwicklungen,<br />
Branchenentwicklungen, Entwicklungen <strong>de</strong>r Märkte und <strong>de</strong>r Marktstellung <strong>de</strong>s Unternehmens)<br />
analysiert wer<strong>de</strong>n.<br />
5.3. Planung und Prognose (Phasenmetho<strong>de</strong>)<br />
75 Aufbauend auf <strong>de</strong>r Vergangenheitsanalyse sind die künftigen finanziellen Überschüsse<br />
zu prognostizieren. Hierzu ist eine Analyse <strong>de</strong>r erwarteten leistungs- und<br />
finanzwirtschaftlichen Entwicklungen <strong>de</strong>s Unternehmens unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r<br />
erwarteten Markt- und Umweltentwicklungen erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
76 Dabei lassen sich für einen gewissen Zeitraum (nähere erste Phase) voraussichtliche<br />
Entwicklungen <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse plausibler beurteilen und sicherer<br />
prognostizieren als für die späteren Jahre. Zwangsläufig ergibt sich damit ein Horizont<br />
für die Zukunftsbetrachtung, jenseits <strong>de</strong>ssen die Quantifizierung <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse nur noch auf globale Annahmen zu stützen ist. In <strong>de</strong>r Praxis hat es<br />
sich daher als hilfreich erwiesen, die finanziellen Überschüsse in unterschiedlichen<br />
Zukunftsphasen zu planen und zu prognostizieren. Die Phasen können in Abhängigkeit<br />
von Größe, Struktur und Branche <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens unterschiedlich<br />
lange Zeiträume umfassen.<br />
77 In <strong>de</strong>n meisten Fällen wird die Planung in zwei Phasen vorgenommen. Für die nähere<br />
erste Phase (Detailplanungsphase), die häufig einen überschaubaren Zeitraum<br />
von drei bis fünf Jahren umfasst, stehen <strong>de</strong>m Wirtschaftsprüfer zumeist hinreichend<br />
<strong>de</strong>taillierte Planungsrechnungen zur Verfügung. In dieser zeitlich näheren Phase<br />
wer<strong>de</strong>n die zahlreichen Einflussgrößen meist einzeln zur Prognose <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse veranschlagt. Insbeson<strong>de</strong>re längerfristige Investitions- o<strong>de</strong>r Produktlebenszyklen<br />
können eine Verlängerung <strong>de</strong>r Detailplanungsphase notwendig machen.<br />
16<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
78 Die Planungsjahre <strong>de</strong>r ferneren zweiten Phase basieren i.d.R. – ausgehend von <strong>de</strong>r<br />
Detailplanung <strong>de</strong>r ersten Phase – auf langfristigen Fortschreibungen von Tren<strong>de</strong>ntwicklungen.<br />
Dabei ist zu untersuchen, ob sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
<strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens nach <strong>de</strong>r Phase <strong>de</strong>r <strong>de</strong>taillierten Planung<br />
im sog. Gleichgewichts- o<strong>de</strong>r Beharrungszustand befin<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r ob sich die jährlichen<br />
finanziellen Überschüsse zwar noch verän<strong>de</strong>rn, jedoch eine als konstant o<strong>de</strong>r<br />
mit konstanter Rate wachsend angesetzte Größe die sich än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n finanziellen<br />
Überschüsse (finanzmathematisch) angemessen repräsentiert.<br />
79 Wegen <strong>de</strong>s starken Gewichts <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse in <strong>de</strong>r zweiten Phase<br />
kommt <strong>de</strong>r kritischen Überprüfung <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Annahmen eine beson<strong>de</strong>re<br />
Be<strong>de</strong>utung zu. Dabei ist insbeson<strong>de</strong>re das Unternehmenskonzept mit <strong>de</strong>n erwarteten<br />
Rahmenbedingungen <strong>de</strong>s Marktes und Wettbewerbs und <strong>de</strong>ren Verän<strong>de</strong>rungen<br />
abzustimmen. Ferner sind Branchenkennzahlen (z.B. Umsatzrenditen) zu<br />
analysieren.<br />
Die Planansätze <strong>de</strong>r ersten Phase sind im Hinblick auf ihre Eignung als Bezugsgröße<br />
für die finanziellen Überschüsse <strong>de</strong>r zweiten Phase zu überprüfen, wobei insbeson<strong>de</strong>re<br />
folgen<strong>de</strong> ausgewählte Sachverhalte zu beachten und ggf. entsprechen<strong>de</strong><br />
Anpassungen vorzunehmen sind: Berücksichtigung wesentlicher und nachhaltiger<br />
Verän<strong>de</strong>rungen auf <strong>de</strong>m Absatz- und Beschaffungsmarkt, Analyse <strong>de</strong>s Produkt- und<br />
Marktpotenzials auf Ausgewogenheit im Produktlebenszyklus, Analyse <strong>de</strong>r Marktund<br />
Wettbewerbspositionierung <strong>de</strong>r Produkte und Leistungen im Hinblick auf noch<br />
nicht berücksichtigte zukünftige Marktchancen sowie Einbeziehung noch nicht berücksichtigter<br />
Kosten für die zukünftige Marktbearbeitung, Normalisierung wesentlicher<br />
Kostenkomponenten, wie z.B. Forschung und Entwicklung und Altersversorgung,<br />
Berücksichtigung nachhaltig wirken<strong>de</strong>r Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen.<br />
80 Aufgrund <strong>de</strong>r Fülle von Einflussfaktoren kann es sich empfehlen, mehrwertige Planungen,<br />
Szenarien o<strong>de</strong>r Ergebnisbandbreiten zu erstellen, um das Ausmaß <strong>de</strong>r Unsicherheit<br />
<strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse zu ver<strong>de</strong>utlichen und erste Anhaltspunkte<br />
für die Berücksichtigung <strong>de</strong>r Unsicherheit im Rahmen <strong>de</strong>s Bewertungskalküls<br />
(vgl. Abschn. 6.2.) zu gewinnen.<br />
5.4. Plausibilitätsbeurteilung <strong>de</strong>r Planungen<br />
81 Die Prognose <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse ist auf ihre Plausibilität hin zu<br />
beurteilen.<br />
Die einzelnen Teilplanungen (insbeson<strong>de</strong>re Plan-Bilanzen, Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen<br />
und Finanzplanungen) müssen aufeinan<strong>de</strong>r abgestimmt und in sich<br />
plausibel sein. Im Rahmen <strong>de</strong>r Planung <strong>de</strong>r Gewinn- und Verlustrechnungen ist<br />
auch zu beachten, dass die Entwicklungen einzelner Positionen zueinan<strong>de</strong>r im Zeitablauf<br />
nachvollziehbar sind. In <strong>de</strong>r Finanzplanung müssen die getroffenen Finanzierungsprämissen<br />
insbeson<strong>de</strong>re unter Berücksichtigung <strong>de</strong>s jeweiligen Ausschüttungsverhaltens<br />
zutreffend umgesetzt sein.<br />
17<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
5.5. Verwendung verlässlicher Bewertungsunterlagen<br />
82 Der Wirtschaftsprüfer hat die Verlässlichkeit und Vollständigkeit <strong>de</strong>r Bewertungsgrundlagen<br />
zu beurteilen.<br />
83 Grundsätzlich sind die (bereinigten) Überschüsse <strong>de</strong>r Vergangenheit unter Verwendung<br />
geprüfter Jahresabschlüsse abzuleiten. Sofern die vorgelegten Jahresabschlüsse<br />
nicht geprüft sind, muss sich <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer von <strong>de</strong>r Verlässlichkeit<br />
<strong>de</strong>r wesentlichen Basisdaten überzeugen und seine hierzu getroffenen Feststellungen<br />
im Bewertungsgutachten darlegen (vgl. Abschn. 9.2.).<br />
84 Der Wirtschaftsprüfer hat von <strong>de</strong>m Unternehmen eine Vollständigkeitserklärung einzuholen.<br />
9 Diese entbin<strong>de</strong>t jedoch nicht davon, dass sich <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer selbst<br />
ein Urteil über die Plausibilität <strong>de</strong>r Planungen und Prognosen zu bil<strong>de</strong>n hat.<br />
6. Kapitalisierung <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse<br />
6.1. Grundlagen<br />
85 Der Unternehmenswert (Zukunftserfolgswert) wird durch Diskontierung <strong>de</strong>r künftigen<br />
finanziellen Überschüsse auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag ermittelt. In <strong>de</strong>r Mehrzahl <strong>de</strong>r<br />
Bewertungsfälle ist von einer unbegrenzten Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens<br />
auszugehen. In bestimmten Fällen kann es aber auch sachgerecht<br />
sein, eine begrenzte Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens anzunehmen.<br />
86 Bei unbegrenzter Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens entspricht <strong>de</strong>r<br />
Unternehmenswert <strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse aus <strong>de</strong>m<br />
betriebsnotwendigen Vermögen zuzüglich <strong>de</strong>s Barwerts <strong>de</strong>r künftigen finanziellen<br />
Überschüsse aus <strong>de</strong>m nicht betriebsnotwendigen Vermögen.<br />
87 Bei begrenzter Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens ist <strong>de</strong>r Unternehmenswert<br />
zu berechnen als Summe aus <strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r künftigen finanziellen<br />
Überschüsse aus <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen Vermögen (bis zur Aufgabe <strong>de</strong>s Unternehmens),<br />
<strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse aus <strong>de</strong>m nicht betriebsnotwendigen<br />
Vermögen (bis zur Aufgabe <strong>de</strong>s Unternehmens) und <strong>de</strong>m Barwert<br />
<strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse, die aus <strong>de</strong>r Aufgabe (z.B. <strong>de</strong>r Liquidation)<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens resultieren.<br />
6.2. Berücksichtigung <strong>de</strong>s Risikos<br />
88 Die künftigen finanziellen Überschüsse können aufgrund <strong>de</strong>r Ungewissheit <strong>de</strong>r Zukunft<br />
nicht mit Sicherheit prognostiziert wer<strong>de</strong>n. Ein unternehmerisches Engagement<br />
ist stets mit Risiken und Chancen verbun<strong>de</strong>n. Die Übernahme dieser unternehmerischen<br />
Unsicherheit (<strong>de</strong>s Unternehmerrisikos) lassen sich Marktteilnehmer<br />
durch Risikoprämien abgelten; Theorie und Praxis gehen übereinstimmend davon<br />
9<br />
Das Muster einer Vollständigkeitserklärung zur Unternehmensbewertung ist bei <strong>de</strong>r <strong>IDW</strong> Verlag GmbH, Postfach<br />
320580, 40420 Düsseldorf, erhältlich.<br />
18<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
aus, dass die Wirtschaftssubjekte zukünftige Risiken stärker gewichten als zukünftige<br />
Chancen (Risikoaversion).<br />
89 Unter Berücksichtigung dieser Risikoeinstellung kann die Unsicherheit <strong>de</strong>r künftigen<br />
finanziellen Überschüsse grundsätzlich durch zwei Vorgehensweisen in die Bewertung<br />
eingehen: Als Abschlag vom Erwartungswert <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse (Sicherheitsäquivalenzmetho<strong>de</strong>,<br />
Ergebnisabschlagsmetho<strong>de</strong>) o<strong>de</strong>r als Zuschlag zum<br />
Kapitalisierungszinssatz (Zinszuschlagsmetho<strong>de</strong>, Risikozuschlagsmetho<strong>de</strong>). Für<br />
<strong>de</strong>n Fall negativer finanzieller Überschüsse kann die Unsicherheit grundsätzlich als<br />
Zuschlag zum Absolutbetrag <strong>de</strong>s Erwartungswerts <strong>de</strong>r negativen finanziellen Überschüsse<br />
(Sicherheitsäquivalenzmetho<strong>de</strong>) o<strong>de</strong>r als Abschlag vom Kapitalisierungszinssatz<br />
(Zinszuschlagsmetho<strong>de</strong>) berücksichtigt wer<strong>de</strong>n.<br />
90 Die national und international üblicherweise angewandte Zinszuschlagsmetho<strong>de</strong> hat<br />
<strong>de</strong>n Vorteil, dass sie sich auf empirisch beobachtbares Verhalten stützen kann und<br />
erlaubt damit eine marktorientierte Vorgehensweise bei <strong>de</strong>r Bemessung von Risikozuschlägen.<br />
Wegen <strong>de</strong>r Problematik einer ein<strong>de</strong>utigen Abgrenzung sollte nicht zwischen<br />
unternehmensspeziellen und allgemeinen Risiken unterschie<strong>de</strong>n und das<br />
(gesamte) Unternehmerrisiko ausschließlich im Kapitalisierungszinssatz berücksichtigt<br />
wer<strong>de</strong>n. Im Zähler <strong>de</strong>r Bewertungsformeln sind dann die Erwartungswerte anzusetzen.<br />
Planungsrechnungen <strong>de</strong>s Unternehmens sind entsprechend zu korrigieren,<br />
wenn sie an<strong>de</strong>re Werte wi<strong>de</strong>rspiegeln.<br />
91 Die konkrete Höhe <strong>de</strong>s Risikozuschlags wird in <strong>de</strong>r Praxis insbeson<strong>de</strong>re hinsichtlich<br />
unterschiedlicher Gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Risikoaversion nur mithilfe von Typisierungen und vereinfachen<strong>de</strong>n<br />
Annahmen festzulegen sein. Am Markt beobachtete Risikoprämien<br />
sind hierfür geeignete Ausgangsgrößen, die an die Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>s Bewertungsfalls<br />
anzupassen sind. Eine bloße Übernahme beobachteter Risikoprämien<br />
schei<strong>de</strong>t grundsätzlich aus, weil sich das zu bewerten<strong>de</strong> Unternehmen in aller Regel<br />
hinsichtlich seiner – durch externe und interne Einflüsse (z.B. Standort-, Umweltund<br />
Brancheneinflüsse, Kapitalstruktur, Kun<strong>de</strong>nabhängigkeit, Produktprogramm)<br />
geprägten – spezifischen Risikostruktur von <strong>de</strong>n Unternehmen unterschei<strong>de</strong>t, für die<br />
Risikoprämien am Markt beobachtet wor<strong>de</strong>n sind. Darüber hinaus müssen für die<br />
Vergangenheit beobachtete Risikoprämien angepasst wer<strong>de</strong>n, wenn für die Zukunft<br />
an<strong>de</strong>re Einflüsse erwartet wer<strong>de</strong>n. Dabei hat <strong>de</strong>r unternehmensspezifische Risikozuschlag<br />
sowohl das operative Risiko aus <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r betrieblichen Tätigkeit als<br />
auch das vom Verschuldungsgrad beeinflusste Kapitalstrukturrisiko abzu<strong>de</strong>cken.<br />
92 Eine marktgestützte Ermittlung <strong>de</strong>s Risikozuschlags kann insbeson<strong>de</strong>re auf <strong>de</strong>r Basis<br />
<strong>de</strong>s Capital Asset Pricing Mo<strong>de</strong>l (CAPM) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Tax-Capital Asset Pricing Mo<strong>de</strong>l<br />
(Tax-CAPM) vorgenommen wer<strong>de</strong>n 10 .<br />
6.3. Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern im Kapitalisierungszinssatz<br />
93 Die finanziellen Überschüsse aus <strong>de</strong>m Unternehmen sind mit <strong>de</strong>n aus einer gleichartigen<br />
Alternativinvestition in Unternehmen zu erzielen<strong>de</strong>n finanziellen Überschüs-<br />
10<br />
Zu Erläuterungen <strong>de</strong>s CAPM und <strong>de</strong>s Tax-CAPM im Hinblick auf die Anwendung bei Unternehmensbewertungen<br />
gemäß <strong>IDW</strong> S 1 vgl. WP Handbuch <strong>2008</strong>, Band II, 13. Aufl., Abschn. A. VI 2.<br />
19<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
sen zu vergleichen. Hierzu ist bei <strong>de</strong>r Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts<br />
typisierend auf Renditen eines Bün<strong>de</strong>ls von am Kapitalmarkt notierten<br />
Unternehmensanteilen (Aktienportfolio) als Ausgangsgröße abzustellen. Sofern die<br />
zu diskontieren<strong>de</strong>n finanziellen Überschüsse um persönliche Ertragsteuern vermin<strong>de</strong>rt<br />
wer<strong>de</strong>n, ist <strong>de</strong>r Kapitalisierungszinssatz ebenfalls unter unmittelbarer Berücksichtigung<br />
persönlicher Ertragsteuern anzusetzen.<br />
6.4. Berücksichtigung wachsen<strong>de</strong>r finanzieller Überschüsse<br />
94 Die finanziellen Überschüsse wer<strong>de</strong>n auch durch Preisän<strong>de</strong>rungen beeinflusst. Zu<br />
erwarten<strong>de</strong> Preissteigerungen wer<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung im Rahmen<br />
einer Nominalrechnung berücksichtigt. Finanzielle Überschüsse und Kapitalisierungszinssatz<br />
sind in einer Nominalrechnung einschließlich erwarteter Preissteigerungen<br />
zu veranschlagen. Ebenso enthält <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sübliche risikofreie Zinssatz, <strong>de</strong>r<br />
bei <strong>de</strong>r Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts einen Bestandteil <strong>de</strong>s<br />
Kapitalisierungszinssatzes darstellt, eine Gel<strong>de</strong>ntwertungsprämie und ist damit eine<br />
Nominalgröße.<br />
95 Ferner können nicht nur Preissteigerungen, son<strong>de</strong>rn auch Mengen- und Strukturverän<strong>de</strong>rungen<br />
(Absatzausweitungen o<strong>de</strong>r -einbrüche, Kosteneinsparungen) Ursachen<br />
für Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r nominalen finanziellen Überschüsse sein.<br />
96 Für die Schätzung <strong>de</strong>s künftigen nominalen Wachstums <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse<br />
kann die erwartete Gel<strong>de</strong>ntwertungsrate daher nur ein erster Anhaltspunkt sein.<br />
Die Preissteigerungen, <strong>de</strong>nen sich das Unternehmen auf <strong>de</strong>n Beschaffungsmärkten<br />
gegenübersieht, können mehr o<strong>de</strong>r weniger stark von dieser Gel<strong>de</strong>ntwertungsrate<br />
abweichen und sind zu<strong>de</strong>m meist für die jeweiligen Einsatzfaktoren unterschiedlich<br />
hoch. Darüber hinaus kann nicht ohne Weiteres unterstellt wer<strong>de</strong>n, dass diese<br />
Preissteigerungen voll auf die Kun<strong>de</strong>n überwälzt wer<strong>de</strong>n können. Vielmehr ist im<br />
konkreten Bewertungsfall eine Annahme darüber zu treffen, ob und in welcher Höhe<br />
Preissteigerungen überwälzt wer<strong>de</strong>n können und darüber hinaus Mengen- und<br />
Strukturän<strong>de</strong>rungen zu erwarten sind.<br />
97 Während das Wachstum in <strong>de</strong>r Detailplanungsphase direkt in <strong>de</strong>r Unternehmensplanung<br />
und somit in <strong>de</strong>n finanziellen Überschüssen abgebil<strong>de</strong>t wird, erfor<strong>de</strong>rt die<br />
Ermittlung eines nachhaltigen Wachstums in <strong>de</strong>r zweiten Phase zunächst eine eingehen<strong>de</strong><br />
Analyse auf <strong>de</strong>r Basis langfristig zu prognostizieren<strong>de</strong>r Wachstumstrends<br />
und die Berücksichtigung <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Investitionserfor<strong>de</strong>rnisse.<br />
98 Wachsen die finanziellen Überschüsse unendlich lange mit konstanter Rate, ist zur<br />
Barwertermittlung <strong>de</strong>r erste finanzielle Überschuss dieser Reihe mit einem um die<br />
Wachstumsrate vermin<strong>de</strong>rten (nominalen, ggf. um persönliche Ertragsteuern gekürzten)<br />
Kapitalisierungszinssatz zu diskontieren.<br />
Bei <strong>de</strong>r Phasenmetho<strong>de</strong> sind daher zunächst die in <strong>de</strong>r Detailplanungsphase einzeln<br />
veranschlagten finanziellen Überschüsse mit einem – nur um persönliche Ertragsteuern<br />
gekürzten – nominalen Kapitalisierungszinssatz zu diskontieren, da ein<br />
Wachstum bereits in <strong>de</strong>n finanziellen Überschüssen abzubil<strong>de</strong>n ist. Erst die finanziellen<br />
Überschüsse <strong>de</strong>r ferneren Phase sind mit einem um einen Wachstumsabschlag<br />
gemin<strong>de</strong>rten – zuvor um persönliche Ertragsteuern gekürzten – Kapitali-<br />
20<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
sierungszinssatz auf <strong>de</strong>n Zeitpunkt <strong>de</strong>s Beginns dieser Phase zu diskontieren; die<br />
weitere Abzinsung auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag ist dann wie<strong>de</strong>rum mit <strong>de</strong>m – nur um<br />
persönliche Ertragsteuern gekürzten – nominalen Kapitalisierungszinssatz vorzunehmen.<br />
6.5. Brutto- o<strong>de</strong>r Nettokapitalisierung<br />
99 Der Unternehmenswert lässt sich rechentechnisch direkt (einstufig) durch Nettokapitalisierung<br />
ermitteln, in<strong>de</strong>m die um Fremdkapitalkosten vermin<strong>de</strong>rten finanziellen<br />
Überschüsse in einem Schritt diskontiert wer<strong>de</strong>n (Ertragswertverfahren, Equity-<br />
Ansatz als eine Variante <strong>de</strong>r DCF-Verfahren). Der Unternehmenswert lässt sich rechentechnisch<br />
aber auch indirekt (mehrstufig) durch Bruttokapitalisierung ermitteln,<br />
in<strong>de</strong>m einzelne Komponenten <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse mit unterschiedlichen<br />
Zinssätzen kapitalisiert wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r in<strong>de</strong>m nur die finanziellen Überschüsse aus <strong>de</strong>r<br />
Geschäftstätigkeit in einem Schritt diskontiert und anschließend um <strong>de</strong>n Marktwert<br />
<strong>de</strong>s Fremdkapitals gemin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Diese Betrachtungsweise liegt <strong>de</strong>m Konzept<br />
<strong>de</strong>s angepassten Barwerts (Adjusted Present Value-Ansatz, APV-Ansatz) und auch<br />
<strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital-<br />
Ansatz, WACC-Ansatz) zugrun<strong>de</strong>, die weitere Varianten <strong>de</strong>r DCF-Verfahren darstellen.<br />
Bei diesen Verfahren sind die einzelnen Komponenten <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse<br />
grundsätzlich mit einem risikoadäquaten Zinssatz zu kapitalisieren; Zähler<br />
und Nenner <strong>de</strong>r Bewertungsformeln müssen auch insoweit aufeinan<strong>de</strong>r abgestimmt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
100 Unabhängig davon, welche Bewertungsmetho<strong>de</strong> angewen<strong>de</strong>t wird, ist <strong>de</strong>r Einfluss<br />
<strong>de</strong>r Kapitalstruktur <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens auf die Kapitalisierungszinssätze<br />
zu berücksichtigen. Für die Bestimmung <strong>de</strong>r Kapitalstruktur sind sog. Marktwerte<br />
(d.h. beim Eigenkapital gutachtlich ermittelte Werte) und nicht Buchwerte relevant.<br />
Es ist davon auszugehen, dass ein hoher Verschuldungsgrad mit einem hohen<br />
finanziellen Risiko korreliert und ceteris paribus zu höheren Risikozuschlägen<br />
führt. Daher ist <strong>de</strong>r Risikozuschlag anzupassen, wenn sich die Kapitalstruktur im<br />
Zeitablauf än<strong>de</strong>rt. Wird <strong>de</strong>r Kapitalisierungszinssatz entsprechend Abschn. 6.2. kapitalmarktorientiert<br />
abgeleitet, sollte auch die Kapitalstruktur mittels eines Marktmo<strong>de</strong>lls<br />
(z.B. auf <strong>de</strong>m Modigliani-Miller-Theorem basieren<strong>de</strong> Arbitragemo<strong>de</strong>lle) im Risikozuschlag<br />
erfasst wer<strong>de</strong>n. Wird von dieser Vorgehensweise abgewichen, ist die<br />
statt<strong>de</strong>ssen gewählte Vorgehensweise zu erläutern und zu begrün<strong>de</strong>n. Auf die geson<strong>de</strong>rte<br />
Berücksichtigung <strong>de</strong>r Kapitalstruktur <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts kann verzichtet<br />
wer<strong>de</strong>n, wenn sie <strong>de</strong>r Kapitalstruktur <strong>de</strong>r Alternativanlage nahezu entspricht und<br />
im Zeitablauf kaum schwankt.<br />
7. Bewertungsverfahren<br />
7.1. Anwendung von Ertragswert- o<strong>de</strong>r DCF-Verfahren<br />
101 Ertragswert- und Discounted Cash Flow-Verfahren beruhen auf <strong>de</strong>r gleichen konzeptionellen<br />
Grundlage (Kapitalwertkalkül); in bei<strong>de</strong>n Fällen wird <strong>de</strong>r Barwert zukünftiger<br />
finanzieller Überschüsse ermittelt. Konzeptionell können sowohl objektivierte<br />
Unternehmenswerte als auch subjektive Entscheidungswerte mit bei<strong>de</strong>n<br />
21<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
Bewertungsverfahren ermittelt wer<strong>de</strong>n. Bei gleichen Bewertungsannahmen bzw.<br />
-vereinfachungen, insbeson<strong>de</strong>re hinsichtlich <strong>de</strong>r Finanzierung, führen bei<strong>de</strong> Verfahren<br />
zu gleichen Unternehmenswerten. Beobachtet man in <strong>de</strong>r Praxis unterschiedliche<br />
Unternehmenswerte aufgrund <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Verfahren, so ist dies<br />
regelmäßig auf unterschiedliche Annahmen - insbeson<strong>de</strong>re hinsichtlich Zielkapitalstruktur,<br />
Risikozuschlag und sonstiger Plandaten – zurückzuführen.<br />
7.2. Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts nach <strong>de</strong>m Ertragswertverfahren<br />
7.2.1. Grundsätzliches Vorgehen<br />
102 Das Ertragswertverfahren ermittelt <strong>de</strong>n Unternehmenswert durch Diskontierung <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n Unternehmenseignern künftig zufließen<strong>de</strong>n finanziellen Überschüsse, wobei<br />
diese üblicherweise aus <strong>de</strong>n für die Zukunft geplanten Jahresergebnissen abgeleitet<br />
wer<strong>de</strong>n. Die dabei zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong> Planungsrechnung kann nach han<strong>de</strong>lsrechtlichen<br />
o<strong>de</strong>r nach an<strong>de</strong>ren Vorschriften (z.B. IFRS, US GAAP) aufgestellt sein.<br />
7.2.2. Ermittlung <strong>de</strong>r Ertragsüberschüsse aus <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen Vermögen<br />
7.2.2.1. Bereinigung <strong>de</strong>r Vergangenheitserfolgsrechnung<br />
103 Es ist sachgerecht, eine Bereinigung <strong>de</strong>r Vergangenheitserfolgsrechnung<br />
(vgl. Abschn. 5.2.) für die folgen<strong>de</strong>n wesentlichen Tatbestän<strong>de</strong> vorzunehmen:<br />
· Eliminierung <strong>de</strong>r Aufwendungen und Erträge <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen<br />
Vermögens<br />
· Bereinigung zur Ermittlung eines perio<strong>de</strong>ngerechten Erfolgsausweises<br />
· Bereinigung zum Ausgleich ausgeübter Bilanzierungswahlrechte<br />
· Bereinigung um personenbezogene und an<strong>de</strong>re spezifische Erfolgsfaktoren<br />
· Erfassung von Folgeän<strong>de</strong>rungen vorgenommener Bereinigungsvorgänge.<br />
7.2.2.2. Planung <strong>de</strong>r Aufwendungen und Erträge<br />
104 Da die bereinigten Vergangenheitsergebnisse unter Verwendung von Gewinn- und<br />
Verlustrechnungen ermittelt wer<strong>de</strong>n, empfiehlt es sich, die künftigen finanziellen<br />
Überschüsse ausgehend von <strong>de</strong>n Aufwands- und Ertragsplanungen für verschie<strong>de</strong>ne<br />
Planungsphasen zu prognostizieren.<br />
105 Soweit möglich wer<strong>de</strong>n Erfolgsanalysen <strong>de</strong>r einzelnen Produkte und Produktbereiche<br />
sowie Analysen <strong>de</strong>r Entwicklungsten<strong>de</strong>nzen <strong>de</strong>r Aufwendungen und Erträge im<br />
Einzelnen vorgenommen, um daraus die Planungsrechnungen und Prognosen zu<br />
entwickeln. Hierfür kann es sinnvoll sein, eine Zuordnung <strong>de</strong>r Aufwands- und Ertragsrechnung<br />
nach Erfolgsbereichen vorzunehmen.<br />
106 Die künftigen Erträge eines Unternehmens umfassen in erster Linie die Umsatzerlöse.<br />
Für die Beurteilung <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen angesetzten<br />
Umsatzerlöse ist im Allgemeinen auf die betriebliche Umsatzplanung <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
zurückzugreifen. Dabei ist insbeson<strong>de</strong>re festzustellen, wie die branchenbezogene<br />
konjunkturelle Entwicklung in <strong>de</strong>r Zukunft voraussichtlich sein wird, ob<br />
22<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
Anhaltspunkte für eine von <strong>de</strong>m Branchentrend abweichen<strong>de</strong> Unternehmensentwicklung<br />
bestehen und welche regelmäßig wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong>n saisonalen Einflüsse<br />
bei <strong>de</strong>r Prognose <strong>de</strong>s Absatzes berücksichtigt wur<strong>de</strong>n bzw. wer<strong>de</strong>n müssen.<br />
107 Aufgabe <strong>de</strong>s Wirtschaftsprüfers ist es, die geplante Absatzentwicklung und die ihr<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Prämissen unter Zuhilfenahme von Plausibilitätsüberlegungen<br />
und Sensitivitätsanalysen kritisch zu hinterfragen, um so die aus seiner Sicht erwartbare<br />
Entwicklung bei <strong>de</strong>r Planung anzusetzen.<br />
108 Vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r geplanten Umsatzerlöse ist neben <strong>de</strong>r Plausibilität <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung einzelner Aufwandsarten auch die zukünftige Entwicklung <strong>de</strong>r Kosten-<br />
Erlös-Relationen zu untersuchen.<br />
7.2.2.3. Finanzplanung und Zinsprognose<br />
109 Je<strong>de</strong> Ertragswertrechnung hat <strong>de</strong>m in aller Regel mehr o<strong>de</strong>r weniger schwanken<strong>de</strong>n<br />
Finanzierungsvolumen eines Unternehmens Rechnung zu tragen. Insoweit kommt<br />
<strong>de</strong>r Prognose <strong>de</strong>r Zinsaufwendungen und -erträge die Aufgabe zu, die Finanzierung<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens und ihre zukünftigen Verän<strong>de</strong>rungen auszudrücken.<br />
110 Je<strong>de</strong>r zusätzliche Finanzbedarf o<strong>de</strong>r -überschuss wirkt unmittelbar auf die Aufnahme<br />
o<strong>de</strong>r Rückzahlung von Fremdmitteln bzw. führt zu Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Aktivseite<br />
(z.B. beim Erwerb von Finanzanlagen aus einem Finanzüberschuss). Dies führt zu<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Zinsaufwendungen und -erträgen, die sich in <strong>de</strong>r Ertragsüberschussrechnung<br />
nie<strong>de</strong>rschlagen.<br />
111 Das Zinsergebnis leitet sich rechnerisch aus <strong>de</strong>m Bestand an verzinslichen Aktiva<br />
und Passiva sowie <strong>de</strong>n jeweiligen Zinssätzen ab. Aus Praktikabilitätsgrün<strong>de</strong>n kann<br />
das Zinsergebnis basierend auf einer saldierten Netto-Finanzposition und einem<br />
durchschnittlichen langfristigen Zinssatz abgeleitet wer<strong>de</strong>n.<br />
7.2.3. Ermittlung <strong>de</strong>r Überschüsse aus nicht betriebsnotwendigem Vermögen<br />
112 Zur Wertermittlung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens vgl. Abschn. 4.5.<br />
7.2.4. Ermittlung <strong>de</strong>s Kapitalisierungszinssatzes<br />
113 Die finanziellen Überschüsse aus <strong>de</strong>m Unternehmen sind mit <strong>de</strong>m Kapitalisierungszinssatz<br />
auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag abzuzinsen, um sie mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Investor zur<br />
Verfügung stehen<strong>de</strong>n Anlagealternative vergleichbar zu machen.<br />
7.2.4.1. Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte<br />
114 Der Kapitalisierungszinssatz repräsentiert die Rendite aus einer zur Investition in<br />
das zu bewerten<strong>de</strong> Unternehmen adäquaten Alternativanlage und muss <strong>de</strong>m zu kapitalisieren<strong>de</strong>n<br />
Zahlungsstrom hinsichtlich Fristigkeit, Risiko und Besteuerung<br />
äquivalent sein. Den Ausgangspunkt für die Bestimmung <strong>de</strong>r Rendite <strong>de</strong>r Alternativanlage<br />
bil<strong>de</strong>t die beobachtete Rendite einer Anlage in Unternehmensanteile. Dies<br />
23<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
gilt unabhängig von <strong>de</strong>r Rechtsform <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens, da diese<br />
Form <strong>de</strong>r Alternativanlage grundsätzlich allen Anteilseignern zur Verfügung steht.<br />
115 Als Ausgangsgrößen für die Bestimmung von Alternativrenditen kommen insbeson<strong>de</strong>re<br />
Kapitalmarktrenditen für Unternehmensbeteiligungen (in Form eines Aktienportfolios)<br />
in Betracht. Diese Renditen für Unternehmensanteile lassen sich grundsätzlich<br />
in einen Basiszinssatz und in eine von <strong>de</strong>n Anteilseignern aufgrund <strong>de</strong>r<br />
Übernahme unternehmerischen Risikos gefor<strong>de</strong>rte Risikoprämie zerlegen.<br />
116 Für <strong>de</strong>n objektivierten Unternehmenswert ist bei <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>s Basiszinssatzes<br />
von <strong>de</strong>m lan<strong>de</strong>süblichen Zinssatz für eine (quasi-)risikofreie Kapitalmarktanlage<br />
auszugehen. Daher wird für <strong>de</strong>n Basiszinssatz grundsätzlich auf die langfristig erzielbare<br />
Rendite öffentlicher Anleihen abgestellt.<br />
117 Bei <strong>de</strong>r Festlegung <strong>de</strong>s Basiszinssatzes ist zu berücksichtigen, dass die Geldanlage<br />
im zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmen mit einer fristadäquaten alternativen Geldanlage<br />
zu vergleichen ist, sodass <strong>de</strong>r Basiszinssatz ein fristadäquater Zinssatz sein muss<br />
(Laufzeitäquivalenz). Sofern ein Unternehmen mit zeitlich unbegrenzter Lebensdauer<br />
bewertet wird, müsste daher als Basiszinssatz die am Bewertungsstichtag beobachtbare<br />
Rendite aus einer Anlage in zeitlich nicht begrenzte Anleihen <strong>de</strong>r öffentlichen<br />
Hand herangezogen wer<strong>de</strong>n. In Ermangelung solcher Wertpapiere empfiehlt<br />
es sich, <strong>de</strong>n Basiszins ausgehend von aktuellen Zinsstrukturkurven und zeitlich darüber<br />
hinausgehen<strong>de</strong>n Prognosen abzuleiten. Bei Unternehmen mit einer zeitlich begrenzten<br />
Lebensdauer ist ein für diese Frist gelten<strong>de</strong>r Zinssatz heranzuziehen.<br />
118 Aus <strong>de</strong>n am Kapitalmarkt empirisch ermittelten Aktienrenditen können mithilfe von<br />
Kapitalmarktpreisbildungsmo<strong>de</strong>llen (CAPM, Tax-CAPM) Risikoprämien abgeleitet<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
119 Aktienrenditen und Risikoprämien wer<strong>de</strong>n grundsätzlich durch persönliche Ertragsteuern<br />
beeinflusst. Das CAPM stellt ein Kapitalmarktmo<strong>de</strong>ll dar, in <strong>de</strong>m Kapitalkosten<br />
und Risikoprämien ohne die Berücksichtigung <strong>de</strong>r Wirkungen von persönlichen<br />
Ertragsteuern erklärt wer<strong>de</strong>n. Eine Erklärung <strong>de</strong>r empirisch beobachtbaren Aktienrenditen<br />
erfolgt durch das Tax-CAPM, welches das CAPM um die explizite Berücksichtigung<br />
<strong>de</strong>r Wirkungen persönlicher Ertragsteuern erweitert. Sofern nach <strong>de</strong>n<br />
dargestellten Grundsätzen die Unternehmensbewertung ohne unmittelbare Berücksichtigung<br />
persönlicher Einkommensteuer erfolgt, können die hierzu erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Vorsteuerrenditen <strong>de</strong>r Alternativanlage anhand <strong>de</strong>s CAPM abgeleitet wer<strong>de</strong>n.<br />
120 Nach <strong>de</strong>m Tax-CAPM wer<strong>de</strong>n die erwarteten Renditen nach typisierter Ertragsteuer<br />
als Summe aus <strong>de</strong>m risikolosen Basiszinssatz nach Ertragsteuer und einer Risikoprämie<br />
nach Ertragsteuer, die mittels <strong>de</strong>s unternehmensindividuellen Betafaktors<br />
zu einer unternehmensindividuellen Risikoprämie transformiert wird, erklärt. Entspricht<br />
im Einzelfall das Risiko <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens <strong>de</strong>m Risiko <strong>de</strong>s<br />
herangezogenen Aktienportfolios, stimmt die Rendite <strong>de</strong>s Aktienportfolios nach Ertragsteuern<br />
mit <strong>de</strong>m Kapitalisierungszinssatz nach Steuern überein.<br />
121 Der unternehmensindividuelle Betafaktor ergibt sich als Kovarianz zwischen <strong>de</strong>n<br />
Aktienrenditen <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens o<strong>de</strong>r vergleichbarer Unternehmen<br />
und <strong>de</strong>r Rendite eines Aktienin<strong>de</strong>x, dividiert durch die Varianz <strong>de</strong>r Renditen<br />
<strong>de</strong>s Aktienin<strong>de</strong>x. Von Finanzdienstleistern wer<strong>de</strong>n auch Prognosen für Betafaktoren<br />
24<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
angeboten. Die Prognoseeignung von Betafaktoren ist im jeweiligen Einzelfall zu<br />
würdigen (Zukunftsausrichtung, Datenqualität, Angemessenheit im Hinblick auf die<br />
Kapitalstruktur, Übertragung ausländischer Betafaktoren).<br />
122 Der Kapitalisierungszinssatz setzt sich bei unmittelbarer Berücksichtigung von persönlichen<br />
Steuern aus <strong>de</strong>m um die typisierte persönliche Ertragsteuer gekürzten<br />
Basiszinssatz und <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Tax-CAPM ermittelten Risikoprämie zusammen.<br />
Für die Unternehmensbewertung ohne unmittelbare Berücksichtigung<br />
persönlicher Ertragsteuern ergibt sich <strong>de</strong>r zu verwen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kapitalisierungszinssatz<br />
als Summe aus (unversteuertem) Basiszinssatz und <strong>de</strong>m auf Basis <strong>de</strong>s CAPM abgeleiteten<br />
Risikozuschlag. In bei<strong>de</strong>n Fällen kann <strong>de</strong>r Erwartung wachsen<strong>de</strong>r finanzieller<br />
Überschüsse in <strong>de</strong>r zweiten Phase durch einen Wachstumsabschlag Rechnung<br />
zu tragen sein (vgl. Abschn. 6.4.).<br />
7.2.4.2. Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte<br />
123 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte richtet sich <strong>de</strong>r Kapitalisierungszinssatz<br />
nach <strong>de</strong>n individuellen Verhältnissen <strong>de</strong>s jeweiligen Investors. Als Kapitalisierungszinssatz<br />
kommt dabei z.B. die individuelle Renditeerwartung <strong>de</strong>s Investors<br />
bei einer Alternativinvestition, <strong>de</strong>r Zinssatz zur Ablösung vorgesehener Kredite o<strong>de</strong>r<br />
ein Zinssatz, <strong>de</strong>r sich aus einer subjektiven Einschätzung <strong>de</strong>r Komponenten (Basiszinssatz,<br />
Risikozuschlag) ableitet, in Betracht. Auch in diesem Fall ist das Erfor<strong>de</strong>rnis<br />
<strong>de</strong>r Laufzeitäquivalenz zu beachten und ggf. ein Wachstumsabschlag zu berücksichtigen.<br />
7.3. Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts nach <strong>de</strong>n DCF-Verfahren<br />
7.3.1. Überblick<br />
124 DCF-Verfahren bestimmen <strong>de</strong>n Unternehmenswert durch Diskontierung von Cashflows.<br />
Die Cashflows stellen erwartete Zahlungen an die Kapitalgeber dar. Je nach<br />
Verfahren sind sie unterschiedlich <strong>de</strong>finiert (vgl. insbeson<strong>de</strong>re Abschn. 7.2.2.2.,<br />
7.3.3. und 7.3.4.). Während nach <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten<br />
(WACC-Ansatz) und nach <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>s angepassten Barwerts (APV-Ansatz)<br />
<strong>de</strong>r Marktwert <strong>de</strong>s Eigenkapitals sich indirekt als Differenz aus einem Gesamtkapitalwert<br />
und <strong>de</strong>m Marktwert <strong>de</strong>s Fremdkapitals ermittelt, wird nach <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r<br />
direkten Ermittlung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>s Eigenkapitals (Equity-Ansatz) <strong>de</strong>r Marktwert <strong>de</strong>s<br />
Eigenkapitals durch Abzinsung <strong>de</strong>r um die Fremdkapitalkosten vermin<strong>de</strong>rten Cashflows<br />
mit <strong>de</strong>r Rendite <strong>de</strong>s Eigenkapitals („Eigenkapitalkosten“) berechnet. Das Konzept<br />
<strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten und das Konzept <strong>de</strong>s angepassten Barwerts gehen<br />
von einer Bruttokapitalisierung aus (Entity-Ansätze), das Konzept <strong>de</strong>r direkten<br />
Ermittlung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>s Eigenkapitals geht dagegen von einer Nettokapitalisierung<br />
aus (vgl. Abschn. 6.5.). Ungeachtet <strong>de</strong>r Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Rechentechnik führen<br />
die einzelnen DCF-Verfahren bei konsistenten Annahmen grundsätzlich zu übereinstimmen<strong>de</strong>n<br />
Ergebnissen.<br />
25<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
7.3.2. Das Konzept <strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten (WACC-Ansatz)<br />
7.3.2.1. Grundsätzliches Vorgehen<br />
125 Der Gesamtkapitalwert nach <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten ergibt sich<br />
durch Diskontierung <strong>de</strong>r Free Cashflows (vor Zinsen). Dabei wer<strong>de</strong>n die Free Cashflows<br />
<strong>de</strong>r ersten Phase <strong>de</strong>tailliert prognostiziert (vgl. Abschn. 5.3.). Für die sich daran<br />
anschließen<strong>de</strong> zweite Phase wird ein Residualwert angesetzt. Die Diskontierung<br />
erfolgt mit <strong>de</strong>n gewogenen Kapitalkosten. Zu <strong>de</strong>m Gesamtkapitalwert wird <strong>de</strong>r Wert<br />
<strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens hinzugerechnet.<br />
126 Der WACC-Ansatz unterstellt, dass <strong>de</strong>r Gesamtkapitalwert – abgesehen von Steuereinflüssen<br />
– unabhängig von <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r Finanzierung ist. In einem zweiten Schritt<br />
ist <strong>de</strong>r Gesamtkapitalwert auf das Eigen- und das Fremdkapital aufzuteilen. Den<br />
Marktwert <strong>de</strong>s Fremdkapitals erhält man, in<strong>de</strong>m die Free Cashflows an die Fremdkapitalgeber<br />
mit einem das Risikopotenzial dieser Zahlungsströme wi<strong>de</strong>rspiegeln<strong>de</strong>n<br />
Zinssatz diskontiert wer<strong>de</strong>n. Die Differenz aus Gesamtkapitalwert und Marktwert<br />
<strong>de</strong>s Fremdkapitals entspricht <strong>de</strong>m Marktwert <strong>de</strong>s Eigenkapitals (Unternehmenswert).<br />
7.3.2.2. Bestimmung <strong>de</strong>r künftigen Free Cashflows<br />
127 Die künftigen Free Cashflows sind jene finanziellen Überschüsse, die unter Berücksichtigung<br />
gesellschaftsrechtlicher Ausschüttungsgrenzen allen Kapitalgebern <strong>de</strong>s<br />
Unternehmens zur Verfügung stehen. Die Free Cashflows stellen finanzielle Überschüsse<br />
nach Investitionen und Unternehmensteuern, jedoch vor Zinsen sowie nach<br />
Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Nettoumlaufvermögens dar. Thesaurierte Cashflows wer<strong>de</strong>n insoweit<br />
durch die Verän<strong>de</strong>rung entsprechen<strong>de</strong>r Bilanzposten berücksichtigt. Bei indirekter<br />
Ermittlung ergeben sich die Cashflows aus Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen<br />
jeweils wie folgt:<br />
Jahresergebnis<br />
+ Fremdkapitalzinsen<br />
- Unternehmensteuer-Ersparnis infolge <strong>de</strong>r Abzugsfähigkeit<br />
<strong>de</strong>r Fremdkapitalzinsen (tax shield)<br />
+ Abschreibungen und an<strong>de</strong>re zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
- zahlungsunwirksame Erträge<br />
- Investitionsauszahlungen abzüglich Einzahlungen aus Desinvestitionen<br />
+/- Vermin<strong>de</strong>rung/Erhöhung <strong>de</strong>s Nettoumlaufvermögens<br />
= Free Cashflow<br />
128 Die Hinzurechnung <strong>de</strong>r Fremdkapitalzinsen kann sowohl Zinsen aufgrund einer expliziten<br />
Vereinbarung als auch implizite Zinsen (insbeson<strong>de</strong>re bei Pensionsverpflichtungen)<br />
umfassen. Letzteres setzt voraus, dass die Pensionsverpflichtungen als Bestandteil<br />
<strong>de</strong>s Fremdkapitals berücksichtigt wer<strong>de</strong>n und die damit verbun<strong>de</strong>nen<br />
Fremdkapitalkosten im Rahmen <strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten erfasst wer<strong>de</strong>n. Die<br />
von <strong>de</strong>m Unternehmen gezahlten Unternehmensteuern wer<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Ermittlung<br />
26<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
<strong>de</strong>r Free Cashflows abgezogen. Da <strong>de</strong>r Free Cashflow unter <strong>de</strong>r Annahme ermittelt<br />
wird, dass keine Gewinn min<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Fremdkapitalzinsen zu zahlen sind, ist die<br />
durch <strong>de</strong>n Abzug <strong>de</strong>r Fremdkapitalzinsen bewirkte Steuerersparnis (bei in- und ausländischen<br />
Ertragsteuern) im Jahresergebnis zu korrigieren.<br />
7.3.2.3. Ermittlung <strong>de</strong>s Residualwerts<br />
129 Der Residualwert wird unter <strong>de</strong>r Annahme <strong>de</strong>r Fortführung o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Veräußerung<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens ermittelt. Maßgeblich ist – falls keine rechtlichen o<strong>de</strong>r wirtschaftlichen<br />
Gegebenheiten <strong>de</strong>r Fortführung bzw. Liquidation entgegenstehen – <strong>de</strong>r jeweils<br />
höhere Wert (vgl. Abschn. 7.4.).<br />
130 Der Fortführungswert entspricht <strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r Free Cashflows nach Ablauf <strong>de</strong>s<br />
Detailprognosezeitraums. Dabei wer<strong>de</strong>n die gewogenen Kapitalkosten i.d.R. als<br />
konstant angenommen.<br />
131 Bei unterstellter Veräußerung <strong>de</strong>s Unternehmens ist <strong>de</strong>r voraussichtliche Veräußerungswert<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens als Ganzes abzüglich <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Kosten<br />
anzusetzen.<br />
7.3.2.4. Wert <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens<br />
132 Bezüglich <strong>de</strong>r Wertermittlung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens<br />
vgl. Abschn. 4.5.<br />
7.3.2.5. Ermittlung <strong>de</strong>r Kapitalkosten<br />
133 Die gewogenen Kapitalkosten hängen von <strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>r Eigen- und <strong>de</strong>r Fremdkapitalkosten<br />
sowie infolge <strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong>n Finanzierungsneutralität <strong>de</strong>r (Unternehmens-)Besteuerung<br />
vom Verschuldungsgrad (gemessen als Verhältnis <strong>de</strong>s<br />
Marktwerts <strong>de</strong>s Fremdkapitals zum Marktwert <strong>de</strong>s Eigenkapitals) ab. Sofern sich<br />
das Verhältnis <strong>de</strong>r Marktwerte von Fremdkapital und Eigenkapital in <strong>de</strong>r Zukunft<br />
voraussichtlich in wesentlichem Umfang än<strong>de</strong>rn wird, sind die gewogenen Kapitalkosten<br />
entsprechend anzupassen. Anpassungen sind darüber hinaus bei wesentlichen<br />
Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Eigenkapitalkosten und/o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Fremdkapitalkosten erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
134 Die Kapitalkosten <strong>de</strong>r Fremdkapitalgeber errechnen sich als gewogener durchschnittlicher<br />
Kostensatz <strong>de</strong>r einzelnen Fremdkapitalformen. Bei nicht explizit verzinslichen<br />
Posten <strong>de</strong>s Fremdkapitals (insbeson<strong>de</strong>re Pensionsrückstellungen) ist ein<br />
Marktzins für fristadäquate Kredite heranzuziehen. Die Ertragsteuern (Gewerbesteuer,<br />
Definitiv-Körperschaftsteuer) sind abzusetzen.<br />
135 Zur Bestimmung <strong>de</strong>r Eigenkapitalkosten im Rahmen <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter<br />
Unternehmenswerte empfiehlt es sich, auf die für das Ertragswertverfahren dargestellten<br />
Grundsätze zurückzugreifen (vgl. Abschn. 7.2.4.1.).<br />
27<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
7.3.3. Das Konzept <strong>de</strong>s angepassten Barwerts (APV-Ansatz)<br />
136 Das Konzept <strong>de</strong>s angepassten Barwerts bestimmt <strong>de</strong>n Gesamtkapitalwert komponentenweise.<br />
Zunächst wird eine ausschließliche Eigenfinanzierung angenommen<br />
und somit <strong>de</strong>r Marktwert eines nicht verschul<strong>de</strong>ten Unternehmens ermittelt; anschließend<br />
wird <strong>de</strong>r Wertbeitrag <strong>de</strong>r Verschuldung berechnet. Die Summe aus <strong>de</strong>m<br />
Marktwert <strong>de</strong>s nicht verschul<strong>de</strong>ten Unternehmens und <strong>de</strong>m Wertbeitrag <strong>de</strong>r Verschuldung<br />
entspricht <strong>de</strong>m Gesamtkapitalwert, <strong>de</strong>r nach Min<strong>de</strong>rung um <strong>de</strong>n Marktwert<br />
<strong>de</strong>r Ansprüche <strong>de</strong>r Fremdkapitalgeber <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s Eigenkapitals ergibt.<br />
137 Die Diskontierung <strong>de</strong>r Free Cashflows erfolgt mit <strong>de</strong>n Eigenkapitalkosten eines unverschul<strong>de</strong>ten<br />
Unternehmens; die Diskontierung <strong>de</strong>s Wertbeitrags <strong>de</strong>r Verschuldung<br />
erfolgt mit <strong>de</strong>m Fremdkapitalzinssatz, sofern die Steuervorteile so sicher sind wie<br />
das Fremdkapital.<br />
7.3.4. Das Konzept <strong>de</strong>r direkten Ermittlung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>s Eigenkapitals (Equity-<br />
Ansatz)<br />
138 Bei <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r direkten Ermittlung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>s Eigenkapitals wer<strong>de</strong>n die<br />
<strong>de</strong>n Eigentümern zufließen<strong>de</strong>n Überschüsse mit <strong>de</strong>n Eigenkapitalkosten (eines verschul<strong>de</strong>ten<br />
Unternehmens) diskontiert. Die Netto-Cashflows wer<strong>de</strong>n folglich um die<br />
perio<strong>de</strong>nspezifischen Zahlungen an die Fremdkapitalgeber gekürzt und mit <strong>de</strong>m<br />
Kapitalkostensatz abgezinst, <strong>de</strong>r sowohl das operative Risiko <strong>de</strong>s Unternehmens als<br />
auch das durch die Kapitalstruktur <strong>de</strong>s Unternehmens entstehen<strong>de</strong> Finanzierungsrisiko<br />
wi<strong>de</strong>rspiegelt.<br />
7.3.5. Berücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner<br />
139 Auch bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung nach <strong>de</strong>n DCF-Verfahren bestimmt sich <strong>de</strong>r<br />
Wert <strong>de</strong>s Unternehmens für <strong>de</strong>n Unternehmenseigner nach <strong>de</strong>n ihm zufließen<strong>de</strong>n<br />
Nettoeinnahmen. Die für das Ertragswertverfahren gelten<strong>de</strong>n Grundsätze zur Berücksichtigung<br />
persönlicher Ertragsteuern fin<strong>de</strong>n gleichermaßen für die DCF-<br />
Verfahren Anwendung.<br />
7.4. Ermittlung von Liquidationswerten<br />
140 Insbeson<strong>de</strong>re bei schlechter Ergebnislage kann <strong>de</strong>r Barwert <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse,<br />
die sich bei Liquidation <strong>de</strong>s gesamten Unternehmens ergeben, <strong>de</strong>n Fortführungswert<br />
übersteigen. In diesem Falle bil<strong>de</strong>t grundsätzlich <strong>de</strong>r Liquidationswert<br />
<strong>de</strong>s Unternehmens die Wertuntergrenze für <strong>de</strong>n Unternehmenswert; nur bei Vorliegen<br />
eines rechtlichen o<strong>de</strong>r tatsächlichen Zwangs zur Unternehmensfortführung ist<br />
gleichwohl auf <strong>de</strong>n Fortführungswert <strong>de</strong>s Unternehmens abzustellen.<br />
141 Der Liquidationswert wird ermittelt als Barwert <strong>de</strong>r Nettoerlöse, die sich aus <strong>de</strong>r<br />
Veräußerung <strong>de</strong>r Vermögensgegenstän<strong>de</strong> abzüglich Schul<strong>de</strong>n und Liquidationskosten<br />
ergeben. Dabei ist ggf. zu berücksichtigen, dass zukünftig entstehen<strong>de</strong> Ertragsteuern<br />
diesen Barwert min<strong>de</strong>rn.<br />
28<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
7.5. Anhaltspunkte für Plausibilitätsbeurteilungen<br />
7.5.1. Börsenpreis<br />
142 Liegen für Unternehmensanteile Börsenkurse vor, so sind diese zur Plausibilitätsbeurteilung<br />
<strong>de</strong>s nach vorstehen<strong>de</strong>n Grundsätzen ermittelten Unternehmens- o<strong>de</strong>r Anteilswerts<br />
heranzuziehen (vgl. im Einzelnen Abschn. 3.).<br />
7.5.2. Vereinfachte Preisfindungen<br />
143 Vereinfachte Preisfindungen (z.B. Ergebnismultiplikatoren, umsatz- o<strong>de</strong>r produktmengenorientierte<br />
Multiplikatoren) können im Einzelfall Anhaltspunkte für eine Plausibilitätskontrolle<br />
<strong>de</strong>r Ergebnisse <strong>de</strong>r Bewertung nach <strong>de</strong>m Ertragswertverfahren<br />
bzw. nach <strong>de</strong>n DCF-Verfahren bieten.<br />
144 Insbeson<strong>de</strong>re im Zusammenhang mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen wird in<br />
<strong>de</strong>r Praxis gelegentlich auf vereinfachte Preisfindungen für Unternehmen zurückgegriffen<br />
(vgl. Abschn. 8.3.4.). Diese können nicht an die Stelle einer Unternehmensbewertung<br />
treten.<br />
8. Beson<strong>de</strong>rheiten bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung<br />
145 Grundsätzlich ist die Ermittlung von Unternehmenswerten unabhängig von Art und<br />
Größe <strong>de</strong>s Unternehmens nach <strong>de</strong>n allgemeinen Grundsätzen (vgl. Abschn. 4.) vorzunehmen.<br />
In Einzelfällen können jedoch Beson<strong>de</strong>rheiten bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung<br />
zu beachten sein. Bei Zugrun<strong>de</strong>legung ausschließlich finanzieller Ziele<br />
ist <strong>de</strong>r Unternehmenswert auch in diesen Fällen allein aus <strong>de</strong>r Eigenschaft <strong>de</strong>r Unternehmen<br />
abzuleiten, entziehbare finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften.<br />
8.1. Bewertung wachstumsstarker Unternehmen<br />
146 Wachstumsunternehmen sind häufig durch Produkt- und Leistungsinnovation, hohe<br />
Investitionen in Human- und Sachkapital, erhebliche Vorleistungen im Entwicklungs-,<br />
Produktions- und Absatzbereich, wachsen<strong>de</strong>n Kapitalbedarf und Einsatz von<br />
Risikokapital, dynamische Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Unternehmensorganisation und – damit<br />
verbun<strong>de</strong>n – progressiv steigen<strong>de</strong> Umsätze geprägt.<br />
147 Bei diesen Unternehmen liefern Vergangenheitsergebnisse im Regelfall keinen geeigneten<br />
Anhaltspunkt für die Prognose zukünftiger Entwicklungen und für die Vornahme<br />
von Plausibilitätsüberlegungen.<br />
148 Die Prognose <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse und insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>s Gleichgewichtso<strong>de</strong>r<br />
Beharrungszustands unterliegt erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen,<br />
verbun<strong>de</strong>n mit einer hohen Sensitivität bezüglich <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung von Planungsparametern.<br />
Bei <strong>de</strong>r Wertfindung müssen daher insbeson<strong>de</strong>re die nachhaltige<br />
Markt- und Wettbewerbsfähigkeit <strong>de</strong>s Produkt- und Leistungsprogramms, die Ressourcenverfügbarkeit,<br />
die infolge <strong>de</strong>s Wachstums erfor<strong>de</strong>rlichen Anpassungsmaßnahmen<br />
<strong>de</strong>r internen Organisation und die Finanzierbarkeit <strong>de</strong>s Unternehmenswachstums<br />
analysiert wer<strong>de</strong>n. Schließlich müssen die Risikoprämie und <strong>de</strong>r Wachs-<br />
29<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
tumsabschlag die Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>r schnell wachsen<strong>de</strong>n Unternehmen hinreichend<br />
berücksichtigen.<br />
8.2. Bewertung ertragsschwacher Unternehmen<br />
8.2.1. Grundsätzliches<br />
149 Ein Unternehmen kann als ertragsschwach bezeichnet wer<strong>de</strong>n, wenn seine Kapitalverzinsung<br />
nachhaltig geringer als <strong>de</strong>r Kapitalisierungszinssatz ist. Eine andauern<strong>de</strong><br />
Ertragsschwäche kann zur Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung<br />
führen 11 .<br />
150 Bei <strong>de</strong>r Bewertung ertragsschwacher Unternehmen hat <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer daher<br />
neben <strong>de</strong>r Beurteilung von Fortführungskonzepten auch die Beurteilung von Zerschlagungskonzepten<br />
vorzunehmen, sofern Zerschlagungskonzepte im jeweiligen<br />
Einzelfall eine mögliche Handlungsalternative darstellen. Ist <strong>de</strong>r Barwert <strong>de</strong>r finanziellen<br />
Überschüsse aus <strong>de</strong>r Zerschlagung (Liquidation) eines Unternehmens höher<br />
als <strong>de</strong>r Barwert <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse bei Fortführung eines Unternehmens,<br />
bil<strong>de</strong>t grundsätzlich <strong>de</strong>r Liquidationswert die Wertuntergrenze bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung<br />
(vgl. hierzu und zur Ermittlung von Liquidationswerten Abschn.<br />
7.4.).<br />
151 Wird bei <strong>de</strong>r Bewertung ertragsschwacher Unternehmen von <strong>de</strong>ren Fortführung<br />
ausgegangen, ist <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>s zugrun<strong>de</strong> zu legen<strong>de</strong>n Unternehmenskonzepts<br />
beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung beizumessen. Wird ein objektivierter Unternehmenswert<br />
ermittelt, sind nur bereits eingeleitete Maßnahmen o<strong>de</strong>r hinreichend konkretisierte<br />
Maßnahmen im Rahmen <strong>de</strong>s bisherigen Unternehmenskonzepts zur Überwindung<br />
<strong>de</strong>r Ertragsschwäche zu berücksichtigen (vgl. Abschn. 4.4.2.1.), während<br />
ein subjektiver Entscheidungswert darüber hinaus auch geplante, aber noch nicht<br />
eingeleitete Maßnahmen o<strong>de</strong>r noch nicht im Unternehmenskonzept dokumentierte<br />
Maßnahmen beinhaltet (vgl. Abschn. 4.4.3.1.). Der Wirtschaftsprüfer hat die in <strong>de</strong>n<br />
Konzepten zur Überwindung <strong>de</strong>r Ertragsschwäche geplanten Maßnahmen sowie die<br />
vom Unternehmen geplanten finanziellen Überschüsse auf ihre Plausibilität und Realisierbarkeit<br />
hin zu untersuchen und darauf aufbauend die künftigen finanziellen<br />
Überschüsse <strong>de</strong>s Unternehmens zu prognostizieren (vgl. Abschn. 5.).<br />
8.2.2. Unternehmen mit nicht vorrangig finanzieller Zielsetzung<br />
152 Stehen bei einem Unternehmen mit unzureichen<strong>de</strong>r Rentabilität nicht finanzielle Zielsetzungen,<br />
son<strong>de</strong>rn Gesichtspunkte <strong>de</strong>r Leistungserstellung im Vor<strong>de</strong>rgrund<br />
(z.B. Non-<strong>Prof</strong>it-Unternehmen), so ist als Wert <strong>de</strong>s Unternehmens aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>s<br />
Leistungserstellers nicht <strong>de</strong>r Zukunftserfolgswert, son<strong>de</strong>rn ein Rekonstruktionswert<br />
maßgeblich (vgl. Abschn. 8.4.). Kann die <strong>de</strong>m zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmen vorge-<br />
11<br />
Vgl. <strong>IDW</strong> Stellungnahme FAR 1/1996: Empfehlungen zur Überschuldungsprüfung bei Unternehmen,<br />
WPg 1997, S. 22, FN-<strong>IDW</strong> 1996, S. 523 sowie <strong>IDW</strong> Prüfungsstandard: Empfehlungen zur Prüfung eingetretener<br />
o<strong>de</strong>r drohen<strong>de</strong>r Zahlungsunfähigkeit bei Unternehmen (<strong>IDW</strong> PS 800), WPg 1999, S. 250, FN-<strong>IDW</strong> 1999,<br />
S. 85, 2001, S. 189, liegt <strong>de</strong>rzeit als Entwurf einer Neufassung <strong>de</strong>s <strong>IDW</strong> Prüfungsstandards: Beurteilung eingetretener<br />
o<strong>de</strong>r drohen<strong>de</strong>r Zahlungsunfähigkeit bei Unternehmen (<strong>IDW</strong> EPS 800 n.F.), WPg Supplement<br />
1/<strong>2008</strong>, FN-<strong>IDW</strong> <strong>2008</strong>, S. 100, vor.<br />
30<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
gebene Leistungserstellung bei unverän<strong>de</strong>rtem laufen<strong>de</strong>n Nettobetriebsaufwand auch<br />
durch die Schaffung einer effizienteren Unternehmenssubstanz o<strong>de</strong>r -struktur erreicht<br />
wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren Aufbau wesentlich geringere Ausgaben verursacht, so ist <strong>de</strong>r Rekonstruktionswert<br />
entsprechend niedriger anzusetzen. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen<br />
ist mit seinem Liquidationswert anzusetzen.<br />
153 Der Unternehmenszweck ist insbeson<strong>de</strong>re bei solchen Unternehmen vorrangig auf<br />
die Leistungserstellung ausgerichtet, die Aufgaben <strong>de</strong>r öffentlichen Daseinsvorsorge<br />
erfüllen (z.B. in <strong>de</strong>r Wohnungs- und Stadtentwicklung o<strong>de</strong>r im Verkehrswesen) o<strong>de</strong>r<br />
karitativen Zwecken dienen. In <strong>de</strong>rartigen Fällen ist anzunehmen, dass die Leistungserstellung<br />
im öffentlichen bzw. gemeinnützigen Interesse liegt und auch unabhängig<br />
von einer unternehmerischen Betätigung erfolgen wür<strong>de</strong>. Auch bei unzureichen<strong>de</strong>r<br />
Ertragskraft kommt in diesen Fällen als Alternative zur Fortführung <strong>de</strong>s<br />
Unternehmens nicht eine Liquidation infrage, son<strong>de</strong>rn eine an<strong>de</strong>rweitige entsprechen<strong>de</strong><br />
Investition außerhalb <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens.<br />
8.3. Bewertung kleiner und mittelgroßer Unternehmen<br />
154 Beson<strong>de</strong>rheiten bei <strong>de</strong>r Bewertung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen können<br />
sich – neben quantitativen Merkmalen – insbeson<strong>de</strong>re aus <strong>de</strong>r Tatsache ergeben,<br />
dass sie im Gegensatz zu großen Unternehmen oftmals nicht über ein von <strong>de</strong>n<br />
Unternehmenseignern weitgehend unabhängiges Management verfügen, sodass<br />
<strong>de</strong>r unternehmerischen Fähigkeit <strong>de</strong>r Eigentümer erhebliche Be<strong>de</strong>utung zukommt.<br />
155 Zur Berücksichtigung individueller persönlicher Verhältnisse bei <strong>de</strong>r Ermittlung eines<br />
Einigungswerts siehe Abschn. IV. <strong>de</strong>r <strong>IDW</strong> Stellungnahme HFA 2/1995.<br />
156 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung eines Unternehmenswerts für kleine und mittelgroße Unternehmen<br />
ist beson<strong>de</strong>res Augenmerk auf die Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts, die<br />
Bestimmung <strong>de</strong>s Unternehmerlohns im Rahmen <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>s Managementfaktors<br />
und die Zuverlässigkeit <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen Informationsquellen zu richten.<br />
8.3.1. Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts<br />
157 Zur Ermittlung <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Unternehmenseinheit i.S.d. Abschn. 4.2. ist bei<br />
personenbezogenen, von <strong>de</strong>n Eigentümern dominierten Unternehmen die Abgrenzung<br />
von betrieblicher und privater Sphäre von beson<strong>de</strong>rer Be<strong>de</strong>utung. Dabei können<br />
z.B. steuerliche Son<strong>de</strong>rbilanzen zur Ermittlung von nicht bilanziertem, aber betriebsnotwendigem<br />
Vermögen und von damit korrespondieren<strong>de</strong>n künftigen finanziellen<br />
Überschüssen herangezogen wer<strong>de</strong>n. Wesentliche Bestandteile <strong>de</strong>s Anlagevermögens<br />
(insbeson<strong>de</strong>re Patente, Grundstücke) wer<strong>de</strong>n häufig im Privatvermögen<br />
gehalten. Demgemäß ist für Zwecke <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung darauf zu achten,<br />
dass diese entwe<strong>de</strong>r in die zu bewerten<strong>de</strong> Vermögensmasse eingebracht o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rweitig<br />
(z.B. durch Berechnung von Miet-, Pacht- o<strong>de</strong>r Lizenzzahlungen) berücksichtigt<br />
wer<strong>de</strong>n. In diesem Zusammenhang ist auch festzustellen, ob sämtliche Aufwendungen<br />
und Erträge betrieblich veranlasst und vollständig im Rechnungswesen<br />
erfasst sind.<br />
31<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
158 Bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen ist häufig ein nach betriebswirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten angemessenes Eigenkapital nicht vorhan<strong>de</strong>n. Im Falle einer<br />
bei Nichtberücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen Haftung von Gesellschaftern zu niedrigen<br />
Eigenkapitalausstattung sind künftige Maßnahmen zur Stärkung <strong>de</strong>r Unternehmenssubstanz<br />
(z.B. Gewinnthesaurierungen, Kapitalerhöhungen) und <strong>de</strong>ren Auswirkungen<br />
auf die künftigen finanziellen Überschüsse zu berücksichtigen. Dabei ist<br />
beschränkten Finanzierungsmöglichkeiten aufgrund fehlen<strong>de</strong>n Zugangs zum Kapitalmarkt<br />
Rechnung zu tragen.<br />
159 Ist anstelle einer Stärkung <strong>de</strong>r Unternehmenssubstanz durch Maßnahmen <strong>de</strong>r Eigenfinanzierung<br />
vorgesehen, dass aus <strong>de</strong>m Privatbereich Sicherheiten zur Verfügung<br />
gestellt wer<strong>de</strong>n, sind entsprechen<strong>de</strong> Aufwendungen für Avalprovisionen zu berücksichtigen.<br />
8.3.2. Bestimmung <strong>de</strong>s Unternehmerlohns<br />
160 Da bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen die Höhe <strong>de</strong>r künftigen finanziellen<br />
Überschüsse maßgeblich vom persönlichen Engagement und <strong>de</strong>n persönlichen<br />
Kenntnissen, Fähigkeiten und Beziehungen <strong>de</strong>r Eigentümer abhängig ist, hat die<br />
Bewertung <strong>de</strong>s Managementfaktors (Unternehmerlohn unter Berücksichtigung sämtlicher<br />
personenbezogener Wertfaktoren) beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung<br />
(vgl. Abschn. 4.4.2.4.).<br />
8.3.3. Eingeschränkte Informationsquellen<br />
8.3.3.1. Bereinigung <strong>de</strong>r Vergangenheitsergebnisse<br />
161 Bei <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>r Vergangenheitsergebnisse ist zu beachten, dass die Jahresabschlüsse<br />
kleiner und mittelgroßer Unternehmen oftmals betont steuerlich ausgerichtet<br />
sind. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Investitionen häufig nur in langen Intervallen<br />
vorgenommen wer<strong>de</strong>n. Die Gewinn- und Verlustrechnungen <strong>de</strong>r nächstzurückliegen<strong>de</strong>n<br />
Perio<strong>de</strong>n spiegeln dann die durchschnittlichen Ergebnisse möglicherweise<br />
nicht zutreffend wi<strong>de</strong>r und müssen entsprechend korrigiert wer<strong>de</strong>n.<br />
8.3.3.2. Analyse <strong>de</strong>r Ertragskraft<br />
162 Im Falle einer fehlen<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r nicht dokumentierten Unternehmensplanung hat <strong>de</strong>r<br />
Wirtschaftsprüfer die Unternehmensleitung aufzufor<strong>de</strong>rn, speziell für die Zwecke <strong>de</strong>r<br />
Unternehmensbewertung eine Planung für <strong>de</strong>n nächsten Zeitraum von ein bis fünf<br />
Jahren vorzulegen. Solche Planungsrechnungen sind im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit<br />
kritisch zu würdigen.<br />
163 Oft wird die Unternehmensleitung keine Planungsrechnung erstellen, son<strong>de</strong>rn lediglich<br />
allgemeine Vorstellungen über die künftige Entwicklung <strong>de</strong>s Unternehmens vortragen.<br />
Soweit diese nicht durch konkrete Anhaltspunkte bestätigt wer<strong>de</strong>n können,<br />
kann <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer nur aufgrund <strong>de</strong>r Vergangenheitsanalyse und <strong>de</strong>r von<br />
ihm hierbei festgestellten Entwicklungslinien eine Ertragsprognose erstellen. Es<br />
empfiehlt sich, in diesen Fällen eine Szenarioanalyse durchzuführen.<br />
32<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
8.3.4. Vereinfachte Preisfindungen<br />
164 In <strong>de</strong>r Praxis wird gelegentlich auf vereinfachte Preisfindungen für Unternehmen<br />
zurückgegriffen. Hierzu gehört insbeson<strong>de</strong>re die Anwendung von Ergebnismultiplikatoren<br />
sowie von umsatz- o<strong>de</strong>r produktmengenorientierten Multiplikatoren.<br />
165 Bei Anwendung von Ergebnismultiplikatoren ergibt sich <strong>de</strong>r Preis für das Unternehmen<br />
als Produkt eines als repräsentativ angesehenen Ergebnisses vor Steuern mit<br />
einem branchen- bzw. unternehmensspezifischen Faktor. Dieser ist insbeson<strong>de</strong>re<br />
Ausdruck <strong>de</strong>r aktuellen Kapitalkosten, <strong>de</strong>r Risikoneigung potenzieller Erwerber sowie<br />
<strong>de</strong>s Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage auf <strong>de</strong>m Markt für Unternehmenstransaktionen.<br />
166 Umsatz- o<strong>de</strong>r produktmengenorientierte Multiplikatoren wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Praxis insbeson<strong>de</strong>re<br />
zur Ermittlung <strong>de</strong>r Marktpreise für kleinere Dienstleistungsunternehmen<br />
angewandt. Diese Marktpreise wer<strong>de</strong>n oftmals weitgehend durch <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s verkehrsfähigen<br />
Kun<strong>de</strong>nstamms geprägt. Auch <strong>de</strong>r Marktwert von freiberuflichen Praxen<br />
wird im Wesentlichen durch <strong>de</strong>n übertragbaren Mandantenstamm bestimmt.<br />
167 Vereinfachte Preisfindungen können Anhaltspunkte bei <strong>de</strong>r Plausibilitätskontrolle<br />
<strong>de</strong>r Ergebnisse <strong>de</strong>r Bewertung nach Ertragswert- o<strong>de</strong>r DCF-Verfahren bieten.<br />
Ergibt sich eine Differenz zwischen <strong>de</strong>m Zukunftserfolgswert und einem zur Plausibilitätskontrolle<br />
anhand einer vereinfachten Preisfindung ermittelten Preis für das<br />
Unternehmen, so kann dies ein Anlass sein, neben <strong>de</strong>n zur Plausibilitätskontrolle<br />
herangezogenen Größen auch die <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung zugrun<strong>de</strong> gelegten<br />
Ausgangsdaten und Prämissen kritisch zu überprüfen und – soweit dabei gewonnene<br />
bessere Erkenntnisse (z.B. in Bezug auf die Ertragserwartungen) dies erfor<strong>de</strong>rn<br />
– zu korrigieren. Zur Berücksichtigung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustan<strong>de</strong><br />
gekommener, stichtagsnaher Marktpreise bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung<br />
im Familien- und Erbrecht wird auf die <strong>IDW</strong> Stellungnahme HFA 2/1995, Abschn.<br />
III.4. verwiesen.<br />
168 Tritt <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer als Berater bei <strong>de</strong>r Ermittlung eines subjektiven Entscheidungswerts<br />
auf, kann <strong>de</strong>r Vergleich <strong>de</strong>s Zukunftserfolgswerts mit einem anhand einer<br />
vereinfachten Preisfindung bestimmten Marktpreis Anhaltspunkte für eine Empfehlung<br />
im Hinblick auf <strong>de</strong>n Kauf bzw. Verkauf <strong>de</strong>s Unternehmens geben.<br />
169 In seinem Bewertungsgutachten (vgl. Abschn. 9.2.) hat <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer klarzustellen,<br />
inwieweit und mit welchen Konsequenzen vereinfachte Preisfindungen eingesetzt<br />
wur<strong>de</strong>n.<br />
8.4. Substanzwert<br />
170 Im Gegensatz zum Liquidationswert als Verkaufs- o<strong>de</strong>r Zerschlagungswert han<strong>de</strong>lt<br />
es sich bei <strong>de</strong>m Substanzwert um <strong>de</strong>n Gebrauchswert <strong>de</strong>r betrieblichen Substanz.<br />
Der Substanzwert ergibt sich als Rekonstruktions- o<strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rbeschaffungswert aller<br />
im Unternehmen vorhan<strong>de</strong>nen immateriellen und materiellen Werte (und Schul<strong>de</strong>n).<br />
Er ist insoweit Ausdruck vorgeleisteter Ausgaben, die durch <strong>de</strong>n Verzicht auf<br />
<strong>de</strong>n Aufbau eines i<strong>de</strong>ntischen Unternehmens erspart bleiben. Dem Alter <strong>de</strong>r Sub-<br />
33<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
stanz ist durch Abschläge vom Rekonstruktionsneuwert Rechnung zu tragen, die<br />
sich aus <strong>de</strong>m Verhältnis <strong>de</strong>r Restnutzungszeit zur Gesamtnutzungszeit <strong>de</strong>r Vermögensteile<br />
bzw. aus <strong>de</strong>m Verhältnis <strong>de</strong>s Restnutzungspotenzials zum Gesamtnutzungspotenzial<br />
ergeben (Rekonstruktionszeitwert). Aufgrund <strong>de</strong>r Schwierigkeiten,<br />
die sich in <strong>de</strong>r Praxis bei <strong>de</strong>r Ermittlung nicht bilanzierungsfähiger, vor allem immaterieller<br />
Werte ergeben, wird i.d.R. ein Substanzwert i.S. eines (Netto-) Teilrekonstruktionszeitwerts<br />
ermittelt.<br />
171 Dem Substanzwert, verstan<strong>de</strong>n als (Netto-)Teilrekonstruktionszeitwert, fehlt grundsätzlich<br />
<strong>de</strong>r direkte Bezug zu künftigen finanziellen Überschüssen. Daher kommt<br />
ihm bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts keine eigenständige Be<strong>de</strong>utung zu.<br />
172 Substanzwerte sind vom Wirtschaftsprüfer nur dann zu ermitteln, wenn dies im Auftrag<br />
für das Bewertungsgutachten ausdrücklich festgelegt ist. Für die Ermittlung von<br />
Substanzwerten gelten sinngemäß die allgemeinen Grundsätze <strong>de</strong>r Maßgeblichkeit<br />
<strong>de</strong>s Bewertungszwecks (vgl. Abschn. 4.1.), <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Unternehmenseinheit<br />
(vgl. Abschn. 4.2.), <strong>de</strong>r geson<strong>de</strong>rten Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen<br />
Vermögens (vgl. Abschn. 4.5.), <strong>de</strong>r Unbeachtlichkeit <strong>de</strong>s (bilanziellen)<br />
Vorsichtsprinzips (vgl. Abschn. 4.6.) und <strong>de</strong>r Nachvollziehbarkeit <strong>de</strong>r Bewertungsansätze<br />
(vgl. Abschn. 4.7.) sowie das Stichtagsprinzip (vgl. Abschn. 4.3.).<br />
9. Dokumentation und Berichterstattung<br />
9.1. Arbeitspapiere<br />
173 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung von Unternehmenswerten sind die berufsüblichen Grundsätze in<br />
Bezug auf die Anlage von Arbeitspapieren entsprechend anzuwen<strong>de</strong>n 12 . Hierzu gehört<br />
auch die Einholung einer Vollständigkeitserklärung (vgl. Abschn. 5.5.).<br />
174 Die Arbeitspapiere müssen es einem sachkundigen Dritten ermöglichen, das Bewertungsergebnis<br />
nachzuvollziehen und die Auswirkungen <strong>de</strong>r getroffenen Annahmen<br />
auf <strong>de</strong>n Unternehmenswert abzuschätzen (intersubjektive Nachprüfbarkeit).<br />
9.2. Bewertungsgutachten<br />
175 Im Bewertungsgutachten muss <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer einen ein<strong>de</strong>utigen Unternehmenswert<br />
bzw. eine -wertspanne nennen und begrün<strong>de</strong>n. Die Berichterstattung verfolgt<br />
grundsätzlich das Ziel, <strong>de</strong>n Empfänger <strong>de</strong>s Gutachtens in die Lage zu versetzen,<br />
die Wertfindung und ihre Methodik, die getroffenen Annahmen, Grundsatzüberlegungen<br />
und Schlussfolgerungen mit vertretbarem Aufwand nachvollziehen<br />
und aus seiner Sicht würdigen zu können, sodass das Gutachten die Grundlage einer<br />
sachlichen Beurteilung bil<strong>de</strong>n kann. Einzelheiten und Überlegungen zur Unternehmensbewertung<br />
sind daher so ausführlich darzulegen, wie es <strong>de</strong>n Grundsätzen<br />
ordnungsmäßiger Berichterstattung unter <strong>de</strong>r oben genannten Zielsetzung entspricht.<br />
12<br />
Vgl. Neufassung <strong>IDW</strong> Prüfungsstandard: Arbeitspapiere <strong>de</strong>s Abschlussprüfers (<strong>IDW</strong> PS 460 n.F. vom<br />
22.02.<strong>2008</strong>), WPg Supplement 2/<strong>2008</strong>, FN-<strong>IDW</strong> <strong>2008</strong>, S. 178.<br />
34<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
176 Aus <strong>de</strong>m Bewertungsgutachten muss ersichtlich sein, in welcher Funktion <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />
die Bewertung vorgenommen hat und welches Wertkonzept (objektivierter<br />
Unternehmenswert, subjektiver Entscheidungswert, Einigungswert) <strong>de</strong>r Bewertung<br />
zugrun<strong>de</strong> liegt.<br />
177 Weiterhin ist eine angemessene Beschreibung <strong>de</strong>r Vorgehensweise bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung<br />
erfor<strong>de</strong>rlich. Dabei ist auf das angewandte Bewertungsverfahren<br />
(Ertragswertverfahren, DCF-Verfahren) einzugehen. Ferner ist das Vorgehen<br />
bei <strong>de</strong>r Prognose und <strong>de</strong>r Diskontierung <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse darzustellen.<br />
Umfang und Qualität <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> gelegten Daten müssen ebenso wie <strong>de</strong>r Umfang<br />
von Schätzungen und Annahmen mit <strong>de</strong>n dahinter stehen<strong>de</strong>n Überlegungen ersichtlich<br />
sein. Insbeson<strong>de</strong>re ist entsprechend <strong>de</strong>m Grundsatz <strong>de</strong>r Klarheit <strong>de</strong>r Berichterstattung<br />
im Bewertungsgutachten <strong>de</strong>utlich zu machen, auf welchen wesentlichen<br />
Annahmen <strong>de</strong>r ermittelte Unternehmenswert beruht. Soweit Vereinfachungen für zulässig<br />
erachtet wer<strong>de</strong>n, sind auch diese zu erörtern.<br />
178 Gegebenenfalls vorgenommene Plausibilitätsbeurteilungen <strong>de</strong>s Bewertungsergebnisses<br />
anhand von Börsenkursen <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens sind darzustellen.<br />
In <strong>de</strong>n Fällen, in <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Börsenkurs von Unternehmensanteilen grundsätzlich<br />
als Min<strong>de</strong>stwert heranzuziehen ist (vgl. Abschn. 3.), ist ausdrücklich auf <strong>de</strong>n<br />
Börsenkurs und <strong>de</strong>ssen Eignung einzugehen.<br />
179 Der Inhalt <strong>de</strong>s Gutachtens sollte im Wesentlichen Folgen<strong>de</strong>s umfassen:<br />
· Darstellung <strong>de</strong>r Bewertungsaufgabe<br />
– Auftraggeber<br />
– Auftrag (Bewertungsanlass; Funktion, in <strong>de</strong>r die Wertermittlung durchgeführt<br />
wird; zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>r Bewertungsstandard)<br />
· Darstellung <strong>de</strong>r angewandten Bewertungsgrundsätze und -metho<strong>de</strong>n<br />
· Beschreibung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts<br />
– rechtliche Grundlagen<br />
– wirtschaftliche Grundlagen<br />
– steuerliche Gegebenheiten<br />
· Darstellung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Bewertung zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Informationen<br />
– Vergangenheitsanalyse<br />
– Planungsrechnungen vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Annahmen<br />
– Verfügbarkeit und Qualität <strong>de</strong>r Ausgangsdaten (einschließlich Gutachten Dritter)<br />
– Plausibilitätsbeurteilung <strong>de</strong>r Planungen<br />
– Abgrenzung <strong>de</strong>r Verantwortung für übernommene Auskünfte<br />
· Darstellung <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens<br />
– Ableitung <strong>de</strong>r erwarteten finanziellen Überschüsse<br />
- Überschüsse im Detailplanungszeitraum<br />
- nachhaltige Überschüsse <strong>de</strong>r ewigen Rente<br />
– Ableitung <strong>de</strong>s Kapitalisierungszinssatzes<br />
- Basiszinssatz<br />
35<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH
<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />
- Risikozuschlag<br />
- Wachstumsabschlag<br />
– Ermittlung <strong>de</strong>s Barwertes <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse<br />
· Darstellung <strong>de</strong>r geson<strong>de</strong>rten Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens<br />
· Unternehmenswert<br />
– ggf. Plausibilitätsbeurteilungen <strong>de</strong>s Bewertungsergebnisses<br />
· abschließen<strong>de</strong> Feststellungen.<br />
36<br />
© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH