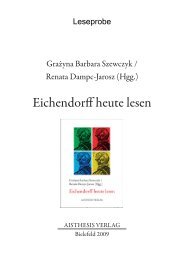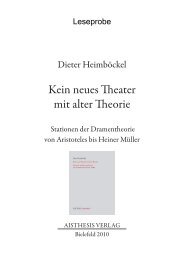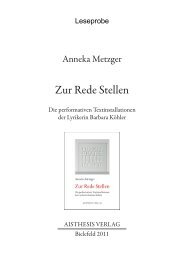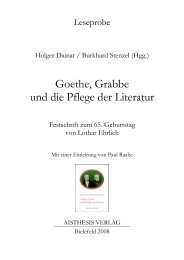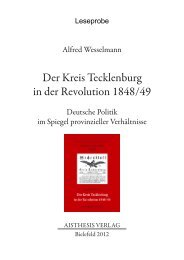Aufbrüche und Vermittlungen Nouveaux horizons et médiations
Aufbrüche und Vermittlungen Nouveaux horizons et médiations
Aufbrüche und Vermittlungen Nouveaux horizons et médiations
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
688<br />
Die folgenden Ausführungen zu Rilkes deutsch-französischer Doppeldichtung<br />
Der Magier – Le magicien versuchen sich dem komplexen Thema<br />
der Biglossie in der Dichtung über den Weg zu nähern, indem sie der Verwendung<br />
einer weiteren Sprache als Dichtsprache nachgehen <strong>und</strong> diese ins<br />
Zentrum stellen; <strong>und</strong> dies nicht ausgehend von der theor<strong>et</strong>ischen Ebene,<br />
sondern in konkr<strong>et</strong>er Auseinanders<strong>et</strong>zung mit dem literarisch-lyrischen<br />
Text. Dabei können nebenbei auch Ergänzungen zu den Gründen für die<br />
Ausbildung einer zweiten Dichtsprache gemacht werden. Diese Vorgehensweise<br />
ist gerade bei den vorliegenden Dichtungen möglich <strong>und</strong> angebracht:<br />
Das Bemerkenswerte an den hier ausgewählten beiden Magier-Dichtungen<br />
besteht eben darin, dass sie nicht nur ein Thema in zwei Sprachen behandeln,<br />
sondern zugleich auch Reflexionen auf Dichtung sind. Somit eign<strong>et</strong><br />
sich eine B<strong>et</strong>rachtung zumindest im doppelten Sinn: Einerseits dient sie<br />
dazu, Einblick in die Entwicklung <strong>und</strong> Entstehung der französischen Produktion<br />
Rilkes zu gewähren, andererseits <strong>und</strong> darüber hinaus, lassen sich<br />
dadurch gleichzeitig exemplarische Ausführungen zur Aneignung einer<br />
neuen Sprache bei einem Dichter machen. Der Aufsatz versucht folglich auf<br />
diesem konkr<strong>et</strong>en Weg einen Beitrag zu dem allgemeinen Thema der Mehrsprachigkeit<br />
zu leisten.<br />
2.<br />
Raoul Walisch<br />
Beide Gedichte sind unmittelbar nacheinander am 12.2.1924 entstanden.<br />
Zuerst hat Rilke das deutsche Gedicht geschrieben, auf dessen Reinschrift<br />
– mit dem Zusatz »(um Mitternacht)« –das französische Gedicht folgt. 12<br />
Verfügung haben, welche darüber hinaus mehr in der Mündlichkeit, als in der Schriftlichkeit<br />
Verwendung find<strong>et</strong> – obwohl sich eine Tendenz zur verstärkten Verwendung<br />
des Luxemburgischen auch im schriftlichen Alltag mittlerweile konstatieren lässt, (2.) sie<br />
zwischen zwei klassischen Kulturräumen leben <strong>und</strong> (3.) der Lebensalltag selbst durch<br />
Mehrsprachigkeit geprägt ist <strong>und</strong> die Autoren folglich ebenfalls mehrsprachig sind. Zu<br />
diesen spezifischen Besonderheiten vgl. <strong>et</strong>wa die Beiträge in: Über Grenzen. Literaturen<br />
in Luxemburg. Hg. v. Irmgard Honnef-Becker u. Johannes Kramer. Esch/Alz<strong>et</strong>te: Phi<br />
2004. Vgl. ebenso: Identitäts(de)konstruktionen. Neue Studien zur Luxemburgistik. Hg.<br />
v. Claude D. Conter u. Germaine Go<strong>et</strong>zinger. Esch/Alz<strong>et</strong>te: Phi 2008.<br />
12 Siehe KA 2, S. 802. Veröffentlicht wird Der Magier zuerst 1924 im Insel-Almanach auf<br />
das Jahr 1925, S. 106. Der Erstdruck von Le magicien erfolgt postum in: Poèmes Français.<br />
Vergers, Les Quatrains Valaisans, Les Roses, les Fenêtres, Carn<strong>et</strong> de poche, Poèmes<br />
épars. Paris: Hartmann 1935, S. 178.