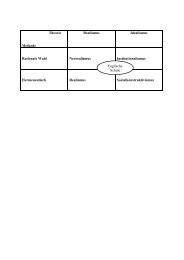Das Konzept der Zivil-Militärischen Kooperation (CIMIC)
Das Konzept der Zivil-Militärischen Kooperation (CIMIC)
Das Konzept der Zivil-Militärischen Kooperation (CIMIC)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tillmann Höntzsch 17<br />
internationale Krisenbewältigung än<strong>der</strong>te sich dies schlagartig. In zerfallenden<br />
Staaten wie Somalia o<strong>der</strong> Bosnien‐Herzegowina entstanden komplexe Notlagen, die<br />
mit den traditionellen Mitteln nicht mehr gelöst werden konnten. So kam es, dass<br />
Anfang bis Mitte <strong>der</strong> 1990er Jahre internationale Missionen wie z. B. die<br />
„humanitäre Intervention“ in Somalia o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Versuch, im Krieg in Bosnien‐<br />
Herzegowina die humanitäre Hilfe militärisch mit Hilfe von VN‐Truppen<br />
abzusichern, scheiterten. Dies ist unter an<strong>der</strong>em darauf zurückzuführen, dass die<br />
zivilen und militärischen Komponenten kaum aufeinan<strong>der</strong> abgestimmt waren, dass<br />
die Akteure mit den neuen Aufgaben teilweise überfor<strong>der</strong>t waren und dass alte<br />
Ressentiments die Erkenntnis überlagerten, dass nur ein gemeinsames Vorgehen<br />
das Ziel erreichbar macht. 35<br />
Der Umstand, dass es den VN trotz eines <strong>Konzept</strong>es des multidimensionalen<br />
Peacekeepings nicht gelungen ist, die neuen Konflikte einzudämmen bzw. zu lösen,<br />
hatte folgende Auswirkungen: Nach <strong>der</strong> Tragödie von Srebrenica wurde das<br />
Versagen <strong>der</strong> VN, <strong>der</strong>en Truppen aufgrund eines unzureichenden Peacekeeping‐<br />
<strong>Konzept</strong>es den Geschehnisse tatenlos zuschauen mussten, deutlich. Unter dem<br />
moralischen (medialen) Druck wurde die NATO im Dezember 1995, legitimiert<br />
durch ein VN‐Mandat (Resolution 1244), erstmals in einem „Out‐Of‐Area“‐Einsatz<br />
(IFOR/später SFOR)) aktiv. Dies war <strong>der</strong> Beginn eines Prozesses, in dessen Verlauf<br />
die NATO zur wichtigsten militärischen Organisation bei <strong>der</strong> Durchführung von<br />
PSOs werden sollte. Zwei Überlegungen waren dafür maßgeblich verantwortlich:<br />
Erstens die Erkenntnis <strong>der</strong> NATO‐Mitglie<strong>der</strong>, dass bei <strong>der</strong> neuen Form <strong>der</strong><br />
Konflikte nur eine militärische Operation auf <strong>der</strong> Grundlage eines robusten<br />
Mandates zum Erfolg führen kann; und zweitens, dass auch Konflikte außerhalb<br />
des Bündnisgebietes und außerhalb von Artikel 5 die Sicherheit ihrer Mitglie<strong>der</strong><br />
nachhaltig gefährden kann. Der Wandel vom Verteidigungsbündnis zu dem<br />
zentralen militärischen Akteur bei PSOs und die Erfahrungen, die das Bündnis bei<br />
seinen ersten friedensunterstützenden Missionen auf dem Balkan gewonnen hat,<br />
35 Vgl.: Rösli, Bruno, a.a.O. (FN 34).