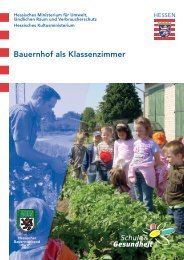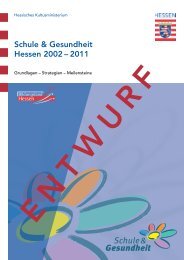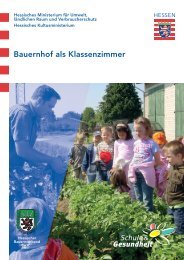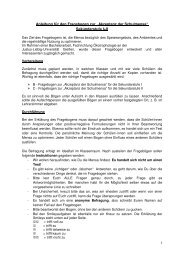Und wie gesund ist Ihre Schule? - Schule & Gesundheit - Hessen
Und wie gesund ist Ihre Schule? - Schule & Gesundheit - Hessen
Und wie gesund ist Ihre Schule? - Schule & Gesundheit - Hessen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Autorinnen:<br />
Prof. Dr. Irmgard Vogt <strong>ist</strong> Leiterin des Instituts für Suchtforschung<br />
(ISFF) der Fachhochschule Frankfurt am Main,<br />
Dipl. Sozialarbeiterin Jana Fritz wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
am selben Institut.<br />
sind, und obwohl sie alle unter diesen<br />
leiden, unterscheiden sie sich oft nicht<br />
sonderlich von anderen Kindern und<br />
Jugendlichen. Sieht man von besonderen<br />
Problemlagen ab, sind ihre Entwicklungschancen<br />
(fast) ebenso gut <strong>wie</strong> die von<br />
anderen Kindern und Jugendlichen – mit<br />
einer Ausnahme: Sie sind stärker als<br />
diese gefährdet, selbst von Alkohol oder<br />
Drogen abhängig zu werden. Aber auch<br />
hier gilt, dass es nicht alle trifft, sondern<br />
nur einen Teil. Es gibt also Entwicklungschancen,<br />
die genutzt werden können. 2<br />
Da viel mehr Väter als Mütter Alkoholprobleme<br />
haben, geht die Gewalt sehr<br />
viel häufiger vom Vater als von der Mutter<br />
aus. Mütter, die sich und ihre Kinder<br />
erfolgreich vor den Wutausbrüchen und<br />
den Gewalttätigkeiten des alkoholabhängigen<br />
Vaters schützen können, vermitteln<br />
den Kindern und Jugendlichen zugleich,<br />
dass es Alternativen gibt. Dazu gehört das<br />
Bemühen der Mütter, die Väter zu einer<br />
Behandlung der Krankheit zu bewegen<br />
und sie in der Abstinenz zu unterstützen.<br />
Gelingt das nicht, kommt es oft zur Trennung<br />
und dem Zerfall der Familie.<br />
Kinder aus alkoholbelasteten Familien<br />
sind überdurchschnittlich oft Scheidungskinder.<br />
Auch hier darf nicht übergeneralisiert<br />
werden; die me<strong>ist</strong>en Scheidungskinder<br />
haben keine alkoholabhängigen<br />
Elternteile.<br />
Überdurchschnittlich hoch <strong>ist</strong> auch der<br />
Anteil der Kinder und Jugendlichen mit<br />
Verhaltensstörungen. Diese lassen sich<br />
in manchen Fällen, in denen die Mutter<br />
alkoholabhängig <strong>ist</strong>, auf Beschädigungen<br />
in der vorgeburtlichen Entwicklung des<br />
Kindes zurückführen, beispielsweise<br />
auf das Fetale Alkoholsyndrom (FAS, in<br />
Deutschland auch als Alkoholembryopathie<br />
bezeichnet), das zu dauerhaften<br />
Störungen der kognitiven Entwicklung<br />
führt, die oft mit anderen Funktions- und<br />
Verhaltensstörungen einhergehen. Dazu<br />
gehören unter anderem Minderbegabung,<br />
Sprach- und Hörstörungen so<strong>wie</strong> feinmo-<br />
torische Störungen. Einige dieser Kinder<br />
fallen durch Aufmerksamkeitsdefizite<br />
und Hyperaktivitätsstörungen auf (ADHS)<br />
auf. Hinzu kommen andere abweichende<br />
Verhaltensweisen, <strong>wie</strong> Aggressivität,<br />
Desinteresse an schulischen Le<strong>ist</strong>ungen,<br />
<strong>Schule</strong>schwänzen usw., die man aber<br />
auch bei anderen Kindern mit Eltern, die<br />
keine Alkohol- oder Drogenprobleme<br />
haben, findet.<br />
Problemhinweise sind Alkoholexzesse<br />
auf dem Schulgelände oder auf Klassenfahrten.<br />
Jugendliche, die sich als besonders<br />
trinkfreudig hervortun und die<br />
durch betrunkenes Verhalten besonders<br />
auffallen, sind gefährdet, sich an einen<br />
riskanten Konsumstil zu gewöhnen. Kommen<br />
dazu Hinweise, dass es in der Familie<br />
Alkoholprobleme gibt, sollten die Verantwortlichen<br />
darauf reagieren und Hilfsangebote<br />
bereitstellen.<br />
Als Erwachsene beschreiben sich die<br />
Kinder und Jugendlichen aus Alkoholikerfamilien<br />
als eher traurig, ängstlich oder<br />
depressiv, aber auch als eher ärgerlich,<br />
zornig und wütend und insgesamt als weniger<br />
fröhlich. Sie erleben sich selbst als<br />
Personen mit starken Stimmungsschwankungen,<br />
die sie nicht immer beherrschen<br />
können. 3 Dazu kommt aber auch, dass<br />
sich vor allem die Mädchen als Personen<br />
wahrnehmen, die schon sehr früh im Leben<br />
Verantwortung übernehmen mussten<br />
und das auch getan haben. Darin kann<br />
eine besondere Stärke liegen, die sie zu<br />
ausgeprägten Persönlichkeiten heranreifen<br />
lässt. Auch dies we<strong>ist</strong> darauf hin, dass<br />
es kein sich zwingend erfüllendes Fatum<br />
<strong>ist</strong>, in einer Familie mit Alkoholproblemen<br />
aufzuwachsen.<br />
Da es keine eindeutigen körperlichen<br />
Merkmale oder besonderen Verhaltensweisen<br />
gibt, die Kinder und Jugendliche<br />
aus Familien mit Alkoholproblemen von<br />
anderen Kindern und Jugendlichen unterscheiden,<br />
sollten Erzieher/innen und Lehrer/innen,<br />
die den Verdacht haben, dass<br />
bestimmte Schüler/innen einen solchen<br />
A L K O H O L<br />
Familienhintergrund haben, diesen mit<br />
konkreten Beobachtungen belegen. Dazu<br />
gehört das Gespräch mit Kolleginnen<br />
und Kollegen über diese Schülerinnen<br />
beziehungsweise Schüler und die eigenen<br />
Vermutungen. Weiterhin sollte das Gespräch<br />
mit den Eltern oder einem Elternteil<br />
gesucht werden, in dem die konkreten<br />
Probleme des Schülers angesprochen<br />
werden, um Wege zu finden, die zu Lösungen<br />
führen können. Alkoholprobleme<br />
in der Familie können nur dann ein Thema<br />
des Gesprächs sein, wenn ein Verdacht<br />
erhärtet <strong>ist</strong>. Dann <strong>ist</strong> aber auch zu überlegen,<br />
wer ein solches Gespräch führen soll.<br />
In <strong>Schule</strong>n, an denen Sozialarbeiterinnen<br />
beziehungsweise Sozialarbeiter und<br />
Psychologinnen beziehungsweise Psychologen<br />
arbeiten, sollten diese solche<br />
Gespräche übernehmen.<br />
Lehrkräfte können auch den Kontakt zu<br />
ihren Schülerinnen beziehungsweise<br />
Schülern direkt suchen. Sie sollten dabei<br />
bedenken, dass für Kinder und Jugendliche<br />
das Thema Alkoholprobleme in der<br />
Familie mit sehr viel Schuld- und Schamgefühlen<br />
besetzt <strong>ist</strong>. Sie werden sich<br />
also nur dann gegenüber einer Lehrkraft<br />
öffnen, wenn sie zu dieser großes Vertrauen<br />
haben. Die Familie wird mehrheitlich<br />
als eine Einheit empfunden, die durch<br />
Abschottung nach außen Fremden jeden<br />
Zugang beziehungsweise Einblick verwehrt.<br />
Hat sich ein Kind doch anvertraut,<br />
erwartet es dann von dieser Lehrperson<br />
auch, dass sie Verantwortung übernimmt<br />
und ihm be<strong>ist</strong>eht. Oft <strong>ist</strong> es besser, wenn<br />
Lehrkräfte Fachleute aus der <strong>Schule</strong><br />
selbst oder aus anderen Institutionen heranziehen<br />
und diesen solche Gespräche<br />
überlassen.<br />
1 Vogt, I. / Fritz, J.: Alkoholabhängige Mütter und ihre<br />
Gefühle gegenüber ihren Kindern. In: Verhaltenstherapie<br />
und Psychosoziale Praxis, 38/2006, (1), S.17 – 38<br />
2 Zobel, M.: Kinder aus alkoholbelasteten Familien.<br />
Hogrefe, Göttingen 2000<br />
3 Klein, M. / Zobel, M.: Prävention und Frühintervention<br />
bei Kindern aus suchtbelasteten Multiproblemfamilien<br />
(1996 – 1999). RIAS, Mainz 2001<br />
P l u s p u n k t 4/2006 17