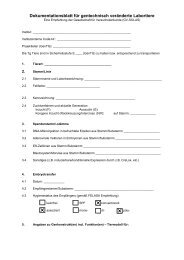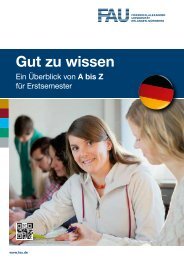uni kurier aktuell - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
uni kurier aktuell - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
uni kurier aktuell - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5<br />
Forschung<br />
Schaltkreise der Immunantwort<br />
Fakultätenübergreifende DFG-Forschergruppe untersucht Funktionen von B-Zellen und Antikörpern<br />
Die durch Antikörper vermittelte (humorale)<br />
Immunantwort dient der Abwehr von Krankheitserregern<br />
wie Bakterien und Viren. Zwar<br />
liegt die Entdeckung des körpereigenen Verteidigungssystems<br />
durch Emil von Behring<br />
und Paul Ehrlich mehr als 100 Jahre zurück,<br />
doch wie der Organismus den Einsatz von<br />
Antikörpern steuert, ist immer noch nicht genau<br />
verstanden. Mit diesem Thema befasst<br />
sich daher die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
(DFG) neu eingerichtete<br />
Forschergruppe „Regulatoren der humoralen<br />
Immunantwort“.<br />
Alle bis heute erfolgreich durchgeführten<br />
Impfungen basieren auf dem Schutz, der<br />
durch Antikörper vermittelt wird. Die Bildung<br />
der Antikörper nach einer Impfung oder auch<br />
nach einer Infektion wird durch ineinandergreifende<br />
molekulare Schaltkreise kontrolliert<br />
und erfolgt durch komplexe und nur zum Teil<br />
verstandene Wechselwirkungen verschiedener,<br />
hochspezialisierter Zellen des Immunsystems.<br />
Zellen mit Spezialgebiet<br />
Im Zentrum des Geschehens steht die sogenannte<br />
B-Zelle. Während ihrer Reifung im<br />
Knochenmark werden die Gene für Antikörpermoleküle<br />
durch Umlagerung von DNA-<br />
Abschnitten zusammengebaut. Dabei entstehen<br />
Millionen von B-Zellen, die alle einen<br />
anderen Typ von Antikörper produzieren. Dieses<br />
Molekül ist entweder auf einen bestimmten<br />
Krankheitserreger oder auf eine molekulare<br />
Struktur ausgerichtet, die generell einen<br />
Angriff signalisiert. Die reife B-Zelle trägt<br />
ihren Antikörper zuerst auf der Zelloberfläche<br />
und kann damit ein passendes Signal auffangen.<br />
In diesem Fall wird die Zelle aktiviert und<br />
gibt dann lösliche protektive Antikörper in<br />
großen Mengen ins Blut ab. Die Forschergruppe<br />
konzentriert ihre Arbeiten auf diese<br />
komplexen Regulationen während der Reifung<br />
und Aktivierung von B-Zellen.<br />
Angeborene und erworbene Störungen<br />
dieses vielschichtigen Differenzierungsschemas<br />
können einerseits zur Immunschwäche -<br />
das heißt zur besonderen Anfälligkeit gegenüber<br />
Infektionskrankheiten bis hin zu lebensbedrohlichen<br />
Immundefekten - führen. Aber<br />
auch überschießende und fehlgeleitete Immunantworten,<br />
wie zum Beispiel bei Allergien<br />
und Autoimmunerkrankungen, werden durch<br />
Störungen in der Regulation der Immunantwort<br />
verursacht. In autoimmunen Patienten<br />
bildet das Immunsystem oftmals Antikörper<br />
aus, die auf Strukturen des eigenen Körpers<br />
statt auf Pathogene ansprechen.<br />
Die Forschergruppe<br />
legt einen<br />
Fokus ihrer Arbeit auf<br />
die Aufklärung solcher<br />
Fehlentwicklungen. Der<br />
Ansatz liegt hier<br />
zunächst in der Grundlagenforschung,<br />
denn<br />
nur durch ein besseres<br />
Verständnis der an der<br />
Antikörper-vermittelten<br />
Immunabwehr beteiligten<br />
molekularen<br />
Schaltkreise und komplexenZell-Zell-Wechselwirkungen<br />
wird es<br />
möglich sein, neue<br />
Therapieformen zu entwickeln.<br />
Eine effiziente humorale Immunantwort<br />
kann derzeit „im Reagenzglas“ nicht adäquat<br />
nachgestellt werden. Die hohe Komplexität<br />
und die Vielzahl an zellulären und molekularen<br />
Interaktionen zwischen B-Zellen und anderen<br />
Zellen des Immunsystems erfordern<br />
Untersuchungen am lebenden Organismus,<br />
an Gewebeschnitten sowie an Zellen, die aus<br />
geeigneten Tiermodellen durch entsprechende<br />
Zellsortiermethoden isoliert werden.<br />
Ein experimenteller Schwerpunkt der Forschergruppe<br />
ist daher die Verwendung der<br />
Maus als Tiermodell für die humorale Immunantwort.<br />
Die Forschungen der vergangenen<br />
Jahre haben klar gezeigt, dass die Prozesse<br />
der Antikörperbildung in Maus und Mensch in<br />
sehr ähnlicher Weise ablaufen. Die Möglichkeit,<br />
„genetisch maßgeschneiderte“ Mausmodelle<br />
zu verwenden und auch hier in <strong>Erlangen</strong><br />
zu etablieren, wird die Forschergruppe in<br />
besonderer Weise dazu nutzen, vor allem solche<br />
molekularen und zellulären Vorgänge<br />
während der humoralen Immunantwort besser<br />
zu verstehen, die weder in Zellkulturen,<br />
noch am Menschen gezielt untersucht werden<br />
können.<br />
Fünf der acht beteiligten Projektleiter, sowohl<br />
Biologen als auch Mediziner, sind im Nikolaus-Fiebiger-Zentrum<br />
für Molekulare Medizin<br />
angesiedelt. Als Besonderheit kann das<br />
Ausbildungskonzept für die in der Forschergruppe<br />
arbeitenden Doktoranden angesehen<br />
werden. Die strukturierte Doktorandenausbildung<br />
erfolgt zusammen mit dem Graduiertenkolleg<br />
592 „Lymphozyten: Differenzierung,<br />
Aktivierung und Deviation“ und die Doktoranden<br />
der Forschergruppe nehmen an den Ver-<br />
Acht Projektleiter gehören der Forschergruppe an: (v. links) André Gessner, Christian<br />
Berens, Hans-Martin Jäck, Thomas Winkler, Dirk Mielenz, Lars Nitschke,<br />
Reinhard Voll und (nicht im Bild) Falk Nimmerjahn.. Foto: privat<br />
<strong>uni</strong> <strong>kurier</strong> <strong>aktuell</strong> | Nr. 66 | April 2007<br />
anstaltungen und Kursen des Graduiertenkollegs<br />
teil. Dies soll eine im internationalen Vergleich<br />
exzellente Ausbildung des wissenschaftlichen<br />
Nachwuchses gewährleisten.<br />
Prof. Dr. Thomas Winkler<br />
Tel.: 09131/85-29136<br />
twinkler@molmed.<strong>uni</strong>-erlangen.de<br />
Prof. Dr. Hans-Martin Jäck<br />
Tel.: 09131/85-35912<br />
hjaeck@molmed.<strong>uni</strong>-erlangen.de<br />
Neuer Sprecher<br />
Forschungsverbünde haben gewählt<br />
Prof. Dr. Martin Faulstich (TU München),<br />
Sprecher des Bayerischen Forschungsverbunds<br />
Abfallforschung und Reststoffverwertung,<br />
ist zum neuen Sprecher der Arbeitsgemeinschaft<br />
der Bayerischen Forschungsverbünde<br />
(abayfor) gewählt worden. Sein Vorgänger<br />
Prof. Bernd Radig stellte sich nach 14<br />
Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl.<br />
Prof. Dr. Manfred Geiger, Lehrstuhl für Fertigungstechnologie<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Erlangen</strong>-<br />
<strong>Nürnberg</strong>, fungiert als stellvertretender Sprecher.<br />
Prof. Dr. Harald Meerkamm (<strong>Erlangen</strong>-<br />
<strong>Nürnberg</strong>), Prof. Dr. Torsten Kühlmann (Bayreuth),<br />
Prof. Dr. Ulrich Bogdahn (Regensburg)<br />
und Prof. Dr. Werner Kießling (Augsburg) repräsentieren<br />
die Themenbereiche Kultur, Leben,<br />
Materie und Information.