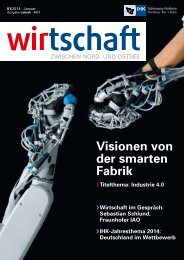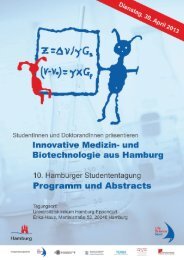Lebenslauf - Life Science Nord
Lebenslauf - Life Science Nord
Lebenslauf - Life Science Nord
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Quantitative Elementanalytik am Knochen-Implantat-Interface (V)<br />
Björn Busse, Zentrum Biomechanik UKE, Zentrum für Operative Medizin<br />
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistrasse 52, 20246 Hamburg<br />
b.busse@uke.uni-hamburg.de; Tel. 040-42803-6366<br />
Ziel<br />
Alle orthopädischen Implantate unterliegen, in Abhängigkeit von ihrer Funktion und Verweildauer<br />
im Organismus, Alterungs- sowie Verschleißprozessen. Dabei gelangen Implantatbestandteile<br />
in das Umgebungsgewebe und es kommt zu Wechselwirkungen zwischen Implantat<br />
und Organismus. Größere Partikel (wie z.B. Polyethylen) sind in histologischen Präparaten gut<br />
erkennbar. Die Identifizierung sehr kleiner Verschleißpartikel ist dagegen problematisch. Elementanalysen<br />
der Partikel sind bisher nur mit aufwendigen Techniken an kleinen Probenzahlen<br />
und/oder begrenzten Arealen möglich; eine gezielte histologische Zuordnung der Befunde<br />
kann meistens nicht erfolgen. Aus diesem Grund wurde der Versuch unternommen, eine zerstörungsfreie<br />
Methode zu etablieren, die es ermöglicht, die mittels Mikroanalytik gewonnenen<br />
Befunde direkt histologischen Strukturen zuzuordnen, um die Gewebe- und Knochenkonstitution<br />
im Implantat-Bereich zu bewerten.<br />
Methoden<br />
Zur Entwicklung der Methode wurde ein Spektrum an Techniken verwendet, dass Ultra-<br />
Dünnschlifftechnik-Histologie, Blockpräparation, Dunkelfeld-Mikroskopie kombiniert mit Rasterelektronen-Mikroskopie,<br />
Proton Induced X-Ray Emission, Elektronendispersiver Mikroanalytik<br />
sowie Mikro-Röntgen-Fluoreszenz-Analytik umfasst. Damit konnte eine Methode erarbeitet<br />
werden, die sowohl histologische als auch mikroanalytische Untersuchungen von Degradationsprodukten<br />
im Gewebe zerstörungsfrei ermöglicht. Dabei wurde das periprothetische Gewebe<br />
speziell auf Legierungsbestandteile der jeweiligen Prothesen untersucht (Chrom, Kobalt,<br />
Molybdän). Die Methode wurde im Rahmen des Projektes bei 5 humanen Oberschenkelpräparaten<br />
angewendet.<br />
Ergebnisse<br />
Verschleißpartikel sind ungleichmäßig im Gewebe verteilt. Intrazellulär findet sich überwiegend<br />
Zirkonium aus dem Knochenzement (Röntgenkontrastmittel). Metallische Verschleißpartikel<br />
lassen sich mit der eingesetzten Methode in Zellen nur vereinzelt detektieren. Im mineralisierten<br />
Knochengewebe konnten dagegen hohe Kobalt-Anreicherungen von bis zu 500 ppm gemessen<br />
werden. Entsprechend der Legierungszusammensetzung konnten die Anteile Chrom<br />
und Molybdän nicht nachgewiesen werden.<br />
Schlussfolgerung<br />
Mit der vorgestellten Methode konnte erstmals gezeigt werden, dass lokale Einlagerungen von<br />
Implantat-Legierungsbestandteilen in das mineralisierte Knochengewebe erfolgen. Es ist zu<br />
prüfen, ob Schwermetall-Belastungen der Knochenmatrix zu Veränderungen im Interface-<br />
Bereich führen und in Verbindung zu Lysezonen im periprothetischen Raum stehen. Sollte sich<br />
herausstellen, dass die Deposition von Legierungs-Bestandteilen im Knochengewebe die Implantatstandzeit<br />
limitiert, gewinnt die Tendenz, Titanimplantate zu verwenden oder Implantate<br />
mit entsprechenden Oberflächenmodifikationen (z.B. TiN-Behandlung) zu versehen, an Bedeutung.<br />
Bis allerdings fundierte Aussagen über die Auswirkungen der Deposition von Implantat-<br />
Legierungselementen in die Knochenmatrix möglich werden, sind zunächst die Ergebnisse<br />
weiterer Untersuchungen abzuwarten.<br />
43