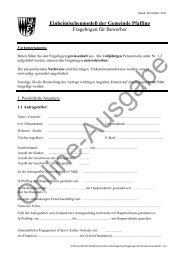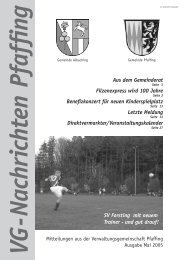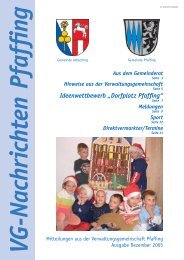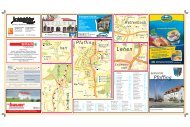GEMEINDE PFAFFING - in Pfaffing
GEMEINDE PFAFFING - in Pfaffing
GEMEINDE PFAFFING - in Pfaffing
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2.3 Natürliche Grundlagen<br />
(Landschaftsplan Kap. 3, teilweise gekürzt)<br />
Geologie<br />
Die Geme<strong>in</strong>degebiete liegen <strong>in</strong> der Grund- und Endmoränenlandschaft Inn (038-A und 038-B),<br />
die Teil der naturräumlichen Haupte<strong>in</strong>heit Inn-Chiemsee-Hügelland (038) ist. Diese liegt<br />
überwiegend im Landkreis Rosenheim, lediglich im Nordwesten reicht sie e<strong>in</strong> gutes Stück weit<br />
<strong>in</strong> den Landkreis Ebersberg h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>. Am äußersten Endmoränenbogen haben auch die<br />
Landkreise München im Westen, Mühldorf im Norden und Traunste<strong>in</strong> im Nordosten teil. Im<br />
Süden schließen das Rosenheimer Becken, das Molassebergland Prien und die<br />
Eiszerfallslandschaft Rimst<strong>in</strong>g-Seeon an. Im Norden wird die Moränenlandschaft vom Inntal<br />
durchzogen. Die Grund- und Endmoränenlandschaft bedeckt im Landkreis 603,7 qkm, das s<strong>in</strong>d<br />
knapp 42% der Landkreisfläche.<br />
Mit dem Austritt aus den Alpen konnte sich der würmeiszeitliche Inngletscher nahezu<br />
une<strong>in</strong>geschränkt <strong>in</strong> alle Richtungen des Vorlandes ausbreiten. Lediglich im Osten verschmolz er<br />
mit Prien- und Chiemseegletscher. Ausgehend von se<strong>in</strong>em übertiefen Stammbecken, dem<br />
heutigen Rosenheimer Becken, rückte der Inngletscher <strong>in</strong> zahlreichen Zweigbecken weiter <strong>in</strong>s<br />
Vorland h<strong>in</strong>aus, bis max. ca. 40 km). Die unterschiedlichen Stadien des Eisvorstoßes und<br />
Rückzugs s<strong>in</strong>d anhand mehrerer Endmoränenzüge mit eisrandperipheren<br />
Entwässerungssystemen erkennbar. Die beiden äußersten, das Kirchseeoner und das<br />
Ebersberger Stadium, s<strong>in</strong>d die markantesten Endmoränenwälle und bilden etwa den äußeren<br />
Abschluss der Zweigbecken. Die für den Landkreis Rosenheim abgegrenzte naturräumliche<br />
Untere<strong>in</strong>heit 'Endmoränenlandschaft Inn' lehnt sich ungefähr an dieser L<strong>in</strong>ie an, wobei die<br />
Moränen des Ebersberger Stadiums v.a. im Westen überwiegend <strong>in</strong> den Landkreisen<br />
Ebersberg und Mühldorf liegen.<br />
Die als 'Grundmoränenlandschaft Inn' bezeichnete Untere<strong>in</strong>heit besteht aus der Grundmoränen-<br />
und der zur Endmoränenlandschaft überleitenden Zweigbeckenzone. Letztere wird gegliedert<br />
durch die vom Endmoränenbogen zum Stammbecken h<strong>in</strong> gerichteten Zweig- oder<br />
Zungenbecken. Dies s<strong>in</strong>d im Wesentlichen die Talräume westlich des Inns (z.B. Ebrach)<br />
Mit dem Abschmelzen des Eises bildeten sich größere Seen <strong>in</strong> den Becken sowie die z.T.<br />
ausgedehnten durch Verlandung oder Versumpfung entstandenen Vermoorungen.<br />
Die zwischen und teilweise auch <strong>in</strong> den Zweig- oder Zungenbecken gelegenen Moränen s<strong>in</strong>d<br />
Endmoränen des Ölkofener Stadiums und der Spätwürm sowie Grundmoränen. Wo<br />
Schmelzwasser abfloss, wurden Niederterrassenschotter abgelagert.<br />
Die Grundmoränen s<strong>in</strong>d stellenweise als Druml<strong>in</strong>schwärme ausgebildet. Westlich des Inns<br />
ziehen sich drei größere Schwärme von Bad Aibl<strong>in</strong>g, Tattenhausen und Rott am Inn nach<br />
Nordwesten.<br />
Anders als im kalkbetonten Lech- und Isar-Jungmoränengebiet, aber ähnlich wie beim Salzach-<br />
Jungmoränengebiet bestehen die Moränen, Schotter und Sande des Inn-Jungmoränengebietes<br />
überwiegend aus zentralalp<strong>in</strong>em, silikatischem Material, das von vornhere<strong>in</strong> relativ karbonatarm<br />
war und im Laufe der Zeit weiter entbast worden ist. Basenreiche Wuchsorte f<strong>in</strong>den sich nur an<br />
Nagelfluh-Aufschlüssen und im nördlichen Inn-Jungmoränengebiet.<br />
Als besonders bedeutsam für die Flora stellt ZAHLHEIMER (1988) die Talsysteme der Grund-<br />
und Endmoränenlandschaft dar:<br />
An den Hangkanten wirken sich Expositionsunterschiede besonders stark aus, es bilden sich<br />
Pionierstandorte <strong>in</strong> Abtrags- und Aufschüttungslagen; die Grundwasserzüge <strong>in</strong> den Tälern<br />
ließen Sümpfe und Kalkniedermoore entstehen.<br />
Zu den bedeutendsten Ersche<strong>in</strong>ungen gehören die zahlreichen Toteisbildungen. Treten diese<br />
gehäuft auf, werden sie als Eiszerfallslandschaften bezeichnet. Ihr Verbreitungsschwerpunkt<br />
liegt entstehungsgeschichtlich bed<strong>in</strong>gt im Endmoränengürtel und damit u.a. im nördlichen<br />
Landkreis.<br />
Wenig eutrophierte, vernässte und vermoorte Toteisformen mit Verlandungsvegetation s<strong>in</strong>d<br />
heute überwiegend <strong>in</strong>nerhalb von Waldgebieten zu f<strong>in</strong>den. Hier s<strong>in</strong>d sie meist von<br />
bruchwaldartigen Beständen und Feuchtgebüschen mit Großseggen bedeckt.<br />
12