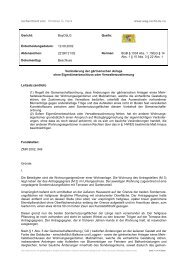LG Wiesbaden, Urteil v. 19.12.2001, Az. 10 S 46/01 - WEG
LG Wiesbaden, Urteil v. 19.12.2001, Az. 10 S 46/01 - WEG
LG Wiesbaden, Urteil v. 19.12.2001, Az. 10 S 46/01 - WEG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
echerchiert von: Christian G. Heckwww.weg-recht.de.vuGericht: <strong>LG</strong> <strong>Wiesbaden</strong> Quelle:Entscheidungsdatum: <strong>19.12.20<strong>01</strong></strong>Aktenzeichen: <strong>10</strong> S <strong>46</strong>/<strong>01</strong> Normen:Dokumenttyp<strong>Urteil</strong>Dauerhafter Betrieb einer AußenleuchteLeitsatz (amtlich)(1) Der dauerhaften Betrieb einer Außenleuchte bei Dunkelheit - Glühbirne mit 40 Watt/matt - rufterhebliches Gefühl der Lästigkeit hervor, der Unterlassungsanspruch genügt den aus § <strong>10</strong>04 BGBausreicht. Das Anbringen von Gardinen auf das zumutbare Maß oder Rollladenbetrieb zumAbzusenken der Lichteinwirkung, kann vom Nachbarn nicht verlangt werden.(2) Derjenige, der die Lampe betreibt, ist Störer.Fundstellen:NJW 2002, 615NZM 2002, 86Entscheidungsgründe:Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Klägers hat in der Sache auch Erfolg.Die Klage ist zulässig.Der mit der Berufung verfolgte, aus dem hiesigen <strong>Urteil</strong>stenor ersichtliche Klagehauptantrag, der in seinerZielrichtung mit jenem in der I. Instanz gestellten Klagehauptantrag identisch ist, stellt sich als hinreichendbestimmt dar (S 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).Der Klagehauptantrag beschränkt sich zulässigerweise auf ein allgemeines, an den Gesetzeswortlaut (§§<strong>10</strong>04, 906 BGB) angelehntes Unterlassungsgebot. Soweit hiernach bewusst in Kauf genommen wird,dass sich die Auseinandersetzung der Parteien mangels konkreter Orientierungswerte in das Vollstreckungsverfahrenverlagern wird, ist dies angesichts der Besonderheiten von immissionsrechtlichenUnterlassungsklagen der vorliegenden Art unschädlich (vgl. auch BGH in NJW 1999, S. 357 ff.).Die Fassung des Klagehauptantrags eröffnet zudem dem Beklagten als Störer die ihm zuzubilligendeMöglichkeit, im Rahmen seines Besitzrechtes als Mieter von mehreren denkbaren Maßnahmen zurUnterlassung der Störung jene zu er-greifen, die ihm am sachdienlichsten erscheinen. Dabei kann er sichan den auch für ein späteres Vollstreckungsverfahren maßgeblichen Maßstäben orientieren, die imMittelpunkt des gerichtlichen Erkenntnisverfahrens standen und in den Entscheidungsgründen des <strong>Urteil</strong>szur Begründung des Unterlassungsgebotes herangezogen werden.Der Klagehauptantrag des Klägers ist auch begründet.Dem Kläger steht gegen den Beklagten entsprechend dem <strong>Urteil</strong>stenor gemäß SS <strong>10</strong>04, 906 BGB einAnspruch auf Unterlassung zu.Mit dem sich auf nahezu jede Nacht erstreckenden, konkreten, dauerhaften Betrieb der Außenlampeneben der Haustür des von ihm bewohnten Hauses nimmt der Beklagte eine Bestrahlung des Hausgrund-Die <strong>Urteil</strong>e werden mit größtmöglicher Sorgfalt übernommen. Dennoch wird keine Haftung für den Inhalt und dessen Richtigkeit übernommen.Seite 1 von 5 Seiten
stücks des Klägers vor, die sich als eine rechtswidrige Eigentumsbeeinträchtigung im Sinne des § <strong>10</strong>04BGB darstellt. Die Störereigenschaft des Beklagten ergibt sich dabei in Ansehung seiner Verfügungsgewaltals Mieter.Der Kläger muss die vorgenannte Bestrahlung nicht gemäß § 906 BGB dulden. Mit der streitgegenständlichenkonkreten, jedenfalls mittels einer Birne von mindestens 40 Watt/matt vorgenommenenBestrahlung ist eine Einwirkung auf das Hausgrundstück des Klägers verbunden, die die Nutzung desHausgrundstücks weder nicht noch nur unwesentlich beeinträchtigt.Bei der Wesentlichkeit einer Beeinträchtigung im Sinne des § 906 BGB - handelt es sich ebenso wie beider »Erheblichkeit« einer Belästigung im Sinne - § 3 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz um einenunbestimmten Rechtsbegriff, der einer wertenden Ausfüllung zugänglich ist.Mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ, 120 S. 2 - ist dabei auf das Empfinden eines»verständigen« Durchschnittsmenschen - stellen und bei der Grenzziehung zwischen wesentlicher undunwesentliche Beeinträchtigung maßgebliche Bedeutung beizumessen, in welchem Ausmaß dieBenutzung des betroffenen Grundstücks nach dessen Natur und tatsächlicher Zweckbestimmung inseiner konkreten Beschaffenheit gestört wird (vgl. i weit BGHZ 111, S. 63 ff.).Einwirkungen auf ein Hausgrundstück, mit denen für dessen Eigentümer eine erhebliche Lästigkeit miteiner Einschränkung der Annehmlichkeit des seins verbunden ist, sind grundsätzlich geeignet, als nichtunwesentliche Beeinträchtigungen im Sinne des § 906 Abs. 1 BGB qualifiziert zu werden, ohne dass esdarauf ankommt, ob mit ihnen eine gesundheitliche Beeinträchtigung einhergeht.Sofern objektive Messungen von Einwirkungen möglich sind, sind dien die Gesamtbetrachtungeinzubeziehen. Liegt nach ihnen keine Überschreintung von Grenz- oder Richtwerten nach Maßgabe des§ 906 Abs. 1 S. 2 und 3 BG: vor, so ist in der Regel die Annahme einer nur unwesentlichen Beeinträchtige-.zwar geboten. Die Feststellung und Bewertung von Einwirkungen im Sinne des § 906 Abs. 1 S.1 BGB steht letztlich jedoch immer unter dem Vorbehalt der richterlichen, unter umfassenderBerücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalles gewonnenen Erkenntnisse undBeweiswürdigung. In dem vorliegenden Rechtsstreit hat der Beklagte, nachdem er insoweit bereits in derI. Instanz Beweis angeboten hatte, in der Berufung eine privatgutachterlichen Stellungnahme desöffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Lichttechnik vorgelegt, nach der die von derLeuchte neben dem Hauseingang des Beklagten auf der gegenüberliegenden Hausfassade des Klägerserzeugte Beleuchtungsstärke nach einem bestimmten Verfahren ermittelt wurde. Aufgrund der ermitteltenWerte gelangt der Sachverständige zu der Feststellung, dass c in der LITG-Publikation 12 »Messung undBeurteilung von Lichtimmissione künstlicher Lichtquellen« begründete zulässige Grenzwert von 1,0 lxnoch nicht einmal zu 1/3 erreicht werde. Hinsichtlich dieser gutachterlichen Feststellungen ist jedochfestzuhalten, dass sie sich an Wertvorstellungen orientieren, die weder in Gesetzen oderRechtsverordnungen noch in Verwaltungsvorschriften Sinne des § 906 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB statuiertworden und damit nicht geeignet sind, die entsprechende gesetzliche Regelvermutung für die Annahmeeiner unwesentlichen Beeinträchtigung zu begründen.Unbeschadet der fehlenden gesetzlichen Normierung von Beleuchtungsgrenzwerten stellt dieBeleuchtungsstärke, wie sie von dem Beklagten ins Feld geführt und durch die privatgutachterlichenFeststellungen des Sachverständigen dokumentiert wird, allerdings einen objektiven Gesichtspunkt dar,den die Kammer in ihre umfassende Würdigung einbezogen hat. Der für den Außenbereich durch denSachverständigen ermittelten und für den Außenbereich auch ein gerichtliches Sachverständigengutachtenermittelbaren objektiven Beleuchtungsstärke konnte dabei jedoch keine maßgeblicheBedeutung zugebilligt werden. Vielmehr hat die Kammer durch die von ihr durchgeführteAugenscheinseinnahme (Ortsbesichtigung) konkrete tatrichterliche Erkenntnisse erlangt, die unbeschadeteiner objektiv messbaren Beleuchtungsstärke die Annahme gebieten, dass mit dem streitgegenständlichendauerhaften Betrieb der Außenlampe des vom Beklagten bewohnten Hauses für den Klägereine nicht nur unwesentliche Beeinträchtigung im Sinne des § 906 Abs. 1 S. 1 BGB verbunden ist.Die bei Dunkelheit durchgeführte Augenscheinseinnahme hat folgendes ergeben:Als die streitgegenständliche Außenleuchte außer Betrieb war und sich die Kammer bei vollständighochgezogenem Rolladen in dem vom Kläger bislang als Schlafzimmer genutzten streitgegenständlichenZimmer im Haus des Klägers befand, ohne dass dort eine Lichtquelle eingeschaltet war, drang von derStraßenlaterne, die vom Zimmer aus gesehen im rechten Randbereich vor dem Haus des Beklagten alsRundleuchte an dem dortigen Wegrand installiert ist, in das streitgegenständliche Zimmer gedämpftesLicht ein. Dieses Licht rief praktisch kein Störungsempfinden hervor, was dadurch in erheblichem Maßebegünstigt wurde, dass sich aus der Zimmerrichtung gesehen rechts vor dem Haus des Klägers eineDie <strong>Urteil</strong>e werden mit größtmöglicher Sorgfalt übernommen. Dennoch wird keine Haftung für den Inhalt und dessen Richtigkeit übernommen.Seite 2 von 5 Seiten
Tanne befindet, die den Lichteinfall von der schräg dahinter postierten Straßenlaterne erheblicheinschränkt.Nachdem nunmehr die streitgegenständliche Außenleuchte mit einer 40 Watt/matt-Birne eingeschaltetworden war, zeigte sich vom Zimmer aus nach außen gesehen ein deutlich wahrnehmbarer, von rechtsvon der streitgegenständlichen Außenleuchte ausgehender schräger Lichteinfall auf den linken Bereich imvorderen Drittel des Zimmers. Mit diesem, durch die Fenstergröße und die Höhe der Fensterbrüstungbegünstigten Lichteinfall war ein Anstrahlungs- und Kanaleffekt verbunden, der sich durch denZimmerzuschnitt und die Position der Außenleuchte zum Zimmer ergab und sich an der linken Zimmerwandin Richtung Fenster gesehen widerspiegelte. Dieser Lichteinfall hob sich von den zuvorfestgestellten Lichtverhältnissen deutlich ab. Nach der Einschätzung der Kammer ist ein solcher Lichteifallohne weiteres geeignet, bei einem in Ruhelage (Schlafposition) befindlichen, durchschnittlichempfindlichen Menschen unweigerlich besondere Aufmerksamkeit und eine gewisse Blendwirkunghervorzurufen, wenn das Licht auf das Gesicht trifft. Beim Herablassen des Rolladens nahm derLichteinfall in dem streitgegenständlichen Zimmer von oben nach unten ab, wobei dann durch denZwischenraum zwischen den Rolladenlamellen entsprechende Lichtbündel deutlich wahrnehmbar bliebbis der Rolladen ganz geschlossen und das streitgegenständliche Zimmer verdunkel war. Dabei blieb derbeschriebene störende Charakter des Lichteinfalls jedenfalls so lange erhalten, bis der Rolladen zu ca.3/4 herunter gelassen war. Nach der nachvollziehbaren, unwidersprochenen Darstellung des Klägers hatsich in dem streitgegenständlichen Zimmer bislang ein Doppelbett mit angepasstem Umbau befunden,welches zur Zeit in Ansehung der vorliegenden Auseinandersetzung in einem anderen Raum aufgestelltist und in Augenschein genommen werden konnte. Das Doppelbett nebst Umbau hat nach dennachvollziehbaren Angaben des Klägers, in Blickrichtung Fenster gesehen, im linken Bereich desstreitgegenständlichen Zimmers an der linken Wand so gestand. dass das Kopfende des parallel zumFenster gestellten Bettes zur linken gezeigt hat.Angesichts des angepassten Bettumbaus und des Umstandes, dass sich auf der gegenüberliegenden –rechten – Zimmerseite die Zimmertür befindet, die dortige Stellwand entsprechend verkürzt, konnte dasDoppelbett nebst Umbau in dem streitgegenständlichen Zimmer sinnvoll nur so aufgestellt worden seinwie dies nach den Angaben des Klägers der Fall gewesen war. Der vorstehend beschriebene besondereLichteinfall, dessen Intensität sich bei den weiterhin mittels einer 40 Watt/klar-Birne, einer 60 Watt/matt-Birne und einer 60 Watt/klar-Birne überprüften Betriebszuständen der streitgegenständlich, - Außenleuchtesubjektiv praktisch nicht veränderte, ist nach alledem nachvollziehbar auf einen Bettbereich desKlägers getroffen, in dem sich der Kläger mi seinem Kopf regelmäßig zum Schlafen aufgehalten hat.Im Außenbereich erwies sich die Außenseite des vom Beklagten bewohnte - Hauses, an der sich diestreitgegenständliche Außenleuchte befindet, durch die bereits vorstehend angesprochene Straßenlaterneauch ohne Betrieb der Außenleuchte hinreichend beleuchtet. Die Außenfassade des vom Beklagtenbewohnten Hauses war gut wahrnehmbar. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich d Bereichs derHauseingangstür, in deren unmittelbaren Nähe sich die streitgegenständliche Außenleuchte befindet.Der Stufenbereich vor der Hauseingangstür des Beklagten wird von der Straßenlaterne noch so erhellt,dass es für einen gefahrlosen Verkehr keiner zusätzlichen Beleuchtung bedarf.Bei eingeschalteter Innenbeleuchtung im Hausflur hinter der Hauseingangstür des Beklagten drang durchdie in großen Teilen aus Glas bestehende Hauseingangstür und seitlich davon eingesetzte GlasscheibenLicht nach außen und leuchtete teilweise den dortigen Hauseingangsbereich aus. An der Straße amHessenring wurde an der dortigen Grundstücksgrenze zum Haus des Beklagten eine Straßenlaterne(Kofferlampe) vorgefunden, die vom Grundstück des Beklagten weg zur Straße hin zeigt. Nach dengetroffenen Feststellungen bleibt die dortige Seite des vom Beklagten bewohnten Hauses relativ imDunkeln und erfährt durch die Straßenbeleuchtung keine der Seite zur Hauseingangstür vergleichbareErhellung.Aus den vorstehend aufgezeigten tatrichterlichen Erkenntnissen ist herzuleiten, dass nach demEmpfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen unter Berücksichtigung der Natur und derkonkreten Zweckbestimmung des Grundstücks des Klägers in der konkreten Beschaffenheit,insbesondere des streitgegenständlichen Schlafzimmers, mit dem dauerhaften Betrieb derstreitgegenständlichen Außenleuchte mittels einer 40 Watt und mehr-Birne am Haus des Beklagten einenicht nur unwesentliche Beeinträchtigung des Grundstücks des Klägers verbunden ist.Bei einer Nutzung des streitgegenständlichen Zimmers als Schlafzimmer, wie sie durch den Kläger bis zuder vorliegenden Auseinandersetzung der Parteien konkret vorgenommen wurde, wird nach Einschätzungder Kammer durch den streitgegenständlichen dauerhaften Betrieb der Außenleuchte am Haus desBeklagten und die daraus resultierenden, aufgezeigten besonderen Lichtverhältnisse bei einem Durch-Die <strong>Urteil</strong>e werden mit größtmöglicher Sorgfalt übernommen. Dennoch wird keine Haftung für den Inhalt und dessen Richtigkeit übernommen.Seite 3 von 5 Seiten
schnittsmenschen zumindest ein erhebliches Lästigkeitsgefühl mit einer Einschränkung hinsichtlich derAnnehmlichkeit des Daseins erzeugt, welches eine nicht nur unwesentliche Beeinträchtigung derBenutzung des Grundstücks des Klägers zur Folge hat.Soweit mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei einer Beurteilung im Rahmen des § 906 Abs.1 S. 1 BGB auch das Verständnis eines Durchschnittsmenschen in Rechnung zu stellen ist, läuft diesesErfordernis vorliegend letztlich auf eine Abwägung der feststellbaren berechtigten Interessen des durchdie Einwirkung Betroffenen, vorliegend des Klägers, und des Einwirkenden, vorliegend des Beklagten,hinaus. Eine solche Abwägung führt zu dem Ergebnis, dass von einem Durchschnittsmenschen für denstreitgegenständlichen dauerhaften Betrieb der Außenleuchte am Haus des Beklagten kein Verständniserwartet und insbesondere auch nicht verlangt werden kann, das streitgegenständliche Zimmer alsSchlafzimmer aufzugeben oder den Zimmerrolladen soweit herunterzulassen, bis Lichtverhältnisse in demstreitgegenständlichen Zimmer herrschen, bei denen keine oder nur eine unwesentliche Einwirkung(Beeinträchtigung) vorliegt. Dies gilt gleichermaßen für Vorhänge, mit denen dieselben Lichtverhältnisseerzielt werden könnten.Soweit das Amtsgericht <strong>Wiesbaden</strong>, das im übrigen eine wesentliche Beeinträchtigung durch dasstreitgegenständliche eindringende Licht bei zu 1/3 und mehr geöffneten Rolladen seinerseits durchauseingeräumt hat, in seinem angefochtenen <strong>Urteil</strong> den Kläger auf solche Schutzmaßnahmen verwiesen unddabei allgemein die nötige und übliche Nutzung von Rolläden, Vorhängen etc. in dicht besiedeltenstädtischen Gebieten mit ihrer Vielzahl von Lichtquellen angeführt hat, erweist sich dies insofern alsfehlerhaft, als dabei die Interessen des die Störungsquelle steuernden Beklagten an dem dauerhaftenBetrieb der Außenleuchte in keiner Weise gewürdigt und gegen das Interesse des Klägers an einemfortbestehenden früheren Zustand, insbesondere an einer weder durch einen Rolladen noch durch einendichten Vorhang behinderten Zimmerlüftung ab_ wogen worden sind.Der Beklagte führt zur Begründung seines Interesses an dem streitgegenständlichen dauerhaften Betriebder Außenleuchte zwei Gesichtspunkte an, _ - zwar zum einen die Vorbeugung gegen Einbruchsdiebstähleund zum anderen die höhere Verkehrssicherheit durch eine bessere Ausleuchtung des Treppenbereichsim Bereich der Hauseingangstür.Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme geht die Kammer davon aus, dass dem Beklagten an demstreitgegenständlichen dauerhaften Betrieb der Außenleuchte praktisch kein berechtigtes Interessezuzubilligen ist und die von insoweit angeführten Gesichtspunkte lediglich konstruiert sind.Der Eingangsbereich einschließlich der dortigen Treppe vor dem Haus des Beklagten wird nach den imRahmen der Augenscheinseinnahme getroffenen Feststellungen durch die Straßenbeleuchtung in einemMaße ausgeleuchtet, dass dort eine hinreichende Verkehrssicherheit gewährleistet ist. DieseZustandsbewertung wird durch den Umstand untermauert, dass sich die Außenleuchte - eintretenderDunkelheit nicht automatisch, sei es mittels eines Zeitschalters oder eines Bewegungsmelders,einschaltet.Kehrt der Beklagte erst nach eintretender Dunkelheit in sein zuvor verlassenes Haus zurück, wasnaturgemäß häufiger vorkommen wird, ist für die Zeit zuvor für die angebliche notwendige zusätzlicheBeleuchtung bezeichnenderweise keine Sorge getragen, und muss der Beklagte erst das Haus betreten,um die Außenleuchte einzuschalten. Dabei kommt er bezeichnenderweise auch ohne eine zusätzlicheBeleuchtung durch die streitgegenständliche Außenleuchte aus. Ein gewisses, für die Beurteilung desvorliegenden Falles vernachlässigbares Interesse des Beklagten an dem Betrieb der Außenleuchtekönnte allenfalls für gelegentliche kürzere Zeiträume zufallen, wenn er Besuch erwartet insbesonderewenn es sich hierbei um Ortsunkundige handelt. In diesem mag der Betrieb der Außenleuchte alsOrientierungshilfe dienlich sein.Soweit der Beklagte die Vorbeugung gegen Einbruchsdiebstähle für den dauerhaften Betrieb derAußenleuchte ins Feld führt, wird sein Vorbringen durch verschiedene Umstände als unredlich entlarvt.Das zur Untermauerung des Interesses an einer Vorbeugung gegen Einbruchsdiebstähle vorgelegteMerkblatt des Polizeipräsidiums <strong>Wiesbaden</strong> spricht gerade nicht davon, dass dauerhaft — nächtelang —Außenleuchten eingeschaltet werden sollen. In ihm ist lediglich davon die Rede, dass »abends ab und zuLicht gemacht werden soll«. Dabei bezieht sich dieser Ratschlag offenbar auf Licht im Innern einesHauses. Für ein solches Licht könnte der Beklagte bezeichnenderweise unschwer durch den Betrieb dervorhandenen Innenleuchte im Hausflur hinter der Hauseingangstür sorgen. Eine solche Vorgehensweisedrängt sich angesichts der Lichtdurchlässigkeit der weitgehend gläsernen Hauseingangstür geradezu auf.Dabei würde Störungsquelle vermieden, um die die Parteien vorliegend streiten. Im Übrigen kann es mitdem Vorbeugungsinteresse des Beklagten auch schon deshalb nicht weit her sein, weil er nach seinemVorbringen zur Vorbeugung gegen Einbruchsdiebstähle lediglich die Außenleuchte an der demDie <strong>Urteil</strong>e werden mit größtmöglicher Sorgfalt übernommen. Dennoch wird keine Haftung für den Inhalt und dessen Richtigkeit übernommen.Seite 4 von 5 Seiten
klägerischen Haus zuwandten Hausseite, die durch die Straßenbeleuchtung eine hinreichende Erhellungerfährt, einschaltet, während die Außenleuchte an der rückwärtigen Terassenseite nur gelegentlich, beigeschlossenem Rolladen nie eingesetzt wird die dem Hessenring zugewandte Hausseite, die durch diedortige Straßenlampe keine hinreichende Ausleuchtung erfährt, unbeleuchtet bleibt. Bei alledem auch inRechnung zu stellen, dass die Hauseingangstüren polizeistatistisch gesehen, zu jenen Schwachstelleneines Hauses gehören, durch die am wenigsten eingebrochen wird.Dass der streitgegenständliche dauerhafte Betrieb der Außenleuchte in Ermangelung eines berechtigtenInteresses des Beklagten angesichts des unnötigen Stromverbrauchs zudem unter gleichfalls zubeachtenden Umweltgesichtspunkten zu missbilligen ist, bedarf keiner näheren Darlegungen.Im Gegensatz zu dem Beklagten kommt dem Kläger bei verständiger Betrachtung eines Durchschnittsmenschenim Rahmen seines Eigentumsrechtes berechtigtes Interesse daran zu, das streitgegenständlicheSchlafzimmer zu Schlafzeiten nach Gutdünken zu lüften, ohne dabei durch das Licht derstreitgegenständlichen Außenleuchte in der dargestellten Art und Weise gestört werden. Angesichts derInteressenlage des Beklagten, wie sie sich nach den vorstehenden Erwägungen darstellt, besteht keineVeranlassung, von dem Kläger das Ergreifen von Schutzvorkehrungen zu verlangen, mit denen einespürbare Einschränkung der Zimmerlüftung und damit des Wohlbefindens des Klägers verbunden wäre.Eine Duldungspflicht des Klägers nach § 906 Abs. 2 BGB besteht nicht. Es en sich nach dem Vorbringender Parteien bereits keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der streitgegenständliche dauerhafteBetrieb der Außenleuchte ortsüblich ist. Unbeschadet dessen ist der Beklagte jedenfalls auch darauf zuverweisen, dass die von ihm zu verantwortende Beeinträchtigung durch bestimmte zumutbareMaßnahmen verhindert werden kann. An dieser Stelle ist den bereits vom Amtsgericht <strong>Wiesbaden</strong>unterbreiteten Vergleichsvorschlag verweisen, der die Anbringung einer Leuchte mit Abschirmungsvorrichtungvertretbaren Kosten vorgesehen hat. Auch wenn der Beklagte nur Mieter des von ihmbewohnten Hauses ist, kann davon ausgegangen werden, dass ihm die Möglichkeit eröffnet ist, imRahmen seines Mietvertrages unter den gegebenen Umständen eine entsprechende Veränderung derMietsache zu erreichen.Die Androhung des Ordnungsmittels folgt aus § 890 ZPO.Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.Die <strong>Urteil</strong>e werden mit größtmöglicher Sorgfalt übernommen. Dennoch wird keine Haftung für den Inhalt und dessen Richtigkeit übernommen.Seite 5 von 5 Seiten