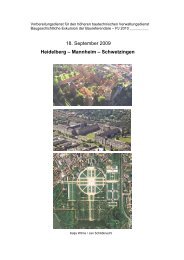Bebenhausen / Zwiefalten
Bebenhausen / Zwiefalten
Bebenhausen / Zwiefalten
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1 BEBENHAUSEN<br />
lich gar nicht mehr selbst bewirtschaftet werden konnte,<br />
auch nicht mehr mit den Laienbrüdern, oder Lohnarbeitern.<br />
Der Anteil der an Bauern gegen Zinsen, Abgaben<br />
und Leistungen ausgegebenen Güter wurde immer größer.<br />
Nach dem Umbau von 1356 bewirtschaftete das Kloster,<br />
das in rund 150 (!) Dörfern und Weilern begütert war,<br />
gerade noch etwa ein Viertel des Landbesitzes im Eigenbau.<br />
26 Beschleunigt wurde diese Entwicklung durch den<br />
Rückgang an Konversen. In <strong>Bebenhausen</strong> waren gegen<br />
Ende des 13. Jahrhunderts etwa 60 bis 80 Mönche und 130<br />
Laienbrüder beheimatet, in den ersten Jahrzehnten des 14.<br />
Jahrhunderts zählte man neben 80 Mönchen gerade noch<br />
40 Konversen, 1432 werden 39 Mönche und 16 Konversen<br />
genannt, und bei der Aufhebung des Klosters 1535 sind es<br />
gar nur noch zwei.<br />
Einen wesentlichen Anteil an diesen Veränderungen hatte<br />
auch der Verfall des Getreidepreises, so dass es bei steigenden<br />
Lohnkosten rentabler wurde, Güter gegen Anteile an<br />
der Ernte an Bauern auszugeben. Diese Entwicklung, die<br />
bereits um 1300 einsetzte und dann eine immer schnellere<br />
Dynamik entfaltete, führte - zumal das Kloster zu Beginn<br />
des 14. Jahrhunderts durch politische Ereignisse und kriegerische<br />
Auseinandersetzung in Bedrängnis geriet - auch<br />
zu einer Abkehr vom Umgang mit dem klösterlichen<br />
Grundbesitz.<br />
Einen Höhe-, aber auch Wendepunkt dieser seit einem<br />
Jahrhundert andauernden expansiven Erwerbspolitik bildete<br />
der 1301 erfolgte Versuch, die Stadt Tübingen zu erwerben,<br />
der schließlich scheiterte.<br />
Etwas generalisierend kann man feststellen, dass von nun<br />
an die Äbte ihr Augenmerk auf die unmittelbare Umgebung<br />
des Klosters richteten, ihren fernen Streubesitz verkauften<br />
und sich um den Aufbau eines geschlossenen Klosterterritoriums<br />
bemühten.<br />
6 EXKURSION BEBENHAUSEN / ZWIEFALTEN<br />
Der wirtschaftliche Aufschwung und der damit Hand<br />
in Hand gehende hohe Personalstand bei Mönchen und<br />
Laienbrüdern führte auch zum raschen Ausbau der Klosteranlage,<br />
die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts<br />
von einer hohen, mit einem Wehrgang versehenen Mauer<br />
umzogen werden konnte. Die Kirche war bereits am 26.<br />
Mai 1228 geweiht worden. Doch gebaut wurde am Kloster<br />
auch in der Folgezeit, zu einem gewissen Baustopp<br />
führte erst die Reformation. Bis dahin zeigt sich die zwar<br />
durchaus auch schwankende, im großen und ganzen aber<br />
anhaltende wirtschaftliche Stärke des Klosters auch darin,<br />
dass in allen Jahrhunderten große „Modernisierungen“,<br />
Um- und Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden konnten.<br />
So entstand um 1335 das „lichtdurchflutete“ Sommerrefektorium,<br />
und in den Jahren 1407 bis 1409 baute<br />
der Laienbruder Georg aus Salem den oft als Wahrzeichen<br />
<strong>Bebenhausen</strong>s apostrophierten, berühmten Dachreiter auf<br />
der Kirche - „den schönsten, den die Zisterziensergotik<br />
hervorgebracht hat“ - an Stelle eines bescheidenen Vorgängers.<br />
Der gotische Kreuzgang erhielt seine heutige Gestalt,<br />
nachdem der romanische abgebrochen war, erst gegen<br />
Ende des 15. Jahrhunderts. Zu jener Zeit galt <strong>Bebenhausen</strong><br />
als das reichste aller württembergischen Klöster, bezahlte<br />
die höchsten Steuern und Umlagen.<br />
AUFBAU EINES KLOSTERTERRITORIUmS<br />
Die Gunst der Stunde nutzend, erwarb das Kloster <strong>Bebenhausen</strong><br />
beim Niedergang der Tübinger Grafen gegen Ende<br />
des 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts nicht nur zäh<br />
Äcker und Wiesen, Weingärten und Wälder, Höfe, Keltern,<br />
Mühlen, Kirchen und Kapellen, sondern, wo sich die<br />
Gelegenheit bot, auch gräfliche Burgen oder Fronhöfe und<br />
die dazugehörende Niedergerichtsbarkeit und Herrschaft<br />
über ganze Dörfer, etwa in Altdorf, Reusten oder Weil im<br />
Schönbuch.