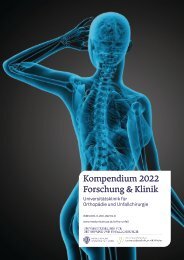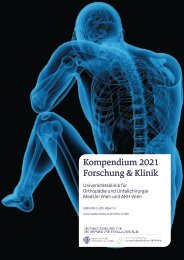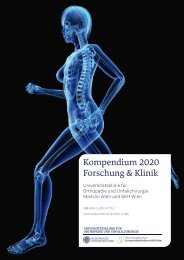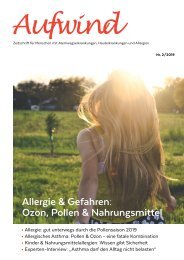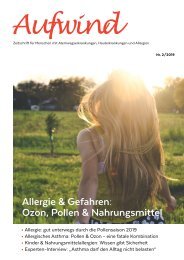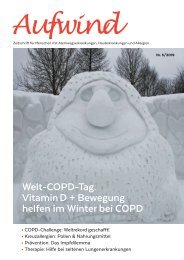KONGRESSJOURNAL 2015/Freitag-Ausgabe public
Offizielle Kongresszeitung der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin, Graz/27. November 2015 An drei Tagen wurden zwei Kongressjournale mit Live-Berichterstattungen, Vorschauen auf Vorträge und Seminare, Interviews und Rückblicke direkt am Kongress verteilt.
Offizielle Kongresszeitung der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin, Graz/27. November 2015
An drei Tagen wurden zwei Kongressjournale mit Live-Berichterstattungen, Vorschauen auf Vorträge und Seminare, Interviews und Rückblicke direkt am Kongress verteilt.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kongress<br />
journal<br />
Offizielle Kongresszeitung der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin Graz/27. November <strong>2015</strong><br />
46. Kongress für Allgemeinmedizin<br />
Der Mensch zwischen<br />
Naturwissenschaft<br />
und Heilkunst<br />
Hausarzt & Palliativmedizin<br />
Die letzten Wegbegleiter<br />
Auch wenn eine Heilung nicht mehr möglich<br />
ist, kann noch sehr viel für die betroffenen<br />
Menschen und ihre Angehörigen<br />
getan werden. Palliativbetreuung bedeutet<br />
jedoch, sich als Arzt mit den mit dem<br />
Sterben verbundenen Ängsten auseinanderzusetzen.<br />
Seite 8<br />
Das Wesen der Osteopathie<br />
Spürsinn entwickeln<br />
Beschwerden an der Wirbelsäule, den<br />
Gelenken oder Kopfschmerz belasten<br />
Lebensqualität und Leistungsfähigkeit<br />
besonders stark und haben zudem<br />
Auswirkungen auf den gesamten Körper.<br />
Oftmals kann dabei die Osteopathie<br />
Abhilfe schaffen. Seite 6<br />
Angst frisst Seele auf<br />
Bitte nicht füttern!<br />
Angst ist hilfreich und dient dem<br />
Selbstschutz. Erst wenn sie Monstergestalt<br />
annimmt, ist sie dem Menschen<br />
nicht mehr hilfreich. Verursachende<br />
Bedingungen sind nicht nur in der Vergangenheit<br />
zu suchen, sondern auch in<br />
gegenwärtigen Situationen. Seite 10
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
INHALT<br />
3 Der Kongress in Bildern<br />
4 Hilfe bei Sarkopenie<br />
6 Das Wesen der Osteopathie<br />
8 Palliativmedizin<br />
9 Strukturierte Versorgung<br />
10 Umgang mit Angst & Panik<br />
12 Traditionelle Europäische Medizin<br />
13 Erdstrahlen erkennen<br />
14 Psychoneuroimmunologie<br />
15 Experten-Tipps: Update Schmerz<br />
18 Institut für Allgemeinmedizin<br />
IMPRESSUM<br />
Medieneigentümer & Herausgeber:<br />
Crisafulli & Stodulka<br />
Unlimited Media GmbH<br />
Unlimited Media<br />
video . web . print & more ...<br />
Verlag & Redaktion:<br />
Salierigasse 26/4, 1180 Wien<br />
Kontakt:<br />
office@unlimitedmedia.at,<br />
unlimitedmedia.at, zoe.imwebtv.at<br />
Chefredaktion:<br />
Thomas Stodulka<br />
Lektorat: Alexandra Lechner<br />
Art Direktion & Layout:<br />
Unlimited Media<br />
Druck:<br />
Universitätsdruckerei Klampfer GmbH<br />
Barbara-Klampfer-Straße 347<br />
8181 St. Ruprecht/Raab<br />
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf eine<br />
geschlechtsspezifische Differenzierung<br />
verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten<br />
im Sinne der Gleichbehandlung für beide<br />
Geschlechter.<br />
Offizielle Kongresszeitung der<br />
Steirischen Akademie für<br />
Allgemeinmedizin<br />
Kongressleiter Dr. med. Walter Fiala bei der Eröffnungsrede<br />
Kongresseröffnung<br />
„Keine seelenlose<br />
Apparatemedizin“<br />
In seiner Eröffnungsrede erklärte gestern Kongressleiter Dr. Walter<br />
Fiala, warum Naturwissenschaften und Heilkunst zum Thema des<br />
diesjährigen Kongresses gewählt wurde. Man wollte darauf hinweisen,<br />
dass der Mensch in seiner Gesamtheit nicht ausschließlich<br />
naturwissenschaftlich zu erkennen und zu behandeln ist.<br />
In der täglichen Praxis gibt es immer<br />
wieder Beispiele, die darauf hinweisen,<br />
dass Heilung nicht nur rein<br />
auf EBM und Schulmedizin basiert.<br />
Walter Fiala: „Wer von Ihnen hat<br />
nicht auch solche Phänomene erlebt,<br />
für die es keine Erklärung gibt,<br />
außer, dass sie gewirkt haben.“ Gerade<br />
der Allgemeinmediziner ist bei<br />
seiner Arbeit oftmals mit den Grenzen<br />
der Schulmedizin konfrontiert.<br />
Aber es geht darum, dieses Feld<br />
nicht Heilpraktikern oder anderen<br />
parawissenschaftlichen Berufsgruppen<br />
zu überlassen.<br />
Vor einigen Jahren forderten Heilpraktiker<br />
ganz vehement die Zulassung in<br />
Österreich, unterstützt von der Kammer<br />
für freie Berufe, die sehr gerne<br />
mehr zahlende Mitglieder gehabt<br />
hätte. Der Ärztekammer ist es gelungen,<br />
dies in Österreich zu verhindern,<br />
indem sie meinte, dass in Österreich<br />
Fotos: Unlimited Media<br />
komplementäre Methoden von Ärzten<br />
auf der Basis ihrer schulmedizinischen,<br />
naturwissenschaftlichen<br />
Kenntnisse ausgeübt werden sollten.<br />
Ärzte sollten in diesem Zusammenhang<br />
auch den Patienten beistehen<br />
und bei der Suche behilflich sein,<br />
was es zusätzlich zur Schulmedizin<br />
an Möglichkeiten gibt oder was man<br />
selbst zur Heilung beitragen kann.<br />
Walter Fiala: „Dieser Kongress soll<br />
zeigen, dass die Schulmedizin keine<br />
seelenlose Apparatemedizin ist<br />
und nicht noch kränker macht und<br />
dass komplementäre Methoden keine<br />
Scheinmedizin sind, sondern sich<br />
diese Methoden im Laufe von oft<br />
langer Zeit durch gute Beobachtung<br />
entwickelt und bewährt haben und<br />
immer komplementär und nie alternativ<br />
sind. Beide sollten zum Wohle<br />
der Patienten aufeinander zugehen<br />
und Vorurteile über Bord werfen.“<br />
2 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Graz/27. November <strong>2015</strong> <strong>KONGRESSJOURNAL</strong> 3
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Hilfe bei Sarkopenie<br />
Wenn der Muskel schwindet<br />
Sarkopenie ist ein durch Alter,<br />
Krankheit oder inadäquate<br />
Lebens- und Ernährungsgewohnheiten<br />
verursachtes<br />
Syndrom, das im Abbau von<br />
skelettaler Muskelmasse in<br />
kritischem Ausmaß und kritisch<br />
abgesenkter Muskelkraft und<br />
Muskelfunktionalität besteht.<br />
Der beste Tipp gegen die Erkrankung<br />
ist frühzeitige Vorbeugung.<br />
Im Vortragssaal: Prim. Dr. Ewald Boschitsch und Prim. Dr. Klaus Hohenstein<br />
Foto: Unlimited Media<br />
Die Häufigkeit der Sarkopenie liegt<br />
in der Gruppe der 60- bis 70-<br />
Jährigen bei etwa 13 Prozent. Ab<br />
dem 50. Lebensjahr nimmt die<br />
Muskelkraft um 15 Prozent pro<br />
Jahrzehnt ab, ab dem 70. Lebensjahr<br />
sogar um 30 Prozent. Die<br />
Häufig keit steigt mit zunehmendem<br />
Alter an, bei den Über-<br />
80-Jährigen ist bereits die Hälfte<br />
betroffen. „Sarkopenie bedeutet<br />
letztlich erhöhte Krankheitshäufigkeit,<br />
erhöhtes Sturz- und Knochenbruch-Risiko,<br />
Invalidität und vor<br />
allem einen Verlust an Lebensqualität<br />
und eine Einschränkung der<br />
selbstbestimmten Lebensführung.<br />
Auch die Sterblichkeit wird natürlich<br />
erhöht”, erklärt Prim. Dr. Klaus<br />
Hohenstein, Wien, gestern beim<br />
Kongress in Graz.<br />
Auf erste Anzeichen achten<br />
Andererseits ist die Erkrankung aber<br />
gut diagnostizierbar und vor allem<br />
in frühen Stadien beeinflussbar. Bewegungs-<br />
und Ernährungstherapie,<br />
insbesondere mit der essentiellen<br />
Aminosäure Leucin, stehen dabei<br />
im Mittelpunkt. Leider ist die erst<br />
seit rund 25 Jahren so bezeichnete<br />
Krankheit noch recht unbekannt und<br />
wird zu selten diagnostiziert. Es beginnt<br />
meist harmlos mit Problemen<br />
beim Gehen. Die Wegstrecken werden<br />
kürzer, die benötigten Pausen<br />
immer länger. Die Einkaufstasche<br />
wird zu schwer und sogar das Stehen<br />
wird mühsam, wenn es länger als<br />
zehn oder 15 Minuten dauert. „Das<br />
können durchaus erste Anzeichen<br />
einer Sarkopenie sein“, warnt Prim.<br />
Hohenstein.<br />
Multifaktorelles Geschehen<br />
Typisch für eine Sarkopenie ist ein<br />
multifaktorielles Geschehen, das<br />
durch genetische, aber durchaus reversible<br />
Alterungsprozesse ausgelöst<br />
und durch zusätzliche Faktoren verstärkt<br />
werden kann. Meist handelt es<br />
sich dabei um zu wenig Bewegung,<br />
verschiedene Krankheiten und Defizite<br />
in der Ernährung, insbesondere die<br />
zu geringe Aufnahme von Proteinen.<br />
Voraussetzung einer kompetenten<br />
Behandlung ist eine möglichst frühzeitige<br />
und exakte Diagnose.<br />
Ein erster Check der Ganggeschwindigkeit<br />
und der Handkraft kann in jeder<br />
Ordination durchgeführt werden<br />
und gibt erste Hinweise auf eine Sarkopenie.<br />
Ab dem 65. Lebensjahr, bei<br />
speziellen Risikofaktoren auch schon<br />
früher, sollten diese Tests durchgeführt<br />
werden. Klaus Hohenstein: „Bei<br />
einer Ganggeschwindigkeit unter 0,8<br />
Metern pro Sekunde oder wenn die<br />
Handkraft vermindert ist, besteht<br />
ein starker Verdacht auf Sarkopenie.“<br />
Dann sollte zur exakten Sicherung<br />
der Diagnose eine Muskelmasse-<br />
Messung mittels Absorptiometrie<br />
oder eine Bioelektrische Impedanzanalyse<br />
vorgenommen werden.<br />
Normaler Muskelabbau im Alter<br />
Vor allem die Schnell-Kraft geht im<br />
Alter verloren. „Schuld daran sind<br />
Fehlfunktionen zellulärer Prozesse<br />
in den Muskelfasern, das altersbedingte<br />
Übergewicht, aber auch<br />
muskelabbauende Prozesse und<br />
die Verringerung muskelaufbauender<br />
Vorgänge”, so Klaus Hohenstein.<br />
Die Muskeln sprechen auf anabole<br />
Stimuli immer weniger an. „Wichtig<br />
ist, die Sarkopenie als gefährliche<br />
Krankheit ernst zu nehmen. Vor allem<br />
Risikopersonen oder Menschen<br />
mit den typischen Beschwerden<br />
benötigen eine kompetente, frühzeitige<br />
Diagnose. Bei Vorliegen einer<br />
Sarkopenie muss diese angemessen<br />
behandelt werden”, erklärt Prim.<br />
Hohenstein.<br />
4 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Das Wesen der Osteopathie<br />
Spüren durch das Innerste<br />
Beschwerden an der Wirbelsäule,<br />
den Gelenken oder Kopfschmerz<br />
belasten die Lebensqualität<br />
und Leistungsfähigkeit<br />
besonders stark und haben<br />
zudem Auswirkungen auf den<br />
gesamten Körper. Oftmals<br />
kann dabei die Osteopathie<br />
Abhilfe schaffen.<br />
Bei der Osteopathie handelt es sich<br />
um eine ganzheitliche Methode, die<br />
sich zur Diagnose und Behandlung<br />
ausschließlich der Hände bedient.<br />
Walter Krasser, Msc, betreibt selbst<br />
eine Praxis für Osteopathie in Graz:<br />
„Die Zielsetzung der Osteopathie ist<br />
es, unterstützt durch eine genaue<br />
Anamnese und eine Reihe von Beweglichkeitstests,<br />
die Ursache für Beschwerden<br />
aufzuspüren und durch<br />
eine adäquate Anwendung von<br />
Techniken die Bewegungseinschränkungen<br />
zu lösen und die Mobilität<br />
des Körpers wiederherzustellen.“<br />
Der Begriff selbst setzt sich aus den<br />
beiden Wörtern Osteon (Knochen,<br />
das Innerste) und Pathos (Leidenschaft,<br />
Erfahrung) zusammen. Osteopathie<br />
kann daher mit „Spüren<br />
durch das Innerste“ übersetzt werden.<br />
Ursprung und Geschichte<br />
Begründer der Osteopathie war der<br />
amerikanische Arzt Dr. Andrew T. Still<br />
in den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts.<br />
Er bemerkte, dass eine Dysharmonie<br />
in der Körpermechanik, sowohl<br />
die betroffene Gewebsstruktur selbst<br />
beeinträchtigt, als auch Funktionen<br />
entfernter Strukturen, wie innere Organe,<br />
stören kann. Durch das Lösen<br />
von Gelenksblockaden können nicht<br />
nur lokale Beschwerden, sondern<br />
auch Funktionsstörungen in anderen<br />
Teilen des Körpers behandelt werden.<br />
Aufgrund dieser Erfahrungen entwickelte<br />
Andrew Still die Osteopathie. Zu<br />
Beginn des 20. Jahrhunderts brachte<br />
Dr. Martin Littlejohn die Osteopathie<br />
nach England und damit nach Europa.<br />
Später entwickelten sich daraus<br />
auch andere Methoden wie Chirotherapie,<br />
Manuelle Therapie, Rolfing oder<br />
Cranio-Sacral-Therapie.<br />
Osteopathische Behandlung<br />
Walter Krasser: „Wichtig sind das<br />
Funktionieren des menschlichen<br />
Körpers als Einheit, seine Fähigkeit<br />
zur Selbstregulation und Selbstheilung<br />
sowie auch das Wechselspiel<br />
von Struktur und Funktion. Die osteopathische<br />
Behandlung hat letztlich<br />
das Ziel, Einschränkungen der<br />
Beweglichkeit von Strukturen und<br />
Geweben zu korrigieren, um dadurch<br />
das körperliche und seelische<br />
Wohlbefinden wiederherzustellen.“<br />
Die Osteopathie erreicht dies durch<br />
eine sehr differenzierte Diagnose<br />
struktureller Störungen und Mobilitätseinschränkungen<br />
sowie ihrer<br />
Auswirkungen mittels klinischer und<br />
osteopathischer Untersuchungsmethoden.<br />
„Am Beginn steht immer<br />
eine ausführliche Anamnese,<br />
dann folgen Tests der einzelnen<br />
Foto: privat<br />
Arbeitsebenen, um herauszufinden,<br />
in welcher Ebene der Behandlungsschwerpunkt<br />
letztendlich zu<br />
setzen ist“, erklärt Walter Krasser.<br />
Der nächste Schritt ist das Zusammenführen<br />
von Anamnese und<br />
palpatorischen Ergebnissen. Wichtig<br />
ist dabei das Erkennen des Dysfunktions-Musters.<br />
Dann kann eine<br />
Korrektur mithilfe sanfter manueller<br />
Techniken erfolgen, entsprechend<br />
den individuellen Bedürfnissen des<br />
Patienten.<br />
Der Anwendungsbereich der Osteopathie<br />
erstreckt sich von der Behandlung<br />
von Neugeborenen nach einer<br />
schweren Geburt über Kinder mit<br />
Verdauungsstörungen, Schlaf - und<br />
Lernschwierigkeiten oder Haltungsschäden<br />
bis zum Erwachsenen nach<br />
Unfällen, Operationen oder mit degenerativen<br />
Erkrankungen.<br />
VORTRAG FÜR ÄRZTE:<br />
Das Wesen der Osteopathie<br />
Fr., 27. 11., 11.40 – 12.00 Uhr<br />
Walter Krasser,<br />
Msc<br />
6 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Palliativmedizin<br />
Hausarzt in den letzten Tagen<br />
Häufig beginnt die palliativmedizinische<br />
Betreuung durch<br />
den Hausarzt erst dann, wenn<br />
dem Patienten im Krankenhaus<br />
oder von fachärztlicher Seite<br />
gesagt wird: „Wir können nichts<br />
mehr für Sie tun“. Laut WHO<br />
sollte die Palliativmedizin<br />
aber frühzeitig eingebunden<br />
werden, um vorbeugend Leiden<br />
zu lindern.<br />
„Wichtig ist, dem Patienten und seinen<br />
Angehörigen zu vermitteln, dass<br />
sehr wohl noch sehr viel getan werden<br />
kann, auch wenn eine Heilung<br />
nicht mehr möglich ist, erklärte MR<br />
Dr. Wolfgang W. Wiesmayr, Arzt für<br />
Allgemeinmedizin, Vöcklabruck, gestern<br />
bei einem Seminar. Besondere<br />
Bedeutung erhält das Gespräch mit<br />
dem Patienten und den Angehörigen.<br />
Dies erfordert vom Hausarzt<br />
entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten<br />
in der Gesprächsführung.<br />
Emotional überfordert<br />
Es müssen die richtigen Worte zur<br />
richtigen Zeit gefunden werden.<br />
Die psychosozialen Probleme von<br />
Patient und Angehörigen müssen<br />
berücksichtigt werden. Palliativbetreuung<br />
bedeutet, sich als Arzt mit<br />
den mit dem Sterben verbundenen<br />
Ängsten auseinanderzusetzen. Diese<br />
Ängste beim Patienten und den<br />
Angehörigen können vielfältig sein:<br />
vor dem Sterben, vor Tod und Trauer,<br />
vor Nebenwirkungen oder dem<br />
Alleinsein. Der Hausarzt ist Drehund<br />
Angelpunkt zwischen stationärer<br />
und ambulanter Betreuung.<br />
Wolfgang Wiesmayr: „Als Hausärzte<br />
fühlen wir uns von den Patienten<br />
und Angehörigen oftmals zeitlich<br />
und emotional überfordert. Hier ist<br />
es hilfreich, Netzwerke mit Kollegen,<br />
Pflegeteams, Seelsorgern, Physiotherapeuten,<br />
Psychotherapeuten<br />
oder Hospizdiensten zu bilden.“<br />
Der Hausarzt sollte seine integrierende<br />
Funktion wahrnehmen, also bei<br />
Bedarf koordinieren und kooperieren.<br />
Wichtig ist, die palliativmedizinische<br />
Basisversorgung zu gewährleisten. Es<br />
bestehen gegenwärtig Defizite in der<br />
Umsetzung einer palliativen Betreuung,<br />
d.h. im Umgang mit Problemen<br />
wie bei der Nahrungsaufnahme, bei<br />
Unruhe, Atmennot oder mit Schmerzen.<br />
Es besteht die Gefahr, dass<br />
quälende Symptome nicht effektiv<br />
beseitigt werden, es zu unnötigen<br />
Krankenhauseinweisungen kommt<br />
und medizinische Maßnahmen ergriffen<br />
werden, die das Sterben des<br />
Patienten unnötig verlängern.<br />
Die häusliche Versorgung schwerstkranker<br />
Sterbender wird heute in<br />
erster Linie von Hausärzten, zusammen<br />
mit Angehörigen, Bekannten,<br />
privaten Pflegediensten und anderen<br />
sozialen Diensten geleistet. Der<br />
Hausarzt muss die in seiner Region<br />
bestehenden Angebote kennen<br />
und mit ihnen kooperieren. Nicht<br />
Foto: privat<br />
Dr. Wolfgang W.<br />
Wiesmayr<br />
selten sind die Beteiligten mit der<br />
Rund-um-die-Uhr-Versorgung der<br />
Schwerstkranken fachlich und zeitlich<br />
überfordert. Wolfgang Wiesmayr:<br />
„Aus diesem Grund sind<br />
flächendeckend spezialisierte ambulante<br />
Palliativversorgungen einzurichten,<br />
die über festzuschreibende<br />
Qualifikationen verfügen.“<br />
Kommunikation<br />
Wolfgang Wiesmayr: „Gespräche<br />
mit Sterbenden sollten auch vor<br />
dem Hintergrund einer verkürzten<br />
verbleibenden Lebenszeit Hoffnung<br />
transportieren. Es geht nicht darum,<br />
unrealistische Hoffnung auf Heilung<br />
zu wecken, sondern beispielsweise<br />
Hoffnung auf ein selbstbestimmtes<br />
Leben bis zum Tod, Hoffnung auf<br />
liebevolle Fürsorge oder Hoffnung<br />
auf Linderung von Symptomen zu<br />
unterstützen.“<br />
8 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Strukturierte Versorgung im Netzwerk<br />
Pilotprojekt wäre startbereit<br />
Herzinsuffizienz (HI) ist eine sehr ernste Erkrankung und mit<br />
250.000 bis 300.000 Patienten eine der meist verbreiteten in<br />
Österreich. Leider ist oft die Compliance der Patienten sehr gering.<br />
Eine rasche Verschlechterung der Krankheit und ein unnötig früher<br />
Tod sind die Folgen, die jedoch vermieden werden könnten.<br />
Regelmäßige Arztkontakte und hohe<br />
Therapietreue bei den Medikamenten<br />
erhöhen signifikant die Überlebenschance.<br />
Deshalb hat ein Team<br />
rund um OA Dr. Christian Ebner,<br />
Kardiologe im KH der Elisabethinen,<br />
und Dr. Erwin Rebhandl,<br />
Arzt für Allgemeinmedizin in<br />
Haslach, OÖ, ein Pilotprojekt<br />
zur strukturierten, wohnortnahen<br />
Betreuung von HI-Patienten<br />
entwickelt. Angehörige, mobile Pflegedienste,<br />
Allgemeinmediziner, Facharzt<br />
und Krankenhaus sollen mit einer<br />
engmaschigeren Betreuung vor allem<br />
die Compliance verbessern. Ziel ist,<br />
dem Patienten rasch die optimale<br />
Versorgung zukommen zu lassen.<br />
Dies beeinflusst nicht nur maßgeblich<br />
Lebensqualität und Krankheitsverlauf,<br />
auch der intramurale, kostenintensive<br />
Bereich wird entlastet.<br />
Das Ziel: Strukturierte Versorgung im<br />
Netzwerk – Betreuung im Team<br />
Hausarzt als Koordinator<br />
Die Versorgungsstruktur hat grundsätzlich<br />
den Patienten als den wichtigsten<br />
Partner im Management<br />
seiner chronischen Erkrankung im<br />
Mittelpunkt. Erste Ansprechstelle<br />
und Koordinator in der Versorgungsstruktur<br />
ist der Hausarzt. Die Hauskrankenpflege<br />
ist der Schlüsselfaktor<br />
für die Patienten im häuslichen<br />
Umfeld. Daher sind die mobilen<br />
Pflegedienste ein wichtiger Hebel<br />
zur engmaschigen Betreuung von<br />
HI-Patienten. Die Befähigung der<br />
Patienten, mit ihrer Krankheit umzugehen<br />
und diese positiv zu beeinflussen,<br />
sind wesentliche Bausteine<br />
des Konzeptes. Die regelmäßigen<br />
Eintragungen des Patienten in sein<br />
Tagebuch setzt eine Auseinandersetzung<br />
mit seiner Erkrankung voraus<br />
und sensibilisiert den Patienten.<br />
Die zusätzliche Unterstützung<br />
oder Kontrolle der Aufzeichnungen<br />
seitens des privaten Umfeldes, der<br />
Pflege bzw. der Ärzteschaft erhöht<br />
zusätzlich die Compliance. Das Patiententagebuch<br />
unterstützt die Therapiertreue<br />
und soll Transparenz in<br />
Bezug auf Diagnosen, Medikamente,<br />
Vitalparameter und Betreuungsteam<br />
schaffen. Ziel der Patientenschulung<br />
ist das Selbstmanagement.<br />
Für eine funktionierende, nahtlose<br />
Versorgung ist die Transparenz in<br />
Sachen Kommunikation und Versorgungsstruktur<br />
sowie Vernetzung aller<br />
Versorgungspartner essentiell. Über<br />
die Guideline-konforme Behandlung<br />
hinweg unterstützen klar definierte<br />
Prozesse und Versorgungsschwerpunkte<br />
die Zusammenarbeit „im<br />
Team“. Der niedergelassene Bereich<br />
kann via Fachinfo-Telefon Rat bei<br />
den HI-Experten aus den Krankenhäusern<br />
beziehen. Wichtig ist auch,<br />
die Vernetzung und Kommunikation<br />
innerhalb aller Versorgungspartner<br />
zu stärken. Niederschwelliger<br />
Zugang zu allen aktuellen Informationen<br />
bietet die Projektwebsite,<br />
wo neben Informationen<br />
für Patienten auch alle<br />
teilnehmenden Versorgungspartner<br />
gelistet sind.<br />
Pilotprojekt in Schwebe<br />
Geplant ist, dieses Konzept im Rahmen<br />
eines Pilotprojektes auf Praxistauglichkeit<br />
und Akzeptanz zu<br />
testen. Das Projekt liegt derzeit mit<br />
einem Finanzierungsantrag bei der<br />
OÖ-GKK und beim Land OÖ. Erwin<br />
Rebhandl: „Durch die schleppende<br />
Bearbeitung bei den Entscheidungsträgern<br />
kommt es zu einer<br />
deutlichen Verzögerung. Wir wissen<br />
leider heute nicht, wann bzw. ob<br />
überhaupt mit dem Pilotversuch<br />
gestartet werden kann.“<br />
Dr. Erwin<br />
Rebhandl<br />
ÄRZTESEMINAR:<br />
Chronische Herzinsuffizienz –<br />
Diagnostik, Therapie und strukturierte<br />
Betreuung, Fr., 27. 11., 9.00 – 12.00 Uhr<br />
Graz/27. November <strong>2015</strong> <strong>KONGRESSJOURNAL</strong> 9<br />
Foto: Unlimited Media
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Umgang mit Angst und Panik<br />
Nicht das Monster füttern<br />
Die Angst sucht das Gesicherte,<br />
das Geprüfte und Beständige<br />
und ist ein Lösungsversuch, wo<br />
gedanklich bereits ein Weiterentwicklungsschritt<br />
im Leben<br />
ansteht. Angst wirkt aber auch<br />
beziehungsgestaltend.<br />
Geschichten und Symptome, die uns<br />
oftmals angstvoll erzählt werden und<br />
das jeweilige Handeln danach, gestalten<br />
letztlich auch die Beziehung<br />
zu Helfern und Angehörigen. In ihrem<br />
Vortrag behandelt Dr. Barbara Hasiba-Cortolezis,<br />
Ärztin für Allgemeinmedizin<br />
und Psychotherapeutin,<br />
Graz, alle Aspekte von Angst, auch<br />
die positiven. Denn betrachtet man<br />
die hilfreichen Aspekte der Angst, so<br />
dient sie dem Selbstschutz. Barbara<br />
Hasiba-Cortolezis: „Man wird vorsichtig,<br />
vermeidet Situationen oder<br />
stellt sich durch beschleunigtes Verhalten<br />
auf Kampf oder Flucht ein.“<br />
Störend oder hilfreich<br />
Erst durch unsere Fragen unterscheiden<br />
wir, wann Angst hilfreich ist oder<br />
sie als Störung erlebt wird. Im besten<br />
Fall wird in weiterer Folge klar, wofür<br />
die Angst steht. Wenn die Angst<br />
unerträglich scheint, ist meist schon<br />
eine Selbsttherapie vorhergegangen,<br />
die sich eventuell in Komorbiditäten<br />
zeigt: Lebensbereiche werden vermieden,<br />
Alkohol oder Beruhigungstabletten<br />
werden verwendet oder<br />
Ersatzhandlungen wie Rauchen,<br />
Essen oder Zwangsrituale kommen<br />
zum Zuge. Manchmal wird auch Ablenkung<br />
durch etwas Exzessiveres<br />
gesucht – wie z.B. riskanter Sport.<br />
Barbara Hasiba-Cortolezis: „Angst<br />
manifestiert sich auf drei Ebenen, im<br />
Fühlen, Denken und Handeln. Dieses<br />
Zusammenspiel gilt es auch, wieder<br />
in Bewegung zu bringen.“<br />
Die Angst hinterfragen<br />
Fragen wie „Wie viel Ihrer Tageszeit<br />
beanspruchen die ängstlichen Gedanken?“<br />
oder „Was würden Sie mit<br />
der Zeit tun, wenn Sie sich nicht mit<br />
Angst beschäftigen würden?“ geben<br />
oft Hinweise auf den hohen Stellenwert<br />
von Leistung, die zurückgestellten<br />
Beziehungen mit Freunden oder<br />
endenwollendes Verständnis von<br />
anderen Familienmitgliedern. Furcht,<br />
Angst und Panik können gemeinsam<br />
auftreten oder alleine, mit oder ohne<br />
anderen körperlichen und psychischen<br />
Erkrankungen. Es gibt jedoch<br />
nicht nur verursachende Bedingungen<br />
in der Vergangenheit für Angststörungen<br />
und Panikattacken, sondern immer<br />
auch aufrechterhaltende Bedingungen<br />
in der Gegenwart. Durch die<br />
Angst wird die Wahrnehmung während<br />
dieser Zeit fokussiert, hierarchisiert<br />
und die Aufmerksamkeit von der<br />
Außen- auf die Innenwelt gerichtet.<br />
„Kleine Körperübungen können unterstützen,<br />
den Fokus der Aufmerksamkeit<br />
selbstwirksam zu nützen“, rät<br />
Foto: privat<br />
Barbara Hasiba-Cortolezis.<br />
Implizite Einladungen<br />
an die Helferinnen<br />
„Hilf mir“ oder<br />
„Alleine schaffe ich<br />
es nicht“ können zu<br />
Fallen werden, die zu<br />
unpassenden Hilfsangeboten<br />
führen und<br />
zur Aufrechterhaltung<br />
beitragen. Nützlicher<br />
sind klärende Fragen.<br />
Dabei geht es um das<br />
Abwägen von Vor- und<br />
Nachteilen der Ängste<br />
in den einzelnen Situationen.<br />
Dies ermöglicht<br />
den Betroffenen, eine Expertenhaltung<br />
zu sich selbst einzunehmen.<br />
Dies betrifft auch eine mögliche medikamentöse<br />
Therapie.<br />
Bewährt hat sich aus Sicht von Hasiba-Cortolezis,<br />
nach Erfahrung im<br />
Bereich der Musik zu suchen, die das<br />
Problem verdeutlichen sowie die<br />
Lösung erlebbar ausdrücken. Drei<br />
zusammenfassende Tipps bietet<br />
sie zum Abschluss: die Freiheit von<br />
einengenden Gewohnheiten zu ermöglichen,<br />
die Fesseln der Angst zu<br />
entknoten und vor alllem die Angst<br />
zum hilfreichen Diener zu machen<br />
statt zum Monster, das gefüttert<br />
werden will.<br />
Dr. Barbara<br />
Hasiba-Cortolezis<br />
VORTRAG FÜR MITARBEITER:<br />
Damit nicht Angst und Panik herrschen<br />
Fr., 27. 11., 11.00 – 12.30 Uhr<br />
10 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
FORTBILDUNG<br />
Unlimited media<br />
video • web • print & more<br />
Fortbildung: Rauchstopp<br />
Österreich ist Europameister, leider nur beim Konsum von Zigaretten.<br />
Dennoch wollen viele Raucherinnen und Raucher einen Rauchstopp<br />
versuchen – oftmals mit Hilfe oder auf Anraten des Arztes oder der Ärztin.<br />
In dieser DFP-Fortbildung werden die Standards der Raucherentwöhnung<br />
zusammengefasst und wichtige Tipps für die ärztliche Beratung gegeben.<br />
THEMENÜBERSICHT<br />
• Zahlen und Fakten<br />
Prim. Dr. Alfred Lichtenschopf gibt einen Überblick über<br />
die Raucherentwöhnung, betont aber auch die Aufgabe der<br />
Ärzte zum Aufhören zu drängen und Hilfe anzubieten.<br />
• Rauchen und COPD<br />
Für OÄ Dr. Irmgard Homeier ist Tabakentwöhnung<br />
die wirksamste Einzelmaßnahme, um das Risiko der<br />
COPD-Entstehung herabzusetzen und das Voranschreiten<br />
zu stoppen.<br />
• Diabetes und CVD<br />
Rauchen erhöht die Diabetesinzidenz um das zweibis<br />
dreifache, erklärt OA Dr. Helmut Brath. Neueste<br />
Studien belegen, dass auch das Passivrauchen nicht viel<br />
besser abschneidet.<br />
• Rauchfrei guter Stimmung<br />
Nikotinabhängigkeit ist eine schwere chronische Erkrankung.<br />
Zudem hängen Rauchen und psychiatrische Erkrankungen<br />
zusammen, ein Rauchstopp ist dann noch<br />
schwieriger, erläutert Univ.-Prof. Dr. Gabriele Fischer.<br />
• Urologie und Krankmacher<br />
Rauchen wirkt sich nicht nur negativ auf das Herz-<br />
Kreislauf-System und die Lunge aus, es fördert auch die<br />
Entstehung von etwa 18 Karzinomen, warnt Univ.-Prof.<br />
Dr. Shahrokh Shariat.<br />
LITERATUR<br />
2 DFP-Punkte<br />
Artikel zum Thema Rauchstopp auf meindfp.at:<br />
www.unlimitedmedia.at/rauchstopp<br />
VIDEO<br />
Alle Videovorträge zum Thema Rauchstopp:<br />
www.unlimitedmedia.at/rauchstopp-video<br />
5 DFP-Punkte<br />
Pro Video-Vortrag<br />
1 Punkt<br />
Infos zu Vareniclin<br />
Im Vortrag erklärt OA Dr. Helmut Brath, Ge sundheitszentrum<br />
Süd Wien, welche Rolle Vareniclin bei<br />
der Tabakentwöhnung spielen kann, wie der Wirkmechanismus<br />
funktioniert und welche Dosierung sich bewährt<br />
hat. (Fachinformation)<br />
Mit freundlicher Unterstützung<br />
Pfizer Corporation Austria GmbH, Wien<br />
CHA-003-15/2/27.10.<strong>2015</strong><br />
IMPRESSUM<br />
Ärztlicher Fortbildungs an bieter:<br />
Zentrum für Allgemeinmedizin<br />
der ÄK für Wien. In Kooperation<br />
mit der Wiener Gesellschaft für<br />
Allgemeinmedizin<br />
Medieneigentümer & Herausgeber:<br />
Unlimited media<br />
video • web • print & more<br />
Crisafulli & Stodulka Unlimited Media GmbH<br />
Verlag & Redaktion: 18., Salierigasse 26/4,<br />
unlimitedmedia.at<br />
Fachkurzinformation auf Seite 16
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Traditionelle Europäische Medizin<br />
Die heile Welt der Kräuter<br />
Warum in die Ferne schweifen,<br />
wenn das Gute ist so nah!<br />
Die Traditionelle Europäische<br />
Medizin und Heilkunde hat<br />
viel altes Wissen zu bieten –<br />
ein noch kaum entdeckter<br />
Schatz für Ärzte und<br />
Ordinationsgehilfen.<br />
Thymian (Thymus vulgare) - potenter Helfer bei winterlichen Infekten<br />
Fotos: Ulrike Köstler<br />
Das Interesse an Naturheilverfahren<br />
beschränkte sich bisher stark auf<br />
asiatische Methoden wie die Traditionelle<br />
Chinesische Medizin oder Ayurveda.<br />
Genauer betrachtet beruhen<br />
die asiatischen Philosophien jedoch<br />
auf der Kenntnis, dass die in der Region<br />
vorkommenden Krankheiten<br />
mit Heilpflanzen aus dem eigenen<br />
Lebensraum am wirkungsvollsten zu<br />
behandeln sind. „Paracelsus sagte<br />
bereits, dass alle Heilmittel, die wir für<br />
unsere gesundheitlichen Probleme<br />
benötigen, in unserer eigenen Umgebung<br />
zu finden sind“, erklärt die zertifizierte<br />
Kräuterfachfrau Ulrike Köstler<br />
und dipl. Traditionelle Europäische<br />
Heilkunde-Praktikerin (TEH), Naturakademie<br />
St. Gilgen am Wolfgangsee.<br />
Sie betont die unterschiedlichen<br />
Lebensbedingungen der verschiedenen<br />
Lebensräume. „Wir haben eine<br />
andere Genetik, ein anderes Klima<br />
und andere körperliche, seelische und<br />
geistige Probleme als Asiaten, Amerikaner<br />
oder Afrikaner. Alpine Heilpflanzen<br />
haben zum Beispiel ganz<br />
besondere Wirkstoffe, die für uns hier<br />
sehr wertvoll sind“, verdeutlicht die<br />
Expertin und weiß zudem die noch<br />
reine Natur Österreichs zu schätzen.<br />
„Unsere Natur ist im Vergleich zu<br />
anderen Gebieten immer noch eine<br />
heile Welt. Wir haben eine gute Luft<br />
und gutes Wasser. Verglichen mit<br />
importierten Kräutern haben unsere<br />
naturheilkundlichen Mittel eine ganz<br />
andere Vitalität, Qualität und andere<br />
Wirkstoffe. Abgesehen davon, dass<br />
bei uns andere Kontrollmöglichkeiten<br />
zur Qualitätssicherung gegeben sind“,<br />
so Expertin Ulrike Köstler.<br />
Hilfe zur Selbsthilfe<br />
Viele naturheilkundliche Maßnahmen<br />
finden heute noch Anwendung und<br />
die Nachfrage danach wird immer<br />
größer. Die Ärzteschaft hat das Potential,<br />
ihr schulmedizinisches Wissen mit<br />
Volksmedizin zu erweitern, allerdings<br />
noch zu wenig erkannt. „Deshalb sind<br />
immer mehr neue Berufsgruppen in<br />
diesem Bereich entstanden. Dabei<br />
wären Ärzte die idealen Ansprechpartner“,<br />
so Ulrike Köstler.<br />
Leider bestehen gewisse Hemmschwellen<br />
bezüglich der Anwendungen.<br />
So sind z.B. Essigpatscherl jedem<br />
ein Begriff, doch wenige wissen<br />
wirklich, wie und wann man diese<br />
richtig einsetzt. „Es wäre gut, wenn in<br />
der Ordination jemand darüber Bescheid<br />
wüsste“, so Ulrike Köstler. „Mit<br />
Fußbädern kann man Infekte, Schlafstörungen<br />
oder Stressprobleme wirkungsvoll<br />
in den Griff bekommen.<br />
Auf der Fußsohle sind alle Reflexzonen<br />
und die Haut ist sehr empfänglich<br />
an dieser Stelle. Der ganze Körper<br />
reagiert mit ganz simplen Zutaten wie<br />
Salz oder Senf“, so die Kräuterfachfrau.<br />
Das Prinzip aller naturheilkundlichen<br />
Methoden ist die Stärkung der<br />
Regulationsfähigkeit des Körpers und<br />
die Anregung der Selbstheilungskräfte.<br />
„Ärztliche Therapien können nur<br />
Unterstützung der Regulation und<br />
der Stärkung der Selbstheilungskräfte<br />
des Menschen sein“, so Ulrike Köstler.<br />
„Heilung passiert immer aus dem<br />
Menschen heraus. Ein Arzt kann die<br />
Wunde nähen, aber die Heilung muss<br />
trotzdem durch das Immunsystem<br />
von innen funktionieren. Aber der<br />
Arzt kann es mit naturheilkundlichen<br />
Mitteln unterstützen, so eine allopathische<br />
Therapie nicht notwendig ist.“<br />
MITARBEITERSEMINARE:<br />
Ulrike Köstler<br />
Die Kunst, mit Kräutern zu heilen<br />
Fr., 27. 11., 9.00 - 10.30 Uhr<br />
Naturheilkunde<br />
Fr., 27. 11., 14.30 - 17.30 Uhr<br />
Bewährte Hausmittel zeitgemäß<br />
einsetzen<br />
Sa., 28. 11., 14.30 - 16.00 Uhr<br />
12 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Erdstrahlen erkennen, meiden, nützen<br />
Strahlende Erkenntnisse<br />
Alle aus der Erde an deren<br />
Oberfläche gelangte Strahlung<br />
und Schwingungen werden als<br />
Erdstrahlung bezeichnet. Diesen<br />
Strahlen werden verschiedene<br />
gesundheitsschädigende<br />
Wirkungen auf den Menschen<br />
zugeschrieben.<br />
Im Seminar möchte Dr. Christoph<br />
Sippel, Arzt für Allgemeinmedizin,<br />
Pöls, den Teilnehmern die wichtigsten<br />
Erdstrahlen vorstellen: „Es geht<br />
um das Kennenlernen der wichtigsten<br />
Erdstrahlen, erste praktische<br />
Erfahrungen mit der Winkelrute zu<br />
sammeln und um das Erkennen von<br />
günstigen und ungünstigen Plätzen<br />
für Menschen, Tiere und Pflanzen.“<br />
Erdstrahlen bilden einen Teil jener äußeren<br />
Einflüsse, welche unser Leben<br />
in zunehmendem Maße beeinflussen.<br />
Sie werden oft auch als geopathische<br />
Störfelder oder Störzonen bezeichnet.<br />
Dabei kann es sich um unterirdische<br />
Wasseradern, Gesteinsbrüche,<br />
Verwerfungen aber auch Gitternetze<br />
handeln. Mit der Erdstrahlung beschäftigen<br />
sich die Menschen schon<br />
seit Jahrtausenden. Im alten Ägypten,<br />
aber auch im Mittelalter achteten die<br />
Baumeister auf die Auswirkungen der<br />
Erdstrahlen. Dann wurde das Wissen<br />
verdrängt und vergessen. Erst im 20.<br />
Jahrhundert beschäftigten sich die<br />
Ärzte Dr. Ernst Hartmann und Dr.<br />
Manfred Curry mit dem Phänomen<br />
natürlicher Störzonen. So kann sich<br />
etwa ein Schlafplatz auf einer Wasserader<br />
negativ auf die Gesundheit<br />
auswirken. Christoph Sippel: „Ein weiteres<br />
Thema ist die Inklination. Der<br />
Grazer Rechtsanwalt Dr. Heinz Eger<br />
erkannte, dass jede Pflanze, jedes<br />
Tier, jeder Mensch, jedes Nahrungsmittel,<br />
jeder Gegenstand, jeder Punkt<br />
auf der Erde und sogar alle abstrakten<br />
Begriffe eine für sie typische Rutenstellung<br />
haben; dies ist reproduzierbar<br />
Foto: Dr. Christoph Sippel<br />
und unabhängig vom Untersucher.“<br />
Im praktischen Teil des Seminars<br />
üben alle Teilnehmer unter Anleitung<br />
das Muten. Dabei kann der Anwender<br />
erkennen, welche Nahrungsmittel,<br />
Arzneien oder Schlafplätze positiv<br />
oder negativ sind.<br />
Dr. Christoph<br />
Sippel<br />
SEMINAR FÜR ÄRZTE/MITARBEITER:<br />
Erdstrahlen erkennen, meiden, nützen<br />
Fr., 27. 11., 14.30 – 17.30 Uhr<br />
Graz/27. November <strong>2015</strong> <strong>KONGRESSJOURNAL</strong> 13
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Psychoneuroimmunologie<br />
Körper und Seele sind eins<br />
Die moderne, medizinische<br />
Forschungsrichtung Psychoneuroimmunologie<br />
(PNI) sagt<br />
der Aufspaltung von Leib und<br />
Seele in der Biomedizin den<br />
Kampf an.<br />
Psychische und psychosoziale Faktoren<br />
haben Einfluss auf die Gesundheit.<br />
„Mit dem Wissen um eine gemeinsame<br />
biochemische Sprache, in der<br />
Nerven-, Hormon- und Immunsystem<br />
miteinander in komplexer Weise<br />
kommunizieren, ist dieser klinischen<br />
Intuition nun der empirische Rückhalt<br />
gegeben“, erklärt Univ.-Prof. DDr.<br />
Christian Schubert, Med. Universität<br />
Innsbruck. Psychoneuroimmunologie<br />
beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen<br />
zwischen psychischen sowie<br />
Nerven-, Hormon- und Immunfaktoren.<br />
Die PNI machte deutlich, dass<br />
die Psyche die Entstehung und Aufrechterhaltung<br />
von chronischen Entzündungserkrankungen<br />
und auch<br />
Autoimmunerkrankungen wesentlich<br />
beeinflussen kann. Umgekehrt kann<br />
aber auch Entzündungsaktivität Erleben<br />
und Verhalten derart verändern,<br />
dass Schwächegefühl, Erschöpfung<br />
und sogar Depression auftreten.<br />
„Dies ist eine klare Ansage an all jene,<br />
die immer noch meinen, Seele habe<br />
nichts mit dem Körper zu tun und<br />
medizinische Tatsachen ließen sich<br />
am besten durch Kenntnis kleinster<br />
molekularer Bausteine erklären“, so<br />
Christian Schubert.<br />
Der Mensch ist keine Maschine<br />
Der Mensch ist keine Maschine, die<br />
sich beliebig vermessen, durchleuchten<br />
und behandeln lässt, wie es die<br />
Biomedizin mit ihrem technischen<br />
Fortschritt propagierte. Der Leitspruch<br />
Univ.-Prof. DDr. Christian Schubert, Med. Universität Innsbruck<br />
„natura sanat, medicus curat“ bekommt<br />
mit der PNI eine neue Bedeutung.<br />
Denn es ist nicht damit getan,<br />
vom Arzt eine Wunde mechanisch<br />
schließen zu lassen. Beim Wundheilen<br />
sind zwei Arbeiter nacheinander<br />
tätig: der Arzt mit seinem Nähen und<br />
die Heilkraft der Wunde, die von der<br />
psychischen Ausgangssituation der<br />
verletzten Person abhängt. Dabei<br />
zeigte die PNI eindrucksvoll, dass sowohl<br />
Stress zu einer Verzögerung der<br />
Wundheilungsgeschwindigkeit führt<br />
und auch positiv Erlebtes zu deren<br />
Beschleunigung.<br />
Neuer Forschungsansatz<br />
Christian Schubert: „Mit der Einbeziehung<br />
der psychischen Wirkkraft und<br />
der damit verbundenen Individualisierung<br />
des Menschen in die Medizin<br />
stößt die Evidenz-basierte Medizin an<br />
ihre Grenzen. Denn Selbstheilungskräfte<br />
und Placebo lassen sich nicht<br />
verschreiben und schon gar nicht in<br />
Gebrauchsanweisungen formulieren!“<br />
Zudem sollte auch die Forschung kritisch<br />
hinterfragt werden, die Erkenntnisse<br />
aus der statistischen Analyse<br />
von Gruppenmittelwerten erzielt.<br />
Berücksichtigt wird dabei weder die<br />
Dynamik von psychischem Erleben<br />
noch die subjektive Bedeutung des<br />
Erlebten. Mithilfe eines neuen Forschungsansatzes<br />
in der Medizin, den<br />
sogenannten „integrativen Einzelfallstudien“,<br />
wurden in den letzten<br />
Jahren neue Ergebnisse möglich, die<br />
sich von den herkömmlichen Resultaten<br />
fundamental unterscheiden.<br />
Mit Interview- und Zeitreihenanalysen<br />
wird die Lebensrealität von Personen<br />
untersucht. So ließ sich zeigen, dass<br />
der Stressreaktionsprozess einerseits<br />
von Person zu Person einem gleichen<br />
Muster folgt. Andererseits wurde<br />
deutlich, dass die zeitliche Verzögerung<br />
zwischen dem Auftreten von<br />
Stressoren und der Stresssystemreaktion<br />
(z.B. Cortisol) von Person zu Person<br />
sehr unterschiedlich ist. Christian<br />
Schubert: „Durch die erweiterte Sicht<br />
der PNI konnte in der Medizin ein<br />
Quantensprung an neuen Erkenntnissen<br />
erzielt werden. Möge die PNI<br />
daher die öffentliche Unterstützung<br />
erhalten, die sie für ihren Aufbruch zu<br />
einer neuen Medizin verdient!“<br />
HAUPTVORTRAG:<br />
Wie Psychisches die Aktivität des<br />
Immunsystems verändert<br />
Fr., 27. 11., 16.55 – 17.35 Uhr<br />
Foto: Univ.-Prof. DDr. Christian Schubert<br />
14 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Experten-Tipps<br />
Update Schmerz<br />
Der Schmerzspezialist<br />
Grünenthal lädt zum Expertentalk.<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf<br />
Likar gibt Tipps rund um die<br />
Diagnostik und Therapie bei<br />
neuropathischen Schmerzen<br />
sowie über die Opioidtherapie<br />
beim geriatrischen Patienten.<br />
Neuropathische Schmerzen gehören<br />
zu den häufigsten neurologischen<br />
Erkrankungen überhaupt.<br />
Viele Patienten sind aber leider<br />
nicht korrekt diagnostiziert, weil es<br />
Defizite in Diagnostik und Behandlung<br />
gibt. Oft vergehen drei bis fünf<br />
Jahre, bevor eine korrekte Diagnose<br />
neuropathischer Schmerz gestellt<br />
wird, im Durchschnitt werden sechs<br />
bis sieben Ärzte aufgesucht.<br />
Die schmerzmedizinische Behandlung<br />
alter und damit meist multimorbider<br />
Menschen ist sehr komplex und<br />
sollte immer multimodal geschehen.<br />
Nutzen und Risiko einer medikamentösen<br />
Therapie müssen noch<br />
sorgfältiger abgewogen werden.<br />
Die tägliche Einnahme einer Tablette<br />
überfordert viele ältere Menschen. Sie<br />
profitieren daher von einer transdermalen<br />
Applikation. Der einfache Anwendungsplan<br />
der fixen Wechseltage<br />
und die unkomplizierte Handhabung<br />
von transdermalem Buprenorphin<br />
Foto: Kabag<br />
(Transtec®) entlastet Patienten und<br />
pflegende Angehörige.<br />
Prim. Univ.-Prof.<br />
Dr. Rudolf Likar<br />
MEET THE EXPERT AM<br />
GRÜNENTHAL-STAND:<br />
Update Neuropathischer Schmerz<br />
Fr., 27. 11., 10.15 – 11.15 Uhr<br />
Update Opioidtherapie beim<br />
geriatrischen Patienten<br />
Fr., 27. 11., 15.45 – 16.30 Uhr<br />
Endlich richtig gut schlafen…<br />
Einzigartige Kombination aus 3 spezifisch wirk samen Substanzen<br />
in ausreichender Dosierung<br />
• Das erste Präparat, das 1 mg Melatonin mit ausreichend<br />
Baldrian und Hopfen in einer Filmtablette kombiniert<br />
• Zielgerichtete Unterstützung bei Einschlafstörungen<br />
(Melatonin, Baldrian), Durchschlafstörungen (Baldrian)<br />
und Schlafqualität (Baldrian, Hopfen)<br />
• Unterstützt einen natürlichen und gesunden Schlaf<br />
• Einfach in der Handhabung: 1 Filmtablette,<br />
30 Minuten vor dem gewünschten Einschlaftermin<br />
• Natürliche Inhaltstoffe mit seit Jahrzehnten<br />
belegter Wirkung<br />
• Keine Abhängigkeit, kein Hangover- Gefühl<br />
JETZT<br />
NEU!<br />
www.easyderm.at<br />
Nahrungsergänzungsmittel – erhältlich in Ihrer Apotheke.<br />
Ein Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche<br />
und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.<br />
www.easysleep.co.at<br />
Ut.Nr.: 2-1101 / 30.4.<strong>2015</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Institut für Allgemeinmedizin an der Grazer Med-Uni<br />
Endlich ein Lehrstuhl<br />
für Hausärzte<br />
Seit Anfang des heurigen Jahres<br />
gibt es endlich ein Institut für Allgemeinmedizin<br />
an der Med-Uni<br />
Graz. Zentrale Aufgaben sind<br />
die Aus- und Weiterbildung von<br />
Allgemeinmedizinern, um dem<br />
drohenden Ärztemangel in der<br />
hausärztlichen Versorgung gegenzusteuern.<br />
Zudem soll mehr<br />
Forschung für und mit Allgemeinmedizinern<br />
initiiert werden.<br />
Univ.-Prof. Dr. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch<br />
Foto: Unlimited Media<br />
Am 1. Jänner <strong>2015</strong> wurde das Institut<br />
für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte<br />
Versorgungsforschung<br />
(IAMEV) an der Med-Uni Graz mit<br />
tatkräftiger Unterstützung der Steirischen<br />
Akademie für Allgemeinmedizin<br />
(STAFAM) eröffnet – das ist<br />
in Österreich bisher einzigartig. Die<br />
Leiterin Univ.-Prof. Dr. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch<br />
erklärte gestern<br />
beim Kongress, dass man vor allem<br />
ein Bindeglied zwischen hausärztlicher<br />
Praxis und medizinischer Wissenschaft<br />
sein möchte.<br />
Gefahr Hausarztmangel<br />
Das Ziel ist, mit den seit Jahren aktiv<br />
tätigen Lehrenden der Allgemeinmedizin<br />
eine qualitativ hochwertige<br />
Aus- und Weiterbildung für eine<br />
bestmögliche Patientenbetreuung in<br />
hausärztlichen Praxen zu gewähren.<br />
Jahrelang habe man sich darum bemüht,<br />
die Allgemeinmedizin auch an<br />
der Universität zu verankern, das sei<br />
nun gelungen. Die Allgemeinmedizin<br />
bekommt dadurch einen gleichen<br />
Stellenwert wie andere medizinische<br />
Fachrichtungen. „Die hausärztliche<br />
Grundversorgung ist wegen des<br />
Nachwuchsmangels in Gefahr und<br />
wird sich in den nächsten Jahren zu<br />
einem akuten Versorgungsproblem<br />
auswachsen”, warnt Siebenhofer-<br />
Kroitzsch. Daher gilt es, die Studierenden<br />
von Anfang an für das Fach<br />
Allgemeinmedizin zu begeistern und<br />
in der Lehre die dafür notwendigen<br />
Kompetenzen zu vermitteln. Erreichen<br />
will man das mit einer Kombination<br />
aus Studium und Praxis.<br />
Dadurch soll es gelingen, dass die<br />
Allgemeinmedizin ein hochinteressantes<br />
Fach bleibt, das die gesamte<br />
Palette der Medizin umfasst und den<br />
Menschen im Mittelpunkt hat.<br />
An der Med-Uni Graz verbringen<br />
Studierende der Humanmedizin verpflichtend<br />
einen Teil ihres sechsten<br />
Studienjahres in einer Allgemeinmedizinischen<br />
Praxis. Die Stafam,<br />
die schon bisher für die Weiterbildung<br />
der Hausärzte verantwortlich<br />
war, wird auch weiterhin eng mit<br />
dem neuen Institut kooperieren.<br />
„Um zu lernen, müssen Studenten<br />
in die Hausarztpraxen gehen”, sagt<br />
Siebenhofer-Kroitzsch. Der Hausarzt<br />
hat viel Wissen und Erfahrung, das<br />
verloren geht, wenn es in Lehre und<br />
Forschung nicht weitergegeben wird.<br />
Gemeinsam forschen<br />
Ein weiteres Anliegen ist ein Forschungsnetzwerk<br />
zu initiieren, in dem<br />
gemeinsam mit Hausärzten Themen<br />
aus der Praxis beforscht werden.<br />
„Bisher ist die Allgemeinmedizin für<br />
die Forschung ein braches Land”,<br />
sagt Siebenhofer-Kroitzsch. Ein klarer<br />
Schwerpunkt wird die Evidenzbasierte<br />
Versorgungsforschung sein:<br />
So will man Umstrukturierungsmaßnahmen<br />
in der Erstversorgung in<br />
Kooperation mit Partnern wie dem<br />
Land Steiermark und den Krankenkassen<br />
mitentwickeln bzw. wissenschaftlich<br />
begleiten. Letztlich geht es<br />
um die Entwicklung und Umsetzung<br />
wissenschaftlich fundierter Versorgungskonzepte<br />
besonders für den<br />
Primärbereich und einer Evaluierung<br />
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit unter<br />
Alltagsbedingungen.<br />
18 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz/27. November <strong>2015</strong>
Unlimited Media<br />
alles in allem:<br />
konzeption • kreation • redaktion & produktion<br />
for video • web • print & more ...<br />
unlimitedmedia.at<br />
zoe.imwebtv.at