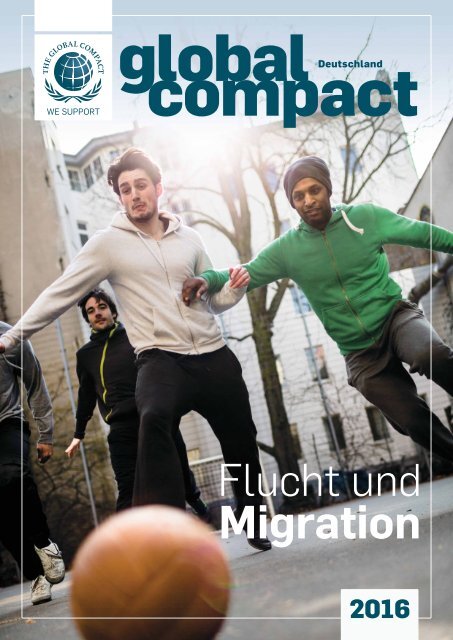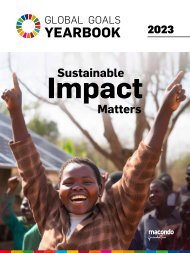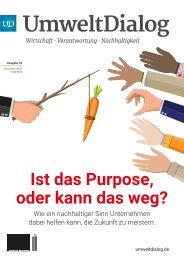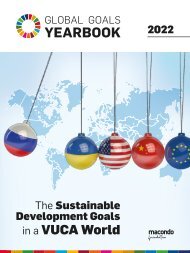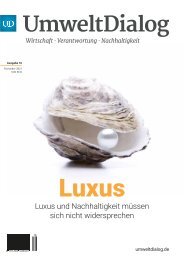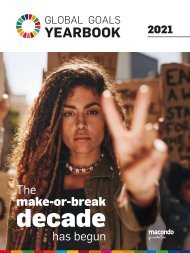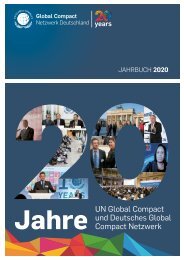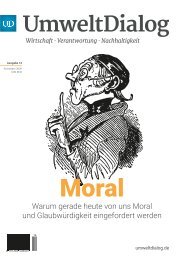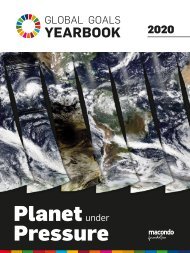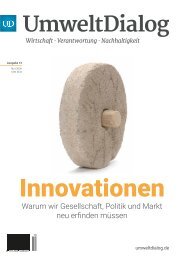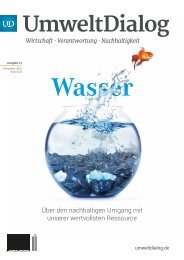Jahrbuch Global Compact Deutschland 2016: Migration und Flucht im Fokus
Über 65 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Hinzu kommen weitere hunderte Millionen, die aus Armut Heim und Familien verlassen müssen. "Das ist eine globale Frage, auf die wir auch globale Antworten finden müssen", schreibt Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Grußwort zum neuen Jahrbuch Global Compact Deutschland. Die aktuelle Ausgabe beleuchtet, welche gemeinsamen Anstrengungen hierzulande im vergangenen Jahr von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der Flüchtlingshilfe unternommen wurden. Gleichzeitig geht es den Motiven und Ursachen von Flucht und Migration in Zeiten der Globalisierung auf den Grund. Weitere zentrale Fragen, denen die Autoren der aktuellen Ausgabe aus verschiedenen Blickwinkeln nachgehen, sind: Welche Rolle spielen künftig die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) bei der Bewältigung dieser globalen Herausforderungen? Und welche Hebel und Mittel besitzen der UN Global Compact und seine nationalen Netzwerke, um Unternehmen bei deren Implementierung und Umsetzung zu unterstützen?
Über 65 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Hinzu kommen weitere hunderte Millionen, die aus Armut Heim und Familien verlassen müssen. "Das ist eine globale Frage, auf die wir auch globale Antworten finden müssen", schreibt Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Grußwort zum neuen Jahrbuch Global Compact Deutschland. Die aktuelle Ausgabe beleuchtet, welche gemeinsamen Anstrengungen hierzulande im vergangenen Jahr von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der Flüchtlingshilfe unternommen wurden. Gleichzeitig geht es den Motiven und Ursachen von Flucht und Migration in Zeiten der Globalisierung auf den Grund. Weitere zentrale Fragen, denen die Autoren der aktuellen Ausgabe aus verschiedenen Blickwinkeln nachgehen, sind: Welche Rolle spielen künftig die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) bei der Bewältigung dieser globalen Herausforderungen? Und welche Hebel und Mittel besitzen der UN Global Compact und seine nationalen Netzwerke, um Unternehmen bei deren Implementierung und Umsetzung zu unterstützen?
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
We support<br />
global<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
compact<br />
<strong>Flucht</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Migration</strong><br />
<strong>2016</strong>
Herausgegeben mit fre<strong>und</strong>licher Unterstüzung durch:
Grusswort<br />
Ban Ki-moon, UN-Generalsekretär (2007 – <strong>2016</strong>)<br />
I have had the privilege of watching closely as the <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> has<br />
grown and matured over nearly ten years as Secretary-General.<br />
This is one of the most successful initiatives launched by the United Nations.<br />
Although it was established <strong>und</strong>er my predecessor, Kofi Annan, it has expanded<br />
very significantly during my t<strong>im</strong>e in office.<br />
I have visited more than two dozen Local Networks on travels aro<strong>und</strong> the world.<br />
I have launched eight issue platforms for companies − many of which are making<br />
an enormous difference in areas including peace and security, cl<strong>im</strong>ate, gender,<br />
water, and management education.<br />
All these activities reflect my strong faith in the <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong>.<br />
This concept resonates throughout the United Nations and with companies everywhere:<br />
do business right, take an active role in creating the world we want, and<br />
build partnerships to deliver progress.<br />
Aro<strong>und</strong> the world, recognition of these principles has grown over the past decade.<br />
The <strong>im</strong>portance of bringing all stakeholders together … The key role of business<br />
in preventing and mitigating the <strong>im</strong>pact of cl<strong>im</strong>ate change … The f<strong>und</strong>amental<br />
relationship between sustainable economic development and human<br />
rights … These ideas are now mainstream.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
3
Grusswort<br />
„Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich<br />
viel Geld habe, sondern ich habe viel<br />
Geld, weil ich gute Löhne bezahle.“ Diese<br />
Aussage von Robert Bosch klingt banal, aber<br />
die dahinterstehende Idee war lange Zeit<br />
leider keine Selbstverständlichkeit. Wirtschaftliche<br />
Interessen <strong>und</strong> faire Entlohnung,<br />
Wachstum <strong>und</strong> Umweltschutz, <strong>Global</strong>isierung<br />
<strong>und</strong> Menschenrechte schienen lange<br />
unvereinbar zu sein.<br />
Dr. Frank-Walter Steinmeier,<br />
B<strong>und</strong>esminister des Auswärtigen<br />
Kofi Annan, damals Generalsekretär der<br />
Vereinten Nationen, hatte vor 16 Jahren<br />
eine andere Idee. Als er 1999 die Unternehmensvorstände<br />
in aller Welt dazu aufrief,<br />
sich an universellen Prinzipien auszurichten,<br />
tat er das auch aus der Überzeugung<br />
heraus, dass nachhaltige Entwicklung nicht<br />
durch Grabenkämpfe zwischen Staaten <strong>und</strong><br />
Unternehmen, sondern nur durch Frieden,<br />
Gerechtigkeit, Innovation <strong>und</strong> Partnerschaft<br />
zu erreichen ist.<br />
Heute ist der von Kofi Annan ins Leben gerufene<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> die größte Initiative<br />
für unternehmerische Verantwortung<br />
<strong>und</strong> Nachhaltigkeit. Aus anfänglich 30 Unternehmen<br />
sind über 9.000 geworden. Im<br />
deutschen <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk allein<br />
haben sich über 320 Unternehmen den<br />
10 Zielen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen,<br />
Umwelt <strong>und</strong> Kl<strong>im</strong>a sowie Korruptions-<br />
4 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
prävention verschrieben. <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
bedeutet national wie international <strong>im</strong>mer<br />
auch, Akteure <strong>und</strong> Institutionen aus Wissenschaft,<br />
Zivilgesellschaft <strong>und</strong> dem öffentlichen<br />
Sektor einzubeziehen.<br />
Das Umfeld für verantwortliches Engagement<br />
von Unternehmen ist dabei nicht einfacher<br />
geworden. 65 Millionen Menschen<br />
sind weltweit auf der <strong>Flucht</strong> vor Krieg <strong>und</strong><br />
Gewalt. Das ist eine globale Frage, auf die<br />
wir auch globale Antworten finden müssen.<br />
Das hat die Staatengemeinschaft mit<br />
dem VN-Gipfel zu <strong>Flucht</strong> <strong>und</strong> <strong>Migration</strong><br />
am 19. September <strong>2016</strong> getan <strong>und</strong> damit<br />
einen wichtigen Schritt hin zu mehr globaler<br />
Verantwortungsteilung in Flüchtlingskrisen<br />
durch alle Akteure vollzogen. In der New<br />
York Declaration for Refugees and Migrants<br />
haben die Staats- <strong>und</strong> Regierungschefs den<br />
Privatsektor ausdrücklich eingeladen, an<br />
Multi-Stakeholder-Allianzen zur Umsetzung<br />
dieser Beschlüsse mitzuwirken. Der<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> mit seinen nationalen<br />
Netzwerken ist für mich eine solche Allianz.<br />
sich die Weltgemeinschaft zu Nachhaltigkeit<br />
<strong>und</strong> Transformation bekannt. Die Agenda<br />
ist ein Weltzukunftsvertrag, an dem wir<br />
alle, Regierungen, Unternehmen, Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Zivilgesellschaft, unser Handeln<br />
ausrichten sollten.<br />
Der UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> <strong>und</strong> sein deutsches<br />
Netzwerk bieten dafür ein hervorragendes<br />
Forum. Unternehmen, Zivilgesellschaft <strong>und</strong><br />
Politik können unter dem Dach des <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> die großen Zukunftsaufgaben mit<br />
anpacken. Wenn sich <strong>im</strong>mer mehr Unternehmen<br />
die 10 Prinzipien des <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
zur Richtschnur machen <strong>und</strong> die Agenda<br />
2030 als Chance betrachten, wird unsere<br />
Welt ein nachhaltigeres, gerechteres <strong>und</strong><br />
inklusiveres Gesicht bekommen.<br />
Diese Investition wird<br />
sich für uns alle lohnen.<br />
Inmitten aller Krisen macht mir auch Hoffnung,<br />
dass die Vereinten Nationen <strong>im</strong> vergangenen<br />
Jahr eine zentrale Richtungsentscheidung<br />
getroffen haben. Mit der Agenda<br />
2030, bei deren Entstehung sich der <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> maßgeblich einbringen konnte, hat<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
5
Inhalt<br />
3<br />
4<br />
10<br />
14<br />
20<br />
24<br />
28<br />
30<br />
Grußworte:<br />
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (2007 – <strong>2016</strong>)<br />
B<strong>und</strong>esaußenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier<br />
<strong>Flucht</strong> <strong>und</strong> <strong>Migration</strong><br />
„Wir fühlen uns lieber schuldig als ohnmächtig“<br />
Interview mit Stephan Grünewald<br />
Wanderung von Waren statt von Menschen<br />
Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker<br />
<strong>Migration</strong> <strong>und</strong> <strong>Flucht</strong> in Zeiten der <strong>Global</strong>isierung<br />
Dr. Pedro Morazán <strong>und</strong> Katharina Mauz<br />
Die Agenda 2030 <strong>im</strong> Kontext von <strong>Migration</strong><br />
Marlehn Thieme<br />
Flüchtlingshilfe von Firmen<br />
Info: Praxisbeispiele<br />
8<strong>Flucht</strong> <strong>und</strong> <strong>Migration</strong><br />
35<br />
40<br />
42<br />
45<br />
46<br />
48<br />
50<br />
Teilhabe <strong>und</strong> Integration – Was kann die schulische<br />
Bildung beitragen?<br />
Ina Bömelburg <strong>und</strong> Katharina Tesmer<br />
Unternehmen <strong>und</strong> Menschenrechte<br />
Zunehmende Verrechtlichung von<br />
Menschenrechtsaspekten<br />
Laura Curtze<br />
Effiziente Vertragsgestaltung in der Lieferkette<br />
Robert Grabosch<br />
Info: Fünf Maßnahmen der DAX 30-Unternehmen<br />
zur Achtung der Menschenrechte<br />
Isabel Ebert<br />
Schutz der Menschenrechte als Faktor bei<br />
Geschäftsinvestitionen<br />
Dr. Christoph Regierer <strong>und</strong> Kai M. Beckmann<br />
Unterstützung durch das Deutsche <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
Netzwerk<br />
Konfliktregionen – Potenzial für mehr <strong>und</strong> besseres<br />
unternehmerisches Engagement<br />
Dr. Melanie Coni-Z<strong>im</strong>mer<br />
38<br />
Unternehmen <strong>und</strong> Menschenrechte<br />
114<br />
Die Nachhaltigen Entwicklungsziele<br />
(SDGs)
Die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs)<br />
116<br />
Netzwerken zum Wohl von Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Weltgemeinschaft<br />
122<br />
Der „SDG Compass“ in einer sich<br />
rasant verändernden Welt<br />
121<br />
Interview mit Marcel Engel<br />
Berliner Forum: Auf dem Weg zur Umsetzung der SDGs<br />
126<br />
Info: Praxisbeispiel<br />
Symrise: Umsetzung der SDGs<br />
54<br />
58<br />
60<br />
62<br />
64<br />
66<br />
Good Practice<br />
Die Nachhaltigkeitsmatrix<br />
ABB<br />
Menschenrechte – durch Schulungen schafft ABB<br />
Kompetenz <strong>und</strong> Verständnis<br />
Audi<br />
Integration von Flüchtlingen: So hilft Audi<br />
Aurubis<br />
Aurubis‘ Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung<br />
BASF<br />
Starting Ventures helfen be<strong>im</strong> Erreichen der globalen<br />
Entwicklungsziele<br />
Bayer<br />
Intelligente Lösungen für die Landwirtschaft<br />
von morgen<br />
84<br />
86<br />
88<br />
90<br />
92<br />
94<br />
96<br />
E.ON<br />
Gemeinsam gegen Energiearmut<br />
Evonik<br />
Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft<br />
EY<br />
Integration von Flüchtlingen gemeinsam gestalten<br />
Freudenberg<br />
Integration durch Bildung<br />
gmc²<br />
Durch gelebte Verantwortung unsere Zukunft<br />
gestalten<br />
HOCHTIEF<br />
Baustellen zum Anfassen<br />
HypoVereinsbank<br />
Sprache ist der Schlüssel<br />
68<br />
Bosch<br />
Gelebte Integration<br />
98<br />
K+S<br />
K+S ist Teil der Lösung<br />
70<br />
CEWE<br />
CEWE betreibt Kl<strong>im</strong>aschutz<br />
100<br />
MAN<br />
MAN fährt be<strong>im</strong> Thema Digitalisierung vorweg<br />
72<br />
CHT / BEZEMA<br />
Langfristig Talente fördern<br />
102<br />
Merck<br />
Gl<strong>im</strong>mer-Lieferkette: Kein Platz für Kinderarbeit<br />
74<br />
76<br />
CiS<br />
CiS: Auf dem Weg in die Zukunft …<br />
Da<strong>im</strong>ler<br />
Systematischer Ansatz zu menschenrechtlicher<br />
Sorgfalt bei Da<strong>im</strong>ler<br />
104<br />
106<br />
Miele<br />
Mit nachhaltigem Personalmanagement auf<br />
Erfolgskurs<br />
Roever Broenner Susat Mazars<br />
Von CSR zu Shared Value<br />
78<br />
DAW<br />
Nachhaltige Farbe. Trend oder Öko-Nische?<br />
108<br />
Tchibo<br />
Wie aus Flüchtlingshilfe Erfolgsgeschichten werden<br />
80<br />
Deutsche Bahn<br />
Digitalisierung ist Hebel zu mehr Nachhaltigkeit<br />
110<br />
TÜV Rheinland<br />
Gemeinsam für die Zukunft: Integration als Chance<br />
82<br />
Deutsche Telekom<br />
Flüchtlingsengagement neu ausgerichtet<br />
112<br />
Weidmüller<br />
Die Mitarbeiter mitnehmen – Arbeit 4.0
Agenda<br />
Migranten <strong>und</strong> Flüchtlinge sind keine Figuren auf<br />
dem Schachbrett der Menschheit. Papst Franziskus<br />
8 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
<strong>Flucht</strong><br />
<strong>und</strong><br />
<strong>Migration</strong><br />
„Die einzige Grenze, die uns trennt, ist<br />
die Menschlichkeit.“ Mit diesen Worten<br />
ermahnte die junge Jesidin <strong>und</strong> ehemalige<br />
IS-Gefangene Nadia Murad die Staatschefs<br />
be<strong>im</strong> UN-Flüchtlingsgipfel in New York.<br />
Über 65 Millionen Menschen sind derzeit<br />
weltweit auf der <strong>Flucht</strong>. Hinzu kommen<br />
weitere h<strong>und</strong>erte Millionen, die aus Armut<br />
He<strong>im</strong> <strong>und</strong> Familien verlassen müssen.<br />
<strong>Flucht</strong> <strong>und</strong> <strong>Migration</strong> sind Ausdruck von<br />
gescheiterter Staatlichkeit <strong>und</strong> fehlgeleiteter<br />
<strong>Global</strong>isierung. Das schiere Ausmaß hat<br />
auch in unseren westlichen Gesellschaften<br />
eine Demokratie- <strong>und</strong> Wertediskussion ausgelöst,<br />
deren Ausgang ungewiss ist.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
9
Agenda<br />
„Wir fühlen uns<br />
lieber schuldig als<br />
ohnmächtig“<br />
Ob nun die geopolitische Lage, die Flüchtlingstragödien oder die <strong>Global</strong>isierung <strong>und</strong> ihre Abkommen<br />
− die Welt, wie sie gerade ist, macht vielen von uns Angst. Angst ist bekanntlich eine<br />
Emotion <strong>und</strong> entsprechend hitzig verlaufen hierzulande die Diskussionen zu solchen Themen.<br />
Im Gespräch mit dem Psychologen <strong>und</strong> Bestseller-Autor Stephan Grünewald gehen wir der<br />
Frage nach, was uns das Fürchten lehrt.<br />
Von Dr. Elmer Lenzen<br />
Die Welt wird <strong>im</strong>mer komplizierter, aber die Antwort <strong>im</strong>mer einfacher.<br />
Herr Grünewald, Sie sind von Haus aus Psychologe <strong>und</strong> können uns<br />
dieses Phänomen best<strong>im</strong>mt erklären!<br />
Wir haben einen paradoxen Bef<strong>und</strong>: <strong>Deutschland</strong> ist als<br />
Exportweltmeister ein <strong>Global</strong>isierungsgewinner. Dennoch<br />
haben wir hierzulande große Ängste vor der <strong>Global</strong>isierung.<br />
Warum? Weil die <strong>Global</strong>isierung, so glaube ich, zu einer<br />
Sch<strong>im</strong>äre <strong>und</strong> zu einem reinen Platzhalter geworden ist<br />
für all das, was die Menschen als ungerecht, als unfassbar,<br />
als schwer nachvollziehbar betrachten. Wir erleben eine<br />
gesellschaftliche Spaltung, bei der Teile der Bevölkerung das<br />
Gefühl haben, abgehängt zu sein. Sie sehen sich als „Hartzer“,<br />
als Verlierer ohne jede Perspektive. <strong>Deutschland</strong> hat <strong>im</strong>mer<br />
davon gelebt, dass be<strong>im</strong> nächsten Wirtschaftswachstum auch<br />
strukturelle Gerechtigkeitsprobleme aufgegriffen werden.<br />
Dieser Glaube an eine bessere Zukunft ist verlorengegangen.<br />
Diese Menschen fühlen sich von den Parteien verraten <strong>und</strong><br />
haben das Gefühl, sie werden nicht genügend wertgeschätzt.<br />
Dieses explosive Gebräu entlädt sich derzeit in Hasstiraden<br />
<strong>und</strong> in Populismus-Sehnsucht. Zu diesem Empfinden tragen<br />
auch „die da oben“ bei: Gesellschaftliche Verlierer erleben seit<br />
Langem nicht mehr die Solidarität der Eliten. Vielmehr empfinden<br />
sie, dass die Eliten hochnäsig von einem überlegenen<br />
moralischen Standpunkt auf sie herabblicken. Wie zeigt sich<br />
das? Indem beispielsweise best<strong>im</strong>mte Lebensäußerungen<br />
<strong>und</strong> Ausdrucksformen wie etwa Alkoholkonsum, Rauchen,<br />
fettes Essen, Süßkonsum, Rezeption von Unterschichten-TV<br />
tabuisiert werden.<br />
Bei der Elitenschelte schwingt also viel Verdruss mit. Immer mehr<br />
Menschen glauben, sie wären die besseren Journalisten oder Politiker<br />
− dabei beherrschen sie nicht einmal den Konjunktiv, beklagt<br />
der Kolumnist Jan Fleischhauer süffisant. Brauchen wir hierzulande<br />
wieder ein Elitebewusstsein?<br />
Eliten zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas für die<br />
Gesellschaft leisten, was andere nicht leisten können. Diese<br />
Leistung muss aber auch erbracht werden: Schauen wir aber<br />
beispielsweise auf die Bankenkrise, dann muss man sagen,<br />
dass die Finanzeliten die Entwicklungen falsch eingeschätzt<br />
oder sich zum Teil schlichtweg verzockt haben. Trotzdem<br />
bekommen sie große Boni. Das ist für viele Leute nicht vermittelbar.<br />
Der Kern des Eliten-Argwohns lautet also: „Die<br />
bringen ihre Leistung nicht“. Dennoch lassen sie sich in ihren<br />
eigenen Kreisen feiern. Die US-Präsidentenwahl von Trump<br />
ist <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e genommen der Denkzettel dafür. Nach dem<br />
Motto: Jetzt kriegt ihr mal mit, was ihr alles übersehen habt.<br />
10 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
Populisten wie Trump arbeiten sich ja durchaus erfolgreich am Konzept<br />
der „political correctness“ ab. Andreas Rödder, Historiker der Universität<br />
Mainz, beklagt, wir seien das selbst schuld: Wir hätten Themen<br />
wie Diversität, Antidiskr<strong>im</strong>inierung, Gleichstellung etc. in den letzten<br />
Jahren derart ideologisch überhöht, dass es schon Züge einer repressiven<br />
Toleranz angenommen habe. Ist an dem Gedanken etwas dran?<br />
Ich würde es anders formulieren. Es ist eine mehrfache Kränkung<br />
in der Gesellschaft. Die Kränkung, dass die Prosperität<br />
an manchen vorbeigeht <strong>und</strong> die Schere zwischen Arm <strong>und</strong><br />
Reich <strong>im</strong>mer größer wird. Dann die Kränkung, dass einige sich<br />
nicht wahrgenommen <strong>und</strong> wertgeschätzt fühlen, sondern <strong>im</strong><br />
Gegenteil, dass das, was ihnen lieb <strong>und</strong> wichtig ist, tabuisiert<br />
wird. Das spitzt sich in der Flüchtlingsthematik noch weiter<br />
zu, wenn das Gefühl aufkommt, dass „der Syrer“ mehr zählt<br />
als „der Sachse“. Die Kränkung <strong>und</strong> das Gefühl, nicht wertgeschätzt<br />
zu werden, führen zu Verbitterung <strong>und</strong> zu Eifersucht.<br />
Erleben wir mit dem Populismus jetzt die „Rückabwicklung“ der<br />
<strong>Global</strong>isierung? Ist das die Konsequenz aus der von Ihnen beschriebenen<br />
Kränkung?<br />
Was ich beschreiben möchte, ist eine Gerechtigkeitsproblematik,<br />
ein Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, sowie eine<br />
Zur Person<br />
Stephan Grünewald ist ein deutscher Psychologe <strong>und</strong> Geschäftsführer<br />
des Markt- <strong>und</strong> Medienforschungs-Instituts rheingold.<br />
Er ist Autor von Bestsellern wie „<strong>Deutschland</strong> auf der Couch“<br />
sowie „Die erschöpfte Gesellschaft“. „Der Psychologe der Nation“<br />
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) führt am rheingold Institut<br />
jedes Jahr mehr als 5.000 Tiefeninterviews zu aktuellen Fragen<br />
aus Markt, Medien <strong>und</strong> Gesellschaft durch.<br />
Eifersuchtsproblematik, wieso andere hofiert <strong>und</strong> bevorzugt<br />
werden <strong>und</strong> ich nicht. Frau Merkel hat das jahrelang kongenial<br />
gelöst, indem sie den Menschen vermittelt hat: „Ihr könnt mir<br />
vertrauen. Ich steuere euch nicht in eine ungewisse Zukunft.“<br />
Wir haben vor zwei, drei Jahren in Forschungsinterviews<br />
<strong>im</strong>mer wieder gespiegelt bekommen, dass viele das Gefühl<br />
haben, <strong>Deutschland</strong> ist eines der letzten Paradiese <strong>und</strong> wir<br />
sind umbrandet von ungeheuer vielen Krisenherden. Wenn<br />
wir in die Zukunft blicken, haben wir das Gefühl, es wird nicht<br />
besser, sondern es kann nur schl<strong>im</strong>mer werden. Das führte<br />
dazu, dass wir an eine permanente Gegenwart glauben, >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
11
<strong>und</strong> Angela Merkel ist die Sachwalterin, weil sie den Menschen<br />
sinngemäß sagt: „Ich fahre auf Sicht, ich führe euch nicht in<br />
etwas Ungewisses, sondern ich garantiere, dass alles so bleibt,<br />
wie es ist.“ Unmut dagegen hat sich nur an den Rändern der<br />
Gesellschaft artikuliert. Zu einer Wellenbewegung wurde das<br />
erst <strong>im</strong> letzten Jahr, als auch die gesellschaftliche Mitte von<br />
der Verunsicherung erfasst wurde. Und dann brachen auch<br />
sehr schnell best<strong>im</strong>mte Kultiviertheitsstandards, nach dem<br />
Motto: Jetzt darf es mal alles ausgesprochen werden. Damit<br />
wurde nicht nur der inhaltliche Radius erweitert, sondern<br />
auch die Affektwucht, mit der Debatten ausgetragen wurden.<br />
Das traditionelle Gr<strong>und</strong>versprechen ist ja, dass unsere Kinder es<br />
einmal besser haben sollen. Das ist heute längst nicht mehr ausgemacht.<br />
Können Sie die Angst der Eltern verstehen?<br />
Die Menschen spüren die kippelige Weltsituation. Bernd<br />
Ulrich hatte letztes Jahr ein Buch geschrieben, in dem er<br />
Gespräche mit Politikern beschreibt, in denen sie ratlos sind<br />
<strong>und</strong> angesichts der globalen Konfliktverwerfungen auch nicht<br />
weiterwissen. Ich habe das mal mit dem Bild beschrieben,<br />
dass <strong>Deutschland</strong> eine „Goretex-Republik“ ist: Das Gute aus<br />
<strong>Deutschland</strong> dringt weiterhin nach außen, es macht uns<br />
beispielsweise zum Export- <strong>und</strong> zum Reiseweltmeister, aber<br />
das Krisenhafte bleibt außen vor. Was wir dann in 2015 erlebt<br />
haben, war die Umkehrung dieser Semipermeabilität. Auf<br />
einmal strömte es von außen scheinbar ungehindert rein, <strong>und</strong><br />
von innen kamen auch nur noch der VW-Abgas-Skandal oder<br />
der Deutsche-Bank-Skandal heraus.<br />
Die „Raute“ von Angela Merkel war <strong>im</strong>mer auch ein Sinnbild<br />
für eine fürsorgliche Umgrenzung der Republik. Damit<br />
hat sie signalisiert: Ich lasse nichts an euch heran. In dem<br />
Moment aber, als sie stattdessen die Arme ausgebreitet hat,<br />
ist sie von der Befürworterin der permanenten Gegenwart<br />
zum internationalen Willkommensengel geworden, der uns<br />
in eine ungewisse Zukunft schickt. Da bekommt die lange<br />
schwelende Eifersuchtsproblematik eine ganz neue Dynamik<br />
<strong>und</strong> mündet in der tiefenpsychologischen Frage: Wen liebt<br />
die Mutter eigentlich? Die eigenen Kinder oder die fremden<br />
Kinder? In einer Studie, die wir Anfang des Jahres über Ängste<br />
r<strong>und</strong> um die Flüchtlingspolitik gemacht haben, haben sehr<br />
viele Befragte geantwortet: Die liebt die fremden Kinder mehr.<br />
Die riskiert dafür ihr eigenes politisches Schicksal. Warum?<br />
Mit dieser Kränkung kommen dann auch Ängste auf: Viele<br />
von uns leben mit der Mentalität einer saturierten Vollkasko-<br />
Gesellschaft, die jetzt auf Menschen trifft, die todesmutig sind,<br />
die auf der <strong>Flucht</strong> jedes Risiko in Kauf genommen haben,<br />
um sich eine bessere Zukunft aufzubauen. An dieser Stelle<br />
beschleicht manche das Gefühl, da kommt eine Power ins<br />
Land, die uns überlegen ist. Das ist der psychologische Gr<strong>und</strong>,<br />
warum ein Land mit einer ungeheuren Leistungsbilanz nicht<br />
das Gefühl hat, wir schaffen das, sondern auf einmal die Angst<br />
hat, die schaffen uns.<br />
Und nun?<br />
<strong>Global</strong>isierung gilt für viele nicht mehr als Zukunftsoption,<br />
<strong>und</strong> auch auf ein Modell der permanenten Gegenwart können<br />
12 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
<strong>Global</strong>isierung gilt für viele nicht mehr als<br />
Zukunftsoption, <strong>und</strong> auch auf ein Modell der<br />
permanenten Gegenwart können wir uns nicht<br />
mehr verlassen, also suchen wir unser Heil in der<br />
Rolle rückwärts. Wir versuchen, Verhältnisse zu<br />
restaurieren − das Amerika der Sechzigerjahre,<br />
<strong>Deutschland</strong> vor der Wende.<br />
wir uns nicht mehr verlassen, also suchen wir unser Heil in<br />
der Rolle rückwärts. Wir versuchen, Verhältnisse zu restaurieren<br />
− das Amerika der Sechzigerjahre, <strong>Deutschland</strong> vor<br />
der Wende etc. Wir versuchen damit, Kindheitserinnerungen<br />
wiederzubeleben. Der Psychologe würde sagen, wir regredieren<br />
auf einfache Muster.<br />
Aus Angst wird irgendwann <strong>im</strong>mer Wut, <strong>und</strong> Wut ist per se ungezügelt.<br />
Sie haben in einem früheren Interview den Umgang mit<br />
Migranten <strong>und</strong> Flüchtlingen provokativ mit der mittelalterlichen<br />
Hexenverfolgung verglichen. Was meinen Sie damit?<br />
Das ist zum Teil vereinfacht aufgegriffen worden. Ich habe<br />
mich nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gefragt, wie<br />
es kommt, dass die Angst vor Flüchtlingen in Regionen größer<br />
ist, die kaum mit Flüchtlingen Kontakt haben. Die Flüchtlinge<br />
werden hier zu einer Projektionsfläche für all die Probleme, die<br />
manche Menschen haben, <strong>und</strong> ein Projektionsmechanismus<br />
funktioniert dann am besten, wenn er nicht durch Realitätserfahrungen<br />
korrigiert wird. Ich kann also das Gefühl, die<br />
Flüchtlinge sind schuld an allem, nur aufrechterhalten, wenn<br />
ich nicht mit ihnen in Kontakt komme.<br />
Das Problem mit Ängsten, <strong>und</strong> dazu zählen eben auch die<br />
<strong>Global</strong>isierungsängste, ist, dass sie zunächst etwas Unfassbares<br />
umschreiben. Es gibt eine Tendenz <strong>im</strong> Seelischen damit umzugehen,<br />
indem man es fassbar macht. Darum kommt es zu diesen<br />
Projektionen. Im Mittelalter gab es die großen Seuchen, <strong>und</strong><br />
überall starben die Menschen, ohne dass man damals wusste,<br />
woran dies lag, weil man Viren <strong>und</strong> Bakterien noch gar nicht<br />
kannte. Also hat man stattdessen angefangen, Juden, Hexen<br />
oder wen auch <strong>im</strong>mer damit in Zusammenhang zu bringen.<br />
Dann hat die Angst ein Gesicht <strong>und</strong> man kann dagegen angehen.<br />
Auch wenn man weiß, dass es Unschuldige trifft?<br />
Ja, auch dann. Unsere seelischen Mechanismen sind so, dass<br />
wir uns lieber schuldig als ohnmächtig fühlen. Noch besser<br />
ist es, einen Schuldigen zu finden, dann können wir nämlich<br />
Macht an den Tag legen.<br />
Aber dann müssen wir dem Angstgefühl ein anderes Bild, einen<br />
besseren Gesellschaftsentwurf entgegenstellen!<br />
Richtig. Wir brauchen ein positives Bild. <strong>Deutschland</strong> ist<br />
mehr als nur das vergangene Bild der Dichter <strong>und</strong> Denker<br />
<strong>und</strong> des Erfindungsgeistes. Wir brauchen neue, zeitgemäße<br />
<strong>und</strong> übergreifende Mythen <strong>und</strong> Bilder, um das Gefühl zu<br />
vermitteln, ja, das ist deutsch.<br />
Die zweite Aufgabe ist, dass es uns wieder gelingen muss,<br />
die Sprachlosigkeit zu überwinden. Wir müssen vermitteln,<br />
dass wir noch in der Lage sind, den Staat umzubauen. Sonst<br />
gewinnt das Gefühl überhand, dass harsche Systemkorrekturen<br />
notwendig sind. Dann glauben die Leute, man braucht einen<br />
Zertrümmerer wie Trump, um etwas zu bewegen.<br />
Vielen Dank für das Gespräch!<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
13
Agenda<br />
Wanderung von<br />
Waren statt von<br />
Der dominante Gr<strong>und</strong> für transnationale Wanderungen ist die Not. Die Menschen verlassen<br />
die He<strong>im</strong>at, wo Hunger oder Bürgerkrieg herrschen. Sie streben dorthin, wo sie diesen Gefahren<br />
für die eigene Existenz entrinnen können. Die heutige Flüchtlingsbewegung nach Europa ist<br />
hier keine Ausnahme.<br />
Von Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker<br />
14 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
Die <strong>Flucht</strong> aus dem Süden in das warme Nest des Nordens<br />
Menschen<br />
Das Sehnsuchtsziel der Flüchtlinge <strong>und</strong> sonstigen Auswanderer<br />
aus den armen Ländern (aus dem „Süden“) sind die reichen<br />
Länder („der Norden“), in denen Wohlstand herrscht, in denen<br />
man hoffen kann, Arbeit zu finden, mit deren Lohn man sich<br />
<strong>und</strong> seine Familie ernähren kann, in denen es mannigfache<br />
soziale Absicherungen gibt, wie sie der Sozialstaat europäischen<br />
oder nordamerikanischen Zuschnitts zur Verfügung stellt.<br />
Ich werde <strong>im</strong> Folgenden zur vereinfachten Darstellung von<br />
den beiden <strong>Global</strong>regionen „Norden“ <strong>und</strong> „Süden“ sprechen.<br />
Es lohnt sich kurz zu rekapitulieren, welche Institutionen es<br />
sind, die das Erfolgsmodell des Nordens ermöglicht haben. Es<br />
handelt sich um die Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft,<br />
wie sie sich <strong>im</strong> Verlauf der letzten 250 Jahre entwickelt haben,<br />
die „große Transformation“ (Karl Polanyi): ein Rechtsstaat, der<br />
Rechtssicherheit <strong>und</strong> die Gleichheit vor dem Gesetz gewährt;<br />
das Gewaltmonopol des Staates, das Bürgerkrieg verhindert;<br />
die Gewaltenteilung, die Demokratie <strong>und</strong> individuelle Freiheit<br />
ermöglicht; eine wettbewerblich verfasste Marktwirtschaft,<br />
die in diesem staatlichen Rahmen Anreize für Effizienz <strong>und</strong><br />
materiellen Fortschritt schafft; Freiheit der Wissenschaft, die<br />
neues, nützliches Wissen generiert; Meinungsfreiheit <strong>und</strong> Mehrheitsprinzip,<br />
die für gewaltfreie Formen des Machtwechsels<br />
<strong>und</strong> somit für gesellschaftliche Integration der meisten Bürger<br />
sorgen; ein Sozialstaat, der bei allen Bürgern ein Interesse an<br />
der Stabilität der öffentlichen Zustände generiert: „Die Rente<br />
ist sicher“ (Norbert Blüm).<br />
Die Antwort: <strong>Global</strong>-Soziale Marktwirtschaft<br />
Ein ungehemmter Zustrom von Menschen aus dem Süden in<br />
den Norden würde das Erfolgsmodell des Nordens zerstören.<br />
Es muss daher <strong>im</strong> Interesse des Nordens liegen, viel dafür zu<br />
tun, dass sich die große Diskrepanz in den Lebensbedingungen<br />
zwischen Norden <strong>und</strong> Süden vermindert. Der Norden<br />
steht vor der großen Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft zu<br />
globalisieren. Wenn er seine Wirtschafts- <strong>und</strong> Gesellschaftsordnung<br />
retten will, muss er sie zu einer <strong>Global</strong>-Sozialen<br />
Marktwirtschaft ausbauen.<br />
Ungefähr in der Mitte des 21. Jahrh<strong>und</strong>erts wird die Weltbevölkerung<br />
die 10-Milliarden-Grenze überschreiten. Im<br />
Vergleich zu heute vermehrt sie sich damit innerhalb weniger<br />
Jahrzehnte um ein Drittel. Dieses Wachstum geht vor allem<br />
in den Ländern der Dritten Welt vor sich. Es stellt diese Länder<br />
vor große Herausforderungen. Dazu kommt: Je ärmer<br />
ein Land ist, desto schneller wächst seine Bevölkerung. Die<br />
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Hunger <strong>und</strong> Bürgerkrieg<br />
in vielen dieser Länder zunehmen werden. Die Ursachen für<br />
transnationale Wanderungen werden voraussichtlich stärker<br />
werden. Dann werden sich die Flüchtlingsströme verstärken;<br />
es sei denn, dass die reichen Länder kräftig darauf hinarbeiten,<br />
diesen Ursachen zu begegnen.<br />
Der Ökonomie-Nobelpreisträger Angus Deaton hat in seinem<br />
Buch „The Great Escape“ eine genauere Analyse der institutionellen<br />
Dynamik vorgelegt, die dem Norden <strong>im</strong> Verlauf von<br />
zwei Jahrh<strong>und</strong>erten diese „<strong>Flucht</strong> aus der Not“ ermöglicht hat.<br />
Ich verstehe den Prozess der <strong>Global</strong>isierung als ganz wesentlich<br />
getrieben von dem Versuch der Menschen aus dem Süden,<br />
die Erfolgsgeschichte des Nordens nachzumachen. Wenn<br />
das Ziel die <strong>Global</strong>-Soziale Marktwirtschaft ist, dann bleibt<br />
gar nichts anderes übrig, als diesen allgemeinen Prozess der<br />
<strong>Global</strong>isierung weiter laufen zu lassen, ja ihn, wenn möglich,<br />
zu beschleunigen.<br />
Damit die Dritte Welt vorankommt in Richtung auf das Ziel,<br />
Teil einer weltweiten Sozialen Marktwirtschaft zu werden, muss<br />
sie die Kultur der erfolgreichen Marktwirtschaft erlernen. Das<br />
geschieht keinesfalls durch Kapital-Entwicklungshilfe >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
15
Agenda<br />
seitens des Nordens. Diese war in der Vergangenheit schon<br />
kein Erfolg. Und sie wird es in der Zukunft nicht werden<br />
können. Denn durch die Kapitalentwicklungshilfe werden<br />
in aller Regel die falschen Anreize gesetzt: Je ärmer man ist,<br />
desto mehr „Anrecht“ hat man auf diese Entwicklungshilfe.<br />
Sie wirkt damit wie eine Bremse für effizientes Wirtschaften<br />
oder, anders ausgedrückt, wie eine Belohnung von Verschwendung<br />
<strong>und</strong> eines Beibehaltens der Machtverhältnisse, die dem<br />
Wohlstandswachstum der Gesamtbevölkerung entgegenstehen.<br />
Sinnvoll kann eine Kapitalentwicklungshilfe dann sein, wenn<br />
sie sich auf ganz best<strong>im</strong>mte Projekte, z.B. Infrastrukturprojekte,<br />
bezieht, die dem wirtschaftlichen Wachstum des Empfängerlandes<br />
förderlich sind. Derartige Hilfe besteht meist aus Darlehen,<br />
die aus den direkten oder indirekten Erträgen des Projekts<br />
bedient werden können. Sie tragen daher zur Disziplinierung<br />
des Wirtschaftens <strong>im</strong> Empfängerland bei. Die Weltbank hat<br />
hier als Kapitalgeber einen großen Erfahrungsschatz gesammelt.<br />
Lernen vom Norden durch Export in den Norden<br />
Aber der wichtigste Lernprozess des volkswirtschaftlich erfolgreichen<br />
Wirtschaftens ist der Warenexport des Südens in<br />
den Norden. Indem Länder des Südens mithilfe ihrer Waren<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen Bedürfnisse ihrer Abnehmer <strong>im</strong> Norden<br />
bedienen, stehen sie K<strong>und</strong>en gegenüber, die Teil einer erfolgreichen<br />
Wirtschaftskultur sind. Damit sie bei diesen K<strong>und</strong>en<br />
reüssieren, müssen sie sich deren Usancen <strong>und</strong> derernKultur<br />
annähern. Sie lernen, dass man Absatz in den Ländern der<br />
reichen Welt nicht durch Bestechung des Einkäufers des<br />
K<strong>und</strong>en generiert, sondern durch das Angebot guter Ware zu<br />
konkurrenzfähigen Preisen <strong>und</strong> mit pünktlicher Lieferung.<br />
Sie lernen damit die Kaufmannstugenden der modernen Welt.<br />
Je mehr ein Land des Südens Waren in den Norden exportieren<br />
kann, desto schneller passt sich seine Kultur, passen sich seine<br />
Institutionen denjenigen des Nordens an, desto erfolgreicher<br />
ist es be<strong>im</strong> Wachstum des he<strong>im</strong>ischen Wohlstands.<br />
Paradebeispiele dieser Lehre bieten einige ostasiatische Staaten<br />
wie Japan, Südkorea, Taiwan, Malaysia, Thailand <strong>und</strong> vor allem<br />
auch die Volksrepublik China. Der rasante Wachstumsprozess<br />
dieses Riesenlandes <strong>im</strong> Verlauf der letzten 35 Jahre ist eines<br />
der erstaunlichsten Phänomene der Weltgeschichte. Im Jahre<br />
1980 lebten noch drei Viertel der Bürger Chinas unter der<br />
absoluten Armutsgrenze. Heute gibt es bei den Han-Chinesen<br />
wohl niemand mehr, der mit weniger als einem Dollar pro Tag<br />
<strong>und</strong> pro Kopf auskommen muss. China ist heute der größte<br />
Verbraucher fossiler Energien, der größte Pkw-Hersteller<br />
der Welt, das Land mit den weitaus meisten Ingenieuren. Es<br />
ist auch militärisch so stark, dass man es angesichts seiner<br />
wirtschaftlichen <strong>und</strong> rüstungsmäßigen Potenz als eine zweite<br />
Weltmacht neben den USA bezeichnen kann.<br />
In unserem Zusammenhang ist nun interessant, dass dieser<br />
stürmische chinesische Wachstumsprozess nicht etwa durch<br />
Kapitalhilfe der übrigen Welt zustande gekommen ist, sondern<br />
− <strong>im</strong> Gegenteil − durch hohe Exportüberschüsse. China hat<br />
16 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
seit den Neunzigerjahren des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts regelmäßig<br />
wertmäßig weit mehr exportiert als <strong>im</strong>portiert. Das bedeutet<br />
zugleich, dass China <strong>im</strong> Saldo Kapital exportiert <strong>und</strong> nicht<br />
<strong>im</strong>portiert hat. Die Zentralbank der Volksrepublik China ist<br />
der weitaus größte Eigentümer US-amerikanischer Staatsanleihen.<br />
Man kann sagen: China ist der wichtigste Finanzier der<br />
Haushaltsdefizite des US-amerikanischen B<strong>und</strong>esstaates. Oder<br />
auch: China ist der bedeutendste Finanzier des chronischen<br />
US-amerikanischen Importüberschusses, bedeutender als die<br />
reichen Ölstaaten vom persischen Golf.<br />
Heute können wir China zusammen mit den OECD-Ländern<br />
zum „Norden“ zählen. Auch seine Demografie ist der europäischer<br />
Staaten oder Japans ähnlicher als dem typischen Land<br />
aus dem Süden. Und so entsteht innerhalb dieses so abgegrenzten<br />
Nordens die scheinbar paradoxe Situation, dass das<br />
ärmste Mitglied, also China, dem reichsten <strong>und</strong> mächtigsten<br />
Mitglied, also den USA, viel Geld schickt; <strong>und</strong> das mit dem<br />
größten Vergnügen.<br />
Diese scheinbare Paradoxie löst sich auf, wenn man daran<br />
denkt, dass es genau der Export von Waren ist, der es China<br />
ermöglicht hat, den Vorsprung des Nordens stark zu verringern,<br />
wesentlich schneller wirtschaftlich zu wachsen als die<br />
Mitglieder des Clubs der Reichen. Es ist der Export, der die<br />
Transformation Chinas von einem rückständigen Reich der<br />
Kulturrevolution zu einem äußerst potenten Industriestaat<br />
bewirkt hat. Durch ihn vor allem sind die dafür notwendigen<br />
sozialen Lernprozesse in Gang gekommen. Nach der fatalen<br />
ersten Kulturrevolution Mao Tse Dungs sind wir nun Zeuge<br />
eines ganz anderen Kulturwandels, der, gestreckt über ein<br />
halbes Jahrh<strong>und</strong>ert, dem chinesischen Volk die Erfolgsgehe<strong>im</strong>isse<br />
der europäischen Moderne beschert. Im Zeitraffer<br />
vollzieht China hier nach, wozu Europa <strong>und</strong> Nordamerika<br />
zwei Jahrh<strong>und</strong>erte gebraucht haben. Dieser Prozess ist in<br />
China noch keineswegs abgeschlossen. Und man kann nicht<br />
ausschließen, dass er <strong>im</strong>mer noch scheitert oder doch noch<br />
einmal zurückgeworfen wird. Auch die Modernisierung eines<br />
Landes wie <strong>Deutschland</strong> ist in den letzten zwei Jahrh<strong>und</strong>erten<br />
nicht geradlinig verlaufen. Man denke nur an das „Dritte Reich“.<br />
Bewegung. Der Wahlkampf eines Donald Trump zentriert<br />
sich bei den Sachthemen genau um das Versprechen, die an<br />
Mexiko <strong>und</strong> China verlorenen Arbeitsplätze zurück in die<br />
USA zu holen. Die Volksabst<strong>im</strong>mung, die zum Brexit führte,<br />
war sehr stark durch protektionistische Emotionen geprägt.<br />
Es besteht gar kein Zweifel, dass <strong>im</strong> Norden einzelne Branchen<br />
durch die ost- <strong>und</strong> süd-ost-asiatische oder auch mexikanische<br />
Industrie-Konkurrenz massiv Arbeitsplätze eingebüßt haben.<br />
Davon sind zum Teil auch ganze Regionen betroffen. Die <strong>Global</strong>isierung<br />
mag auch dazu beigetragen haben, dass einfache<br />
Arbeit in den Ländern des Nordens schlechter entlohnt wird<br />
als sie ohne den Ausbau des internationalen Handels bezahlt<br />
worden wäre. Die Einkommensverteilung mag innerhalb der<br />
Staaten des Nordens wegen dieser <strong>Global</strong>isierung ungleicher<br />
geworden sein. Diese Aussage gilt jedoch nur für die „Pr<strong>im</strong>ärverteilung“<br />
der Einkommen, während sie nach Berücksichtigung<br />
der staatlichen Umverteilung zumindest in den europäischen<br />
Ländern nicht ungleicher geworden ist.<br />
Insgesamt war jedenfalls dieser <strong>Global</strong>isierungsprozess ein<br />
großer Erfolg für die Volkswirtschaften des Nordens. Länder<br />
wie <strong>Deutschland</strong>, die USA, Japan, die Schweiz, Schweden,<br />
Kanada haben ihr Sozialprodukt globalisierungsbedingt stark<br />
steigern können. Das liegt einerseits daran, dass die Schwellenländer<br />
kraft ihres Wachstums zu wichtigen Abnehmern<br />
von Hochqualitätsgütern wurden. Dazu gehören die Produkte<br />
des Silicon Valley, der pharmazeutischen Industrie, des gehobenen<br />
Maschinen- <strong>und</strong> Anlagenbaus, des gehobenen >><br />
Die Vor- <strong>und</strong> Nachteile für den Norden<br />
Die Transformation Chinas <strong>und</strong> überhaupt Ostasiens in die<br />
Moderne ist <strong>im</strong> Abendland mit gemischten Gefühlen aufgenommen<br />
worden. Neben der Genugtuung über den daran<br />
erneut sichtbar werdenden Erfolg des eigenen Modells, neben<br />
auch der Sympathie darüber, dass hier ein Teil der Menschheit<br />
die bittere Not hinter sich gelassen hat, gibt es eine markante<br />
Konkurrenzangst. Diese ist kein neues Phänomen. Schon Kaiser<br />
Wilhelm II sprach von der „Gelben Gefahr“. Aber richtig<br />
handgreiflich wurde sie erst in den letzten Jahrzehnten. In<br />
den Achtziger- <strong>und</strong> frühen Neunzigerjahren des zwanzigsten<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts war es die Japan-Phobie, die einen wichtigen<br />
Platz <strong>im</strong> öffentlichen Diskurs erhielt. Doch seitdem ist es die<br />
steigende Konkurrenzangst vor China, die ein Dauerthema der<br />
öffentlichen Debatte ist. Sie führt, wie gerade jüngste Ereignisse<br />
zeigen, zu einer stärker werdenden protektionistischen<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
17
Agenda<br />
Automobilbaus, der Versicherungswirtschaft, partiell des<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesens, der Vermögensverwaltung <strong>und</strong> anderer<br />
Branchen mehr.<br />
Darüber hinaus haben alle Länder des Nordens davon profitiert,<br />
dass die Schwellenländer zahlreiche Produkte sehr preiswert<br />
produzieren konnten. Das Faktum, dass man in <strong>Deutschland</strong><br />
als Sozialhilfeempfänger nicht an der Kleidung erkannt werden<br />
kann, verdankt man den günstigen Bekleidungs<strong>im</strong>porten aus<br />
China oder Bangladesch.<br />
Die Wirkung des Kapitalexports aus dem Süden in den<br />
Norden<br />
Schließlich ist der Wohlfahrtsgewinn nicht zu unterschätzen,<br />
der dem Norden dadurch zufiel, dass er <strong>im</strong> großen Stil Kapital<br />
aus China <strong>und</strong> anderen Schwellenländern zu günstigen Konditionen<br />
<strong>im</strong>portieren konnte. Die Wohnungsversorgung in der<br />
reichen Welt hat sehr davon profitiert, dass die Kreditzinsen<br />
wesentlich niedriger liegen als früher. Und dies ist nicht zuletzt<br />
Folge davon, dass die Bewohner Chinas heute <strong>im</strong> großen Stil<br />
sparen <strong>und</strong> ihre Sachwalter auf dem Weltkapitalmarkt nach<br />
Anlagemöglichkeiten dieser Ersparnisse suchen. Die „Sparschwemme“,<br />
die wir seit einiger Zeit konstatieren können,<br />
rührt nicht zuletzt auch daher.<br />
Natürlich ging dieser <strong>Global</strong>isierungsprozess nicht reibungslos<br />
vonstatten. Immer wieder entstanden Krisen, die schließlich<br />
in der weltweiten Finanzkrise seit 2008 kulminierten.<br />
Hier ist nicht der Ort für eine genaue Ursachenanalyse der<br />
Finanzkrise. Nur so viel: sie ist in ihrer Schwere <strong>und</strong> Länge<br />
ganz wesentlich dadurch erklärbar, dass die meisten Köpfe<br />
die Bewegungsgesetze dieses <strong>Global</strong>isierungsprozesses noch<br />
nicht erfasst haben. Daher tut man sich zum Beispiel auch so<br />
schwer mit dem fortdauernden Nullzinsphänomen, das ich<br />
pr<strong>im</strong>är als durchaus positiv zu beurteilende Begleiterscheinung<br />
der <strong>Global</strong>isierung <strong>und</strong> ihrer demografischen Folgen<br />
interpretiere. Als Kontrast denke man nur an den hypothetischen<br />
Fall, dass Chinas Bevölkerung aus Armutsgründen<br />
so wachsen würde wie die Afrikas. Die daraus resultierende<br />
Entwicklung für die Weltbevölkerung wäre katastrophal für<br />
die Stabilität des Erfolgsmodells des Nordens. Aber je mehr<br />
Länder den demografischen Übergang („demographic transition“),<br />
wie jetzt China, beendet haben, desto stärker wird<br />
die „Sparschwemme“ werden. Es wird also gerade der Erfolg<br />
des <strong>Global</strong>isierungsprozesses mitsamt seinen demografischen<br />
Wirkungen sein, der zu niedrigen Zinsen führt, mit denen<br />
der Finanzsektor <strong>und</strong> die gesamtwirtschaftliche Steuerung<br />
fertig werden müssen.<br />
Der Handel als die Schule der Moderne<br />
Wenn China <strong>und</strong> überhaupt Ostasien als Vorbild dienen können,<br />
dann sollte die „Leistung“ des Nordens für den Süden darin<br />
bestehen, dass man die Süd-Exporte von Industriewaren <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen bewusst fördert, dass man diesen Export als<br />
Schule der Moderne kräftiger macht, um so den Wanderungsdruck<br />
aus dem Süden in den Norden abzubauen. Die Waren<br />
sollen wandern, nicht die Menschen.<br />
Diese Schule der Moderne kann insbesondere durch zwei<br />
Maßnahmen des Nordens gedeihen. Erstens: Abbau von Handelshemmnissen<br />
für Waren, die <strong>im</strong> Süden hergestellt <strong>und</strong> <strong>im</strong><br />
Norden verbraucht werden. Zweitens: ein für den Export aus<br />
dem Süden günstiger Wechselkurs zwischen der „Währung“<br />
des Nordens <strong>und</strong> der des Südens. Eine derartige Politik des<br />
Nordens kann <strong>und</strong> sollte <strong>im</strong> Süden zu einem Überschuss der<br />
wertmäßigen Exporte über den wertmäßigen Importen führen.<br />
Denen steht spiegelbildlich <strong>im</strong> Norden ein Überschuss<br />
der wertmäßigen Importe über den wertmäßigen Exporten<br />
gegenüber. Indem der Norden sich großzügig als Absatzgebiet<br />
für südliche Waren <strong>und</strong> Dienstleistungen zur Verfügung stellt,<br />
schafft er indirekt Arbeitsplätze <strong>im</strong> Süden, trägt er zur Prosperität<br />
<strong>im</strong> Süden bei. Das ist die für den Süden selbst voreilhafte<br />
Wanderungsbremse. Diese aber muss vital <strong>im</strong> Interesse des<br />
Nordens sein, wenn er seine materiell so erfolgreiche Kultur<br />
aufrechterhalten will.<br />
18 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
In diesem kurzen Abriss kann ich auf Details nicht eingehen.<br />
Es kommt mir hier auf den Gr<strong>und</strong>gedanken an. Nicht die<br />
Kapitalentwicklungshilfe des Nordens ist der richtige Weg,<br />
sondern quasi sein Gegenteil: die Öffnung der Märkte des<br />
Nordens für den Süden, der damit seinen Vorteil niedriger<br />
Löhne ausspielen kann <strong>und</strong> <strong>im</strong> Verlauf die Erfolgskultur des<br />
Nordens von seinen nördlichen K<strong>und</strong>en lernt.<br />
Wie schon <strong>im</strong> Falle Chinas oben gezeigt, würde der Norden von<br />
einem solchen Politikwechsel profitieren, selbst wenn man den<br />
Effekt der Wanderungsbremse nicht in Rechnung stellt: zwar<br />
würden in einigen Branchen Arbeitsplätze wegfallen; jedoch<br />
würden andere entstehen, solange der Norden durch eine geeignete<br />
„<strong>Global</strong>steuerung“ dafür sorgt, dass Vollbeschäftigung<br />
bestehen bleibt. Der mit dem Importüberschuss einhergehende<br />
Kapital<strong>im</strong>port aus dem Süden hätte einen zins-senkenden Effekt<br />
auf dem Kapitalmarkt. Sofern die Zinsen nicht weiter sinken<br />
können, weil sie schon bei null angekommen sind, kann sich<br />
der Staat quasi kostenlos zusätzlich verschulden, um auf diese<br />
Weise der Sparschwemme entgegen zu wirken <strong>und</strong> durch seine<br />
schuldenfinanzierte Nachfrage nach Waren <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
für Vollbeschäftigung zu sorgen. Diese Staatsverschuldung<br />
ist kostenlos, weil der Fiskus auf seine Staatsschulden keine<br />
Zinsen zahlen muss, da ja voraussetzungsgemäß die Kapitalmarktzinsen<br />
bei null liegen. Die Steuern können bei gegebenen<br />
Staatsausgaben gesenkt werden, weil der Staat einen Teil der<br />
Steuereinnahmen durch fortdauernde Nettoneuverschuldung<br />
ersetzen kann. Diese Nettoneuverschuldung zum Zins null<br />
dient somit einerseits dazu, den Wohlstandsgewinn des Nordens<br />
aus einer solchen Politik durch Aufrechterhaltung der<br />
Vollbeschäftigung Realität werden zu lassen; er dient andererseits<br />
dazu, dem aus dem Süden hereinfließenden Kapital eine<br />
Anlagemöglichkeit zu schaffen.<br />
Der wichtigste Gr<strong>und</strong> für diesen Politikschwenk ist allerdings<br />
die damit einhergehende Beschleunigung des Wachstums <strong>im</strong><br />
Süden − mit der für den Norden bedeutsamen Einrichtung<br />
einer Wanderungsbremse, soweit es die Wanderung vom<br />
Süden in den Norden betrifft.<br />
Natürlich sind nicht alle Staaten des Südens in gleicher Weise<br />
darauf vorbereitet, auf den Märkten des Nordens konkurrenzfähig<br />
zu sein. Einige Länder wie zum Beispiel Indien, Bangladesch,<br />
Brasilien, Mexiko, Vietnam, Ägypten mögen in der Lage sein,<br />
von den geöffneten Toren des Nordens gewinnbringenden<br />
Gebrauch zu machen. Andere Staaten, geplagt von Bürgerkrieg<br />
oder völlig rückständigen Machteliten, mögen hier <strong>im</strong><br />
Vergleich weiter zurückfallen. Das aber ist kein Einwand gegen<br />
eine solche Politik. Im Gegenteil, je zahlreicher die Beispiele<br />
erfolgreicher Nutzung eines freien Marktzugangs sind, desto<br />
stärker werden auch in den rückständigen Ländern die Kräfte<br />
werden, die auf Reform <strong>im</strong> Interesse höherer Konkurrenzfähigkeit<br />
drängen. Erfolg wirkt ansteckend.<br />
Zur Person<br />
Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker ist Fachmann für theoretische<br />
Fragen der Volkswirtschaftslehre, der Wettbewerbs<strong>und</strong><br />
Energiepolitik. Seit seiner Emeritierung 2003 ist er Senior<br />
Research Fellow am interdisziplinär ausgerichteten Max-Planck-<br />
Institut zur Erforschung der Gemeinschaftsgüter in Bonn.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
19
Agenda<br />
<strong>Migration</strong> <strong>und</strong> <strong>Flucht</strong><br />
in Zeiten der <strong>Global</strong>isierung<br />
Gegenwärtig versucht die Politik <strong>im</strong>mer intensiver, eine klare Grenze zwischen „Flüchtling“ (auf<br />
der Suche nach Schutz) <strong>und</strong> „Migrant“ (auf der Suche nach sozio-ökonomischer Verbesserung) zu<br />
ziehen. In der Praxis ist eine Trennungslinie aber alles andere als klar.<br />
20 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
Von Dr. Pedro Morazán <strong>und</strong> Katharina Mauz<br />
In der gesellschaftlichen Debatte wird von <strong>Migration</strong> sehr<br />
häufig als „Problem“ gesprochen, das schnell politisch gelöst<br />
werden müsse. Reflexartig wird für strengere Grenzkontrollen<br />
<strong>und</strong> gar für eine Sicherung bzw. Schließung von Grenzen<br />
plädiert − wenn nötig auch mit „Schießbefehl“. Übersehen<br />
wird allerdings, dass <strong>Migration</strong> Teil eines breiteren <strong>und</strong> weltweiten<br />
Prozesses von Entwicklung, <strong>Global</strong>isierung <strong>und</strong> sozialer<br />
Transformation ist, welcher die Menschheit seit Jahrh<strong>und</strong>erten<br />
begleitet <strong>und</strong> auch künftig begleiten wird.<br />
Die Ursachen von <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Mobilität sind nicht eind<strong>im</strong>ensional.<br />
Es wäre zu kurz gegriffen, Armut oder <strong>Global</strong>isierung<br />
als die einzigen <strong>Migration</strong>sursachen zu betrachten. Es<br />
gibt Umstände in den Herkunftsländern, die Auswanderung<br />
auslösen − sogenannte Abstoßkräfte (push factors). Dazu gehören<br />
ethnische oder religiöse Diskr<strong>im</strong>inierung ebenso wie<br />
schlechte Arbeitsbedingungen <strong>und</strong> Armut. Das allein erklärt<br />
aber nicht die Entscheidungen der Menschen auszuwandern.<br />
Anziehungskräfte der Zielländer (pull factors), wie höhere Löhne,<br />
Bedarf an saisonalen Arbeitskräften in der Landwirtschaft oder<br />
<strong>im</strong> Pflegebereich sowie an hochqualifizierten Fachkräften <strong>im</strong><br />
IT-Bereich, beeinflussen ebenfalls die <strong>Migration</strong>.<br />
<strong>Migration</strong> ist nicht gleich <strong>Migration</strong><br />
Das Zusammenwirken verschiedener Faktoren wie Wohlstand,<br />
geographische Nachbarschaft, Transportverbesserungen oder<br />
plötzliche Ereignisse schaffen die Bedingungen <strong>und</strong> das Umfeld,<br />
in dem Menschen die Entscheidung zwischen Gehen<br />
oder Bleiben treffen − dies sind die Motive oder Ursachen der<br />
<strong>Migration</strong>. Insgesamt sechs Tendenzen der <strong>Migration</strong> werden<br />
in der <strong>Migration</strong>sforschung identifiziert:<br />
• Erstens die <strong>Global</strong>isierung der <strong>Migration</strong>, d. h. <strong>im</strong>mer mehr<br />
Länder weltweit sind von der <strong>Migration</strong> betroffen.<br />
• Zweitens der Richtungswechsel der <strong>Migration</strong>sbewegungen,<br />
d. h. die Süd-Nord-<strong>Migration</strong> ist heute stärker als die<br />
Nord-Süd-<strong>Migration</strong> der Vergangenheit (von Europa nach<br />
Argentinien, Australien etc.).<br />
• Drittens die Differenzierung der <strong>Migration</strong>, d. h. die meisten<br />
Länder haben mit verschiedenen <strong>Migration</strong>sformen zu tun.<br />
• Viertens die Proliferation von <strong>Migration</strong>sübergängen, d. h.<br />
viele Auswanderungsländer werden zunehmend zu Einwanderungsländern.<br />
• An fünfter Stelle die Feminisierung der Arbeitsmigration,<br />
d. h. anders als in der Vergangenheit sind es heute in zahlreichen<br />
<strong>Migration</strong>sbewegungen mehrheitlich Frauen, die<br />
ihre He<strong>im</strong>atländer verlassen.<br />
• Und sechstens die steigende Politisierung von <strong>Migration</strong>,<br />
d. h. <strong>Migration</strong> best<strong>im</strong>mt <strong>im</strong>mer mehr die Innen-, Außen<strong>und</strong><br />
Entwicklungspolitik der beteiligten Länder.<br />
Ursachen:<br />
1) <strong>Global</strong>e Ungleichheit<br />
Während sogenannte Wirtschaftsmigranten − per Definition<br />
− ihr <strong>Migration</strong>sziel hinsichtlich eines höheren Beschäftigungseinkommens<br />
wählen, geht es bei den politischen Flüchtlingen<br />
in erster Linie darum, ihr Leben zu retten <strong>und</strong> sich in<br />
Sicherheit zu bringen. Die sogenannten Wirtschaftsmigranten<br />
hoffen, in den Zielländern mit besseren Arbeitsbedingungen<br />
<strong>und</strong> angemessenerer Entlohnung ihr Wohlstandsniveau verbessern<br />
zu können. Es muss allerdings festgehalten werden,<br />
dass auch politische Flüchtlinge eher in Ländern mit geringer<br />
Arbeitslosigkeit, wie <strong>Deutschland</strong>, Österreich oder Schweden,<br />
Schutz suchen als in Ländern mit Beschäftigungsproblemen,<br />
wie Griechenland oder vielen osteuropäischen Ländern.<br />
Die Verbindung zwischen <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Beschäftigung ist<br />
inzwischen als entscheidend für Armutsbekämpfung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
anerkannt. Die Lohndisparitäten zwischen reichen,<br />
entwickelten Industrieländern <strong>und</strong> Entwicklungs- bzw. Schwellenländern<br />
sind groß <strong>und</strong> haben in den letzten Jahren der<br />
Wirtschaftskrise weiter zugenommen. Der Durchschnittslohn<br />
lag 2013 in den entwickelten Ländern bei 3.000 US-Dollar − pro<br />
Monat gemessen in Kaufkraftparität − verglichen mit einem<br />
Durchschnittslohn von 1.000 US-Dollar in Schwellen- <strong>und</strong> Entwicklungsländern.<br />
Der US-amerikanische Durchschnittslohn<br />
ist mehr als dre<strong>im</strong>al so hoch wie der chinesische Durchschnittslohn.<br />
Zwar ist der Lohnunterschied zwischen beiden Ländern<br />
leicht zurückgegangen, die Arbeitsbedingungen haben sich<br />
allerdings nicht verbessert.<br />
2) Kl<strong>im</strong>awandel <strong>und</strong> Umweltzerstörung<br />
Insbesondere in armen Entwicklungsländern hat der Kl<strong>im</strong>awandel<br />
zu einer signifikanten Steigerung von <strong>Migration</strong> <strong>und</strong><br />
Umsiedlung geführt. Zwischen 2008 <strong>und</strong> 2013 mussten weltweit<br />
ca. 165 Millionen Menschen wegen durch den Kl<strong>im</strong>awandel<br />
bedingte Naturkatastrophen ihre He<strong>im</strong>at verlassen. Jedoch<br />
nicht <strong>im</strong>mer haben sogenannte Umweltflüchtlinge die Möglichkeit,<br />
frei darüber zu entscheiden, ob sie migrieren oder<br />
bleiben. Diese Entscheidungen hängen von den Umständen ab,<br />
unter denen Menschen von Umweltereignissen betroffen sind.<br />
Opfer von schweren Naturkatastrophen oder Enteignungen<br />
haben kaum die Kontrolle darüber, wie <strong>und</strong> wann sie ihren<br />
angestammten Wohnsitz verlassen <strong>und</strong> wo sie Schutz suchen<br />
können. Für die Bewohner vieler Regionen in Entwicklungsländern<br />
ist <strong>Migration</strong> der einzige Ausweg, sich an >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
21
Agenda<br />
schwerwiegende Umweltveränderungen, beispielsweise Dürren<br />
oder Überschwemmungen, anzupassen. Wenn Menschen ihre<br />
He<strong>im</strong>at aufgr<strong>und</strong> der unmittelbaren Folgen des Kl<strong>im</strong>awandels<br />
verlassen, dann bewegen sie sich meist innerhalb ihrer<br />
He<strong>im</strong>atländer oder zwischen den Nachbarländern. Man spricht<br />
deshalb auch von „trapped populations“ [„gefangene Bevölkerung“].<br />
Nichtsdestotrotz ist die zunehmende <strong>Migration</strong> aus<br />
Afrika über das Mittelmeer nach Europa unter anderem auch<br />
eine Folge von tiefgreifenden Umweltveränderungen in der<br />
Sahelregion <strong>und</strong> Subsahara-Afrika. Die Menschen sehen sich<br />
zu <strong>Migration</strong> gezwungen, weil sie sich nicht mehr ernähren<br />
können <strong>und</strong> deshalb ihr Überleben nicht mehr gewährleistet ist.<br />
Die wirtschaftlichen <strong>und</strong> politischen Folgen von kl<strong>im</strong>atisch<br />
bedingten Umweltveränderungen sind schwerwiegender als<br />
angenommen. Ein Beispiel ist der Krieg in Syrien, der als Folge<br />
einer ganzen Reihe von ineinandergreifenden Entwicklungen<br />
zu sehen ist. Im <strong>Fokus</strong> der Öffentlichkeit stand zwar der Protest<br />
gegen das Al Asad-Reg<strong>im</strong>e, aber neben den bekannten religiösen,<br />
ethnischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Hintergründen spielten<br />
auch Umweltfaktoren eine nicht zu unterschätzende Rolle.<br />
3) Krieg <strong>und</strong> Gewalt<br />
Ein Großteil der Flüchtlinge kommt aus fragilen Staaten,<br />
Kriegsgebieten <strong>und</strong> Konfliktregionen. Die meisten von ihnen<br />
bleiben in ihrer Region, da sie sich die Reise nach Europa,<br />
bei der sie möglicherweise auf Schlepper angewiesen wären,<br />
finanziell nicht leisten können. Gegenwärtig sind es besonders<br />
Syrer <strong>und</strong> Eritreer, die flüchten müssen <strong>und</strong> in einem anderen<br />
Land, beispielsweise in <strong>Deutschland</strong>, Schutz suchen. In fragi-<br />
Fragiles Afrika<br />
Bis 2030 wird die Anzahl der Menschen, die in Trockengebieten<br />
in Westafrika leben, um 65 bis 80 Prozent steigen, so die<br />
Schätzungen der Weltbank. Alarmierend ist auch, dass infolge<br />
des Kl<strong>im</strong>awandels der Anteil der Fläche, die als Trockenland<br />
eingestuft wird, um mindestens 20 Prozent wachsen wird.<br />
Der Zwang zur <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Vertreibungen werden in Afrika<br />
zunehmen. Besonders stark betroffen sind mehr als 300<br />
Millionen Menschen, die in Trockengebieten <strong>im</strong> Westen <strong>und</strong><br />
Osten Afrikas leben.<br />
In Westafrika sprechen US-amerikanische <strong>Migration</strong>sforscher<br />
von einem Spannungsbogen (arc of tension), der das Zusammenwirken<br />
zwischen Kl<strong>im</strong>awandel, politischer Instabilität <strong>und</strong><br />
<strong>Migration</strong> entlang der vier Länder Nigeria, Niger, Algerien <strong>und</strong><br />
Marokko beschreibt. Diese vier Länder, teilweise verb<strong>und</strong>en<br />
durch die Sahara, wurden von Sicherheitsexperten bisher<br />
eher selten als eine geopolitische Konfliktregion angesehen.<br />
Erst durch die neue <strong>Migration</strong>skrise versteht man allmählich,<br />
dass der Kl<strong>im</strong>awandel Auslöser für weitere Krisen ist. Es ist<br />
abzusehen, dass sich der Verteilungskampf um <strong>im</strong>mer knapper<br />
werdende Ressourcen in Zukunft zuspitzen wird.<br />
22 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
Die wirtschaftlichen <strong>und</strong> politischen Folgen<br />
von kl<strong>im</strong>atisch bedingten Umweltveränderungen<br />
sind schwerwiegender als angenommen.<br />
len Staaten können in Teilen des Landes oder <strong>im</strong> gesamten<br />
Staatsgebiet die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet <strong>und</strong><br />
Bildung, Ges<strong>und</strong>heit, wirtschaftliche Entwicklungschancen,<br />
Rechtsordnung <strong>und</strong> -sprechung sowie Umweltschutz nicht<br />
bereitgestellt werden. F<strong>und</strong>amentale Infrastruktur oder Kommunikationseinrichtungen<br />
fehlen. In diesem Vakuum übernehmen<br />
Guerilla- <strong>und</strong> Rebellenbewegungen, Stammesfürsten,<br />
Warlords, religiöse Führer oder Dorfälteste die Macht. Kurz:<br />
Offizielle Strukturen werden zunehmend unterwandert <strong>und</strong><br />
ausgehöhlt <strong>und</strong> der Prozess des Zerfalls schreitet voran.<br />
Rücküberweisungen<br />
Die zehn Länder, die am meisten<br />
von Rücküberweisungen profitieren<br />
(als Anteil des BIP 2014)<br />
47,2 %<br />
29,2 %<br />
25 %<br />
Tadschikistan<br />
Kirgisistan<br />
Lesotho<br />
Lange Zeit wurde die Bedeutung von Rücküberweisungen als<br />
wichtiger Entwicklungsfaktor in Rahmen der <strong>Migration</strong>sforschung<br />
verkannt. Dies hat sich geändert, seit der wirtschaftliche<br />
Gewinn deutlich geworden ist, den die Herkunftsländer<br />
aus dem Geldtransfer erzielen, welchen Migranten von ihren<br />
neuen Standorten aus veranlassen. Im Jahr 2015 betrug der<br />
Wert von Rücküberweisungen in Entwicklungsländer 432<br />
Milliarden US-Dollar. Außerdem spielen Rücküberweisungen<br />
eine große Rolle für die Privathaushalte in den Herkunftsländern,<br />
eröffnen neue Bildungschancen, verringern die Armut<br />
<strong>und</strong> führen zu Verbesserungen in der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung.<br />
<strong>Migration</strong> bietet somit Potenziale für die Herkunftsländer<br />
der Migranten <strong>und</strong> fördert dort die lokale Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Infrastruktur.<br />
Der Zusammenhang zwischen Rücküberweisungen <strong>und</strong> sogenanntem<br />
„brain drain“ (Abwanderung von qualifizierten<br />
Arbeitskräften) kann jedoch auch negative Auswirkungen<br />
auf die Herkunftsländer haben. Qualifizierte Arbeitskräfte<br />
verlassen ihre Herkunftsländer <strong>im</strong> <strong>Global</strong>en Süden <strong>und</strong> hinterlassen<br />
eine entscheidende Lücke, die sich negativ auf den<br />
Transformationsprozess dieser Länder auswirkt.<br />
Bisher sind die Rücküberweisungen von Industrieländern in<br />
die Herkunftsländer der Migranten recht kostspielig. Durchschnittlich<br />
acht Prozent des Transferbetrags wird von der<br />
Bank einbehalten. Möchte man Geld in die Subsahara-Region<br />
verschicken, kann das sogar bis zu zwölf Prozent des Betrags<br />
kosten. Die Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development<br />
Goals, SDG) <strong>und</strong> der <strong>im</strong> November 2015 von der<br />
EU verabschiedete Notfall-Treuhandfonds für Afrika sehen<br />
vor, die Kosten für Rücküberweisungen bis 2030 auf mindestens<br />
drei Prozent <strong>und</strong> max<strong>im</strong>al fünf Prozent zu senken.<br />
23,7 %<br />
Moldawien<br />
23,7 %<br />
Nepal<br />
23,4 %<br />
Liberia<br />
22,6 %<br />
Samoa<br />
20,5 %<br />
Haiti<br />
Info<br />
Quelle: DAC Statistik<br />
<strong>und</strong> Worldbank 2014<br />
18,6 %<br />
18,5 %<br />
Westjordanland<br />
<strong>und</strong> Gazastreifen<br />
Armenien<br />
Weitere <strong>und</strong> vertiefende Informationen finden Sie in der Südwind-<br />
Studie „<strong>Migration</strong> <strong>und</strong> <strong>Flucht</strong> in Zeiten der <strong>Global</strong>isierung. Die<br />
Zusammenhänge zwischen <strong>Migration</strong>, globaler Ungleichheit <strong>und</strong><br />
Entwicklung“, Bonn <strong>2016</strong>.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
23
Agenda<br />
Die Agenda 2030<br />
<strong>im</strong> Kontext von <strong>Migration</strong><br />
Von Marlehn Thieme<br />
Das Thema <strong>Flucht</strong> <strong>und</strong> <strong>Migration</strong> hat die deutsche, europäische<br />
<strong>und</strong> internationale Politik auch <strong>2016</strong> deutlich geprägt <strong>und</strong> Spuren<br />
hinterlassen. Anfang Mai präsentierte der Generalsekretär<br />
der Vereinten Nationen (VN) − <strong>und</strong> diesjährige Gewinner des<br />
deutschen Nachhaltigkeitspreises − Ban Ki-moon einen viel<br />
beachteten Bericht zur Lage der Migranten <strong>und</strong> Flüchtlinge<br />
weltweit („In Safety and dignity“). Darin fordert er die internationale<br />
Staatengemeinschaft auf, den effektiven Schutz <strong>und</strong><br />
die rechtlichen Rahmenbedingungen der Flüchtenden wie<br />
auch Migrantinnen <strong>und</strong> Migranten zu verbessern. Gleichzeitig<br />
warnt er vor Rassismus <strong>und</strong> Xenophobie. Wenige Monate<br />
nach Erscheinen des Berichts trafen am 19. September <strong>2016</strong><br />
erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen Staats- <strong>und</strong><br />
Regierungschefs aus aller Welt zu einem <strong>Migration</strong>sgipfel zusammen.<br />
In der abschließenden New York Erklärung stießen<br />
sie Aushandlungsprozesse für zwei globale Pakte an: Einen für<br />
Flüchtlinge <strong>und</strong> einen weiteren Pakt für sichere, geordnete <strong>und</strong><br />
reguläre <strong>Migration</strong>. Beide sollen bis 2018 verabschiedet werden.<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die neuen Pakte ist auch das Versprechen der<br />
Agenda 2030, „niemanden zurückzulassen“ <strong>und</strong> die Zielvorgabe,<br />
„eine geordnete, sichere, reguläre <strong>und</strong> verantwortungsvolle<br />
<strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Mobilität von Menschen zu erleichtern“. Die<br />
Agenda 2030 hat den Anspruch, die Lebensbedingungen <strong>und</strong><br />
die Lebensqualität der Menschen weltweit zu verbessern. Für<br />
die gelebte Realität wird die Umsetzung dieser Absichten<br />
vor Ort entscheidend sein. Hoffnung gibt die Agenda 2030<br />
für nachhaltige Entwicklung durch ihre festgeschriebene<br />
Erkenntnis der Interdependenz aller Staaten dieser Welt <strong>und</strong><br />
der Notwendigkeit eines ganzheitlichen Governance-Ansatzes.<br />
Politisch gesehen befindet sich die Weltgemeinschaft bezüglich<br />
<strong>Flucht</strong> <strong>und</strong> <strong>Migration</strong> in einem Lernprozess. Mehr<br />
denn je wird den Menschen bewusst, wie wichtig es ist, über<br />
Fach- <strong>und</strong> Ländergrenzen hinweg voneinander zu lernen <strong>und</strong><br />
miteinander zu arbeiten, um Lösungsansätze für gemeinsame<br />
Herausforderungen zu entwickeln.<br />
24 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
Im Jahr <strong>2016</strong> sind 65 Millionen Menschen auf der <strong>Flucht</strong> − so viele waren es zuletzt während<br />
des 2. Weltkrieges. Nur die wenigsten von ihnen kommen nach Europa: Zwei Drittel der Geflüchteten<br />
bleiben <strong>im</strong> eigenen Land, viele andere zieht es in angrenzende Staaten. So leben insgesamt<br />
86 Prozent der Flüchtlinge in Entwicklungsländern, während die sechs größten Volkswirtschaften<br />
weniger als neun Prozent aufgenommen haben. Was die Geflüchteten kurzfristig brauchen,<br />
sind Nahrung <strong>und</strong> Schutz vor Witterung. Mittelfristig gilt es, die notwendige Infrastruktur aufzubauen<br />
<strong>und</strong> Bildungs- sowie Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. Langfristig benötigen die<br />
Flüchtlinge eine Perspektive <strong>und</strong> nachhaltige Entwicklung.<br />
Von der Entwicklungszusammenarbeit zum<br />
ganzheitlichen Governance-Ansatz<br />
Die zunehmenden globalen Herausforderungen betreffen<br />
auch das Entwicklungsressort, dessen Bedeutung innerhalb<br />
der Gesellschaft durch die weltweite Flüchtlingskrise zugenommen<br />
hat. Zur <strong>Flucht</strong>ursachenbekämpfung werden daher<br />
erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt. Mit<br />
dem Regierungsentwurf für 2017 haben sich die Ausgaben<br />
in den Politikbereichen Entwicklungszusammenarbeit <strong>und</strong><br />
Auswärtiges seit Beginn der Legislaturperiode 2013 um mehr<br />
als 30 Prozent auf 13 Milliarden Euro erhöht.<br />
Alleine werden diese Ressorts die Herausforderungen allerdings<br />
nicht bewältigen können. So herrscht, verstärkt durch die<br />
Verabschiedung der Agenda 2030, in der klassischen, ODAfinanzierten<br />
Entwicklungszusammenarbeit seit längerem<br />
eine gewisse Orientierungslosigkeit. Neben den klassischen<br />
Anfang Mai präsentierte der Generalsekretär der<br />
Vereinten Nationen (VN) − <strong>und</strong> diesjährige Gewinner<br />
des deutschen Nachhaltigkeitspreises − Ban Ki-moon<br />
einen viel beachteten Bericht zur Lage der Migranten<br />
<strong>und</strong> Flüchtlinge weltweit („In Safety and dignity“)<br />
Nord-Süd-Beziehungen wurden etwa Süd-Süd <strong>und</strong> / oder trilaterale<br />
Partnerschaften <strong>im</strong>mer wichtiger. Viele ehemalige<br />
Entwicklungsländer treten mittlerweile selber als Geber auf.<br />
Durch die zunehmende Komplexität der Herausforderungen<br />
verliert die Entwicklungspolitik ihre Exklusivität für <strong>im</strong><br />
Ausland unterstützte Entwicklungsprozesse. Eine kohärente<br />
Vorgehensweise wird damit erschwert, bleibt aber mehr als<br />
zuvor notwendig. >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
25
Agenda<br />
Wie schwierig dies mitunter sein kann, zeigt sich seit längerer<br />
Zeit an der Schnittstelle von Entwicklungszusammenarbeit<br />
<strong>und</strong> humanitärer Hilfe. Wann handelt es sich (nur) um eine<br />
kurzfristige Notsituation, <strong>und</strong> wann ist eine gegebenenfalls<br />
jahrzehntelange Unterstützung in einem Land nötig? Der<br />
Kl<strong>im</strong>awandel verschärft die Notwendigkeit, beides zusammen<br />
zu denken: Zunehmende Naturkatastrophen erfordern eine<br />
kurzfristige emergency response, langfristig aber müssen die<br />
Länder bei der Anpassung an den Kl<strong>im</strong>awandel unterstützt<br />
werden. Durch den transformativen Charakter der Agenda<br />
2030 kommt hinzu, dass nun alle Länder zu Entwicklungsländern<br />
werden. Für den Erfolg sind alle Ressorts gleichermaßen<br />
verantwortlich.<br />
auszutauschen, neue Perspektiven <strong>und</strong> Lösungsansätze kennenzulernen,<br />
handlungsorientierte Netzwerke zu knüpfen<br />
<strong>und</strong> sich gegenseitig zu inspirieren <strong>und</strong> zu motivieren.<br />
Die Rolle der Privatwirtschaft<br />
Die Politik alleine wird die Umsetzung der SDGs nicht bewältigen<br />
können. Schon vor ihrer Verabschiedung diskutierten daher<br />
<strong>im</strong> Juli 2015 in Addis Abeba <strong>im</strong> Rahmen der dritten internationalen<br />
Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung Experten<br />
aus aller Welt über Möglichkeiten, die Privatwirtschaft stärker<br />
als bislang in die Verantwortung zu nehmen. So gilt es, zur<br />
Verbesserung der Situation in den Ländern des globalen Südens<br />
Open SDGclub.Berlin<br />
Um sich über die in der Agenda 2030 festgelegten Ziele <strong>und</strong><br />
die Erfahrungen in der bisherigen Umsetzung auszutauschen,<br />
organisierte der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) <strong>im</strong> Jahr<br />
<strong>2016</strong> den Open SDGclub.Berlin. Geladen waren Akteure, die in<br />
ihrem jeweiligen Kontext für die Umsetzung der Agenda 2030<br />
zuständig sind <strong>und</strong> / oder dafür werben. Angesprochen waren<br />
vor allem Vertreter von Nachhaltigkeitsräten <strong>und</strong> ähnlicher<br />
Multi-Stakeholder-Einrichtungen <strong>und</strong> zivilgesellschaftliche<br />
Netzwerker auf unterschiedlichen Handlungsebenen.<br />
Die Open-SDGclub.Berlin-Teilnehmenden kamen aus über<br />
zwanzig verschiedenen Ländern, viele davon aus Ländern, die<br />
<strong>2016</strong> be<strong>im</strong> High Level Political Forum (HLPF) berichtet haben<br />
oder vorhaben, dies 2017 zu tun. Der Open SDGclub.Berlin<br />
stellte eine Gelegenheit dar, sich aus unterschiedlichsten<br />
Erfahrungshorizonten heraus über Umsetzungserfahrungen<br />
die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort zu fördern. Ebenso<br />
wichtig ist jedoch, dass sich international tätige Unternehmen<br />
ihrer Verantwortung stellen <strong>und</strong> transparent handeln.<br />
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat deshalb bereits 2011<br />
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (Sustainability Code) eingeführt,<br />
durch den die Mindeststandards der B<strong>und</strong>esregierung<br />
<strong>und</strong> Europäischen Kommission anerkannt <strong>und</strong> in praktisches<br />
Handeln umgesetzt werden. Mit dem Transparenzstandard<br />
können Unternehmen von ihrem jeweiligen Standpunkt aus<br />
ihre Nachhaltigkeitsleistungen beschreiben <strong>und</strong> aufzeigen, wo<br />
sie derzeit <strong>im</strong> Prozess hin zu einem integrierten Nachhaltigkeitsmanagement<br />
stehen. Beispiele hierfür sind die Verknüpfung<br />
von Nachhaltigkeitskriterien in der Managementvergütung; der<br />
Anteil des Gesamtumsatzes, der in Forschung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
für Nachhaltigkeitsprodukte <strong>und</strong> Dienstleistungen investiert<br />
wird <strong>und</strong> wie viele Gelder ein Unternehmen in Betriebsrenten<br />
u. ä. anlegt.<br />
26 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
Gleichzeitig bietet ihnen der Kodex Ansatzpunkte für weitere<br />
ökologische <strong>und</strong> soziale Verbesserungen. Damit werden<br />
die Unternehmen zur lernenden Organisation <strong>und</strong><br />
glaubwürdiger. Dazu gehört auch, Schwachstellen in den<br />
Lieferketten aufzuzeigen: Hochglanzberichte, die nur die<br />
erste Stufe der Lieferkette aufzeigen, aber keine tieferen<br />
Einblicke in ihre Produktionsabläufe gewähren, sind nicht<br />
zielführend. Wenn Unternehmen, die mit ihrer Nachhaltigkeit<br />
werben, aufgr<strong>und</strong> von Profitstreben nicht für<br />
Nachhaltigkeit <strong>und</strong> die Beachtung der Menschenrechte<br />
entlang ihrer Lieferkette einstehen, ist dies unaufrichtig.<br />
Sorgfaltspflicht sollte das Gebot der St<strong>und</strong>e sein. Transparenz<br />
ist die Voraussetzung für Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> Vertrauen.<br />
ihre gesamte Arbeit an der 2030-Agenda auszurichten. Die<br />
Aufgabe der anstehenden deutschen Präsidentschaft wird<br />
nun sein, diesen umzusetzen.<br />
Vom 21. bis 23. November <strong>2016</strong> lud der Rat für Nachhaltige<br />
Entwicklung erstmalig zum „Open SDGclub.Berlin“ ein.<br />
Auf der internationalen Konferenz ging es um erste Erfahrungen<br />
mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen.<br />
Nach der wirtschaftlichen <strong>und</strong> informationellen <strong>Global</strong>isierung<br />
brauchen wir nun eine soziale <strong>Global</strong>isierung <strong>und</strong> eine<br />
weltweit stärkere Beachtung der Menschenrechte. Menschenrechtsverletzungen<br />
sind nach der Reduktion von Treibhausgasen<br />
das nächste Hochrisikothema (Divestment) für zahlreiche<br />
Investoren. Bei soft commodities wie beispielsweise Palmöl<br />
ziehen sich bereits große institutionelle Investoren zurück,<br />
wenn ihre Investitionen mit Menschenrechtsrisiken behaftet<br />
sind. Auf dem Markt der Zukunft wird daher nur bestehen,<br />
wer Nachhaltigkeitsthemen frühzeitig erkennt, angeht <strong>und</strong><br />
offenlegt.<br />
Die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien in der gesamten<br />
Lieferkette wird international zunehmend relevanter <strong>und</strong> soll<br />
auch eines der Themen der Deutschen G20-Präsidentschaft<br />
sein. Be<strong>im</strong> Gipfeltreffen in Hangzhou, China, hatten die G20-<br />
Staats- <strong>und</strong> Regierungschefs bereits einen G20-Aktionsplan<br />
zur 2030-Agenda vereinbart, mit dem sie sich verpflichten,<br />
Über die Autorin<br />
Marlehn Thieme ist seit 2003 Mitglied des<br />
Rates der Evangelischen Kirche in <strong>Deutschland</strong><br />
<strong>und</strong> seit 2004 Mitglied <strong>im</strong> Rat für Nachhaltige<br />
Entwicklung. Seit 2012 ist sie die Vorsitzende<br />
des Rates. Von 1986 bis Ende 2013 arbeitete die<br />
Juristin bei der Deutsche Bank AG als Direktorin<br />
<strong>im</strong> Bereich Corporate Social Responsibility <strong>und</strong><br />
als Mitglied des Aufsichtsrates. Marlehn Thieme<br />
ist Aufsichtsratsvorsitzende der Bank für Kirche<br />
<strong>und</strong> Diakonie (KD-Bank) <strong>und</strong> Vorsitzende des<br />
ZDF-Fernsehrates.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
27
Agenda<br />
Flüchtlingshilfe<br />
von Firmen<br />
Die Flüchtlingshilfe war <strong>und</strong> ist bis heute vielfältig. Neben den unzähligen freiwilligen Helfern<br />
sind es vor allem Firmen, die spenden <strong>und</strong> Jobperspektiven geben. Einen Überblick gibt eine<br />
Studie der Bertelsmann Stiftung.<br />
Die aktuellen Flüchtlingszuströme haben in <strong>Deutschland</strong><br />
eine Welle der Hilfsbereitschaft mobilisiert. Viele Privatpersonen<br />
engagieren sich in Organisationen oder mit Sach- <strong>und</strong><br />
Geldspenden. Diese Hilfsbereitschaft zeigt sich auch bei<br />
Unternehmen: Ein großer Teil setzt sich für die direkte Unterstützung<br />
von Flüchtlingen ein. 74 Prozent der befragten<br />
Unternehmen geben mindestens eine Maßnahme an, mit der<br />
sie zur Flüchtlingshilfe beitragen. Die meisten engagieren sich<br />
mit unterschiedlichen Maßnahmen: Von sieben möglichen<br />
Tätigkeiten gaben die Unternehmen durchschnittlich 2,3 Betätigungsfelder<br />
an. Dieses Engagement erfolgt am häufigsten<br />
in Form von Sachspenden. Die Hälfte der Unternehmen unterstützt<br />
die Flüchtlinge durch die Bereitstellung materieller Güter.<br />
Besonders Dienstleistungsunternehmen wählen diese Form<br />
der Hilfsleistung: Der Anteil der Dienstleistungsunternehmen<br />
mit 250 bis 499 Mitarbeitern, die Sachspenden bereitstellen,<br />
Direkte Unterstützung von Flüchtlingen in Prozent nach Mitarbeiterzahl <strong>und</strong> Branche<br />
Praktikumsplätzen<br />
62,2<br />
Ausbildungsplätzen<br />
48,3<br />
Arbeitsplätzen<br />
47,4<br />
Berufsvorbereitungsmaßnahmen<br />
40,2<br />
Berufsbegleitenden Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungen<br />
34,3<br />
Berufsinformationsveranstaltungen<br />
32,7<br />
Sprachkursen<br />
29,8<br />
Mentoring / Coachingprogrammen<br />
26,7<br />
Sonstigen Angeboten<br />
13,5<br />
Studienstipendien<br />
6,1<br />
Quelle: Bertelsmann Stiftung / IW Consult <strong>2016</strong>; n = 279 | Frage, nur den Unternehmen gestellt, die angegeben haben, Flüchlinge mindestens in geringem<br />
Maße bei der Arbeitsintegration zu unterstützen: „Unterstützt Ihr Unternehmen Flüchtlinge bei der Arbeitsmarktintegration durch das zusätzliche Angebot von ...?“<br />
28 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
liegt mit 50 Prozent gut neun Prozentpunkte höher als der<br />
Anteil der Betriebe aus dem Verarbeitenden Gewerbe <strong>und</strong><br />
Baugewerbe derselben Größenklasse. Ab einer Größe von<br />
über 500 Beschäftigten gibt es hier keinen nennenswerten<br />
Unterschied mehr zwischen den Branchen.<br />
Ein ebenfalls hoher Teil von Unternehmen gibt an, unternehmenseigene<br />
Kompetenzen zur Flüchtlingshilfe bereitzustellen.<br />
Das wäre bei kleineren Unternehmen etwa der Fall, wenn ein<br />
ortsansässiges Fotostudio die Flüchtlinge mit Passfotos bei<br />
der Beantragung von Genehmigungen oder Ausweispapieren<br />
unterstützt oder eine Fahrradwerkstatt bei der Reparatur oder<br />
Montage von Fahrrädern hilft. Dadurch wird die direkte Hilfe<br />
besonders effizient. Auch bei dieser Maßnahme ist der Anteil<br />
an Dienstleistungsunternehmen höher als <strong>im</strong> Verarbeitenden<br />
Gewerbe <strong>und</strong> Baugewerbe.<br />
genannt. Auch behördliche Restriktionen, die der gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
Bereitschaft zum Engagement entgegenstehen, werden<br />
thematisiert: „Wir würden uns gerne in der Flüchtlingsintegration<br />
engagieren, haben aber noch keine Möglichkeiten,<br />
da diese [Flüchtlinge] erst nach einer längeren Zeit arbeiten<br />
dürfen.“ Daher ist zu erwarten, dass sowohl aufgr<strong>und</strong> der<br />
steigenden Zahl von Arbeitserlaubnissen als auch aufgr<strong>und</strong> der<br />
Umsetzung von Maßnahmen, die gerade in Planung sind oder<br />
angeschoben werden, sich künftig noch mehr Unternehmen<br />
für die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen einsetzen.<br />
Darauf weisen auch Umfragen zu den künftigen Plänen der<br />
Unternehmen hin. >><br />
Auffällig ist jedoch, dass kein merklicher Unterschied zwischen<br />
der Größe der Unternehmen besteht. Während sich bei den<br />
meisten anderen Maßnahmen verstärkt große Unternehmen<br />
mit über 500 Mitarbeitern engagieren, ist der Unterschied bei<br />
der Einbringung unternehmenseigener Kompetenzen geringer.<br />
Im Verarbeitenden Gewerbe <strong>und</strong> Baugewerbe engagieren sich<br />
in diesem Bereich mit 33 Prozent die kleineren Betriebe sogar<br />
leicht mehr als die großen Betriebe der Branche mit 31 Prozent.<br />
Neben Geldspenden, die r<strong>und</strong> 36 Prozent der Unternehmen<br />
aufbringen, stellen jeweils ein Drittel der befragten Unternehmen<br />
Infrastruktur bereit oder Mitarbeiter für ehrenamtliches<br />
Engagement frei. Mit der Organisation von Informations- oder<br />
Begegnungsveranstaltungen engagiert sich ein geringerer<br />
Anteil von jeweils knapp einem Fünftel.<br />
Arbeitsmarktintegration<br />
Im Bereich der Arbeitsmarktintegration engagieren sich deutlich<br />
weniger Unternehmen als in der direkten Hilfe. R<strong>und</strong><br />
die Hälfte der befragten Unternehmen gibt an, Flüchtlinge<br />
oder Asylberechtigte aktuell mindestens in geringem Maße<br />
bei der Arbeitsmarktintegration zu unterstützen. Knapp ein<br />
Viertel setzt sich in mittlerem oder hohem Maße dafür ein,<br />
ein weiteres Viertel in geringem Maße. Auffällig ist, dass<br />
es be<strong>im</strong> Ausmaß dieses Engagements kaum Unterschiede<br />
zwischen den Branchen gibt. Größere Unternehmen engagieren<br />
sich jedoch erwartungsgemäß zu einem höheren<br />
Anteil als kleinere.<br />
In der aktuellen Debatte wird häufig auf die Faktoren hingewiesen,<br />
die das Engagement bei der Integration von Flüchtlingen<br />
auf dem Arbeitsmarkt erschweren. Vor allem mangelnde<br />
Sprachkenntnisse, fehlende Qualifikationen oder Informationen<br />
darüber sowie aufenthaltsrechtliche Restriktionen<br />
erschweren die Einstellung von Flüchtlingen − selbst dann,<br />
wenn diese von beiden Seiten gewünscht ist. Anmerkungen<br />
aus der Unternehmensbefragung geben ebenfalls Hinweise<br />
auf derartige Restriktionen. Unter anderem werden die jetzt<br />
erst anlaufenden Maßnahmen, die mangelnden rechtlichen<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> fehlende Unterstützung für Unternehmen<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
29
Agenda<br />
Dieses Engagement kann durch verschiedene Maßnahmen<br />
erfolgen. Aktuell engagierte Unternehmen bieten meistens<br />
Praktika an. Von den Unternehmen, die sich mindestens in<br />
geringem Maße für die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen<br />
engagieren, stellen 62 Prozent zusätzliche Praktikumsplätze<br />
zur Verfügung. Knapp die Hälfte bietet zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze an. Damit scheint ein Schwerpunkt des<br />
Engagements die Unterstützung junger beziehungsweise<br />
ungelernter Flüchtlingen zu sein. 47 Prozent engagieren<br />
sich jedoch auch durch das zusätzliche Angebot von Arbeitsplätzen.<br />
Der Anteil von Dienstleistungsunternehmen, die<br />
zusätzliche Arbeitsplätze anbieten, liegt mit 51 Prozent um<br />
zehn Prozentpunkte höher als der der Betriebe des Verarbeitenden<br />
Gewerbes <strong>und</strong> Baugewerbes. Jeweils ungefähr ein<br />
Drittel der Unternehmen unterstützen Flüchtlinge durch<br />
berufsbegleitende Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungen sowie durch<br />
Berufsinformationsveranstaltungen.<br />
Aus der Praxis<br />
Motive<br />
Die Integration von Menschen mit Behinderung, Menschen<br />
mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> älteren Arbeitnehmern in die<br />
Belegschaft kann für Unternehmen eine Möglichkeit darstellen,<br />
auf den demografischen Wandel <strong>und</strong> gesellschaftliche Veränderungsprozesse<br />
zu reagieren. Unternehmen können durch eine<br />
erfolgreiche Integration dieser Personen auf einen größeren<br />
Bewerberpool zurückgreifen <strong>und</strong> die Kompetenzvielfalt der<br />
Belegschaft erhöhen. Gleichzeitig fördert die Berücksichtigung<br />
von Gruppen mit erschwerten Zugangsvoraussetzungen zum<br />
Arbeitsmarkt die Chancengleichheit <strong>und</strong> kann damit zur<br />
Verringerung der sozialen Ungleichheit beitragen.<br />
Umfragen zeigen, dass Unternehmen, die Maßnahmen <strong>im</strong><br />
Diversitäts- <strong>und</strong> Integrationsmanagement durchführen, zwei<br />
Hauptmotive haben. Sie wollen zum einen ihr Rekrutierungspotenzial<br />
erhöhen, indem sie Personengruppen gezielt<br />
ansprechen, <strong>und</strong> gleichzeitig ihr Arbeitgeber<strong>im</strong>age verbessern.<br />
Damit ist der Fachkräfte- beziehungsweise Bewerbermangel für<br />
72 Prozent der Unternehmen ein wichtiger Beweggr<strong>und</strong>. Zum<br />
anderen wollen viele Unternehmen durch die Maßnahmen<br />
das Know-how <strong>und</strong> die Arbeitsprozesse verbessern. 65 Prozent<br />
versprechen sich von einer multikulturellen Belegschaft mehr<br />
Kreativität, Innovationskraft <strong>und</strong> Wissensvielfalt. Diversität<br />
als Mittel zur internationalen Reputation <strong>und</strong> zum verbesserten<br />
Marktzutritt erhofft sich mit jeweils etwa 40 Prozent ein<br />
weitaus geringerer Anteil von Unternehmen.<br />
Eines der wichtigsten Elemente in der<br />
Flüchtlingshilfe ist Geduld: Es wird nicht<br />
alles auf Anhieb klappen. Die Integration<br />
der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ist<br />
ressourcen- <strong>und</strong> betreuungsintensiv.<br />
Es braucht Zeit, um eine neue Sprache<br />
zu lernen <strong>und</strong> sich auf dem deutschen<br />
Arbeitsmarkt sowie in den Unternehmen<br />
inklusive der jeweiligen Unternehmenskultur<br />
zurechtzufinden. Da es gut<br />
ein Jahr oder auch länger dauern kann,<br />
bis Asylverfahren <strong>und</strong> Integrationskurs<br />
abgeschlossen sind, ist es sinnvoll,<br />
Qualifizierungsmaßnahmen <strong>und</strong> Berufsorientierung<br />
bereits währenddessen<br />
anzubieten.<br />
Allerdings hat dieses Motiv für Betriebe des Verarbeitenden<br />
Gewerbes <strong>und</strong> des Baugewerbes eine größere Bedeutung als<br />
für Dienstleistungsunternehmen.<br />
Mehr zum Thema<br />
Weitere Informationen finden Sie in der Bertelsmann Studie<br />
„Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen angesichts<br />
neuer Herausforderungen <strong>und</strong> Megatrends“.<br />
30 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Praxisbeispiele<br />
Berufsvorbereitung <strong>und</strong> Berufseinstieg<br />
„Gemeinsam handeln!“ − dieser Name ist Programm: Gemeinsam<br />
mit zahlreichen Partnern hat Deutsche Post DHL Group ein<br />
deutschlandweit koordiniertes Projekt ins Leben gerufen, um<br />
in der Flüchtlingskrise nachhaltige <strong>und</strong> langfristige Unterstützung<br />
zu bieten. Das Projekt fußt auf der Expertise anerkannter<br />
Organisationen <strong>und</strong> konzentriert sich darauf, das gesellschaftliche<br />
Engagement der Mitarbeiter zu fördern <strong>und</strong> zu stärken,<br />
Flüchtlingen eine berufliche Orientierung zu ermöglichen<br />
sowie B<strong>und</strong>, Länder <strong>und</strong> Kommunen zu unterstützen. Der<br />
Startschuss fiel <strong>im</strong> September 2015. Zu Beginn war besonders<br />
eine schnelle, unbürokratische <strong>und</strong> effektive Unterstützung<br />
gefordert: Die Gr<strong>und</strong>bedürfnisse der Geflüchteten − Unterkunft,<br />
medizinische Versorgung, Unterstützung bei der Asylbürokratie<br />
sowie Beschulung − standen <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>. Mittlerweile<br />
fördert Deutsche Post DHL Group die Integration durch gezielte<br />
Unterstützung des Spracherwerbs <strong>und</strong> der Berufsvorbereitung.<br />
Um zielgerichtet helfen zu können, hat das Unternehmen ein<br />
b<strong>und</strong>esweites Netzwerk aus 100 Koordinatoren in den Niederlassungen<br />
aufgebaut. Diese haben die Aufgabe, gemeinsam<br />
mit den beteiligten Hilfsorganisationen in ganz <strong>Deutschland</strong>,<br />
jeweils auf lokaler Ebene zu unterstützende Projekte zu identifizieren<br />
<strong>und</strong> zu betreuen. Sie dienen auch den Mitarbeitern<br />
als Ansprechpartner vor Ort.<br />
>><br />
Praktikum statt Krieg <strong>und</strong> Terror<br />
Von der Westküste Afrikas an die Ruhr:<br />
Im Briefzentrum Essen absolviert derzeit<br />
Mamadou Diallo ein Praktikum<br />
<strong>im</strong> Bereich Briefsortierung. Seit zwei<br />
Jahren lebt der Flüchtling aus Guinea<br />
in <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> bekommt nun bei<br />
der Deutschen Post DHL Group die<br />
Chance, wertvolle Qualifikationen für<br />
das Berufsleben zu erwerben − sei es<br />
in Europa oder Afrika.<br />
Für <strong>Deutschland</strong>s größtes Logistikunternehmen<br />
ist es eine Selbstverständlichkeit,<br />
Menschen in Notsituationen zu helfen.<br />
„Wir nehmen, als einer der größten Arbeitgeber<br />
Europas, unsere gesellschaftliche<br />
Verantwortung außerordentlich<br />
ernst“, erklärt Karl-Heinz Behrens. Er<br />
ist Niederlassungsleiter der Deutschen<br />
Post in Essen. „Die Flüchtlingshilfe ist ein<br />
konkretes Beispiel dafür, dass wir bei dem<br />
Thema Unternehmensverantwortung<br />
zwar langfristig denken <strong>und</strong> planen, aber<br />
auch in der Lage sind, uns kurzfristig auf<br />
gesellschaftliche Herausforderungen<br />
einzustellen.“<br />
Mamadou Diallo <strong>und</strong> die vielen Menschen,<br />
die genau wie er auf der <strong>Flucht</strong> vor Krieg<br />
<strong>und</strong> Terror in <strong>Deutschland</strong> Asyl gef<strong>und</strong>en<br />
haben, werden von der Deutschen Post<br />
umfassend unterstützt. Spracherwerb<br />
<strong>und</strong> berufliche Qualifikation steht <strong>im</strong><br />
Mittelpunkt des Praktikumsprogramms<br />
für Flüchtlinge, für die das Unternehmen<br />
deutschlandweit 1.000 Plätze geschaffen<br />
hat. Die Praktikanten aus den Krisengebieten<br />
erleben so einen ersten Blick in<br />
das Logistikunternehmen − wie es auch<br />
viele deutsche Praktikanten erstmals<br />
kennenlernen. Sollte sich am Ende eines<br />
Praktikums der Wunsch nach einem<br />
Ausbildungsplatz ergeben, ist dies ganz<br />
<strong>im</strong> Sinne der Post. „Im Praktikum kann<br />
ich mich über den Arbeitsalltag <strong>und</strong> die<br />
Möglichkeiten bei der Post genau informieren“,<br />
bestätigt Mamadou Diallo.<br />
R<strong>und</strong> 100 Mitarbeiter wurden als Praktikumskoordinatoren<br />
für die Menschen aus<br />
Afrika <strong>und</strong> dem Nahen Osten qualifiziert.<br />
Sie sind die Schnittstelle zwischen den<br />
Postbeschäftigten <strong>und</strong> den humanitären<br />
Stellen, die Menschen auf der <strong>Flucht</strong><br />
versorgen. R<strong>und</strong> eine Million Euro stellt<br />
die Deutsche Post <strong>im</strong> ersten Jahr des<br />
Projekts für die Flüchtlingshilfe vor Ort<br />
zur Verfügung.<br />
Im Unternehmen trifft das Engagement<br />
auf breite Zust<strong>im</strong>mung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
durch die Mitarbeiter. R<strong>und</strong> 10.000<br />
Mitarbeiter setzen sich deutschlandweit<br />
ehrenamtlich für unterschiedliche<br />
Flüchtlingsprojekte ein <strong>und</strong> organisieren<br />
beispielsweise Sachspenden oder Freizeitaktivitäten<br />
für die Menschen in Not.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
31
Praxisbeispiele<br />
Berufsvorbereitung <strong>und</strong> Berufseinstieg<br />
Das Familienunternehmen Bahlsen bietet Flüchtlingen in<br />
seinen Standorten Praktikumsplätze <strong>und</strong> eröffnet berufliche<br />
Chancen. Ziel ist es, den Menschen nach Monaten der Ungewissheit<br />
wieder eine Perspektive zu geben <strong>und</strong> sie dabei zu<br />
unterstützen, in ihrer neuen He<strong>im</strong>at beruflich Fuß zu fassen.<br />
Mitarbeiter von Bahlsen sind in die Initiative eingeb<strong>und</strong>en. Sie<br />
begleiten Flüchtlinge durchs Unternehmen <strong>und</strong> arbeiten eng<br />
mit ihnen zusammen. Be<strong>im</strong> Einsatz <strong>im</strong> Schichtbetrieb wird<br />
auf die besonderen Rahmenbedingungen der Flüchtlinge (z. B.<br />
durch eingeschränkte Mobilität) Rücksicht genommen. Soweit<br />
möglich werden die Flüchtlinge nach ihrem Praktikum an das<br />
Unternehmen Bahlsen geb<strong>und</strong>en.<br />
Da<strong>im</strong>ler hat <strong>im</strong> ersten Halbjahr <strong>2016</strong> r<strong>und</strong> 300 Flüchtlingen<br />
ein sogenanntes Brückenpraktikum angeboten. Im Spätsommer<br />
<strong>2016</strong> begann die zweite Welle dieser Brückenpraktika<br />
in einer ähnlichen Größenordnung. Darüber hinaus hat<br />
das Unternehmen noch weitere Praktikumsplätze vergeben,<br />
Ausbildungsplätze geschaffen <strong>und</strong> Flüchtlinge fest eingestellt.<br />
Die Flüchtlinge erlernen <strong>im</strong> Brückenpraktikum praktische<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse zur Arbeit in der Industrieproduktion <strong>und</strong><br />
besuchen täglich einen Deutschkurs. Die Sprachkurse zielen<br />
auch darauf ab, den Teilnehmern in der deutschen Arbeitswelt<br />
weiterzuhelfen. So werden zusammen Bewerbungsunterlagen<br />
erstellt <strong>und</strong> Vorstellungsgespräche auf Deutsch trainiert. Die<br />
B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit finanziert die ersten sechs Wochen<br />
des Brückenpraktikums. In den restlichen Wochen vergütet<br />
Da<strong>im</strong>ler die Arbeitszeit auf Basis des Mindestlohngesetzes.<br />
die eine Willkommenskultur für Geflüchtete in <strong>Deutschland</strong><br />
stärken. Die Think-Big-Projekte helfen beispielsweise dabei,<br />
zwischen Behörden <strong>und</strong> Flüchtlingen zu vermitteln, Begegnungen<br />
zu ermöglichen <strong>und</strong> Zugang zu Freizeitaktivitäten zu<br />
schaffen. Telefónica-Mitarbeiter unterstützen einige Projekte<br />
als ehrenamtliche Paten.<br />
Die Commerzbank setzt sich ein, um jungen, nach <strong>Deutschland</strong><br />
geflohenen Menschen den Start ins Berufsleben zu erleichtern:<br />
In den kommenden drei Jahren unterstützt das Finanzinstitut<br />
den Auf- <strong>und</strong> Ausbau von „Kompass“ − dem neuen Programm<br />
von „Joblinge“ zur Integration von jungen Flüchtlingen in den<br />
ersten Arbeitsmarkt. Seit 2007 engagiert sich „Joblinge“, um<br />
Jugendlichen mit schwierigen Startbedingungen eine tatsächliche<br />
<strong>und</strong> qualifizierte Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt<br />
zu ermöglichen. „Joblinge“ wurde hierfür schon 2014 von der<br />
<strong>Deutschland</strong>stiftung Integration ausgezeichnet. „Kompass“<br />
richtet sich gezielt an die zahlenmäßig größte Gruppe der nach<br />
<strong>Deutschland</strong> geflüchteten Menschen: Jugendliche zwischen<br />
18 <strong>und</strong> 25 Jahren mit niedriger bis mittlerer Qualifikation. In<br />
dem neuen Programm wird insbesondere auf die Aktivierung<br />
des Selbsthilfepotenzials <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Stärkung<br />
der Selbstbest<strong>im</strong>mung Wert gelegt. Ehrenamtliche geschulte<br />
Mentoren stehen den jungen Menschen für die Gesamtdauer<br />
des Projekts von r<strong>und</strong> einem Jahr zur Seite. Neben sprachlicher<br />
<strong>und</strong> beruflicher Qualifizierung n<strong>im</strong>mt die Sensibilisierung für<br />
interkulturelle Belange einen großen Raum ein.<br />
Tchibo <strong>und</strong> seine Mitarbeiter engagieren sich in Hamburg <strong>und</strong><br />
b<strong>und</strong>esweit mit Corporate-Volunteering-Maßnahmen, Beschäftigungsangeboten<br />
sowie Sachspenden für die Integration von<br />
Geflüchteten. Die Tchibo Patenschaft für Geflüchtete setzt drei<br />
Schwerpunkte: Kooperationen <strong>und</strong> Corporate Volunteering,<br />
Beschäftigung sowie bedarfsgerechte Sachspenden. Auf dieser<br />
Basis setzt Tchibo nun ein langfristiges Corporate-Volunteering-Programm<br />
auf. Angedacht sind Kooperationen mit einer<br />
Erstaufnahmeeinrichtung sowie einer Schule in Hamburg.<br />
Projekt- <strong>und</strong> Abteilungsteams können hier Teamtage vor Ort<br />
durchführen. Darüber hinaus haben Tchibo-Mitarbeiter die<br />
Möglichkeit, ehrenamtlich als Mentor zu fungieren.<br />
Das Ziel von Telefónica <strong>Deutschland</strong> ist, Flüchtlingen bei der<br />
Integration zu helfen. Ein wichtiger Ansatzpunkt dafür ist das<br />
erfolgreiche Jugendprogramm „Think Big“, in dem engagierte<br />
Jugendliche zwischen 14 <strong>und</strong> 25 Jahren eigene soziale <strong>und</strong><br />
digitale Projektideen verwirklichen <strong>und</strong> dabei mit fachlichem<br />
Coaching <strong>und</strong> finanziellen Mitteln unterstützt werden. Mit<br />
der Patenschaft ermöglicht Telefónica auch Jugendprojekte,<br />
Corporate-Volunteering-Programm bei Tchibo<br />
32 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Ausbildung <strong>und</strong> Arbeit<br />
Die Deutsche Bahn baut ihr Engagement zur Integration von<br />
Flüchtlingen aus. In den Jahren 2017 <strong>und</strong> 2018 werden 150<br />
zusätzliche Plätze in den Qualifizierungsprogrammen der DB<br />
angeboten. Sie kommen zu den insgesamt r<strong>und</strong> 120 Flüchtlingen<br />
hinzu, die <strong>2016</strong> bei der DB qualifiziert wurden. Ziel der<br />
DB ist es, die Flüchtlinge mit zertifizierten Qualifizierungen<br />
nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Schon<br />
seit Ende 2015 hat die DB erfolgreich Qualifizierungsprogramme<br />
angeschoben. Bei „Chance plus für Flüchtlinge“ werden<br />
junge Leute über mehrere Monate fit für eine Ausbildung<br />
gemacht, die „Umschulung für Flüchtlinge“ zum Elektroniker<br />
für Betriebstechnik in München dauert bis zu 28 Monate <strong>und</strong><br />
richtet sich an Berufserfahrene. Beide Programme beinhalten<br />
intensive Sprachkurse.<br />
Flüchtlingen in Ausbildung <strong>und</strong> Arbeit. Damit das Programm<br />
die Teilnehmer bestmöglich unterstützen kann, werden die<br />
angebotenen Praktika <strong>und</strong> Ausbildungsplätze u.a. durch<br />
interkulturelle Trainings, ein Mentoring- <strong>und</strong> Patensystem<br />
sowie eine psychologische Hotline begleitet. >><br />
McDonald’s setzt sich zum Ziel, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt<br />
zu integrieren. Seit Beginn des Zustroms Anfang 2015 haben<br />
McDonald’s <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> seine Franchise-Partner über<br />
900 Flüchtlingen ein Beschäftigungsverhältnis ermöglicht.<br />
Ende 2015 hat man in Kooperation mit der B<strong>und</strong>esagentur für<br />
Arbeit (BA) <strong>im</strong> Rahmen eines Pilotprojekts in den Restaurants<br />
Bewerbertage speziell für Flüchtlinge durchgeführt. Daraus ist<br />
ein Leitfaden entstanden, der das Einstellen von Flüchtlingen<br />
in die Restaurants deutschlandweit <strong>und</strong> die Abst<strong>im</strong>mung mit<br />
den Behörden erleichtern soll.<br />
thyssenkrupp hat das Programm „we help“ <strong>im</strong> September 2015<br />
ins Leben gerufen, um zusätzliche 150 Ausbildungsplätze <strong>und</strong><br />
230 Praktikumsplätze für Flüchtlinge zu schaffen. Das Unternehmen<br />
möchte damit einen Beitrag leisten, den Flüchtlingen<br />
die Integration zu erleichtern <strong>und</strong> ihnen die Möglichkeit zu<br />
geben, sich aus eigener Kraft ein Leben in <strong>Deutschland</strong> aufzubauen.<br />
Das zunächst auf zwei Jahre angelegte Programm<br />
„we help“ wird vom Gesamtkonzern <strong>und</strong> dem Engagement<br />
seiner Mitarbeiter getragen, die sich vor Ort als Ausbilder,<br />
Integrationshelfer <strong>und</strong> Mentoren um die Integration der<br />
Flüchtlinge in den Betriebsablauf <strong>und</strong> das Miteinander mit<br />
den Kollegen kümmern.<br />
Wie gut das gelingt, zeigt das Beispiel von Amanuel aus Eritrea,<br />
der seit Kurzem eine Ausbildung bei thyssenkrupp macht.<br />
Gemeinsam mit vielen anderen bereits eingestellten jungen<br />
Zuwanderern profitiert er von den professionellen Ausbildungsmöglichkeiten<br />
des Konzerns sowie von der toleranten,<br />
multinationalen Atmosphäre unter den Kollegen. Die Ausbildungs-<br />
<strong>und</strong> Praktikumsplätze werden sowohl <strong>im</strong> gewerblichen<br />
als auch <strong>im</strong> kaufmännischen Bereich an unterschiedlichen<br />
Standorten von thyssenkrupp in <strong>Deutschland</strong> geschaffen. Im<br />
Mittelpunkt des Programms „we help“ steht die Integration von<br />
thyssenkrupp-Auszubildender Amanuel aus Eritrea<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
33
Praxisbeispiele<br />
Bürgerschaftliches Engagement<br />
Für das „Ankommen“ in <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> die Integration in<br />
den Arbeitsmarkt werden gute Deutschkenntnisse benötigt.<br />
Daher unterstützt Innogy Flüchtlinge durch Dolmetschertätigkeit<br />
<strong>und</strong> be<strong>im</strong> Erlernen der deutschen Sprache. Konkret stellt<br />
Innogy bis Ende 2017 mindestens 15 Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />
Mitarbeiter für Dolmetschertätigkeiten zur Verfügung, um<br />
arabisch-, französisch- <strong>und</strong> englischsprachige Flüchtlinge zu<br />
unterstützen. Zusätzlich bietet Innogy in Kooperation mit der<br />
Caritas Essen Sprachkurse für mindestens 60 Flüchtlinge für<br />
das Jahr <strong>2016</strong> an. Bis zu 20 Flüchtlinge drücken bei Innogy<br />
zwe<strong>im</strong>al in der Woche die Schulbank <strong>und</strong> lernen Deutsch.<br />
Insgesamt meldeten sich mehr als 70 Mitarbeiter. Die Kurse<br />
finden während der Arbeitszeit in Räumen der Innogy SE statt.<br />
So unterstützt der Vorstand das ehrenamtliche Engagement<br />
der Mitarbeiter. Den ersten erfolgreichen Pilot-Kurs gab es<br />
bereits von Februar bis April. Auch die Innogy-Kollegen lernen<br />
bei den Sprachkursen dazu. So erweitern sie zum Beispiel ihr<br />
interkulturelles Wissen, üben Moderationstechniken <strong>und</strong><br />
freies Sprechen − <strong>und</strong> nebenbei erfahren sie viel Herzlichkeit.<br />
Die Integration von Flüchtlingen gehen der FC <strong>und</strong> die Stiftung<br />
1. FC Köln sportlich an. Fußball ist die ideale Sportart,<br />
um Menschen jeden Alters, jeder Nation <strong>und</strong> jeder Religion<br />
zusammenzuführen. Fußball verbindet Menschen, Fußball<br />
ist international. Sprachbarrieren spielen bei diesem Sport<br />
keine Rolle. Seit Herbst 2015 ermöglicht die FC-Stiftung ein<br />
wöchentliches Training für Flüchtlingskinder zwischen acht<br />
<strong>und</strong> 14 Jahren. Bei den Einheiten zeigen bis zu 15 Kinder<br />
aus der Flüchtlingsunterkunft Neusser Straße ihr fußballerisches<br />
Können. Sie kicken gemeinsam mit Kindern des<br />
CfB Ford-Niehl, einem Partnerverein des 1. FC Köln. So wurden<br />
zahlreiche neue Fre<strong>und</strong>schaften geknüpft, die den Start in ein<br />
neues Leben in Köln vereinfacht haben.<br />
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) steht bei der Betreuung von<br />
Flüchtlingen vor gewaltigen Herausforderungen. Deshalb stellt<br />
die Stiftung der Airbus Group dem DRK auf unbest<strong>im</strong>mte Zeit<br />
eine mobile Ges<strong>und</strong>heitsstation für die medizinische Versorgung<br />
von Flüchtlingen zur Verfügung. Mit der Übergabe der<br />
mobilen Ges<strong>und</strong>heitsstation soll die medizinische Versorgung<br />
von 5.000 Flüchtlingen <strong>im</strong> niederbayerischen Feldkirchen<br />
gewährleistet <strong>und</strong> entscheidend verbessert werden. Das DRK<br />
kann hierdurch die gesamte medizinische Palette anbieten<br />
− von der Behandlung kleinerer Verletzungen bis zur notfallmedizinischen<br />
Versorgung. Die mobile Ges<strong>und</strong>heitsstation<br />
kann bei Bedarf an anderen Orten aufgestellt werden − national<br />
sowie international.<br />
Vissmanns unterstützt die Renovierung <strong>und</strong> Ausstattung des<br />
Flüchtlingshe<strong>im</strong>s in Battenberg. Die ersten Erfahrungen sind<br />
sehr positiv. Die Flüchtlinge sind überaus motiviert <strong>und</strong> die<br />
Vissmann Mitarbeiter engagieren sich mit großem Einsatz bei<br />
der Betreuung. Insgesamt sieht man in der Region sowohl bei<br />
den Menschen als auch bei den Unternehmen eine hohe Bereitschaft,<br />
die Menschen, die zu uns kommen, zu unterstützen<br />
<strong>und</strong> möglichst schnell zu integrieren.<br />
Mit verschiedenen Projekten engagiert sich VAUDE gemeinsam<br />
mit seinen Mitarbeitern für die Integration von Flüchtlingen.<br />
Dabei spielt für den Hersteller von Outdoor-Artikeln<br />
auch der Sport eine wichtige Rolle. So können Flüchtlinge<br />
an vielfältigen Sportkursen teilnehmen, die <strong>im</strong> Rahmen des<br />
betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsmanagements bei VAUDE angeboten<br />
werden. Dazu gehören beispielsweise auch Kletterkurse<br />
an der betriebseigenen Kletterwand. Ein weiteres konkretes<br />
Projekt: Gemeinsam mit Flüchtlingen werden in der VAUDE<br />
Fertigung am Firmenstandort in Tettnang nachhaltige Taschen<br />
aus Stanzresten gemeinnützig produziert. Auf diese Weise<br />
bietet das Unternehmen Zuwanderern eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit<br />
bei der sie gleichzeitig erste Erfahrungen<br />
<strong>im</strong> deutschen Arbeitsalltag sammeln können. Darüber hinaus<br />
organisiert der Outdoor-Ausstatter in diesem Jahr einen Tag<br />
der offenen Tür speziell für Flüchtlinge. Hierbei erfahren sie<br />
nicht nur, welche Arbeitsbereiche <strong>und</strong> Stellen es bei VAUDE<br />
gibt, sondern können auch an Bewerbungstrainings teilnehmen<br />
sowie bei Führungen den Arbeitsalltag kennenlernen.<br />
Quelle<br />
Eigene Beiträge <strong>und</strong> Beispiele von „Wir-Zusammen. Initiative<br />
der deutschen Wirtschaft zur Unterstützung der Integration von<br />
Flüchtlingen in <strong>Deutschland</strong>.“<br />
34 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
Teilhabe <strong>und</strong> Integration<br />
Was kann die schulische Bildung beitragen?<br />
<strong>Deutschland</strong> ist <strong>und</strong> bleibt ein Einwanderungsland. In diesem Kontext führen chancengleiche<br />
Bildung <strong>und</strong> Teilhabe nicht nur zu individuellen, sondern auch gesamtgesellschaftlichen Vorteilen.<br />
Bildung trägt dazu bei, dass Kinder <strong>und</strong> Jugendliche lernen, sich in der Welt zu orientieren, sie<br />
zu verstehen, zu reflektieren, in ihr eine Rolle zu finden <strong>und</strong> sich an ihrer Gestaltung zu beteiligen.<br />
Dabei geht es um die Entwicklung von Kompetenzen, um am gesellschaftlichen <strong>und</strong> politischen<br />
Leben unserer Demokratie mitzuwirken. Die Schule ist eine Gesellschaft <strong>im</strong> Kleinen, wo junge<br />
Menschen all dies lernen können.<br />
Von Ina Bömelburg <strong>und</strong> Katharina Tesmer<br />
Bis Ende des Jahres <strong>2016</strong> werden ca. 1,3 Millionen Menschen<br />
in <strong>Deutschland</strong> als schutz- <strong>und</strong> asylsuchend registriert sein, gut<br />
200.000 von ihnen <strong>im</strong> schulpflichtigen Alter zwischen sechs<br />
<strong>und</strong> 16 Jahren, gut 750.000 jünger als 25 Jahre. So verw<strong>und</strong>ert<br />
es nicht, dass die bildungspolitischen Debatten derzeit stark<br />
geprägt sind von Fragen der <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> der Integration<br />
junger Menschen in das deutsche Bildungssystem.<br />
In ihrer „Erklärung zur Integration von jungen Geflüchteten<br />
durch Bildung“ hat die Kultusministerkonferenz (KMK) Anfang<br />
Oktober <strong>2016</strong> festgehalten: „Wir werden aber auch <strong>im</strong><br />
kommenden Jahr die bislang eingeleiteten Maßnahmen <strong>und</strong><br />
Angebote zur schulischen <strong>und</strong> beruflichen Bildung junger Geflüchteter<br />
fortführen, weiterentwickeln <strong>und</strong> ausbauen müssen.“<br />
Dafür haben die B<strong>und</strong>esländer <strong>im</strong> Schuljahr 2015/<strong>2016</strong> unter<br />
anderem etwa 13.000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen.<br />
Aber nicht nur der politische Handlungsdruck ist gewachsen.<br />
Die Bildung junger Geflüchteter in den Blick zu nehmen, ist<br />
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. <strong>Deutschland</strong> hat >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
35
Agenda<br />
eine starke Zivilgesellschaft, wie zuletzt der Freiwilligen-Survey<br />
vom Frühjahr <strong>2016</strong> <strong>und</strong> eine Studie des Berliner Instituts<br />
für empirische Integrations- <strong>und</strong> <strong>Migration</strong>sforschung (BIM)<br />
der Humboldt-Universität zu Berlin zeigten: Im Jahr 2014<br />
sollen 43,6 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren<br />
freiwillig engagiert gewesen sein <strong>und</strong> es hat sich gezeigt, dass<br />
sich <strong>im</strong>mer mehr Menschen in <strong>Deutschland</strong> ehrenamtlich für<br />
Flüchtlinge engagieren. Vereine verzeichneten in den Jahren<br />
2013 bis 2015 einen Anstieg um 70 Prozent. Ehrenamtliche<br />
vermitteln zwischen Familien <strong>und</strong> Schulen oder engagieren<br />
sich <strong>im</strong> Sprachunterricht.<br />
Die Stiftung Mercator mit ihren thematischen Schwerpunkten<br />
in der internationalen Zusammenarbeit, der Wissenschaftsförderung,<br />
dem Kl<strong>im</strong>awandel, der Integration <strong>und</strong> kulturellen<br />
Bildung versteht sich als Teil der Zivilgesellschaft. Wir sind<br />
für die Bildung aktiv, weil wir dort einen drängenden gesellschaftlichen<br />
Bedarf erkennen <strong>und</strong> zugleich mit unserem<br />
Engagement etwas bewegen können.<br />
Wie aber kommen wir von den Zielen gleicher Bildungs- <strong>und</strong><br />
Teilhabechancen zu tatsächlichen Veränderungen? Wer sind<br />
die entscheidenden Akteure? Wie findet Integration durch<br />
Bildung statt? Und was können wir als Stiftung zu einer gelingenden<br />
Integration in der Schule beitragen?<br />
Schulen <strong>und</strong> Lehrkräfte brauchen Unterstützung<br />
Trotz bestehender Schulpflichtregelungen der B<strong>und</strong>esländer<br />
gilt die Schulpflicht nicht überall von Anfang an, insbesondere<br />
für Asyl suchende Kinder <strong>und</strong> Jugendliche <strong>im</strong> schulpflichtigen<br />
Alter. In der Praxis ist der Schulzugang daher für viele prekär.<br />
Sind die Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen einer Schule zugeordnet,<br />
werden sie entweder direkt in Regelklassen aufgenommen oder<br />
in den sogenannten Willkommens- oder Seiteneinsteigerklassen<br />
unterrichtet. Welches Modell hierbei am günstigsten ist, ist<br />
wissenschaftlich noch nicht bewertet worden. Klar ist jedoch,<br />
dass es vielfach an qualifiziertem Lehrpersonal fehlt. Und<br />
zunehmend wird deutlich, wie zentral eine psychologische<br />
Betreuung von traumatisierten Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen ist.<br />
Umgang mit zunehmender Diversität wird Kernaufgabe<br />
von Schule<br />
Die hohe Zahl der neu eingewanderten schulpflichtigen<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen stellt das Schulsystem aktuell vor<br />
große Herausforderungen. Laut Bevölkerungsstatistik wird in<br />
nur wenigen Jahren mehr als die Hälfte aller Schüler einen<br />
<strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> haben. Sie kommen aus unterschiedlichen<br />
kulturellen, religiösen <strong>und</strong> sozialen Kontexten <strong>und</strong><br />
bringen Herkunftssprachen aus aller Welt mit. Die bereits<br />
vorhandene Diversität <strong>im</strong> Klassenz<strong>im</strong>mer wird dadurch also<br />
weiter verstärkt. Schulen <strong>und</strong> Lehrkräfte müssen sich der<br />
wachsenden sozialen, sprachlichen, kulturellen <strong>und</strong> religiösen<br />
Heterogenität der Schülerschaft stellen, die Schule <strong>und</strong> ihren<br />
Unterricht gr<strong>und</strong>legend verändern.<br />
Insbesondere können Einstellungen, Haltungen <strong>und</strong> Erwartungen<br />
von Lehrkräften einen Einfluss auf die Leistungen von<br />
Schülern haben. Ein defizitär geprägter Blick auf Menschen<br />
kann dazu führen, ihre Potenziale zu verkennen. Die Stärken<br />
von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong>,<br />
wie beispielsweise ihre Mehrsprachigkeit, eine ausgeprägte<br />
Leistungsorientierung <strong>und</strong> hohe Flexibilität, werden <strong>im</strong> Bildungssystem<br />
<strong>im</strong>mer noch zu wenig erkannt <strong>und</strong> gefördert.<br />
Neben der einzelnen Lehrkraft spielt die Schule an sich ebenfalls<br />
eine entscheidende Rolle be<strong>im</strong> Abbau von Bildungsungleichheit.<br />
Die Schule als Gesamtes muss sich interkulturell<br />
öffnen: „Bei der interkulturellen Öffnung des Schulsystems<br />
geht es um einen veränderten Blick der Institution Schule<br />
sowie der in ihr verantwortlich Handelnden auf die durch<br />
<strong>Migration</strong>sprozesse veränderte Schulrealität insgesamt sowie<br />
um eine Anpassung der Institution in ihren Strukturen,<br />
Methoden, Curricula <strong>und</strong> Umgangsformen an eine in vielen<br />
D<strong>im</strong>ensionen plurale Schülerschaft“, schreibt die <strong>Migration</strong>s-<br />
<strong>und</strong> Erziehungswissenschaftlerin Yasemin Karakaşoğlu.<br />
Diesen Handlungsbedarf hat auch die Politik erkannt: Mit<br />
dem Beschluss „Interkulturelle Bildung <strong>und</strong> Erziehung in<br />
der Schule“ fordert beispielsweise die Kultusministerkonferenz,<br />
allen Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen unabhängig von ihrer<br />
Herkunft umfassende Teilhabe an Bildung <strong>und</strong> Chancen<br />
für den größtmöglichen Bildungserfolg zu eröffnen, indem<br />
Diskr<strong>im</strong>inierung abgebaut wird <strong>und</strong> verschiedene Kulturen<br />
selbstverständlicher Teil der Schule werden.<br />
Eine erfolgreiche Integration kann also nur dann gelingen,<br />
wenn Schulen gut mit der zunehmenden Diversität umgehen<br />
können. Dabei darf es nicht um eine Weiterentwicklung<br />
kompensatorischer Förderstrategien gehen, sondern<br />
um die Verankerung einer Anerkennung <strong>und</strong> Achtung von<br />
Vielfalt. Aber bekommen Schulen die dafür notwendige<br />
Unterstützung? Zu wenig, resümieren das Mercator-Institut<br />
36 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
MIGRATION<br />
für Sprachförderung <strong>und</strong> Deutsch als Zweitsprache <strong>und</strong> der<br />
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration <strong>und</strong><br />
<strong>Migration</strong> nach einer Untersuchung darüber, wie Lehrkräfte<br />
in <strong>Deutschland</strong> in ihrer Ausbildung <strong>und</strong> in der Fortbildung<br />
lernen, mit kulturellen <strong>und</strong> sprachlichen Unterschieden <strong>im</strong><br />
Klassenz<strong>im</strong>mer angemessen umzugehen. Sie haben Prüfungs-,<br />
Studienordnungen <strong>und</strong> Fortbildungskataloge analysiert <strong>und</strong><br />
sind zu dem Schluss gekommen, dass Lehrkräfte in nur sechs<br />
deutschen B<strong>und</strong>esländern den Umgang mit sprachlicher <strong>und</strong><br />
kultureller Vielfalt systematisch lernen. Es gibt noch zu wenige<br />
wirksame <strong>und</strong> wenig praxisnahe Qualifizierungsangebote. Die<br />
zentrale Empfehlung lautet, dass die Lehrerbildung an Universitäten,<br />
<strong>im</strong> Referendariat <strong>und</strong> in der Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
entsprechend angepasst werden muss.<br />
Um Schulen <strong>und</strong> Lehrkräfte bei dieser Herausforderung zu<br />
unterstützen, verstärken wir unser Engagement für einen besseren<br />
Umgang mit Diversität in der Schule. Daneben sind wir<br />
in langjährig aufgebauten Handlungsfeldern aktiv, mit denen<br />
wir zu mehr Bildungsgerechtigkeit in <strong>Deutschland</strong> beitragen<br />
möchten. Hier einige Schlaglichter bezogen auf die Schule.<br />
Durchgängige Sprachbildung fördern<br />
Im Handlungsfeld der sprachlichen Bildung <strong>und</strong> Sprachförderung,<br />
das als wichtiger Faktor für einen guten Umgang mit<br />
Diversität zu verstehen ist, haben wir darauf hingearbeitet,<br />
die Projekte <strong>im</strong> Hinblick auf das Ziel der chancengerechten<br />
Teilhabe systemisch anzulegen; weg von additiven, zusätzlich<br />
geförderten Maßnahmen wie dem Förderunterricht, hin zu<br />
einer systemischen Förderung, bei der die Akteure <strong>im</strong> Schulsystem<br />
− in der Regel die Lehrer − qualifiziert <strong>und</strong> begleitet<br />
werden. Die wissenschaftliche Forschung, die praktische Schul<strong>und</strong><br />
Unterrichtsentwicklung, die Lehrerbildung <strong>und</strong> politische<br />
Kommunikation greifen ineinander, damit Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler verbesserte Lernbedingungen <strong>und</strong> bestmögliche<br />
Unterstützung erfahren.<br />
Bildungsübergänge verbessern<br />
Neben sprachlichen Hürden lässt sich beobachten, dass Schüler<br />
mit <strong>Migration</strong>shintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> / oder aus Nichtakademiker-<br />
Familien insbesondere be<strong>im</strong> Übergang von einer Bildungsinstitution<br />
in die nächsthöhere Probleme haben. Dies führt<br />
dazu, dass viele junge Menschen nicht die Bildung erhalten,<br />
die ihren Fähigkeiten entspricht.<br />
Dies gilt besonders für neu eingewanderte junge Menschen,<br />
bei denen es aufgr<strong>und</strong> mangelnder Sprach- <strong>und</strong> Kulturkenntnisse<br />
besonders schwierig ist, ihre Kompetenzen richtig einzuschätzen<br />
<strong>und</strong> entsprechende Übergangsempfehlungen<br />
auszusprechen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> haben wir gemeinsam<br />
mit der RuhrFutur gGmbH, einer Partnergesellschaft der<br />
Stiftung Mercator, beispielsweise das Programm „Wegbereiter“<br />
entwickelt, das Kommunen <strong>und</strong> Schulen <strong>im</strong> Ruhrgebiet u. a.<br />
dabei unterstützt, bessere Diagnoseverfahren zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> eine durchlässige schulische Integration der geflüchteten<br />
Kinder zu ermöglichen.<br />
Qualität <strong>im</strong> Ganztag verbessern<br />
Auch setzen wir auf die Verbesserung der Qualität <strong>im</strong> Ganztag,<br />
weil der Ganztag die Schulform der Zukunft in einer<br />
vielfältigen Gesellschaft ist. Er bietet opt<strong>im</strong>ale Bedingungen,<br />
um gerade sozial benachteiligte Kinder <strong>und</strong> Jugendliche (<strong>und</strong><br />
damit auch neu eingewanderte junge Menschen) individuell<br />
<strong>und</strong> unabhängig von den Unterstützungsmöglichkeiten des<br />
Elternhauses zu fördern. In den Projekten dieses Handlungsfelds<br />
wie beispielsweise „LiGa − Lernen <strong>im</strong> Ganztag“ zeigt sich,<br />
dass es in Ganztagsschulen besonders gut gelingt, geflüchtete<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendliche von Anfang an ins Sozialleben <strong>und</strong><br />
Regelangebot der Schule einzubeziehen.<br />
Kulturelle Bildung als Mittel zur Integration<br />
Aktivitäten <strong>im</strong> Bereich der kulturellen Bildung sind ein wichtiges<br />
Mittel, um die nachhaltige Integration neu eingewanderter<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen in der Schule den Boden zu bereiten.<br />
Gerade künstlerische Aktivitäten wie gemeinsames Singen<br />
oder Tanzen sind besonders geeignet, Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
unmittelbar in Interaktionen <strong>und</strong> Kommunikationen ohne<br />
Sprachbarrieren zu bringen. Einige unserer Projekte <strong>im</strong> Bereich<br />
„Kulturelle Bildung“ setzen daher genau hier an.<br />
Gesellschaftliche Diskurse versachlichen<br />
Die Schule steht nicht allein, sondern ist Teil gesellschaftlicher<br />
Diskurse <strong>und</strong> Entwicklungen. Was eine Schule ausmacht, ist<br />
eben nicht nur die Struktur, ihre Organisation <strong>und</strong> das fachliche<br />
Know-how der Pädagogen, sondern auch die Einstellungen <strong>und</strong><br />
Haltungen zu Integration <strong>und</strong> Diversität. Ein chancengleicher<br />
Zugang zu Bildung für alle Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen ist nur<br />
dann möglich, wenn auch die Gesellschaft Einwanderung<br />
<strong>und</strong> Vielfalt positiv gegenübersteht. Zwar überwiegen nach<br />
wie vor positive Einstellungen in der deutschen Bevölkerung,<br />
der aktuelle Trend hin zu einer Ablehnung der Vielfalts- <strong>und</strong><br />
Willkommenskultur allerdings markiert einen verstärkten<br />
Handlungsbedarf von Zivilgesellschaft <strong>und</strong> Staat. Durch die<br />
Förderung des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für<br />
Integration <strong>und</strong> <strong>Migration</strong> oder Studien wie „ZuGleich − Zugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> Gleichwertigkeit“ möchte die Stiftung Mercator<br />
beispielsweise zur Versachlichung der öffentlichen Debatte<br />
beitragen <strong>und</strong> eine unabhängige, faktenbasierte Politikberatung<br />
ermöglichen.<br />
Über die Autorinnen<br />
Ina Bömelburg <strong>und</strong> Katharina Tesmer sind als Projektmanagerinnen<br />
<strong>im</strong> Bereich „Integration“ der Stiftung Mercator tätig.<br />
Dort entwickeln <strong>und</strong> begleiten sie Projekte <strong>und</strong> Initiativen für<br />
gerechtere Bildungschancen in <strong>Deutschland</strong>. Sie verantworten<br />
insbesondere die Handlungsfelder zur Förderung einer durchgängigen<br />
Sprachbildung, für einen positiven Integrationsdiskurs <strong>und</strong><br />
besseren Umgang mit sozialer, kultureller <strong>und</strong> religiöser Diversität<br />
in Schule <strong>und</strong> Gesellschaft.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
37
Agenda<br />
Unternehmen <strong>und</strong><br />
Wie kaum ein zweites Nachhaltigkeitsthema<br />
erleben die Menschenrechte<br />
derzeit eine Entwicklung hin zu mehr<br />
Verbindlichkeit. Angestoßen hat diesen<br />
Prozess vor fünf Jahren John Ruggie<br />
mit der Entwicklung der UN-Leitprinzipien<br />
für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte.<br />
Aber auch Katastrophen wie<br />
das Unglück in der Textilfabrik Rana<br />
Plaza, der schwierige Umgang mit<br />
Konfliktmineralien <strong>und</strong> die Vermeidung<br />
von Kinderarbeit führen zu zunehmender<br />
staatlicher Regulierung. Durch die<br />
Verpflichtung zu verantwortlichem<br />
<strong>und</strong> integrem Handeln – auch entlang<br />
ihrer Lieferketten − können Unternehmen<br />
entscheidend zur Umsetzung der<br />
Menschenrechte beitragen. Modernes<br />
Menschenrechtsmanagement formuliert<br />
nicht nur Herausforderungen,<br />
sondern Unternehmen können dies<br />
auch als Leitmotiv verstehen <strong>und</strong> als<br />
Chance, Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben.<br />
38 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Menschenrechte<br />
Menschenrechte<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
39
Agenda<br />
Zunehmende Verrechtlichung von<br />
Menschenrechtsaspekten<br />
Dass Menschenrechte auch Unternehmen etwas angehen, hat sich heute als weitgehender<br />
Konsens durchgesetzt. Verschiedene gesetzgeberische Initiativen befassen sich mit unterschiedlichen<br />
Teilaspekten der menschenrechtlichen Verantwortung wirtschaftlicher Akteure.<br />
Was das in der Praxis bedeutet <strong>und</strong> warum sich daraus auch Chancen für Unternehmen<br />
ergeben, zeigt das Beispiel des britischen Modern Slavery Act.<br />
Von Laura Curtze<br />
Transparenz in der Lieferkette<br />
Seit Oktober 2015 sind mit dem britischen Modern Slavery<br />
Act neue Transparenzbest<strong>im</strong>mungen für Unternehmen in<br />
Kraft. Demnach müssen Firmen jährlich öffentlich zugängliche<br />
Erklärungen darüber abgeben, welche Maßnahmen sie<br />
ergreifen, um moderner Sklaverei in ihren Lieferketten <strong>und</strong><br />
Geschäftstätigkeiten vorzubeugen <strong>und</strong> entgegenzuwirken.<br />
Moderne Sklaverei umfasst dabei nicht nur Zwangsarbeit <strong>im</strong><br />
herkömmlichen Sinne, sondern auch Menschenhandel mit dem<br />
Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung. Berichten müssen alle<br />
Unternehmen, deren Jahresumsatz über 36 Millionen Pf<strong>und</strong><br />
liegt <strong>und</strong> die zumindest einen Teil davon durch Tätigkeit in<br />
Großbritannien erbringen. Das schließt auch eine große Zahl<br />
deutscher Unternehmen mit ein.<br />
Das Gesetz an sich schreibt zwar nicht vor, was genau in den<br />
Erklärungen enthalten sein muss. Der begleitende Leitfaden<br />
der britischen Regierung allerdings empfiehlt deutlich, sowohl<br />
Informationen über den eigenen Betrieb <strong>und</strong> relevante<br />
interne Richtlinien bereitzustellen als auch zu beschreiben,<br />
wie genau vorgegangen wird, um Risiken moderner Sklaverei<br />
zu erkennen <strong>und</strong> zu mildern. Nicht die Risikovermeidung<br />
steht hierbei <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>, sondern Transparenz <strong>und</strong> ein<br />
effektiver Umgang mit eventuellen Negativauswirkungen <strong>im</strong><br />
Sinne einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht.<br />
Internationale <strong>und</strong> nationale Rahmenwerke<br />
Dieser Ansatz bildet spätestens seit der Beschließung der<br />
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte durch<br />
den UN-Menschenrechtsrat den Rahmen für die soziale Verantwortung<br />
wirtschaftlicher Akteure. In der Praxis bedeutet<br />
das für Unternehmen, potenzielle Negativauswirkungen ihrer<br />
direkten <strong>und</strong> indirekten Aktivitäten auf die Menschenrechte<br />
zu identifizieren, zu min<strong>im</strong>ieren <strong>und</strong> wiedergutzumachen.<br />
40 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Menschenrechte<br />
Auch auf gesetzlicher <strong>und</strong> politischer Ebene ist die Verantwortung<br />
von Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte<br />
zunehmend fest verankert. Bislang haben Regierungen in acht<br />
Staaten ihre Strategie zur Umsetzung der UN Leitprinzipien<br />
in Nationalen Aktionsplänen festgehalten, in gut 30 weiteren<br />
Ländern sind entsprechende Konzepte in Arbeit, darunter<br />
auch <strong>Deutschland</strong>. Ein dem Modern Slavery Act ähnliches<br />
Gesetz verpflichtet bereits seit 2010 in Kalifornien tätige<br />
Unternehmen, über Risiken in Bezug auf Zwangsarbeit <strong>und</strong><br />
Menschenhandel zu berichten. In Frankreich befindet sich ein<br />
Gesetzesentwurf zur unternehmerischen Verantwortung für<br />
Menschenrechte in der Abst<strong>im</strong>mung, in der Schweiz wird eine<br />
entsprechende Volksabst<strong>im</strong>mung vorbereitet <strong>und</strong> europaweit<br />
müssen EU-Mitgliedsstaaten − sofern noch nicht geschehen<br />
− die sogenannte CSR-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung<br />
umsetzen.<br />
Menschenrechte zunehmend relevant<br />
Diese Entwicklungen tragen einer veränderten Realität Rechnung:<br />
Mit zunehmend globalen <strong>und</strong> komplexen Liefer- <strong>und</strong><br />
Wertschöpfungsketten steigt für Unternehmen auch das Risiko,<br />
direkt oder indirekt zu Menschenrechtsverletzungen beizutragen.<br />
Der Einsturz der Rana Plaza Textilfabrik in Bangladesch,<br />
Berichte über Arbeitssklaven auf thailändischen Fischtrawlern<br />
oder prekäre Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern in<br />
Europa − all das sind Szenarien, die den daraus entstehenden<br />
Handlungsbedarf unterstreichen.<br />
Eine große <strong>und</strong> stetig wachsende Zahl von Unternehmen setzt<br />
sich daher aktiv für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen<br />
<strong>und</strong> Min<strong>im</strong>ierung von menschenrechtlichen Risiken in ihren<br />
Lieferketten <strong>und</strong> Geschäftsbeziehungen ein. In Umfragen unter<br />
Geschäftsleuten landen Menschenrechte <strong>im</strong>mer häufiger unter<br />
den wichtigsten Themen der Nachhaltigkeitsagenda. Als vor<br />
Kurzem das britische Business & Human Rights Resource Centre<br />
eine Befragung unter den DAX 30-Unternehmen durchführte,<br />
nahmen mehr als zwei Drittel der kontaktierten Firmen teil<br />
<strong>und</strong> machten teils detaillierte Angaben dazu, was sie zur<br />
Achtung der Menschenrechte unternehmen.<br />
Was machen Unternehmen?<br />
Auch die Transparenzbest<strong>im</strong>mungen des Modern Slavery Act<br />
spielen hierbei eine Rolle. Ergon Associates, eine auf Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Menschenrechte spezialisierte Beratung, analysiert<br />
die Umsetzung der Berichtspflicht des Modern Slavery Act<br />
seit dessen Inkrafttreten. Eine kürzlich mit Historic Futures<br />
durchgeführte Studie ergab, dass der Modern Slavery Act erheblich<br />
dazu beigetragen hat, die Führungsebene britischer<br />
Unternehmen für soziale <strong>und</strong> menschenrechtliche Risiken<br />
in der Lieferkette zu sensibilisieren. Auch der <strong>Fokus</strong> auf die<br />
Identifizierung <strong>und</strong> Überwachung von Risiken habe nach<br />
Einführung des Modern Slavery Act weiter zugenommen.<br />
Das zeigt sich − zumindest teilweise − auch in den bislang veröffentlichten<br />
Berichten. Knapp 1.000 Modern-Slavery-Erklärungen<br />
sind mittlerweile in dem von zivilgesellschaftlichen<br />
Organisationen getragenen zentralen Register hinterlegt. Auch<br />
eine Zahl deutscher Unternehmen ist darunter. Die inhaltliche<br />
Tiefe der Berichte variiert stark: Eine Analyse der r<strong>und</strong> 250<br />
ersten Berichte durch Ergon Associates zeigte, dass nur knapp<br />
20 Prozent der gemachten Erklärungen genauere Angaben<br />
dazu enthielten, wie die Unternehmen Zwangsarbeits- <strong>und</strong><br />
Menschenhandelsrisiken in der Lieferkette identifizieren <strong>und</strong><br />
bekämpfen. Auch ein Jahr nach Inkrafttreten der Berichtspflicht<br />
sind dies Bereiche, zu denen viele Unternehmen lediglich vage<br />
Informationen bereitstellen. Gleichzeitig ist jedoch auch zu<br />
beobachten, dass gerade größere, global agierende Firmen<br />
detaillierte Erklärungen abgeben, oftmals integriert in die<br />
breitere Nachhaltigkeits- oder Menschenrechtsberichterstattung,<br />
die ihren Umgang mit Risiken moderner Sklaverei ausführlich<br />
beschreiben. Das ist nicht nur <strong>im</strong> Sinne des Gesetzes, sondern<br />
auch von strategischer Bedeutung.<br />
Die Berichtspflicht als Chance<br />
Denn der Umgang von Unternehmen mit menschenrechtlichen<br />
<strong>und</strong> sozialen Risiken wird auch für zivilgesellschaftliche<br />
Beobachter, Geschäftspartner <strong>und</strong> Konsumenten <strong>im</strong>mer wichtiger.<br />
Und auch für Investoren spielt das menschenrechtliche<br />
Risikomanagement von Unternehmen eine wachsende Rolle.<br />
Das zeigt sich zum Beispiel in der Erweiterung des Dow<br />
Jones Sustainability Index um einen Indikator zum Thema<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte oder in der Entwicklung von<br />
Initiativen wie dem Corporate Human Rights Benchmark, der<br />
sich auf die vergleichende Bewertung von unternehmerischen<br />
Sorgfaltspflichtsprozessen konzentriert. Auch für kleinere<br />
Betriebe wird eine transparente Haltung zum Thema Menschenrechte<br />
zunehmend relevant, nicht zuletzt aufgr<strong>und</strong><br />
von K<strong>und</strong>enanfragen.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> bietet die Berichterstattung unter<br />
dem Modern Slavery Act Unternehmen auch klare Chancen:<br />
Zum einen kann die Berichtspflicht dabei helfen, Nachhaltigkeitsthemen<br />
intern zu priorisieren <strong>und</strong> eigene Prozesse<br />
zur Risikoidentifizierung <strong>und</strong> -min<strong>im</strong>ierung anzustoßen, zu<br />
evaluieren <strong>und</strong> zu opt<strong>im</strong>ieren. Darüber hinaus stellen die zu<br />
veröffentlichenden Erklärungen auch eine Gelegenheit für<br />
Unternehmen dar, verstärktes Engagement zu demonstrieren,<br />
Transparenz herzustellen − <strong>und</strong> so nicht zuletzt gegenwärtigen<br />
<strong>und</strong> zukünftigen Anforderungen seitens Konsumenten,<br />
K<strong>und</strong>en, Investoren <strong>und</strong> Gesetzgebern entgegenzukommen.<br />
Die Berichte <strong>und</strong> Analysen von Ergon Associates zum Modern Slavery Act sind<br />
abruf bar unter: www.ergonassociates.net<br />
Über die Autorin<br />
Laura Curtze arbeitet als Researcher bei Ergon Associates, einer<br />
Unternehmensberatung mit Hauptsitz in London, die K<strong>und</strong>en aus<br />
ganz Europa zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichtsprozessen,<br />
Arbeitsnormen, sozialer Nachhaltigkeit in der Lieferkette <strong>und</strong><br />
Reporting berät.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
41
Agenda<br />
Effiziente<br />
Vertragsgestaltung<br />
in der Lieferkette<br />
CSR-Vereinbarungen sind ein gutes Mittel unternehmerischer Sorgfalt, sagt der Jurist<br />
Robert Grabosch <strong>und</strong> erläutert, wie Verträge entsprechend gestaltet werden können.<br />
Die Anforderungen an die unternehmerische Sorgfalt steigen.<br />
Das betrifft alle vier Themen des UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong>.<br />
Die Sorgfalt darf sich in allen Geschäftsfeldern nicht mehr<br />
auf die unmittelbaren Geschäftspartner des Unternehmens<br />
beschränken. Sie muss − wo angezeigt − auch tiefer in die<br />
Wertschöpfungskette hineinreichen. Ausweislich der neuen<br />
CSR-Berichtspflichten betrifft dies alle verschiedenen<br />
nichtfinanziellen Belange. Gleichzeitig zeigen Investoren<br />
<strong>und</strong> K<strong>und</strong>en <strong>im</strong> Falle eines Skandals <strong>im</strong>mer weniger Geduld.<br />
Dass in der Lieferkette Probleme auftreten können, ist keine<br />
neue Erkenntnis. Der hilflose Einwand, man könne für das<br />
Verhalten von Lieferanten oder deren Geschäftspartner keine<br />
Verantwortung übernehmen, wirkt heute eher unbeholfen<br />
denn glaubwürdig. Kann ein Unternehmen <strong>im</strong> Skandalfall<br />
nicht angemessen handeln, erwägen inzwischen selbst solche<br />
Investoren einen Ausstieg, die sich Nachhaltigkeit nicht<br />
ausdrücklich auf die Fahne geschrieben haben.<br />
Umso wichtiger wird es, Informationsrechte <strong>und</strong> Einflussmacht<br />
in Verträgen zu gestalten. Dazu sollten mit den sorgfältig<br />
ausgewählten Geschäftspartnern klare Absprachen getroffen<br />
werden. Dass Geschäftspartner rein mündlich formulierte<br />
oder gar stillschweigende Erwartungen erfüllen, ist nicht<br />
ernsthaft zu erwarten. Es gilt der Gr<strong>und</strong>satz: Was wichtig ist,<br />
wird schriftlich fixiert. Aber nicht alle Probleme lassen sich<br />
durch klare Verhaltensregeln vermeiden. Deswegen ist in<br />
Vertragswerken auch festzuhalten, wie die Vertragspartner mit<br />
Problemfällen umgehen werden. Nur so vermeiden Geschäftsführer<br />
<strong>und</strong> Vorstände es, in Skandalfällen handlungsunfähig<br />
zu sein <strong>und</strong> sich in peinliches Schweigen hüllen zu müssen.<br />
Dieser Beitrag gibt einen Überblick darüber, welche Vereinbarungen<br />
mit Lieferanten in Betracht kommen. Die neuen<br />
CSR-Berichtspflichten auf Gr<strong>und</strong>lage der EU-Richtlinie vom<br />
22.10.2014 sollten den mit CSR-Aufgaben betrauten Mitarbeitern<br />
Anlass bieten, die Vertragswerke gemeinsam mit internen oder<br />
externen Rechtsberatern auf Verbesserungspotential zu prüfen.<br />
CSR in Verträgen thematisieren<br />
Nicht wenige Unternehmen erwarten von ihren Geschäftspartnern<br />
schlicht, dass sie ihren Verhaltenskodex zur Kenntnis<br />
nehmen <strong>und</strong> bestätigen. Ob damit aber irgendeine rechtliche<br />
Verbindlichkeit einhergeht <strong>und</strong> wie mit möglichen Verstößen<br />
gegen den Kodex umgegangen werden soll, bleibt zwischen<br />
den Vertragspartnern ungeklärt.<br />
Wer zeigen will, dass er es mit der Unternehmensverantwortung<br />
ernst meint, muss sie in seinen Vertragswerken thematisieren.<br />
Vereinbarungen zum Umgang mit CSR-Belangen sind heutzutage<br />
in den Geschäftsbeziehungen großer Unternehmen<br />
bereits weit verbreitet. Doch häufig erschöpfen sie sich in<br />
vagen Wunschvorgaben oder gar apodiktischen Behauptungen.<br />
So heißt es etwa in den allgemeinen Einkaufsbedingungen<br />
eines großen deutschen Einzelhändlers, der Lieferant „versichert,<br />
dass die gelieferte Ware weder durch ausbeuterische,<br />
ges<strong>und</strong>heitsschädigende oder sklavenartige Arbeit noch durch<br />
Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder sonst die Menschenwürde<br />
verletzende Gefängnisarbeit hergestellt worden ist.“ Doch<br />
was genau bedeutet das beispielsweise für Hersteller von Lebensmitteln<br />
mit Zutaten aus Kolumbien oder für Lieferanten<br />
42 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Menschenrechte<br />
von Non-Food-Waren aus Pakistan? In welcher Form <strong>und</strong> auf<br />
welcher Gr<strong>und</strong>lage „versichern“ sie all diese Umstände? Wann<br />
ist Arbeit überhaupt „ausbeuterisch“? Genauere Vorgaben für<br />
die wichtigsten Produktarten <strong>und</strong> Geschäftsregionen lassen<br />
die Vertragswerke häufig vermissen. Es ist kein W<strong>und</strong>er, wenn<br />
Lieferanten derartige Klauseln mehr oder weniger bewusst<br />
übersehen.<br />
Das Unternehmen kann dann <strong>im</strong> Konfliktfall noch nicht einmal<br />
verlangen, dass der Geschäftspartner sich an die getroffene<br />
Vereinbarung hält. Wegen Unklarheiten bei der Formulierung<br />
ist nämlich schon zweifelhaft, ob die jeweilige CSR-Klausel<br />
überhaupt rechtlich wirksam ist. Denn Vertragswerke, die<br />
für eine mehrfache Verwendung vorformuliert worden sind,<br />
behandelt das Gesetz als „Allgemeine Geschäftsbedingungen“.<br />
AGB müssen einige gesetzliche Anforderungen erfüllen − auch<br />
wenn sie ausschließlich für den Geschäftsverkehr mit Unternehmen<br />
gedacht sind. Klauseln müssen klar formuliert sein,<br />
vom gesetzlichen Leitbild nicht zu sehr abweichen <strong>und</strong> den<br />
Geschäftspartner nicht unangemessen benachteiligen. Auch<br />
darf eine CSR-Klausel nicht am Ende einer ganz anderen ausführlichen<br />
Regelung − etwa der Liefermodalitäten − „versteckt“<br />
werden. In all diesen Fällen ist die CSR-Klausel unwirksam.<br />
Relevante Inhalte konkretisieren<br />
CSR-Klauseln müssen aber auch nicht bis hin zur lästigen,<br />
unnötigen Kleinlichkeit ausgedehnt werden. Welche Themen<br />
sind es, die besonders genau geregelt werden sollten? Das zeigen<br />
die Ergebnisse der Umfeld- <strong>und</strong> Geschäftspartneranalysen, die<br />
selbstverständlich auch <strong>im</strong> Hinblick auf die vier Gebiete des<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> durchzuführen sind. Aus dem vielfältigen<br />
Bestand an Standards für verschiedene Branchen können<br />
passende ausgewählt werden. In den allermeisten Fällen<br />
bedarf es keiner Neuerfindung von Standards <strong>und</strong> Zertifizierungssystemen.<br />
Die Gr<strong>und</strong>züge eines passenden Standards<br />
werden dann <strong>im</strong> Vertrag beschrieben, ggf. wesentliche Inhalte<br />
hervorgehoben, <strong>und</strong> ihr Text als Anlage dem Vertrag beigefügt,<br />
falls er nicht bereits als bekannt vorausgesetzt werden kann.<br />
Jedenfalls für große kapitalmarktorientierte Unternehmen<br />
<strong>und</strong> deren Geschäftspartner sind auch die neuen CSR-Berichtspflichten<br />
auf Gr<strong>und</strong>lage der europäischen Richtlinie 2014/95<br />
wichtig. Damit die Controlling-Abteilung die nichtfinanziellen<br />
Berichte vorbereiten kann, muss die Geschäftsleitung relevante<br />
qualitative <strong>und</strong> quantitative Informationen best<strong>im</strong>men. Die<br />
Sammlung der Informationen bei den Geschäftspartnern, ggf.<br />
gar durch die Lieferkette hinweg, sollte durch vertragliche<br />
Verpflichtungen zur Selbstauskunft gesichert werden.<br />
Die <strong>im</strong> deutschen Vertragsrecht anerkannte Gestaltungsfreiheit<br />
ermöglicht außerdem vielfältige Vereinbarungen zugunsten<br />
Dritter, die selbst nicht Vertragspartner sind. Derartige Klauseln<br />
können zum Beispiel betroffene indigene Bevölkerungen<br />
oder Arbeiter auf Plantagen unmittelbar ermächtigen, ges<strong>und</strong>heitsschützende<br />
Maßnahmen oder Schadensersatz vom<br />
Lieferanten zu verlangen. Es kommt dann nicht mehr darauf<br />
an, ob derartige Ansprüche in der dortigen (ausländischen)<br />
Rechtsordnung vorgesehen sind oder vom Lieferanten gegenüber<br />
seinen Arbeitnehmern zugesagt worden sind. >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
43
Agenda<br />
Folgen von Verstößen<br />
Verstöße gegen die vereinbarten Standards lassen sich nie ganz<br />
ausschließen, auch nicht durch höchste Sorgfalt bei der Auswahl<br />
zuverlässiger Lieferanten. Bisher verlassen sich Unternehmen<br />
überwiegend darauf, dass der Lieferant in Problemfällen von<br />
sich aus Maßnahmen weitgehend tolerieren wird, um seine<br />
Geschäftsbeziehung zu erhalten. Nur durch geeignete Klauseln<br />
zum Informationsfluss <strong>und</strong> Krisenmanagement sichert sich das<br />
Unternehmen jedoch seine Handlungsfähigkeit. Stehen ihm<br />
vereinbarte Anreiz- <strong>und</strong> Sanktionsinstrumente zur Verfügung,<br />
kann es zügig angemessene Maßnahmen einleiten <strong>und</strong> seine<br />
Geschäftspartner zur Mitwirkung bei der Problemlösung zwingen.<br />
CSR-Probleme müssen dann nicht mehr in Blamagen enden.<br />
Ebenso wie Belohnungen, z. B. Bonuszahlungen, für die Erreichung<br />
prüf barer Indikatoren gewährt werden können, lassen<br />
sich auch Schadensersatzpflichten <strong>und</strong> Vertragsstrafen in Fällen<br />
festgestellter Verstöße vereinbaren.<br />
Für Fälle festgestellter Verstöße sollte sich das Unternehmen<br />
auch eine Auswahl an praktisch sinnvollen Konsequenzen<br />
sichern. Inwiefern muss sich der Lieferant an einer Krisenbewältigung<br />
beteiligen <strong>und</strong> wann ist eine außerordentliche<br />
Kündigung des Liefervertrages möglich? Die meisten der<br />
bisherigen Kündigungsklauseln in Verhaltenskodizes sind<br />
nicht rechtswirksam, denn sie stellen nicht darauf ab, ob<br />
der Lieferant hinreichend Möglichkeit hatte, den Verstoß zu<br />
verhindern oder zu beseitigen.<br />
Einflussmacht durch Kontrollinstrumente<br />
Wichtig ist es auch, Kontrollinstrumente zwecks Überprüfung<br />
der Einhaltung der ausgewählten Standards zu vereinbaren.<br />
Andernfalls ist kein Verlass darauf, dass der Lieferant an Kontrollen<br />
mitwirkt oder auch nur Auskunft über Betriebsvorgänge<br />
erteilt <strong>und</strong> ggf. bei Dritten einholt. Hier sind die Vor- <strong>und</strong><br />
Nachteile von Zertifizierungen, Audits <strong>und</strong> Besuchen bei<br />
Lieferanten durch eigenes Personal abzuwägen. Audits sind<br />
zwar weit verbreitet, aber nicht ohne Weiteres zuverlässig.<br />
Wie den Auditoren zusätzliche Anreize für eine gründlichere<br />
Prüfung gesetzt werden kann, sollte <strong>im</strong> Verhältnis zum Audit-<br />
Unternehmen bei der Verhandlung der Auftragsbedingungen<br />
bedacht werden.<br />
Weitergeleitete CSR-Vereinbarungen<br />
Durch eine Vereinbarung mit dem Lieferanten können nicht<br />
unmittelbar auch dessen Vor-Lieferanten Pflichten auferlegt<br />
werden. Damit auch Vor-Lieferanten in die Pflicht genommen<br />
werden können, muss der Lieferant verpflichtet werden, die<br />
Inhalte der CSR-Klauseln an die Vor-Lieferanten zu berichten<br />
<strong>und</strong> sich bestmöglich darum zu bemühen, diese entsprechend<br />
zu verpflichten <strong>und</strong> die Einhaltung der Pflichten regelmäßig<br />
zu prüfen.<br />
Zusammenfassung<br />
Eine effiziente Vertragsgestaltung macht andere Maßnahmen<br />
unternehmerischer Sorgfalt nicht überflüssig. Vielmehr setzt<br />
sie eine gründliche Risikoanalyse voraus <strong>und</strong> ergänzt andere<br />
Maßnahmen wie Monitoring-Systeme, Multi-Stakeholder-<br />
Initiativen, Schulungen u.s.w. So verstanden <strong>und</strong> umgesetzt<br />
sichern CSR-integrierte Verträge die unternehmerische Handlungsfähigkeit<br />
in Problemsituationen <strong>und</strong> sind die Gr<strong>und</strong>lage<br />
für ein vorbildliches Krisenmanagement. Gerade in Regionen<br />
mit niedrigen Lebensstandards <strong>und</strong> in typischerweise gefahrgeneigten<br />
Branchen können so beachtliche Erfolge erzielt<br />
werden. Das Unternehmen hat dann in jeder Problemsituation<br />
die Chance, seine angemessene Risikovorsorge unter Beweis<br />
zu stellen.<br />
Über den Autor<br />
Robert Grabosch ist Rechtsanwalt & Wirtschaftsmediator bei der<br />
deutsch-niederländischen Anwaltskanzlei Grabosch T<strong>im</strong>mermans.<br />
Diese berät Unternehmen auf dem Gebiet des Zivilrechts sowie der<br />
Corporate Responsibility.<br />
44 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Info<br />
Fünf Maßnahmen der DAX 30-Unternehmen<br />
zur Achtung der Menschenrechte<br />
Von Isabel Ebert<br />
Deutsche DAX30-Unternehmen können als Pioniere voranschreiten <strong>und</strong> die Menschenrechte in<br />
ihren Sektoren <strong>und</strong> dem Mittelstand innerhalb <strong>Deutschland</strong>s <strong>und</strong> <strong>im</strong> Ausland achten oder gar<br />
fördern. Schöpfen die Konzerne dieses Potenzial aus? In einer kürzlich durchgeführten Umfrage<br />
unter den führenden börsennotierten deutschen Unternehmen (DAX30) haben zwei Drittel der<br />
Unternehmen sich dazu entschieden, Informationen über ihre Menschenrechts-Policies <strong>und</strong><br />
-Praktiken über die Company Action Platform des Business and Human Rights Resource Centre<br />
zu veröffentlichen. Die Unternehmen hoben fünf Schlüsselbereiche hervor, in denen sie Maßnahmen<br />
zur Achtung der Menschenrechte ergreifen:<br />
1. Beschwerdemechanismen: Der Zugang zu betrieblichen<br />
Beschwerdemechanismen unterstützt ein Unternehmen bei der<br />
Etablierung eines Frühwarnsystems zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen<br />
sowie zur Minderung von eventuellen<br />
Missständen. Als eines der ersten Unternehmen, das seinen<br />
Beschwerdemechanismus an die UN-Leitprinzipien zu Unternehmen<br />
<strong>und</strong> Menschenrechten (UN Guiding Principles on Business<br />
and Human Rights / UNGPs) angepasst hat, führte Adidas einen<br />
weltweiten Beschwerdemechanismus ein. Auf regionaler Ebene<br />
startete Adidas <strong>im</strong> Jahr 2012 einen SMS-Beschwerdemechanismus<br />
für Arbeitskräfte seiner Fertigungspartner in Indonesien. Bisher<br />
umfasst der Mechanismus 14 Fabriken <strong>und</strong> 80.000 Arbeitskräfte.<br />
Dieser ermöglicht Adidas, unabhängig zu verfolgen, wie Lieferanten<br />
vor Ort mit Beschwerden umgehen.<br />
2. Einbindung von lokalen Gemeinden <strong>und</strong> Stakeholder-<br />
Gruppen: Um ein besseres Bild der Interessen <strong>und</strong> Bedürfnisse<br />
lokaler Gemeinden zu gewinnen, welche von den Aktivitäten eines<br />
Unternehmens betroffen sind, werden konkrete Maßnahmen zur<br />
Beteiligung von Stakeholder-Gruppen durch mehrere DAX 30-Unternehmen<br />
ergriffen. Die Allianz verweist auf ihr ESG-Rahmenwerk<br />
als Kerndokument, in dem der Ansatz des Unternehmens zu<br />
Menschenrechten zusammengefasst wird. Die Community Advisory<br />
Panels der BASF dienen als Diskussionsforum auf lokaler<br />
Ebene. Die Panels bestehen aus einer Gruppe von Anwohnern einer<br />
Chemiefabrik, welche die Interessen der Gemeinden <strong>im</strong> Rahmen<br />
des Panels gegenüber der Betriebsführung vertreten.<br />
3. Schulungen zu Menschenrechten: Bayer weist auf die Durchführung<br />
von Menschenrechtsschulungen hin, an welchen <strong>im</strong><br />
vergangenen Jahr 52 Prozent seiner Belegschaft teilnahmen. Die<br />
Deutsche Post unterstreicht spezifische Trainings ihrer Mitarbeiter<br />
<strong>im</strong> Rahmen des Employee Relations Forum, welches <strong>im</strong> Jahr 2013<br />
als Governance-Gremium bestehend aus Mitarbeitervertretenden<br />
aller Unternehmensbereiche <strong>und</strong> der Konzernzentrale gegründet<br />
wurde. Mit der Kampagne zu „Diversity & Inclusion“ aus dem Jahr<br />
2015 zielt Henkel darauf ab, das Verständnis von Vielfalt <strong>und</strong><br />
respektvollem Verhalten <strong>im</strong> Konzern zu stärken.<br />
4. Einbindung von Geschäftspartnern <strong>und</strong> menschenrechtliche<br />
Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette: Im Rahmen<br />
der <strong>Global</strong> Business Partner Risk Management-Richtlinie legt<br />
Merck fest, dass alle Partner zur Einhaltung von international<br />
anerkannten Menschen- <strong>und</strong> Arbeitsnormen verpflichtet sind.<br />
Volkswagen verwies neben ähnlichen Maßnahmen auf eine neue<br />
Leitlinie zu Konfliktrohstoffen.<br />
5. Impact Assessment zu Menschenrechten (Human Rights<br />
Impact Assessments): Als entscheidender Schritt für ein Unternehmen,<br />
um seine Auswirkungen auf die Menschenrechte<br />
abzuschätzen, unterstreichen die UNGP die Notwendigkeit,<br />
spezifische Impact Assessments zu Menschenrechten durchzuführen.<br />
Im Rahmen des „Human Rights Respect System“ erhebt<br />
Da<strong>im</strong>ler an den Produktionsstandorten Informationen zur<br />
Menschenrechtssituation. Da<strong>im</strong>ler betont, auf der Gr<strong>und</strong>lage der<br />
Ergebnisse des Impact Assessments zu handeln <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
umzusetzen. Bayer identifizierte die Vermeidung von Kinderarbeit<br />
als eine zentrale Herausforderung für ein nachhaltiges Lieferantenmanagement.<br />
Daher hat Bayer CropScience Maßnahmen zur<br />
Vermeidung von Kinderarbeit in der Saatgutversorgung in Indien,<br />
Bangladesch <strong>und</strong> den Philippinen durch Kinderbetreuungsprogramme<br />
eingeführt.<br />
Quelle: UmweltDialog.de<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
45
Agenda<br />
Schutz der<br />
Menschenrechte als<br />
Faktor bei Geschäftsinvestitionen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte: Dieses Spannungsfeld wurde in den letzten Jahrzehnten <strong>im</strong>mer<br />
wieder umfassend diskutiert <strong>und</strong> auch weltweit institutionalisiert. Doch haben wir erst kürzlich<br />
damit begonnen uns die Frage zu stellen: „Welche Rolle übern<strong>im</strong>mt die Wirtschaft dabei?“<br />
Von Dr. Christoph Regierer <strong>und</strong> Kai M. Beckmann<br />
Weitverbreitet herrscht die Vorstellung, die Verknüpfung<br />
von Menschenrechten <strong>und</strong> Wirtschaft bedeute, dass Unternehmensinvestitionen<br />
in Übereinst<strong>im</strong>mung mit etablierten<br />
Menschenrechtsstandards getätigt werden sollten. Diese Annahme<br />
ist jedoch so nicht hinreichend: Die Integration von<br />
Menschenrechten in das unternehmerische Denken setzt bereits<br />
wesentlich früher an. Es geht darum, wie Unternehmen<br />
ihre Gewinne erwirtschaften <strong>und</strong> nicht wie sie sie investieren.<br />
Dabei handelt es sich auch nicht um einen rein philanthropischen<br />
Ansatz: Menschenrechte zu schützen bedeutet, das<br />
Geschäftsmodell <strong>und</strong> die Leitlinien eines Unternehmens so zu<br />
definieren, dass gr<strong>und</strong>legende Prinzipien gelten <strong>und</strong> verbindlich<br />
eingehalten werden. Die Leitplanken für das eigene Handeln<br />
sind so zu definieren, dass die genaue Position <strong>im</strong>mer wieder<br />
mit internen <strong>und</strong> externen Anspruchsgruppen ausgehandelt<br />
wird. Dabei sollte die Berücksichtigung von Menschenrechten<br />
<strong>im</strong>mer <strong>im</strong> Blick sein − gerade bei internationalem Engagement,<br />
bzw. als Bestandteil globaler Lieferketten.<br />
Während die Aufwände für die Berücksichtigung von Menschenrechten<br />
relativ gering sind, ist die daraus erwachsende<br />
Rentabilität erheblich. Bei der Investition in den Schutz von<br />
Menschenrechten ist es wichtig, vollständig zu verstehen, was<br />
Menschenrechte <strong>im</strong> geschäftlichen Umfeld des jeweiligen<br />
Unternehmens bedeuten. Nur so können die richtigen Kennzahlen,<br />
die Key Performance Indicators (KPIs), identifiziert<br />
<strong>und</strong> die Rentabilität überwacht werden. Laut dem von Mazars<br />
mitentwickelten <strong>und</strong> international gültigen United Nations<br />
Guiding Principles Reporting Framework sollten Unternehmen<br />
als Erstes fragen: „Welches sind unsere herausragenden<br />
Menschenrechtsthemen?“<br />
Nur wenn ein Unternehmen definiert <strong>und</strong> identifiziert hat,<br />
was ‚Menschenrechte‘ tatsächlich in der Verbindung mit der<br />
eigenen Geschäftstätigkeit bedeuten, kann es anfangen, diese<br />
in sein Geschäftsmodell zu integrieren. In der Rohstoffindustrie<br />
werden sich beispielsweise herausragende Menschenrechtsthemen<br />
um die Auswirkungen auf die Allgemeinheit sowie<br />
Umweltschäden, Ges<strong>und</strong>heits-, Gefahren- <strong>und</strong> Sicherheitsthemen<br />
drehen, während in einem anderen Sektor vollkommen<br />
andere Risiken <strong>im</strong> <strong>Fokus</strong> stehen können.<br />
Risiken für Menschen − Risiken für Unternehmen<br />
Bei der Identifizierung von „herausragenden Menschenrechtsthemen“<br />
spielt ein weiterer Faktor eine wichtige Rolle: Es ist<br />
entscheidend, dass die relevanten Risiken als die Risiken für<br />
Menschen <strong>und</strong> nicht etwa als Risiken für Unternehmen definiert<br />
sind. Würden wir nur auf die Risiken für Unternehmen<br />
schauen, übersähen wir einige herausragende Risiken für<br />
Menschenrechte. Paradoxerweise kann man üblicherweise<br />
diese Risiken nicht von den Risiken für ein Unternehmen<br />
trennen. Wir müssen nur den Blickwinkel ändern, mit dem<br />
wir auf für uns potenziell schädliche Risiken schauen.<br />
Sind diese Risiken erst einmal identifiziert, die relevanten<br />
Prozesse <strong>im</strong>plementiert <strong>und</strong> die Kennzahlen zur Überwachung<br />
46 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Menschenrechte<br />
des Schutzes der Menschenrechte verstanden, lässt sich auch<br />
der Nutzen für das Unternehmen schnell erkennen. Er zeigt<br />
sich nicht nur in Form von gesteigerter Reputation, sondern<br />
auch in Form von erhöhter Profitabilität: Das Risiko von<br />
Rechtsstreitigkeiten <strong>und</strong> den damit zusammenhängenden<br />
Kosten sinkt, Versicherungskosten sinken voraussichtlich<br />
ebenfalls, das Vertrauen von kritischen Stakehodern wächst,<br />
die Mitarbeiterbindung steigt, globale Beschaffung wird sicherer,<br />
weniger Lieferantenthemen fallen an.<br />
Es gilt, die Hürden zu überwinden<br />
Besonders wichtig ist für Unternehmen das Verständnis darüber,<br />
inwiefern der Schutz der Menschenrechte zur Steigerung der<br />
Unternehmensleistung beitragen kann. Die genannte Studie<br />
zeigt, dass Unternehmen das Thema als hilfreich bewerten<br />
be<strong>im</strong> Aufbau guter Beziehungen mit der lokalen Bevölkerung<br />
(48 Prozent), be<strong>im</strong> Schutz von Marke <strong>und</strong> Reputation (43<br />
Prozent) <strong>und</strong> bei sittlich-ethischen Erwägungen (41 Prozent).<br />
Streng genommen kann jedoch nur einer dieser Punkte als<br />
wertschöpfend kategorisiert werden: der Schutz von Marke<br />
<strong>und</strong> Reputation. So scheint es bei der Ausbildung für unternehmerische<br />
Verantwortung ebenfalls noch Nachholbedarf<br />
zu geben.<br />
Des Weiteren ist entscheidend, dass Unternehmen lernen, über<br />
kurzfristige Profitabilitätsziele hinaus zu denken <strong>und</strong> sich<br />
mit der langfristigen Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells<br />
auseinanderzusetzen. Die aktuellen Kapitalmarktregelungen<br />
verpflichten börsennotierte Unternehmen, vierteljährlich über<br />
ihre Finanzdaten zu berichten. Das zwingt Unternehmen<br />
aus Gründen der Kurspflege zugunsten ihrer Shareholder<br />
vor allem kurzfristige Profitabilitätsziele <strong>im</strong> Blick zu haben.<br />
Die zwangsläufige Folge ist ein Konflikt mit der langfristigen<br />
Ausrichtung eines Unternehmens. Diese Regelungen bedürfen<br />
einer Reform, um den unbeabsichtigten Auswirkungen des<br />
Quartalsreportings vorzubeugen, da so für alle Stakeholder<br />
ein Mehrwert geschaffen werden kann.<br />
Quelle: UmweltDialog.de<br />
Über die AutorEn<br />
Dr. Christoph Regierer ist Mitglied des Group Executive Board<br />
Mazars bei Roever Broenner Susat Mazars.<br />
Kai Michael Beckmann verantwortet bei Roever Broenner Susat<br />
Mazars den Bereich Corporate Responsibility (CR).<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
47
Agenda<br />
Unterstützung durch das<br />
Deutsche <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk<br />
Die Prinzipien des <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> entsprechen auch den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Menschenrechte, einem internationalen Referenzrahmen für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte.<br />
Dieser formuliert die gr<strong>und</strong>legende gesellschaftliche Erwartung, dass Unternehmen weltweit<br />
die Verantwortung haben, Menschenrechte zu achten, die <strong>im</strong> Zusammenhang mit der eigenen<br />
Geschäftstätigkeit <strong>und</strong> den Geschäftsbeziehungen stehen.<br />
Im Arbeitsfeld „Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte“<br />
unterstützt das DGCN Unternehmen<br />
bei der Umsetzung ihrer sozialen Verantwortung,<br />
indem es:<br />
• die Relevanz der Achtung der Menschenrechte<br />
entlang der Wertschöpfungskette<br />
für Unternehmen aufzeigt,<br />
• Unternehmen mit praktischen Lösungen<br />
<strong>und</strong> Instrumenten dazu befähigt, die<br />
menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in<br />
Managementprozessen unter Einbindung<br />
interner <strong>und</strong> externer Stakeholder zu<br />
verankern,<br />
• eine Plattform zum kontinuierlichen Austausch<br />
bietet, um Strategien <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
zu diskutieren <strong>und</strong> unternehmensbezogene<br />
Ansätze weiterzuentwickeln.<br />
Je nach Kenntnisstand können Unternehmen<br />
aus folgenden Formaten auswählen:<br />
ANGEBOTE FÜR EINSTEIGER<br />
Ein Dreiklang aus Publikationen, einem Webinar <strong>und</strong> einem Coaching ermöglicht<br />
den Einstieg in die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht − Teilnehmer erhalten<br />
konkrete Anhaltspunkte, um sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.<br />
• Die Publikationen „Menschenrechte achten − ein Leitfaden für Unternehmen“<br />
<strong>und</strong> „5 Schritte zum Management der menschenrechtlichen<br />
Auswirkungen“ zeigen die Bedeutung einzelner Menschenrechte für Unternehmen<br />
auf <strong>und</strong> begleiten Unternehmen bei ersten Maßnahmen auf dem<br />
Weg zu menschenrechtlicher Sorgfalt.<br />
• Das Online-Portal www.MR-Sorgfalt.de vermittelt Unternehmen einen<br />
schrittweisen Einstieg ins Management der menschenrechtlichen Auswirkungen<br />
<strong>und</strong> bietet handlungsorientierte Anleitung sowie weiterführende<br />
Ressourcen.<br />
• Das Gruppencoaching „Menschenrechte achten“ ermöglicht den Teilnehmern,<br />
menschenrechtliche Risiken ihres Unternehmens abzuschätzen<br />
<strong>und</strong> anzugehen. Anhand von Praxisbeispielen <strong>und</strong> Übungen vertiefen sie ihre<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> entwickeln erste eigene Lösungs- <strong>und</strong> Handlungsansätze.<br />
48 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Menschenrechte<br />
ANGEBOTE FÜR ANWENDER<br />
PEER LEARNING<br />
Für Unternehmen, die sich mit dem Thema bereits beschäftigen,<br />
stehen vertiefende Angebote zu spezifischen Themen<br />
<strong>und</strong> Herausforderungen bereit:<br />
• Webinare: Regelmäßig stattfindende Webinare greifen<br />
praxisrelevante Fragestellungen aus dem Themenbereich<br />
Menschenrechte auf, etwa zur Stakeholder-Beteiligung<br />
oder zur Stärkung der Frauen <strong>im</strong> Unternehmen.<br />
• Publikationen: In Zusammenarbeit mit Fachexperten <strong>und</strong><br />
Kooperationspartnern stellt das DGCN praktische <strong>und</strong><br />
anwendungsorientierte Leitfäden zu wichtigen Themen<br />
bereit, beispielsweise zur Ermittlung menschenrechtlicher<br />
Risiken <strong>und</strong> Auswirkungen <strong>im</strong> Unternehmen.<br />
• Mit dem Online-Tool „Human Rights Capacity Diagnostic<br />
(HRCD)“ können Unternehmen unter MR-Sorgfalt.de<br />
ihre Management-Kapazitäten bei der Umsetzung der<br />
UN-Leitprinzipien einschätzen <strong>und</strong> ausbauen.<br />
Austauschformate ermöglichen Praktikern, Lösungsansätze<br />
gemeinsam weiterzuentwickeln, sich kontinuierlich zu<br />
Themen auszutauschen <strong>und</strong> voneinander zu lernen:<br />
• Lerngruppe: Derzeit besteht eine Lerngruppe aus zehn<br />
Unternehmen verschiedener Branchen. Die Alumni der<br />
Coachings tauschen sich unter Leitung der Geschäftsstelle<br />
on- <strong>und</strong> offline über ihre Erfahrungen aus <strong>und</strong> entwickeln<br />
ihre Ansätze gemeinsam mit Experten weiter. Die Ergebnisse<br />
werden dem breiteren Netzwerk anonymisiert<br />
zugänglich gemacht.<br />
• Workshops: Bei den halbjährlichen DGCN-Netzwerktreffen<br />
finden regelmäßig Workshops zu Menschenrechtsaspekten<br />
statt. Diese Angebote werden <strong>im</strong> Anschluss<br />
online zur Verfügung gestellt <strong>und</strong> stehen damit<br />
allen Teilnehmern zur Verfügung.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
49
Agenda<br />
Es gibt keinen Weg zum Frieden,<br />
der Frieden ist der Weg.<br />
Mahatma Gandhi<br />
50 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Menschenrechte<br />
Konfliktregionen<br />
Potenzial für mehr <strong>und</strong> besseres<br />
unternehmerisches Engagement<br />
Unternehmen können in Konfliktregionen wichtige Beiträge zu Frieden <strong>und</strong> Sicherheit leisten.<br />
Durch die konfliktsensitive Ausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit <strong>und</strong> von CSR-Maßnahmen<br />
können sie vermeiden, neue Konflikte zu schaffen oder bestehende Konflikte zu verschärfen.<br />
Darüber hinaus können sie aber auch positive Beiträge zu nachhaltigem Frieden leisten.<br />
Von Dr. Melanie Coni-Z<strong>im</strong>mer<br />
Konfliktprävention ist für kein Unternehmen eine einfache<br />
Aufgabe, sie ist dennoch dringlich. Die weltweite Zahl der gewaltsam<br />
ausgetragenen Konflikte steigt. Weit mehr als 100.000<br />
Menschen starben <strong>im</strong> Jahr 2014 durch organisierte Gewalt, das<br />
ist die höchste Zahl seit 1994. Der <strong>Global</strong> Peace Index <strong>2016</strong><br />
zeichnet ebenfalls eine negative Entwicklung in den letzten<br />
zehn Jahren nach <strong>und</strong> verweist zudem auf die ökonomischen<br />
Kosten weltweiter Gewalt, die auf 13,3 Prozent des weltweiten<br />
GDP geschätzt werden.<br />
Für Unternehmen entstehen durch Gewaltkonflikte nicht nur<br />
Risiken für Personal <strong>und</strong> Anlagen oder für ihre Lieferbeziehungen,<br />
sondern auch für ihre Reputation. Unternehmen müssen<br />
nicht in einer Konfliktregion tätig sein, um einen Einfluss auf die<br />
− positive wie negative − Entwicklung von gesellschaftlichen<br />
Konflikten zu nehmen. Sie tun dies auch über ihre Lieferketten.<br />
Die wohl bekanntesten Beispiele hierfür sind <strong>im</strong> Rohstoffsektor<br />
zu finden, wie die Diskussionen um Konfliktmineralien zeigen.<br />
Was können Unternehmen tun?<br />
Für Unternehmen gilt zunächst, dass sie sich am Prinzip des<br />
„Do no harm“ orientieren sollten. Sie sollten durch ihre Aktivitäten<br />
keine neuen Konflikte verursachen oder bestehende<br />
Konflikte verschärfen. Dieser scheinbar einfache Gr<strong>und</strong>satz stellt<br />
aber bereits hohe Ansprüche an unternehmerisches Handeln.<br />
Darüber hinaus können Unternehmen auch anstreben, einen<br />
positiven Beitrag zu Frieden <strong>und</strong> Sicherheit zu leisten.<br />
Im <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> beschäftigt sich seit dessen Gründung ein<br />
Arbeitsprozess mit der Geschäftstätigkeit von Unternehmen<br />
in Konfliktregionen. Seitdem ist eine Reihe von Handreichungen<br />
für Unternehmen vorgelegt worden, an denen sich<br />
Unternehmen orientieren können. Dazu gehört etwa die <strong>im</strong><br />
Jahr 2010 veröffentlichte „Guidance on Responsible Business<br />
in Conflict-Affected and High-Risk Areas“. Ein Engagement<br />
von Unternehmen kann in sehr unterschiedlichen Bereichen<br />
sinnvoll <strong>und</strong> wünschenswert sein, je nach Konfliktphase, Konfliktgegenstand<br />
oder der Rolle des Unternehmens <strong>im</strong> Konflikt.<br />
Konflikt ist nicht gleich Konflikt. Es kann sich um soziale<br />
Unruhen oder eher lokal begrenzte Konflikte handeln. Ein<br />
Unternehmen kann mit einem akuten Gewaltkonflikt zwischen<br />
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit landesweiten<br />
Auswirkungen konfrontiert sein oder aber es handelt sich um<br />
eine Post-Konflikt-Gesellschaft, in welcher der gewaltsame<br />
Konfliktaustrag beigelegt wurde. Dementsprechend stellen<br />
sich sehr unterschiedliche Aufgaben. Diese können in der<br />
Phase eines akuten Gewaltkonflikts von der Initiierung <strong>und</strong><br />
Förderung von Dialogprozessen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen<br />
Gruppen über Friedensverhandlungen bis hin zur<br />
Nothilfe für die betroffene Bevölkerung <strong>und</strong> für Gewaltopfer<br />
reichen. In einer Nachkriegsgesellschaft stehen Aufgaben wie<br />
die Aussöhnung zwischen Bevölkerungsgruppen <strong>und</strong> die Entschädigung<br />
von Opfern, der Aufbau des Sicherheitssektors <strong>und</strong><br />
anderer staatlicher Institutionen oder auch die Reintegration<br />
von Ex-Kombattanten <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>.<br />
>><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
51
Unternehmerisches Engagement mit dem Ziel des „Do no<br />
harm“ beginnt mit der Einhaltung von Sorgfaltspflichten in<br />
der Lieferkette, aber geht auch darüber hinaus. Maßnahmen<br />
können von der Korruptionsbekämpfung, der Einhaltung von<br />
Umweltstandards, einer konfliktsensiblen Personalpolitik bis<br />
hin zur Einführung von Standards <strong>im</strong> Umgang mit privaten<br />
<strong>und</strong> öffentlichen Sicherheitskräften reichen. Unternehmen<br />
können Dialogprozesse fördern oder Projekte zur Einkommensschaffung<br />
für best<strong>im</strong>mte Bevölkerungsgruppen durchführen.<br />
Ein besonders wichtiger Bereich ist die Einhaltung<br />
von menschenrechtlichen Standards in Konfliktregionen.<br />
Menschenrechtsverletzungen können sowohl eine Ursache<br />
als auch eine Folge von Gewaltkonflikten sein. So verweisen<br />
auch die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte<br />
auf das erhöhte Risiko von Menschenrechtsverletzungen in<br />
Konfliktregionen <strong>und</strong> das Risiko, dass Unternehmen hierin<br />
verwickelt werden. Auch wenn der Nationale Aktionsplan<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte hinter den Erwartungen einiger<br />
Stakeholder zurückbleiben wird, wird dieser zukünftig eine<br />
zentrale Referenz für verantwortungsvolles unternehmerisches<br />
Verhalten in Konfliktregionen sein.<br />
Nicht jede unternehmerische Maßnahme ist ein Beitrag zu<br />
Frieden <strong>und</strong> Sicherheit. Maßnahmen müssen dem spezifischen<br />
Gewaltkonflikt angemessen sein, d. h. dessen Ursachen,<br />
Auslöser <strong>und</strong> Dynamiken adressieren. Das erfordert ein hohes<br />
Maß an Kenntnis über den entsprechenden Konfliktkontext.<br />
Die Durchführung einer Konfliktanalyse ist ein erster Schritt,<br />
um festzustellen, wie das Unternehmen einen negativen Einfluss<br />
auf einen Konflikt vermeiden kann bzw. positive Effekte<br />
max<strong>im</strong>ieren kann. Besonders größere Unternehmen <strong>und</strong> solche,<br />
die bereits seit Langem in einem best<strong>im</strong>mten Land tätig<br />
sind, mögen über entsprechende Kapazitäten <strong>und</strong> Expertise<br />
verfügen. Für kleinere Unternehmen oder solche ohne direkte<br />
Präsenz in einem Land ist dies eher schwierig <strong>und</strong> erfordert<br />
die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die über<br />
entsprechende Expertise verfügen.<br />
Entscheidend dafür, welchen Beitrag ein Unternehmen zu<br />
Frieden <strong>und</strong> Sicherheit leisten kann, ist auch, ob <strong>und</strong> wie ein<br />
Unternehmen oder eine best<strong>im</strong>mte Branche in einen Konflikt<br />
verwickelt ist. Besonders deutlich wird dies, wo es um die<br />
Förderung <strong>und</strong> den Import von Rohstoffen geht, die allzu oft<br />
eine negative Rolle bei der Entstehung <strong>und</strong> Eskalation von<br />
gewaltsam ausgetragenen Konflikten spielen. Unternehmen<br />
dieser Branchen sind direkt mit Konfliktdynamiken verb<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> haben entsprechend einen größeren direkten Einfluss.<br />
Zugleich sind die Interventionen von Unternehmen hier<br />
höchst sensibel <strong>und</strong> vorbelastet. Hier ist die Wahl geeigneter<br />
Partner eine wichtige Strategie.<br />
Geeignete Partner<br />
Die Konsultation von Stakeholdern <strong>und</strong> die Zusammenarbeit<br />
mit internationalen <strong>und</strong> lokalen Partnern kann sowohl die<br />
B4ROL<br />
Business for the Rule of Law<br />
Der UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> entwickelt seine Initiative für mehr<br />
Rechtsstaatlichkeit weiter. „Business for the Rule of Law“<br />
(B4ROL) bietet unter dem Dach des UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
einen Rahmen für Unternehmen, die sich für die Einhaltung<br />
rechtsstaatlicher Prinzipien engagieren. Die B4ROL-Initiative<br />
hat hierzu begleitende Guidelines entwickelt. Folgende<br />
zentrale Handlungsfelder werden vom UNGC ausgemacht:<br />
• Kerngeschäft<br />
• Strategisches soziales Investment<br />
• Philanthropie<br />
• Advocacy & Public Policy Engagement<br />
• Partnerschaften & „Collective Action“<br />
Weitere Infos: https://www.unglobalcompact.org/library/1341<br />
52 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Menschenrechte<br />
Analyse eines Konfliktkontexts als auch das Design <strong>und</strong> die<br />
Durchführung von Maßnahmen erleichtern. Wertvolle Informationen<br />
können dabei sowohl Organisationen in <strong>Deutschland</strong> als<br />
auch solche vor Ort in Konfliktregionen geben. Geschäftspartner<br />
<strong>und</strong> andere Unternehmen sind mit Sicherheit erste Anlaufstellen<br />
für einen Informationsaustausch. In einigen Ländern gibt<br />
es kollektive Unternehmensinitiativen, denen Unternehmen<br />
sich anschließen können. Aber gerade auch internationale<br />
Organisationen, zivilgesellschaftliche oder wissenschaftliche<br />
Institutionen, Agenturen der Entwicklungszusammenarbeit<br />
(wie die GIZ) verfügen über wichtige unabhängige Expertise.<br />
Bei der Wahl von Partnern sollte insbesondere Wert auf deren<br />
Reputation gelegt werden, vor allem darauf, ob eine Organisation<br />
bei best<strong>im</strong>mten Konfliktparteien auf Vorbehalte stoßen<br />
könnte. Eine Kooperation mit staatlichen Akteuren mag etwa<br />
in vielen Fällen wichtig oder gar unabdingbar sein. Gleichzeitig<br />
ist der Staat aber häufig eine Partei <strong>im</strong> Gewaltkonflikt <strong>und</strong><br />
damit alles andere als ein neutraler Akteur.<br />
Privatwirtschaft sollte ihre Potenziale ausschöpfen<br />
Die Realität sieht leider nicht sehr rosig aus. Unternehmen<br />
schöpfen ihr Potenzial, zu Frieden <strong>und</strong> Sicherheit beizutragen,<br />
nicht aus. Sicherlich sind Interventionen von externen Akteuren<br />
in Konfliktkontexten generell höchst sensibel <strong>und</strong> schwierig<br />
<strong>und</strong> erfordern einen langen Atem. Dies gilt nicht nur, aber eben<br />
auch für Erwartungen an Unternehmen, einen substanziellen<br />
Beitrag zur Friedensentwicklung in einer Gesellschaft zu leisten.<br />
Kein Unternehmen wird einen Gewaltkonflikt alleine lösen.<br />
Jedoch legen sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Wissenschaft<br />
<strong>im</strong>mer wieder dar, wie Unternehmen zur Verschärfung<br />
von Konfliktdynamiken beitragen. Konfliktmineralien aus der<br />
Demokratischen Republik Kongo oder Kohle aus Kolumbien<br />
sind aktuell kontrovers diskutierte Beispiele. Unternehmen,<br />
die erste Schritte zu mehr Transparenz machen <strong>und</strong> neue<br />
Maßnahmen entwickelt haben, sollten ermutigt werden, diesen<br />
Weg weiterzugehen. Insgesamt ist aber erschreckend, wie viele<br />
Unternehmen sich angesichts des Themas Gewaltkonflikte<br />
noch <strong>im</strong>mer einem kritischen Dialog verweigern <strong>und</strong> sich<br />
ihrer Verantwortung entziehen.<br />
Dilemmata für Unternehmen <strong>und</strong> die deutsche Regierung<br />
Unternehmen stehen vor einer durchaus schwierigen Aufgabe,<br />
wenn sie Beiträge zu Frieden <strong>und</strong> Sicherheit leisten wollen.<br />
Die Erwartungen der Stakeholder an unternehmerische Standards<br />
− gerade auch die der Zivilgesellschaft in <strong>Deutschland</strong><br />
− sind hoch <strong>und</strong> dürfen dies auch sein. Für Unternehmen ist die<br />
Aufgabe jedoch alles andere als einfach. Wenn ein Unternehmen<br />
sich mit seinen Auswirkungen auf gesellschaftliche Konflikte<br />
auseinandersetzen will, erfordert dies nicht nur entsprechende<br />
Kapazitäten. Es kann für Unternehmen auch zu schwierigen<br />
Situationen führen. Maßnahmen zum Lieferkettenmanagement<br />
mögen etwa auf wenig Zust<strong>im</strong>mung bei den Zulieferern stoßen<br />
oder von Konkurrenten zum eigenen Vorteil ausgenutzt werden.<br />
Ein gerne verwendetes Argument aufseiten von Unternehmen<br />
ist, dass das Unternehmen sich engagieren werde, wenn dies<br />
von der Regierung des Gastlandes gewollt ist. Regierungen −<br />
<strong>und</strong> hier besonders solche jenseits der OECD-Welt − stehen<br />
jedoch unter dem Druck, Unternehmen ein attraktives Umfeld<br />
bieten zu wollen, um von deren Tätigkeit zu profitieren.<br />
Folglich stellen sie oft keine entsprechenden Forderungen, die<br />
vielmehr von gesellschaftlichen Akteuren formuliert werden.<br />
Dieses „Schwarze-Peter-Spiel“ sollte aber keine Entschuldigung<br />
für Unternehmen dafür sein, sich nicht zu engagieren.<br />
Auch die deutsche B<strong>und</strong>esregierung ist bisher sehr zurückhaltend,<br />
wenn es darum geht, von Unternehmen ein stärkeres<br />
konstruktives Engagement in Konfliktkontexten einzufordern<br />
oder gar Mindeststandards zu setzen. Die B<strong>und</strong>esregierung<br />
sollte sich hier stärker engagieren, um von deutschen Unternehmen<br />
ein verantwortliches Handeln in Konfliktkontexten<br />
einzufordern <strong>und</strong> Unternehmen als ernsthafte Partner für die<br />
Krisenprävention zu gewinnen.<br />
Über die Autorin<br />
Dr. Melanie Coni-Z<strong>im</strong>mer ist Projektleiterin <strong>im</strong> Programmbereich<br />
„Private Akteure <strong>im</strong> transnationalen Raum“ am Leibniz-Institut<br />
Hessische Stiftung Friedens- <strong>und</strong> Konfliktforschung (HSFK).<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
53
Good Practice<br />
Die Nachhaltigkeitsmatrix<br />
Konzeption: Dr. Elmer Lenzen<br />
Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger <strong>und</strong> zeitgemäßer<br />
Energie für alle sichern.<br />
Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Kl<strong>im</strong>awandels<br />
<strong>und</strong> seiner Auswirkungen ergreifen.<br />
Ziel 14: Ozeane, Meere <strong>und</strong> Meeresressourcen <strong>im</strong> Sinne<br />
einer nachhaltigen Entwicklung erhalten <strong>und</strong><br />
nachhaltig nutzen.<br />
Ziel 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen<br />
<strong>und</strong> ihre nachhaltige Nutzung fördern,<br />
Wälder nachhaltig bewirtschaften,<br />
Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung<br />
stoppen <strong>und</strong> umkehren<br />
<strong>und</strong> den Biodiversitätsverlust stoppen.<br />
Umweltschutz<br />
Planet<br />
- Umweltperformance<br />
- CO 2<br />
-Bilanz<br />
- Scope 1 – 3<br />
- Ressourceneffizienz<br />
Arbeitsnormen<br />
Ziel 8: Dauerhaftes, inklusives <strong>und</strong> nachhaltiges<br />
Wirtschaftswachstum,<br />
produktive Vollbeschäftigung <strong>und</strong><br />
menschenwürdige Arbeit für alle fördern.<br />
Ziel 1: Armut in jeder Form <strong>und</strong> überall beenden.<br />
- Menschenrechte<br />
- Arbeitsnormen<br />
- Einbindung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
der Gemeinschaft<br />
People<br />
Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit<br />
<strong>und</strong> eine bessere Ernährung erreichen <strong>und</strong> eine<br />
nachhaltige Landwirtschaft fördern.<br />
Menschenrechte<br />
Ziel 3: Ein ges<strong>und</strong>es Leben für alle Menschen jeden Alters<br />
gewährleisten <strong>und</strong> ihr Wohlergehen fördern.<br />
Ziel 4: Inklusive, gerechte <strong>und</strong> hochwertige Bildung gewährleisten<br />
<strong>und</strong> Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.<br />
Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit <strong>und</strong> Selbstbest<strong>im</strong>mung für alle Frauen<br />
<strong>und</strong> Mädchen erreichen.<br />
MAKING<br />
LINKING GRI’S G<br />
EUROPEAN DIR<br />
AND DIVERSITY<br />
Ziel 6: Verfügbarkeit <strong>und</strong> nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser <strong>und</strong> Sanitärversorgung<br />
für alle gewährleisten.<br />
54 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Frieden<br />
Ziel 16: Friedliche <strong>und</strong> inklusive Gesellschaften <strong>im</strong> Sinne einer nachhaltigen<br />
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen <strong>und</strong><br />
effektive, rechenschaftspflichtige <strong>und</strong> inklusive Institutionen<br />
auf allen Ebenen auf bauen.<br />
Profit<br />
- Wirtschaftliche Performance<br />
- Faire Geschäftspraktiken<br />
- Produktverantwortung<br />
- Konsumentenbelange<br />
Ziel 9: Eine belastbare Infrastruktur auf bauen, inklusive<br />
<strong>und</strong> nachhaltige Industrialisierung fördern <strong>und</strong><br />
Innovationen unterstützen.<br />
Ziel 11: Städte <strong>und</strong> Siedlungen inklusiv, sicher,<br />
widerstandsfähig <strong>und</strong> nachhaltig machen.<br />
Finanzen<br />
26000<br />
Ziel 12: Für nachhaltige Konsum- <strong>und</strong><br />
Produktionsmuster sorgen.<br />
Sustainable<br />
development<br />
G o a l s<br />
- Organisationsführung<br />
- Managementansatz<br />
- Compliance<br />
- Diversity<br />
Management<br />
Korruptionsvermeidung<br />
Partnerschaft<br />
Ziel 10: Ungleichheit innerhalb von <strong>und</strong> zwischen Staaten verringern.<br />
Ziel 17: Umsetzungsmittel stärken <strong>und</strong> die globale Partnerschaft für nachhaltige<br />
Entwicklung wiederbeleben.<br />
© macondo publishing <strong>2016</strong><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
55
Good Practice<br />
Good Practice<br />
Für die redaktionellen Beiträge dieser Rubrik sind ausschließlich die Unternehmen <strong>und</strong> ihre Autoren selbst verantwortlich.<br />
58<br />
ABB<br />
60<br />
Audi<br />
62<br />
Aurubis<br />
64<br />
BASF<br />
66<br />
Bayer<br />
68<br />
Bosch<br />
70<br />
CEWE<br />
72<br />
CHT / BEZEMA<br />
74<br />
CiS<br />
76<br />
Da<strong>im</strong>ler<br />
78<br />
DAW<br />
80<br />
Deutsche Bahn<br />
82<br />
Deutsche Telekom<br />
84<br />
E.ON<br />
56 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
86<br />
Evonik<br />
88<br />
EY<br />
90<br />
Freudenberg<br />
92<br />
gmc²<br />
94<br />
HOCHTIEF<br />
96<br />
HypoVereinsbank<br />
98<br />
K+S<br />
100<br />
MAN<br />
102<br />
Merck<br />
104<br />
Miele<br />
106<br />
Roever Broenner Susat Mazars<br />
108<br />
Tchibo<br />
110<br />
TÜV Rheinland<br />
112<br />
Weidmüller<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
57
Good Practice<br />
Menschenrechte – durch<br />
Schulungen schafft ABB<br />
Kompetenz <strong>und</strong> Verständnis<br />
ABB setzt sich als global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie <strong>und</strong><br />
Automation gezielt dafür ein, die Achtung der Menschenrechte in die Unternehmensleistung<br />
einzubeziehen. In umfassenden Schulungsmaßnahmen klärt ABB Mitarbeiter darüber auf,<br />
wie sie menschenrechtsbezogene Risiken erkennen, mildern <strong>und</strong> vermeiden können.<br />
Von Ronald Popper, Leiter Corporate Responsibility, ABB<br />
2011 nahmen alle Staaten die UN-Leitprinzipien<br />
für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte<br />
an. Sie bilden den Gr<strong>und</strong>stein des<br />
Bestrebens von ABB, eine Sensibilisierung<br />
für Themen herzustellen, die <strong>im</strong><br />
Zusammenhang mit der Einhaltung der<br />
Menschenrechte existieren.<br />
Im Jahr 2000 begann ABB, sich ernsthaft<br />
in diesem Bereich zu engagieren.<br />
Damals trat das Unternehmen als Gründungsmitglied<br />
dem United Nations<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> bei <strong>und</strong> unterzeichnete<br />
dessen zehn Prinzipien, von denen die<br />
ersten beiden den Menschenrechten<br />
gewidmet sind. In den folgenden Jahren<br />
überprüfte ABB ihre Vorschriften <strong>und</strong><br />
Verfahren darauf, wo sie inner- <strong>und</strong><br />
außerhalb des Unternehmens Menschenrechtsfragen<br />
berühren. Dieser<br />
Prozess führte dazu, dass Menschenrechtskriterien<br />
in wichtige geschäftliche<br />
Entscheidungsprozesse integriert<br />
wurden <strong>und</strong> eine Menschenrechtsleitlinie<br />
(Human Rights Policy) Ende 2007<br />
eingeführt wurde.<br />
Voraussetzung für eine Verbesserung<br />
der Leistungen <strong>im</strong> Bereich der Menschenrechte<br />
sind Schulungen. Diese<br />
sensibilisieren die Teilnehmer für die<br />
Thematik <strong>und</strong> ermöglichen ihnen, ihre<br />
Kompetenzen weiterzuentwickeln. Daher<br />
ist ABB seit 2011 weltweit in diesen<br />
Bereichen aktiv.<br />
Für den Zeitraum 2014 bis 2020 legte der<br />
ABB-Konzern neun Nachhaltigkeitsziele<br />
fest. Eines der Ziele greift das Thema<br />
Menschenrechte auf. Bis zum Jahr 2020<br />
will ABB <strong>im</strong> gesamten Unternehmen ein<br />
umfassendes Verständnis in Bezug auf<br />
menschenrechtsbezogene Risiken in der<br />
Wertschöpfungskette von ABB erschaffen.<br />
Dazu hat ABB zwei Schulungsziele definiert:<br />
Bis Ende <strong>2016</strong> sollten 600 hochrangige<br />
Führungskräfte in verschiedenen<br />
Teilen der Welt darüber aufgeklärt<br />
werden, wie sie potenzielle Risiken <strong>im</strong><br />
Geschäftsbetrieb erkennen, mildern <strong>und</strong><br />
vermeiden können. Außerdem sollte bis<br />
<strong>2016</strong> ein Netzwerk von Menschenrechtsexperten<br />
aufgebaut werden, die dem<br />
Unternehmen als fachk<strong>und</strong>ige Berater<br />
zur Seite stehen. Weitere Ziele folgen<br />
für die folgenden Jahre.<br />
Das weltweite Sensibilisierungsprogramm<br />
richtet sich an hochrangige<br />
Führungskräfte in wichtigen Produktions-<br />
<strong>und</strong> Exportländern von ABB. Das<br />
Unternehmen führte das Programm<br />
bereits in 13 Ländern durch, in einigen<br />
Staaten bereits zum zweiten Mal. Die<br />
Vorgaben hat ABB bereits nahezu erfüllt:<br />
Anfang <strong>2016</strong> haben bereits über 500<br />
Mitarbeiter an den Schulungen teilgenommen.<br />
Der jüngste Kurs fand <strong>2016</strong><br />
in <strong>Deutschland</strong> statt.<br />
Die Schulungen stützen sich sowohl auf<br />
die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Menschenrechte als auch auf andere<br />
Standards <strong>und</strong> Gesetze. Teilnehmer des<br />
Seminares sollen erkennen, dass die<br />
Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht auf<br />
menschenrechtsbezogene Risiken <strong>im</strong><br />
Geschäftsbetrieb essenziell ist. Der Kurs<br />
stellt anschauliche ABB-Fallstudien aus<br />
verschiedenen Teilen der Welt vor.<br />
Der Schwerpunkt liegt auf verschiedenen<br />
Bereichen, in denen ABB Auswirkungen<br />
auf die Menschenrechte haben kann.<br />
Dies ist als Lieferant von Produkten <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen für K<strong>und</strong>enprojekte<br />
<strong>und</strong> bei der Arbeit an sensiblen Standorten<br />
der Fall. Auch der Umgang <strong>und</strong><br />
das Verhalten inner- <strong>und</strong> außerhalb des<br />
Unternehmens gegenüber Kollegen <strong>und</strong><br />
Kolleginnen zählen zu den Schulungsschwerpunkten.<br />
58 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
ABB führte die Schulungen in verschiedenen<br />
Regionen in Asien, Europa, Afrika<br />
<strong>und</strong> Nord- <strong>und</strong> Südamerika durch. Zum<br />
Teilnehmerkreis zählen Country Manager<br />
<strong>und</strong> Leiter von Geschäftsbereichen<br />
sowie Vertreter verschiedener Funktionen<br />
wie Supply Chain Management,<br />
Legal and Integrity, Human Resources<br />
<strong>und</strong> Sustainability.<br />
Ein Kompetenzentwicklungsprogramm<br />
ergänzt die derzeitigen Schulungen. Diese<br />
Initiative soll es ABB ermöglichen,<br />
potenziell nachteilige menschenrechtliche<br />
Auswirkungen zu erkennen <strong>und</strong><br />
zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird<br />
in mehreren Ländern ein Netzwerk von<br />
geschulten Mitarbeitern aufgebaut, die<br />
das Unternehmen in Menschenrechtsfragen<br />
kompetent beraten. Die Nachhaltigkeitsziele<br />
von ABB sahen vor, bis<br />
Anfang <strong>2016</strong> ein Netzwerk von speziell<br />
geschulten Beratern zu entwickeln. Das<br />
von zwei ABB-Experten geleitete detaillierte<br />
Schulungsprogramm startete 2012,<br />
<strong>und</strong> das Netzwerk wurde weit vor dem<br />
Zieldatum aufgebaut.<br />
Die Gruppe trifft sich zwe<strong>im</strong>al <strong>im</strong> Jahr,<br />
um eine Vielzahl von Fragen zu erörtern.<br />
Auf der letzten Versammlung Mitte <strong>2016</strong><br />
wurden den Mitgliedern Erkenntnisse<br />
aus einer unlängst abgehaltenen Tagung<br />
der <strong>Global</strong> Business Initiative on Human<br />
Rights vermittelt, der ABB als Mitglied<br />
angehört. Weitere Themen waren die<br />
Auswirkungen des britischen „Modern<br />
Slavery Act“, die Reaktionen von ABB auf<br />
dieses Gesetz <strong>und</strong> eine Initiative in Südafrika<br />
zur Stärkung von LGBT-Rechten.<br />
Zudem stellte ABB ein Programm vor,<br />
das bei der Lieferantenentwicklung <strong>und</strong><br />
der Erhöhung des Lieferantenstandards<br />
ebenfalls Arbeits- <strong>und</strong> Menschenrechte<br />
aufgreift.<br />
Die Versammlungen bieten ein Forum<br />
für lebhafte Diskussionen unter den 20<br />
bis 30 Netzwerkmitgliedern. Zum einen<br />
sind die Teilnehmer dadurch über aktuelle<br />
Entwicklungen <strong>und</strong> neue Erkenntnisse<br />
informiert <strong>und</strong> zum anderen können sie<br />
Führungskräfte von ABB in ihren Regionen<br />
oder Ländern kompetent beraten.<br />
Ergänzend zu den Schulungen führte<br />
ABB <strong>im</strong> Unternehmen ein E-Learning-Tool<br />
ein, das einen erweiterten Personenkreis<br />
über die Verantwortung von ABB für die<br />
Achtung der Menschenrechte aufklärt.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
59
Good Practice<br />
Integration von Flüchtlingen:<br />
So hilft Audi<br />
Angesichts der großen Not der Flüchtlinge in Europa hat die AUDI AG <strong>im</strong> September 2015<br />
eine Million Euro für Flüchtlings-Hilfsprojekte an den Produktionsstandorten Brüssel, Győr,<br />
Ingolstadt <strong>und</strong> Neckarsulm zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt stand anfangs die Soforthilfe<br />
für die vielen Menschen, die <strong>im</strong> Sommer 2015 nach Europa kamen. Mittlerweile konzentrieren<br />
sich die Hilfsprojekte vor allem auf die Themen Spracherwerb, berufliche Qualifikation <strong>und</strong><br />
kulturelle Integration, um den Geflüchteten in <strong>Deutschland</strong> neue Perspektiven zu eröffnen.<br />
Von Hannah van Basshuysen, Standortprojekte,<br />
<strong>und</strong> Jasmin Lotze, Nachhaltigkeit, AUDI AG<br />
Antrag zur finanziellen Unterstützung<br />
für Flüchtlingshilfe. Ein Spendengremium<br />
entscheidet anschließend auf Basis<br />
festgeschriebener Richtlinien, welche<br />
Summen bewilligt werden.<br />
In der Region Ingolstadt<br />
R<strong>und</strong> um den Audi Stammsitz in Ingolstadt<br />
wurden bereits mehr als 30<br />
Flüchtlingsprojekte von Mitarbeitern<br />
eingereicht <strong>und</strong> vom Unternehmen finanziell<br />
über den Spendentopf sowie<br />
organisatorisch von der Abteilung Standortprojekte<br />
unterstützt.<br />
den Hausaufgaben oder konnten einen<br />
Design-Workshop besuchen, den Audi-<br />
Designer ehrenamtlich durchführten.<br />
Schon früh wurde deutlich: Aufgr<strong>und</strong><br />
kultureller Unterschiede haben weibliche<br />
Flüchtlinge einen ganz besonderen<br />
Förderbedarf. Daher startete <strong>im</strong><br />
September <strong>2016</strong> eine weitere Klasse an<br />
der Berufsschule I in Ingolstadt nur für<br />
geflüchtete Frauen zwischen 18 <strong>und</strong><br />
30 Jahren. Audi finanziert dabei zehn<br />
Wochenst<strong>und</strong>en sozialpädagogischen<br />
Unterricht <strong>und</strong> anfallende Nachhilfe-<br />
Mitarbeiter werden in ihrem ehrenamtlichen<br />
Engagement unterstützt<br />
Audi-Mitarbeiter, die sich bereits ehrenamtlich<br />
bei einer gemeinnützigen Organisation<br />
<strong>im</strong> Bereich der Flüchtlingshilfe<br />
engagieren, können bei Audi schnell<br />
<strong>und</strong> unbürokratisch auf die finanzielle<br />
Unterstützung des Unternehmens zugreifen.<br />
Durch den regelmäßigen Kontakt<br />
mit den Einrichtungen am jeweiligen<br />
Standort wissen sie bestens, bei welchen<br />
regionalen Projekten Bedarf zur Unterstützung<br />
besteht.<br />
Im Audi Intranet findet zudem eine<br />
regelmäßige Berichterstattung über<br />
Flüchtlings-Hilfsprojekte statt. Dort<br />
finden die Audi-Mitarbeiter auch eine<br />
Auswahl an konkreten Projekten, bei<br />
denen sie sich direkt als ehrenamtliche<br />
Helfer anmelden können sowie den<br />
Das Thema Bildung n<strong>im</strong>mt hierbei einen<br />
hohen Stellenwert ein. Audi brachte<br />
relevante Akteure der regionalen Flüchtlingshilfe<br />
an einen Tisch, um die bestehenden<br />
Bedarfe zu identifizieren <strong>und</strong><br />
gemeinsam Projekte auf den Weg zu<br />
bringen. Daraus entstand ein großes<br />
Bildungsprojekt in Kooperation mit der<br />
Stadt Ingolstadt, der VHS <strong>und</strong> der Berufsschule<br />
I: 24 junge Flüchtlinge zwischen<br />
18 <strong>und</strong> 26 Jahren besuchen seit Januar<br />
<strong>2016</strong> eine Klasse an der Berufsschule in<br />
Ingolstadt. Sie werden unter anderem<br />
in den Fächern Deutsch, Mathematik<br />
<strong>und</strong> Kulturk<strong>und</strong>e unterrichtet. Mit der<br />
Fortführung der Klasse <strong>im</strong> Schuljahr<br />
<strong>2016</strong>/17 soll das Ziel der Ausbildungsreife<br />
erreicht werden. Ehrenamtliche<br />
Betreuer, darunter auch Audi-Mitarbeiter,<br />
begleiten die jungen Erwachsenen<br />
über den Unterricht hinaus<br />
− beispielsweise erhalten sie Hilfe bei<br />
Richtlinie:<br />
„Audi Förderleitlinie<br />
für gesellschaftliches<br />
Engagement“<br />
Bereits 2012 hat die AUDI AG <strong>im</strong><br />
Rahmen ihrer unternehmerischen<br />
Verantwortung eine Richtlinie für<br />
gesellschaftliches Engagement<br />
beschlossen. Sie gilt an allen Audi<br />
Produktionsstandorten weltweit<br />
<strong>und</strong> sorgt dank konkreter Förderkriterien<br />
für klare Prozesse be<strong>im</strong> Engagement<br />
in den Bereichen Bildung,<br />
Technik <strong>und</strong> Katastrophenhilfe.<br />
Daran orientiert sich Audi auch <strong>im</strong><br />
Rahmen der Flüchtlingshilfe.<br />
60 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Links: Mitarbeiter engagieren sich <strong>im</strong><br />
Rahmen des Audi Freiwilligentages für<br />
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.<br />
Rechts: Be<strong>im</strong> Verkehrserziehungskurs<br />
lernen Schüler aus Afrika, Afghanistan <strong>und</strong><br />
Pakistan die deutschen Verkehrsregeln<br />
kennen.<br />
st<strong>und</strong>en. Die Frauen lernen eine Vielzahl<br />
an möglichen Ausbildungswegen<br />
<strong>und</strong> potenziellen Berufe kennen.<br />
Auch das Thema Sicherheit fördert Audi<br />
mit regionalen Partnern: Schon <strong>im</strong> Sommer<br />
2015 finanzierte das Unternehmen<br />
integrative Schw<strong>im</strong>mkurse der DLRG. Im<br />
Juni <strong>2016</strong> nahm die von Audi unterstützte<br />
Flüchtlingsklasse am Pilotprojekt „Verkehrserziehungstag“<br />
in Zusammenarbeit<br />
mit der Verkehrswacht Ingolstadt teil. Das<br />
Projekt soll fortgeführt <strong>und</strong> auch anderen<br />
Flüchtlingsgruppen angeboten werden.<br />
Neben Kursen zur Sprachförderung <strong>und</strong><br />
interkultureller Beratung zeigen weitere<br />
von Audi unterstützte Projekte, dass Integration<br />
auch auf spielerische Art Früchte<br />
trägt: Für die Theateraufführung der<br />
Bremer Stadtmusikanten probten einhe<strong>im</strong>ische<br />
<strong>und</strong> geflüchtete Jugendliche fünf<br />
Monate lang gemeinsam <strong>und</strong> erhielten<br />
bei ihren Aufführungen dafür tosenden<br />
Applaus. Im Projekt „Willkommen <strong>im</strong><br />
Fußball“ in Zusammenarbeit mit dem<br />
FC Ingolstadt <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esligastiftung<br />
engagieren sich Audi-Mitarbeiter ehrenamtlich<br />
als Fußballtrainer.<br />
Neckarsulm<br />
Auch am Standort Neckarsulm hat Audi<br />
bereits r<strong>und</strong> 20 Projekte unterstützt.<br />
Beispielsweise hat das Unternehmen<br />
dort <strong>im</strong> Sommer 2015 Sprachkurse für<br />
Asylbewerber <strong>im</strong> Landkreis Heilbronn<br />
ermöglicht. Die Kurse bauten auf dem<br />
Gr<strong>und</strong>sprachkurs auf, der jedem Asylbewerber<br />
zusteht. In 40 Unterrichtseinheiten<br />
lernten die Teilnehmer in mehreren<br />
Gruppen nicht nur die Sprache, sondern<br />
auch die Kultur kennen.<br />
In Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsinitiative<br />
Bad Rappenau <strong>und</strong> der Jugendpflege<br />
der Stadt Bad Rappenau wurden<br />
gespendete Fahrräder wieder verkehrstauglich<br />
gemacht, Fahrradhelme <strong>und</strong><br />
-schlösser beschafft <strong>und</strong> Fahrradunterricht<br />
erteilt. Auch die Audi-Auszubildenden<br />
engagierten sich fleißig: Für die<br />
Johannes Diakonie in Mosbach errichteten<br />
sie einen Grillplatz für unbegleitete<br />
minderjährige Flüchtlinge. Das Baumaterial<br />
für Bänke, Tische <strong>und</strong> den Grill<br />
wurde von Audi finanziert.<br />
Brüssel<br />
Der Audi Standort in der Gemeinde Forêt /<br />
Forest in Brüssel konzipierte in Kooperation<br />
mit dem europäischen „think & do<br />
tank“ Pour la solidarité (PLS) ein umfassendes<br />
Flüchtlings-Hilfsprojekt: verschiedene<br />
Bedarfe der Flüchtlinge wurden<br />
identifiziert <strong>und</strong> die bereits bestehenden<br />
gemeinnützigen Einrichtungen, die in<br />
der Lage sind, diese Notwendigkeiten zu<br />
decken, finanziell unterstützt.<br />
Győr<br />
In Ungarn war die Situation der Flüchtlinge<br />
<strong>im</strong> Spätsommer 2015 besonders akut.<br />
Mithilfe der finanziellen Mittel der Audi<br />
Soforthilfe konnte das Flüchtlingslager<br />
Vámosszabadi in der Nähe von Győr winterfest<br />
gemacht werden. Um die Flüchtlinge<br />
mit warmen Getränken zu versorgen,<br />
wurde für die ungarischen Malteser ein<br />
Fahrzeug umgebaut <strong>und</strong> als Teewagen<br />
genutzt. Darüber hinaus finanzierte Audi<br />
dem Roten Kreuz einen Rettungswagen<br />
samt Ausstattung <strong>und</strong> unterstützte eine<br />
gemeinnützigen Organisation bei der<br />
kulturellen <strong>und</strong> therapeutischen Integrationsarbeit<br />
für Frauen <strong>und</strong> Kinder.<br />
Ehrenamtsvermittlung online<br />
Als Teil der Initiative „Wir zusammen“<br />
ist Audi als Marke auf der Internetplattform<br />
des Volkswagen Konzerns unter<br />
www.audi-hilft.de vertreten. Die Plattform<br />
informiert mit Artikeln, Fotos <strong>und</strong><br />
Videos über zahlreiche Projekte <strong>im</strong> Bereich<br />
der Flüchtlingshilfe. Daneben werden<br />
regelmäßig Gesuche nach ehrenamtlicher<br />
Unterstützung oder Sachspenden<br />
eingestellt. Die offene Plattform bietet<br />
somit die Möglichkeit, sich unverbindlich<br />
über die Bedarfe in den Regionen<br />
der Unternehmensstandorte Ingolstadt<br />
<strong>und</strong> Neckarsulm zu informieren <strong>und</strong><br />
sich bei Interesse an die angegebene<br />
Kontaktperson zu wenden. Auch über<br />
die Werksgrenzen hinaus können sich<br />
Interessierte informieren <strong>und</strong> sind eingeladen,<br />
sich in sozialen Projekten zu<br />
engagieren.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
61
Good Practice<br />
Aurubis‘ Beitrag zu einer<br />
nachhaltigen Entwicklung<br />
Aurubis ist der führende integrierte Kupferkonzern <strong>und</strong> der größte Kupferrecycler weltweit. Gemäß<br />
dem Leitspruch „Our Copper for your Life“ produziert Aurubis hochreines <strong>und</strong> hochwertiges<br />
Kupfer <strong>und</strong> verarbeitet es weiter zu Vorprodukten. Pro Jahr werden mehr als eine Million Tonnen<br />
börsenfähiger Kupferkathoden hergestellt, davon über ein Drittel aus Recyclingmaterialien.<br />
globalen nachhaltigen Entwicklungsziele<br />
der Vereinten Nationen, der Sustainable<br />
Development Goals (SDG), möchte der<br />
Kupferproduzent seinen Beitrag leisten.<br />
Der Anspruch ist, Aurubis als ein Nachhaltigkeit<br />
lebendes Unternehmen erfolgreich<br />
zu führen. Dies ist nicht allein für<br />
die r<strong>und</strong> 6.300 Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />
Mitarbeiter von großer Bedeutung, sondern<br />
auch für die Nachbarn, Lieferanten,<br />
Partner <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en.<br />
Die Gewinnung <strong>und</strong> Nutzung von Metallen<br />
sind weltweit gr<strong>und</strong>legende Voraussetzungen<br />
für technischen Fortschritt<br />
<strong>und</strong> damit höheren Lebensstandard. Aurubis<br />
trägt hier zur Bedarfsdeckung bei.<br />
Sowohl pr<strong>im</strong>äre als auch sek<strong>und</strong>äre Rohstoffe<br />
werden beschafft <strong>und</strong> verarbeitet.<br />
Aurubis ist sich der Verantwortung in der<br />
Lieferkette bewusst <strong>und</strong> arbeitet daran,<br />
die Umsetzung von ökologischen <strong>und</strong><br />
sozialen Standards <strong>und</strong> damit ein nachhaltiges<br />
Wirtschaften an verschiedenen<br />
Standorten der Zulieferer zu fördern. Als<br />
elementares Prüfinstrument für nachhaltige<br />
Standards wird beispielsweise ein<br />
Business Partner Screening eingesetzt.<br />
Im Jahr <strong>2016</strong> beging Aurubis gemäß dem<br />
Motto „150 Jahre Zukunft“ das 150. Jubiläum<br />
der Firmengründung. Seit jeher sind<br />
nachhaltiges Handeln <strong>und</strong> Wirtschaften<br />
zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie<br />
<strong>und</strong> spielen bei sämtlichen Aktivitäten<br />
des Konzerns eine Rolle. Das<br />
schließt die vielschichtigen Aspekte der<br />
Lieferketten ebenso mit ein wie den sorgsamen<br />
Umgang mit Umwelt <strong>und</strong> Ressourcen<br />
<strong>und</strong> die Menschen <strong>im</strong> <strong>Fokus</strong> ihres<br />
täglichen Miteinanders, ihre Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Sicherheit, ihre Qualifikationen, ihre<br />
Motivation, ihre Zusammenarbeit. Um zu<br />
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen<br />
zu können, hat das Unternehmen sich in<br />
seiner Nachhaltigkeitsstrategie 15 klare<br />
Ziele gesetzt.<br />
Die Aurubis Nachhaltigkeitsstrategie<br />
Seit Ende 2014 n<strong>im</strong>mt Aurubis am <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> der Vereinten Nationen teil<br />
<strong>und</strong> unterstützt dessen Prinzipien zur<br />
sozialen <strong>und</strong> ökologischen Gestaltung der<br />
<strong>Global</strong>isierung. Auch zur Erreichung der<br />
62 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Für einen wirksamen <strong>und</strong> nachhaltigen<br />
Umweltschutz sind modernste Techniken<br />
unabdingbar. Durch eine kontinuierliche<br />
Investition in die Anlagen − seit<br />
dem Jahr 2000 wurden <strong>im</strong> Bereich der<br />
Kupfererzeugung r<strong>und</strong> 530 Mio. € allein<br />
in Umweltschutzmaßnahmen investiert<br />
− hat Aurubis <strong>im</strong> weltweiten Vergleich<br />
eine Spitzenposition <strong>im</strong> Umweltschutz<br />
erreicht. Qualität <strong>und</strong> Umweltschutz stehen<br />
<strong>im</strong> gesamten Produktionsprozess <strong>im</strong><br />
Vordergr<strong>und</strong>; die Managementsysteme<br />
sind nach anerkannten internationalen<br />
Standards zertifiziert.<br />
Hier wird 1.200 Grad heißes Kupfer bei Aurubis vergossen.<br />
Kupfer trägt maßgeblich zur Energiewende<br />
<strong>und</strong> zur Verbesserung der CO 2<br />
-Bilanz<br />
bei, denn es ist Bestandteil innovativer<br />
Technologieentwicklungen <strong>und</strong> kann<br />
<strong>im</strong>mer wieder <strong>und</strong> ohne Qualitätsverlust<br />
recycelt werden. Durch das umweltfre<strong>und</strong>liche<br />
<strong>und</strong> energieeffiziente Multi-<br />
Metal-Recycling schließt Aurubis den<br />
Wertstoffkreislauf für Kupfer sowie viele<br />
weitere Metalle <strong>und</strong> Elemente. Mithilfe<br />
des Ansatzes „Closing the loop“ werden<br />
K<strong>und</strong>en gleichzeitig zu Lieferanten <strong>und</strong><br />
der Vertrieb der Kupferprodukte mit der<br />
Beschaffung von Recycling-Rohstoffen<br />
verb<strong>und</strong>en. Das Recycling bildet in einer<br />
rohstoffarmen Region wie Europa eine<br />
wichtige Rohstoffquelle für die Zukunft.<br />
Politisch wird dem Recyclinggedanken<br />
unter anderem durch die europäische<br />
Direktive „Waste Electrical and Electronic<br />
Equipment“ (WEEE) für Elektro- <strong>und</strong><br />
Elektronik-Altgeräte <strong>und</strong> dem Gesetzespaket<br />
der EU-Kommission zur Kreislaufwirtschaft<br />
„Circular Economy Package“<br />
Rechnung getragen. Aurubis war zudem<br />
an der Entwicklung des freiwilligen<br />
„WEEE End Processor Standard“ beteiligt,<br />
der einen weltweiten Wettbewerb um die<br />
Verwertung von Elektronikschrotten auf<br />
höchstem technischen Niveau zum Ziel<br />
hat − ein wichtiger Beitrag zu international<br />
geordneten Verwertungs- <strong>und</strong> Entsorgungsprozessen.<br />
2015 wurde Aurubis<br />
entsprechend zertifiziert. Des Weiteren<br />
wurde Aurubis von der Investoreninitiative<br />
„Carbon Disclosure Project“ (CDP)<br />
ausgezeichnet. Zu dem guten Abschneiden<br />
haben die Nachhaltigkeitsstrategie<br />
sowie die transparente Darstellung des<br />
Umgangs mit den Chancen <strong>und</strong> Risiken<br />
des Kl<strong>im</strong>awandels geführt. Auch die Kupferprodukte,<br />
die zu einer Effizienzsteigerung<br />
von Anwendungen beitragen, sowie<br />
die effektiven Produktionsprozesse, das<br />
Energiemanagement <strong>und</strong> Investitionen<br />
in Energie- <strong>und</strong> CO 2<br />
-Effizienzopt<strong>im</strong>ierungen<br />
flossen in die Bewertung ein. Der<br />
produktbezogene CO 2<br />
-Ausstoß konnte<br />
beispielsweise seit dem Jahr 2000 um 36<br />
Prozent vermindern werden.<br />
Aurubis hat sich ein konzernweites Kl<strong>im</strong>aschutzziel<br />
gesetzt − die Reduktion<br />
der CO 2<br />
-Emissionen um 100.000 Tonnen<br />
CO 2<br />
durch Energieeffizienzprojekte <strong>und</strong><br />
interne Stromproduktion bis 2018. Ein<br />
Beitrag dazu: Innerhalb des Hamburger<br />
Kl<strong>im</strong>aschutzkonzeptes hat sich das Unternehmen<br />
verpflichtet, weitere 12.000<br />
Tonnen CO 2<br />
pro Jahr einzusparen. Es wird<br />
aber schwieriger, hier signifikante Fortschritte<br />
zu erreichen, denn schon heute<br />
besteht ein Konflikt zwischen Energieeffizienz<br />
<strong>und</strong> Ressourcenschonung. Ein<br />
wachsender Anteil des Stroms entfällt auf<br />
Umweltschutzmaßnahmen. Außerdem:<br />
Es ist eine volatile Produktionsfahrweise<br />
erwünscht, um regenerative Energien<br />
besser nutzen zu können, was aber die<br />
Energieeffizienz eher vermindert. Aurubis<br />
stellt sich dieser Herausforderung<br />
<strong>und</strong> geht innovative Wege. Neben großen<br />
Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz<br />
− wie an den Standorten Hamburg,<br />
Lünen <strong>und</strong> Pirdop die Dampfturbinen zur<br />
Stromerzeugung aus Prozessabwärme −<br />
sind auch ein energiebewusstes Verhalten<br />
<strong>und</strong> die Mitarbeit aller Mitarbeiter gefragt.<br />
Um für das Thema zu sensibilisieren, werden<br />
Energietage durchgeführt; darüber<br />
hinaus finden regelmäßig Energieschulungen<br />
statt.<br />
2012 hat Aurubis in Hamburg die „Partnerschaft<br />
für Luftgüte <strong>und</strong> schadstoffarme<br />
Mobilität“ unterzeichnet, dessen Ziel<br />
die Reduktion der Stickstoffemissionen<br />
ist, die insbesondere durch den Verkehr<br />
verursacht werden.<br />
Nachhaltigkeit beginnt in der<br />
Ausbildung<br />
Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung sind zentrale<br />
Bestandteile unserer Personalpolitik,<br />
denn eine hochwertige Ausbildung <strong>und</strong><br />
gezielte Investitionen in die Qualifikation<br />
der Mitarbeiter sichern den langfristigen<br />
Erfolg eines Unternehmens. Da<br />
der Wettbewerb um talentierte <strong>und</strong> gut<br />
ausgebildete Mitarbeiter durch den demografischen<br />
Wandel zun<strong>im</strong>mt, bilden<br />
wir selber aus <strong>und</strong> stellen sicher, dass<br />
wir über eine ausreichende Zahl an qualifizierten<br />
Mitarbeitern verfügen. Dabei<br />
verfolgt Aurubis stetig das Ziel, mehr<br />
Frauen für die Mitarbeit <strong>im</strong> Konzern zu<br />
gewinnen <strong>und</strong> gezielt zu fördern.<br />
Ebenso wichtig ist, dass bereits die Auszubildenden<br />
ihren Beitrag dazu leisten,<br />
die vereinbarten Maßnahmen <strong>und</strong> Ziele<br />
der Aurubis-Nachhaltigkeitsstrategie<br />
umzusetzen. Deshalb ist Nachhaltigkeit<br />
inzwischen ein fester Bestandteil der<br />
Ausbildung. Den Auftakt haben Hamburger<br />
Auszubildende <strong>im</strong> Jahr 2015 mit<br />
einer Nachhaltigkeitswoche gebildet.<br />
Sie analysierten den Weg des Kupfers<br />
bei Aurubis unter dem Gesichtspunkt<br />
der Nachhaltigkeit <strong>und</strong> stellten die Ergebnisse<br />
ihrer Arbeit <strong>im</strong> Rahmen einer<br />
Veranstaltung aus.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
63
Good Practice<br />
Starting Ventures helfen<br />
be<strong>im</strong> Erreichen der globalen<br />
Entwicklungsziele<br />
Wir wollen zu einer Welt beitragen, die eine lebenswerte Zukunft mit besserer Lebensqualität für<br />
alle bietet, <strong>und</strong> haben dies in unserem Unternehmenszweck „We create chemistry for a sustainable<br />
future“ verankert. Innovationen aus der Chemie nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein, denn<br />
sie liefern einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft einer wachsenden Weltbevölkerung.<br />
Mit unserem Starting Ventures Programm wollen wir Menschen, deren elementare<br />
Gr<strong>und</strong>bedürfnisse derzeit noch nicht erfüllt sind, dabei unterstützen, ihr Einkommen <strong>und</strong> ihre<br />
Lebensqualität aus eigener Kraft zu verbessern. Wir tragen damit zum Erreichen der globalen<br />
Entwicklungsziele der UN bei.<br />
Von Courtney Lee Hagewood <strong>und</strong> David Möller, Sustainability Strategy, BASF<br />
Mehr als eine Milliarde Menschen haben<br />
sich seit 1990 aus extremer Armut<br />
befreien können. Trotz dieses bemerkenswerten<br />
Erfolges haben <strong>im</strong>mer noch<br />
vier Milliarden Menschen − die Mehrheit<br />
der Weltbevölkerung − nur ein geringes<br />
Einkommen. Weltweit strebt diese bis<br />
2050 am stärksten wachsende Bevölkerungsschicht<br />
nach besserer Beschäftigung,<br />
um sich bessere Ernährungs-,<br />
Wohn- <strong>und</strong> Hygieneverhältnisse leisten<br />
zu können − für sich selbst <strong>und</strong> für ihre<br />
Kinder.<br />
Armut bekämpfen, Nahrungssicherheit<br />
<strong>und</strong> Wasserversorgung sicherstellen,<br />
Energie- <strong>und</strong> Kl<strong>im</strong>awandel − das sind<br />
auch die Ziele der 17 umfassenden <strong>und</strong><br />
übergreifenden UN Sustainable Development<br />
Goals. BASF hat sich in Arbeitsgruppen<br />
aktiv an der Entwicklung der UN<br />
SDGs beteiligt. Insbesondere Themen wie<br />
Ernährung, sauberes Wasser <strong>und</strong> sanitäre<br />
Anlagen, erneuerbare Energien, Beschäftigung<br />
<strong>und</strong> wirtschaftliches Wachstum,<br />
Innovationen <strong>und</strong> Infrastruktur, nachhaltiger<br />
Städtebau, verantwortungsvolle<br />
Produktion <strong>und</strong> Verbrauch, Kl<strong>im</strong>aschutz<br />
<strong>und</strong> die internationale Zusammenarbeit<br />
sind von großer Bedeutung für BASF als<br />
global agierendes Unternehmen, das mit<br />
seinen Innovationen zu einer nachhaltigen<br />
Zukunft beiträgt.<br />
Die Rolle der Unternehmen<br />
Alle Gesellschaftsbereiche sind gefragt,<br />
wenn es darum geht, diese Probleme zu<br />
mindern. Dazu gehört auch die Privatwirtschaft,<br />
die auf vielfältige Weise die<br />
Lebensqualität einkommensschwacher<br />
Menschen positiv beeinflussen kann. Unternehmen<br />
ermöglichen sowohl Chancen<br />
für Beschäftigung <strong>und</strong> Unternehmertum<br />
als auch den Zugang zu bezahlbaren<br />
Produkten <strong>und</strong> Dienstleistungen, die<br />
wesentliche Gr<strong>und</strong>bedürfnisse erfüllen.<br />
Einkommensschwache Bevölkerungsschichten<br />
stellen weltweit aber auch ein<br />
großes Potenzial für Unternehmen dar.<br />
Als Zulieferer, Distributoren <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en<br />
in ihre Wertschöpfungsketten integriert,<br />
erschließen sich für Unternehmen vielfältige<br />
Möglichkeiten für Innovation <strong>und</strong><br />
Wachstum in neuen Märkten.<br />
Als global agierendes Chemieunternehmen<br />
ist BASF gut positioniert, um diese<br />
Rolle zu erfüllen. Unser breiter Marktzugang<br />
<strong>und</strong> die Entwicklung unseres<br />
Portfolios zu nachgelagerten Industrien<br />
ermöglichen uns, positive Veränderungen<br />
anzustoßen. Die enge Zusammenarbeit<br />
mit der Zivilgesellschaft, dem<br />
öffentlichen Sektor <strong>und</strong> Partnern entlang<br />
der Wertschöpfungskette sind dabei ein<br />
Schlüssel zum Erfolg.<br />
Beispielsweise hat unsere Initiative<br />
zur Nahrungsmittelanreicherung den<br />
64 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Mangel an Mikronährstoffen bei Millionen<br />
von Menschen in Entwicklungsländern<br />
erfolgreich reduziert − eine der<br />
weitverbreitetsten Formen der Mangelernährung.<br />
Projekte wie dieses haben<br />
uns vielfältige Lernerfahrungen geboten<br />
<strong>und</strong> uns <strong>2016</strong> in die Lage versetzt, den<br />
nächsten Schritt zu tun.<br />
Was wir tun<br />
Starting Ventures ist ein konzernweites<br />
Programm. Es schafft unternehmerische<br />
Freiräume für Lösungen, die Menschen<br />
mit geringem Einkommen die<br />
Möglichkeit geben, ihre Lebensqualität<br />
aus eigener Kraft zu verbessern. Zu<br />
diesen unternehmerischen Lösungen<br />
gehören beispielsweise die Vermittlung<br />
von Fähigkeiten für verbesserte Beschäftigungschancen<br />
sowie der Zugang zu<br />
bezahlbaren Produkten für ges<strong>und</strong>e Ernährung,<br />
Hygiene <strong>und</strong> Wohnen. Starting<br />
Ventures konzentriert sich auf neue Geschäftsmodelle<br />
<strong>und</strong> sektorübergreifende<br />
Partnerschaften, um Zugang zu neuen<br />
Märkten zu erhalten. Das Programm<br />
berücksichtigt dabei auch bisherige<br />
Markteintrittsbarrieren, wie Verbraucherverhalten,<br />
finanzielle Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> unzureichende Infrastruktur.<br />
Das Programm Starting Ventures stellt<br />
unseren Geschäftseinheiten die Ressourcen,<br />
diese neuen Wege des Unternehmertums<br />
zu verfolgen. Außerdem<br />
fördert das Programm den Austausch von<br />
Erfahrungen <strong>und</strong> Expertise innerhalb<br />
der gesamten Organisation.<br />
Starting Ventures<br />
Die Auswahl der Projektideen durch<br />
einen zentralen BASF-Lenkungskreis<br />
erfolgt nach Kriterien in drei<br />
Bereichen: gesellschaftliche Wirkung,<br />
innovativer Geschäftsansatz<br />
sowie Geschäftspotenzial. Die<br />
UN Sustainable Development Goals<br />
(Nachhaltigkeitsziele der Vereinten<br />
Nationen) bilden die Gr<strong>und</strong>lage für<br />
die Kriterien zu gesellschaftlicher<br />
Wirkung.<br />
Das Programm wurde <strong>2016</strong> erfolgreich gestartet.<br />
Die vom zentralen Lenkungskreis<br />
(s. Infobox) ausgewählten Projektvorschläge<br />
aus verschiedenen Geschäftseinheiten<br />
spiegeln die Vielfalt unserer K<strong>und</strong>enindustrien<br />
<strong>und</strong> unseren weltweiten<br />
Marktzugang wieder. Die ausgewählten<br />
Projekte erhalten finanzielle Unterstützung<br />
durch einen internen Fonds.<br />
Ein Projektbeispiel − Espacio Inclusivo<br />
− stammt aus der Automobilindustrie<br />
in Südamerika. Das Projekt baut auf<br />
vorangegangenen Erfolgen mit Jugendlichen<br />
aus strukturschwachen städtischen<br />
Gebieten in Chile auf <strong>und</strong> weitet das<br />
Projekt jetzt auch auf Argentinien <strong>und</strong><br />
Uruguay aus. In diesen Ländern haben<br />
Jugendliche aus einkommensschwachen<br />
Familien häufig nur geringe Chancen<br />
auf eine Berufsausbildung. Gleichzeitig<br />
leiden die Werkstätten zur Fahrzeuglackierung<br />
<strong>und</strong> -reparatur − unsere<br />
K<strong>und</strong>en − an einem Fachkräftemangel.<br />
Wir haben deshalb begonnen, arbeitslose<br />
Jugendliche als Fahrzeuglackierer<br />
auszubilden. Damit versetzen wir sie in<br />
die Lage, Stellen bei unseren K<strong>und</strong>en<br />
zu besetzen. Die bisherigen Erfolge in<br />
Chile haben gezeigt, dass die Jugendlichen,<br />
die erfolgreich ihre Ausbildung<br />
beendet haben, mindestens 55 Prozent<br />
mehr als den gesetzlichen Mindestlohn<br />
verdienen.<br />
Das Projekt Espacio Inclusivo bildet in Chile,<br />
Argentinien <strong>und</strong> Uruguay Jugendliche als<br />
Fahrzeuglackierer aus.<br />
Unser Ansatz<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> globaler unternehmerischer<br />
Aktivitäten arbeiten wir daran,<br />
die sich wandelnden Bedarfe <strong>und</strong> Erwartungen<br />
unserer Stakeholder zu erfüllen.<br />
Unsere Rolle als Unternehmen beruht<br />
dabei auf einem Verständnis, das neue<br />
Entwicklungen wie die Leitprinzipien<br />
für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte oder<br />
auch die nachhaltigen Entwicklungsziele<br />
der Vereinten Nationen integriert.<br />
Starting Ventures ist unser Weg, einkommensschwache<br />
Menschen zum<br />
wechselseitigen Vorteil in die Wirtschaft<br />
einzubinden <strong>und</strong> damit langfristigen<br />
Wert für unser Geschäft <strong>und</strong> zugleich<br />
eine positive gesellschaftliche Wirkung<br />
zu erzielen. Indem sich beide Ziele gegenseitig<br />
verstärken, ermöglichen sie<br />
den kontinuierlichen Ausbau unserer<br />
Aktivitäten: je größer der Beitrag zu<br />
unserem langfristigen Erfolg, desto<br />
größer unsere positive Wirkung in der<br />
Gesellschaft.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
65
Good Practice<br />
Intelligente Lösungen für die<br />
Landwirtschaft von morgen<br />
Die Ernährungssicherheit zählt zu den dringlichsten Herausforderungen einer stetig wachsenden<br />
Weltbevölkerung. Neue Anbauflächen für die weitere landwirtschaftliche Entwicklung sind jedoch<br />
knapp. Nur mit einer nachhaltigen Landwirtschaft lassen sich auch in Zukunft genügend Nahrungsmittel<br />
für uns <strong>und</strong> unsere Nutztiere produzieren. Mit seinem innovativen Geschäftsmodell<br />
„Digital Farming“ trägt Bayer zur Bewältigung dieser Aufgabe bei. Bayer unterstützt damit das<br />
zweite Ziel nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen: „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit<br />
<strong>und</strong> eine bessere Ernährung erreichen <strong>und</strong> eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“<br />
<strong>und</strong> stellt sein Engagement für den UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> unter Beweis.<br />
Von Tobias Menne,<br />
Leiter Digital Farming, Bayer<br />
Die Situation ist alarmierend: Laut UN-<br />
Studien wird die Weltbevölkerung bis<br />
2050 auf mehr als neun Milliarden Menschen<br />
steigen. Infolgedessen steigt auch<br />
die globale Nachfrage nach Nahrungsmitteln.<br />
Gleichwohl ist die verfügbare<br />
Anbaufläche, mit der die stetig steigende<br />
Weltbevölkerung versorgt werden muss,<br />
begrenzt. Die Landwirte müssen somit<br />
höhere Erträge auf derselben Fläche erwirtschaften.<br />
Deshalb ist es notwendig,<br />
die landwirtschaftlichen Produktionsmittel<br />
wie Saatgut, Dünge- <strong>und</strong> Pflanzenschutzmittel<br />
so genau wie möglich<br />
zu wählen, um die Nahrungsmittelproduktion<br />
auf Dauer zu sichern.<br />
Vorteile von Digital Farming<br />
aller wetterbedingten Ernteschäden<br />
lassen sich mithilfe von Wettermodellen<br />
<strong>und</strong> Methoden der Präzisionslandwirtschaft<br />
vermeiden.<br />
Quellen: IBM Research, CEMA, FAO<br />
kann der Landwirt jährlich sparen,<br />
indem er ein Satellitennavigationssystem<br />
mit einem Autopilotsystem<br />
kombiniert.<br />
Für Bayer ist die digitale Innovation ein<br />
wichtiger Schlüssel zu einer Produktionssteigerung,<br />
bei der die Ressourcen des<br />
Planeten effizienter <strong>und</strong> nachhaltiger<br />
genutzt werden können. Denn mit ihr<br />
lassen sich höhere Erträge erzielen, ohne<br />
die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft<br />
außer Acht zu lassen. Anstatt die<br />
Komplexität zu erhöhen, macht sie die<br />
Welt der Landwirtschaft berechenbarer<br />
<strong>und</strong> hilft den Landwirten, das zu tun,<br />
was sie am besten könne: Nahrungs- <strong>und</strong><br />
Futtermittel zu produzieren − jetzt <strong>und</strong><br />
in Zukunft.<br />
Digitalisierung der Landwirtschaft<br />
Ackerland kann sehr unterschiedlich<br />
beschaffen sein, selbst innerhalb ein <strong>und</strong><br />
muss die landwirtschaftliche<br />
Produktivität steigen, um die Menschheit<br />
2050 ausreichend zu ernähren. Digitale<br />
Innovationen wie das Internet der Dinge<br />
können ein Wachstumsmotor sein.<br />
dieselben Parzelle, je nach Topografie,<br />
Bodenart <strong>und</strong> bodenbedingter Wasser<strong>und</strong><br />
Nährstoffversorgung der Pflanzen.<br />
Alle diese Faktoren wirken sich auf die<br />
Biomasse aus. Digital Farming − die<br />
nächste Entwicklungsstufe in der Digitalisierung<br />
der Landwirtschaft − wird in<br />
Zukunft hyperlokale <strong>und</strong> feldspezifische<br />
Informationen liefern können, die ein<br />
schnelles <strong>und</strong> intelligentes Eingreifen<br />
auf dem Feld ermöglichen.<br />
Unser Unternehmen bietet großen <strong>und</strong><br />
kleineren Betrieben in aller Welt aktuell<br />
eine Vielzahl digitaler Entscheidungshilfen.<br />
Ein Expert-Tool liefert dem<br />
Landwirt beispielsweise Analysen zum<br />
Infektionsprozess bei Pilzerkrankungen,<br />
zur Entwicklung <strong>und</strong> Ausbreitung von<br />
Schädlingen <strong>und</strong> zum wetterbedingten<br />
Lagerrisiko. Anwendungen zur Unkrauterkennung<br />
helfen dem Landwirt, die<br />
richtige Behandlung zu wählen, <strong>und</strong><br />
digitale Anwendungen, die zurzeit noch<br />
66 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
entwickelt werden, sollen Kleinbauern<br />
bei der Betriebsführung unterstützen.<br />
Echtzeitanalysen werden in nicht allzu<br />
ferner Zukunft helfen, Schädlinge,<br />
Krankheiten <strong>und</strong> Unkräuter, die die<br />
Ernte gefährden, bis auf den Quadratmeter<br />
genau zu lokalisieren. Sensoren<br />
<strong>und</strong> bildgebende Verfahren grenzen das<br />
Problem präzise ein <strong>und</strong> ermöglichen es<br />
dem Landwirt, das Problem direkt an der<br />
Ursache zu bekämpfen. Feldspezifische<br />
Modelle <strong>und</strong> die Integration von öffentlichen<br />
<strong>und</strong> eigenen Daten ermöglichen<br />
zielgerichtete Empfehlungen, auf die<br />
sich der Landwirt verlassen kann.<br />
Schon jetzt ist eine Vielzahl von Daten<br />
vorhanden. Moderne Satellitentechnik<br />
liefert detaillierte Karten <strong>und</strong> Wetterdaten<br />
oder berechnet sogar die Biomasse<br />
eines Feldes, um das Ertragspotenzial<br />
oder mögliche Unkrautprobleme zu best<strong>im</strong>men.<br />
Im Betrieb selbst wird anhand<br />
der Daten, die der Landwirt <strong>im</strong> Laufe<br />
der Anbausaison erfasst, eine Datenspur<br />
erstellt. Die verwendete Saatgutsorte,<br />
GPS- <strong>und</strong> Produktdaten der Maschinen,<br />
Wasserverbrauch <strong>und</strong> Erträge − ein<br />
Großteil dieser Informationen wird gesammelt<br />
<strong>und</strong> gespeichert, um einen<br />
Vergleich über die Anbausaison hinweg<br />
zu ermöglichen. Die Frage lautet:<br />
Wie lässt sich diese Unmenge an Daten<br />
sinnvoll auf bereiten? Letztlich kommt<br />
es darauf an, die ungeheuren Datenmengen<br />
richtig zu interpretieren. Der<br />
technische Fortschritt macht es möglich,<br />
dass Software-Programme unzählige<br />
Datenpunkte durchforsten, analysieren,<br />
kombinieren <strong>und</strong> in Beziehung zueinander<br />
setzen, um daraus eine individuelle<br />
Empfehlung abzuleiten.<br />
Wie können alle diese Daten<br />
nutzbar gemacht werden?<br />
Digital Farming: Landwirte erhalten unmittelbar<br />
spezifische Informationen für eine<br />
opt<strong>im</strong>ale Bewirtschaftung einer Ackerfläche.<br />
Wir übertragen diese Rohdaten in praxisrelevante<br />
<strong>und</strong> verwertbare Entscheidungshilfen,<br />
die es den Landwirten ermöglichen,<br />
Böden <strong>und</strong> Wasserressourcen<br />
besser zu bewirtschaften <strong>und</strong> die Auswirkungen<br />
best<strong>im</strong>mter Maßnahmen<br />
genauer abzuschätzen, zum Beispiel die<br />
Wahl des Saatguts, die Dosierung von<br />
Pflanzenschutzmitteln <strong>und</strong> den Erntezeitpunkt.<br />
Risiken lassen sich so leichter<br />
beherrschen, Ressourcen schonen <strong>und</strong><br />
die Erträge steigen nachhaltig. Die individuellen<br />
Empfehlungen lassen sich<br />
direkt auf die Maschinen des Landwirts<br />
übertragen. Geoinformationssysteme<br />
spielen demzufolge eine wichtige Rolle<br />
für die nachhaltige Landwirtschaft der<br />
Zukunft. Wir wollen das Angebot der<br />
digitalen Dienste für unesere K<strong>und</strong>en<br />
weiter ausbauen.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wir<br />
wollen den Landwirten helfen, ihre landwirtschaftlichen<br />
Entscheidungen mit<br />
noch nie dagewesener Präzision, Effizienz<br />
<strong>und</strong> Einfachheit umzusetzen. Indem<br />
wir den perfekten Zeitpunkt <strong>und</strong> die<br />
ideale Menge einer Produktanwendung<br />
für jedes Feld best<strong>im</strong>men, personalisieren<br />
wir quasi unsere Produkte für jeden<br />
Einzelnen. Diese Unterstützung wird eines<br />
Tages bis zum letzten Quadratmeter<br />
eines Feldes möglich sein.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
67
Good Practice<br />
Gelebte Integration<br />
Bosch begreift nachhaltiges unternehmerisches Handeln als einen festen Bestandteil seiner<br />
Unternehmensstrategie. Die Orientierung an einem gemeinsamen Wertekanon hat dabei eine<br />
tiefe Verwurzelung: So folgte das Unternehmen während seiner gesamten Entwicklung den<br />
ethischen Prinzipien <strong>und</strong> sozialen Aktivitäten seines Gründers Robert Bosch. Dieses gelebte<br />
Verantwortungsbewusstsein zeigt sich unter anderem <strong>im</strong> persönlichen Engagement der Belegschaft<br />
bei der Integration von Flüchtlingen.<br />
Von Bernhard Schwager, Leiter Geschäftsstelle<br />
Nachhaltigkeit, Bosch<br />
Die <strong>im</strong>mer noch große Zahl von Flüchtlingen,<br />
die derzeit auf der Suche nach<br />
Sicherheit <strong>und</strong> einer besseren Zukunft<br />
nach Europa kommen, stellt die Mitgliedstaaten<br />
vor teils enorme Herausforderungen.<br />
Seit 2015 steht auch <strong>Deutschland</strong><br />
vor einer besonderen Aufgabe: Weit über<br />
eine Million Menschen haben seitdem<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Schutz gesucht.<br />
Diese Situation sorgt für kontroverse<br />
Diskussionen <strong>und</strong> wirft viele Fragen auf.<br />
Ungeachtet dessen ist sich die Mehrheit<br />
aus Politik, Wirtschaft <strong>und</strong> Bevölkerung<br />
einig: Um die Lage in den Griff zu bekommen,<br />
müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten.<br />
Und dabei ist auch der Beitrag<br />
der Wirtschaft wichtig, denn gerade bei<br />
der Integration von Flüchtlingen können<br />
Unternehmen vielfältig unterstützen.<br />
Spenden für lokale<br />
Hilfsorganisationen<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> fanden 2015 <strong>und</strong><br />
<strong>2016</strong> in verschiedenen Bosch-Ländern gezielte<br />
Hilfsaktionen statt. So startete beispielsweise<br />
die von Bosch-Mitarbeitern<br />
getragene Hilfsorganisation Pr<strong>im</strong>avera<br />
e.V. einen groß angelegten Spendenaufruf.<br />
Mithilfe der Bosch-Geschäftsführung,<br />
dem Konzernbetriebsrat <strong>und</strong><br />
dem Konzernsprecherausschuss wurden<br />
<strong>im</strong> Dezember 2015 alle Mitarbeiter um<br />
Unterstützung für die Flüchtlingshilfe<br />
gebeten. Das erfreuliche Ergebnis: Mehr<br />
als 400 000 Euro sind aus den verschiedenen<br />
Ländern zusammengekommen.<br />
Bosch hat die Spendensumme wie zuvor<br />
angekündigt verdoppelt. 820 000 Euro<br />
kamen so nachhaltigen Vor-Ort-Projekten<br />
zugute, die gezielt Flüchtlinge unterstützen.<br />
Zudem konnten die Mitarbeiter<br />
selbst Hilfsorganisationen für die Förderung<br />
vorschlagen. Dahinter steckte die<br />
Überlegung, dass diese meist am besten<br />
wissen, welche sozialen Aktivitäten <strong>im</strong><br />
Umfeld ihrer Standorte wichtig sind.<br />
Infrage kamen gemeinnützige Initiativen,<br />
die bereits von aktiven oder ehemaligen<br />
Bosch-Mitarbeitern unterstützt werden<br />
<strong>und</strong> sich <strong>im</strong> Idealfall in der Nähe eines<br />
Bosch-Standorts befinden. Die Verteilung<br />
der Gelder best<strong>im</strong>mte ein Gremium, in<br />
dem der Verein Pr<strong>im</strong>avera, der Gesamtbetriebsrat<br />
<strong>und</strong> das Unternehmen selbst<br />
vertreten waren. Auf diese Weise hat<br />
Bosch bereits über einh<strong>und</strong>ert Projekte<br />
gezielt gefördert.<br />
Mitarbeiter als Mentoren<br />
Darüber hinaus übern<strong>im</strong>mt Bosch gesellschaftliche<br />
Verantwortung für die<br />
Integration der Geflüchteten <strong>und</strong> trägt<br />
so dazu bei, den Neuankömmlingen<br />
den Start in <strong>Deutschland</strong> zu erleichtern.<br />
Dazu hatte das Unternehmen bereits<br />
vor der oben erwähnten Spendenaktion<br />
500 000 Euro für Integrationsmaßnahmen<br />
an den Standorten bereitgestellt.<br />
Außerdem bietet Bosch Städten <strong>und</strong><br />
Gemeinden Gr<strong>und</strong>stücksflächen zur<br />
Errichtung von Notunterkünften sowie<br />
freie Wohnungen an.<br />
Zudem hat Bosch in 2015 über 400<br />
Flüchtlingen berufsorientierende Praktikumsplätze<br />
zur Verfügung gestellt, die<br />
auf eine Ausbildung oder den Eintritt in<br />
den deutschen Arbeitsmarkt vorbereiten.<br />
Mentorenschaften von Bosch-Mitarbei-<br />
„Die Integration von Flüchtlingen ist eine<br />
gesellschaftliche Aufgabe von überragender<br />
Bedeutung. Daher wollen auch wir bei Bosch<br />
einen aktiven Beitrag zur Unterstützung der<br />
Integration leisten. Wir sehen uns hier in<br />
einer langen Tradition, die wirtschaftliches<br />
Handeln <strong>und</strong> soziale Verantwortung vereint.<br />
Gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitern<br />
wollen wir so Menschen unterstützen,<br />
in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen<br />
<strong>und</strong> ihnen eine Zukunftsperspektive bieten.“<br />
Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der<br />
Geschäftsführung, Robert Bosch GmbH<br />
68 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
tern <strong>und</strong> begleitende Deutschkurse sollen<br />
parallel dazu beitragen, dass sich die<br />
Praktikanten schnell in der neuen Umgebung<br />
zurechtfinden. Hierzu arbeitet<br />
das Unternehmen eng mit öffentlichen<br />
Institutionen zusammen, um bestehende<br />
Qualifizierungsprogramme sinnvoll zu<br />
ergänzen. Mit diesem Ziel vermittelt<br />
auch die Bosch-Jugendhilfe Mitarbeiter<br />
als Mentoren für Flüchtlingskinder an<br />
die Organisation „KinderHelden“. Als<br />
engagierte Ansprechpartner helfen sie<br />
Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen be<strong>im</strong> Einstieg<br />
in die Schule <strong>und</strong> stehen ihnen <strong>im</strong> schulischen<br />
Alltag mit Rat <strong>und</strong> Tat zur Seite.<br />
Im Verb<strong>und</strong> mit der Wirtschaft<br />
Bosch ist außerdem Teil der b<strong>und</strong>esweiten<br />
Wirtschaftsinitiative „Wir zusammen“.<br />
Auf dieser Plattform bündeln<br />
mehr als 120 große <strong>und</strong> mittelständische<br />
Unternehmen ihre Projekte <strong>und</strong><br />
inspirieren andere, sich ebenfalls für<br />
Flüchtlinge einzusetzen. Stellvertretend<br />
für die vielen Initiativen an fast 30 deutschen<br />
Standorten übern<strong>im</strong>mt Bosch die<br />
Patenschaft für ein Projekt in Immenstadt<br />
<strong>im</strong> Allgäu. Es handelt sich dabei<br />
um eine Initiative, die 24 unbegleitete<br />
jugendliche Flüchtlinge betreut <strong>und</strong><br />
ihnen unter anderem <strong>im</strong> Zusammenspiel<br />
mit der Berufsschule Immenstadt<br />
sechswöchige Praktika bei Bosch ermöglicht.<br />
Die ersten Praktikumssequenzen<br />
wurden bereits durchlaufen <strong>und</strong> waren<br />
aufgr<strong>und</strong> der außerordentlichen Motivation<br />
der Praktikanten sehr erfolgreich.<br />
Dieses Projekt ist stellvertretend für die<br />
lokalen Aktivitäten, weil es zeigt, was<br />
eine gemeinsame Initiative von Auszubildenden,<br />
der örtlichen Werkleitung<br />
<strong>und</strong> vieler weiterer Mitarbeiter bewirkt.<br />
Kultureller Austausch<br />
Nicht zuletzt lebt die Flüchtlingshilfe von<br />
dem Engagement der vielen freiwilligen<br />
Helfer in Europa. Auch bei Bosch gibt es<br />
zahlreiche Mitarbeiter, die auf diesem<br />
Wege zum Gelingen von Integration beitragen.<br />
Erwähnt sei hier eine Auszubildenden-Initiative<br />
aus <strong>Deutschland</strong>, die<br />
den kulturellen Austausch zwischen verschiedenen<br />
Nationalitäten fördern möchte.<br />
Dazu treffen sich die Teilnehmer regelmäßig<br />
mit Flüchtlingen, um gemeinsam zu<br />
kochen oder lokale Veranstaltungen zu<br />
besuchen. An anderen Bosch-Standorten<br />
organisieren Mitarbeiter regelmäßig Sammelaktionen,<br />
um Neuankömmlinge mit<br />
den wichtigsten Alltagsutensilien auszustatten.<br />
Wieder andere ermöglichen<br />
Sprach- <strong>und</strong> Mathematik-Unterricht.<br />
Fazit<br />
Alle diese Aktivitäten liefern allein keine<br />
abschließende Lösung für die erfolgreiche<br />
Integration von Flüchtlingen<br />
in Europa. Aber: Das Engagement von<br />
Unternehmen wie Bosch <strong>und</strong> ihren Belegschaften<br />
zeigen Wege auf, sich der<br />
historischen Herausforderung zu stellen<br />
<strong>und</strong> Verantwortung zu übernehmen. Es<br />
geht darum, konkrete Integrationsmöglichkeiten<br />
für den Einzelnen zu schaffen,<br />
Gemeinsamkeiten mit den Menschen<br />
aus anderen Kulturkreisen zu finden<br />
<strong>und</strong> Unterschiede zu entdecken, die<br />
unsere Gesellschaften bereichern <strong>und</strong><br />
nach vorne bringen. Und hier kann sich<br />
jeder einbringen. Ob mit großem oder<br />
kleinem Einsatz: Jede Hilfe zählt.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
69
Good Practice<br />
CEWE betreibt Kl<strong>im</strong>aschutz<br />
CEWE, Europas führender Fotofinisher <strong>und</strong> kommerzieller Online-Druckpartner, produziert ab<br />
sofort seine gesamte Markenproduktpalette kl<strong>im</strong>aneutral. Das Oldenburger Unternehmen unterstützt<br />
ein umfassendes Kl<strong>im</strong>aschutzprojekt in Kenia <strong>und</strong> gleicht dadurch sämtliche bei der Herstellung<br />
der jährlich produzierten Exemplare des CEWE FOTOBUCHs, der CEWE KALENDER,<br />
CEWE CARDS, CEWE WANDBILDER <strong>und</strong> CEWE SOFORTFOTOS entstehenden CO 2<br />
-Emissionen aus.<br />
Von Dr. Christine Hawighorst,<br />
Leiterin CSR <strong>und</strong> PR, CEWE<br />
Wir verfolgen seit vielen Jahren eine<br />
nachhaltige Kl<strong>im</strong>aschutzstrategie. Jetzt<br />
hat CEWE dieses Umweltengagement<br />
deutlich erweitert. Das CEWE FOTO-<br />
BUCH <strong>und</strong> alle anderen CEWE Markenprodukte<br />
werden ab sofort kl<strong>im</strong>aneutral<br />
hergestellt <strong>und</strong> das nachweislich<br />
<strong>und</strong> ohne Mehrkosten für den K<strong>und</strong>en.<br />
Wir übernehmen damit volle Kl<strong>im</strong>averantwortung<br />
<strong>und</strong> schützen die Umwelt.<br />
Die Kompensation von CO 2<br />
-Emissionen<br />
erfolgt durch den Schutz bestehender<br />
Wälder in Kenia mit dem Projekt Kasigau<br />
Wildlife Corridor.<br />
Transparenz <strong>und</strong> Glaubwürdigkeit<br />
Um den CO 2<br />
-Fußabdruck so gering wie<br />
möglich zu halten, arbeiten wir mit<br />
Cl<strong>im</strong>atePartner zusammen. Cl<strong>im</strong>atePartner<br />
berechnet die CO 2<br />
-Emissionen der<br />
CEWE Fotoprodukte <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
<strong>und</strong> entwickelt Strategien, diese mit<br />
Emissionszertifikaten zu kompensieren.<br />
Kl<strong>im</strong>aneutralität mit Cl<strong>im</strong>atePartner<br />
ist TÜV-Austria-zertifiziert <strong>und</strong> das unterstützte<br />
Kl<strong>im</strong>aschutzprojekt Kasigau<br />
ist nach dem strengen Verified Carbon<br />
Standard (VCS) sowie dem CCB Standard<br />
„Gold Level“ zertifiziert. Der CCB Standard<br />
bezieht sich auf Landnutzungs- <strong>und</strong><br />
Forstprojekte, die entsprechenden Projekte<br />
müssen sich einem zweiphasigen<br />
Evaluierungsprozess unterziehen. „Vollständige<br />
Transparenz ist entscheidend,<br />
um unser Engagement be<strong>im</strong> Kl<strong>im</strong>aschutz<br />
glaubhaft zu vermitteln, denn unsere<br />
Kl<strong>im</strong>aschutzstrategie ist seit Langem ein<br />
wichtiger Teil unseres Unternehmens“,<br />
erläutert Dr. Rolf Hollander, Vorstandsvorsitzender<br />
von CEWE. „Wir übernehmen<br />
konsequent Verantwortung für die<br />
Umwelt. Und wir freuen uns, mit dem<br />
kl<strong>im</strong>aneutralen CEWE FOTOBUCH <strong>und</strong><br />
den kl<strong>im</strong>aneutralen Markenprodukten<br />
einen weiteren Beitrag zum Kl<strong>im</strong>aschutz<br />
leisten zu können.“<br />
Wald von der doppelten Fläche<br />
Berlins in Kenia unter Schutz<br />
Als Papier verarbeitendes Unternehmen<br />
fühlen wir uns sehr eng mit dem Thema<br />
Waldschutz verb<strong>und</strong>en. Das Projekt Kasigau<br />
erstreckt sich <strong>im</strong> Südwesten Kenias<br />
<strong>und</strong> schützt den durch Brandrodung <strong>und</strong><br />
Abholzung gefährdeten Trockenwald auf<br />
einer Fläche von r<strong>und</strong> 200.000 Hektar;<br />
das entspricht etwa der doppelten Fläche<br />
Berlins. Um die bei CEWE anfallenden<br />
CO 2<br />
-Emissionen der CEWE FOTOWELT zu<br />
kompensieren, wird die CO 2<br />
-Speicherkraft<br />
70 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
einer Waldfläche von etwas über 26 km 2<br />
− etwa 3.700 Fußballfelder − benötigt.<br />
Vielfältige nachhaltige Projekte, Aufklärungsprogramme<br />
<strong>und</strong> Aufforstung helfen<br />
bei der Erhaltung einer natürlichen Kohlenstoffsenke<br />
<strong>und</strong> schützen gleichzeitig<br />
die lokale Biodiversität in Kenia.<br />
Projekt Kasigau Korridor Kenia<br />
Die Wälder <strong>im</strong> Kasigau Korridor wurden<br />
bisher durch die Anwohner abgeholzt,<br />
um unter anderem Holzkohle zur Essenszubereitung<br />
herzustellen. Mit den<br />
Geldern des Projekts werden Alternativen<br />
finanziert, die den r<strong>und</strong> 118.500<br />
Bewohnern der Region eine nachhaltige<br />
Lebensgr<strong>und</strong>lage sichern, ohne dass Wälder<br />
abgeholzt werden müssen. So wurden<br />
zum Beispiel eine alternative Holzkohleherstellung<br />
initiiert <strong>und</strong> Wasserstellen<br />
mit unbeschränktem Zugang für die<br />
Anwohner ausgehoben. 40 Prozent des<br />
gesamten Geldes werden in Bildungsprojekte<br />
investiert, da die weiterführenden<br />
Schulen in Kenia nicht kostenfrei sind.<br />
Darüber hinaus werden Arbeitsplätze<br />
geschaffen, wie zum Beispiel durch ein<br />
Tierschutzprojekt, bei dem 100 junge<br />
Männer als Ranger ausgebildet wurden,<br />
die sich r<strong>und</strong> um die Uhr um den Erhalt<br />
der lokalen Tierwelt kümmern. Damit<br />
das Projekt auch in der Zukunft Bestand<br />
hat, werden neue Bäume, darunter auch<br />
Fruchtbäume, gezüchtet. Bisher wurden<br />
bereits 55.000 neue Setzlinge gepflanzt.<br />
Nachhaltig auf ganzer Linie – von<br />
der Bestellung bis zum Briefkasten<br />
Zum ökologischen Wirtschaften gehört<br />
bei uns eine gesamthaft nachhaltige<br />
Lieferkette. Von der Wahl der Rohstoffe,<br />
dem Einkauf, über die Produktion bis<br />
hin zur Auslieferung gestaltet CEWE<br />
die gesamte Wertschöpfungskette kl<strong>im</strong>aneutral.<br />
Schon 2009 hatte CEWE <strong>im</strong><br />
Bereich Postversand das Projekt GoGreen<br />
mit der Deutschen Post aufgegriffen,<br />
um so den CO 2<br />
-neutralen Versand in<br />
die Praxis umzusetzen. Allein über den<br />
CO 2<br />
-neutralen Versand hat CEWE 2015<br />
insgesamt 877 Tonnen CO 2<br />
-Emissionen<br />
durch kl<strong>im</strong>aneutrale Produkte <strong>und</strong> Services<br />
zertifiziert ausgeglichen. Sie beinhalten<br />
Emissionen aus Transport <strong>und</strong><br />
Logistik sowie vorgelagerte Emissionen<br />
aus Kraftstoff- <strong>und</strong> Energieerzeugung.<br />
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges<br />
Element der Unternehmenskultur<br />
Das gesamte Unternehmen arbeitet daran,<br />
seinem Markenversprechen über<br />
alle Produkte <strong>und</strong> Leistungen hinweg<br />
verantwortungsvoll <strong>und</strong> nachhaltig gerecht<br />
zu werden. Umweltschonendes,<br />
gesellschaftlich engagiertes Handeln<br />
<strong>und</strong> ein fürsorglicher Umgang mit Mitarbeitern<br />
sind wichtige Eckpfeiler der<br />
Unternehmenskultur. Zur Schonung<br />
der Umwelt legen wir großen Wert auf<br />
umweltbewusste Maßnahmen. Jedes<br />
Jahr veröffentlichen wir den Nachhaltigkeitsbericht<br />
zur Dokumentation unserer<br />
Fortschritte <strong>und</strong> Zielsetzungen in diesem<br />
Bereich. Dazu gehören Zertifizierungen<br />
des Umweltmanagements nach ISO<br />
14001 genauso wie der Einsatz von FSC®zertifiziertem<br />
Papier (FSC®-C101851) bis<br />
hin zum CO 2<br />
-neutralen Druck <strong>und</strong> dem<br />
CO 2<br />
-neutralen Versand der Produkte. Das<br />
gesellschaftliche Engagement mit den<br />
SOS-Kinderdörfern hat CEWE in vielen<br />
Bereichen erweitert. Gefördert werden<br />
insbesondere Projekte für Kinder <strong>und</strong> Familien<br />
an den Unternehmensstandorten<br />
Oldenburg, Mönchengladbach, Freiburg<br />
<strong>und</strong> Germering. Daneben unterstützt<br />
CEWE überregionale Partnerschaften<br />
mit den SOS-Kinderdörfern in Ghana.<br />
Für unsere Mitarbeiter übernehmen<br />
wir aktiv soziale Verantwortung. Dazu<br />
gehören Themen wie die Vereinbarkeit<br />
von Familie <strong>und</strong> Beruf oder die Förderung<br />
ehrenamtlicher Engagements. Seit<br />
2014 ist CEWE von der Hertie-Stiftung<br />
<strong>im</strong> Audit Vereinbarkeit von Familie <strong>und</strong><br />
Beruf zertifiziert <strong>und</strong> zudem vom TÜV<br />
Rheinland als Ausgezeichneter Arbeitgeber<br />
prämiert. Als Auszeichnung für das<br />
nachhaltige Engagement erhielt CEWE<br />
den ersten CHIP FOTO AWARD für Nachhaltigkeit,<br />
der auf der photokina <strong>2016</strong><br />
verliehen wurde.<br />
Mehr Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement<br />
von CEWE finden Sie unter:<br />
http://company.cewe.de/de/nachhaltigkeit.html<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
71
Good Practice<br />
Langfristig Talente fördern<br />
Die CHT / BEZEMA Gruppe ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe, deren <strong>Fokus</strong> auf<br />
der Entwicklung <strong>und</strong> Herstellung von Spezialchemikalien als Funktionsgeber, Hilfsmittel <strong>und</strong><br />
Additive für industrielle Prozesse liegt. Unsere Produkte verbessern die Qualität, die Funktionalität<br />
<strong>und</strong> die Performance von Textilien, Baustoffen, Farben, Lacken, Papier, Leder sowie von<br />
Reinigungs- <strong>und</strong> Pflegeprodukten für verschiedene Anwendungsgebiete. Darüber hinaus bedienen<br />
wir die Formenbau- <strong>und</strong> Prototyping-Industrie, Medizintechnik sowie Elektronikindustrie<br />
mit hochwertigen Silikonelastomeren.<br />
Von Dr. Annegret Vester, Head of Corporate Marketing and Communications, CHT / BEZEMA Gruppe<br />
72 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Das Thema Nachhaltigkeit n<strong>im</strong>mt bei<br />
der CHT / BEZEMA Gruppe einen hohen<br />
Stellenwert ein − Nachhaltigkeitsaspekte<br />
werden in unserer traditionsbewussten<br />
Unternehmensgruppe <strong>im</strong> Stiftungsbesitz<br />
schon sehr lange gelebt. Wir verstehen<br />
unter Nachhaltigkeit einen langfristig<br />
angelegten, global vernetzten <strong>und</strong> verantwortungsbewussten<br />
Umgang mit allen<br />
Ressourcen unter Einbeziehung aller<br />
drei D<strong>im</strong>ensionen − Ökonomie, Ökologie<br />
<strong>und</strong> Soziales. Eine Verpflichtung<br />
gegenüber den künftigen Generationen<br />
in Form einer langfristig angelegten<br />
Zukunftsstrategie verbindet den wirtschaftlichen<br />
Erfolg mit gesellschaftlicher<br />
<strong>und</strong> sozialer Verantwortung <strong>und</strong> dem<br />
Schutz der Umwelt.<br />
Entsprechend verankern wir Nachhaltigkeit<br />
sowohl strategisch als auch organisatorisch<br />
<strong>im</strong> Unternehmen. Wir setzen<br />
uns <strong>im</strong> Rahmen der unternehmerischen<br />
Selbstverpflichtung messbare Nachhaltigkeitsziele<br />
<strong>und</strong> definieren Maßnahmen zu<br />
deren Umsetzung. Strategisch betrachtet<br />
ist unser Nachhaltigkeitsmanagement<br />
darauf ausgerichtet, erstens als Arbeitgeber<br />
<strong>und</strong> Geschäftspartner einen Beitrag<br />
zum sozialen Fortschritt der Gesellschaft<br />
zu leisten, zweitens durch weitsichtiges<br />
Handeln ökologische, ökonomische <strong>und</strong><br />
personelle Risiken zu min<strong>im</strong>ieren, drittens<br />
zusätzliche Geschäftschancen zu<br />
erschließen, viertens die vertrauensvolle<br />
Beziehung zu unseren Stakeholdern<br />
auszubauen <strong>und</strong> fünftens als der bevorzugte<br />
Partner <strong>und</strong> die führende Referenz<br />
für nachhaltige chemische Lösungen in<br />
unseren Märkten aufzutreten.<br />
Als ein Teil der sozialen D<strong>im</strong>ension wurde<br />
<strong>2016</strong> der Verhaltenskodex „Code of<br />
Conduct“ der CHT / BEZEMA Gruppe<br />
veröffentlicht, welcher gr<strong>und</strong>legende<br />
Standards definiert <strong>und</strong> Erwartungen an<br />
das Handeln von Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />
Mitarbeitern <strong>im</strong> Unternehmensalltag beschreibt.<br />
Denn verantwortungsbewusstes,<br />
gesetzestreues <strong>und</strong> integres Verhalten ist<br />
von höchster Bedeutung für das Ansehen<br />
unseres Unternehmens <strong>und</strong> das Vertrauen<br />
unserer Geschäftspartner sowie der<br />
Gesellschaft. Daher ist das vorrangige<br />
Ziel des Code of Conduct, Verstöße von<br />
vornherein zu vermeiden.<br />
Als einen wesentlichen <strong>und</strong> wichtigen<br />
sozialen Nachhaltigkeitsaspekt wollen<br />
wir Menschenrechte weltweit einhalten<br />
<strong>und</strong> einfordern. Unser Unternehmen<br />
ist einer humanen Gr<strong>und</strong>überzeugung<br />
verpflichtet <strong>und</strong> achtet strikt auf die<br />
Einhaltung <strong>und</strong> Achtung der Menschenrechte<br />
in unserem Handlungs- <strong>und</strong><br />
Einflussbereich. Mehr noch, wir sehen<br />
unsere Verantwortung für die Achtung<br />
der Menschenrechte als integralen Bestandteil<br />
unserer nachhaltigen Unternehmensführung.<br />
Diese Verantwortung nehmen wir aktiv<br />
an allen Standorten wahr. Führungskräfte<br />
<strong>und</strong> Geschäftsführer wissen um ihre<br />
verantwortliche Position hinsichtlich der<br />
Sicherstellung zur Einhaltung des Code<br />
of Conduct sowie der Menschenrechte.<br />
Regelmäßig durchgeführte Corporate<br />
Self-Assessments aller Managing Directors<br />
weltweit beinhalten sämtliche <strong>im</strong><br />
Code of Conduct definierten Themen<br />
<strong>und</strong> gewährleisten die Berichterstattung<br />
<strong>und</strong> Dokumentation. Die strikte<br />
Einhaltung der Menschenrechte auch<br />
aufseiten unserer Geschäftspartner ist<br />
für uns ein Kriterium für dauerhafte<br />
Geschäftsbeziehungen. Mit der Einführung<br />
unserer Compliance-Richtlinien,<br />
die die Inhalte unseres Code of Conduct<br />
widerspiegeln, wollen wir ab <strong>2016</strong> auch<br />
unsere Geschäftspartner an diese Richtlinien<br />
binden, um so eine Einhaltung<br />
der Menschenrechte zu gewährleisten.<br />
Des Weiteren wollen wir vor Diskr<strong>im</strong>inierung<br />
schützen. Unsere Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter spiegeln unsere globale<br />
Präsenz <strong>und</strong> unsere Philosophie für kulturelle<br />
Vielfalt wider. Als internationale<br />
Unternehmensgruppe, die Menschen<br />
aus vielen unterschiedlichen Nationen<br />
beschäftigt, steht der Schutz vor Diskr<strong>im</strong>inierung<br />
an oberster Stelle. Wir<br />
tolerieren keinerlei Benachteiligungen<br />
aus Gründen der Rasse, ethnischen Herkunft,<br />
der Religion, der Weltanschauung,<br />
des Geschlechts, einer Behinderung, des<br />
Alters oder der sexuellen Identität unserer<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter.<br />
Regelmäßige Schulungen gewährleisten,<br />
dass unsere Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
mit den Inhalten des Allgemeinen<br />
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vertraut<br />
sind <strong>und</strong> sich entsprechend diesen<br />
Regeln verhalten. In allen Bereichen<br />
unseres Unternehmens <strong>und</strong> ebenfalls<br />
gegenüber unseren Geschäftspartnern<br />
gelten die gleichen Werte für die Zusammenarbeit.<br />
Mit der verbindlichen, weltweiten<br />
Einführung des Verhaltenskodex<br />
„Code of Conduct“ in <strong>2016</strong> wollen wir<br />
die Einhaltung der Gleichbehandlung<br />
sicherstellen.<br />
Selbstverständlich lehnen wir auch jegliche<br />
Form von Kinderarbeit strikt ab. An<br />
unseren Standorten halten wir die lokal<br />
geltenden Vorschriften zum Mindestalter<br />
unserer Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
konsequent ein. Ist keine solche Vorschrift<br />
vorhanden, halten wir uns an das<br />
in <strong>Deutschland</strong> geltende Gesetz.<br />
Die Rechte unserer Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter fördern wir ausdrücklich.<br />
Dazu zählt auch <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Vereinigungsfreiheit das Recht unserer<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter, Gewerkschaften<br />
beizutreten <strong>und</strong> sich von<br />
diesen in Übereinst<strong>im</strong>mung mit den geltenden<br />
nationalen Gesetzen vertreten zu<br />
lassen. Für alle unsere Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter, die Unternehmensleitung<br />
ausgenommen, gelten Kollektivvereinbarungen.<br />
Im Rahmen des ONE Company Ansatzes<br />
werden wir uns 2017 gruppenweit mit<br />
dem Thema Diversity beschäftigen. In einem<br />
ersten Schritt sollen alle knapp 2.000<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter zu ihrer<br />
Wahrnehmung zum Thema Chancengleichheit<br />
in der CHT / BEZEMA Gruppe<br />
befragt werden <strong>und</strong> diese bewerten.<br />
Langfristig geht es uns darum, alle Talente<br />
zu fördern, unabhängig von Alter,<br />
Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität <strong>und</strong><br />
persönlichen Lebensbedingungen.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
73
Good Practice<br />
CiS: Auf dem Weg<br />
in die Zukunft …<br />
Kabelkonfektionierung gehört in beste Hände, denn für eine<br />
r<strong>und</strong>um zuverlässige Funktion komplexer Systeme muss auf<br />
die Verkabelung <strong>und</strong> Verbindungstechnik absolut Verlass sein.<br />
CiS ist ein führender Hersteller von k<strong>und</strong>enspezifischer Verbindungstechnik<br />
in der Elektronik – mit großem Produktmix, vom<br />
Einzelstück bis zur Großserie <strong>und</strong> höchster Zuverlässigkeit in<br />
Qualität <strong>und</strong> Termintreue seit über 40 Jahren in allen Bereichen.<br />
Von Doris Wöllner, CSR Beauftragte, CiS<br />
In der CiS Gruppe spielen Werte wie<br />
Menschenrechte, Umweltschutz, Arbeitsnormen,<br />
Korruptionsbekämpfung <strong>und</strong><br />
ein wertschätzender Umgang in internen<br />
<strong>und</strong> externen Bereichen <strong>im</strong>mer schon<br />
eine wichtige Rolle.<br />
Seit drei Jahren sind wir offizielles Mitglied<br />
des UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> <strong>und</strong> verpflichten<br />
uns auch öffentlich, jederzeit<br />
für diese Werte einzustehen. Auch unsere<br />
Geschäftspartner werden aufgefordert,<br />
unseren Code of Conduct einzuhalten.<br />
Die CiS Gruppe ist ein inhabergeführtes<br />
Unternehmen mit Hauptsitz in <strong>Deutschland</strong><br />
<strong>und</strong> Produktionsstandorten in Tschechien<br />
<strong>und</strong> Rumänien. Derzeit beschäftigen<br />
wir insgesamt über 1.100 Mitarbeiter.<br />
Als Kabelkonfektionär <strong>und</strong> Systemlieferant<br />
trägt CiS eine besondere Verantwortung<br />
für K<strong>und</strong>en, Mitarbeiter, Umwelt<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft. Seit über vier<br />
Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit<br />
Kabelkonfektionierungen, Sondersteckverbindern<br />
<strong>und</strong> Mechatronik. Damit<br />
leisten wir einen entscheidenden Beitrag<br />
zu den Produkten unserer K<strong>und</strong>en in den<br />
Bereichen Automotive, Maschinen- <strong>und</strong><br />
Anlagenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik,<br />
Energie- <strong>und</strong> Umwelttechnik,<br />
Sicherheitstechnik, Luft- <strong>und</strong> Raumfahrttechnik.<br />
Um Vielfalt in der Breite<br />
der Märkte <strong>und</strong> Qualität auch in Zukunft<br />
fest <strong>im</strong> Unternehmen zu verankern, gilt<br />
es, die Herausforderungen <strong>und</strong> Probleme<br />
einer Welt in Bewegung zu verstehen<br />
<strong>und</strong> zu lösen.<br />
Auch in Zukunft wollen wir unserer Verantwortung<br />
weiterhin gerecht werden.<br />
Die CiS Gruppe hat ihre Unternehmensstrategie<br />
„iSpeed“ neu ausgerichtet <strong>und</strong><br />
bereitet sich intensiv auf die zu erwartenden<br />
Veränderungen der industriellen<br />
Entwicklung in den nächsten Jahren vor.<br />
Industrie <strong>im</strong> Wandel der Zeit –<br />
Digitalisierung als Chance …<br />
Bereits zu Beginn des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
hat die 1. industrielle Revolution mit<br />
der Erfindung der Dampfmaschine begonnen.<br />
Die 2. industrielle Revolution<br />
begann Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts mit<br />
der Einführung der Elektrizität <strong>und</strong><br />
der Erfindung der Fließbandfertigung.<br />
Ab den 1970er Jahren startete die 3. industrielle<br />
Revolution mit der weiteren<br />
Automatisierung <strong>und</strong> Einführung von<br />
Computer, Internet <strong>und</strong> Robotik. Zum<br />
Ende des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts hat die 4. industrielle<br />
Revolution begonnen.<br />
Nichts bewegt die deutsche<br />
Industrie derzeit mehr als die<br />
magische „4.0“<br />
Industrie 4.0 ist der Begriff für moderne<br />
Technologie <strong>und</strong> Produktion <strong>im</strong> Zeitalter<br />
der digitalen Revolution. Damit ist<br />
nicht eine industrielle Entwicklung weiterer<br />
Technologien gemeint, sondern die<br />
veränderte Produktions- <strong>und</strong> Arbeitswelt<br />
<strong>im</strong> globalen Zeitalter. Zu den wichtigsten<br />
Zielen von Industrie 4.0 gehören<br />
die El<strong>im</strong>inierung von Kapitalbindung<br />
durch unnötige Vorratswirtschaft <strong>und</strong><br />
max<strong>im</strong>ale Flexibilität für die Erfüllung<br />
kurzfristiger K<strong>und</strong>enanforderungen.<br />
Das bedeutet einen Wandel mit zunehmender<br />
Geschwindigkeit in allen<br />
Bereichen des Marktes <strong>und</strong> damit auch<br />
in unserem Unternehmen: von der gemeinsamen<br />
Entwicklung mit unseren<br />
K<strong>und</strong>en über die gesamte Lieferkette,<br />
durch die Produktion bis hin zum Service<br />
<strong>und</strong> der Entsorgung. Die Digitalisie-<br />
74 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
ung der Dinge <strong>und</strong> die Automatisierung<br />
auch der administrativen Bereiche wird<br />
zu einem zentralen Hebel zukünftiger<br />
Wertschöpfung <strong>und</strong> Wettbewerbsfähigkeit.<br />
„Alles, was digitalisiert werden<br />
kann, wird digitalisiert − <strong>und</strong> alles, was<br />
automatisiert werden kann, wird automatisiert!“<br />
− so verkünden es bereits<br />
seit geraumer Zeit die Zukunftsforscher.<br />
Als Folge der zunehmenden Digitalisierung<br />
muss sich die Industrie großen<br />
Herausforderungen stellen. K<strong>und</strong>en<br />
suchen nach intelligenten <strong>und</strong> einfachen<br />
Lösungen in einer <strong>im</strong>mer komplexeren,<br />
zunehmend digitalisierten Welt.<br />
Das bedeutet, Unternehmen müssen<br />
flexibler werden <strong>und</strong> ihre Effizienz<br />
steigern − bei gleichbleibender oder<br />
steigender Qualität. Aber es bedeutet<br />
auch unzählige Herausforderungen<br />
<strong>und</strong> neue Chancen! Das wirtschaftliche<br />
Potenzial ist angesichts der sich bietenden<br />
Möglichkeiten enorm. Es geht dabei<br />
um die Digitalisierung der physischen<br />
Welt <strong>und</strong> die Verbindung von Dingen,<br />
Menschen, Prozessen <strong>und</strong> Daten bis hin<br />
zur Dematerialisierung. Viele Produkte<br />
werden künftig durch eine APP ersetzt.<br />
Für uns stellt sich die Frage: Wie generieren<br />
wir durch Industrie 4.0 Lösungen<br />
<strong>und</strong> messbare Mehrwerte für unsere<br />
K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> unser Unternehmen?<br />
Mit unserem Projekt „CiS 2020“ bereiten<br />
wir uns auf die enormen Veränderungen<br />
am globalen Markt vor. Ziel ist, unser<br />
Unternehmen so aufzustellen, dass wir<br />
weiterhin schnellster <strong>und</strong> zuverlässigster<br />
Kabelkonfektionär in diesen veränderten<br />
Märkten der Zukunft sind. Die<br />
dazu eingesetzte Methodik ist u. a. die<br />
Wertstromanalyse in Bezug auf max<strong>im</strong>al<br />
sinnvolle Automatisierung möglichst<br />
vieler Prozesse <strong>und</strong> Verkürzung aller<br />
Durchlaufzeiten.<br />
CiS verfolgt mit der langfristig angelegten<br />
Strategie „iSpeed“ die Entwicklungen<br />
des Marktes <strong>und</strong> setzt als führender<br />
Markenkonfektionär auf nachhaltige<br />
Konzepte, Schnelligkeit <strong>und</strong> Zuverlässigkeit<br />
auf höchstem Qualitätsniveau. Um<br />
die globale Entwicklung auf höchstem<br />
wissenschaftlichem Niveau verfolgen<br />
zu können, unterstützt CiS aktiv das<br />
Forschungsprojekt „<strong>Deutschland</strong> 2030“,<br />
Eine Gruppe von Wirtschaftsvertretern,<br />
Wissenschaftlern <strong>und</strong> Zukunftsinteressierten<br />
möchte der vorherrschenden „Zukunftsblindheit“<br />
entgegentreten <strong>und</strong> hat<br />
daher mit Unterstützung des „Senat der<br />
Wirtschaft e.V.“ www.senat-deutschland.de<br />
als strategischen Partner die Initiative<br />
D2030 ins Leben gerufen. Die Initiatoren<br />
dieses Projektes sind u. a. die bekannten Zukunftsforscher<br />
Klaus Burmeister <strong>und</strong> Beate<br />
Schulz-Montag von www.Foresightlab.de.<br />
Ihr Ziel ist es, einen unabhängigen, interdisziplinären<br />
Diskurs über die Entwicklung<br />
<strong>Deutschland</strong>s in den nächsten<br />
15 Jahren <strong>und</strong> darüber hinaus zu<br />
ermöglichen. <strong>Deutschland</strong> wird dabei<br />
selbstverständlich nicht isoliert betrachtet,<br />
sondern in seiner internationalen<br />
politischen, ökonomischen <strong>und</strong> kulturellen<br />
Vernetzung. Genau deshalb sollen<br />
Szenarien für <strong>Deutschland</strong> <strong>im</strong> Jahr 2030<br />
entworfen werden. CiS verfolgt als aktives<br />
Mitglied die Ergebnisse der Forschung<br />
<strong>und</strong> passt frühzeitig seine Strategie<br />
„iSpeed“ der zu erwartenden Entwicklung<br />
an. Mit diesen Maßnahmen können wir<br />
langfristig wettbewerbsfähig bleiben <strong>und</strong><br />
unsere Arbeitsplätze sichern.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
75
Good Practice<br />
Systematischer Ansatz<br />
zu menschenrechtlicher<br />
Sorgfalt bei Da<strong>im</strong>ler<br />
Mit dem Da<strong>im</strong>ler „Human Rights Respect System“ entwickelt das Unternehmen einen systematischen<br />
Ansatz zur Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten gemäß der „UN-Leitprinzipien<br />
für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte“. Die Risiko-Bewertungsphase dieses Ansatzes<br />
zur Ermittlung menschenrechtlicher Auswirkungen der Da<strong>im</strong>ler-Einheiten in Mehrheitsbeteiligung<br />
wurde <strong>2016</strong> erfolgreich pilotiert.<br />
Von Dr. Wolfram Heger, Senior Manager Corporate Responsibility Management, Da<strong>im</strong>ler AG<br />
Da<strong>im</strong>ler entwickelt seit 2008 kontinuierlich<br />
einen systematischen <strong>und</strong> unternehmensspezifischen<br />
Menschenrechtsansatz.<br />
Als Gr<strong>und</strong>lage dienten von Beginn an die<br />
Anforderungen des UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
sowie, seit 2011, die „UN-Leitprinzipien<br />
für Wirtschaft <strong>und</strong> Menschenrechte“<br />
als handlungsleitende Referenzrahmen.<br />
Verantwortlich für Menschenrechtsfragen<br />
ist das Vorstandsressort „Integrität<br />
<strong>und</strong> Recht“.<br />
Der Einsatz des zunächst von 2011 bis<br />
2015 verwendeten Instruments des „Human<br />
Rights Compliance Assessments“<br />
vom renommierten Danish Institute for<br />
Human Rights brachte wichtige erste<br />
Erkenntnisse <strong>und</strong> Erfahrungen zur Achtung<br />
der Menschenrechte <strong>im</strong> wirtschaftlichen<br />
Kontext. Dabei wurde jedoch auch<br />
klar, dass, um der Erwartungshaltung<br />
der UN-Leitprinzipien wirklich gerecht<br />
zu werden, ein spezifischer Ansatz für<br />
das Unternehmen selbst notwendig ist.<br />
Das in diesem Sinne entwickelte Da<strong>im</strong>ler<br />
„Human Rights Respect System“ fokussiert<br />
zunächst auf die von Da<strong>im</strong>ler kontrollierten<br />
Einheiten <strong>und</strong> wird derzeit<br />
schrittweise umgesetzt.<br />
Da<strong>im</strong>ler „Human Rights Respect<br />
System“: Systemischer Ansatz mit<br />
Platz für Einzelfall-Betrachtung<br />
Oberstes Ziel des Da<strong>im</strong>ler „Human<br />
Rights Respect System“ ist es vor allem,<br />
systemische Risiken <strong>und</strong> mögliche<br />
negative Auswirkungen von operativem<br />
Handeln auf Menschenrechte frühzeitig<br />
<strong>und</strong> vorausschauend (also auch, wenn<br />
sich diese noch nicht konkret manifestiert<br />
haben) zu erkennen <strong>und</strong> diese zu<br />
mitigieren. Hierfür umfasst das Da<strong>im</strong>ler<br />
System insgesamt vier Prozessschritte,<br />
welche die menschenrechtliche Expertise<br />
mit den langjährigen Prozess- <strong>und</strong><br />
Methodenerfahrungen aus dem bereits<br />
etablierten Compliance Management<br />
Ansatz des Bereiches „Group Compliance“<br />
zusammenbringt:<br />
1. die Identifikation potenzieller Menschenrechtsrisiken,<br />
2. die Einleitung <strong>und</strong> Steuerung von<br />
Gegenmaßnahmen,<br />
3. ein Monitoring, das sich vor allem<br />
auf Hochrisikoeinheiten konzentriert,<br />
4. ein regelmäßiges Reporting, das intern<br />
über relevante Fragen berichtet<br />
<strong>und</strong> zugleich externe Berichtsanforderungen<br />
erfüllt.<br />
Da<strong>im</strong>ler „Human Rights Respect<br />
System“: Risikobewertung zu<br />
menschenrechtlichen Auswirkungen<br />
Die UN-Leitprinzipien schreiben fest, dass<br />
Unternehmen ihre menschenrechtlichen<br />
Auswirkungen hinsichtlich der Risiken<br />
für die jeweiligen Rechtsträger ermitteln<br />
sollen (Leitprinzip 18). Hierauf fokussiert<br />
<strong>im</strong> Da<strong>im</strong>ler „Human Rights Respect System“<br />
die Risiko-Bewertungsphase, die wir<br />
<strong>im</strong> Jahr <strong>2016</strong> pilotiert haben.<br />
Die Risiko-Bewertung besteht aus zwei<br />
Verfahrensschritten: In einem ersten<br />
Schritt werden die kontrollierten Einheiten<br />
des Konzerns auf Basis festgelegter<br />
Kriterien bewertet. Dabei wird einerseits<br />
die landesspezifische menschenrechtliche<br />
Risikolage betrachtet. Andererseits<br />
76 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
determiniert das Geschäftsmodell der<br />
betrachteten Einheit das potenzielle Risiko.<br />
Beide Kriterien gemeinsam betrachtet<br />
erlauben eine erste Einschätzung darüber,<br />
welche unserer weltweiten Einheiten<br />
relativ gesehen einem erhöhten bzw.<br />
einem geringeren menschenrechtlichem<br />
Risiko ausgesetzt sind.<br />
Auf Gr<strong>und</strong>lage dieser Bewertung werden<br />
in einem zweiten Schritt die Einheiten<br />
mit potenziell erhöhten Menschenrechtsrisiken<br />
vor Ort überprüft. Es wird also<br />
untersucht, inwiefern konkrete Risiken<br />
für Rechtsträger bestehen <strong>und</strong> wie das<br />
Unternehmen diesen menschenrechtlichen<br />
Risiken begegnet. Für diese Vor-<br />
Ort-Überprüfung wurde eine eigene<br />
Methodik entwickelt, welche aus einer<br />
Mischung von detaillierten, fokussierten<br />
<strong>und</strong> explorativen Interviews sowie Vor-<br />
Ort-Betrachtungen besteht.<br />
Inhaltlich wird dabei ein breites Spektrum<br />
an Menschenrechtsaspekten abgedeckt.<br />
Ein modularer Ansatz erlaubt es<br />
uns, sowohl zentrale Normen des internationalen<br />
Menschenrechts abzudecken (Allgemeine<br />
Erklärung der Menschenrechte,<br />
Internationale Pakte über bürgerliche <strong>und</strong><br />
politische sowie ökonomische, soziale<br />
<strong>und</strong> kulturelle Rechte, ILO Kernnormen<br />
etc.) als auch unternehmensspezifische<br />
potenzielle Risiken an unseren Produktionsstandorten<br />
zu adressieren − zum<br />
Beispiel die Arbeit mit schwerem Gerät<br />
oder Gefahrenstoffen.<br />
Des Weiteren erlaubt die modulare Vorgehensweise,<br />
den Prüfungen zusätzliche<br />
thematische Module hinzuzufügen,<br />
u. a. wenn der länderspezifische Kontext<br />
dies erforderlich macht (z. B. Länder, in<br />
denen die Rechte best<strong>im</strong>mter Minderheiten<br />
oder der Zugang zu best<strong>im</strong>mten<br />
Lebensgr<strong>und</strong>lagen besonderer Betrachtung<br />
bedürfen).<br />
Da<strong>im</strong>ler „Human Rights Respect<br />
System“: Einbindung potenziell<br />
betroffene Gruppen<br />
Um den Anforderungen der UN Leitprinzipen<br />
weiter Rechnung zu tragen,<br />
beinhaltet das Da<strong>im</strong>ler „Human Rights<br />
Respect System“ explizit auch Konsultationen<br />
„mit potenziell betroffenen<br />
Gruppen … die der Art <strong>und</strong> des Kontexts<br />
der Geschäftstätigkeit Rechnung tragen“<br />
(Leitprinzip 18). Daher wird der Ermittlung<br />
von Sichtweisen <strong>und</strong> den Themen<br />
der Rechtsträger bei der Vor-Ort-Betrachtung<br />
der Risikolage viel Platz eingeräumt<br />
− so zum einen in Form von Gesprächen<br />
mit Mitarbeitern sowie deren offiziellen<br />
Repräsentanten (Gewerkschafts- oder<br />
Arbeitnehmervertretern) oder bei Begehungen<br />
der Arbeitsplätze (z. B. Produktion,<br />
Gefahrengut-Lager). Überprüft<br />
wird hierbei die Kohärenz zwischen der<br />
tatsächlichen Situation vor Ort <strong>und</strong> den<br />
Anforderungen, die für Da<strong>im</strong>ler durch<br />
Richtlinien <strong>und</strong> menschenrechtliche<br />
Normen entstehen.<br />
Da<strong>im</strong>ler „Human Rights Respect<br />
System“: Ausblick<br />
Aufgr<strong>und</strong> der positiven Erfahrungen,<br />
die wir mit der Pilotierung des Risiko-<br />
Assessments sammeln konnten, werden<br />
wir das Da<strong>im</strong>ler „Human Rights Respect<br />
System“ kontinuierlich weiterentwickeln<br />
<strong>und</strong> schrittweise umsetzen − auch<br />
mit Unterstützung von externen Stakeholdern,<br />
wie jüngst be<strong>im</strong> 9. „Da<strong>im</strong>ler<br />
Sustainability Dialogue“. Gleichzeitig<br />
werden die Programmelemente „Steuerung<br />
erforderlicher Maßnahmen“ sowie<br />
„Monitoring <strong>und</strong> Reporting“ aufgesetzt.<br />
Insgesamt leistet das Da<strong>im</strong>ler „Human<br />
Rights Respect System“ so einen Beitrag<br />
zur Erreichung der Zielsetzungen<br />
des UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong>s sowie der<br />
„UN Leitprinzipien für Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Menschenrechte“.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
77
Good Practice<br />
Nachhaltige Farbe.<br />
Trend oder Öko-Nische?<br />
Die neue Dialogreihe der DAW stellt die Gebäudehülle in den Mittelpunkt.<br />
Von Bettina Klump-Bickert,<br />
Head of Sustainability, DAW<br />
Als inhabergeführtes mittelständisches<br />
Unternehmen entwickelt, produziert<br />
<strong>und</strong> vertreibt die DAW Firmengruppe<br />
seit fünf Generationen innovative Beschichtungssysteme<br />
für Gebäude <strong>und</strong><br />
den Bautenschutz. Mit mehr als 5000<br />
Mitarbeitern ist die DAW SE in über<br />
40 Ländern <strong>und</strong> r<strong>und</strong> 30 Produktionsstandorten<br />
vertreten. Die bekanntesten<br />
Marken sind Caparol <strong>und</strong> Alpina − mit<br />
Europas meistgekaufter Innenfarbe:<br />
Alpinaweiß.<br />
Im September 2015 haben die Vereinten<br />
Nationen die „Agenda 2030 für Nachhaltige<br />
Entwicklung“ beschlossen, die mit den<br />
neuen Sustainable Development Goals<br />
(SDG) eine Richtschnur für eine nachhaltigere<br />
Welt bildet. Als Unterzeichner des<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong>s, zu dessen 10 Prinzipien<br />
sich die DAW SE ausdrücklich bekennt,<br />
möchten wir einen aktiven Beitrag zu<br />
Realisierung der Agenda 2030 zu leisten.<br />
Innovation <strong>und</strong> Nachhaltigkeit<br />
Aufgr<strong>und</strong> ihrer generationenübergreifenden<br />
Ausrichtung legt die DAW SE besonderen<br />
Wert darauf, den wirtschaftlichen<br />
Erfolg <strong>im</strong> Einklang mit ökologischen<br />
<strong>und</strong> gesellschaftlichen Ansprüchen zu<br />
erzielen. Daher wurde bei der DAW Geschäfts-<br />
<strong>und</strong> Produktphilosophie schon<br />
seit jeher Nachhaltigkeit integriert. Um<br />
dies konsequent umzusetzen, sieht die<br />
DAW Innovation als wichtigsten Wettbewerbsfaktor<br />
an.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> wurde <strong>im</strong> letzten<br />
Jahr damit begonnen, den traditionell<br />
starten <strong>Fokus</strong> auf Innovation strategisch<br />
neu aufzusetzen. Die neue Innovationsstrategie<br />
folgt den vier Leitprinzipien<br />
Ästhetik, Funktionalität, Ökologie sowie<br />
Energieeffizienz <strong>und</strong> setzt sich aus den<br />
drei verb<strong>und</strong>enen Bausteinen Innovationskultur,<br />
Innovationsmanagement <strong>und</strong><br />
Innovationsinhalt zusammen.<br />
Als Voraussetzung für jegliche Form von<br />
Innovation sieht die DAW eine gelebte<br />
Innovationskultur, die das gesamte Unternehmen<br />
einschließt. Alle Mitarbeiter<br />
sind eingeladen, kreativ zu sein <strong>und</strong> neue<br />
Ideen zu generieren. Um diesen Weg<br />
beschreiten zu können, bietet das Unternehmen<br />
ein Max<strong>im</strong>um an Offenheit<br />
<strong>und</strong> fördert vielfältige Möglichkeiten zur<br />
Weiterentwicklung. Als weiteren Baustein<br />
zur Förderung von Innovation wurde<br />
eine Ideenplattform aufgebaut, die den<br />
78 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, mit<br />
ihren Ideen <strong>und</strong> Vorschlägen zur Weiterentwicklung<br />
des Unternehmens <strong>und</strong> der<br />
Produkte beizutragen. Nach einer ersten<br />
Bewertung durchlaufen die besten Ideen<br />
den neu eingeführten <strong>und</strong> mehrstufig<br />
angelegten Innovationsprozess. Somit<br />
können die Ideen noch zielgerichteter herausgefiltert,<br />
kanalisiert <strong>und</strong> für das Unternehmen<br />
weiterentwickelt zu werden.<br />
Leitthema Gebäudehülle<br />
Doch welche Nachhaltigkeitsthemen haben<br />
nun das größte Innovationspotenzial,<br />
welche nachhaltigen Aspekte sind für die<br />
DAW wesentlich <strong>und</strong> wo liegen Chancen<br />
<strong>und</strong> Risiken? Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> hat<br />
die DAW einen Stakeholder-Dialog unter<br />
Alpina Kl<strong>im</strong>a-Weiß –<br />
gut für Erd- <strong>und</strong> Raumkl<strong>im</strong>a<br />
Mit Alpina Kl<strong>im</strong>a-Weiß bietet Alpina<br />
erstmalig eine kl<strong>im</strong>aneutral hergestellte<br />
Innenfarbe an, die zudem frei<br />
von Löse- <strong>und</strong> Konservierungsmittel<br />
ist. Das enthaltende Bindemittel<br />
wurde zu h<strong>und</strong>ert Prozent durch<br />
nachwachsende Rohstoffe ersetzt<br />
<strong>und</strong> der Rumpf des Farbe<strong>im</strong>ers aus<br />
recycelten Rohstoffen hergestellt.<br />
CapaGeo – lässt<br />
Farben nachwachsen<br />
Auch die neue Produktlinie CapaGeo<br />
steht ganz <strong>im</strong> Anspruch des Unternehmens,<br />
Farben <strong>und</strong> Nachhaltigkeit<br />
in Einklang zu bringen. Mit CapaGeo<br />
wurde ein nachhaltiges Produktkonzept<br />
<strong>im</strong> Profi-Bereich eingeführt, das<br />
von Anfang an auf eine Reduktion<br />
von fossilen Rohstoffen wie Erdöl<br />
<strong>und</strong> Ergas setzt. CapaGeo ist ein<br />
integraler Bestandteil des Caparol<br />
Premium Sort<strong>im</strong>ents <strong>und</strong> setzt mit<br />
Innenfarben <strong>und</strong> wasserverdünnbaren<br />
Lacken den Beginn einer ressourcenschonenden<br />
Produktfamilie.<br />
dem Leitthema Gebäudehülle gestartet,<br />
der sich intensiv mit den Anforderungen<br />
bezüglich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit<br />
<strong>und</strong> Energieeffizienz für das<br />
kostenintensivste Bauelement auseinandersetzt.<br />
Als Hersteller von innovativen<br />
Beschichtungssystem ist es der DAW ein<br />
besonders Anliegen, das Wissen r<strong>und</strong> um<br />
die Bedeutung der Gebäudehülle für eine<br />
nachhaltige Gebäude- <strong>und</strong> Infrastruktur<br />
durch einen Stakeholder-Dialog zusammenzuführen<br />
<strong>und</strong> zu fördern.<br />
Stakeholder-Dialog „Nachhaltige<br />
Farbe. Trend oder Öko-Nische?“<br />
Nachdem die ersten Veranstaltungen<br />
aus aktuellem Anlass das Thema Wärmedämmung<br />
konstruktiv beleuchtet<br />
hatten, beschäftigte sich der aktuelle<br />
Stakeholder-Dialog nun mit der äußersten<br />
Schutzschicht der Gebäudehülle −<br />
den Lacken <strong>und</strong> Farben.<br />
Unter dem Motto „Nachhaltige Farbe.<br />
Trend oder Öko-Nische?“ diskutierten<br />
<strong>und</strong> vertieften externe Stakeholder <strong>und</strong><br />
Mitarbeiter des Unternehmens vielfältige<br />
Aspekte von nachhaltig gestalteten<br />
Farben <strong>und</strong> Lacken. So bestand zum<br />
Beispiel <strong>im</strong> Rahmen eines Mobildialogs<br />
die Möglichkeit, in drei Diskussionsfeldern<br />
die Themen „Definition von Nachhaltigkeitskriterien“,<br />
„Nachwachsende<br />
Rohstoffe vs. Petrochemie“ <strong>und</strong> „Sozialer<br />
Produktnutzen von Farbe“ gemeinsam<br />
zu vertiefen <strong>und</strong> zu konkretisieren.<br />
Hierdurch entstand eine Vielzahl an<br />
Perspektiven <strong>und</strong> Beiträgen, die die DAW<br />
künftig in die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie<br />
einbeziehen kann.<br />
Bei dem Austausch wurden auch die<br />
aktuell neu in den Markt eingeführten<br />
<strong>und</strong> auf Nachhaltigkeit ausgerichteten<br />
Produktlinien insgesamt positiv gewertet<br />
(siehe Kasten).<br />
Erforschungsdialog 2036<br />
Weiterhin wurde in einem Erforschungsdialog<br />
zu einem gemeinsamen Diskurs in<br />
das Jahr 2036 eingeladen. Wie wird der<br />
Markt der Zukunft für Farbe <strong>und</strong> Lacke<br />
aussehen? Wie wird sich das Umfeld<br />
gestalten? Obwohl ein konkreter Blick in<br />
die Zukunft nicht möglich ist, konnten<br />
doch anhand von Fakten <strong>und</strong> Trends<br />
mögliche Szenarien abgeleitet werden.<br />
So zeichneten sich für die Zukunft Veränderungen<br />
an der Gebäudehülle ab,<br />
die neue Perspektiven für den Anwendungsbereich<br />
von Farben <strong>und</strong> Lacken<br />
eröffnen, wie beispielweise eine Erhöhung<br />
der Funktionalität von Fassaden,<br />
der vermehrte Einsatz von vorgefertigten<br />
Modulen oder ein zunehmendes Maß an<br />
Automatisierung.<br />
Dialog-Reihe „Zukunft der Gebäudehülle“<br />
wird fortgesetzt<br />
Die Dialog-Reihe „Zukunft der Gebäudehülle“<br />
wird auf Wunsch der externen<br />
Stakeholder voraussichtlich <strong>im</strong> Sommer<br />
2017 mit einem vergleichbaren Stakeholder-Dialog<br />
fortgeführt. Aufgr<strong>und</strong> der<br />
regen Teilnahme <strong>und</strong> des konstruktiven<br />
Austausches in diesem Dialog wird die<br />
Arbeit an einzelnen ausgewählten Themen<br />
unter Einbezug der Stakeholder bis<br />
zum nächsten Stakeholder-Dialog weiter<br />
vertieft werden.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
79
Good Practice<br />
Digitalisierung ist Hebel<br />
zu mehr Nachhaltigkeit<br />
Die Digitalisierung <strong>im</strong> Schienenverkehr n<strong>im</strong>mt deutlich Fahrt auf. Der öffentliche Verkehr steckt<br />
voller Chancen. Denn integrierte Konzepte für nachhaltige Verkehrssysteme werden mit den<br />
digitalen Technologien leichter realisierbar. Für den K<strong>und</strong>en wird die Kombination verschiedener<br />
Verkehrsmittel einfacher <strong>und</strong> bequemer. Die Schiene – als energieeffizientester <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>lichster<br />
Verkehrsträger – spielt bei der Gestaltung nachhaltiger Mobilität eine Schlüsselrolle.<br />
Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird sie weiter an Bedeutung gewinnen.<br />
Von Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender <strong>und</strong><br />
Chief Sustainability Officer der Deutschen Bahn<br />
Auf dem Mobilitätsmarkt ist eine ungeheure<br />
Dynamik zu beobachten. Nicht<br />
zuletzt unsere Besuche <strong>im</strong> Silicon Valley<br />
führen uns als Deutsche Bahn deutlich<br />
vor Augen, dass die Innovationen <strong>im</strong><br />
Umfeld digitaler Technologien auf einem<br />
Gebiet stark ausgeprägt sind − <strong>und</strong> das<br />
ist der Mobilitätsmarkt. In den kalifornischen<br />
Innovationszentren beschäftigen<br />
sich über 60 Prozent der Start-ups mit<br />
neuen Mobilitätslösungen. Das autonome<br />
Fahren auf der Straße ist dabei von<br />
besonderer Bedeutung − nicht nur für<br />
die Autoindustrie, sondern auch für<br />
Google oder Uber.<br />
Was das für den Bahnsektor bedeutet?<br />
Ganz klar: Auch wir erwarten viel mehr<br />
<strong>und</strong> viel stärker Wettbewerber aus allen<br />
Richtungen. Deshalb müssen wir<br />
die Vorteile ausspielen, die die Bahn als<br />
sicherstes, bequemstes <strong>und</strong> kl<strong>im</strong>afre<strong>und</strong>lichstes<br />
Verkehrsmittel bietet. Bei der<br />
DB arbeiten wir unternehmensweit intensiv<br />
an der digitalen Zukunft − nicht<br />
nur <strong>im</strong> Schienenverkehr. Für uns ist die<br />
Digitalisierung ein geschäftsfeldübergreifendes<br />
Anliegen. Alle Bereiche unseres<br />
Mobilitäts- <strong>und</strong> Logistik-Portfolios sind<br />
involviert. Vom Personenverkehr über<br />
den Gütertransport, die Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> die Produktion bis hin zur IT <strong>und</strong><br />
der neuen Arbeitswelt 4.0.<br />
Lösungen für die K<strong>und</strong>en:<br />
digital, einfach, schnell<br />
Diese Veränderungen gehen wir mit<br />
vollem Engagement an. Erstens weil<br />
wir Treiber sein wollen, <strong>und</strong> zweitens,<br />
weil wir die digitalen Technologien als<br />
80 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Fortschritt verstehen <strong>und</strong> einen Markt<br />
für nachhaltige neue datenbasierte Geschäftsmodelle<br />
sehen.<br />
Unsere nachhaltige Konzernstrategie<br />
DB2020+ gibt uns die Richtung vor: Wir<br />
wollen Digitalisierung <strong>und</strong> Nachhaltigkeit<br />
verknüpfen. Was heißt das konkret?<br />
Der nachhaltige Verkehr der Zukunft<br />
bedeutet für uns dreierlei:<br />
• Er ist individuell − wir wollen noch<br />
k<strong>und</strong>enspezifischere Lösungen bieten,<br />
die der Vielfalt unserer K<strong>und</strong>en<br />
Rechnung tragen;<br />
• Er ist flächendeckend − wir wollen<br />
Verkehrsangebote noch effizienter<br />
gestalten <strong>und</strong> für noch mehr<br />
Menschen den Zugang zu Mobilität<br />
ermöglichen;<br />
• Er ist ökologisch − wir wollen die<br />
Ökobilanz unserer Verkehre weiter<br />
verbessern.<br />
Ein anderes Beispiel ist Qixxit: Der mobile<br />
Reiseassistent vergleicht verschiedene<br />
Verkehrsmittel. Der K<strong>und</strong>e entscheidet,<br />
ob er schnell, preiswert oder besonders<br />
umweltfre<strong>und</strong>lich reisen will. Qixxit<br />
bezieht auch die Car Sharing-Angebote<br />
von Flinkster <strong>und</strong> mehr als 10.000 Call<br />
a bike-Mietfahrräder mit ein, die eine<br />
„Tür-zu-Tür“-Mobilität ermöglichen. Da<br />
setzen wir an, wenn wir die Zukunft<br />
gestalten. Es geht um die nahtlose Mobilitätslösung:<br />
einfach, ohne komplizierte<br />
Buchungs- <strong>und</strong> Bezahlprozesse. In wenigen<br />
Klicks, in Sek<strong>und</strong>en zur Lösung<br />
− das ist das Ziel.<br />
Digitalisierung <strong>und</strong> Nachhaltigkeit<br />
verknüpfen<br />
Weil möglichst viele Menschen flächendeckend<br />
Zugang zu Mobilität haben sollen,<br />
beschäftigen wir uns auch mit dem autonomen<br />
Fahren auf der Straße − für Auto,<br />
Bus <strong>und</strong> Lkw. Hier wollen wir neue Geschäftsmodelle<br />
entwickeln. Selbst fahrende<br />
Autos werden einen neuen Markt entstehen<br />
lassen: Der klassische motorisierte<br />
Individualverkehr <strong>und</strong> der öffentliche<br />
Verkehr verschmelzen zum individuellen<br />
öffentlichen Verkehr. Mobilitätsangebote<br />
werden „on demand“ produziert. So werden<br />
neue Räume erschlossen − etwa über<br />
eine bessere Vernetzung auf dem Land.<br />
Mit diesen Aktivitäten stärken wir auch<br />
unsere ökologische Leistung. Denn eines<br />
ist klar: Die Schiene ist <strong>und</strong> bleibt der<br />
Motor der Energiewende <strong>im</strong> Verkehr.<br />
Jedes Jahr entlastet die Deutsche Bahn<br />
<strong>Deutschland</strong>s Straßen um 1,5 Milliarden<br />
Auto- <strong>und</strong> 8 Millionen Lkw-Fahrten. Bis<br />
2020 wollen wir als DB-Konzern zudem<br />
unsere spezifischen CO 2<br />
-Emissionen um<br />
30 Prozent gegenüber 2006 reduzieren.<br />
Diese Zielsetzung macht deutlich: Wir<br />
nehmen unseren Anspruch, Umwelt-<br />
Vorreiter zu sein, sehr ernst. Die mit<br />
der Digitalisierung verb<strong>und</strong>enen Effizienzpotenziale<br />
wollen wir dabei gezielt<br />
nutzen. Das vollautomatische Fahren auf<br />
der Schiene ist hier wichtiger Baustein,<br />
kann es doch Effizienz <strong>und</strong> Leistung<br />
deutlich erhöhen. Auch das passiert<br />
nicht von heute auf morgen. Aber wir<br />
wollen Vorreiter sein <strong>und</strong> suchen dafür<br />
die Kooperation mit den Partnern in der<br />
Industrie, anderen Bahn-Unternehmen,<br />
der Politik <strong>und</strong> unseren Mitarbeitern.<br />
Mit unserer Vision eines nachhaltigen<br />
Verkehrs der Zukunft leisten wir unseren<br />
Beitrag zur Agenda 2030 <strong>und</strong> den 17 Sustainable<br />
Development Goals (SDGs) der<br />
Vereinten Nationen. Die Digitalisierung<br />
ist ein enormer Hebel hin zu mehr Nachhaltigkeit,<br />
dafür müssen beide Themen<br />
von vorneherein zusammen gedacht<br />
werden. Wenn wir die Weichen jetzt<br />
richtig stellen, können wir den Wandel<br />
positiv gestalten. Die Deutsche Bahn<br />
wird mit gutem Beispiel vorangehen.<br />
Weitere Informationen zum Engagement der DB:<br />
www.deutschebahn.com/de/nachhaltigkeit<br />
www.deutschebahn.com/sdg<br />
Individuell passende Mobilität ist gleichbedeutend<br />
damit, dass Reisen einfacher,<br />
bequemer, flexibler <strong>und</strong> persönlicher<br />
wird. Digitalisierung bedeutet in erster<br />
Linie: Der K<strong>und</strong>e findet rasch die für<br />
ihn geeignete Lösung. Da hat sich viel<br />
getan: So ist das Smartphone längst Fahrplanauskunft,<br />
Ticketschalter <strong>und</strong> Reisebegleiter<br />
in einem. Das lässt sich gut an<br />
unserer App „DB Navigator“ ablesen: Mit<br />
täglich vier Millionen Reiseauskünften<br />
oder monatlich r<strong>und</strong> dreieinhalb Millionen<br />
verkauften Online- <strong>und</strong> Handytickets<br />
ist der DB Navigator die erfolgreichste<br />
Mobilitäts-App. Über die Hälfte der Tickets<br />
<strong>im</strong> Fernverkehr werden online<br />
gebucht − mit steigender Tendenz. Das<br />
mobile Internet als Vertriebskanal wächst<br />
dabei besonders stark.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
81
Good Practice<br />
Flüchtlingsengagement<br />
neu ausgerichtet<br />
Auch nach über einem Jahr Flüchtlingshilfe in <strong>Deutschland</strong> ist das Thema aktueller denn je.<br />
Die Herausforderungen für Unternehmen, die sich nachhaltig engagieren wollen, sind hoch.<br />
Spracherwerb <strong>und</strong> zielgerichtete Angebote sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine gute<br />
Integration.<br />
Von Sabrina Haag, Deutsche Telekom<br />
Im August 2015 hat der Vorstand der<br />
Deutschen Telekom unmittelbar auf<br />
die stark wachsende Anzahl Zuflucht<br />
suchender Menschen in <strong>Deutschland</strong><br />
reagiert <strong>und</strong> die Task Force „DT hilft<br />
Flüchtlingen“ gebildet. Der <strong>Fokus</strong> der<br />
Task Force lag vor allem auf der Ersthilfe.<br />
Erste wirksame Maßnahmen waren die<br />
Versorgung vieler Erstaufnahmeeinrichtungen<br />
mit WLAN, die Bereitstellung<br />
von Immobilien, die Personalvermittlung<br />
von Beamten an das B<strong>und</strong>esamt für<br />
<strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Flüchtlinge (BAMF) <strong>und</strong><br />
das Onlineportal www.refugees.telekom.de.<br />
Neben Praktikums- <strong>und</strong> Ausbildungsplätzen<br />
wurden in der Folge auch spezielle<br />
Stipendien für die Telekom-eigene<br />
Hochschule für Telekommunikation in<br />
Leipzig an Flüchtlinge vergeben. Viele<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter haben<br />
sich zudem ehrenamtlich engagiert <strong>und</strong><br />
wurden dabei von der Deutschen Telekom<br />
finanziell, mit Freistellungen <strong>und</strong><br />
mit Infrastruktur unterstützt.<br />
Lag der Schwerpunkt <strong>im</strong> Jahr 2015 noch<br />
auf dem Ankommen <strong>und</strong> der ersten<br />
Orientierung, stand in <strong>2016</strong> die Klärung<br />
von Aufenthaltsstatus, Wohnort <strong>und</strong><br />
Integration in Umfeld <strong>und</strong> Arbeitsmarkt<br />
in <strong>Deutschland</strong> <strong>im</strong> Mittelpunkt.<br />
„Blicken wir auf unser bisheriges Engagement<br />
zurück, so konnten wir in der<br />
Phase des Ankommens auf Basis unserer<br />
Kernkompetenzen viel Unterstützung<br />
bieten. Doch nun müssen wir uns neu<br />
ausrichten. Die nachhaltige Integration<br />
82 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt<br />
stellt sich als eine viel größere<br />
Herausforderung dar, als ursprünglich<br />
angenommen“, so Barbara Costanzo,<br />
Leiterin der Einheit Group Social Engagement<br />
<strong>und</strong> Verantwortliche für die<br />
Task Force „DT hilft Flüchtlingen“ bei<br />
der Deutschen Telekom AG .<br />
Um die Integration in den Arbeitsmarkt<br />
zu fördern gründete die Telekom <strong>2016</strong><br />
gemeinsam mit Henkel, der Deutschen<br />
Post / DHL <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esagentur für<br />
Arbeit die Initiative „Praktikum PLUS<br />
Direkteinstieg“.<br />
Nach aktuellen Erkenntnissen verfügen<br />
ca. 86 Prozent der geflüchteten Menschen<br />
über keine formale berufliche<br />
Qualifikation oder zumindest über keine,<br />
die in <strong>Deutschland</strong> Anerkennung<br />
findet. Damit sind viel weniger Fachkräfte<br />
nach <strong>Deutschland</strong> gekommen<br />
als zunächst angenommen. Praktikum<br />
PLUS Direkteinstieg richtet sich an genau<br />
diese Zielgruppe. An Flüchtlinge mit<br />
Integrationshemmnissen wie nicht abgeschlossene<br />
Ausbildung <strong>im</strong> Herkunftsland,<br />
aber gutem Potenzial: Flüchtlinge<br />
mit Berufserfahrung, die einen direkten<br />
Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt<br />
anstreben. B<strong>und</strong>esweit werden insgesamt<br />
zunächst 100 Stellen von den drei beteiligten<br />
Unternehmen angeboten. Ziel ist<br />
es, in einem Zeitraum von 2,5 Jahren die<br />
berufliche Perspektive zu verbessern <strong>und</strong><br />
die Chancen für den deutschen Arbeitsmarkt<br />
zu erhöhen. Die ersten 6 Monate<br />
werden als Orientierungsphase in Form<br />
von Praktika umgesetzt, an die sich unmittelbar<br />
eine befristete Anstellung für<br />
2 Jahre anschließt. Das Besondere dabei:<br />
Die Integration in das Arbeitsleben<br />
erfolgt bei gleichzeitiger Fortsetzung<br />
der Teilnahme an Integrations- <strong>und</strong><br />
Sprachkursen <strong>und</strong> der Einstieg über<br />
die beiden Phasen bietet die Möglichkeit<br />
eines niederschwelligen Übergangs in<br />
die Arbeitswelt, da die Verantwortung<br />
<strong>im</strong> Job langsam ansteigt.<br />
„Ohne den Erwerb der deutschen Sprache<br />
können wir in einem Unternehmen wie<br />
unserem, in dem das gesprochene <strong>und</strong><br />
geschriebene Wort zu den wichtigsten<br />
Arbeitsinstrumenten gehört, keine Perspektive<br />
bieten“, so Barbara Costanzo.<br />
Nicht nur der Spracherwerb, der deutlich<br />
länger dauert als zunächst angenommen,<br />
stellt sich als große Hürde heraus. Auch<br />
die verschiedenen Aufenthaltsstatus<br />
machen es Unternehmen nicht leicht,<br />
passende Angebote für Flüchtlinge zu<br />
schaffen. Die rechtliche Lage ist komplex,<br />
zusätzlich stellen sich ändernde<br />
rechtliche Rahmenbedingungen Unternehmen,<br />
die in gut abgest<strong>im</strong>mten<br />
Prozessen arbeiten müssen, <strong>im</strong>mer<br />
wieder vor neue Herausforderungen.<br />
Sich darauf einzulassen erfordert ein<br />
Umdenken− Standardprozesse müssen<br />
oft auch für kleine Zielgruppen angepasst<br />
werden, selten sind hierfür notwendige<br />
Ressourcen vorgehalten. Auch haben<br />
die Menschen aus der Zielgruppe häufig<br />
andere Erfahrungen mit dem Einstieg in<br />
den Arbeitsmarkt. Eine irakische Praktikantin<br />
der Deutschen Telekom formuliert<br />
es so: „Wenn Du bei uns Koch sein<br />
willst, denn gehst Du in ein Restaurant<br />
<strong>und</strong> bist es! Ausbildung <strong>und</strong> die vielen<br />
Bezeichnungen für Berufe kennen<br />
wir nicht.“ Zudem haben viele junge<br />
Flüchtlinge sich nicht damit auseinander<br />
gesetzt, was sie einmal beruflich tun<br />
möchten. In <strong>Deutschland</strong> ist dies in jeden<br />
Lehrplan von weiterführenden Schulen<br />
inklusive berufliche Praktika <strong>und</strong> vieles<br />
mehr eingeb<strong>und</strong>en. Auch <strong>im</strong> privaten<br />
Umfeld spielt die Frage: „Was möchtest<br />
Du einmal werden?“ von Kindesbeinen<br />
an eine wichtige Rolle. Das ist in den<br />
Herkunftsländern vieler Flüchtlinge<br />
nicht selbstverständlich.<br />
Mit der Neuausrichtung des Flüchtlingsengagements<br />
will die Deutsche Telekom<br />
insbesondere auch eine Erhöhung der<br />
Bewerberzahlen erreichen. Nur mit einer<br />
ausreichenden Anzahl an Bewerbungen<br />
können die Kandidaten gef<strong>und</strong>en werden,<br />
die gut zur Stelle <strong>und</strong> ins Unternehmen<br />
passen.<br />
Auf Basis der Erfahrungen <strong>und</strong> Erfolge<br />
der ersten Projektphase wird auch<br />
das Flüchtlingsportal neu ausgerichtet<br />
<strong>und</strong> mit neuen Partnern fortgeführt.<br />
Das Engagement der Mitarbeiter wird<br />
verstärkt für die Integration der neuen<br />
Kollegen eingesetzt, indem diese zum<br />
Beispiel Flüchtlinge be<strong>im</strong> Spracherwerb<br />
unterstützen.<br />
Kooperationen mit Firmen, aber auch<br />
NGOs helfen dabei, Erfahrungen besser<br />
nutzbar zu machen <strong>und</strong> Angebote noch<br />
besser zu positionieren <strong>und</strong> auszubauen.<br />
So wird es bei der Telekom eine<br />
neue Kooperation mit help e.V. geben,<br />
die Menschen auch in den Herkunftssprachen<br />
unterstützt, sofern sie dies<br />
wünschen. Diese wird das langjährig<br />
erprobte Angebot zur Mitarbeiter- <strong>und</strong><br />
Führungskräfteberatung auch in psychosozialen<br />
Fragestellungen über die B.A.D<br />
GmbH ergänzen.<br />
Um ihr gesellschaftliches Engagement<br />
zielgerichtet weiterzuentwickeln, nutzt<br />
die Telekom den regelmäßigen Austausch<br />
mit anderen Unternehmen, NGOs,<br />
Behörden, Ehrenamtlern, Menschen aus<br />
der Zielgruppe sowie Experten. Gemeinsam<br />
werden Ideen diskutiert <strong>und</strong> Problemstellungen<br />
− wie die derzeit noch<br />
mangelnde Anzahl an Bewerbern − aus<br />
verschiedenen Perspektiven betrachtet,<br />
um neue Lösungsansätze zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> zu erproben.<br />
„Für das Jahr 2017 rechnen wir mit einer<br />
großen Anzahl von Menschen, die nach<br />
der Teilnahme an Sprach- <strong>und</strong> Integrationskursen<br />
bereit sind für den Einstieg<br />
in den Arbeitsmarkt. Darauf richten wir<br />
uns aus. Weil wir als eines der führenden<br />
DAX-Unternehmen Verantwortung<br />
übernehmen <strong>und</strong> weil wir wissen, dass<br />
die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen<br />
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe<br />
ist, die uns alle angeht“, so Barbara<br />
Costanzo.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
83
Good Practice<br />
Gemeinsam gegen<br />
Energiearmut<br />
Kein warmes Wasser, keine Möglichkeit zu kochen oder Wäsche zu waschen: In <strong>Deutschland</strong> wird<br />
jedes Jahr 350.000 Haushalten laut B<strong>und</strong>esnetzagentur der Strom abgestellt. Für die Betroffenen<br />
sind diese Sperrungen dramatisch <strong>und</strong> können zum sozialen Abstieg führen. Aber auch Energieanbietern<br />
entstehen dadurch hohe Kosten, zusätzlicher bürokratischer Aufwand <strong>und</strong> eine negative<br />
Außenwirkung. E.ON hat das Problem erkannt <strong>und</strong> für finanzschwache K<strong>und</strong>en eigens ein Programm<br />
entwickelt. Dieses hilft den Betroffenen, ihre Energieschulden in kleinen Schritten zu<br />
begleichen, so die Energiesperrungen zu vermeiden <strong>und</strong> bietet eine erste Hilfe auf dem Weg aus<br />
der Schuldenfalle.<br />
Von Dr. Joach<strong>im</strong> Klein,<br />
Head of Customer Relations, E.ON<br />
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum<br />
Menschen ihre Stromrechnung nicht<br />
rechtzeitig bezahlen: Viele Betroffenen<br />
kontrollieren ihren Zählerstand nicht <strong>und</strong><br />
sind sich über ihren tatsächlichen Verbrauch<br />
nicht bewusst. Als Folge st<strong>im</strong>men<br />
die Abschlagszahlungen nicht mit dem eigentlichen<br />
Stromverbrauch überein, <strong>und</strong><br />
es kommt zu hohen Nachforderungen.<br />
Lösungen bei Zahlungsproblemen<br />
Tatsächlich hängen Energieschulden<br />
aber oft auch mit anderen Schuldenproblemen<br />
zusammen. „Wir kooperieren<br />
deshalb in dem Zahlhilfe-Programm auch<br />
eng mit den Jobcentern der B<strong>und</strong>esagentur<br />
für Arbeit <strong>und</strong> den Schuldnerberatungen<br />
der Wohlfahrtsverbände“, erklärt<br />
Sandra Turner, Strategie K<strong>und</strong>enbindung<br />
bei E.ON. „Dieses intersektorale Angebot,<br />
das unterschiedliche Perspektiven vereint<br />
<strong>und</strong> gemeinsam versucht, den K<strong>und</strong>en in<br />
ihrer Notsituation bestmöglich zu helfen,<br />
ist in dem Bereich wirklich einzigartig.“<br />
Hilfe zu Selbsthilfe für zahlungsschwache<br />
E.ON-K<strong>und</strong>en<br />
Das Zahlhilfe-Programm von E.ON begegnet<br />
deshalb dem Problem der Energiearmut<br />
der K<strong>und</strong>en auf unterschiedlichen<br />
Ebenen. Kurzfristig ist das Ziel, die drohende<br />
Sperrung aufzuhalten, mittelfristig<br />
gilt es, die Energieschulden der Betroffenen<br />
abzubauen, <strong>und</strong> langfristig soll<br />
das Entstehen neuer Schulden vermieden<br />
werden. Dabei geht es auch darum, jenen<br />
Menschen, die sich nicht selbst zu<br />
helfen wissen, eine Orientierungshilfe<br />
zu geben <strong>und</strong> Perspektiven aufzuzeigen:<br />
„Wir bieten unseren K<strong>und</strong>en nachhaltige<br />
Lösungen, die speziell an ihren Bedürfnissen<br />
orientiert sind, damit sie künftig<br />
ihre Energiekosten selbstständig <strong>im</strong> Griff<br />
haben“, so Turner weiter.<br />
haben. Zu diesen Maßnahmen zählen<br />
unter anderem ...<br />
Für K<strong>und</strong>en:<br />
• K<strong>und</strong>en mit Zahlungsschwierigkeiten<br />
haben die Möglichkeit, einen zwölfmonatigen<br />
Ratenplan zur Rückzahlung<br />
mit E.ON zu vereinbaren. Hierzu<br />
können sie sich an das sogenannte<br />
Zahlhilfe-Team wenden, das den Betroffenen<br />
bei Fragen weiterhilft.<br />
• Auf Wunsch vermittelt E.ON einen<br />
Termin bei einer gemeinnützigen, telefonischen<br />
Schuldnerberatung, die<br />
Externe Unterstützung<br />
Um das zu erreichen, setzt sich das Programm<br />
aus verschiedenen Maßnahmen<br />
für K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Jobcenter / Schuldenberatungen<br />
zusammen. Diese greifen je<br />
nach individueller Problemlage des Betroffenen<br />
<strong>und</strong> den jeweiligen Ursachen,<br />
die zur Energieverschuldung geführt<br />
84 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
die finanzielle Situation der K<strong>und</strong>en<br />
analysiert, einen Haushaltsplan erstellt<br />
<strong>und</strong> eine zahlbare Ratenhöhe ermittelt.<br />
Zur langfristigen Unterstützung kann<br />
der Kontakt zu einer Beratungsstelle<br />
vor Ort hergestellt werden.<br />
• Um eine Sperrung zu vermeiden, können<br />
K<strong>und</strong>en bar in Einzelhandelsgeschäften<br />
wie dm, Penny, REWE, der<br />
Deutschen Telekom oder real unbürokratisch<br />
Teilbeträge auf die Energierechnung<br />
überweisen. Die Zahlscheine<br />
erhalten sie per E-Mail oder SMS.<br />
Weitere Informationen finden sie unter<br />
www.eon.de/barzahlen.<br />
Sperrung vermeiden<br />
• Die Broschüren „E.ON unterstützt“ bieten<br />
K<strong>und</strong>en einfach verständliche Informationen<br />
<strong>und</strong> Hilfestellungen zu Themen<br />
wie Energieverbrauch, Nachzahlung,<br />
Zahlungsschwierigkeiten oder Sperrung.<br />
Sie werden direkt an betroffene K<strong>und</strong>en<br />
verteilt, den Mahnungen beigelegt oder<br />
auf Wunsch in Jobcentern ausgelegt.<br />
Im Internet sind die Flyer in 15 verschiedenen<br />
Sprachen erhältlich.<br />
Wir sprechen Ihre Sprache<br />
• In der Zahlhilfe-Rubrik www.eon.de/<br />
zahlhilfe bekommen die K<strong>und</strong>en alle<br />
Hilfsangebote aus den Broschüren<br />
<strong>und</strong> weitere nützliche Links wie zum<br />
Beispiel zur Online-Schuldnerberatung<br />
der Caritas aufgeführt. Außerdem können<br />
sie hier die Adressen des Stromspar-Checks<br />
per PLZ-Suche finden, um<br />
einen Termin zu vereinbaren, bei dem<br />
ein Stromspar-Team unter anderem<br />
den Energieverbrauch des Haushalts<br />
prüft.<br />
Prävention<br />
Für Jobcenter <strong>und</strong> Schuldnerberatungen:<br />
• Jobcenter <strong>und</strong> Schuldnerberatungen haben<br />
die Möglichkeit, sich innerhalb des<br />
Zahlhilfe-Teams über eine Hotline an<br />
„Berater-Spezialisten“ zu wenden. Diese<br />
sind besonders geschult <strong>und</strong> haben<br />
einen größeren Handlungsspielraum<br />
als andere E.ON-Mitarbeiter. So können<br />
diese Berater den Sperrprozess stoppen,<br />
sobald ein Jobcenter oder eine Beratungsstelle<br />
für einen K<strong>und</strong>en anruft.<br />
• Danach wird geprüft, ob der K<strong>und</strong>e<br />
einen Ratenplan ohne Zinsen <strong>und</strong> Gebühren<br />
erhalten kann. Das Jobcenter<br />
prüft wiederum die Vergabe eines Darlehens<br />
für die Energieschulden. Sollte<br />
beides nicht möglich sein, bietet E.ON<br />
<strong>im</strong> Einzelfall den „Ratenplan Zahlhilfe“<br />
mit einer längeren Laufzeit an.<br />
Die Schuldnerberatungen erarbeiten<br />
dann mit dem K<strong>und</strong>en eine realistische<br />
Ratenhöhe, die in das Gesamtbudget<br />
passt.<br />
• E.ON bietet den Mitarbeitern der Jobcenter<br />
ein „Zahlhilfe-Set“ an. Gemeinsam<br />
können sie so mit dem K<strong>und</strong>en<br />
die Ursachen für die Energieschulden<br />
frühzeitig identifizieren.<br />
K<strong>und</strong>enzentrierte Entwicklung des<br />
Programms<br />
E.ON hat 2014 angefangen, das Zahlhilfe-<br />
Programm <strong>im</strong> Unternehmen voranzutreiben.<br />
Dabei orientierte sich der Energieanbieter<br />
am Konzept des sogenannten<br />
Service Designs, mit dessen Hilfe Unternehmen<br />
methodisch Dienstleistungen<br />
aus Sicht von K<strong>und</strong>en entwickeln. Um die<br />
genauen Bedürfnisse zu ermitteln, führte<br />
E.ON Interviews mit Betroffenen, den<br />
Jobcentern <strong>und</strong> Schuldnerberatungen<br />
durch: „K<strong>und</strong>en sind teilweise überfordert,<br />
wenn der Schuldenberg anwächst.<br />
Dann bedienen sie eher die Gläubiger,<br />
die am meisten Druck machen“, erklärt<br />
Turner. „Zur Existenzsicherung ist die<br />
Zahlung von Strom, Heizung <strong>und</strong> Miete<br />
aber am wichtigsten. Dazu raten auch<br />
Schuldnerberatungen.“<br />
In einem zweiten Schritt hat man bei<br />
E.ON die unterschiedlichen Dienstleistungen<br />
ein halbes Jahr lang an 300<br />
echten K<strong>und</strong>enfällen <strong>und</strong> involvierten<br />
Jobcentern <strong>und</strong> Beratungsstellen getestet,<br />
um so die notwendigen Ressourcen <strong>und</strong><br />
Kompetenzen für die eigenen Serviceleistungen<br />
aufzubauen: „Mit dem Zahlhilfe-Programm<br />
haben wir die Themen<br />
Energiearmut, Zahlungsprobleme <strong>und</strong><br />
Stromsperrungen nachhaltig <strong>im</strong> Unternehmen<br />
verankert. Um eine positive<br />
Wirkung der Initiative zu gewährleisten,<br />
führen wir kontinuierlich Evaluationen<br />
durch, sodass wir Opt<strong>im</strong>ierungspotenziale<br />
schnell erkennen <strong>und</strong> <strong>im</strong> Programm<br />
umsetzen können“, so Turner weiter.<br />
Momentan findet der b<strong>und</strong>esweite Rollout<br />
statt, bei dem E.ON-Mitarbeiter das<br />
Programm den regionalen Vertretungen<br />
der B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit <strong>und</strong> den<br />
Jobcentern vor Ort in Informationsveranstaltungen<br />
vorstellen.<br />
E.ON beschränkt sein Engagement für<br />
finanzschwache K<strong>und</strong>en mit Energieschulden<br />
aber nicht nur auf <strong>Deutschland</strong>.<br />
So bietet das Unternehmen Programme<br />
mit kleinerem Umfang auch beispielsweise<br />
in UK <strong>und</strong> Ungarn an.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
85
Good Practice<br />
Auf dem Weg in eine<br />
nachhaltigere Zukunft<br />
Profitables Wachstum <strong>und</strong> zukünftige Geschäftserfolge beruhen maßgeblich auf vorausschauendem<br />
<strong>und</strong> verantwortungsvollem Handeln. Davon sind wir bei Evonik überzeugt. Dies gilt für<br />
jeden einzelnen unserer weltweit r<strong>und</strong> 33.000 Beschäftigten. Die zehn Prinzipien des UN <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> sind dabei eine wichtige Richtschnur.<br />
Von Dr. Detlef Männig, Corporate Responsibility, Evonik<br />
Unser Handeln zielt darauf ab, durch<br />
innovative Produkte das Leben der Menschen<br />
gesünder <strong>und</strong> lebenswerter zu<br />
machen. Das erwarten insbesondere<br />
unsere K<strong>und</strong>en von uns, bei denen wir<br />
eine steigende Nachfrage nach Produkten<br />
beobachten, die eine ausgewogene<br />
Balance ökonomischer, ökologischer<br />
<strong>und</strong> sozialer Faktoren aufweisen. Vor<br />
diesem Hintergr<strong>und</strong> richtet Evonik seine<br />
Geschäftsaktivitäten zunehmend auf<br />
Nachhaltigkeit aus.<br />
Nachhaltigkeitsanalyse unserer<br />
Geschäfte<br />
Im Rahmen unserer langfristig ausgerichteten<br />
Strategie haben wir 2015 die strukturierte<br />
Nachhaltigkeitsanalyse unserer<br />
Geschäfte fortgesetzt <strong>und</strong> in den drei<br />
Chemiesegmenten auf alle 22 Geschäftsgebiete<br />
ausgedehnt. Hierbei zeigte sich,<br />
dass Evonik bereits über 50 Prozent des<br />
Umsatzes mit Produkten für ressourcenschonende<br />
Anwendungen erzielt.<br />
F<strong>und</strong>ierte Analysen helfen uns, die Auswirkungen<br />
unserer Produkte transparent<br />
zu machen. Das stärkt unsere Glaubwürdigkeit<br />
als zuverlässiger Lösungsanbieter<br />
für unsere K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> hilft uns,<br />
die Nachhaltigkeit unserer Geschäfte<br />
kontinuierlich weiter zu verbessern.<br />
Inzwischen hat Evonik bereits r<strong>und</strong> 70<br />
Prozent des Außenumsatzes seiner drei<br />
Chemiesegmente mittels ökobilanzieller<br />
Betrachtungen untersucht. Angestrebt ist<br />
eine Ausdehnung auf 80 Prozent.<br />
Unser aus Wissenschaftlern <strong>und</strong> Ingenieuren<br />
interdisziplinär zusammengesetztes<br />
Life-Cycle-Management-Team (LCM)<br />
hat seit dem Jahr 2009 über 100 lebenszyklusbasierte<br />
Analysen für Produkte,<br />
Prozesse oder ganze Standorte erstellt.<br />
Produktbeispiele sind Aminosäuren für<br />
die Tierernährung sowie Straßenmarkierungen,<br />
die auf dem Reaktionsharz<br />
DEGAROUTE® basieren. Darüber hinaus<br />
bringen sich die LCM-Experten mit ihrer<br />
Erfahrung in die Weiterentwicklung der<br />
Methodik von lebenszyklusbasierten<br />
Analysen ein. Dies erfolgt sowohl national<br />
als auch international <strong>im</strong> Rahmen<br />
von Nachhaltigkeitsinstitutionen <strong>und</strong><br />
-netzwerken wie dem World Business<br />
Council for Sustainable Development.<br />
Hohe Ausgaben für Forschung <strong>und</strong><br />
Entwicklung<br />
Evonik ist ein forschungsintensives Unternehmen<br />
<strong>und</strong> gibt jedes Jahr mehr als<br />
3 Prozent seines Umsatzes für Forschung<br />
<strong>und</strong> Entwicklung aus. Dieses hohe Niveau<br />
wollen wir beibehalten. In den nächsten<br />
zehn Jahren sollen insgesamt mehr als 4<br />
Milliarden € in Forschung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
fließen. Die Nachhaltigkeitsaktivitäten<br />
sind in unseren operativen Segmenten<br />
unmittelbar an die Verantwortung für<br />
Produkt- <strong>und</strong> Geschäftsentwicklung angeschlossen,<br />
also an der produktnahen<br />
Forschung & Entwicklung. In der Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
hat unsere strategische<br />
Forschungseinheit Creavis einen I2P³-<br />
Prozess („Innovation to People, Planet,<br />
Profit“) eingeführt. Bei der Produkt- <strong>und</strong><br />
Verfahrensentwicklung berücksichtigt<br />
dieser schon in einem frühen Stadium<br />
neben ökonomischen auch ökologische<br />
<strong>und</strong> soziale Fragestellungen. Damit sind<br />
Nachhaltigkeitskriterien dem Innovationsprozess<br />
quasi von der Wiege an einge<strong>im</strong>pft.<br />
Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber<br />
In vielen unserer Geschäfte erleben wir<br />
Nachhaltigkeit inzwischen als Wachstums<strong>und</strong><br />
Innovationstreiber. Ein aktuelles<br />
Beispiel sind unsere Biotenside für Wasch<strong>und</strong><br />
Reinigungsmittel auf Basis von Sophorolipiden.<br />
Diese sind zu 100 Prozent<br />
aus nachwachsenden Rohstoffen mittels<br />
biotechnologischer Verfahren hergestellt.<br />
Sie weisen sehr gute Reinigungseigenschaften<br />
auf, haben ein herausragendes<br />
toxikologisches <strong>und</strong> ökologisches Profil<br />
<strong>und</strong> sind vollständig biologisch abbaubar.<br />
REWOFERM® SL 446 wurde daher<br />
als „Biobased Material of the Year <strong>2016</strong>“<br />
ausgezeichnet.<br />
86 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Links: REWOFERM® SL 446<br />
Rechts: SEPURAN® Hohlfasermembranbündel<br />
Unten: Met-Met für Garnelen<br />
Eine weitere Innovation von Evonik<br />
zielt auf die Aquakultur, die aufgr<strong>und</strong><br />
der Überfischung der Ozeane zunehmend<br />
an Bedeutung gewinnt. Tatsache<br />
ist aber, dass zurzeit das Futter für diese<br />
Anwendung hauptsächlich aus Fischmehl<br />
besteht <strong>und</strong> damit die weitere<br />
Überfischung sogar fördert. Evonik hat<br />
deshalb das Dipeptid Met-Met entwickelt.<br />
Es ermöglicht, den pflanzlichen Anteil<br />
an Protein in der Nahrung deutlich zu<br />
erhöhen. So werden Lachse <strong>und</strong> Garnelen<br />
quasi zu Vegetariern.<br />
Bevor Biogas ins Erdgasnetz eingespeist<br />
werden kann, sind eine umfangreiche<br />
Aufbereitung <strong>und</strong> Reinigung nötig. Neue,<br />
besonders selektive SEPURAN® Polymermembranen<br />
von Evonik verwandeln<br />
Rohbiogas einfach <strong>und</strong> effizient in hochreines<br />
Biomethan. Das steigert den Ertrag<br />
<strong>und</strong> schont wertvolle Ressourcen.<br />
Das Produktportfolio von Evonik umfasst<br />
zahlreiche weitere ressourcenschonende<br />
Lösungen. Dazu zählen beispielsweise<br />
Öladditive, die den Treibstoffverbrauch<br />
von Hydraulikmaschinen deutlich senken<br />
oder Hochleistungskunststoffe zur<br />
Gewichtsreduzierung in der Automobil<strong>und</strong><br />
Luftfahrtindustrie. Systemlösungen<br />
für Windkraftanlagen helfen bei der<br />
Erzeugung von erneuerbaren Energien.<br />
Auch be<strong>im</strong> Ausbau unseres Corporate-<br />
Venture-Capital-Portfolios ist Nachhaltigkeit<br />
ein wichtiges Kriterium. Ein Beispiel<br />
dafür ist unser Engagement bei Biosynthetic<br />
Technologies. Das Unternehmen<br />
stellt eine neue Klasse biobasierter Öle<br />
her, die als Hochleistungsschmierstoffe<br />
Anwendung finden.<br />
Evonik erstmals <strong>im</strong> Dow Jones<br />
Sustainability Index<br />
Unser Nachhaltigkeitsengagement wird<br />
anerkannt. So wurde Evonik Anfang<br />
<strong>2016</strong> erstmals <strong>im</strong> renommierten Nachhaltigkeitsjahrbuch<br />
von RobecoSAM als<br />
„Sustainability Leader“ mit der Auszeichnung<br />
„Silver Class“ gewürdigt. Auf Anhieb<br />
konnten wir uns unter den besten<br />
Zehn der weltweit etwa 70 bewerteten<br />
Chemieunternehmen platzieren. Im<br />
weiteren Verlauf des Jahres wurde Evonik<br />
erstmals in die Dow Jones Sustainability<br />
Indizes World <strong>und</strong> Europe aufgenommen<br />
sowie für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis<br />
in den Kategorien „<strong>Deutschland</strong>s<br />
nachhaltigste Großunternehmen“ <strong>und</strong><br />
„Forschung“ nominiert. Diese Auszeichnungen<br />
sind für uns Ansporn, den Nachhaltigkeitsnutzen<br />
unserer Produkte <strong>und</strong><br />
Lösungen konsequent auszubauen.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
87
Good Practice<br />
EY: Integration von Flüchtlingen<br />
gemeinsam gestalten<br />
Die hohe Zahl an Flüchtlingen stellt Politik, Gesellschaft <strong>und</strong> Wirtschaft vor große Herausforderungen.<br />
Angesichts von demografischem Wandel <strong>und</strong> Fachkräftemangel hierzulande kann das<br />
aber auch eine Chance sein. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die erfolgreiche Integration<br />
der Menschen. Das Prüfungs- <strong>und</strong> Beratungsunternehmen EY widmet sich dieser Aufgabe mit<br />
vier zentralen Maßnahmen: mit Praktikumsangeboten, dem „R<strong>und</strong>en Tisch der Charta der Vielfalt“,<br />
der Investition in Bildung sowie durch das Engagement seiner Mitarbeiter.<br />
Von Dr. Sonja Würtemberger, Head of Strategy &<br />
Governance, Talent Team GSA, EY<br />
Die Geschichte von Mohammed Basel<br />
Alyounes liest sich wie ein „Integrationsmärchen“:<br />
Der Syrer floh <strong>im</strong> August 2015<br />
nach seinem Wirtschaftsstudium aus Damaskus<br />
nach <strong>Deutschland</strong>. Dass er heute<br />
bei EY in Berlin arbeitet, verdankt er, wie<br />
er selbst sagt, Zufall, Glück <strong>und</strong> Verstand.<br />
Von einem TV-Reporter nach seinen Träumen<br />
gefragt, antwortete er, dass er gerne<br />
für Ernst & Young arbeiten würde. Diesen<br />
Fernsehbeitrag sah Ana-Cristina Grohnert<br />
aus der Geschäftsführung von EY. Es<br />
gelang ihr, Mohammed Basel Alyounes<br />
über eine syrische Facebook-Gruppe ausfindig<br />
zu machen, sie lud ihn zu einem<br />
Gespräch ein <strong>und</strong> bot ihm anschließend<br />
ein Praktikum an. Inzwischen betreut er<br />
bereits die ersten K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> unterstützt<br />
andere Flüchtlinge als Mentor <strong>und</strong> ist<br />
Teil des Projektteams „Onboarding <strong>und</strong><br />
Integration Geflüchtete@EY“.<br />
Praktika als erster Einstieg in die<br />
Berufswelt<br />
EY hat mittlerweile mehrere Flüchtlinge<br />
als Praktikanten eingestellt, zwei davon<br />
wurden in ein festes Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis<br />
übernommen. Der erste<br />
Kontakt erfolgt in der Regel über private<br />
Kontakte, Job-Portale <strong>und</strong> soziale Medien,<br />
danach werden sie zu Bewerbungsgesprächen<br />
bei EY eingeladen. Während<br />
eines drei- bis sechsmonatigen Praktikums<br />
profitieren sie von Unterstützungsangeboten<br />
wie Sprachkursen, Freizeitangeboten<br />
zum Netzwerken <strong>und</strong> einem sich <strong>im</strong><br />
Auf bau befindlichen Buddy-Programm.<br />
Anschließend haben sie die Chance auf<br />
eine Verlängerung bzw. eine weitere Beschäftigung.<br />
EY arbeitet derzeit, basierend<br />
auf den ersten Erfahrungen, an einem<br />
einheitlichen Einstiegsmodell, um den<br />
Integrationsprozess in das Unternehmen<br />
zu vereinfachen <strong>und</strong> zu beschleunigen.<br />
Integration gemeinsam bewältigen<br />
Um <strong>im</strong> Schulterschluss mit Politik, Gesellschaft<br />
<strong>und</strong> weiteren Unternehmen<br />
einen konkreten Beitrag zur Integration<br />
zu leisten, ist EY darüber hinaus der<br />
Initiative „Wir zusammen“ beigetreten.<br />
Ziel des Netzwerks ist es, einen Überblick<br />
über die zahlreichen Angebote in der<br />
Flüchtlingshilfe zu geben <strong>und</strong> weitere<br />
Firmen zum Mitmachen zu bewegen.<br />
88 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Alle Teilnehmer wissen, dass Integration<br />
nur durch gemeinsames Handeln erfolgreich<br />
gestaltet werden kann.<br />
Anlässlich eines Besuchs von B<strong>und</strong>espräsident<br />
Joach<strong>im</strong> Gauck bei den Mitgliedern<br />
der Initiative sagte der Vorsitzende der<br />
Geschäftsführung von EY, Hubert Barth:<br />
„Mit unserem Unternehmensleitbild ‚Building<br />
a Better Working World‘ machen wir<br />
es uns zur Aufgabe, die Wirtschaftswelt<br />
von morgen nachhaltig mitzugestalten.<br />
Wir sind uns bewusst, dass wir als internationales<br />
Unternehmen eine Verantwortung<br />
für unser Umfeld tragen − dazu<br />
zählt auch die Bewältigung des Flüchtlingszustroms.“<br />
Aus dieser Gr<strong>und</strong>überzeugung heraus<br />
initiierte EY Ende 2015 einen „R<strong>und</strong>en<br />
Tisch“ innerhalb der „Charta der Vielfalt“.<br />
Dieser soll dabei helfen, die Flüchtlingshilfe<br />
innerhalb der deutschen Wirtschaft<br />
besser zu koordinieren. Die Charta der<br />
Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative<br />
zur Förderung von Vielfalt in der Unternehmenskultur.<br />
Mehr als 2.350 Unternehmen<br />
<strong>und</strong> Institutionen haben sie bisher<br />
unterzeichnet.<br />
Die Idee für den „R<strong>und</strong>en Tisch“ entstand<br />
bei einem Treffen der Unternehmensvorstände<br />
mit der Staatsministerin Aydan<br />
Özoğuz <strong>im</strong> September 2015. Bei einem<br />
anschließenden Kick-off-Meeting bei EY<br />
in Berlin bildeten sich drei Schwerpunkte<br />
heraus: die Entwicklung einer internen<br />
Kommunikationsplattform, um Best Practices<br />
<strong>und</strong> Erfahrungen auszutauschen<br />
− diese ist seit September <strong>2016</strong> live geschaltet;<br />
die Erarbeitung einer Informationsplattform<br />
für Flüchtlinge; ein dritter<br />
Arbeitskreis beschäftigt sich mit Einstiegsmodellen<br />
für den deutschen Arbeitsmarkt,<br />
z. B. durch Sprachkurse oder Praktika.<br />
Im Dezember <strong>2016</strong> trifft sich der R<strong>und</strong>e<br />
Tisch zum vierten Mal unter dem Motto<br />
„Ein Jahr R<strong>und</strong>er Tisch − was haben wir<br />
gemeinsam erreicht?“<br />
„Vielfalt bereichert unsere<br />
Arbeitswelt“<br />
Ebenfalls Ende 2015 hat EY den Verein<br />
„EYcares e.V.“ ins Leben gerufen, der<br />
Flüchtlinge, aber auch politisch, rassistisch<br />
<strong>und</strong> religiös Verfolgte unterstützt.<br />
„Wir sind überzeugt, dass eine von Vielfalt<br />
geprägte Arbeitswelt bereichernd ist <strong>und</strong><br />
wollen dabei helfen, Flüchtlinge schnell<br />
in Gesellschaft <strong>und</strong> Arbeitsleben zu integrieren.<br />
Gleichzeitig wollen wir ein Auseinanderdriften<br />
der verschiedenen Teile<br />
der Gesellschaft verhindern. Deswegen<br />
setzen wir uns nicht nur für Flüchtlinge<br />
ein, sondern auch für die Integration<br />
anderer, bereits in <strong>Deutschland</strong> behe<strong>im</strong>ateter,<br />
benachteiligter Gruppen in die<br />
Wirtschaft“, erläutert Ana-Cristina Grohnert,<br />
Mitglied der Geschäftsführung <strong>und</strong><br />
personalverantwortliche Partnerin. Als<br />
erste Maßnahme rief EY seine Mitarbeiter<br />
zu Spenden für die Organisation „Save<br />
the Children“ auf, die sich unter anderem<br />
für Flüchtlingskinder einsetzt. Gleich zu<br />
Beginn spendete EY 50.000 Euro.<br />
Mitarbeiter engagieren sich<br />
Der Empfang von Flüchtlingen mit<br />
Essen am Bahnhof, der Besuch eines<br />
Basketballspiels, die Verabredung zum<br />
gemeinsamen Fußballgucken oder die<br />
Gründung eines Lauftreffs sind Beispiele<br />
dafür, wie sich auch EY-Mitarbeiter privat<br />
für die Integration der Flüchtlinge in die<br />
Arbeitswelt einsetzen. Das Unternehmen<br />
fördert dieses Engagement, indem<br />
es seinen Mitarbeitern ein best<strong>im</strong>mtes<br />
Zeitbudget für ehrenamtliche Tätigkeiten<br />
zur Verfügung stellt. Insgesamt haben<br />
sich EY-Mitarbeiter so bereits über 1.000<br />
St<strong>und</strong>en in der Flüchtlingshilfe engagiert.<br />
An vielen Standorten haben zudem<br />
Spenden, Ausflüge <strong>und</strong> Sammelaktionen<br />
gestartet <strong>und</strong> laufen <strong>im</strong>mer noch.<br />
Bildungsengagement<br />
Der Zugang zu Bildung ist für EY ein<br />
weiterer entscheidender Schritt hin zu<br />
einer schnellen Eingliederung. Dafür<br />
setzt sich das Unternehmen mit seinen<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Ressourcen ein. So<br />
unterstützt EY etwa die Kiron University,<br />
eine Online-Universität für Flüchtlinge,<br />
be<strong>im</strong> Auf bau eines Rechnungswesens<br />
sowie ihrer HR-Systeme <strong>und</strong> bei der<br />
Entwicklung eines zu den besonderen<br />
Anforderungen eines sozialen Start-Ups<br />
passenden Vergütungsmodells. Die Kiron<br />
University ist nicht nur in <strong>Deutschland</strong><br />
tätig, sondern unterhält Dependancen<br />
in Jordanien <strong>und</strong> der Türkei, um Bildung<br />
dorthin zu bringen, wo die meisten<br />
Flüchtlinge sind. Bei der Umsetzung<br />
dieser Strategie steht EY der Kiron University<br />
mit seinen Kenntnissen der lokalen<br />
rechtlichen <strong>und</strong> regulatorischen<br />
Anforderungen zur Seite.<br />
Zudem hat EY mit Spenden zur Entwicklung<br />
einer Sprach-Lern-App (Lugha)<br />
beigetragen, die seit Anfang November<br />
kostenlos in den App-Stores erhältlich ist.<br />
Zusätzlich entwickelt man gemeinsam<br />
mit der The DO School einen Lösungsansatz<br />
zur Integration von Flüchtlingen<br />
in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus begleitet<br />
EY operativ <strong>und</strong> beratend die Facebook-Seite<br />
des Syrischen Hauses, ein Projekt<br />
des Vereins „Integration HUB e.V.“.<br />
Die Facebook-Seite hat bereits über<br />
120.000 Follower <strong>und</strong> wird von Menschen,<br />
die aus Syrien nach <strong>Deutschland</strong><br />
geflohen sind, dafür genutzt, sich zu<br />
vernetzen <strong>und</strong> über das Leben <strong>und</strong> Arbeiten<br />
in <strong>Deutschland</strong> zu informieren.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
89
Good Practice<br />
Integration durch Bildung<br />
Für Freudenberg als werteorientierter Technologiekonzern in<br />
Familienbesitz bedeutet Erfolg nicht nur finanziell erfolgreich zu<br />
sein, sondern <strong>im</strong>mer auch die Übernahme von Verantwortung für<br />
die Gesellschaft. Seit 2015 engagieren sich das Unternehmen<br />
<strong>und</strong> seine Mitarbeiter in vielfältigen Aktionen für Geflüchtete.<br />
Im Mittelpunkt steht die Förderung von Sprache <strong>und</strong> Bildung,<br />
insbesondere für Familien mit Kindern <strong>und</strong> für junge Menschen.<br />
Von Laura Rech, Corporate Communications,<br />
Freudenberg Group<br />
Den Startpunkt der Flüchtlingshilfe-<br />
Initiative bildete eine weltweite Spendenaktion,<br />
zu der das Unternehmen alle<br />
40.000 Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter,<br />
Pensionäre sowie Gesellschafter aufrief.<br />
Für jeden gespendeten Euro gab<br />
Freudenberg zwei Euro hinzu − verdreifachte<br />
also die Summe. Insgesamt<br />
kamen so bis Dezember 2015 gut 1,6<br />
Millionen Euro zusammen. Mehr als die<br />
Hälfte des Betrags ist bereits eingesetzt:<br />
R<strong>und</strong> 60 Projekte − von der lokalen Bürgerinitiative<br />
bis hin zu internationalen<br />
Hilfsorganisationen wie der Deutschen<br />
Welthungerhilfe <strong>und</strong> dem Türkischen<br />
Roten Halbmond − haben eine Unterstützung<br />
aus dem Spendentopf erhalten.<br />
Letztere leisten wichtige Soforthilfe in<br />
den Krisenregionen vor Ort.<br />
Mitarbeiter engagieren sich<br />
Die meisten Projekte haben Mitarbeiter<br />
<strong>und</strong> Gesellschafter selbst vorgeschlagen.<br />
„Wir unterstützen bevorzugt Initiativen<br />
an unseren Standorten, zu denen unsere<br />
Mitarbeiter einen persönlichen Bezug<br />
haben − wir sind stolz auf das Engagement<br />
jedes Einzelnen“, so Dr. Mohsen<br />
Sohi, Sprecher des Vorstands der<br />
Freudenberg Gruppe. Viele Mitarbeiter<br />
der Freudenberg Gruppe engagieren<br />
sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit in<br />
Kleiderkammern, Nähkursen, Fahrradwerkstätten<br />
oder Begegnungscafés. Immer<br />
wieder berichten sie, dass Geflüchtete<br />
− insbesondere die jungen unter<br />
ihnen − den Wunsch haben, so schnell<br />
wie möglich Deutsch zu lernen, zur<br />
Schule zu gehen, zu studieren oder eine<br />
Ausbildung zu absolvieren.<br />
Sprache als Schlüssel zu Integration<br />
„Sprachkenntnisse sind eine Gr<strong>und</strong>voraussetzung<br />
für gesellschaftliche Teilhabe<br />
<strong>und</strong> berufliche Chancen“, so Sohi. „Da<br />
Sprache der Schlüssel zur Integration<br />
ist, sind wir froh darüber, mit dem<br />
Goethe-Institut einen perfekten Partner<br />
für unser Engagement gef<strong>und</strong>en<br />
zu haben.“ Neben der Förderung von<br />
Deutschkursen für junge Geflüchtete<br />
übern<strong>im</strong>mt das Unternehmen die Kosten<br />
für Lehrgänge an allen Goethe-Instituten<br />
in <strong>Deutschland</strong>, die ehrenamtlichen<br />
Helfern Gr<strong>und</strong>kenntnisse des Deutschunterrichtens<br />
vermitteln. Auch viele<br />
Mitarbeiter haben bereits an einem der<br />
Lehrgänge teilgenommen.<br />
Sprachlernspiele in Kooperation mit<br />
dem Goethe-Institut<br />
Nach dem Kurs erhalten die Teilnehmer<br />
„Sprachlernspiele“, die ebenfalls<br />
<strong>im</strong> Rahmen der Kooperation mit dem<br />
Goethe-Institut entstanden sind. Sie geben<br />
ehrenamtlichen Helfern ein konkretes<br />
Werkzeug an die Hand, mit dem<br />
Geflüchtete schnell <strong>und</strong> einfach lernen<br />
können, erste Gespräche auf Deutsch<br />
zu führen. Einkaufen, Verabredungen<br />
treffen, sich in der neuen Umgebung<br />
zurechtfinden: Die Spielkarten decken<br />
verschiedene Alltagssituationen in 53 Varianten<br />
ab. Sie stehen zur Ausleihe in den<br />
zwölf Goethe-Instituten in <strong>Deutschland</strong><br />
zur Verfügung <strong>und</strong> lassen sich zudem −<br />
mitsamt den Spielregeln <strong>und</strong> weiteren<br />
Tipps für die Spracharbeit − auf goethe.<br />
de/willkommen herunterladen.<br />
Einblicke in die Arbeitswelt<br />
ermöglichen<br />
Eines von vielen Beispielen für das herausragende<br />
Engagement der Freudenberg-<br />
Standorte ist das Werk in Kufstein, Österreich.<br />
Hier engagieren sich Mitarbeiter<br />
für junge, unbegleitete Geflüchtete.<br />
Mit finanzieller Unterstützung von<br />
Freudenberg fördern sie r<strong>und</strong> 30 Afghanen,<br />
Syrer, Iraker, Somalier <strong>und</strong> Guineaner<br />
zwischen 14 <strong>und</strong> 17 Jahren, etwa<br />
durch Hausaufgabenhilfe, Deutschunterricht<br />
oder gemeinsame Unternehmungen.<br />
Besuche <strong>im</strong> Werk <strong>und</strong> Gespräche mit<br />
Mitarbeitern ermöglichen den Jugendlichen<br />
erste Einblicke in die deutsche<br />
Arbeitswelt.<br />
90 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Das Pilgerhaus, eine Einrichtung der Jugend<strong>und</strong><br />
Behindertenhilfe, betreut derzeit r<strong>und</strong><br />
h<strong>und</strong>ert unbegleitete junge Geflüchtete in<br />
Weinhe<strong>im</strong>, dem Stammsitz der Freudenberg<br />
Gruppe. Mit finanzieller Unterstützung von<br />
Freudenberg lernen die Jugendlichen unter<br />
fachlicher Begleitung Merkmale des deutschen<br />
Alltagslebens kennen, werden in ihrer<br />
sozialen Interaktion gefördert – wie hier be<strong>im</strong><br />
gemeinsamen Gärtnern – <strong>und</strong> schulisch<br />
unterstützt.<br />
Praktika machen fit für die<br />
Arbeitswelt<br />
Duale Ausbildung eröffnet<br />
Zukunftsperspektiven<br />
Am Stammsitz in Weinhe<strong>im</strong> geht das<br />
Unternehmen noch einen Schritt weiter:<br />
Zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung<br />
von Freudenberg<br />
<strong>und</strong> der Industrie- <strong>und</strong> Handelskammer<br />
Rhein-Neckar waren <strong>im</strong> Sommer <strong>2016</strong><br />
Jugendliche eingeladen, die als Geflüchtete<br />
oder Migranten nach <strong>Deutschland</strong><br />
gekommen sind. „Viele dieser jungen<br />
Menschen wissen häufig gar nicht, was<br />
eine duale Ausbildung ist <strong>und</strong> sie wollen<br />
am liebsten studieren. Doch das ist<br />
nicht für alle der richtige Weg − zumal<br />
es häufig an den Deutschkenntnissen<br />
fehlt“, sagt Dr. Rainer Kuntz, Leiter des<br />
Freudenberg-Ausbildungszentrums <strong>und</strong><br />
Gastgeber der Veranstaltung. Einige stünden<br />
unter hohem Druck, schnell Geld<br />
zu verdienen, beispielsweise, um ihre<br />
Familien in der He<strong>im</strong>at zu versorgen.<br />
„Da liegt es für manche erst einmal näher,<br />
einfache Hilfsjobs anzunehmen − leider.<br />
Denn diese Tätigkeiten bieten keine Entwicklungsperspektive.<br />
Unser Ziel ist es,<br />
den Jugendlichen das duale Ausbildungssystem<br />
zu erklären, sie zu motivieren<br />
<strong>und</strong> ihnen eine Perspektive aufzuzeigen“,<br />
sagt Kuntz. Abger<strong>und</strong>et wurde die Veranstaltung<br />
durch eine Führung in der<br />
Lehrwerkstatt, die einen Einblick in den<br />
praktischen Teil der Berufsausbildung<br />
ermöglichte.<br />
Seit Oktober <strong>2016</strong> sind acht junge Geflüchtete<br />
regelmäßig in der Freudenberg-<br />
Lehrwerkstatt anzutreffen. Sie absolvieren<br />
ein schulbegleitendes Praktikum, das<br />
sie auf eine Ausbildung in einfachen<br />
Metallberufen wie Industriemechaniker,<br />
Metallbauer oder Maschinen- <strong>und</strong> Anlagenführer<br />
vorbereitet. In gemeinsamen<br />
Pausen <strong>und</strong> bei Mahlzeiten kommen die<br />
jungen Geflüchteten in Kontakt mit den<br />
Jugendlichen, die regulär eine Ausbildung<br />
bei Freudenberg oder einem Partnerunternehmen<br />
des Ausbildungsverb<strong>und</strong>s<br />
machen. Das erleichtert die Integration<br />
<strong>und</strong> erhöht die Motivation, nach dem<br />
Praktikum einen Ausbildungsplatz zu<br />
finden.<br />
Links: Deutschunterricht ebnet den Weg zur<br />
Integration. Viele Freudenberg-Mitarbeiter<br />
engagieren sich ehrenamtlich als Lernbegleiter<br />
für Flüchtlinge. Freudenberg unterstützt<br />
zudem eine Vielzahl von lokalen <strong>und</strong> landesweiten<br />
Sprachangeboten für Geflüchtete.<br />
Rechts: In einem Praktikum lernen junge<br />
Geflüchtete bei Freudenberg die Gr<strong>und</strong>techniken<br />
der Metallarbeit kennen. Ziel des<br />
gemeinsamen Projekts mit einer berufsbildenden<br />
Schule ist es, die jungen Männer für<br />
einen dualen Ausbildungsplatz fit zu machen.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
91
Good Practice<br />
Durch gelebte<br />
Verantwortung<br />
unsere Zukunft<br />
gestalten<br />
Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen <strong>und</strong> CSR als<br />
selbstverständlichen Bestandteil in die Unternehmenskultur<br />
integrieren – eine Idee, die auch kleine Unternehmen umsetzen<br />
sollten? Unbedingt, sagt die gmc² gerhards multhaupt consulting<br />
GmbH aus Bonn. Das Unternehmen macht sich stark für den<br />
Gleichklang aus Ökonomie, Ökologie <strong>und</strong> Sozialem <strong>und</strong> lebt das<br />
Konzept des „nachhaltigen Wirtschaftens“ seit jeher. Dabei<br />
pflegt gmc² auch den intensiven Dialog mit K<strong>und</strong>en, Partnern<br />
<strong>und</strong> Interessierten.<br />
„Mensch sein heißt verantwortlich sein“<br />
− besser als mit den Worten des französischen<br />
Schriftstellers Antoine de<br />
Saint-Exupéry lässt sich unser unternehmerisches<br />
Selbstverständnis nicht<br />
beschreiben. Der Ausspruch bildet die<br />
Max<strong>im</strong>e, nach der wir handeln, für die<br />
wir Bewusstsein schaffen wollen. Achtung<br />
<strong>und</strong> Respekt gegenüber Mensch<br />
<strong>und</strong> Natur sind Werte, für die wir aus<br />
vollster Überzeugung einstehen <strong>und</strong> die<br />
ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie<br />
sind. Bio-Milch<br />
<strong>und</strong> Ökostrom sind zwar ein Anfang, wir<br />
finden aber, dass zu unternehmerischer<br />
Verantwortung weitaus mehr gehört.<br />
Von Anna Muntzos, redaktionelle Assistentin, <strong>und</strong> Stephan Multhaupt, Geschäftsführer, gmc²<br />
Deshalb setzen wir uns u. a. für faire<br />
Arbeitsbedingungen ein, die deutlich<br />
über gesetzliche Mindestanforderungen<br />
hinausgehen. So möchten wir eine<br />
Unternehmenskultur schaffen, die den<br />
Einzelnen in den Mittelpunkt stellt <strong>und</strong><br />
in der sich unsere Mitarbeitenden ausleben,<br />
einbringen <strong>und</strong> weiterentwickeln<br />
können. Wir vertrauen darauf, dass dies<br />
der richtige Weg zu max<strong>im</strong>alem Unternehmenserfolg<br />
ist − für alle Beteiligten.<br />
Unsere Mitgliedschaft be<strong>im</strong> UN <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> verstehen wir deshalb als ausdrückliches<br />
Bekenntnis zu unseren gelebten<br />
CSR-Leitlinien.<br />
Soziale Verantwortung:<br />
Gerade die Wirtschaft ist gefragt<br />
Gegenwart verändern – Zukunft gestalten /<br />
Mit innovativen Lösungen <strong>und</strong> starken Netzen nachhaltig Werte <strong>und</strong> Bewusstsein schaffen<br />
Be<strong>im</strong> aktuellen Thema „Verantwortung“<br />
bildet die Integration der vielen Zufluchtsuchenden<br />
eine wichtige Aufgabe. Wir<br />
sind der Überzeugung, dass es an dieser<br />
Stelle ohne die Unterstützung der Wirtschaft<br />
nicht geht. Arbeit ist ein wichtiger<br />
Motor für eine gelungene Integration.<br />
Arbeit ermöglicht Ankommen <strong>und</strong> einen<br />
Neustart, nirgends kann eine Gesell-<br />
92 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
schaft mit all ihren Eigenschaften besser<br />
kennengelernt werden. Um aber in der<br />
deutschen Arbeitswelt überhaupt Fuß<br />
fassen zu können, ist es wichtig, die<br />
„Spielregeln“ des hiesigen Bewerbungs<strong>und</strong><br />
Arbeitsmarktes zu kennen <strong>und</strong> zu<br />
verstehen. Und das ist der Punkt, an dem<br />
wir ansetzten konnten.<br />
Im Juni <strong>2016</strong> startete auf Initiative von<br />
drei Mitarbeiterinnen unser Integrationsprojekt<br />
„Hand in Hand − Brücken bauen“.<br />
Ziel dieses Pilotprojektes war es, jungen<br />
Geflüchteten einen Weg durch den Deutschen<br />
Bewerbungs-Dschungel zu zeigen<br />
<strong>und</strong> ihnen somit einen erfolgreichen Start<br />
in ein neues Leben zu ermöglichen. Ganz<br />
<strong>im</strong> Sinne des Mottos „Hilfe zur Selbsthilfe“<br />
gingen unsere Mitarbeitenden gemeinsam<br />
mit den Teilnehmenden allen wichtigen<br />
Fragen r<strong>und</strong> um das Thema „Bewerbung“<br />
nach: Wo finde ich eine Stellenanzeige?<br />
Wie sieht eine gute Bewerbung aus? Was<br />
passiert in einem Vorstellungsgespräch?<br />
Und wer ist eigentlich Max Mustermann?<br />
Da ein solches Coaching auch für uns<br />
Neuland darstellte, bekamen wir wertvolle<br />
Hilfe vom Forum Ehrenamt in<br />
Königswinter. Eine Partnerschaft, die sich<br />
ausgezahlt hat: Mit großem Elan, Zuversicht<br />
<strong>und</strong> vor allem sehr viel Spaß konnte<br />
bereits ein Teil der Teilnehmenden in ihr<br />
erstes Praktikum in <strong>Deutschland</strong> starten.<br />
Der Erfolg unseres Coachings hat uns<br />
regelrecht beflügelt − ein Erlebnis, mit<br />
dem wir noch eine Vielzahl an Unternehmen<br />
inspirieren möchten. Wir hoffen,<br />
diese Erfahrung mit anderen teilen zu<br />
können, um miteinander <strong>und</strong> voneinander<br />
zu lernen <strong>und</strong> um diese Werte<br />
gemeinsam weiterzutragen.<br />
Zukunftsfähige Geschäftsmodelle<br />
dank CSR<br />
Leider lassen die Worte „soziale <strong>und</strong><br />
ökologische Verantwortung“ insbesondere<br />
kleine Unternehmen aus Angst vor<br />
zeitlichem Mehraufwand <strong>und</strong> hohen<br />
Kosten schnell zurückschrecken. Dabei<br />
profitieren gerade auch diese Unternehmen<br />
von der unternehmerischen Verantwortungsübernahme.<br />
Denn <strong>im</strong>mer<br />
häufiger werden Kaufentscheidungen<br />
aufgr<strong>und</strong> nachhaltigkeitsbezogener Kriterien<br />
getroffen. CSR bildet also gewissermaßen<br />
den Königsweg zum Erfolg.<br />
Unternehmen erzielen so mittel- <strong>und</strong><br />
langfristig wichtigen Mehrwert: von<br />
stabilen Lieferantenbeziehungen <strong>und</strong><br />
einer opt<strong>im</strong>alen Qualität von Produkten,<br />
über eine gesteigerte Attraktivität des<br />
Unternehmens bis hin zu motivierten,<br />
zufriedenen Arbeitnehmern, um nur<br />
einige zu nennen.<br />
„Mit unserer Erfahrung <strong>und</strong><br />
unserer Expertise möchten wir<br />
alle Interessierten auf ihrem<br />
CSR-Weg begleiten <strong>und</strong> unterstützen.<br />
Hand in Hand auf<br />
Augenhöhe, damit wir gemeinsam<br />
die Gegenwart verändern <strong>und</strong><br />
die Zukunft gestalten. “<br />
Damit diese Vorteile überhaupt erreicht<br />
werden können, muss CSR erst einmal<br />
systematisch in den Unternehmensalltag<br />
Einzug finden. Mögliche Handlungsfelder<br />
müssen identifiziert <strong>und</strong> zielführende<br />
Maßnahmen abgeleitet werden. Solche<br />
Maßnahmen können beispielsweise aus<br />
Mitarbeiterfortbildungen <strong>und</strong> der Min<strong>im</strong>ierung<br />
von Emissionen bestehen, oder<br />
aber aus der Einführung innovativer<br />
BI-Lösungen für transparente Businessmodelle<br />
von morgen. Eine der größten<br />
Herausforderungen in diesem Zusammenhang<br />
ist nicht nur die Identifikation<br />
der Handlungsfelder, sondern auch die<br />
Steuerung <strong>und</strong> damit die Messbarkeit des<br />
Erfolges. Während sich der Verbrauch von<br />
Ökostrom etwa sehr leicht feststellen lässt,<br />
bildet das Monitoring der Mitarbeiterzufriedenheit<br />
einen deutlich abstrakteren<br />
Gegenstand. Doch wie lassen sich Konzepte<br />
zur Steuerung solch abstrakter Werte<br />
praktikabel in der Realität anwenden?<br />
Die Antworten können nur gef<strong>und</strong>en<br />
werden, wenn Forschung <strong>und</strong> Wirtschaft<br />
Hand in Hand gehen <strong>und</strong> die Bedeutung<br />
der Thematik von jedem Einzelnen verstanden<br />
<strong>und</strong> aufgenommen wird.<br />
Darauf möchten wir zusammen mit<br />
unseren Partnern <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en Einfluss<br />
nehmen. Wir wollen das Bewusstsein<br />
für die Relevanz sozialer, ökologischer<br />
<strong>und</strong> ökonomischer Aspekte schaffen. Für<br />
uns, unsere Umwelt <strong>und</strong> für ein faires<br />
Miteinander. Denn eines ist sicher: Hier<br />
liegt die Chance, die Wertschöpfungspotenziale<br />
von morgen zu entdecken. Wir<br />
hoffen, dass unsere Begeisterung für das<br />
Thema ansteckend ist.<br />
CSR für gmc²<br />
Corporate Social Responsibility (CSR)<br />
beschreibt die unternehmerische<br />
Übernahme gesellschaftlicher, ökologischer<br />
<strong>und</strong> sozialer Verantwortung.<br />
Für uns bedeutet das: faire Arbeitsbedingungen<br />
über gesetzliche Mindestanforderungen<br />
hinaus <strong>und</strong> ein<br />
Geschäftsmodell, das unsere Wertvorstellungen<br />
mit unserer Kernkompetenz,<br />
den innovativen BI-Lösungen,<br />
verbindet. So schaffen wir das Bewusstsein<br />
für den Gleichklang von<br />
Ökonomie, Ökologie <strong>und</strong> Sozialem.<br />
So verändern wir die Gegenwart,<br />
so gestalten wir die Zukunft.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
93
Good Practice<br />
Baustellen zum Anfassen<br />
Die Wörter „Autobahn“ <strong>und</strong> „Baustelle“ in einem Satz werden oft mit „Stau“ <strong>und</strong> „Stillstand“<br />
assoziiert. Das macht es für das Bauunternehmen, das die Straße ausbaut oder auch ein Gebäude<br />
errichtet, eine Brücke saniert oder einen Tunnel bohrt, nicht leicht. Es berührt das Leben vieler<br />
Menschen. Deshalb gehört es zu den Aufgaben der Verantwortlichen, die Bedürfnisse aller zu<br />
berücksichtigen <strong>und</strong> früh zu informieren: Verkehrsplaner müssen genauso mit ins Boot geholt<br />
werden wie Umweltschutzorganisationen, Pendler oder Anwohner. Sie alle haben ein Recht<br />
darauf zu erfahren, wann Sperrungen entstehen, wie tief der Eingriff in die natürlichen Begebenheiten<br />
ist oder ob sie mit größeren Beeinträchtigungen rechnen müssen.<br />
Wenn Verkehrsteilnehmer <strong>und</strong> Anwohner<br />
verstehen, welche Verbesserungen<br />
nach der Fertigstellung auf sie zukommen,<br />
wächst folglich die Akzeptanz der<br />
Baumaßnahme. Dabei ist es wichtig,<br />
dass Bauherren, Planer, Projektsteuerer<br />
<strong>und</strong> Ingenieure an einem Strang ziehen.<br />
Bei HOCHTIEF, dem internationalen<br />
Baukonzern mit Sitz in Essen, gewinnt<br />
die Abst<strong>im</strong>mung unter allen Beteiligten<br />
<strong>im</strong>mer mehr an Bedeutung. Denn das<br />
gemeinsame Ziel ist es, dass Anwohner<br />
<strong>und</strong> Pendler, K<strong>und</strong>en, Politiker, Nachunternehmer,<br />
spätere Nutzer <strong>und</strong> weitere<br />
Interessierte stets frühzeitig informiert<br />
werden. Nur so kann ein Projekt erfolgreich<br />
realisiert werden. Folglich beschäftigen<br />
sich <strong>im</strong>mer mehr Ingenieure <strong>und</strong><br />
Projektleiter mit Kommunikationsfragen.<br />
Dies geschieht in enger Abst<strong>im</strong>mung<br />
mit der HOCHTIEF-Konzernkommunikation.<br />
Schließlich hat der Auftritt nach<br />
außen Auswirkung auf die Reputation<br />
des Unternehmens.<br />
Gerade bei großen Infrastrukturprojekten<br />
ist das öffentliche Interesse stark<br />
− wie be<strong>im</strong> Ausbau der Autobahn 7<br />
nördlich von Hamburg. Auf 65 Kilometern<br />
Strecke wird die A7 bis Ende 2018<br />
verbreitert. Ein Projekt, das die Gemüter<br />
bewegt: Etwa 155.000 Fahrzeuge pro<br />
Tag − besetzt mit Anwohnern, Urlaubern,<br />
Berufspendlern oder Lieferanten<br />
Auch bei widrigen Wetterbedingungen<br />
auf Sendung: Der Austausch mit Medien,<br />
Anwohnern <strong>und</strong> Pendlern ist Alltag für die<br />
Kommunikationsverantwortlichen be<strong>im</strong><br />
Ausbau der A7.<br />
94 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
− nutzen den Abschnitt zwischen den<br />
Autobahndreiecken Hamburg-Nordwest<br />
<strong>und</strong> Bordesholm. Für die Nutzer <strong>und</strong><br />
Anwohner sind zeitnahe <strong>und</strong> umfassende<br />
Informationen notwendig: Wann<br />
ist welche Ausfahrt gesperrt? Müssen<br />
Brücken abgerissen werden? Kommt<br />
es zur Vollsperrung? Die Anforderungen<br />
sind durch die Möglichkeiten, die<br />
das Internet mit sozialen Netzwerken<br />
bietet, höher als noch vor einigen Jahren.<br />
Dadurch steigen auch die Chancen,<br />
möglichst viele Menschen zu erreichen.<br />
Eine stets aktuelle Website trägt zum<br />
lückenlosen Informationsfluss wesentlich<br />
bei.<br />
Die A7 führt durch zwei B<strong>und</strong>esländer.<br />
Christian Merl, der Kommunikationsverantwortliche<br />
der Konzessionsgesellschaft<br />
Stakeholder-Einbindung<br />
bei HOCHTIEF<br />
Ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie<br />
ist der kontinuierliche<br />
Austausch mit den verschiedenen Interessengruppen,<br />
auch Stakeholder<br />
genannt. Neben der Kommunikation<br />
<strong>im</strong> Alltag mit K<strong>und</strong>en, Nachunternehmen,<br />
Journalisten oder Analysten gibt es deshalb einen Termin <strong>im</strong> Jahr, an<br />
dem Vertreter aller Gruppen zu einem konzentrierten CR-Stakeholder-Dialog<br />
zusammenkommen. Ziel ist es dann, die Themenfelder der Nachhaltigkeit<br />
bei HOCHTIEF zu diskutieren <strong>und</strong> zu bewerten: Stellt HOCHTIEF sicher, dass<br />
Themen wie faire Arbeitsbedingungen, Korruption oder Umweltschutz zufriedenstellend<br />
behandelt werden? Wie kann Arbeitssicherheit weiter verbessert<br />
werden? Tut der Konzern genug, um nachhaltige Produkte zu realisieren?<br />
Vorstandsmitglied Nikolaus Graf von Matuschka diskutiert mit <strong>und</strong> lobt die<br />
stets vertrauensvolle, persönliche <strong>und</strong> offene Diskussion: „Die Ideen <strong>und</strong> Einschätzungen<br />
der Stakeholder sind für die Weiterentwicklung von HOCHTIEF<br />
von großer Bedeutung.“<br />
„Via Solutions Nord“ mit HOCHTIEF als<br />
Federführer, st<strong>im</strong>mt sich eng mit den<br />
Verkehrsministerien ab. Wöchentliche<br />
Berichte an die Zuständigen von<br />
HOCHTIEF, an die Vertreter der Konzessionsgesellschaft<br />
<strong>und</strong> die Bauherren<br />
sind daher Pflicht. Der regelmäßige<br />
Austausch trägt viel zum konstruktiven<br />
<strong>und</strong> reibungslosen Projektverlauf<br />
bei. Christian Merl steht in direktem<br />
Kontakt zu Journalisten, Anwohnern<br />
<strong>und</strong> Pendlern <strong>und</strong> findet auf jede Frage<br />
eine Antwort: „Bei berechtigten Einwänden<br />
kläre ich mit allen Beteiligten<br />
ab, ob wir ohne großen Aufwand eine<br />
Lösung finden können.“ Eine positive<br />
Rückmeldung sei in jedem Fall gut für<br />
das Projekt, das dann auch in der Öffentlichkeit<br />
mit einem guten St<strong>im</strong>mungsbild<br />
wahrgenommen werde.<br />
Bei einem anderen wichtigen Verkehrsprojekt,<br />
an dem HOCHTIEF wesentlich<br />
beteiligt ist, sind die Kommunikationsverantwortlichen<br />
ebenfalls gefordert.<br />
Be<strong>im</strong> Brückenprojekt „Queensferry<br />
Crossing“ nördlich von Edinburgh in<br />
Schottland wurde schon in der Startphase<br />
ein „Contact & Education Center“<br />
eingerichtet. Dort gibt es eine Brücke<br />
„zum Anfassen“, Modelle, Broschüren<br />
<strong>und</strong> Filme. Zehntausende Besucher<br />
haben sich bereits über das populäre<br />
Projekt informiert: Denn das Bauwerk<br />
über den Firth of Forth, das 2017 eröffnet<br />
werden soll, wird die längste dreitürmige<br />
Schrägseilbrücke Europas sein. Schulklassen<br />
aus der Umgebung besuchen<br />
die Baustelle, <strong>und</strong> es gibt „Tage der offenen<br />
Baustelle“. Organisatorisch sind<br />
diese aufwendig: Die Sicherheit muss<br />
gewahrt, der Baufortschritt darf nicht<br />
beeinträchtigt werden.<br />
Nicht zuletzt ist interne Kommunikation<br />
essenziell, vor allem, wenn bei Großprojekten<br />
wie hier zu Spitzenzeiten zirka<br />
1200 Menschen auf der Baustelle arbeiten.<br />
Ein interner Newsletter informiert<br />
dann die Baubeteiligten über den allgemeinen<br />
Baufortschritt, Sicherheitsfragen<br />
<strong>und</strong> wichtige Details. „Dies ist auch für<br />
die Motivation der Kollegen wesentlich“,<br />
sagt David Watt, Kommunikationsverantwortlicher<br />
für das Konsortium Forth<br />
Crossing Bridge Constructors.<br />
Baustellenbesichtigungen bieten einen<br />
Blick hinter die Kulissen <strong>und</strong> sorgen<br />
dafür, Interesse zu wecken <strong>und</strong> Achtung<br />
vor der Meisterschaft der Ingenieure<br />
zu schaffen; gegenseitiges Vertrauen<br />
entsteht. Auch auf vielen Hochbau-<br />
Baustellen gehören solche Informationskampagnen<br />
dazu, Beispiele sind die<br />
Elbphilharmonie in Hamburg <strong>und</strong> das<br />
Berliner Schloss / Humboldtforum.<br />
Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die<br />
Kommunikation sein kann <strong>und</strong> sein<br />
muss. HOCHTIEF legt viel Wert darauf,<br />
dass der Austausch zwischen allen relevanten<br />
Interessengruppen dynamisch<br />
<strong>und</strong> wechselseitig ist. So wird der Blick<br />
auf den Markt <strong>und</strong> relevante Einflussfaktoren<br />
deutlich geschärft. Denn für<br />
die Reputation, die Zukunftsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> den Erfolg eines Unternehmens<br />
wie auch eines Projekts ist es wichtig,<br />
die Wünsche <strong>und</strong> Anforderungen aller<br />
Interessengruppen zu berücksichtigen.<br />
Damit beeinflussen sie die Entscheidungsprozesse<br />
<strong>und</strong> die Strategie des<br />
Konzerns.<br />
Es ist ein gegenseitiges Geben <strong>und</strong> Nehmen,<br />
sich ernst nehmen <strong>und</strong> achten.<br />
Schließlich freuen sich alle über ein<br />
erfolgreich abgeschlossenes Projekt.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
95
Good Practice<br />
Sprache ist der<br />
Schlüssel<br />
HVB-Mitarbeiterin Monika Blaes<br />
hilft Ahmed als Mentorin, Deutsch<br />
zu lernen. Sein Ziel ist es, die Sprache<br />
bald so gut zu beherrschen, dass er<br />
eine Ausbildung beginnen kann.<br />
Jeder braucht eine Aufgabe <strong>und</strong> ein soziales Netz zur persönlichen Entfaltung. Eine Ausbildung<br />
bietet beides. Doch für viele Jugendliche – <strong>und</strong> besonders auch für junge Flüchtlinge – ist es oft<br />
nicht einfach, den Weg in die Arbeitswelt zu finden. In Kooperation mit der gemeinnützigen Initiative<br />
JOBLINGE begleiten HVB-Mitarbeiter deshalb Jugendliche ohne Ausbildung <strong>und</strong> Flüchtlinge<br />
auf dem Weg ins Berufsleben. Ein Engagement, von dem beide Seiten profitieren.<br />
Von Irina Detlefsen, Corporate Sustainability, HypoVereinsbank<br />
Jeden Dienstag treffen sich Monika Blaes<br />
<strong>und</strong> der 21-jährige Ahmed <strong>im</strong> Münchner<br />
Westend. Ein schlichtes Büro wird<br />
dann zum Mini-Klassenz<strong>im</strong>mer. Denn<br />
jede Woche hilft die HVB-Mitarbeiterin<br />
ihrem Schützling u. a. dabei, die deutsche<br />
Sprache zu lernen. Ahmed kam<br />
vor sieben Monaten aus Eritrea <strong>und</strong> hat<br />
inzwischen ein Bleiberecht. Seit April<br />
<strong>2016</strong> n<strong>im</strong>mt er am neu geschaffenen<br />
Flüchtlingsprogramm von JOBLINGE teil.<br />
Bewährte Partnerschaft<br />
Mit über 100 Mentoren ist die Hypo-<br />
Vereinsbank der größte Kooperationspartner<br />
der gemeinnützigen Initiative<br />
JOBLINGE, die Jugendliche mit Startschwierigkeiten<br />
auf dem Weg in die<br />
Arbeitswelt begleitet. Seit vielen Jahren<br />
arbeitet die HypoVereinsbank <strong>im</strong> Rahmen<br />
ihres gesellschaftlichen Engagements<br />
mit JOBLINGE zusammen. R<strong>und</strong><br />
160 Jugendliche ohne Ausbildung haben<br />
die HVB-Mentoren seither bei ihrem Start<br />
in die Berufswelt unterstützt. Im Zuge<br />
der HVB-Flüchtlingsinitiative weitete die<br />
Bank die Zusammenarbeit nun aus. Denn<br />
auch JOBLINGE entwickelte sich weiter<br />
<strong>und</strong> schuf ein Programm, das speziell<br />
auf Flüchtlinge zugeschnitten ist. Seit<br />
Anfang <strong>2016</strong> haben HVB-Mitarbeiter<br />
nun die Möglichkeit, hier auch für junge<br />
Flüchtlinge aktiv zu werden.<br />
Die Kooperation mit JOBLINGE ist eine<br />
von vielen Maßnahmen <strong>im</strong> Rahmen<br />
der HVB-Flüchtlingsinitiative, die die<br />
HypoVereinsbank mit Spenden <strong>und</strong><br />
gemeinsam mit ihren Mitarbeitern, die<br />
sich ehrenamtlich engagieren, unterstützt<br />
(siehe Kasten). Für Stefan Löbbert,<br />
Leiter Corporate Sustainability,<br />
entspringt die Hilfe für Flüchtlinge aus<br />
dem Selbstverständnis der Bank: „Als<br />
Teil der Gesellschaft helfen wir, wo<br />
wir können. Mit gezielten Maßnahmen<br />
wollen wir zur nachhaltigen Integration<br />
96 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
der Flüchtlinge beitragen. Sprache <strong>und</strong><br />
Ausbildung sind dabei zwei sehr bedeutsame<br />
Säulen.“<br />
Sprache als Schlüssel<br />
Da Sprache <strong>und</strong> Ausbildung auch die<br />
Kernthemen <strong>im</strong> JOBLINGE-Flüchtlingsprogramm<br />
sind, ergänzt es das Engagement<br />
der HypoVereinsbank für Flüchtlinge<br />
in besonderem Maße. Das Flüchtlingsprogramm<br />
von JOBLINGE baut auf den<br />
Erfolgsfaktoren des erprobten Mentoringprogramms<br />
auf: individuelle Betreuung,<br />
Praxisnähe <strong>und</strong> Bezug zum Alltag der Jugendlichen.<br />
Mangelnde Sprachkenntnisse<br />
sind die größte Hürde für den Einstieg in<br />
bringt sich die HypoVereinsbank mit<br />
ihren Mitarbeitern ein: Seit Mitte August<br />
<strong>2016</strong> bieten 15 HVB-Mitarbeiter gemeinsam<br />
neben der Arbeit einen zehnwöchigen<br />
Intensivsprachkurs an. Das Ziel: Die<br />
Chancen der Teilnehmer − zehn junge<br />
Männer aus Syrien, Eritrea <strong>und</strong> dem Iran<br />
− auf dem Arbeitsmarkt weiter erhöhen.<br />
Neben einfachen Sätzen <strong>und</strong> Grammatik<br />
üben sie mit den Flüchtlingen gezielt<br />
Fachvokabeln aus der Verwaltungs- <strong>und</strong><br />
Bankenbranche <strong>und</strong> informieren sie über<br />
das deutsche Bildungssystem <strong>und</strong> den<br />
Arbeitsmarkt. Um die Mitarbeiter auf ihre<br />
Aufgabe als Sprachlehrer vorzubereiten,<br />
arbeitet die Bank auch hier Hand in<br />
Hand mit JOBLINGE. Eine weitere Veranstaltung<br />
ist derzeit in Vorbereitung: In<br />
einem Workshop sollen Auszubildende<br />
der Bank jungen Flüchtlingen vorstellen,<br />
worauf es bei Bewerbungen ankommt.<br />
der Gesellschaft Fuß fasst, ist eine große<br />
Aufgabe. Doch wenn das geschafft ist,<br />
profitieren beide Seiten. „Man lernt viel<br />
über andere Menschen <strong>und</strong> Kulturen,<br />
aber auch über sich selbst <strong>und</strong> die eigene<br />
Welt“, sagt Blaes.<br />
Mut wird belohnt<br />
den Arbeitsmarkt, deshalb liegt gerade<br />
am Anfang der <strong>Fokus</strong> auf der Sprachausbildung<br />
der jungen Flüchtlinge.<br />
Nach einem anfänglichen Basissprachkurs<br />
nehmen die wöchentlichen Treffen<br />
mit den Mentoren wie Monika Blaes<br />
<strong>und</strong> vielen anderen HVB-Mitarbeitern<br />
einen besonderen Stellenwert ein. Hier<br />
können die Jugendlichen Fragen stellen,<br />
die sich aus ihrem Leben in <strong>Deutschland</strong><br />
ergeben, <strong>und</strong> Verständnisschwierigkeiten<br />
besprechen. Die Herausforderung: „Als<br />
Mentorin muss man fordern <strong>und</strong> zugleich<br />
Vertrauen auf bauen, man muss<br />
sich auf die Jugendlichen einstellen <strong>und</strong><br />
ihnen etwas He<strong>im</strong>at bieten“, so Monika<br />
Blaes. Schulungen bereiten die Freiwilligen<br />
auf diese Aufgabe vor.<br />
Breites Engagement<br />
Interkulturelle Trainings, Unterstützung<br />
bei Behördengängen <strong>und</strong> branchenspezifische<br />
Sprachkurse in verschiedenen<br />
Unternehmen ergänzen das JOBLINGE-<br />
Programm für die Flüchtlinge. Auch hier<br />
Bei all ihren Engagements legt die Hypo-<br />
Vereinsbank großen Wert darauf, ihren<br />
Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten,<br />
sich zu engagieren. Sie unterstützt sie<br />
mit Sonderurlaub, zusätzlichen Spenden<br />
<strong>und</strong> steht jederzeit mit Rat <strong>und</strong> Tat zur<br />
Seite. Denn als Mentor oder Sprachlehrer<br />
aktiv zu werden braucht oft auch<br />
etwas Mut. Die Verantwortung dafür<br />
zu tragen, dass ein junger Mensch in<br />
Verständigung für Integration –<br />
die HVB-Flüchtlingsinitiative<br />
Eine Aufgabe, ein Ziel <strong>und</strong> ein soziales Netz<br />
zu haben, ist für jeden Menschen wichtig.<br />
Eine Ausbildung oder ein Studium bieten<br />
den jungen Flüchtlingen dafür die beste<br />
Voraussetzung.<br />
Die HypoVereinsbank hilft Flüchtlingen, in <strong>Deutschland</strong> Fuß zu fassen: mit<br />
dem „Konto für jedermann“, indem sie K<strong>und</strong>en bei der Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften<br />
unterstützt <strong>und</strong> indem sie unter dem Motto „Verständigung<br />
für Integration“ Sprache, Ausbildung <strong>und</strong> persönliche Begleitung fördert. Die<br />
Bank ermöglicht Sprachkurse, unterstützt die Initiative JOBLINGE, bietet Freizeitprogramme<br />
<strong>und</strong> gibt ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich zu engagieren.<br />
Über 200 HVB-Mitarbeiter bringen sich inzwischen ehrenamtlich dafür ein <strong>und</strong><br />
erhalten für ihren Einsatz bis zu zwei Tage Sonderurlaub.<br />
Die HVB-Flüchtlingsinitiative ist Teil des gesellschaftlichen Engagements der<br />
HypoVereinsbank. Mit ihren langjährigen Aktivitäten in diesem Bereich verfolgt<br />
sie das Ziel, alle Menschen am wirtschaftlichen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Leben<br />
teilhaben zu lassen. Dafür sowie für ihre gesamten Leistungen <strong>im</strong> Bereich<br />
Nachhaltigkeit wurde die Bank bereits mehrfach ausgezeichnet.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
97
Good Practice<br />
K+S ist Teil der Lösung<br />
Eine ausgewogene Düngung ermöglicht erhebliche Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft.<br />
Im Zusammenspiel mit der Reduzierung von Nach-Ernte-Verlusten <strong>und</strong> einer verbesserten Infrastruktur<br />
bietet dies die Chance auf ausreichende Nahrung für die wachsende Weltbevölkerung.<br />
Die K+S Gruppe ist mit ihren Produkten zur Pflanzenernährung auf Basis von Kali <strong>und</strong> Magnesium<br />
Teil der Lösung.<br />
Von Britta Sadoun,<br />
Sustainability Management, K+S<br />
Die Ernährungs- <strong>und</strong> Landwirtschaftsorganisation<br />
der Vereinten Nationen<br />
(FAO) sagt einen Verlust der pro Kopf<br />
zur Verfügung stehenden Ackerfläche<br />
bis 2050 um fast ein Drittel voraus. Das<br />
Problem knapper Ressourcen wird unter<br />
anderem durch den Kl<strong>im</strong>awandel<br />
<strong>und</strong> die zunehmende Konkurrenz um<br />
landwirtschaftlich nutzbare Flächen verschärft.<br />
Weltweit sind Landwirte daher<br />
gefordert, den zur Verfügung stehenden<br />
Boden opt<strong>im</strong>al zu nutzen, um genügend<br />
Lebensmittel für eine stetig wachsende<br />
Weltbevölkerung produzieren zu<br />
können.<br />
K+S respektiert die international anerkannten<br />
Menschenrechte <strong>und</strong> unterstützt<br />
deren Einhaltung. Dazu gehört das Recht<br />
auf ausreichende Ernährung, welches<br />
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte<br />
verankert <strong>und</strong> in Artikel 11<br />
des Sozialpakts festgeschrieben ist. Noch<br />
<strong>im</strong>mer hungern fast 800 Millionen Menschen.<br />
Zwar ist die Zahl der Hungernden<br />
weltweit zurückgegangen, doch das Recht<br />
auf angemessene Nahrung ist erst dann<br />
verwirklicht, wenn jedem Menschen zu<br />
jeder Zeit Zugang zu Ressourcen gewährt<br />
wird, um Nahrung zu produzieren, zu<br />
verdienen oder zu erwerben.<br />
Neue Chancen für Kooperationen<br />
<strong>und</strong> Austausch<br />
Wie bei allen großen komplexen Fragen<br />
− viele davon zusammengefasst in den 17<br />
Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)<br />
− kann nur eine gemeinsame Bearbeitung<br />
der Themen zu Erfolgen führen.<br />
Die handelnden Akteure <strong>im</strong> Bereich<br />
Ernährung müssen <strong>und</strong> werden viele<br />
sein: Regierungen <strong>und</strong> Nichtregierungsorganisationen,<br />
Wissenschaftler <strong>und</strong><br />
Unternehmen <strong>und</strong> natürlich Landwirte.<br />
Denn ob die Welt <strong>im</strong> Kampf gegen den<br />
Hunger erfolgreich sein wird, hängt <strong>im</strong><br />
Wesentlichen davon ab, wie auf dem<br />
Land gewirtschaftet wird. K+S fördert<br />
den Austausch von Ideen <strong>und</strong> Strategien<br />
zur Bekämpfung des Hungers <strong>und</strong> zur<br />
langfristigen Sicherung der Welternährung<br />
<strong>und</strong> lud deshalb <strong>im</strong> Oktober <strong>2016</strong><br />
zum zweiten Future Food Forum nach<br />
98 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Berlin ein. Dieses Zukunftsforum zur<br />
Welternährung bietet eine Plattform für<br />
einen aktiven Dialog zentraler nationaler<br />
wie internationaler Stakeholder aus<br />
Politik, Wissenschaft <strong>und</strong> NGOs (siehe<br />
Textbox rechts).<br />
Projekt „Growth for Uganda“<br />
Zugleich geht K+S neue Wege vor Ort.<br />
Das 2013 ins Leben gerufene Projekt<br />
„Growth for Uganda“ der K+S KALI GmbH<br />
in Kooperation mit der Sasakawa Africa<br />
Association hat bisher mehr als 92.500<br />
Bauern geschult, um bessere Techniken in<br />
der Landwirtschaft anwenden zu können<br />
sowie Nachernteverluste zu reduzieren.<br />
So konnte das Leben von fast 650.000<br />
Familienmitgliedern verbessert werden.<br />
Die Versorgung mit selbst angebauter<br />
Nahrung wurde zuverlässiger, die Erträge<br />
sind erheblich gestiegen <strong>und</strong> durch<br />
deren Vermarktung andere Leistungen<br />
erschwinglich geworden.<br />
Rohstoffe schaffen Werte<br />
In der zweiten Projektphase geht es −<br />
neben der Basisarbeit − nun stärker um<br />
den geschäftlichen Aspekt „Farming as<br />
a Business“. In einem Umfeld, in dem<br />
kleinbäuerliche Strukturen dominieren,<br />
soll eine Infrastruktur für den Düngemittelabsatz<br />
ausgebaut werden. Dazu zählt<br />
das Angebot von Düngemitteln in Kleingrößen,<br />
wie sie vor Ort besonders gefragt<br />
sind, sowie die Schulung von Händlern.<br />
Das Projekt leistet zudem Hilfestellung<br />
für die fachgerechte <strong>und</strong> damit weniger<br />
verlustreiche Lagerung der Ernte sowie<br />
die Verarbeitung der Rohstoffe zu hochwertigeren<br />
Produkten mit höheren Margen.<br />
K+S leistet damit einen Beitrag zur<br />
Erreichung des SDG 2, macht gleichzeitig<br />
Erfahrungen in einem sich entwickelnden<br />
Markt <strong>und</strong> gewinnt somit Erkenntnisse<br />
über neue Vertriebs- <strong>und</strong> Beratungswege.<br />
Das Engagement verbessert also vor Ort<br />
die Lebenssituation vieler Menschen <strong>und</strong><br />
eröffnet dem Unternehmen gleichzeitig<br />
neue Möglichkeiten.<br />
Future Food Forum<br />
Alle zwei Jahre veranstaltet K+S <strong>im</strong><br />
Vorfeld des Welternährungstages <strong>im</strong><br />
Oktober das Future Food Forum in<br />
Berlin. Es bietet eine internationale<br />
Plattform für den Austausch von Ideen<br />
zur Bekämpfung des Hungers <strong>und</strong><br />
bringt Akteure aus Politik, Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Wissenschaft zusammen. Dabei<br />
konzentriert sich die Aufmerksamkeit<br />
schwerpunktmäßig auf die Frage, wie<br />
die Land- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft<br />
vor Ort Produktionsmethoden <strong>und</strong><br />
Distributionskanäle verbessern kann.<br />
Auch die Rolle der internationalen<br />
Zusammenarbeit wird thematisiert.<br />
K+S fördert <strong>und</strong> veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die Wertschöpfungskette<br />
erstreckt sich über sechs Schritte: Exploration, Förderung, Produktion,<br />
Logistik, Vertrieb / Marketing <strong>und</strong> Anwendung. Ein Großteil der hergestellten<br />
Produkte kommt in der Agrarwirtschaft zum Einsatz. Im Kerngeschäft trägt K+S<br />
somit insbesondere zum Ziel 2 „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit <strong>und</strong><br />
eine bessere Ernährung erreichen <strong>und</strong> eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“<br />
bei. Berührungspunkte bestehen mit zahlreichen anderen Zielen. Deshalb gleicht<br />
K+S <strong>im</strong> Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements seine Unternehmensaktivitäten<br />
mit allen 17 SDGs, deren 169 Zielvorgaben <strong>und</strong> Indikatoren systematisch ab. So<br />
können auch weniger offensichtliche Bezüge zu den SDGs <strong>und</strong> deren Zielvorgaben<br />
herausgefiltert werden.<br />
Das K+S-Düngemittelportfolio<br />
Das universell einsetzbare mineralische Düngemittel Kaliumchlorid wird insbesondere<br />
bei wichtigen Anbaukulturen wie Getreide, Mais, Reis <strong>und</strong> Sojabohnen angewandt.<br />
Kaliumchlorid wird direkt auf den Äckern ausgebracht, mit anderen Einzeldüngern<br />
in Mischdüngeranlagen zu sogenannten „Bulk Blends“ gemischt oder mit anderen<br />
Nährstoffen weiterverarbeitet.<br />
Die Düngemittelspezialitäten der K+S KALI GmbH unterscheiden sich vom klassischen<br />
Kaliumchlorid entweder durch Chloridfreiheit oder unterschiedliche Nährstoffrezepturen<br />
mit Magnesium, Schwefel, Natrium <strong>und</strong> Spurenelementen. Diese Produkte werden<br />
für Kulturen eingesetzt, die einen erhöhten Magnesium- <strong>und</strong> Schwefelbedarf haben,<br />
wie z. B. Raps oder Sonnenblumen, sowie bei chloridempfindlichen Sonderkulturen<br />
wie Kartoffeln, Zitrusfrüchte, Wein oder Gemüse.<br />
Zu den prominenten Rednern des Future<br />
Food Forums am 13. Oktober <strong>2016</strong><br />
zählten Friedensnobelpreisträger Prof.<br />
Muhammad Yunus, Prof. Dr. Klaus<br />
Töpfer, langjähriger B<strong>und</strong>esminister<br />
<strong>und</strong> früherer Leiter des Umweltprogramms<br />
der Vereinten Nationen, sowie<br />
Charles Ogang von der World Farmers<br />
Organisation. Yunus, auch Gründer der<br />
Grameen Bank, die für die Erfindung<br />
sogenannter „Social-Business-“ <strong>und</strong><br />
Mikrokredite steht, plädierte auf dem<br />
Future Food Forum <strong>2016</strong> für mehr Unternehmertum<br />
zur Abwendung einer<br />
möglichen neuen Ernährungskrise. Am<br />
Beispiel der Geschichte seines Unternehmens<br />
berichtete er, wie es vor einigen<br />
Jahrzehnten nach einer Hungersnot<br />
in Bangladesch gelang, Millionen<br />
Menschen aus der Armut zu befreien.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
99
Good Practice<br />
MAN fährt be<strong>im</strong> Thema<br />
Digitalisierung vorweg<br />
Die Digitalisierung erfasst zunehmend unseren Alltag <strong>und</strong> die Arbeitswelt. Das betrifft auch die<br />
Transportbranche. Der Fahrzeug- <strong>und</strong> Maschinenbaukonzern MAN will den digitalen Wandel aktiv<br />
mitgestalten <strong>und</strong> setzt dabei auf neue Produkte <strong>und</strong> Geschäftsmodelle, die das Transportgeschäft<br />
effizienter <strong>und</strong> nachhaltiger gestalten sollen. Ein Beispiel ist das „Platooning“. Darunter versteht<br />
man das vernetzte Fahren <strong>im</strong> Konvoi, das sich bereits in der Praxis bewährt hat.<br />
Von Peter Attin,<br />
Head of Corporate Responsibility, MAN<br />
Ob Lebensmittel oder Baumaterialien:<br />
Der größte Teil des Güterverkehrs in<br />
<strong>Deutschland</strong> rollt noch <strong>im</strong>mer über<br />
Straßen − Tendenz steigend. So wird<br />
das Transportaufkommen innerhalb<br />
des deutschen Verkehrsnetzes laut einer<br />
aktuellen Prognose des B<strong>und</strong>esamtes für<br />
Güterverkehr insgesamt von 4.256,4 Millionen<br />
Tonnen <strong>im</strong> Jahr 2015 auf 4.308,6<br />
Millionen Tonnen <strong>im</strong> Jahr 2018 steigen.<br />
Das wäre eine Zunahme von etwa einem<br />
halben Prozent Jahr für Jahr. Für die<br />
Transportleistung wird für denselben<br />
Zeitraum sogar eine Steigerung von gut<br />
4,5 Prozent von 665,5 Milliarden Tonnenkilometer<br />
auf dann 696,6 Milliarden<br />
Tonnenkilometer erwartet.<br />
Wie kann man dieses Aufkommen effizienter<br />
<strong>und</strong> damit letztendlich auch<br />
nachhaltiger organisieren? Intelligentes<br />
Datenmanagement ist hierfür ein<br />
Schlüssel: Schon heute können viele Informationen<br />
über den Einsatz eines Lastkraftwagens<br />
digital erfasst werden. So<br />
können nicht nur die Lenk- <strong>und</strong> Ruhezeiten<br />
sowie die technischen Betriebsdaten<br />
des Fahrzeugs, sondern auch der Zustand<br />
der Ladung überwacht <strong>und</strong> Routendaten<br />
nachverfolgt werden. Werkstattaufenthalte<br />
können damit früher geplant,<br />
die Personaldisposition erleichtert <strong>und</strong><br />
die Kraftstoffverbrauchsdaten exakter kalkuliert<br />
werden. Dennoch ist das Potenzial,<br />
das die Digitalisierung der Transportbranche<br />
etwa unter Umweltschutzaspekten<br />
bietet, noch nicht voll ausgeschöpft.<br />
Um die Digitalisierung der Nutzfahrzeug-<br />
<strong>und</strong> Logistikwelt voranzutreiben,<br />
investierte MAN <strong>im</strong> Jahr 2015 insgesamt<br />
r<strong>und</strong> 43 Millionen Euro <strong>und</strong> gründete<br />
einen eigenen Geschäftsbereich hierfür.<br />
Die „Telematics and Digital Solutions“ in<br />
der Parkstadt in München-Schwabing<br />
bündelt die IT-Spezialisten von MAN, die<br />
hier an neuen smarten Produkten <strong>und</strong><br />
Services arbeiten. Zu ihren Aufgaben<br />
gehört auch, künftig stärker als bisher<br />
über den herkömmlichen Tellerrand der<br />
Nutzfahrzeugsparte hinauszuschauen.<br />
100 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Ein Beispiel dafür ist das offene, cloudbasierte<br />
Betriebssystem „Rio“, das auf<br />
der IAA <strong>2016</strong> seine Weltpremiere feierte<br />
<strong>und</strong> die gesamte Transportbranche − vom<br />
Versender über Speditionen bis hin zu<br />
Transportunternehmen <strong>und</strong> Fahrer −<br />
miteinander vernetzen soll. Als Datenlieferanten<br />
dienen unter anderem die<br />
in den LKW verbauten Telematiksysteme.<br />
Das System soll unabhängig von<br />
der Marke arbeiten <strong>und</strong> damit auch die<br />
Daten anderen LKW-Hersteller ohne Probleme<br />
einbeziehen. Der Austausch von<br />
Informationen über globale Lieferketten<br />
hinweg ist nämlich für alle Beteiligten<br />
von Vorteil <strong>und</strong> eröffnet jedem Chancen<br />
auf neue Geschäftsmodelle.<br />
diese dem anderen Verkehrsteilnehmer<br />
Platz <strong>und</strong> lösen den Verb<strong>und</strong> auf.<br />
Verlässt das Fahrzeug die Lücke wieder,<br />
fügt sich die Kolonne wieder zusammen.<br />
Der computergesteuerte LKW reagiert<br />
dabei schneller auf Hindernisse <strong>und</strong><br />
andere Verkehrsteilnehmer als jeder<br />
Mensch. Die Technik könnte also nicht<br />
nur dabei helfen, die Umwelt <strong>und</strong> den<br />
Kraftfahrer zu entlasten, sondern auch<br />
dazu beitragen, den Verkehr sicherer<br />
MAN-Entwickler arbeiten bereits seit Längerem<br />
an solchen Technologien zum automatisierten<br />
<strong>und</strong> vernetzten Fahren. Mit<br />
der Teilnahme an der „European Truck<br />
Platooning Challenge“ Anfang <strong>2016</strong> demonstrierte<br />
MAN, dass die entsprechenden<br />
Systeme jetzt einsatztauglich sind.<br />
Die technische Serienreife wird voraussichtlich<br />
2021 / 22 erreicht. Die Testfahrt<br />
nach Rotterdam war der Anfang. Die<br />
Kooperation mit den Logistikern von DB<br />
Schenker schlägt das nächste Kapitel in<br />
Sachen Mobilität der Zukunft auf: Ziel<br />
der Entwicklungspartnerschaft ist es,<br />
die Logistikabläufe noch transparenter,<br />
schneller <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>licher zu<br />
gestalten. Im Rahmen dessen werden<br />
erstmals ein Fahrzeughersteller <strong>und</strong><br />
ein Logistikkonzern gemeinsam an der<br />
Ein Beispiel ist das „Platooning“ − vor<br />
allem dann, wenn es flottenübergreifend<br />
stattfindet: Be<strong>im</strong> Platooning fahren<br />
mindestens zwei LKW in einem Abstand<br />
von etwa zehn bis fünfzehn Meter beziehungsweise<br />
einer halben Sek<strong>und</strong>e<br />
Fahrzeit <strong>im</strong> Konvoi hintereinander. Dadurch,<br />
dass die nachfolgenden LKW <strong>im</strong><br />
Windschatten fahren, verbrauchen sie<br />
bis zu zehn Prozent weniger Treibstoff.<br />
Die CO 2<br />
-Emissionen verringern sich <strong>im</strong><br />
gleichen Maße.<br />
Damit es be<strong>im</strong> dichten Auffahren nicht<br />
zu Unfällen kommt, sind die LKW über<br />
die sogenannte Car-to-Car-Kommunikation<br />
miteinander vernetzt <strong>und</strong> mit<br />
Fahrassistenz- <strong>und</strong> Steuerungssystemen<br />
ausgestattet. Diese wiederum werden von<br />
Radaren, Laserscannern <strong>und</strong> Kameras<br />
mit den notwendigen Umgebungsinformationen<br />
versorgt.<br />
Der erste Truck in der Kolonne gibt das<br />
Tempo <strong>und</strong> die Fahrtrichtung vor, alle<br />
anderen folgen. Schert ein anderes Fahrzeug<br />
zwischen den LKW ein, machen<br />
zu machen. Denn etwa 86 Prozent der<br />
Verkehrsunfälle in <strong>Deutschland</strong> sind<br />
heute auf menschliches Fehlverhalten<br />
zurückzuführen.<br />
„Platooning ist ein echter Gewinn für<br />
die Verkehrssicherheit. Menschliches<br />
Versagen gehört leider zu den häufigsten<br />
Ursachen für Auffahrunfälle. Die elektronische<br />
Kopplung von LKW gibt uns hier<br />
einen vielversprechenden Lösungsansatz.<br />
Windschattenfahren senkt maßgeblich<br />
den Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig<br />
können wir mit Platooning die Verkehrsinfrastruktur<br />
deutlich effizienter nutzen“,<br />
fasst Joach<strong>im</strong> Drees, Vorsitzender des<br />
Vorstands von MAN SE <strong>und</strong> MAN Truck<br />
& Bus, die Vorteile zusammen.<br />
B<strong>und</strong>esverkehrsminister Alexander Dobrindt<br />
schickte gemeinsam mit dem CEO von<br />
Volkswagen Truck & Bus, Andreas Renschler,<br />
<strong>und</strong> dem CEO von MAN Truck & Bus, Joach<strong>im</strong><br />
Drees, den MAN-Platoon auf die Reise nach<br />
Rotterdam zum European Truck Platooning<br />
Challenge <strong>2016</strong>.<br />
Entwicklung vernetzter LKW-Kolonnen<br />
arbeiten. Eine Erprobung <strong>im</strong> Echtbetrieb<br />
auf der A9 zwischen München<br />
<strong>und</strong> Nürnberg ist für 2018 vorgesehen.<br />
In einem zweiten Schritt plant man den<br />
Einsatz autonom fahrender LKW auf dem<br />
Nürnberger DB Schenker-Werksgelände.<br />
Noch fehlen allerdings auf öffentlichen<br />
Straßen die gesetzlichen Voraussetzungen<br />
für die Platooning-Technik. So ist in<br />
<strong>Deutschland</strong> derzeit etwa ein Mindestabstand<br />
von 50 Metern zwischen zwei LKW<br />
vorgeschrieben. Sobald die rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen geschaffen sind,<br />
wird MAN ein entsprechendes System<br />
am Markt anbieten.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
101
Good Practice<br />
Gl<strong>im</strong>mer-Lieferkette:<br />
Kein Platz für Kinderarbeit<br />
Ob Lippenstift, Lidschatten oder Autolack: Für den schönen Sch<strong>im</strong>mer sorgt oft das Mineral<br />
Gl<strong>im</strong>mer. Der begehrte Rohstoff wird unter anderem <strong>im</strong> Norden Indiens in den B<strong>und</strong>esstaaten<br />
Jharkhand <strong>und</strong> Bihar abgebaut. Die Region ist geprägt von politischer Instabilität <strong>und</strong> Armut.<br />
Kinderarbeit ist weit verbreitet. Auch Merck nutzt Gl<strong>im</strong>mer als Hauptrohstoff für seine Effektpigmente.<br />
Das Wissenschafts- <strong>und</strong> Technologieunternehmen lehnt Kinderarbeit strikt ab <strong>und</strong><br />
setzt sich für sichere Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter ein. Außerdem unterstützt Merck<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsprojekte, die das Leben der Familien in den Abbaugebieten verbessern.<br />
Von Gregor Hilkert, Head of Business Support,<br />
Pigments & Functional Materials, Merck<br />
Gl<strong>im</strong>mer ist nach seiner Fähigkeit benannt,<br />
Licht zu brechen <strong>und</strong> zu reflektieren.<br />
Der Rohstoff kommt an vielen Orten<br />
vor. Merck bezieht ihn vor allem aus<br />
Indien, aber auch aus den Vereinigten<br />
Staaten <strong>und</strong> Brasilien. Das Unternehmen<br />
benötigt den natürlichen Gl<strong>im</strong>mer − neben<br />
synthetischen Substraten − für die<br />
Herstellung seiner hochwertigen Effektpigmente.<br />
Sie kommen unter anderem in<br />
Automobil- <strong>und</strong> Industrielacken <strong>und</strong> in<br />
der Kosmetik- <strong>und</strong> Lebensmittelindustrie<br />
zum Einsatz.<br />
Null Toleranz gegenüber<br />
Kinderarbeit<br />
Merck bekämpft seit 2008 Kinderarbeit<br />
<strong>im</strong> indischen Gl<strong>im</strong>merabbau. Anlass war<br />
eine unternehmensinterne Untersuchung.<br />
Sie hatte ergeben, dass die Bewohner der<br />
Region Jharkhand Gl<strong>im</strong>mer in stillgelegten<br />
Minen oder vom Boden sammeln<br />
− vereinzelt auch gemeinsam mit ihren<br />
Kindern. Ein klarer Verstoß gegen die<br />
Unternehmenswerte <strong>und</strong> die Prinzipien<br />
der Menschenrechts-Charta von Merck:<br />
„Die Einhaltung gr<strong>und</strong>legender Arbeitsstandards<br />
bei unseren Lieferanten hat für<br />
uns höchste Priorität. Wir haben daher<br />
sofort, nachdem wir von den Vorfällen<br />
erfahren hatten, Maßnahmen ergriffen,<br />
um Kinderarbeit vollständig zu unterbinden“,<br />
erklärt Michael Heckmeier,<br />
Leiter der Geschäftseinheit Pigments<br />
& Functional Materials bei Merck. Das<br />
Unternehmen hat seine Lieferkette<br />
komplett umgestellt <strong>und</strong> setzt sich dafür<br />
ein, die Arbeitsbedingungen der<br />
Minenarbeiter in Indien zu verbessern.<br />
„Wir unterhalten inzwischen direkte<br />
Geschäftsbeziehungen mit Gl<strong>im</strong>mer-<br />
Minen <strong>und</strong> den Gl<strong>im</strong>mer-verarbeitenden<br />
Betrieben. In diesem, <strong>im</strong> Gegensatz zur<br />
Sammlung formalen Arbeitsumfeld haben<br />
wir deutlich mehr Einfluss“, sagt<br />
Heckmeier. Darüber hinaus hat Merck<br />
Kontrollmechanismen eingeführt <strong>und</strong><br />
so einen umfassenden Überblick über<br />
die gesamte Lieferkette.<br />
102 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Hohe Lieferketten-Standards<br />
Mit verschiedenen Maßnahmen sichert Merck die Umsetzung sozialer Standards:<br />
• Merck bezieht Gl<strong>im</strong>mer ausschließlich aus kontrollierten Minen: Nur die formelle<br />
Arbeitsumgebung gewährleistet die Einhaltung globaler Standards.<br />
Wird Gl<strong>im</strong>mer in öffentlich zugänglichen Bereichen gesammelt, kann Kinderarbeit<br />
nicht ausgeschlossen werden.<br />
• Mithilfe eines Nachverfolgungssystems stellt das Unternehmen sicher, dass<br />
der gelieferte Gl<strong>im</strong>mer ausschließlich aus Minen stammt <strong>und</strong> nicht aus unkontrollierten<br />
Quellen: Die Minenbesitzer halten die tägliche Fördermenge einer<br />
Mine in einem Logbuch fest. Diese dokumentierten Gl<strong>im</strong>mermengen sind die<br />
Basis für die Lizenzgebühren, die die Minenbesitzer an die Regierung zahlen<br />
müssen. Wenn Gl<strong>im</strong>mer aus unkontrollierten Quellen mit verwendet würde,<br />
müssten die Minenbesitzer auch für diese Gl<strong>im</strong>mermengen Lizenzgebühren<br />
zahlen. Dies ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, denn der Gl<strong>im</strong>mer wäre für den<br />
Minenbesitzer teurer als der in seiner Mine geförderte. Merck überprüft monatlich<br />
die <strong>im</strong> Logbuch gemeldeten <strong>und</strong> die an weiterverarbeitende Betriebe<br />
gelieferten Gl<strong>im</strong>mermengen.<br />
• Mit Audits kontrolliert das Unternehmen das regelkonforme Verhalten der<br />
Partner. Hierzu zählen beispielsweise das Alter der Arbeiter, die Arbeitszeiten<br />
<strong>und</strong> die gezahlten Löhne, aber auch die durchgeführten Ges<strong>und</strong>heitschecks<br />
<strong>und</strong> Sicherheitsübungen. Zusätzlich kontrollieren Merck-Mitarbeiter vor Ort<br />
die Zulieferer in regelmäßigen Abständen. Darüber hinaus führen das Environmental<br />
Resource Management (ERM) <strong>und</strong> IGEP als unabhängige Drittparteien<br />
eigene Audits durch. Während IGEP einmal <strong>im</strong> Monat die Einhaltung der Arbeitsstandards<br />
kontrolliert, überprüft ERM jährlich die Arbeitsbedingungen <strong>und</strong> die<br />
Einhaltung von Umwelt-, Sicherheits- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsstandards.<br />
Sozioökonomischer Hintergr<strong>und</strong><br />
Merck hat sich bewusst dazu entschieden,<br />
seine Geschäftsbeziehungen <strong>im</strong><br />
nördlichen Indien aufrechtzuerhalten.<br />
Das Unternehmen übern<strong>im</strong>mt Verantwortung<br />
für die Region: Arbeitsplätze<br />
sollen erhalten bleiben.<br />
Wie wichtig dieser Ansatz ist, zeigen die<br />
sozialen Umstände in Jharkhand <strong>und</strong> Bihar.<br />
Sie bilden einen idealen Nährboden<br />
für Kinderarbeit: Beide B<strong>und</strong>esstaaten<br />
zählen zu den ärmsten Regionen Indiens.<br />
Die Alphabetisierungsquote <strong>und</strong> die Anzahl<br />
der Kinder, die eine Schule besuchen,<br />
liegen laut einer Studie von Terre des<br />
Hommes <strong>und</strong> SOMO (Stichting Onderzoek<br />
Multinationale Ondernemingen /<br />
Centre for Research on Multinational<br />
Corporations) aus dem Jahr <strong>2016</strong> weit<br />
unter dem Landesdurchschnitt.<br />
Investitionen in Bildung <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Um die Lebenssituation der Familien zu<br />
verbessern, hat Merck nicht nur seine<br />
Gl<strong>im</strong>mer-Lieferkette umgestellt, sondern<br />
gemeinsam mit seinem lokalen<br />
Partner IGEP soziale Projekte für die<br />
Bevölkerung der Region initiiert. Das<br />
gemeinsame Ziel ist, den Zugang zur<br />
Ges<strong>und</strong>heitsversorgung zu verbessern<br />
<strong>und</strong> den Kindern eine schulische <strong>und</strong><br />
berufliche Perspekte zu bieten:<br />
• Merck betreibt in den Dörfern Tisri,<br />
Barkitand <strong>und</strong> Saphi Schulen mit angeschlossenen<br />
Kindergärten, die von<br />
über 500 Schülern besucht werden.<br />
Auf dem St<strong>und</strong>enplan stehen auch Aufklärung<br />
über Hygiene <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit.<br />
In Tisri können sich die Jugendlichen<br />
außerdem zu Tischlern oder Schneidern<br />
ausbilden lassen. Merck unterstützt<br />
darüber hinaus eine vierte Schule in<br />
Koderma mit Stipendien für 150 Schüler.<br />
• In Saphi hat Merck ein Ges<strong>und</strong>heitszentrum<br />
eingerichtet. Dort arbeiten zwei<br />
Ärzte <strong>und</strong> eine Krankenschwester, die<br />
auch die medizinische Versorgung der<br />
Schulen übernehmen. Sie besuchen<br />
außerdem die Schulen <strong>und</strong> Dörfer in<br />
der Umgebung.<br />
Für sein Engagement erhält Merck vonseiten<br />
der Zivilgesellschaft viel Anerkennung.<br />
Laut der SOMO-Studie führt das<br />
Unternehmen <strong>im</strong> Vergleich zu anderen<br />
Gl<strong>im</strong>mer-Importeuren bei Weitem die<br />
besten Maßnahmen durch, um Kinderarbeit<br />
in der Lieferkette auszuschließen <strong>und</strong><br />
die Lebensbedingungen der Menschen zu<br />
verbessern. Merck engagiert sich darüber<br />
hinaus an Multistakeholder-Dialogen<br />
<strong>und</strong> -Initiativen für eine Verbesserung<br />
der Lebens- <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen in<br />
der Gl<strong>im</strong>mer-Region.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
103
Good Practice<br />
Mit nachhaltigem Personalmanagement<br />
auf Erfolgskurs<br />
Nachwuchssicherung, die Förderung von Fach- <strong>und</strong> Führungskräften sowie Vielfalt <strong>und</strong> Chancengleichheit<br />
werden angesichts von demografischem Wandel, Fachkräftemangel <strong>und</strong> einer zunehmenden<br />
Internationalisierung <strong>im</strong>mer wichtiger. Das weiß man auch be<strong>im</strong> Hausgerätehersteller<br />
Miele. Der respektvolle Umgang mit Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern ist hier seit Generationen<br />
fester Bestandteil der Unternehmenskultur <strong>und</strong> auch der Nachhaltigkeitsstrategie. Folgerichtig<br />
ist Miele langjähriges Mitglied des UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> <strong>und</strong> seit 2004 nach dem international<br />
anerkannten Sozialstandard SA8000 zertifiziert.<br />
Mit der „Agenda 2030 für nachhaltige<br />
Entwicklung“ hat sich die Weltgemeinschaft<br />
viel vorgenommen − besonders<br />
mit Blick auf die Arbeitswelt. So lautet<br />
etwa Ziel 8 der Sustainable Development<br />
Goals, ein dauerhaftes <strong>und</strong> breitenwirksames<br />
Wirtschaftswachstum zu fördern<br />
<strong>und</strong> dabei zugleich produktive Vollbeschäftigung<br />
<strong>und</strong> menschenwürdige<br />
Arbeit für alle sicherzustellen.<br />
Wie das in der Praxis aussehen kann,<br />
zeigt das Beispiel Miele: Das Gütersloher<br />
Familienunternehmen legt traditionell<br />
großen Wert auf einen respektvollen Umgang<br />
mit seinen Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />
Mitarbeitern. Deshalb haben hohe soziale<br />
<strong>und</strong> ethische Standards wie die Einhaltung<br />
gr<strong>und</strong>legender Menschenrechte,<br />
eine faire Vergütung, Weiterbildungsangebote,<br />
betriebliche Mitbest<strong>im</strong>mung<br />
sowie Maßnahmen zu Sicherheit <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge höchste Priorität.<br />
Sie bilden die Gr<strong>und</strong>lage des strategischen<br />
Personalmanagements.<br />
Das gilt weltweit: Die freiwillige Zertifizierung<br />
nach dem „Social Accountability<br />
8000“-Standard (SA8000) bescheinigt,<br />
dass Miele diese hohen Ansprüche gegenüber<br />
seinen weltweit über 18.000<br />
Mitarbeitern einhält. Inzwischen erfüllen<br />
alle Werkstandorte die SA8000-Anforderungen<br />
oder bereiten die entsprechende<br />
Zertifizierung vor.<br />
Der SA8000-Standard<br />
Der SA8000-Standard wurde 1997 von<br />
der gemeinnützigen Organisation Social<br />
Accountability International (SAI)<br />
mit dem Ziel ins Leben gerufen, die<br />
Arbeiter von Firmen, NGOs oder staatlichen<br />
Einrichtungen zu stärken <strong>und</strong> zu<br />
schützen. Das schließt laut Leitfaden alle<br />
Arbeiter ein, die von der Organisation<br />
selbst, deren Sub-Unternehmern <strong>und</strong><br />
Unterlieferanten beschäftigt werden<br />
sowie die He<strong>im</strong>arbeiter. SA8000 beruht<br />
auf der UN-Menschenrechtserklärung<br />
<strong>und</strong> berücksichtigt Übereinkommen der<br />
International Labour Organization (ILO),<br />
internationale Menschenrechte <strong>und</strong> Anforderungen<br />
aus nationalem Arbeitsrecht.<br />
Bei Miele werden die Kriterien <strong>und</strong> ihre<br />
Einhaltung <strong>im</strong> Rahmen von externen <strong>und</strong><br />
internen Audits geprüft. Die Steuerung<br />
des Auditierungs- <strong>und</strong> Zertifizierungsverfahrens<br />
liegt in der Verantwortung<br />
des Zentralen Qualitätsmanagements<br />
am Stammsitz in Gütersloh. Für die Umsetzung<br />
<strong>und</strong> Einhaltung der Vorgaben<br />
an den Miele-Standorten sind wiederum<br />
die Werk- <strong>und</strong> Abteilungsleiter zuständig.<br />
Die interne Auditierung wird von<br />
erfahrenen, entsprechend qualifizierten<br />
Miele-Auditoren <strong>im</strong> Rahmen einer<br />
Selbstüberwachung durchgeführt. So<br />
sollen Abweichungen frühzeitig identifiziert<br />
<strong>und</strong> Gegenmaßnahmen eingeleitet<br />
werden. Die externe Prüfung findet halbjährig<br />
statt. Eine Rezertifizierung aller<br />
Werke erfolgt alle drei Jahre, zuletzt 2014.<br />
104 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Gemäß den Anforderungen von SA8000<br />
werden diese Gr<strong>und</strong>sätze allen Mitarbeitern<br />
bei Eintritt in das Unternehmen<br />
kommuniziert. Sie gelten für jeden einzelnen<br />
Arbeitnehmer <strong>und</strong> als Maßstab<br />
für das tägliche Handeln. Dazu zählt<br />
ausdrücklich das Verbot von Zwangs-,<br />
Pflicht- oder Kinderarbeit. Damit befindet<br />
sich Miele <strong>im</strong> Einklang mit den<br />
Zielvorgaben der nachhaltigen Entwicklungsagenda,<br />
die ebenfalls auf die<br />
Abschaffung von Kinder- <strong>und</strong> Zwangsarbeit<br />
zielt.<br />
Mitbest<strong>im</strong>mung <strong>und</strong> Vorschlagswesen<br />
Neben seiner Verpflichtung, Risiken für<br />
den Ges<strong>und</strong>heitsschutz <strong>und</strong> die Sicherheit<br />
am Arbeitsplatz zu vermeiden <strong>und</strong><br />
falls nötig zu beseitigen, hat für Miele<br />
auch die betriebliche Mitbest<strong>im</strong>mung<br />
einen hohen Stellenwert. Im Rahmen<br />
des Programms „Welcome@Miele“ informiert<br />
das Unternehmen neue Mitarbeiter<br />
unmittelbar bei Arbeitsbeginn über ihre<br />
Rechte zur Mitbest<strong>im</strong>mung.<br />
Wesentliches Merkmal der Miele-Unternehmenskultur<br />
ist außerdem die Einbindung<br />
der Meinungen <strong>und</strong> Ideen der<br />
Mitarbeiter <strong>im</strong> Rahmen des betrieblichen<br />
Vorschlagswesens. Im Geschäftsjahr<br />
2015/16 wurden allein in den deutschen<br />
Werken über 2.000 Vorschläge zu Einsparungen<br />
<strong>und</strong> Verbesserungen von Produkten<br />
<strong>und</strong> Arbeitsabläufen eingereicht.<br />
Zudem hat Miele an jedem Standort in<br />
<strong>Deutschland</strong> eine Beschwerdestelle gemäß<br />
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz<br />
(AGG) eingerichtet.<br />
Anti-Diskr<strong>im</strong>inierung <strong>und</strong><br />
leistungsgerechte Vergütung<br />
Miele hat sich zum Ziel gesetzt, überall<br />
<strong>im</strong> Unternehmen ein Bewusstsein für das<br />
Potenzial der Vielfalt zu schaffen <strong>und</strong> jegliche<br />
Form der Diskr<strong>im</strong>inierung − etwa<br />
aufgr<strong>und</strong> von Rasse, Staatsangehörigkeit,<br />
Religion, Behinderung, Geschlecht, sexueller<br />
Orientierung, politischer Ansichten,<br />
Alter oder Ähnlichem − zu unterbinden.<br />
Deshalb unterstützt das Unternehmen<br />
die Charta der Vielfalt <strong>und</strong> trägt seinen<br />
Teil durch die Etablierung eines integrierten<br />
Diversity Managements bei.<br />
Zum Selbstverständnis von Miele als<br />
sozial verantwortlichem Arbeitgeber<br />
zählt auch ein angemessener Lohn für<br />
alle Mitarbeiter, bei dessen Festlegung<br />
keine Unterscheidung nach Geschlecht<br />
gemacht wird <strong>und</strong> der sich an tarifvertraglichen<br />
<strong>und</strong> betrieblichen Vereinbarungen<br />
orientiert, sowie umfassende<br />
Sozialleistungen − etwa zur Förderung<br />
der privaten Altersvorsorge.<br />
Frauen- <strong>und</strong> Nachwuchsförderung<br />
Die Gleichstellung der Geschlechter<br />
<strong>und</strong> Stärkung aller Frauen <strong>und</strong> Mädchen<br />
erreichen − so lautet das Ziel 5 der<br />
Sustainable Development Goals. Auch<br />
<strong>und</strong> gerade für technisch geprägte Unternehmen<br />
wie Miele werden hochqualifizierte<br />
Frauen <strong>im</strong>mer wichtiger. Mit<br />
verschiedenen Maßnahmen wie flexiblen<br />
Teilzeitmodellen oder der Unterstützung<br />
bei der Kinderbetreuung will Miele<br />
Frauen deshalb ermutigen <strong>und</strong> dabei<br />
unterstützen, trotz Familienplanung<br />
Führungspositionen anzustreben. Außerdem<br />
beteiligt sich Miele an Förderprojekten<br />
wie dem „Frauen-Karriere-Index“,<br />
engagiert sich <strong>im</strong> Nationalen Pakt für<br />
Frauen in MINT-Berufen <strong>und</strong> hat bereits<br />
2007 den Miele-Ingenieurinnen-Treff ins<br />
Leben gerufen.<br />
Zur Nachwuchsförderung bietet Miele<br />
seit 1995 ein Duales Bachelorstudium an.<br />
Weitere Einstiegsmöglichkeiten in das<br />
Unternehmen sind das Master@Miele-<br />
Programm für Bachelorabsolventen oder<br />
das Trainee-Programm für Absolventen<br />
mit Masterabschluss. Zudem kann sich<br />
der Nachwuchs bereits vor Studien- <strong>und</strong><br />
Ausbildungsbeginn, zum Beispiel am<br />
„Tag der offenen Ausbildung“, über die<br />
vielfältigen Berufsangebote bei Miele<br />
informieren.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
105
Good Practice<br />
Von CSR zu Shared Value<br />
Was strategische Corporate Social Responsibility<br />
mit Geschäftsinvestition zu tun hat<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> CSR: Dieses Spannungsfeld wurde <strong>im</strong> letzten Jahrzehnt zunehmend häufiger<br />
umfassend diskutiert. Doch welche Rolle übern<strong>im</strong>mt hierbei eigentlich die Wirtschaft?<br />
Von Dr. Christoph Regierer <strong>und</strong> Kai M. Beckmann,<br />
Roever Broenner Susat Mazars<br />
Verbreitet herrscht die Vorstellung, die<br />
Verknüpfung von CSR <strong>und</strong> Wirtschaft<br />
bedeute, dass Unternehmensinvestitionen<br />
in Übereinst<strong>im</strong>mung mit etablierten<br />
oder zukünftigen CSR-Standards getätigt<br />
werden sollten. Doch die Integration<br />
von CSR in das unternehmerische Denken<br />
setzt bereits wesentlich früher an:<br />
Es geht darum, wie Unternehmen ihre<br />
Gewinne erwirtschaften <strong>und</strong> welche<br />
Auswirkungen das eigene unternehmerische<br />
Handeln hat <strong>und</strong> nicht nur, wie<br />
Unternehmen investieren.<br />
CSR ist kein philanthropischer Ansatz.<br />
Die Herausforderung besteht darin, die<br />
wachsende Bedeutung von CSR früh zu<br />
erkennen <strong>und</strong> in Geschäftsmodelle <strong>und</strong><br />
Leitlinien zu überführen. Das schwer<br />
Greif bare greif bar zu machen, zu definieren,<br />
zu systematisieren <strong>und</strong> in die<br />
Unternehmensprozesse zu integrieren −<br />
das ist vielen Unternehmen heute noch<br />
lästig, perspektivisch aber unerlässlich!<br />
Dabei gilt es, nicht nur einen verlässlichen<br />
Rahmen für das eigene Handeln<br />
festzulegen, sondern auch übergeordnete<br />
Leitplanken, wie z. B. die Sustainable<br />
Development Goals (SDGs) <strong>und</strong> internationale<br />
Standards, <strong>im</strong> Blick zu haben.<br />
Strategische CSR –<br />
Chancen für Unternehmen<br />
Der Vorteil strategischer CSR zeigt sich<br />
nicht nur in gesteigerter Reputation, sondern<br />
auch in Form erhöhter Profitabilität:<br />
Das Risiko von Rechtsstreitigkeiten <strong>und</strong> Bei der Beurteilung wesentlicher CSRden<br />
damit zusammenhängenden Kosten<br />
sinkt, Kapitalkosten werden <strong>im</strong>mer gewichtige Rolle: So ist es entschei-<br />
Themen spielt ein weiterer Faktor eine<br />
stärker durch CSR beeinflusst, Vertrauen dend, als relevante Risiken auch jene<br />
von Stakeholdern wächst, Mitarbeiterbindung<br />
steigt, globale Beschaffung wird erfassen, die sich unmittelbar aus der<br />
unternehmerischen Folgerisiken zu<br />
sicherer. Diese Betrachtung erscheint eigenen Unternehmenstätigkeit ergeben.<br />
SHARED VALUE<br />
SHARED Shared Value VALUE<br />
Einkauf<br />
Personal<br />
Produktion<br />
Vertrieb<br />
...<br />
Einkauf<br />
Personal<br />
Produktion<br />
Vertrieb<br />
...<br />
CSR-<br />
Controlling<br />
allerdings vielen Unternehmen auf den<br />
ersten Blick nicht plausibel: Welches<br />
Unternehmen erfasst schon alle kumulierten<br />
CSR-Kosten aus Einkauf, Cla<strong>im</strong>-<br />
Management, Qualitätssicherung, Marken<strong>im</strong>age<br />
oder Reputation <strong>und</strong> setzt<br />
diese in Bezug zu CSR-Zielen?<br />
Positionierung<br />
Kostentransparenz<br />
CSR-<br />
Controlling<br />
…<br />
Konnektivität<br />
Positionierung<br />
Kostentransparenz<br />
…<br />
Neue Märkte,<br />
Geschäftsprozesse,<br />
internationale<br />
Projekte, etc.<br />
Diese Folgerisiken, die häufig in Zusammenhang<br />
mit der Lieferkette stehen,<br />
werden in der Regel nicht als<br />
klassische Unternehmensrisiken aufgenommen.<br />
Der US-amerikanische<br />
Dodd-Frank Act zielt auf genau ein<br />
solches Folgerisiko, nämlich die Fi-<br />
Konnektivität<br />
106 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
nanzierung von Rebellengruppen <strong>im</strong><br />
Kongo durch „Konfliktmineralien“. Wir<br />
sollten also den Blick, mit dem wir bisher<br />
auf CSR-Risiken geschaut haben,<br />
erweitern. Denn sind diese Folgerisiken<br />
erst einmal identifiziert, die Kennzahlen<br />
zur Überwachung verstanden <strong>und</strong><br />
die passenden Steuerungsprozesse <strong>im</strong>plementiert,<br />
lässt sich neben Risikoprävention<br />
häufig ein Nutzen für das<br />
Unternehmen erkennen: die Fähigkeit<br />
des Unternehmens zur Konnektivität.<br />
Konnektivität ist ein zunehmend wichtiger<br />
Erfolgsfaktor. Hier geht es darum,<br />
dass z. B. international Projekte vermehrt<br />
über strategische Allianzen <strong>und</strong><br />
Partnerschaften entwickelt <strong>und</strong> bearbeitet<br />
werden, wie etwa internationale<br />
Allianzen <strong>und</strong> Fonds, die <strong>im</strong> Bereich<br />
der internationalen Ges<strong>und</strong>heitspolitik<br />
entstanden sind. Ein Beispiel ist die<br />
<strong>Global</strong> Alliance for Vaccines and Immunisation.<br />
Sie wurde ins Leben gerufen<br />
mit dem Ziel, jedem Kind Impfschutz<br />
Beispiel Menschenrechte:<br />
Es gilt, die Hürden zu überwinden<br />
Dass Unternehmen in dem Zusammenhang<br />
noch großes Entwicklungspotenzial<br />
haben, zeigt das Thema „Menschenrechte“.<br />
Eine Umfrage des Economist Intelligence<br />
Unit (EIU) ergab, dass 83 Prozent<br />
der befragten Unternehmensvertreter die<br />
Wirtschaft als einen wichtigen Protagonisten<br />
be<strong>im</strong> Schutz der Menschenrechte<br />
sehen. Gleichzeitig konnten jedoch nur<br />
wenige Studienteilnehmer erklären, wie<br />
der Schutz der Menschenrechte entlang<br />
ihrer eigenen Zulieferkette integriert ist.<br />
Das Ergebnis zeigt: Der Wille ist da, in<br />
der Praxis gibt es jedoch noch Hürden zu<br />
nehmen. Das Beispiel verdeutlicht auch,<br />
dass der Blick auf die eigene Lieferkette<br />
noch zu sehr auf ausgewählte Aspekte<br />
fokussiert ist <strong>und</strong> mögliche Chancenpotenziale<br />
− z. B. hinsichtlich ihrer Konnektivität<br />
− unzureichend erfasst <strong>und</strong><br />
bewertet werden.<br />
Creating Shared Value<br />
Je internationaler ein Unternehmen ist,<br />
desto komplexer <strong>und</strong> anspruchsvoller ist<br />
die Berücksichtigung der wachsenden<br />
regulativen <strong>und</strong> marktgesteuerten CSR-<br />
Anforderungen. Eine zentrale Steuerung<br />
dieser Herausforderungen ist ohne definierten<br />
Organisationsrahmen kaum<br />
möglich. Für den internationalen Mittelstand<br />
stellt diese Entwicklung eine<br />
besondere Herausforderung dar, denn<br />
viele dieser zum Teil familiengesteuerten<br />
Unternehmen bewerten die eigene<br />
CSR-Performance noch <strong>im</strong>mer stark aus<br />
einem traditionellen Werteverständnis<br />
heraus. Dabei bleibt die Erwartungshaltung<br />
wichtiger Auslandsmärkte häufig<br />
unzureichend berücksichtigt.<br />
Unsere Überzeugung ist: Unternehmen,<br />
die CSR systematisch in die Organisation<br />
<strong>und</strong> in ihr Handeln integrieren, sind<br />
produktiver <strong>und</strong> schaffen Mehrwert. Für<br />
viele Unternehmen ist dazu nur ein letzter<br />
Schritt erforderlich, doch ohne diesen<br />
bleibt der CSR-Blick zu stark eingeschränkt.<br />
Gr<strong>und</strong>lage ist dafür ein tiefes<br />
Verständnis <strong>und</strong> Engagement gegenüber<br />
Mitarbeitern, Lieferanten, kulturellen Besonderheiten,<br />
Gesetzgebern <strong>und</strong> der Zivilgesellschaft.<br />
Dieses umfassend zu bewerten<br />
<strong>und</strong> in Bezug zum eigenen Handeln<br />
zu setzen, kann Ausgangspunkt für neue<br />
Geschäftschancen sein (Konnektivität).<br />
Unternehmen, die dieses Engagement<br />
bei der Erwirtschaftung ihrer Gewinne<br />
einbeziehen, gehen über CSR hinaus <strong>und</strong><br />
beginnen Shared Value zu schaffen, indem<br />
sie die Interessen der Wirtschaft mit<br />
denen der sie umgebenden Gemeinschaften<br />
<strong>und</strong> der Umwelt in Übereinst<strong>im</strong>mung<br />
bringen. Wir sind der Überzeugung, dass<br />
hier die unternehmerische Zukunft liegt:<br />
Der Jahresbericht 2014/15 unserer internationalen<br />
Mazars Gruppe trägt den Titel<br />
„Creating Shared Value“.<br />
gegen die wichtigsten Infektionskrankheiten<br />
zu ermöglichen; getragen wird<br />
die Allianz von privaten Stiftungen,<br />
internationalen Organisationen (UNICEF,<br />
WHO,Weltbank), Regierungen, Forschungseinrichtungen,<br />
Unternehmen<br />
<strong>und</strong> NGOs.<br />
In einer solchen Kooperation Partner zu<br />
sein, eröffnet neue Märkte <strong>und</strong> Geschäftspotenziale.<br />
Doch ist der Zutritt oft mit<br />
hohen Anforderungen an Transparenz,<br />
Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> Integrität verknüpft.<br />
Ein umfassendes CSR-Verständnis, das<br />
die Auswirkungen des eigenen Handels<br />
einschließt, eröffnet oft erst den Blick<br />
auf diese neue Art an Geschäftspotenzial<br />
<strong>und</strong> ist zugleich eine wichtige Zugangsvoraussetzung.<br />
WP/RA/StB Dr. Christoph Regierer,<br />
Managing Partner bei<br />
Roever Broenner Susat Mazars<br />
Kai Michael Beckmann,<br />
Director Compliance, Risk & Responsibility<br />
bei Roever Broenner Susat Mazars<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
107
Good Practice<br />
Wie aus Flüchtlingshilfe<br />
Erfolgsgeschichten werden<br />
Mehr als eine Million Menschen sind <strong>im</strong> Jahr 2015 als Flüchtlinge nach <strong>Deutschland</strong> gekommen.<br />
Ihre gesellschaftliche <strong>und</strong> wirtschaftliche Integration ist eine große Herausforderung. Das können<br />
Staat <strong>und</strong> die vielen Ehrenamtlichen nicht alleine leisten, sondern hier sind alle Teile der Gesellschaft,<br />
also auch die Unternehmen gefordert. Tchibo setzt sich in der Flüchtlingshilfe mit drei<br />
Maßnahmen ein: dem ehrenamtlichen Einsatz der Mitarbeiter, Beschäftigungsangeboten sowie<br />
bedarfsgerechten Sachspenden. Zusätzlich ist Tchibo <strong>im</strong> Juni <strong>2016</strong> der Integrationsinitiative der<br />
deutschen Wirtschaft „Wir zusammen“ beigetreten.<br />
Von Monika Focks,<br />
Managerin Unternehmensverantwortung, Tchibo<br />
Mitarbeiter <strong>im</strong> Einsatz für den<br />
guten Zweck<br />
Bei Tchibo ist man davon überzeugt,<br />
dass geflüchtete Menschen unsere Gesellschaft<br />
bereichern. „Dazu benötigen<br />
sie Unterstützung bei ihrer Integration.<br />
Tchibo als global tätigem Unternehmen<br />
ist es wichtig, zusammen mit den Mitarbeitern<br />
einen Beitrag zu Integration<br />
<strong>und</strong> Beschäftigung zu leisten“, erläutert<br />
der Vorsitzende der Geschäftsführung,<br />
Dr. Markus Conrad. Deshalb unterstützt<br />
Tchibo seine Mitarbeiter dabei, ehrenamtlich<br />
in der Flüchtlingshilfe aktiv<br />
zu werden. Den Auftakt dazu machte<br />
<strong>im</strong> Januar <strong>2016</strong> eine Aktion, bei der<br />
24 Tchibo-Mitarbeiter in einer Erstaufnahmeeinrichtung<br />
Kleiderspenden sortierten.<br />
Im Anschluss an diese positive<br />
Erfahrung entwickelte das Unternehmen<br />
dann ein umfassendes Corporate-<br />
Volunteering-Programm <strong>im</strong> Umfeld<br />
der Flüchtlingshilfe. Ein wesentliches<br />
Element ist die Zusammenarbeit mit<br />
zwei entsprechenden Institutionen: einer<br />
Erstaufnahmeeinrichtung sowie einer<br />
Schule mit einem sehr hohen Anteil an<br />
Kindern von Geflüchteten.<br />
Im August <strong>2016</strong> organisierten 40 Tchibo-<br />
Mitarbeiter an zwei Nachmittagen Kinderfeste<br />
in der Erstaufnahmeeinrichtung<br />
„Sportallee“ in Hamburg. Hier werden<br />
r<strong>und</strong> 750 Bewohner meist für einen<br />
Zeitraum von bis zu acht Monaten untergebracht.<br />
Für ihren Einsatz − etwa<br />
be<strong>im</strong> Kinderschminken, Dosenwerfen<br />
oder bei Bastelaktionen − ernteten die<br />
freiwilligen Helfer strahlende Gesichter<br />
<strong>und</strong> jede Menge Kinderlachen: „Die<br />
Fröhlichkeit der Kinder zu erleben war<br />
einzigartig!“, schilderte eine Beteiligte<br />
ihre Erfahrungen. Neben vom Unternehmen<br />
organisierten Aktionen wie dieser<br />
können sich Tchibo-Mitarbeiter auch<br />
als ehrenamtliche Mentoren engagieren,<br />
108 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
zum Beispiel als Begleiter bei Ausflügen.<br />
Jochen Eckhold, Director Human<br />
Resources, weiß: „Es ist gut, über den<br />
Tellerrand zu schauen; die Distanz zur<br />
täglichen Arbeit erweitert die eigene<br />
Perspektive, es macht etwas mit einem.“<br />
Spenden in Höhe von zwei Millionen<br />
Euro<br />
Als weitere Maßnahme spendete Tchibo<br />
2015 <strong>und</strong> <strong>2016</strong> dringend benötigte Waren<br />
aus dem eigenen Produktsort<strong>im</strong>ent<br />
an Hilfsorganisationen wie das Deutsche<br />
<strong>und</strong> Österreichische Rote Kreuz oder den<br />
Türkischen Roten Halbmond, darunter<br />
Spielsachen, Bettwäsche <strong>und</strong> Kleidung.<br />
Große Wäsche- <strong>und</strong> Kleiderspenden gingen<br />
auch an das LaGeSo in Berlin, die<br />
Hamburger Kleiderkammer sowie die<br />
Erstaufnahme „Sportallee“. Seit 2015<br />
hat Tchibo Waren <strong>im</strong> Verkaufswert von<br />
insgesamt r<strong>und</strong> zwei Millionen Euro<br />
gespendet.<br />
Wie gelingt eine nachhaltige<br />
Integration?<br />
Während Unternehmen ihre Hilfsangebote<br />
für Flüchtlinge oft zunächst auf die<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
von Erstaufnahmeeinrichtungen konzentrierten,<br />
rückt jetzt allmählich die Frage<br />
in den Blickpunkt, wie eine langfristige<br />
Integration der Menschen in die Gesellschaft<br />
<strong>und</strong> den hiesigen Arbeitsmarkt<br />
gelingen kann. Der überwiegende Teil<br />
der Geflüchteten ist jünger als 25 Jahre<br />
<strong>und</strong> befindet sich somit noch <strong>im</strong> Schuloder<br />
Ausbildungsalter. Der Zugang zu<br />
schulischer <strong>und</strong> beruflicher Bildung<br />
bedeutet für sie einen entscheidenden<br />
Schritt für eine erfolgreiche Integration.<br />
Für die deutsche Wirtschaft wiederum,<br />
deren Belegschaften <strong>im</strong> Durchschnitt<br />
<strong>im</strong>mer älter werden, bieten diese jungen<br />
Asylsuchenden ein hohes Potenzial in<br />
einem zunehmend wettbewerbsintensiven<br />
Arbeitsmarkt. Eine Schlüsselrolle<br />
nehmen dabei berufsvorbereitende Maßnahmen<br />
wie Praktikums- <strong>und</strong> Ausbildungsangebote<br />
ein.<br />
Erste Erfolgsgeschichten<br />
Tchibo kann bereits mehrere Erfolgsgeschichten<br />
<strong>im</strong> Zusammenhang mit der<br />
Beschäftigung von Flüchtlingen erzählen:<br />
So nahmen Ahmad Y. aus Afghanistan<br />
<strong>und</strong> Kinda F. aus Syrien <strong>im</strong> Februar <strong>2016</strong><br />
<strong>im</strong> kaufmännischen Bereich ihre Arbeit<br />
als Praktikanten bei Tchibo auf. Ahmad<br />
Y. unterstützte den Bereich International<br />
Sales <strong>und</strong> wurde inzwischen aufgr<strong>und</strong><br />
seiner sprachlichen <strong>und</strong> fachlichen Qualifikation<br />
in eine Festanstellung übernommen.<br />
Kinda F. half in der Abteilung<br />
Human Resource Planning be<strong>im</strong> Aufbau<br />
eines neuen IT Human Resource Tools<br />
<strong>und</strong> schloss ihr Praktikum ebenfalls erfolgreich<br />
ab. Vier weitere Geflüchtete<br />
erhielten bislang die Möglichkeit, verschiedene<br />
Bereiche des Unternehmens <strong>im</strong><br />
Rahmen eines Praktikums kennenzulernen<br />
<strong>und</strong> ihre Sprach- <strong>und</strong> Fachkenntnisse<br />
zu vertiefen. Bis Ende des Jahres sollen bis<br />
zu zehn kaufmännische <strong>und</strong> gewerbliche<br />
Praktikumsplätze von jungen Migranten<br />
genutzt werden.<br />
Darüber hinaus beteiligt sich Tchibo<br />
mit Beschäftigungsangeboten <strong>im</strong> Mitarbeiterrestaurant<br />
<strong>und</strong> in der Rösterei<br />
an dem Programm zur sogenannten<br />
Ausbildungsvorbereitung für Migranten<br />
(AvM-Dual). Der auf zwei Jahre ausgelegte<br />
<strong>und</strong> Anfang <strong>2016</strong> als b<strong>und</strong>esweit<br />
einzigartiges Projekt in Hamburg gestartete<br />
Bildungsgang zielt darauf, junge<br />
Flüchtlinge durch eine enge Verzahnung<br />
von Sprachförderung, Schulunterricht<br />
<strong>und</strong> betrieblichen Praktikumsphasen<br />
besser auf den Einstieg in die Berufswelt<br />
vorzubereiten. So bietet sich bei Tchibo<br />
bei entsprechender Eignung etwa die<br />
Chance auf eine Ausbildung zum Koch<br />
oder aber als Maschinenführer in der<br />
Rösterei.<br />
Auf unterschiedlichem Weg zu<br />
einem gemeinsamen Ziel<br />
Tchibo ist überzeugt, dass die Integration<br />
der Flüchtlinge nur durch gemeinsames<br />
Handeln gelingt. Deshalb hat sich das<br />
Unternehmen <strong>im</strong> Juni <strong>2016</strong> der Integrationsinitiative<br />
der deutschen Wirtschaft<br />
„Wir zusammen“ angeschlossen. Mehr als<br />
160 Unternehmen engagieren sich bereits<br />
in dem Netzwerk (Stand August <strong>2016</strong>)<br />
<strong>und</strong> nutzen es als Plattform, um eigene<br />
konkrete Projekte vorzustellen sowie<br />
andere Firmen <strong>und</strong> deren Mitarbeiter<br />
dazu zu motivieren, ebenfalls in der<br />
Flüchtlingshilfe aktiv zu werden. „Mit<br />
dem Engagement für die Integration von<br />
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sowie<br />
Soforthilfen durch den ehrenamtlichen<br />
Einsatz der Mitarbeiter <strong>und</strong> Sachspenden<br />
leistet Tchibo einen wertvollen Beitrag<br />
dazu, den Neuankömmlingen eine Perspektive<br />
für ihr Leben in <strong>Deutschland</strong><br />
zu bieten“, so die Projektleiterin der<br />
Initiative, Marlies Peine.<br />
Wie viele Menschen nach <strong>2016</strong> als<br />
Flüchtlinge nach <strong>Deutschland</strong> kommen<br />
werden, lässt sich laut einer aktuellen<br />
Studie von „Wir zusammen“ nur schwer<br />
abschätzen. Angesichts der vielen weltweit<br />
von <strong>Flucht</strong> <strong>und</strong> Vertreibung betroffenen<br />
Menschen bleibt Flüchtlingshilfe<br />
ein zentrales Thema. Tchibo will sich<br />
der „großen Gemeinschaftsaufgabe“ Integration<br />
auch in Zukunft stellen <strong>und</strong><br />
sein Engagement auf verschiedenen<br />
Ebenen fortsetzen. Und damit den bisherigen<br />
Erfolgsgeschichten viele weitere<br />
hinzufügen.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
109
Good Practice<br />
Gemeinsam für die Zukunft:<br />
Integration als Chance<br />
Mitarbeiter aus 86 Nationen weltweit: Bei TÜV Rheinland wird interkulturelle Vielfalt wertgeschätzt.<br />
Denn Facettenreichtum ist etwas, was uns bereichert <strong>und</strong> stark gemacht hat – sowohl<br />
nach innen, als auch nach außen. Für TÜV Rheinland ist es deshalb selbstverständlich, sich<br />
nachhaltig für die Integration von Geflüchteten einzusetzen <strong>und</strong> dazu beizutragen, dass aus<br />
Herausforderungen Chancen werden.<br />
Von Susanne Dunschen <strong>und</strong> Dr. Hannes Hofmann,<br />
CSR <strong>und</strong> Nachhaltigkeit, TÜV Rheinland<br />
65 Millionen Menschen waren <strong>im</strong> Jahr<br />
2015 auf der <strong>Flucht</strong>. Davon kamen allein<br />
890.000 nach <strong>Deutschland</strong>. Laut Angaben<br />
des B<strong>und</strong>esministeriums des Innern<br />
wurden <strong>im</strong> Jahr 2015 be<strong>im</strong> B<strong>und</strong>esamt<br />
für <strong>Migration</strong> <strong>und</strong> Flüchtlinge knapp<br />
477.000 formelle Asylanträge gestellt −<br />
mehr Anträge als jemals zuvor <strong>und</strong> fast<br />
doppelt so viele wie <strong>im</strong> Vorjahr 2014.<br />
Das sind Zahlen, auf die Bevölkerung, Politik<br />
<strong>und</strong> Wirtschaft so nicht vorbereitet<br />
waren. Umso wichtiger ist es, Strukturen<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen für eine erfolgreiche<br />
Integration so schnell, aber auch so gut<br />
durchdacht wie möglich auszubauen <strong>und</strong><br />
so den vielen Geflohenen, die aufgr<strong>und</strong><br />
von Kriegen, politischer Verfolgung <strong>und</strong><br />
Diskr<strong>im</strong>inierung nicht in ihre He<strong>im</strong>atländer<br />
zurückkehren können, eine reelle<br />
Chance auf ein neues Leben in <strong>Deutschland</strong><br />
zu geben. Mit dem <strong>im</strong> Mai <strong>2016</strong><br />
verabschiedeten Integrationsgesetz hat<br />
die B<strong>und</strong>esregierung einen wichtigen<br />
Schritt getan, um die Einstellung von<br />
Geflüchteten für Unternehmen zu erleichtern.<br />
Dennoch bleiben Sprachbarrieren<br />
<strong>und</strong> teilweise mangelnde oder<br />
schwer nachweisbare Qualifizierung eine<br />
Herausforderung für die Wirtschaft, der<br />
es sich gezielt zu stellen gilt.<br />
TÜV Rheinland bekennt sich seit 2006<br />
zu den zehn Prinzipien des UN <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> <strong>und</strong> versteht diese als Werterahmen<br />
des täglichen unternehmerischen<br />
Handelns. Aus diesem Bekenntnis<br />
werden Programme <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
abgeleitet, um zum einen innerhalb des<br />
Unternehmens der Verantwortung gegenüber<br />
Umwelt <strong>und</strong> Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeitern gerecht zu werden <strong>und</strong><br />
sich in der Erbringung unserer Dienstleistungen<br />
verantwortungsbewusst<br />
zu zeigen. Zum anderen versteht sich<br />
TÜV Rheinland als Teil der Gesellschaft,<br />
in der es wirtschaftet, <strong>und</strong> sieht sich in<br />
der Pflicht, einen aktiven Beitrag zur<br />
Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen<br />
zu leisten. Deshalb ist es für<br />
TÜV Rheinland selbstverständlich, sich<br />
auch mit der Frage auseinanderzusetzen,<br />
wie für Geflüchtete eine neue Perspektive<br />
geschaffen werden kann.<br />
Soforthilfe durch engagierte<br />
Mitarbeiter <strong>und</strong> Orientierung<br />
durch Angebote der<br />
TÜV Rheinland Akademie<br />
F<strong>und</strong>ament des Engagements von TÜV<br />
Rheinland ist die große Hilfsbereitschaft<br />
der Mitarbeitenden selbst. An den drei<br />
größten deutschen Standorten des Unternehmens,<br />
in Berlin, Nürnberg <strong>und</strong> Köln,<br />
führte <strong>im</strong> Spätsommer 2015 der Aufruf<br />
zur Soforthilfe durch Sachspenden für<br />
Flüchtlingserstaufnahmestellen zu einer<br />
überwältigenden Menge <strong>und</strong> Vielfalt an<br />
Gebrauchsgegenständen. Darüber hinaus<br />
engagierten sich Teile der Belegschaft<br />
ehrenamtlich in verschiedenen Hilfsprojekten<br />
in Köln, Berlin <strong>und</strong> Nürnberg. TÜV<br />
Rheinland unterstützte hierbei <strong>und</strong> stellte<br />
Helferinnen <strong>und</strong> Helfer für die entsprechenden<br />
Einsatztage von der Arbeit frei.<br />
Als zweiten wichtigen Baustein zur Integration<br />
bietet die TÜV Rheinland Akademie<br />
seit Ende 2015 Sprachkurse für<br />
Geflüchtete an. Im Vordergr<strong>und</strong> steht<br />
die Vermittlung von Sprachkenntnissen,<br />
die bei der Bewältigung von Alltagssituationen<br />
helfen sollen. Bislang haben weit<br />
über 1.000 Geflohene dieses Angebot<br />
wahrgenommen. Parallel dazu entwickelten<br />
Fachleute der TÜV Rheinland<br />
Akademie <strong>im</strong> Auftrag des Goethe Instituts<br />
München eine virtuelle Entdeckungsreise<br />
durch die deutsche Arbeitswelt. Sie leisten<br />
dadurch einen Beitrag zum Projekt „Mein<br />
Weg nach <strong>Deutschland</strong>“, das Menschen<br />
bereits vor dem Start von Integrationskursen<br />
helfen soll, sich mit der deutschen<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Alltagswelt schrittweise <strong>und</strong><br />
spielerisch vertraut zu machen.<br />
Ausbildungsplätze schaffen<br />
Integration <strong>und</strong> bieten Zukunftsperspektiven<br />
In enger Zusammenarbeit mit der IHK<br />
Köln hat TÜV Rheinland Einstiegsqualifizierungen<br />
<strong>und</strong> Praktika für Geflüchtete<br />
am Standort Köln angeboten. Darauf<br />
auf bauend hat das Unternehmen zwölf<br />
110 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
neue Ausbildungsplätze geschaffen, von<br />
denen acht in den Bereichen IT, Baustoff<strong>und</strong><br />
Werkstoffprüfung <strong>und</strong> Gastronomie<br />
in Nürnberg <strong>und</strong> Köln besetzt sind. Acht<br />
besetzte Ausbildungsplätze − das mag auf<br />
den ersten Blick nicht nach viel klingen,<br />
bedeutet für TÜV Rheinland jedoch konkret,<br />
dass die für das Ausbildungsjahr<br />
<strong>2016</strong> in ganz <strong>Deutschland</strong> geplanten 30<br />
Ausbildungsplätze um fast ein Drittel aufgestockt<br />
wurden, um Geflüchteten einen<br />
Alseny Barry (l.) <strong>und</strong><br />
Tobias Hainke (r.) treffen sich<br />
regelmäßig <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Integrationspatenschaften.<br />
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt<br />
zu ermöglichen. Durch dieses Angebot<br />
will TÜV Rheinland dazu beitragen, dass<br />
auch Menschen, die ihre Erfahrungen<br />
nicht für einen direkten Einstieg in den<br />
deutschen Arbeitsmarkt nutzen können,<br />
gezielt für best<strong>im</strong>mte Stellen qualifiziert<br />
werden <strong>und</strong> somit durch Bildung<br />
in ihre Zukunft investieren. Um den<br />
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung<br />
zu gewährleisten, werden die neuen Auszubildenden<br />
in einem firmeninternen<br />
Programm intensiv begleitet. So besuchen<br />
sie wöchentlich einen am Standort organisierten<br />
Deutschkurs <strong>und</strong> nahmen an<br />
einem verpflichtenden interkulturellen<br />
Training teil. Nicht zuletzt sind es jedoch<br />
„Respekt <strong>und</strong> Toleranz sind Gr<strong>und</strong>werte unserer<br />
Unternehmenskultur. Es ist für uns als<br />
verantwortlich handelndes Unternehmen<br />
selbstverständlich, sich damit auseinanderzusetzen,<br />
wie wir für Menschen, die vor Krieg<br />
<strong>und</strong> Katastrophen geflohen sind, eine Perspektive<br />
schaffen können – ganz gleich, ob<br />
sie dauerhaft bleiben wollen oder nicht. Dies<br />
sehen wir als kontinuierliche Aufgabe.“<br />
Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der<br />
TÜV Rheinland AG<br />
die zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
über den eigenen Arbeitsplatz hinaus, die<br />
für die besondere Atmosphäre bei TÜV<br />
Rheinland sorgen. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e<br />
stehen den neuen Auszubildenden am<br />
Firmenhauptsitz in Köln seit Beginn des<br />
Ausbildungsjahres engagierte Integrationspaten<br />
<strong>und</strong> -patinnen an der Seite. Sie<br />
sind während des ersten Ausbildungsjahres<br />
persönliche Ansprechpartner, bieten<br />
Orientierung <strong>im</strong> Unternehmen <strong>und</strong> ermöglichen<br />
durch regelmäßige Gespräche<br />
eine zusätzliche Sprachförderung.<br />
Durch Beharrlichkeit<br />
<strong>und</strong> Ausdauer ans Ziel<br />
Nun erlöschen Krisenherde nicht über<br />
Nacht. Es ist davon auszugehen, dass<br />
auch in den nächsten Jahren Kriegsflüchtlinge<br />
nach <strong>Deutschland</strong> kommen<br />
werden. Darüber hinaus werden sich<br />
auch viele Kl<strong>im</strong>aflüchtlinge aus ihrer<br />
durch Dürre, Überschwemmung <strong>und</strong><br />
andere Naturkatastrophen unbewohnbar<br />
gewordenen He<strong>im</strong>at auf den Weg in<br />
eine sicherere Zukunft, zum Beispiel in<br />
<strong>Deutschland</strong>, begeben. Auch sie werden<br />
auf Arbeitsplätze angewiesen sein <strong>und</strong><br />
sich die Suche danach unter anderem mit<br />
denjenigen Geflüchteten teilen, die schon<br />
länger in <strong>Deutschland</strong> leben <strong>und</strong> ebenfalls<br />
auf Arbeit angewiesen sind. Die Bereitstellung<br />
<strong>und</strong> Besetzung zusätzlicher<br />
Ausbildungsplätze durch Geflüchtete<br />
soll daher bei TÜV Rheinland keine einmalige<br />
Maßnahme bleiben. Durch den<br />
Beitritt zur Initiative „wir zusammen“, einem<br />
Netzwerk, das das Engagement von<br />
Unternehmen für Geflüchtete bündelt<br />
<strong>und</strong> auf einer gemeinsamen Plattform<br />
präsentiert, bekennen wir uns öffentlich<br />
zur Fortführung unserer Maßnahmen.<br />
So sollen für das Ausbildungsjahr 2017<br />
neue Ausbildungsplätze an weiteren<br />
deutschen Standorten TÜV Rheinlands<br />
geschaffen werden. Auch die in Köln<br />
gestarteten Integrationspatenschaften<br />
sind schon jetzt ein Erfolgsmodell. Derzeit<br />
noch als lokales Pilotprojekt, sollen<br />
Patenschaften sukzessive auf weitere<br />
Ausbildungs-Standorte in <strong>Deutschland</strong><br />
ausgeweitet werden.<br />
Mit seinem Engagement für Geflüchtete<br />
hat TÜV Rheinland einen Weg eingeschlagen,<br />
der zahlreiche Akteure auf unbekanntem<br />
Terrain zusammenbringt. Nur<br />
wenn wir voneinander lernen, langfristig<br />
zusammenarbeiten <strong>und</strong> uns unterstützen,<br />
kann Menschen, die vor Krieg <strong>und</strong> Verfolgung<br />
fliehen mussten, ein solides F<strong>und</strong>ament<br />
für ihr zukünftiges Berufsleben<br />
geboten werden <strong>und</strong> eine erfolgreiche<br />
Integration in den Arbeitsmarkt gelingen.<br />
TÜV Rheinland möchte Perspektiven<br />
schaffen: jetzt <strong>und</strong> in Zukunft.<br />
„Die Integration von Geflüchteten ist ein<br />
langer Weg <strong>und</strong> der Zugang zum deutschen<br />
Arbeitsmarkt stellt einen wesentlichen<br />
Pfeiler dar. Eine hervorragende<br />
Ausgansposition bietet eine solide<br />
Berufsausbildung, deren Erfolg wir durch<br />
flankierende Integrations- <strong>und</strong> Förderprogramme<br />
sicherstellen wollen.“<br />
Thomas Biedermann, Personalvorstand <strong>und</strong><br />
Arbeitsdirektor der TÜV Rheinland AG<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
111
Good Practice<br />
Die Mitarbeiter mitnehmen<br />
– Arbeit 4.0<br />
Steigender Wettbewerbsdruck, drohender Stellenabbau <strong>und</strong> schleichende Übernahme von<br />
menschlichen Tätigkeiten durch Roboter bereiten vielen Sorge. Oft zu Unrecht, denn durch<br />
Industrie 4.0 bedingte Entwicklungen bringen bei den künftigen Tätigkeiten von Arbeitnehmern<br />
vielmehr neue Kompetenzprofile hervor. So warten anspruchsvollere Aufgaben mit höherer<br />
Wertschöpfung <strong>und</strong> mehr Abwechslung. Die individuelle Expertise wird dabei <strong>im</strong>mer mehr an<br />
Bedeutung gewinnen. Wissensaneignung <strong>im</strong> Beruf stellt künftig keinen temporären, sondern<br />
einen dauerhaft wiederkehrenden Vorgang dar.<br />
Von Dr. Eberhard Niggemann,<br />
Leiter Weidmüller Akademie<br />
Insgesamt wird durch die Digitalisierung<br />
eine Vielzahl neuer Geschäftsfelder<br />
<strong>und</strong> Arbeitsplätze geschaffen. Da<br />
gerade <strong>Deutschland</strong> prädestiniert ist,<br />
durch Industrie 4.0 die Wettbewerbsfähigkeit<br />
deutlich zu steigern, wird sich<br />
die Arbeitskräftebilanz wahrscheinlich<br />
sogar ins Plus verschieben. Zwar werden<br />
nach Untersuchungen des Instituts<br />
für Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Berufsforschung<br />
(IAB) durch den digitalen Wandel in<br />
<strong>Deutschland</strong> in den kommenden Jahren<br />
ca. 490.000 Jobs mit niedriger Qualifikation<br />
entfallen, darunter viele Routinearbeiten,<br />
aber auch körperlich schwere<br />
<strong>und</strong> gefährliche Arbeit. Dem gegenüber<br />
stehen aber auch 430.000 neue Stellen.<br />
Diese neuen Jobs entstehen vor allem<br />
<strong>im</strong> Bereich der Informationstechnologie,<br />
in naturwissenschaftlichen Berufen, in<br />
der Unternehmensberatung sowie in<br />
der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung, der in den<br />
kommenden Jahren eine entscheidende<br />
Rolle zukommen wird.<br />
Bei Weidmüller, dem Elektrotechnikspezialisten<br />
aus Detmold ist man sich<br />
bewusst, dass Industrie 4.0 frühzeitig in<br />
112 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
die Entwicklung von Mitarbeitern integriert<br />
werden muss, damit der Wandel<br />
hin zur Smart Factory gelingen kann. In<br />
der unternehmenseigenen Weidmüller<br />
Akademie wurde bereits das Aus- <strong>und</strong><br />
Weiterbildungskonzept auf das Zukunftsthema<br />
ausgerichtet. Das Ziel ist<br />
es, Mitarbeiter so früh wie möglich für<br />
das Thema zu begeistern. Denn man<br />
hat bei Weidmüller erkannt, dass das<br />
lebenslange <strong>und</strong> selbstgesteuerte Lernen<br />
deutlich an Bedeutung gewinnen wird.<br />
Bei Industrie 4.0 kommt es auf fachübergreifendes<br />
Wissen, Verständnis für<br />
die Arbeits- <strong>und</strong> Denkweisen korrespondierender<br />
Disziplinen <strong>und</strong> Denken<br />
in übergreifenden Prozessen an. Der<br />
Mitarbeiter muss zusätzlich zu seiner<br />
jeweiligen Fachkompetenz mit Spezialwissen<br />
mehr Systemwissen aufbauen. Bei<br />
den neuen Lernmustern, die in der Akademie<br />
entwickelt wurden, geht es mehr<br />
<strong>und</strong> mehr in Richtung informelles <strong>und</strong><br />
interaktives Lernen. Lernen via Tablet<br />
oder Smartphone kann überall <strong>und</strong> zu<br />
jeder Zeit stattfinden. Auch dies fußt auf<br />
der Erkenntnis, dass neue Mult<strong>im</strong>edia-,<br />
Social Media- <strong>und</strong> Cloud-Technologien<br />
das Lernen weiter verstärken <strong>und</strong> revolutionieren<br />
werden.<br />
Hightech-Assistenzsysteme <strong>im</strong><br />
Testeinsatz<br />
Bei Weidmüller hat die Industrie 4.0<br />
längst in den Arbeitsalltag Einzug gehalten.<br />
Schon seit 2011 hat das Unternehmen<br />
ein intelligentes Energiemanagement<br />
eingeführt, das Teil des „Fertigungsalltags“<br />
geworden ist. Derzeit<br />
werden verschiedene Pilotprojekte durchgeführt.<br />
Außerdem testen der hausinterne<br />
Bereich Continuous Improvement<br />
<strong>und</strong> die Instandhaltung gemeinsam den<br />
Einsatz von Augmented Reality <strong>und</strong> die<br />
praktische Verwendung virtueller Datenbrillen<br />
für die Produktion. Mit deren<br />
Hilfe können Bilder auf einen Computer<br />
übertragen werden. Das ist vor allem<br />
in der globalen Instandhaltung für die<br />
Themen Fernwartung <strong>und</strong> Reparatur<br />
interessant.<br />
Dazu gehören neben dem Einsatz von<br />
Datenbrillen auch Mensch-Maschine-<br />
Kollaborationen mit Robotern sowie<br />
der Umgang mit selbstopt<strong>im</strong>ierenden<br />
Systemen. Bei der Mensch-Maschinen-<br />
Kollaboration stieß bei ersten Versuchen<br />
in der Montage die Zusammenarbeit mit<br />
dem Roboter auf eine hohe Akzeptanz.<br />
Das liegt unter anderem an den vorhersehbaren<br />
Bewegungen des Roboters<br />
<strong>und</strong> der Vorgabe der Arbeitsgeschwindigkeit<br />
durch die Mitarbeiterinnen <strong>und</strong><br />
Mitarbeiter.<br />
Hochtechnologie am Puls der Zeit<br />
Ein weiteres Projekt ist das Computer<br />
Aid Facility Management (CAFM), bei<br />
dem mithilfe der Software visTable die<br />
opt<strong>im</strong>ale Aufstellung einer zukünftigen<br />
Fabrik am Computer geplant werden<br />
kann. Auf Knopfdruck können Engpässe<br />
<strong>im</strong> Materialfluss sichtbar <strong>und</strong><br />
Flächen bilanziert werden. Darüber<br />
hinaus beschäftigt sich Weidmüller mit<br />
den Möglichkeiten des 3D-Drucks <strong>und</strong><br />
der Maschinendatenerfassung (BDE).<br />
Knapp 210 Maschinen an den weltweiten<br />
Standorten sind zur Datenerfassung<br />
an ein Monitoring angeschlossen. Mithilfe<br />
der Daten werden wichtige Rückschlüsse<br />
gezogen, was in den einzelnen<br />
Produktionsprozessen überflüssig ist.<br />
So wird die gesamte Wertschöpfung<br />
verbessert.<br />
Neben der Einführung der Funktion<br />
des „Chief Digital Officers“ wurde <strong>im</strong><br />
Juli dieses Jahres eine neue Abteilung<br />
„<strong>Global</strong> Factory Digitalization and Intelligence“<br />
geschaffen. Zu den Aufgaben<br />
gehören vor allem die Integration von<br />
Industrie 4.0-Technologien in die globale<br />
Supply Chain, die standortübergreifende<br />
Abst<strong>im</strong>mung <strong>und</strong> Koordination dieser<br />
Themen, die Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung<br />
der Roadmap sowie die Bündelung<br />
der verschiedenen Aktivitäten.<br />
Veränderte Arbeitswelten<br />
Arbeit 4.0 zeichnet sich aber vor allem<br />
durch Interdisziplinarität aus. Durch<br />
Kooperationen mit Hochschulen gibt es<br />
eine Vielzahl von Abschluss- <strong>und</strong> Projektarbeiten,<br />
in denen Studierende <strong>und</strong><br />
Professoren mit Weidmüller-Mitarbeitern<br />
zusammenarbeiten. So wird kontinuierlich<br />
Know-how <strong>im</strong> Unternehmen aufgebaut.<br />
Im Zuge einer Kooperation mit der<br />
Hochschule OWL wird seit <strong>2016</strong> ein neuer,<br />
praxisorientierter Dualer Studiengang<br />
„Technische Informatik“ angeboten. Er<br />
fokussiert auf eine noch stärkere Hybridisierung<br />
der Wissensfelder Technologie<br />
<strong>und</strong> Software. In weiteren Initiativen<br />
<strong>und</strong> Arbeitsgruppen mit Hochschulen<br />
können anwendungsorientierte Weiterbildungsmodule<br />
aus der Hochschule<br />
für das Unternehmen entwickelt <strong>und</strong> in<br />
die verschiedenen Ausbildungskonzepte<br />
integriert werden.<br />
Doch nicht nur für den Nachwuchs, auch<br />
für erfahrenere Mitarbeiter wurden Modelle<br />
entwickelt, um die Fachexpertise<br />
langjähriger Kollegen opt<strong>im</strong>al nutzen zu<br />
können. Bereits zehn Jahre vor dem tatsächlichen<br />
Renteneintritt können bspw.<br />
verschiedene Freizeitmodule genommen<br />
werden. So werden die Regenerationsphasen<br />
in den letzten Arbeitsjahren<br />
erhöht <strong>und</strong> damit Arbeitsfähigkeit <strong>und</strong><br />
Arbeitsfreude nachhaltig gesteigert. „Unser<br />
Interesse war, vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
des demografischen Wandels ein Programm<br />
zu schaffen, das es uns ermöglicht,<br />
gute Fach- <strong>und</strong> Führungskräfte<br />
länger <strong>im</strong> Berufsleben zu halten“, erläutert<br />
Andreas Uhlitz, Leiter Personal /<br />
Gr<strong>und</strong>satzfragen bei Weidmüller. Neben<br />
der klassischen Teilzeitlösung gibt es<br />
auch die Möglichkeit, den Jahresurlaub<br />
zu erhöhen, dre<strong>im</strong>onatige Sabbaticals<br />
zu nutzen oder eine Viereinhalb-Tage-<br />
Woche in Anspruch zu nehmen. Ergänzt<br />
wird das Programm durch Module aus<br />
dem Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsmanagement,<br />
an dem auch die (Ehe-)Partner<br />
teilnehmen können. Uhlitz: „Wir haben<br />
länger hochmotivierte <strong>und</strong> leistungsfähige<br />
Mitarbeiter.“<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
113
Agenda<br />
Die Nachhaltigen<br />
Die Staats- <strong>und</strong> Regierungschefs von 193 Mitgliedstaaten<br />
der Vereinten Nationen haben sich<br />
am 25. September 2015 auf einen Katalog von<br />
17 nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs nach<br />
dem englischen Akronym) geeinigt. Mit diesem<br />
Zielkatalog sollen bis zum Jahr 2030 Armutsreduzierung,<br />
Umweltschutz <strong>und</strong> nachhaltiges<br />
Wirtschaften weltweit vorangetrieben werden.<br />
Eine besondere Rolle kommt dabei der Wirtschaft<br />
zu: Unternehmen sollen mehr gesellschaftliche<br />
Verantwortung übernehmen – durch<br />
Innovationen, Wachstum <strong>und</strong> faire Produkte<br />
sowie Arbeitsbedingungen. Was auf dem Papier<br />
plausibel klingt, ist in der Praxis oft kompliziert.<br />
Das Deutsche <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk ist hier<br />
ein wichtiger <strong>und</strong> hilfreicher Begleiter.<br />
114 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
SDGs<br />
Entwicklungsziele (SDGs)<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
115
Agenda<br />
Netzwerken<br />
zum Wohl von Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Weltgemeinschaft<br />
Der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> ist die weltweit größte <strong>und</strong> wichtigste Initiative für unternehmerische<br />
Verantwortung <strong>und</strong> Nachhaltigkeit. Angesichts riesiger Aufgaben wie den UN-Entwicklungszielen<br />
<strong>und</strong> globalen Herausforderungen wie Kl<strong>im</strong>awandel <strong>und</strong> Ressourcenverknappung<br />
kommt es in den nächsten Jahren besonders auf solche Organisationen an. Hier bündeln sich<br />
Größe <strong>und</strong> Glaubwürdigkeit zu einem wichtigen Umsetzungshebel. Wir sprachen darüber mit<br />
Marcel Engel, dem neuen Leiter des Deutschen <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerks.<br />
Von Dr. Elmer Lenzen<br />
Hallo Marcel, du bist von der international ausgerichteten Organisation<br />
WBCSD zum Deutschen <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk (DGCN)<br />
gewechselt. Was ist anders? Was ist ähnlich?<br />
Beide Organisationen fördern unternehmerische Verantwortung<br />
sowie den Beitrag der Wirtschaft zur nachhaltigen Entwicklung<br />
entlang der Sustainable Development Goals (SDGs). Dies ist<br />
der gemeinsame Nenner. Ein wichtiger Unterschied besteht<br />
darin, dass der WBCSD ein von Großunternehmen getragener<br />
Verband ist, während das DGCN − als lokales Netzwerk des UN<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> − eine von den Vereinten Nationen legit<strong>im</strong>ierte<br />
Multi-Stakeholder-Plattform ist, in welcher neben Großunternehmen<br />
auch KMUs, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft <strong>und</strong><br />
die Politik vertreten sind. Ein zweiter wichtiger Unterschied<br />
ist natürlich, dass der WBCSD eine globale Ausrichtung hat,<br />
während das DGCN vor allem auf nationaler Ebene agiert,<br />
wenngleich wir zunehmend auch mit deutschen Unternehmen<br />
<strong>und</strong> deren Zulieferern <strong>im</strong> Ausland zusammenarbeiten.<br />
Da globale Initiativen der lokalen Umsetzung bedürfen, <strong>und</strong><br />
wir auch viele mittlere <strong>und</strong> kleine Unternehmen zu unseren<br />
Teilnehmern zählen, sind die Aktivitäten des DGCN wesentlich<br />
praxisorientierter ausgerichtet.<br />
Die Teilnahme am DGCN ist freiwillig, aber viele der Themen, die<br />
hier behandelt werden, sind es längst nicht mehr. Sei es die EU-<br />
Berichtspf licht, Kinderarbeitsauf lagen aus UK <strong>und</strong> natürlich die<br />
Dekarbonisierungsthematik <strong>im</strong> Nachgang zum Pariser Kl<strong>im</strong>abeschluss.<br />
Inwieweit verändert diese Pf licht <strong>und</strong> damit ja auch der Zwang den<br />
Charakter <strong>und</strong> die Arbeitsweise einer Initiative wie dem DGCN?<br />
Richtig ist, dass der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> von Anfang an auf<br />
Freiwilligkeit der Teilnehmer setzte <strong>und</strong> auch weiter setzen<br />
wird − das heißt aber nicht, dass alle der <strong>im</strong> <strong>Compact</strong><br />
behandelten Themen ebenfalls freiwillig sind <strong>und</strong> sein<br />
müssen: <strong>im</strong> Gegenteil, Arbeitsstandards oder Korruptionsbekämpfung<br />
sind seit jeher in fast allen Ländern der Welt<br />
<strong>im</strong> Gesetz festgeschrieben. Ich würde behaupten, dass durch<br />
den nun zunehmenden Pflichtcharakter, auch etwa <strong>im</strong> Bereich<br />
Menschenrechte, das Interesse eher gestiegen ist. Wir<br />
können nun auch Unternehmen erreichen, die sich bislang<br />
noch nicht ernsthaft der Nachhaltigkeitsthematik gewidmet<br />
haben. Somit n<strong>im</strong>mt auch deren Bedarf an Unterstützung<br />
in der Wahrnehmung ihrer neuen Pflichten zu. Im DGCN<br />
versuchen wir dieser Nachfrage mit angepassten Lern- <strong>und</strong><br />
Dialogformaten zu begegnen, die sich an Unternehmen<br />
116 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
SDGs<br />
ZUR PERSON<br />
Am 1. April <strong>2016</strong> übernahm Marcel Engel die Leitung der<br />
Geschäftsstelle des Deutschen <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerks<br />
(DGCN) in Berlin. Er bringt über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung<br />
in der Zusammenarbeit der Entwicklungshilfe<br />
mit der Wirtschaft mit. Durch seine langjährige Tätigkeit<br />
be<strong>im</strong> World Business Council for Sustainable Development<br />
(WBCSD) in Genf greift er auf f<strong>und</strong>ierte Erfahrungen in<br />
der Förderung verantwortungsvoller <strong>und</strong> nachhaltiger<br />
Unternehmensführung zurück <strong>und</strong> bringt diese <strong>im</strong> DGCN<br />
ein. Be<strong>im</strong> WBCSD baute er als Führungskraft das globale<br />
Netzwerk von Partnerorganisationen auf. Gleichzeitig<br />
führte er zahlreiche Projekte in enger Zusammenarbeit<br />
mit weltweit tätigen Unternehmen. Schwerpunktthemen<br />
waren dabei unter anderem Armutsbekämpfung, Einkommensbeschaffung,<br />
Menschenrechte <strong>und</strong> Reporting.<br />
unterschiedlichen Wissens- <strong>und</strong> Erfahrungsstands in der<br />
Umsetzung von Sozial- <strong>und</strong> Umweltstandards richten. Dazu<br />
gehören sowohl allgemeine Online-Seminare für Einsteiger<br />
wie auch Trainings für fortgeschrittene Anwender oder Peer-<br />
Learning Groups, in welchen sich führende Unternehmen<br />
zu Best Practices austauschen können.<br />
Da möchte ich nachhaken: Für viele Teilnehmer ist die Beteiligung<br />
am <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> etwas, mit dem sie sich positiv hervortun können.<br />
Manche nutzen CSR sogar als ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber<br />
Wettbewerbern. Wenn jetzt aber alle zu verantwortlichem Handeln<br />
gedrängt werden, dann ist CSR ja nichts besonderes mehr. Welchen<br />
Anreiz gibt es dann für weitere Akteure, vor allem aus dem Mittelstand,<br />
sich be<strong>im</strong> DGCN zu beteiligen?<br />
Es ist nicht unser Ziel, Unternehmen zu gewinnen, damit<br />
diese sich mit dem UN-Logo schmücken können, sondern<br />
um sie zu unterstützen, sich kontinuierlich zu verbessern.<br />
Die Teilnahme am <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> ist mit einer Selbstverpflichtung<br />
der Unternehmen verb<strong>und</strong>en, die zehn Prinzipien<br />
des <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> zu Menschenrechten, Arbeitsnormen,<br />
Umweltschutz <strong>und</strong> Korruptionsbekämpfung umzusetzen −<br />
<strong>und</strong> jährlich über ihre Fortschritte zu berichten. Andernfalls<br />
droht der Ausschluss, <strong>und</strong> dies traf auch schon über 5.000<br />
Teilnehmer seit Gründung der Organisation <strong>im</strong> Jahr 2000.<br />
Das gibt der Initiative Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> wird auch<br />
in Zukunft ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des UN<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> sein. Im Übrigen ist der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
von ursprünglich 50 Gründungsmitgliedern <strong>im</strong> Jahr 2000<br />
kontinuierlich auf heute über 13.000 Teilnehmer gewachsen.<br />
Auch in <strong>Deutschland</strong> hatten wir einen Zuwachs von über<br />
zehn Prozent <strong>im</strong> letzten Jahr auf nunmehr knapp 450 Teilnehmer<br />
− über 80 Prozent davon Unternehmen. Ein weiterer<br />
wichtiger Faktor für den Zuwachs ist sicherlich, dass der<br />
„Business Case“ für Unternehmen <strong>im</strong>mer offensichtlicher<br />
wird: verantwortungsvolle Unternehmen min<strong>im</strong>ieren ihre<br />
Risiken, indem sie gegen kostspielige <strong>und</strong> rufschädigende<br />
Vergehen gegen Arbeitnehmer oder die Umwelt vorbeugen;<br />
sie können neue Geschäftsmöglichkeiten entwickeln, indem<br />
sie innovative Technologien <strong>und</strong> Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen<br />
entwickeln; <strong>und</strong> schließlich werden<br />
sie auch erfolgreicher be<strong>im</strong> Rekrutieren der hart umkämpften<br />
Talente auf dem Arbeitsmarkt sein, die ein Unternehmen<br />
mit gutem Ruf vorziehen werden. >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
117
Agenda<br />
UN-Entwicklungsziele<br />
Mit den UN-Entwicklungszielen (SDGs) haben wir auf internationaler<br />
Ebene bis 2030 einen politischen Handlungsrahmen mit klarem<br />
Mandat. Der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> versteht seine Aufgabe darin, die<br />
SDGs in Wirtschaftssprache zu übersetzen. Kannst du uns diesen<br />
Übersetzungsauftrag erläutern? Was heißt das konkret?<br />
Als in der UN verankerte Organisation hat der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
tatsächlich ein Mandat erhalten, Unternehmen bei der<br />
Auslegung <strong>und</strong> Umsetzung der SDGs zu unterstützen. Und<br />
es ist essenziell, die Wirtschaft einzubinden, da ohne deren<br />
Innovations- <strong>und</strong> Investitionskraft die ambitionierten Ziele für<br />
eine gerechtere <strong>und</strong> nachhaltige Welt nicht erreicht werden<br />
können. Daher sind wird auf globaler wie nationaler Ebene<br />
bestrebt, die SDGs den Unternehmen schrittweise näherzubringen.<br />
Dabei geht es zunächst einmal darum, die Relevanz<br />
einzelner SDGs für Unternehmen zu erläutern, sowohl in Bezug<br />
auf Risiken als auch auf Chancen, die je nach Land <strong>und</strong> Sektor<br />
erheblich variieren können. Wir haben auch mehrere konkrete<br />
Fallbeispiele von Unternehmen <strong>im</strong> DGCN dokumentiert,<br />
die ebenfalls als Referenz hilfreich sein können. Ebenso sind<br />
wir bestrebt, durch hochkarätige Großveranstaltungen <strong>und</strong><br />
regionale Roadshows in Zusammenarbeit mit verschiedenen<br />
Industrie- <strong>und</strong> Handelskammern Unternehmer für die SDGs<br />
zu sensibilisieren.<br />
Wenn man die SDGs zu Ende denkt, ist das ja nicht ohne: Der <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> steht ursprünglich für den defensiven Gedanken „do<br />
no harm“. Es geht also darum, so zu wirtschaften, dass künftige<br />
Generationen möglichst viele Optionen behalten. Die SDGs wiederum<br />
bedeuten „be part of the change“. Unternehmen sollen also offensiv<br />
die Welt <strong>und</strong> die Situation künftiger Generationen ändern. Sind<br />
das nicht komplett neue Spielregeln?<br />
Es bleibt aber <strong>im</strong>mer ein Vakuum politischer Legit<strong>im</strong>ation. Unternehmen<br />
sind nicht legit<strong>im</strong>iert, politische Aufgaben zu übernehmen. Aber<br />
kommen wir nicht unweigerlich in solche Fahrwasser, wenn Firmen<br />
in den Feldern Bildung, Ges<strong>und</strong>heit, Sicherheit staatliche Aufgaben<br />
übernehmen? Gerade auch in Staaten mit schwacher Staatlichkeit?<br />
Die SDGs wurden einst<strong>im</strong>mig von der Weltgemeinschaft<br />
verabschiedet, repräsentieren daher einen breiten Konsens<br />
<strong>und</strong> haben einen hohen Grad an Legit<strong>im</strong>ität, auf die sich<br />
auch Unternehmen berufen können. Die Herausforderung<br />
ist vielmehr, Unternehmen substanzieller an der Umsetzung<br />
der SDGs zu beteiligen − nicht, sie davon abzuhalten.<br />
Dies bedarf zum einem Partnerschaften mit Regierungen<br />
<strong>und</strong> der Zivilgesellschaft, um Barrieren zu überwinden <strong>und</strong><br />
nachhaltigkeitsfördernde regulatorische <strong>und</strong> institutionelle<br />
Rahmenbedingungen zu schaffen. Es bedarf aber auch einer<br />
Bewusstseinsänderung in der Wirtschaft, verb<strong>und</strong>en mit<br />
dem Verständnis, dass die Umsetzung der SDGs letztendlich<br />
in ihrem eigenen Interesse ist. Wie eben erläutert, können<br />
Unternehmen Risiken min<strong>im</strong>ieren, neue Geschäftsmöglichkeiten<br />
entwickeln <strong>und</strong> ihre Reputation anhand der SDGs<br />
verbessern. Zudem gilt das englische Sprichwort: „business<br />
can´t succeed in a society that fails“. Insofern leisten die<br />
SDGs auch einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Verbesserung<br />
der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Form<br />
von stabileren Gesellschaften, wachsenden Märkten, besser<br />
ausgebildeten Arbeitskräften, effizienteren Institutionen <strong>und</strong><br />
der längerfristigen Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen,<br />
von denen viele Unternehmen abhängig sind.<br />
Bei den SDGs geht es nicht um ein „Entweder-oder“ sondern<br />
vielmehr um ein „Sowohl-als-auch“. Es muss vermieden werden,<br />
dass Unternehmen ihre Verantwortung vernachlässigen<br />
<strong>und</strong> sich die SDGs heraussuchen, die ihnen am besten passen<br />
− also sozusagen „Rosinenpicken“ betreiben. Das wäre absolut<br />
kontraproduktiv. Vielmehr geht es darum, zunächst einmal<br />
die negativen Folgen ihres unternehmerischen Handelns<br />
durch die konsequente Anwendung des Vorsorgeprinzips zu<br />
min<strong>im</strong>ieren − also dem „do no harm“. Dies fördert der UN<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> aktiv seit seiner Gründung, indem er Unternehmen<br />
unterstützt, die zehn Prinzipien zu Menschenrechten,<br />
Arbeitsnormen, Umweltschutz <strong>und</strong> Korruptionsprävention<br />
umzusetzen, die sich allesamt in den SDGs widerspiegeln.<br />
Auf bauend auf der Erfüllung ihrer Pflicht zum verantwortungsvollen<br />
Handeln unterstützt der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Unternehmen<br />
natürlich auch, neue Geschäftsmöglichkeiten <strong>im</strong><br />
Rahmen der SDGs zu identifizieren <strong>und</strong> zu nutzen, also <strong>im</strong><br />
„find opportunities“. Angesichts der dringend erforderlichen<br />
Privatinvestitionen zur Verwirklichung der SDGs gibt es viele<br />
Möglichkeiten für Unternehmen, durch innovative Produkte<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen nicht nur direkt zur Verwirklichung der<br />
SDGs beizutragen, sondern auch neue Märkte zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> zu erweitern. Eine klassische Win-win-Situation also.<br />
118 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
SDGs<br />
Lieferketten<br />
Im Moment wird die Nachhaltigkeits-Diskussion oft so geführt, als<br />
läge der Ball <strong>im</strong> Feld der Wirtschaft. Das gilt vor allem be<strong>im</strong> Thema<br />
Lieferkette. Das DGCN verstärkt deshalb sein Engagement <strong>im</strong> Ausland,<br />
hier vor allem in Südafrika <strong>und</strong> Indien. Was macht ihr dort?<br />
In der Tat werden Unternehmen in unserer vernetzten <strong>und</strong><br />
transparenten Gesellschaft nicht nur für ihre eigenen Aktivitäten<br />
zur Rechenschaft gezogen, sondern zunehmend auch<br />
für die ihrer Zulieferer. Daher ist die Lieferkettenthematik ins<br />
Zentrum der Aufmerksamkeit geraten, nicht zuletzt infolge<br />
von tragischen Unfällen oder Vergehen, die die Lieferketten<br />
einer breiten Palette von Sektoren betroffen hat, u. a. in der<br />
Textilindustrie, in der Forstwirtschaft, in Verbindung mit<br />
gewissen Rohstoffen − wie Diamanten <strong>und</strong> Rohöl − oder Agrarprodukten<br />
− wie Kakao <strong>und</strong> Palmöl.<br />
Daher bezieht sich bereits seit einiger Zeit ein Großteil unserer<br />
Aktivitäten <strong>im</strong> DGCN direkt auf die nachhaltige Gestaltung<br />
von Lieferketten, sei es über das Management von Scope 3 −<br />
Treibhausgasemissionen, Geschäftspartner-Compliance oder<br />
das Achten von Menschenrechten. Dabei bieten wir unsere<br />
Lern- <strong>und</strong> Austauschformate zunehmend auch <strong>im</strong> Ausland an,<br />
so zum Beispiel Trainings zur menschenrechtlichen Sorgfalt<br />
in der Lieferkette für deutsche Niederlassungen <strong>und</strong> ihre<br />
Zulieferer in Südafrika <strong>und</strong> Indien, die wir Ende <strong>2016</strong> durchgeführt<br />
haben. Extrem wertvoll waren dabei unsere <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong>-Partnernetzwerke vor Ort sowie die Auslandshandelskammern,<br />
bei denen wir die Trainings veranstaltet haben. Die<br />
sehr positive Resonanz zeigt uns, dass wir mit dem Ansatz<br />
durchaus richtig lagen <strong>und</strong> nun schauen müssen, wie wir<br />
diese Pilotformate weiter ausbauen.<br />
Lieferketten sind von Natur aus komplex <strong>und</strong> sensibel. Die klassischen<br />
Ref lexe angesichts von potenziellen Risiken sind Kontrollen,<br />
Sanktionsandrohungen, hierarchische Beziehungen. Kann man solche<br />
Geschäftsbeziehungen auch anders, intrinsischer organisieren, oder<br />
ist das Sozialromantik?<br />
Es gibt in Lieferbeziehungen für beide Seiten genügend handfeste<br />
Gründe, sich stärker für ein nachhaltiges Management<br />
zu engagieren − <strong>und</strong> wir sprechen hier vor allem von einem<br />
Engagement jenseits von Checklisten <strong>und</strong> strikten Kontrollen.<br />
Es gibt mittlerweile zahlreiche Beispiele von Firmen, die ihre<br />
Lieferkette nicht mehr alleine über Audits steuern, die oftmals<br />
diesen angesprochenen „hierarchischen“ Charakter haben<br />
<strong>und</strong> <strong>im</strong> schl<strong>im</strong>msten Fall dazu führen, dass der Zulieferer<br />
nur noch eine Liste abarbeitet, aber keine Sensibilität für die<br />
notwendigen Verbesserungen entwickelt.<br />
Vor allem gemeinsam gestaltete Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsformate<br />
sowohl für das Management der Zuliefererbetriebe als<br />
auch für die Arbeiterinnen <strong>und</strong> Arbeiter erweisen sich hier<br />
als sehr wertvolle Ergänzung. Weniger Fluktuation unter<br />
den Angestellten, geringere Anfälligkeit für Streiks bis hin zu<br />
verbesserter Produktivität: All das wurde von fortschrittlichen<br />
Unternehmen in diesem Kontext bereits nachweislich erreicht.<br />
Wir Deutschen neigen dazu, unsere eigene Rolle in der Welt als sehr<br />
stark <strong>und</strong> best<strong>im</strong>mend anzusehen, <strong>und</strong> für Lieferketten-Akteure heißt<br />
das, dass sie nach unseren Wünschen spuren sollen. Andere Länder<br />
haben aber ihre eigenen Ansichten, <strong>und</strong> viele Lieferanten sind alles<br />
andere als Lauf burschen. Wie können wir in der Praxis globale<br />
Lieferketten effektiv managen <strong>und</strong> dabei nationale <strong>und</strong> kulturelle<br />
Befindlichkeiten einfangen?<br />
Zunächst einmal beruhen die allermeisten Standards <strong>und</strong> Anforderungen<br />
an das nachhaltige Management von Lieferketten<br />
nicht auf deutschen Initiativen, sondern sind in internationalen<br />
Vereinbarungen festgeschrieben. Somit gelten sie gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
für die Zuliefererbetriebe genauso wie für die deutschen (<strong>und</strong><br />
anderen europäischen) Counterparts. Problematisch wird es für<br />
die Nachhaltigkeit in der Lieferkette ja besonders in Ländern<br />
mit schwachen legalen <strong>und</strong> institutionellen Rahmenbedingungen,<br />
in welchen also die Regierung entweder nicht in der<br />
Lage oder nicht willens ist, gewisse Standards festzuschreiben<br />
oder durchzusetzen. Wenn sich hier deutsche <strong>und</strong> internationale<br />
Unternehmen stärker engagieren, ist das erst einmal<br />
uneingeschränkt positiv zu bewerten. Um jedoch dann nicht<br />
in eine Rhetorik des „Wir gegen die“ abzurutschen <strong>und</strong> die<br />
Lieferanten nicht wie Lauf burschen zu behandeln, empfiehlt<br />
sich als Gr<strong>und</strong>konzept genau der vorhin angesprochene <strong>Fokus</strong><br />
auf die gemeinsame Gestaltung der Geschäftsbeziehungen.<br />
Bewusstseinsbildung, Dialog <strong>und</strong> gemeinsame Lernformate<br />
als Ausgangspunkt sind sicherlich vielversprechender als ein<br />
einmal jährliches Audit. >><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
119
Agenda<br />
<strong>Global</strong>isierung<br />
<strong>Global</strong>isierung ist das Stichwort für den letzten Themenblock. Der<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> entstand zur Jahrtausendwende in einer Zeit, als viel<br />
Angst vor der <strong>Global</strong>isierung herrschte. Heute sind wir wieder in so<br />
einer Situation. Sieht das DGCN sich als aktiven Teil einer Debatte<br />
um <strong>Global</strong>isierungsängste, Freihandelsabkommen <strong>und</strong> den neuen<br />
Nationalismus? Oder sind diese Themen nicht Teil der Agenda?<br />
Der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> wurde tatsächlich vom damaligen UN-<br />
Generalsekretär Kofi Annan ins Leben gerufen, um die Kräfte<br />
der Märkte mit universellen Idealen zu verbinden − <strong>und</strong> so<br />
sicherzustellen, dass die <strong>Global</strong>isierung auch den Benachteiligten<br />
<strong>und</strong> den zukünftigen Generationen zugutekommt.<br />
Der <strong>Global</strong>isierungsprozess hat ohne Frage maßgeblich dazu<br />
beigetragen, dass H<strong>und</strong>erte von Millionen Einwohner in<br />
Entwicklungs- <strong>und</strong> vor allem Schwellenländern der Armut<br />
entrinnen <strong>und</strong> ihre Lebensverhältnisse verbessern konnten.<br />
Allerdings haben sich die ökologischen Herausforderungen<br />
eher verschärft − ebenso wie die sozialen Ungleichheiten in<br />
vielen Ländern. Dies kombiniert mit einer diffusen Angst vor<br />
Überfremdung, gerade unter den sich vernachlässigt fühlenden<br />
Verlierern der <strong>Global</strong>isierung, trägt sicherlich dazu bei,<br />
dass rückwärtsgewandte, nationalistische Kräfte vielerorts an<br />
Auftrieb gewinnen. Dies ist natürlich ein zentrales Thema für<br />
den <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong>. Die konsequente Umsetzung der SDGs<br />
ist das beste Mittel, um der aufke<strong>im</strong>enden Abschottung, dem<br />
Nationalismus <strong>und</strong> dem Populismus entgegenzuwirken. In<br />
den SDGs ist der Teil der <strong>Global</strong>isierungsthematik enthalten,<br />
der bisher vernachlässigt wurde <strong>und</strong> dringend stärker in den<br />
<strong>Fokus</strong> gerückt werden muss, um <strong>im</strong> Sinne unseres Gründers,<br />
Kofi Annan, der <strong>Global</strong>isierung ein „menschliches“ (ich würde<br />
auch „ökologisches“ hinzufügen) Antlitz zu verleihen, bevor<br />
es zu spät ist.<br />
Der Gr<strong>und</strong>gedanke des <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> beruht auf Multi-Stakeholder-<br />
Beteiligung <strong>und</strong> Multilateralismus. Jetzt erleben wir aber eine Zeit,<br />
in der <strong>im</strong>mer weniger Bereitschaft herrscht, gemeinsame Lösungen<br />
zu finden. Politik <strong>und</strong> Wirtschaft sind stattdessen von Uneinigkeit<br />
best<strong>im</strong>mt. Konsens ist ein Fremdwort. Ist die Idee <strong>und</strong> auch das<br />
Ideal des <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> also noch zeitgemäß?<br />
Ich würde eher behaupten, dass sich unter allen Stakeholdern<br />
zahlreiche Akteure finden lassen, die an einer Zusammenarbeit<br />
für eine gerechtere <strong>und</strong> nachhaltigere Zukunft interessiert sind.<br />
Ein gutes Beispiel für eine effektive Zusammenarbeit in diesem<br />
Sinne stellt der dreijährige Vorbereitungsprozess der SDGs dar,<br />
an welchem Teilnehmer aus der Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Wirtschaft intensiv teilnahmen. Die SDGs wurden<br />
dann auch einst<strong>im</strong>mig von allen 193 UN-Mitgliedstaaten <strong>im</strong><br />
September des vorigen Jahres verabschiedet. Ganz <strong>im</strong> Sinne<br />
des SDG 17 geht es also darum, effektive Partnerschaften von<br />
gleichgesinnten Stakeholdern zu schaffen, um die Agenda<br />
2030 voranzutreiben − auch gegen Opposition. Also eine Art<br />
„Coalition of the Willing“, aber unter anderen Vorzeichen als<br />
denjenigen, unter denen dieser Begriff <strong>im</strong> letzten Jahrzehnt<br />
konzipiert wurde.<br />
Welche Impulse <strong>und</strong> Richtungsvorgaben erwartet respektive erhofft<br />
sich das DGCN vom neuen UN-Generalsekretär António Guterres?<br />
Als ehemaliger Regierungschef seines He<strong>im</strong>atlandes <strong>und</strong> Hoher<br />
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen bringt Guterres<br />
einen idealen Erfahrungsschatz <strong>und</strong> hohe Glaubwürdigkeit in<br />
die Position mit. Dass António Guterres zuletzt eine führende<br />
internationale Rolle in einer Thematik ausübte, die uns in<br />
<strong>Deutschland</strong> besonders intensiv beschäftigt, ist ein zusätzlicher<br />
Pluspunkt aus unserer Perspektive. Er wird der UN sicherlich<br />
neue Impulse geben, <strong>und</strong> wir erwarten, dass er ebenso wie<br />
seine Vorgänger zu einem enthusiastischen Unterstützer des<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> wird. Denn die effektive Einbindung der<br />
Wirtschaft für eine gerechtere <strong>und</strong> nachhaltigere Zukunft ist<br />
<strong>im</strong> Hinblick auf die erwähnten enormen sozio-ökonomischen,<br />
ökologischen <strong>und</strong> politischen Herausforderungen heute wichtiger<br />
denn je.<br />
Lieber Marcel, herzlichen Dank für das Gespräch.<br />
120 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
SDGs<br />
Berliner Forum:<br />
Auf dem Weg zur<br />
Umsetzung der SDGs<br />
Die Frage, wie die globalen Nachhaltigkeitsziele umgesetzt werden können, best<strong>im</strong>mte das<br />
inhaltliche Programm des diesjährigen Berliner Forums, welches das Deutsche <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
Netzwerk (DGCN) in Partnerschaft mit econsense veranstaltet hat. Mehr als 350 Gäste kamen,<br />
um sich über die SDGs sowie die Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu informieren<br />
<strong>und</strong> auszutauschen.<br />
Das Museum für Kommunikation in Berlin war Schauplatz der<br />
Impulse für Nachhaltigkeit − Berliner Forum <strong>2016</strong>. Marcel Engel,<br />
Geschäftsleiter des DGCN <strong>und</strong> Dr. Wolfgang Große Entrup,<br />
Vorstandsvorsitzender von econsense, konnten zahlreiche<br />
hochrangige Sprecher <strong>und</strong> Vertreter aus der Wirtschaft, der<br />
Politik <strong>und</strong> der Zivilgesellschaft in dem geschichtsträchtigen<br />
Gebäude begrüßen.<br />
Unter ihnen war auch Lise Kingo, die Exekutivdirektorin des<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong>, die es sich nicht nehmen ließ, für die<br />
Veranstaltung extra aus New York anzureisen. Sie attestierte,<br />
dass man einen guten Start nach der Verabschiedung der SDGs<br />
<strong>im</strong> vorigen Jahr hingelegt habe, <strong>und</strong> es nun darum gehen müsse,<br />
noch aktiver auf die Implementierung der Zielumsetzung in<br />
die tägliche Praxis hinzuarbeiten.<br />
Tanja Gönner, Vorstandsmitglied der Deutsche Gesellschaft<br />
für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, pflichtete<br />
ihr bei <strong>und</strong> sagte, dass es wichtig sei, nicht global mit einer<br />
Generallösung zu arbeiten, sondern länderspezifische<br />
Maßnahmen zu ergreifen − ganz <strong>im</strong> Geiste des Mottos des<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> „Making <strong>Global</strong> Goals Local Business“.<br />
Thomas Silberhorn, Staatssekretär <strong>im</strong> B<strong>und</strong>esministerium<br />
für wirtschaftliche Zusammenarbeit <strong>und</strong> Entwicklung (BMZ),<br />
unterstrich: „Es ist wichtig, dass sich die Wirtschaft unter dem<br />
Dach der Agenda 2030 versammelt.“<br />
In den Panels auf dem Berliner Forum diskutierten unter anderem<br />
Lenkungskreismitglieder des DGCN, wie Dr. Meike Niedbal<br />
von der Deutsche Bahn AG, die Rolle der Wirtschaft <strong>im</strong> Hinblick<br />
auf die Umsetzung der SDGs, Digitalisierung <strong>und</strong> Innovation.<br />
Dabei zeigten sie Antworten der Wirtschaft auf die Herausforderungen<br />
der Nachhaltigkeitsagenda sowie Verantwortung in<br />
globalen Lieferketten auf. Als Keynote-Speaker sprach Prof. Dr.<br />
Helge Braun, Staatsminister <strong>im</strong> B<strong>und</strong>eskanzleramt, über die<br />
Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Direktorin Lise Kingo (Mitte) <strong>und</strong> das<br />
Team der DGCN-Geschäftsstelle.<br />
DGCN <strong>und</strong> econsense konnten nicht nur wichtige Impulse mit<br />
Blick auf die Beteiligung der Wirtschaft bei der Umsetzung<br />
der SDGs setzen, sondern nutzten den Rahmen des Berliner<br />
Forums auch, um die Ergebnisse einer Umfrage bei 380 Firmen<br />
vorzustellen. Das Ergebnis ist, dass 52 Prozent der Befragten<br />
sich bereits mit den SDGs beschäftigen. Die fünf wichtigsten<br />
Themen sind Arbeitsbedingungen <strong>und</strong> Wachstum (Ziel 8),<br />
Innovation <strong>und</strong> Infrastruktur (Ziel 9), Kl<strong>im</strong>aschutz (Ziel 13),<br />
Bildung (Ziel 4) sowie bezahlbare Energie (Ziel 7).<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
121
Agenda<br />
Der<br />
„SDG Compass“<br />
in einer sich rasant<br />
verändernden Welt<br />
122 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
SDGs<br />
Ob Bevölkerungswachstum, Wohlstandsverteilung, Ressourcenverbrauch<br />
oder Kl<strong>im</strong>awandel − die Welt steht vor gewaltigen globalen Herausforderungen.<br />
Die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals<br />
− SDGs) setzen hierzu klare Ziele auf globaler, regionaler <strong>und</strong> lokaler Ebene, um<br />
den größten dieser Risiken entgegenzuwirken. Für Unternehmen bedeuten diese<br />
globalen Veränderungen zunächst einen enormen Anpassungsdruck. Aber sie<br />
können auch neue Aktionsfelder <strong>und</strong> Chancen beinhalten: In den Megatrends<br />
stecken für Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, sich zu positionieren <strong>und</strong> zu<br />
einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.<br />
Arbeiten mit dem SDG Compass<br />
Um Firmen die Integration der SDGs in ihre Strukturen <strong>und</strong><br />
die Umsetzung zielführender Maßnahmen zu erleichtern, hat<br />
der UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> in Zusammenarbeit mit der <strong>Global</strong><br />
Reporting Initiative (GRI) <strong>und</strong> dem World Business Council for<br />
Sustainable Development (WBCSD) einen Leitfaden erstellt, der<br />
in fünf Schritten Ansätze zur Ausrichtung unternehmerischen<br />
Handelns sowie Hilfestellungen zum Reporting bietet:<br />
Der „SDG Compass“ hilft, die UN-Entwicklungsziele anhand<br />
der unternehmensspezifischen Handlungsspielräume zu priorisieren<br />
<strong>und</strong> entsprechende Maßnahmen daraus abzuleiten.<br />
Der Leitfaden ist in fünf kurze Kapitel gegliedert, in denen er<br />
Wissen über die SDGs liefert <strong>und</strong> Instrumente zur Umsetzung<br />
bietet. Die fünf Kapitel sind gleichzeitig fünf aufeinander<br />
auf bauende Aktionsschritte:<br />
Schritt 1: Die SDGs verstehen<br />
Die SDGs sind letztendlich nicht philanthropisch, sondern<br />
auch <strong>im</strong> Eigeninteresse: Kein Unternehmen kann in einem<br />
Umfeld gut funktionieren, in dem die Probleme ungelöst<br />
bleiben. Im Umkehrschluss wird daraus der Business-Case<br />
für die SDGs: Diejenigen Unternehmen, die zur Umsetzung<br />
der SDGs beitragen, können sich durch Innovationen neue<br />
Marktfelder erschließen − etwa in der Erschließung neuer<br />
Ges<strong>und</strong>heitsversorgung. Sie erfüllen die Erwartungen, die von<br />
verschiedenen Seiten an sie gestellt werden <strong>und</strong> min<strong>im</strong>ieren<br />
damit Risiken, denen andere Unternehmen sich aussetzen. Sie<br />
nutzen die Potenziale erneuerbarer Energien <strong>und</strong> eines geringeren<br />
Ressourcenverbrauchs. Letztlich tragen sie durch stabilere<br />
Gesellschaften, mehr Marktteilnehmer <strong>und</strong> größere Märkte<br />
sowie Marktregelungen zur wirtschaftlichen Stabilität bei.<br />
1. SDGs verstehen,<br />
2. Die tatsächlichen Auswirkungen des Unternehmens priorisieren<br />
<strong>und</strong> den SDGs zuordnen,<br />
3. Konkrete Ziele sowie KPIs best<strong>im</strong>men, denen jeweils auch<br />
ein zeitlicher Rahmen zugeordnet wird <strong>und</strong> Bekenntnis zu<br />
den SDGs,<br />
4. Nachhaltigkeit <strong>im</strong> Kerngeschäft integrieren <strong>und</strong> dabei über<br />
die reine Funktionalität für das Unternehmen hinaus gehen<br />
sowie Partnerschaften mit anderen Organisationen eingehen,<br />
5. Über den Erfolg <strong>und</strong> die Herausforderungen berichten.<br />
Schritt 2: Prioritäten definieren<br />
Nachdem sich die Unternehmen in Schritt 1 mit den SDGs<br />
vertraut gemacht haben, geht es in Schritt 2 <strong>und</strong> 3 des „SDG<br />
Compass“ darum, die jeweiligen Handlungsprioritäten der<br />
Unternehmen zu identifizieren <strong>und</strong> diese mit Zielen zu versehen.<br />
Dazu sollten die Unternehmen zuerst eine Analyse ihrer<br />
positiven <strong>und</strong> negativen Auswirkungen auf die SDGs entlang<br />
der gesamten Wertschöpfungskette vornehmen. Die größten<br />
Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf die SDGs fallen<br />
meist in der Lieferkette (Rohmaterialien oder Produktion), der<br />
Logistik, dem Vertrieb oder der Nutzung der Produkte an. Eine<br />
Analyse der eigenen Wertschöpfungskette stellt sicher, dass<br />
die wichtigsten Möglichkeiten, aber auch Risiken, die sich aus<br />
den SDGs ergeben, wahrgenommen werden.<br />
>><br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
123
Agenda<br />
Unternehmen wählen dazu für jeden identifizierten Bereich<br />
mit (potenziell) großen Auswirkungen geeignete Indikatoren.<br />
Wenn möglich sollten hierbei Inputs (aufgewendete Ressourcen),<br />
Outputs (Resultat einer Aktivität wie Anzahl erreichter<br />
Menschen), Outcomes (Ergebnisse wie z. B. Änderungen <strong>im</strong><br />
Leben der durch die Unternehmensaktivitäten erreichten<br />
Menschen) <strong>und</strong> Impacts (langfristige Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten)<br />
gemessen werden. Allerdings sind<br />
Impacts schwierig zu messen, weil sie langfristig auftreten<br />
oder die Messbasis derzeit noch diskutiert wird. Falls die Auswirkungen<br />
tatsächlich zu schwierig zu messen sind, können<br />
Outputs oder Outcomes als Indikatoren nützlich sein.<br />
Darauf auf bauend können die Unternehmen unter Einbeziehung<br />
der Stakeholder dann ihre Handlungsprioritäten<br />
definieren. Dabei ist es wichtig, auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen<br />
wie etwa Frauen oder beeinträchtigte Personen<br />
zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Unternehmen den<br />
jeweiligen (länderspezifischen) Kontext beachten, in dem sie die<br />
Geschäftstätigkeit ausüben. Einerseits könnte das Unternehmen<br />
beispielsweise arbeitsintensive Aktivitäten in einem Land<br />
unterhalten, in dem die Löhne niedrig sind oder Arbeitsrechte<br />
nicht durchgesetzt werden. Andererseits können aber auch<br />
hergestellte Produkte oder angebotene Dienstleistungen die<br />
Lebensbedingungen von Menschen verbessern.<br />
Um Unternehmen den Einstieg in die Umsetzung der SDGs<br />
zu erleichtern, hat der UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> gemeinsam mit<br />
Partnern verschiedene Tools wie die „SDG Industry Matrix“<br />
entwickelt. Ziel der „SDG Industry Matrix“ ist es, über Maßnahmen<br />
zum Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele zu<br />
informieren <strong>und</strong> zu Umsetzungsideen anzuregen. Die Matrix<br />
wurde in dem Bewusstsein erstellt, dass die Möglichkeiten für<br />
Unternehmen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen,<br />
je nach Branche variieren. Sie enthält deshalb mehrere<br />
Publikationen mit Beispielen für die besten <strong>und</strong> effektivsten<br />
Möglichkeiten zur Umsetzung der SDGs aus spezifischer<br />
Branchenperspektive.<br />
Bislang sind Praxisbeispiele aus folgenden Branchen erhältlich:<br />
• Financial Services<br />
• Food, Beverage & Consumer Goods<br />
• Cl<strong>im</strong>ate Extract<br />
• Healthcare and Life Sciences<br />
• Industrial Manufacturing<br />
• Energy, Natural Resources, Chemicals (Consultation Draft)<br />
Schritt 3: Ziele setzen<br />
Jetzt kann sich das Unternehmen Ziele setzen, die zur Erreichung<br />
der SDGs beitragen. Ein Bekenntnis des Unternehmens<br />
zur Nachhaltigkeit <strong>und</strong> zu den SDGs ist glaubhafter, wenn<br />
entsprechende spezifische, messbare <strong>und</strong> zeitlich begrenzte<br />
Unternehmensziele vorliegen. Die ausgewählten KPIs, anhand<br />
derer der Fortschritt oder der Erfüllungsgrad der Ziele<br />
best<strong>im</strong>mt wird, müssen die Outcomes <strong>und</strong> Impacts der Unternehmensaktivitäten<br />
abbilden. Die Auswahl von Output- oder<br />
Outcome-Indikatoren als Ersatz für Impact-KPIs kann durch<br />
Stakeholder-Engagement verbessert oder gestärkt werden.<br />
Die 5 Schritte des SDG Compass<br />
als Wegweiser für die Integration<br />
verantwortungsvoller <strong>und</strong><br />
nachhaltiger Geschäftstätigkeit<br />
Schritt 4: Integration der SDGs in die<br />
Unternehmensstrategie<br />
Laut einer Befragung der Wirtschaftsprüfungs- <strong>und</strong> Beratungsgesellschaft<br />
PwC sind 71 Prozent der Unternehmen bereits<br />
dabei, ihren Umgang mit den SDGs zu planen, <strong>und</strong> 34 Prozent<br />
der Unternehmen haben bereits konkrete Pläne beschlossen<br />
<strong>und</strong> / oder sind dabei, diese umzusetzen. 37 Prozent der Unternehmen,<br />
die an der Befragung teilgenommen haben, arbeiten<br />
zurzeit an einer Strategie.<br />
5.<br />
Reporting<br />
4.<br />
Integration<br />
1. SDGs verstehen<br />
2. Prioritäten<br />
definieren<br />
3. Ziele<br />
setzen<br />
124 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
SDGs<br />
Schritt 5: SDGs kommunizieren<br />
Die Qualität <strong>und</strong> Quantität der globalen Nachhaltigkeitsberichterstattung<br />
hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Das<br />
ist freiwilligen Initiativen wie dem <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> <strong>und</strong> vor<br />
allem der <strong>Global</strong> Reporting Initiative (GRI) zu verdanken. Aber<br />
auch verstärkte Gesetzgebung wie die EU-CSR-Berichtspflicht<br />
tragen in großem Maße dazu bei.<br />
Die klassische Nachhaltigkeitsberichterstattung ist nicht 1:1<br />
auf eine SDG-Berichterstattung übertragbar. Hierfür sind<br />
Transferschritte notwendig. So haben sich UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
<strong>und</strong> GRI Ende September <strong>2016</strong> darauf verständigt, <strong>im</strong> Rahmen<br />
der Initiative „SDG Leadership through Reporting“ (https://www.<br />
globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/GRI-and-<br />
UN-<strong>Global</strong>-<strong>Compact</strong>-partner-to-shape-the-future-of-SDG-reporting.aspx)<br />
klare Regeln für das SDG-Reporting aufzustellen.<br />
Was macht einen SDG-Report aus?<br />
Der zentrale Unterschied be<strong>im</strong> SDG-Reporting zu anderen<br />
Nachhaltigkeitsberichtsformaten ist die deutlich erkennbare<br />
Kontextualisierung des eigenen Engagements mit relevanten<br />
globalen Entwicklungen <strong>und</strong> Zielen. So kann ein Unternehmen<br />
beispielsweise be<strong>im</strong> Thema Wasser seine eigenen Aktivitäten<br />
<strong>und</strong> die in seinen Lieferketten in den Verständnis- <strong>und</strong> Handlungskontext<br />
der SDGs „Zugang zu Wasser“ bzw. „Sanitäre<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung“ einbringen. Anhand dieser Ziele lassen<br />
sich die unternehmerischen Auswirkungen dann ganz konkret<br />
identifizieren <strong>und</strong> messen.<br />
Was ist die beste Ausgangslage für einen SDG-Report?<br />
Nach Ansicht des „SDG Compass“ sind besonders hilfreich für<br />
die SDG-Berichterstattung:<br />
1. Wesentlichkeit:<br />
Der Materialitätsansatz ermöglicht schon in der Gr<strong>und</strong>ausrichtung<br />
eine Einbindung der Themen, die <strong>im</strong> SDG-Prozess<br />
identifiziert wurden.<br />
2. Anschlussfähigkeit:<br />
Die Anknüpfung an GRI erlaubt, bestehende Managementstrukturen<br />
weiter zu nutzen, die Einbeziehung von Stakeholdern<br />
(stakeholder inclusiveness) sowie die gemeinsame<br />
Kommunikation der Ergebnisse.<br />
3. Messbarkeit:<br />
Darüber hinaus bieten verschiedene ISO-Standards die<br />
Möglichkeit, die SDGs klar in den Geschäftsprozess zu integrieren.<br />
Dazu zählen etwa ISO 14064 (Treibhausgase / GHG-<br />
Protokoll), ISO 50001 (Energie Management), ISO 14001<br />
(Umwelt-Management). Mittelständische Unternehmen, die<br />
eine umfangreiche ISO-Implementierung scheuen, sollten<br />
die nicht-zertifizierbare ISO-Norm 26000 in Betracht ziehen:<br />
Sie bietet ergänzend oder sogar alternativ zu GRI gute<br />
Möglichkeiten, die SDGs thematisch <strong>und</strong> auf Prozessebene<br />
einzufangen.<br />
Tipps zur Integration der SDGs in Ihrem Unternehmen<br />
Unternehmen, die die SDGs umsetzen wollen, sollten folgende Schritte beachten:<br />
• Entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich für Ihr Unternehmen<br />
aus den SDGs ergeben. Verbinden Sie diese mit Ihrer CSRoder<br />
Nachhaltigkeitsstrategie!<br />
• Nutzen Sie die Wesentlichkeitsanalyse Ihrer tatsächlichen<br />
Unternehmensauswirkungen als wichtige Voraussetzung für<br />
die Priorisierung der SDGs.<br />
• Identifizieren Sie aufbauend auf den zehn Prinzipien des<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> die Möglichkeiten, die sich aus den SDGs<br />
für Ihr Unternehmen ergeben. Analysieren Sie, welche Ziele<br />
für Ihr Unternehmen relevant sind.<br />
• Leiten Sie daraus ein strategisches Konzept <strong>und</strong> unternehmerische<br />
Maßnahmen ab. Mit welchen Kompetenzen <strong>und</strong><br />
Maßnahmen kann Ihr Unternehmen zur Lösung der globalen<br />
Herausforderungen beitragen?<br />
• Diese Maßnahmen haben sich bewährt: die SDGs als wichtig<br />
kommunizieren; die SDGs explizit in die Wesentlichkeitsanalyse<br />
einbinden; die SDGs als Leitbild verwenden für spezifische<br />
<strong>und</strong> messbare langfristige Unternehmensziele; regelmäßige<br />
Berichterstattung über Fortschritte zu jedem Ziel sowie über<br />
weitere Schritte<br />
• Schulen Sie sich <strong>und</strong> Ihr Team! Die SDGs sind weniger abstrakt,<br />
wenn man sich z. B. die 169 Unterziele (Targets)<br />
anschaut. Mit Schulungsangeboten <strong>und</strong> dem SDG Compass<br />
zur Erstorientierung sowie Best Practices von großen Unternehmen<br />
werden Sie schnell herausfinden, welche konkreten<br />
Handlungsfelder sich für Sie ergeben.<br />
• Seien Sie kreativ <strong>und</strong> innovativ! Die Umsetzung der SDGs<br />
erfordert neue Wirtschaftsweisen, die für Sie ein neues <strong>und</strong><br />
lohnenswertes Geschäftsfeld bedeuten können.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
125
Praxisbeispiel<br />
Symrise: Umsetzung der SDGs<br />
Wie Unternehmen ihre Handlungsprioritäten definieren<br />
<strong>und</strong> darauf auf bauend Ziele zur Erreichung der SDGs setzen<br />
können, zeigt das Engagement der Symrise AG mit Sitz in<br />
Holzminden. Diese stellt Duft-, Geschmacks- <strong>und</strong> Wirkstoffe<br />
für Kosmetika <strong>und</strong> Lebensmittel her. Symrise bezieht<br />
sein Nachhaltigkeitsengagement auf das gesellschaftliche<br />
Umfeld, in dem sich das Unternehmen bewegt. Hier gilt es<br />
seiner ökologischen <strong>und</strong> sozialen Verantwortung so nachzukommen,<br />
dass sich sowohl das Unternehmen selbst <strong>und</strong><br />
seine K<strong>und</strong>en als auch die Mitarbeiter <strong>und</strong> die Gesellschaft<br />
positiv <strong>und</strong> nachhaltig darin entwickeln können. Gemäß dem<br />
eigenen Leitbild „Sharing Values“ wird dabei die gesamte<br />
Wertschöpfungskette − vom Rohstofflieferanten bis zum<br />
Endverbraucher − einbezogen, wie die Nachhaltigkeitsbilanz<br />
des Unternehmens informiert.<br />
Die Unternehmensstrategie stützt sich auf die vier Säulen der<br />
Nachhaltigkeitsagenda von Symrise: Footprint, Innovation,<br />
Sourcing <strong>und</strong> Care. In diesen Bereichen will das Unternehmen<br />
die negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit konsequent<br />
min<strong>im</strong>ieren <strong>und</strong> seinen gesellschaftlichen Mehrwert steigern.<br />
Auf diese Weise will Symrise aktiv zur Erreichung der SDGs<br />
beitragen. Ausformulierte kurz-, mittel- <strong>und</strong> langfristige Ziele<br />
messen die Umsetzung der Ambitionen.<br />
• Ziel „Footprint“<br />
Min<strong>im</strong>ierung des ökologischen Fußabdrucks entlang der<br />
gesamten Wertschöpfungskette, um Ressourcen zu schonen,<br />
die Umweltauswirkungen zu verringern <strong>und</strong> Risiken<br />
vorzubeugen.<br />
• Ziel „Innovation“<br />
Max<strong>im</strong>ierung des sozialen <strong>und</strong> ökologischen Mehrwerts<br />
der Produkte. Die konsequente Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien<br />
in der Produktentwicklung führt nicht nur zu<br />
ressourcenschonenden <strong>und</strong> geschäftssteigernden Effekten<br />
innerhalb der eigenen Wertschöpfung, sondern beeinflusst<br />
auch das Konsumentenverhalten positiv.<br />
• Ziel „Sourcing“<br />
Bleibenden Wert für die Mitarbeiter <strong>und</strong> Standortgemeinden<br />
generieren. Außerdem Stärkung der Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> Gemeinschaft, um neue Talente zu gewinnen <strong>und</strong> die<br />
Motivation der Mitarbeiter zu steigern.<br />
• Ziel „Care“<br />
Nachhaltige Entwicklung der Rohstoff-Beschaffung <strong>und</strong><br />
deren Lieferketten. Im Mittelpunkt stehen dabei eine stabile<br />
Versorgung mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen <strong>und</strong> die<br />
größtmögliche Transparenz <strong>und</strong> Kontrolle der ökologischen<br />
<strong>und</strong> sozialen Auswirkungen.<br />
Um die Relevanz der einzelnen SDGs <strong>und</strong> die Einflussmöglichkeiten<br />
von Symrise zu best<strong>im</strong>men, hat das Unternehmen<br />
eine diesbezügliche Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt.<br />
Die wesentlichen Themen<br />
Symrise hat die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen<br />
nach ihrem „Wert für die Gesellschaft“ <strong>und</strong> nach ihrem „Wert<br />
für Symrise“ eingeteilt <strong>und</strong> sie nach ihrem größten Potenzial<br />
für eine gemeinsame Wertschaffung identifiziert. Die Prioritäten<br />
der wichtigsten Anspruchsgruppen, zu denen K<strong>und</strong>en,<br />
Mitarbeiter, Aktionäre, Nachbarn, Politik, Nichtregierungsorganisationen<br />
<strong>und</strong> ihre Geschäftspartner gehören, hat Symrise<br />
dabei <strong>im</strong> Rahmen des am AA1000 Stakeholder Engagement<br />
Standards orientierten Stakeholder-Managements ermittelt.<br />
126 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Den Handlungsfeldern „Gewährleistung höchster Produktsicherheit“,<br />
„Anlagensicherheit“, „Einhaltung der Menschenrechte“<br />
<strong>und</strong> „Compliance“ wurde dabei ein höherer „Wert<br />
für Symrise“ zugeschrieben; neu ergänzt wurde zudem das<br />
Handlungsfeld „Tierwohl“.<br />
Neben der strategischen Orientierung dient die Identifikation<br />
wesentlicher Themen gleichzeitig zur Strukturierung der<br />
Berichterstattung gemäß den GRI G4-Leitlinien: Zu Themen,<br />
denen das Unternehmen einen hohen Wert sowohl für<br />
Symrise als auch für die Gesellschaft zugeordnet hat, wird<br />
vollständig berichtet. Über Themen, die eine hohe Relevanz<br />
in nur einer D<strong>im</strong>ension aufweisen, berichtet Symrise mit<br />
mindestens einem Indikator. Über die Nachhaltigkeitsleistungen<br />
<strong>und</strong> Kennzahlen wird in der Nachhaltigkeitsbilanz<br />
Rechenschaft abgelegt.<br />
In der Wesentlichkeitsmatrix vereint Symrise drei D<strong>im</strong>ensionen:<br />
So spiegelt die X-Achse den „Wert“ der jeweiligen Handlungsfelder<br />
für Symrise wider, während die Y-Achse den „Wert für<br />
die Gesellschaft“ aufzeigt. Die Größe der Handlungsfeldkreise<br />
gibt das Ausmaß der Erwartungen, die dem Handlungsfeld aus<br />
der Perspektive der Stakeholder zukommt, wider.<br />
Um die Auswirkungen von Symrise auf die jeweiligen SDGs<br />
zu bewerten, hat das Unternehmen die identifizierten Handlungsfelder<br />
bezüglich der vier Säulen der Nachhaltigkeitsagenda<br />
Footprint, Innovation, Sourcing <strong>und</strong> Care analysiert.<br />
Eine Matrix stellt den direkten <strong>und</strong> indirekten Einfluss von<br />
Symrise <strong>und</strong> die Höhe der Relevanz hinsichtlich der SDGs dar<br />
<strong>und</strong> führt sie entsprechend auf.<br />
Für die Säule „Footprint“ bedeutet dies beispielweise, dass<br />
Symrise durch seine Fortschritte innerhalb der definierten<br />
Handlungsfelder Ressourcenschonung <strong>und</strong> Emissionsreduzierung,<br />
effiziente Rohstoffnutzung <strong>und</strong> Erhalt der Biodiversität<br />
einen direkten Einfluss auf folgende SDGs hat, deren Relevanz<br />
für Symrise als hoch einzuschätzen ist:<br />
• SDG 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger<br />
<strong>und</strong> zeitgemäßer Energie für alle sichern,<br />
• SDG 8: Dauerhaftes, inklusives <strong>und</strong> nachhaltiges Wirtschaftswachstum,<br />
produktive Vollbeschäftigung <strong>und</strong> menschenwürdige<br />
Arbeit für alle fördern,<br />
• SDG 9: Eine belastbare Infrastruktur auf bauen, inklusive<br />
<strong>und</strong> nachhaltige Industrialisierung fördern <strong>und</strong> Innovationen<br />
unterstützen,<br />
• SDG 12: Für nachhaltige Konsum- <strong>und</strong> Produktionsmuster<br />
sorgen,<br />
• SDG 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des<br />
Kl<strong>im</strong>awandels <strong>und</strong> seiner Auswirkungen ergreifen,<br />
• SDG 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen <strong>und</strong><br />
ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften,<br />
Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung<br />
stoppen <strong>und</strong> umkehren <strong>und</strong> den Biodiversitätsverlust<br />
stoppen.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
127
Agenda<br />
Stiftung<br />
Deutsches <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk<br />
Mit der Stiftung hat das Deutsche <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk<br />
(DGCN) <strong>im</strong> Frühsommer 2009 ein Instrument geschaffen, über<br />
das sich die Teilnehmer auch finanziell an den kontinuierlich<br />
zunehmenden Aktivitäten des Netzwerks beteiligen können.<br />
Bis dato wurde das DGCN vor allem von der deutschen<br />
B<strong>und</strong>esregierung aus dem Etat des B<strong>und</strong>esministeriums für<br />
wirtschaftliche Zusammenarbeit <strong>und</strong> Entwicklung (BMZ) finanziert.<br />
Mit der Stiftung soll sich dies ändern: Die überwiegende<br />
Mehrheit der beteiligten Unternehmen hat zugest<strong>im</strong>mt, die<br />
gemeinsamen Aufgaben künftig zu möglichst gleichen Teilen<br />
aus privaten <strong>und</strong> öffentlichen Geldern zu finanzieren − <strong>und</strong><br />
so dem Anspruch einer unternehmensgetriebenen Multi-<br />
Stakeholder-Initiative voll gerecht zu werden.<br />
Die Stiftung fördert die Tätigkeiten des<br />
UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> <strong>und</strong> des DGCN.<br />
Sie verfolgt ausschließlich <strong>und</strong> unmittelbar gemeinnützige<br />
Zwecke. Die Stiftung ist weder rechtlich noch organisatorisch<br />
mit der in den USA registrierten <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Fo<strong>und</strong>ation<br />
verb<strong>und</strong>en, welche das New Yorker Büro <strong>und</strong> weltweite Aktivitäten<br />
des UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> unterstützt. Finanzierungsentscheidungen<br />
der DGCN-Stiftung werden vom Lenkungskreis<br />
des DGCN getroffen, der auch die drei Beiratsmitglieder stellt.<br />
Rechtliche Trägerin der Stiftung ist die Macenata Management<br />
GmbH. Die Stiftung ist damit unabhängig vom Focal Point<br />
des DGCN.<br />
Deutsche Unternehmen können entscheiden, wie sie am<br />
besten den <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> unterstützen möchten.<br />
Sie können an die nach deutschem Recht gemeinnützige <strong>und</strong><br />
daher steuerlich begünstigte DGCN-Stiftung spenden, die<br />
hauptsächlich die Arbeit in <strong>Deutschland</strong> fördert. Eine andere<br />
Möglichkeit ist die Unterstützung der US-amerikanischen <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> Fo<strong>und</strong>ation, welche in <strong>Deutschland</strong> steuerlich nicht<br />
begünstigt ist. Die Stiftung empfiehlt, beides zu kombinieren:<br />
Sie spenden einen Betrag in die deutsche DGCN-Stiftung<br />
<strong>und</strong> veranlassen die Stiftungsverwaltung, einen von Ihnen<br />
best<strong>im</strong>mten Teilbetrag als zweckgeb<strong>und</strong>ene Spende an die<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Fo<strong>und</strong>ation weiterzuleiten. Auf diese Weise<br />
bedeutet Ihre Unterstützung einen min<strong>im</strong>alen administrativen<br />
Aufwand für Ihr Unternehmen.<br />
Kontoinhaber:<br />
Stiftung Deutsches <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk<br />
Kto. Nr. 138412000<br />
BLZ: 700 303 00 (Bankhaus Reuschel)<br />
IBAN: DE75700303000138412000<br />
S.W.I.F.T-BIC: REUCDEMMXXX<br />
An der Ausrichtung <strong>und</strong> Arbeitsteilung der Arbeit <strong>im</strong> Deutschen<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Netzwerk ändert sich dadurch nichts: Alle<br />
inhaltlichen Entscheidungen verbleiben <strong>im</strong> Lenkungskreis<br />
mit Vertretern von Unternehmen, der Zivilgesellschaft <strong>und</strong><br />
den B<strong>und</strong>esministerien. Der Lenkungskreis arbeitet nach dem<br />
Konsensverfahren. Dies gilt auch für die Verabschiedung des<br />
Budgets. Darüber hinaus werden wichtige Entscheidungen<br />
<strong>im</strong> Verlauf der DGCN-Arbeitstreffen vorbereitet <strong>und</strong> diskutiert.<br />
Die operative Realisierung der Aktivitäten des DGCN,<br />
z. B. Veranstaltungen <strong>und</strong> Publikationen, verantwortet wie<br />
bisher der „Focal Point“ als Sekretariat des DGCN, der von der<br />
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gestellt<br />
wird. Aktuelle Informationen zur Stiftung <strong>und</strong> ihrem Budget<br />
finden Sie <strong>im</strong> internen Bereich der DGCN-Webseite.<br />
128 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
Impressum<br />
Verlag:<br />
macondo publishing GmbH<br />
Dahlweg 87<br />
48153 Münster<br />
Tel.: +49 (0) 251 – 200782-0<br />
Fax: +49 (0) 251 – 200782-22<br />
Mail: info@macondo.de<br />
URL: www.macondo.de<br />
USt-Id-Nr.: DE 292 662 536<br />
Chefredakteur:<br />
Dr. Elmer Lenzen<br />
Redaktion:<br />
Sonja Scheferling, Milena Knoop<br />
Bildredaktion:<br />
Marion Lenzen<br />
Gestaltung:<br />
Magnus A. S<strong>und</strong>ermann<br />
Lektorat:<br />
Marion Lenzen, Milena Knoop<br />
Kl<strong>im</strong>aneutralität:<br />
Das vorliegende Druckerzeugnis ist<br />
durch anerkannte Kl<strong>im</strong>aschutzprojekte<br />
kl<strong>im</strong>aneutral gestellt worden.<br />
(Nature Office Gold Standard Portfolio -<br />
GS, VER)<br />
kl<strong>im</strong>aneutral<br />
natureOffice.com | DE-223-320876<br />
gedruckt<br />
Papier:<br />
Plano® Art, FSC zertifiziert<br />
Grußworte:<br />
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon,<br />
Rede be<strong>im</strong> UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Board<br />
Meeting, 22. Juni <strong>2016</strong><br />
B<strong>und</strong>esaußenminister<br />
Dr. Frank-Walter Steinmeier<br />
Autoren dieser Ausgabe<br />
(in alphabetischer Reihenfolge):<br />
Peter Attin, Hannah van Basshuysen,<br />
Kai M. Beckmann, Ina Bömelburg,<br />
Dr. Melanie Coni-Z<strong>im</strong>mer, Laura Curtze,<br />
Irina Detlefsen, Susanne Dunschen,<br />
Isabel Ebert, Marcel Engel, Monika<br />
Focks, Robert Grabosch, Dr. Rüdiger<br />
Grube, Stephan Grünewald, Sabrina<br />
Haag, Courtney Lee Hagewood,<br />
Dr. Christine Hawighorst, Dr. Wolfram<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong><br />
Heger, Gregor Hilkert, Dr. Hannes<br />
Hofmann, Dr. Joach<strong>im</strong> Klein, Bettina<br />
Klump-Bickert, Dr. Elmer Lenzen,<br />
Jasmin Lotze, Dr. Detlef Männig,<br />
Katharina Mauz, Tobias Menne, David<br />
Möller, Dr. Pedro Morazán, Stephan<br />
Multhaupt, Anna Muntzos, Dr. Eberhard<br />
Niggemann, Ronald Popper, Laura Rech,<br />
Dr. Christoph Regierer, Britta Sadoun,<br />
Bernhard Schwager, Katharina Tesmer,<br />
Marlehn Thieme, Dr. Annegret Vester,<br />
Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker,<br />
Doris Wöllner, Dr. Sonja Würtemberger<br />
Namentlich gekennzeichnete<br />
Beiträge geben nicht die Meinung des<br />
Herausgebers wieder.<br />
Bildnachweis:<br />
UN Photo/Mark Garten (S. 3), Auswärtiges<br />
Amt/photothek/Thomas Köhler (S. 4),<br />
iStockphoto.com/fcscafeine (S. 6 oben,<br />
8), UN Photo/JC McIlwaine (S. 6 Mitte,<br />
38 - 40), UN Photo/Cia Pak (S. 6 unten,<br />
114/115), Rheingold Institut/Jurga Graf<br />
(S. 11), iStockphoto.com/HansUlrich-Ansebach<br />
(S. 12), Marco2811/Fotolia.com<br />
(S. 14), UN Photo/Jawad Jalali (S. 16),<br />
Jashin/Fotolia.com (S. 17), UN Photo/<br />
Eskinder Debebe (S. 18), Christian Martinez/fresnel6/Fotolia.com<br />
(S. 19), iStockphoto.com/Juanmonino<br />
(S. 20), UN Photo/Martine<br />
Perret (S. 22), UN Photo/Rick<br />
Bajornas (S. 24/25), André Wagenzik/<br />
Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE)<br />
(S. 26/27), Martin Joppen/Rat für Nachhaltige<br />
Entwicklung (RNE) (S. 27 unten),<br />
iStockphoto.com/Steve Debenport/<br />
asiseeit (S. 29), „Wir zusammen“ (S. 30),<br />
Deutsche Post DHL Group (S. 31),<br />
Tchibo (S. 32, 108/109), „Wir zusammen“/<br />
thyssenkrupp (S. 33), drubig-Foto/Fotolia.com<br />
(S. 35), Christian Schwier/Fotolia.com<br />
(S. 36), iStockphoto.com/paulprescott72<br />
(S. 43), DGCN/David Ausserhofer<br />
(S. 44), UN Photo/Jean Pierre<br />
Laffont (S. 47), GIZ/Paul Hahn (S. 49,<br />
117 - 120), UN Photo/Albert Gonzalez<br />
Farran (S. 50), UN Photo/Marco Dormino<br />
(S. 52 links), UN Photo/Arpan Munier<br />
(S. 52 rechts), UN Photo/Tobin Jones<br />
(S. 53 rechts), aerogondo/Fotolia.com<br />
(S. 59), Audi (S. 61), Aurubis (S. 63),<br />
BASF (S. 65), Bayer/Michael Rennertz<br />
(S. 67), Bosch/Thomas Bauer (S. 68),<br />
Bosch (S. 69), CEWE (S. 70/71), CHT/<br />
BEZEMA (S. 72), CiS/Gerhard Ledwinka/<br />
magele-picture/Fotolia.com (S. 74),<br />
CiS/Pixelbliss/Fotolia.com (S. 75),<br />
DAW (S. 78/79), Deutsche Bahn/Ali<br />
Kerem Yücel/iStockphoto.com (S. 80),<br />
Deutsche Bahn/Pablo Castagnola (S. 81),<br />
Deutsche Telekom/Iris Schröder (S. 82/<br />
83), E.ON (S. 84/85), Evonik (S. 87), EY/<br />
Clemens Bilan (S. 88/89), Freudenberg/<br />
Marco Schilling (S. 90), Freudenberg/<br />
Peter Dorn (S. 91), gmc2/nopparit/<br />
iStockphoto.com (S. 92), gmc2 (S. 93),<br />
HOCHTIEF/Christoph Schroll (S. 94/95),<br />
HVB/Stefan Obermeier (S. 96), HVB/<br />
Jürgen Sauer (S. 97), K+S (S. 98), K+S/<br />
Harry Soremski (S. 99), MAN/Max Kratzer<br />
(S. 100), MAN/Silvio Wyszengrad<br />
(S. 101), Merck/Vivek Sharma/Xtreme<br />
Pictures (S. 102/103), Miele (S. 104/105),<br />
Roever Broenner Susat Mazars (S. 107<br />
links), Marion Lenzen (S. 107 rechts),<br />
TÜV Rheinland/Hanne Engwald (S. 111),<br />
Weidmüller/Fotostudio + Medienlabor<br />
Hesterbrink (S. 112/113), econsense<br />
(S. 121) sowie Symrise (S. 126/127).<br />
Titelbild:<br />
iStockphoto.com/TommL<br />
Bezugspreis:<br />
€ 15,00 zzgl. Porto:<br />
[D] + € 1,00<br />
[CH] + € 3,50<br />
[EU] + € 2,00<br />
[Int.] + € 5,50<br />
Rechte:<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste<br />
<strong>und</strong> Internet sowie Vervielfältigung<br />
jeglicher Art nur nach vorheriger<br />
schriftlicher Zust<strong>im</strong>mung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingeschickte<br />
Manuskripte, Fotos <strong>und</strong> Illustrationen<br />
übernehmen wir keine Gewähr.<br />
ISSN 1614-7685<br />
ISBN-13: 978-3-946284-02-4<br />
Printed in Germany © <strong>2016</strong><br />
Anschrift DGCN:<br />
Geschäftsstelle Deutsches <strong>Global</strong><br />
<strong>Compact</strong> Netzwerk (DGCN)<br />
Deutsche Gesellschaft für<br />
Internationale Zusammenarbeit<br />
(GIZ) GmbH<br />
Reichpietschufer 20<br />
10785 Berlin<br />
Tel.: +49 (0) 30 72614-204<br />
Fax.: +49 (0) 30 72614-130<br />
Mail: globalcompact@giz.de<br />
URL: www.globalcompact.de<br />
129
Die 10 Prinzipien<br />
des United Nations<br />
<strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
Im Mittelpunkt der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong>-Initiative stehen zehn Prinzipien zu Menschenrechten,<br />
Arbeitsnormen, Umweltschutz <strong>und</strong> Korruptionsbekämpfung. Der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> ruft weltweit<br />
Unternehmen dazu auf, sich zu diesen Prinzipien öffentlich zu bekennen <strong>und</strong> aktiv für ihre<br />
Umsetzung einzusetzen.<br />
Menschenrechte<br />
Prinzip 1: Unterstützung<br />
<strong>und</strong> Respektierung<br />
der internationalen<br />
Menschenrechte <strong>im</strong> eigenen<br />
Einflussbereich<br />
Prinzip 2: Sicherstellung,<br />
dass sich das eigene<br />
Unternehmen nicht an<br />
Menschenrechtsverletzungen<br />
beteiligt<br />
UmweLT<br />
Prinzip 7: Unterstützung eines<br />
vorsorgenden Ansatzes <strong>im</strong><br />
Umgang mit Umweltproblemen<br />
Prinzip 8: Ergreifung von<br />
Schritten zur Förderung einer<br />
größeren Verantwortung<br />
gegenüber der Umwelt<br />
Prinzip 9: Hinwirkung<br />
auf die Entwicklung <strong>und</strong><br />
Verbreitung umweltfre<strong>und</strong>licher<br />
Technologien<br />
Arbeitsnormen<br />
Prinzip 3: Wahrung der<br />
Vereinigungsfreiheit <strong>und</strong><br />
wirksame Anerkennung<br />
des Rechts zu<br />
Kollektivverhandlungen<br />
Prinzip 4: Abschaffung jeder<br />
Art von Zwangsarbeit<br />
KORRUPTIONsbekämpfung<br />
Prinzip 10: Unternehmen sollen<br />
gegen alle Arten der Korruption<br />
eintreten, einschließlich<br />
Erpressung <strong>und</strong> Bestechung<br />
Prinzip 5: Abschaffung der<br />
Kinderarbeit<br />
Prinzip 6: Beseitigung von<br />
Diskr<strong>im</strong>inierung bei Anstellung<br />
<strong>und</strong> Beschäftigung<br />
130 globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2016</strong>
www.kod-druck.de<br />
Dr. Horst Köhler,<br />
Deutscher B<strong>und</strong>espräsident<br />
German Federal President<br />
Dr. Angela Merkel,<br />
Deutsche B<strong>und</strong>eskanzlerin<br />
German Federal Chancellor<br />
BESTELLANSCHRIFT Berliner Platz 8-10 Tel: +49 (0) 251 - 48 44 93 40 info@macondo.de<br />
Mediengruppe macondo D-48143 Münster Fax: +49 (0) 251 - 48 44 93 42 www.macondo.de<br />
Titel_2005_RZ 06.01.2006 15:02 Uhr Seite 2<br />
BESTELLANSCHRIFT<br />
mediengruppe macondo<br />
Hüfferstr.25 | 48149Münster<br />
Tel.: +49(0)251/48449340<br />
Fax: +49(0)251/48449342<br />
info@macondo.de<br />
SGS-COC-1349<br />
Der Druck wurde realisiert von<br />
Falzmarken Rücken<br />
SGS-COC-1349<br />
Der Druck wurde realisiert von<br />
BESTELLANSCHRIFT Berliner Platz 8-10 Tel: +49 (0) 251 - 48 44 93 40 info@macondo.de<br />
Mediengruppe macondo D-48143 Münster Fax: +49 (0) 251 - 48 44 93 42 www.macondo.de<br />
I call on business leaders to embrace<br />
<br />
SGS-COC-1349<br />
Der Druck wurde realisiert von<br />
BESTELLANSCHRIFT Berliner Platz 8-10 Tel: +49 (0) 251 - 48 44 93 40 info@macondo.de<br />
Mediengruppe macondo D-48143 Münster Fax: +49 (0) 251 - 48 44 93 42 www.macondo.de<br />
gc06_umschlag_rz.indd 1<br />
20.12.2006, 20:56<br />
gc07_umschlag_rz.indd 1<br />
27.12.2007, 16:59<br />
UN Generalsekretär Ban Ki-moon<br />
Bestellanschrift<br />
Mediengruppe macondo<br />
Dahlweg 87<br />
48153 Münster<br />
Tel: +49 (0) 2 51 - 200 782 -0<br />
Fax: +49 (0) 2 51 - 200 782 -22<br />
info@macondo.de<br />
www.macondo.de<br />
B<strong>und</strong>eskanzlerin Dr. Angela Merkel<br />
Bestellanschrift<br />
Mediengruppe macondo<br />
Dahlweg 87<br />
48153 Münster<br />
Tel: +49 (0) 2 51 - 200 782 -0<br />
Fax: +49 (0) 2 51 - 200 782 -22<br />
info@macondo.de<br />
www.macondo.de<br />
Bisherige Ausgaben<br />
»<br />
Let us choose to unite the power<br />
of markets with the authority of<br />
universal ideals. Let us choose to<br />
reconcile the creative forces of private<br />
«<br />
entrepeneurship with the needs of the<br />
disadvantaged and the requirements<br />
of future generations.<br />
Kofi Annan, Secretary-General of the United Nations<br />
global<br />
compact<br />
25 | 30 US$<br />
global compact <strong>Deutschland</strong> | 2005<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
global<br />
compact<br />
2005<br />
Today it is increasingly clear<br />
that UN objectives – peace,<br />
security, development go hand-inhand<br />
with prosperity and growing<br />
markets.<br />
If societies fail, so will markets.<br />
Kofi Annan, former Secretary-General of the United Nations<br />
global<br />
compact<br />
25,00 EUR<br />
global compact <strong>Deutschland</strong> | 2006<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
global<br />
compact<br />
2006<br />
the <strong>Compact</strong> as an organizing tool<br />
for your global operations. Ensure that<br />
your boards, subsidiaries and supply chain<br />
partners use the <strong>Compact</strong> as both a<br />
management guide and a moral compass.<br />
25,00 EUR<br />
Ban Ki-moon,<br />
Secretary General of the United Nations<br />
global compact <strong>Deutschland</strong> | 2007<br />
global<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
compact<br />
2007<br />
Ich freue mich, dass die Mitglieder des <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> <strong>Deutschland</strong> in einem<br />
<strong>Jahrbuch</strong> über ihre Aktivitäten berichten. Ich wünsche mir, dass dieses Buch noch<br />
mehr Unternehmen anspornt, sich zu den Prinzipien des <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> zu bekennen<br />
<strong>und</strong> diese mit Engagement umzusetzen – <strong>im</strong> eigenen Betrieb ebenso wie über dessen<br />
Grenzen hinaus. Wir brauchen dieses Engagement der Unternehmen für mehr Ausgleich<br />
<strong>und</strong> Gerechtigkeit der internationalen Ordnung.<br />
I am pleased that the members of <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Germany are reporting on their<br />
activities in a yearbook. I hope that this book will encourage even more companies to<br />
adopt the <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Principles and carry them out with commitment – in their own<br />
operations and beyond their bo<strong>und</strong>aries. We need this involvement of<br />
companies for more balance and justice in the international order.<br />
global compact <strong>Deutschland</strong> | 2008<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
global<br />
compact<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
global<br />
compact<br />
Unternehmerische<br />
Verantwortung muss ein<br />
Eckpfeiler werden für ethische<br />
<strong>und</strong> stabile Märkte.<br />
global compact <strong>Deutschland</strong> 2010<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
global<br />
compact<br />
Durch Vorbilder <strong>und</strong> Kooperationen<br />
in Initiativen <strong>und</strong> Netzwerken können<br />
wir das Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch<br />
als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor weiter<br />
schärfen. Hierbei n<strong>im</strong>mt der <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
eine wichtige Rolle ein. Allen Akteuren, die<br />
sich in diese weltweite Initiative einbringen,<br />
sage ich von Herzen Dank.<br />
global compact <strong>Deutschland</strong> 2011<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
global<br />
compact<br />
Ich wünsche dem deutschen <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> <strong>Jahrbuch</strong> einen großen Leserkreis.<br />
Möge es zu weiteren Anstrengungen für kreative <strong>und</strong> erfolgreiche Partnerschaften<br />
an<strong>im</strong>ieren, die der <strong>Global</strong>isierung nicht nur ein fre<strong>und</strong>liches Gesicht verleihen, sondern vor<br />
allem deren vielfältige Chancen <strong>und</strong> positive Entwicklungen konkret erfahrbar machen.<br />
I wish the German <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong> Yearbook a large readership. May it<br />
an<strong>im</strong>ate further efforts towards creative and successful partnerships that not only give<br />
globalisation a friendly face but, above all, make it possible to experience<br />
concretely its many opportunities and positive developments.<br />
2008<br />
2009<br />
30,00 EUR<br />
30,00 EUR<br />
30,00 EUR<br />
2010<br />
2011
Vor allem die Industriestaaten<br />
sollten <strong>und</strong> müssen angesichts ihres<br />
wirtschaftlichen Gewichts mit gutem<br />
Beispiel vorangehen. Daher ist es gut<br />
zu wissen, mit dem UN <strong>Global</strong> <strong>Compact</strong><br />
<strong>und</strong> seinem deutschen Netzwerk eine<br />
starke Verantwortungsgemeinschaft<br />
aus Unternehmen, Zivilgesellschaft<br />
<strong>und</strong> Politik als Wegbegleiter<br />
zur Seite zu haben.<br />
B<strong>und</strong>eskanzlerin Dr. Angela Merkel<br />
Bestellanschrift<br />
macondo publishing GmbH<br />
Dahlweg 87<br />
48153 Münster<br />
Tel: +49 (0) 2 51 - 200 782 -0<br />
Fax: +49 (0) 2 51 - 200 782 -22<br />
info@macondo.de<br />
www.macondo.de<br />
15,00 EUR