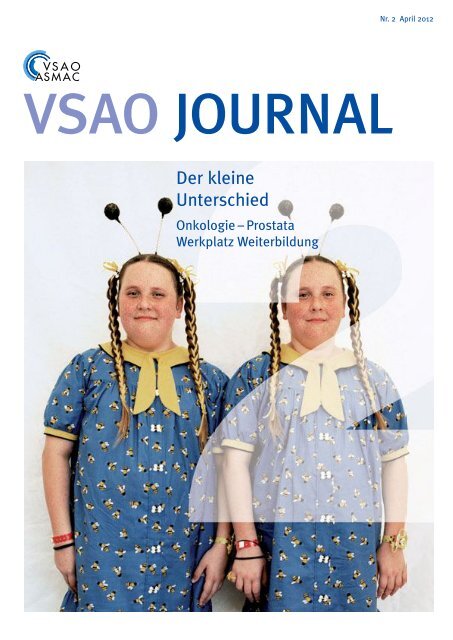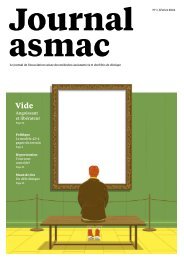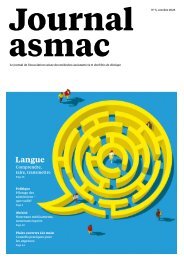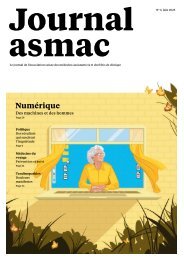VSAO JOURNAL Nr. 2 - April 2012
Der kleine Unterschied - Onkologie-Prostata Werkplatz Weiterbildung
Der kleine Unterschied - Onkologie-Prostata
Werkplatz Weiterbildung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
inhalt<br />
Titelbild: aebi, grafik & illustration, bern<br />
EDITORIAL<br />
5 Tolle Theorie, passable Praxis<br />
Politik<br />
6 Managed Care: Referendums abstimmung<br />
am 17. Juni<br />
8 Arbeitsbedingungen wieder im Fokus<br />
10 Auf den Punkt gebracht<br />
… old soldiers never die, they just fade<br />
away …<br />
Weiterbildung<br />
12 Bauplan der Weiterbildung<br />
14 Bewährtes Kontrollinstrument<br />
16 Informationen des Berner Instituts<br />
für Hausarztmedizin<br />
17 Lesen lernen:<br />
Fokussieren mit Filtern<br />
<strong>VSAO</strong><br />
19 Sektion Basel<br />
19 Sektion Bern<br />
20 Sektion Neuenburg<br />
20 Sektion Solothurn<br />
21 Sektion Waadt<br />
24 <strong>VSAO</strong> Rechtsberatung<br />
25 Geglückter Start<br />
26 <strong>VSAO</strong>-Inside<br />
Fokus<br />
29 Nicht Mann, noch Frau<br />
32 Sie gegen ihn<br />
35 HIV-Präventionskampagnen bei<br />
schwulen Männern<br />
37 Die Feminisierung und ihre Folgen<br />
Perspektiven<br />
40 Feinere Filter – bessere Behandlung<br />
44 Aus der Praxis<br />
Das Prostatakarzinom: Eine Übersicht<br />
aktueller Behandlungsstrategien<br />
48 Unglaubliche Fallgeschichten aus<br />
der Medizin: Ein hellhöriger Arzt<br />
MediSERVice <strong>VSAO</strong>-ASMAC<br />
49 Briefkasten<br />
50 Mehr Sicherheit durch Telematik<br />
52 Vereinfachte Steuerabrechnung<br />
für Nebenbeschäftigung<br />
54 Impressum<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
3
editorial<br />
Foto: Severin Novacki<br />
Catherine Aeschbacher<br />
Chefredaktorin <strong>VSAO</strong>-Journal<br />
Tolle Theorie, passable Praxis<br />
1975 veröffentlichte die deutsche Feministin Alice Schwarzer<br />
ein Buch mit dem Titel «Der kleine Unterschied und seine grossen<br />
Folgen». Ihre Analyse des Geschlechterkonflikts wurde<br />
schnell zu einem der wichtigsten Werke der feministischen<br />
Bewegung. Bald vierzig Jahre später sind – wenigstens in der<br />
westlichen Welt – viele der damaligen Forderungen erfüllt worden.<br />
Trotz allem ist niemand so blauäugig, zu behaupten, die<br />
Gleichstellung der Geschlechter sei verwirklicht. Wahrscheinlich<br />
muss jede Generation den Umgang mit dem kleinen Unterschied<br />
und seinen (hoffentlich nicht allzu grossen) Folgen<br />
neu definieren und gestalten.<br />
In unserm Schwerpunkt haben wir versucht, kleine Teilchen<br />
aus dem riesigen Themenbereich herauszupicken. Themen,<br />
die mit Geschlechtszugehörigkeit oder dem Umgang der Geschlechter<br />
miteinander zu tun haben, die aber nicht unbedingt<br />
im Zentrum des Interesses stehen. So etwa die Frage, was geschieht,<br />
wenn ein Kind zur Welt kommt, dessen Geschlecht<br />
undefiniert ist. Oder die Frage, weshalb es bisweilen so schwierig<br />
ist, in Vergewaltigungsprozessen Recht zu sprechen. Ein<br />
Beitrag zur HIV-Prävention beschreibt, wie man Sexualverhalten<br />
zu beeinflussen versucht, ohne die Moralkeule zu<br />
schwingen. Und schliesslich wenden wir uns konkret den Folgen<br />
der Feminisierung in der Medizin zu.<br />
Das Referendum gegen die Managed-Care-Vorlage ist bekanntlich<br />
zustande gekommen. Nun gilt es, die Abstimmung zu gewinnen.<br />
Mehr dazu im Politikteil. Unter Beschuss geraten ist<br />
hingegen das Arbeitsgesetz. Die Replik darauf findet sich ebenfalls<br />
im Politikteil.<br />
Dem Arbeitsgesetz geht es ähnlich wie der Gleichstellung: Theorie<br />
und Praxis sind zuweilen weit voneinander entfernt. Wie<br />
oft es noch bei der Umsetzung des Arbeitsgesetzes hapert, zeigen<br />
die einzelnen Berichte der Sektionen im <strong>VSAO</strong>-Teil.<br />
In der Rubrik Weiterbildung zeigt eine «Bauplan» der Weiterbildung<br />
deren gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen auf<br />
und stellt die Instanzen vor, die mit der Kontrolle und der<br />
Durchführung betraut sind. Und weil auch in diesem Bereich<br />
Papier geduldig ist, gehen wir in einem weiteren Beitrag auf<br />
die Visitation als ein wichtiges Kontrollinstrument näher ein.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
5
Politik<br />
Managed Care:<br />
Referendumsabstimmung<br />
am 17. Juni<br />
Am 17. Juni <strong>2012</strong> kommt die Managed-Care-Vorlage vors Volk. Es geht dabei nicht um Ja oder Nein<br />
zur Förderung von integrierter Versorgung, sondern um Ja oder Nein zu dieser konkreten Vorlage,<br />
die den Krankenkassen sehr viel Macht gibt. Es zweifelt niemand daran, dass die heutigen<br />
Netz werke qualitativ gut und kostengünstig arbeiten. Die Vorlage gefährdet aber genau das.<br />
Rosmarie Glauser, Politische Sekretärin <strong>VSAO</strong>. Bilder: Raffael Waldner<br />
Am 19. Januar <strong>2012</strong> konnte das Referendum<br />
gegen die Managed-Care-Vorlage mit<br />
über 132 000 beglaubigten Unterschriften<br />
eingereicht werden. Damit haben die drei<br />
Referendumskomitees innerhalb von drei<br />
Monaten mehr als doppelt so viele als die<br />
nötigen 50 000 Unterschriften zusammengebracht.<br />
Zur Gesamtzahl von<br />
132 837 Unterschriften hat das von den<br />
Personalverbänden vpod und <strong>VSAO</strong> initiierte<br />
Referendumskomitee «Nein zur Mogelpackung»<br />
14 042 beigesteuert. An einer<br />
gemeinsamen Medienkonferenz begründeten<br />
Vertreterinnen und Vertreter der drei<br />
Komitees ihre Ablehnung der Managed-<br />
Care-Vorlage. Die Pressemappe mit allen<br />
Texten kann auf unserer Website www.<br />
vsao.ch heruntergeladen werden.<br />
Bereits am Tag nach der Einreichung begann<br />
der Abstimmungskampf. Ende Januar<br />
musste nämlich bei der Bundeskanzlei<br />
der Text für die Abstimmungsbroschüre<br />
eingereicht werden. Es war gar<br />
nicht einfach, sich unter den drei Referendumskomitees<br />
auf einen Text zu einigen,<br />
zumal insgesamt nur 1600 Zeichen<br />
zur Verfügung standen und die Argumente<br />
gegen die MC-Vorlage sehr unterschiedlich<br />
gewichtet werden. Wichtig für den<br />
<strong>VSAO</strong> war, dass die Ablehnung nicht allein<br />
aus ärztlichen Kreisen kommt, damit<br />
nicht der falsche Eindruck entsteht, die<br />
Vorlage sei nur für diese gefährlich. Inzwischen<br />
konnte ein breit abgestütztes<br />
Dachkomitee gegen die Managed-Care-<br />
6 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Politik<br />
Vorlage gegründet werden. Bei Erscheinen<br />
des Journals wird die Kampagne angelaufen<br />
sein. Weitere Informationen können<br />
deshalb laufend auf unserer Website www.<br />
vsao.ch oder unter www.nein-zur-mogelpackung.ch<br />
abgerufen werden. Abstimmungsmaterial<br />
wie Flyer, Plakate und so<br />
weiter können bei uns oder bei der FMH<br />
bestellt werden.<br />
Mein Arzt bleibt meine Wahl! Nein zur KVG-Änderung!<br />
NEIN zur Abschaffung der freien Arztwahl<br />
Wer weiterhin seinen Arzt frei wählen will, muss 15 statt 10 Prozent der Kosten selber bezahlen und dies bis zu 1000 statt 500 Franken.<br />
Viele Versicherte werden faktisch gezwungen, einem Managed-Care-Netzwerk (integrierte Versorgungsnetze) beizutreten.<br />
NEIN zur Abschaffung der freien Wahl des Spitals, des Pflegeheims und der Apotheke<br />
Netzwerke können mit Spitälern, Pflegeheimen und Apotheken Exklusivverträge abschliessen. Damit sind Versicherte nicht mehr<br />
frei in ihrer Wahl.<br />
NEIN zur Benachteiligung chronisch kranker Menschen<br />
Chronisch kranke Menschen sind über Jahre bei den Ärzten ihres Vertrauens in Behandlung. Dies sichert Qualität und spart<br />
Kosten. Sind einige dieser Ärzte nicht im gleichen Netzwerk, müssen chronisch Kranke ihren Arzt wechseln.<br />
NEIN zu teuren Knebelverträgen<br />
Bis zu drei Jahre können Krankenkassen die Versicherten an die Netzwerke binden. Wer wechseln will, muss neu eine hohe Austrittsprämie<br />
zahlen.<br />
NEIN zu Rationierung und Zweiklassenmedizin<br />
Netzwerke stehen unter Budgetdruck. Das kann zu Qualitätsverlust führen, weil auf Kosten der nötigen Behandlungen gespart<br />
wird. Es drohen Rationierung und Zweiklassenmedizin.<br />
NEIN zu Zwang<br />
Alle Beteiligten (Patienten, Ärzte, Kassen) können sich heute freiwillig für oder gegen ein Netzwerk entscheiden. Damit ist ein<br />
fairer Wettbewerb gewährleistet. Der faktische Netzwerkzwang will den Radikalumbau unseres bewährten, qualitativ hochstehenden<br />
Schweizer Gesundheitswesens.<br />
Aus diesen Gründen haben über 130 000 Stimmberechtigte das Referendum ergriffen und empfehlen<br />
Ihnen ein NEIN.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
7
Politik<br />
Arbeitsbedingungen<br />
wieder im Fokus<br />
Seit 2005 unterstehen die Assistenzärztinnen und -ärzte dem Arbeitsgesetz. Seither hat sich vieles<br />
verbessert. Wirklich flächendeckend umgesetzt sind die Bestimmungen allerdings noch lange<br />
nicht. Eine nationalrätliche Motion will Abhilfe schaffen. Gleichzeitig wurde eine umstrittene Studie<br />
in Zusammenhang mit der 50-Stunden-Woche veröffentlicht.<br />
Rosmarie Glauser, Politische Sekretärin <strong>VSAO</strong><br />
Unter dem Titel «Arbeitsgesetz im<br />
Spital» hat Nationalrätin Marianne<br />
Streiff, EVP, eine Motion mit folgendem<br />
Wortlaut eingereicht:<br />
1. Der Bundesrat wird beauftragt, die<br />
Einhaltung des Arbeitsgesetzes in den<br />
Spitälern kontrollieren zu lassen.<br />
2. Der Bundesrat wird beauftragt, die<br />
notwendigen Schritte einzuleiten,<br />
damit Verstösse gegen das Arbeitsgesetz<br />
unverzüglich behoben werden.<br />
Der <strong>VSAO</strong> begrüsst diese Motion, denn das<br />
Arbeitsgesetz wird in vielen Schweizer Spitälern<br />
immer noch nicht eingehalten und<br />
zum Teil sogar massiv verletzt. Es besteht<br />
also Handlungsbedarf. Der Staat kann<br />
und darf nicht dulden, dass Gesetze einfach<br />
missachtet werden. Er ist daher gehalten,<br />
deren Einhaltung sicherzustellen.<br />
Für die Kontrolle, dass das Arbeitsgesetz<br />
auch wirklich eingehalten wird, sind die<br />
kantonalen Arbeitsinspektorate zuständig.<br />
Der Bund übt gemäss Art. 42 ArG die<br />
Oberaufsicht über den Vollzug aus.<br />
Die rasche Kontrolle und Durchsetzung<br />
des Arbeitsgesetzes ist auch im Hinblick<br />
auf die neue DRG-Spitalfinanzierung<br />
wichtig. Die Spitäler werden in eine Konkurrenzsituation<br />
gebracht, bei der das<br />
kostengünstigste Spital den Takt angibt.<br />
Damit geraten die Arbeitsbedingungen<br />
noch mehr unter Druck. Um kostendeckende<br />
Pauschalen zu erreichen, muss<br />
wenigstens sichergestellt sein, dass von<br />
gesetzeskonformen Arbeitsbedingungen<br />
ausgegangen wird. Der angestrebte Wettbewerb<br />
darf nicht zulasten des Personals<br />
ausgetragen werden.<br />
Das eidgenössische Parlament hat 2005<br />
die Assistenzärztinnen und -ärzte dem<br />
Arbeitsgesetz unterstellt. Damit wollte der<br />
Gesetzgeber sicherstellen, dass arbeitsmedizinische<br />
Erkenntnisse auch im ärztlichen<br />
Bereich Anwendung finden. Die betroffenen<br />
Ärztinnen und Ärzte, aber auch<br />
die Patientinnen und Patienten sollten<br />
damit geschützt werden.<br />
Studie in der<br />
«Swiss Medical Weekly»<br />
Im Januar wurde in der «Swiss Medical<br />
Weekly» eine Studie aus der Chirurgie des<br />
Spitalzentrums Biel veröffentlicht, die<br />
zum Schluss kommt, dass die Einführung<br />
der 50-Stunden-Woche nicht zu mehr<br />
Patientensicherheit führe, dass im Gegenteil<br />
die Mortalität und die Komplikationsrate<br />
leicht zugenommen habe. Damit sei<br />
das Ziel, das man mit der Unterstellung<br />
der Assistenzärzte unter das Arbeitsgesetzes<br />
erreichen wollte, nicht erfüllt. Die<br />
«SonntagsZeitung» hat im Februar über<br />
die Studie berichtet.<br />
Die Studie weist leider gravierende Mängel<br />
auf und es werden unzulässige Schlussfolgerungen<br />
gezogen. Exemplarisch seien<br />
hier einige Punkte erwähnt:<br />
• Die Studie vergleicht die Verhältnisse<br />
von 2001–2004 einerseits, und 2005–<br />
2008 andererseits. Im Kanton Bern<br />
wurde die 50-Stunden-Woche aber bereits<br />
mit dem Gesamtarbeitsvertrag im<br />
Jahr 2000 eingeführt. Entsprechend<br />
sank die Arbeitszeit laut Studie auch<br />
nur unbeträchtlich von 52,5 auf 49,7<br />
Stunden. Gemäss einer Studie des Büro<br />
BASS aus dem Jahr 1998 betrug die<br />
wöchentliche Arbeitszeit in den chirurgischen<br />
Abteilungen im Kanton Bern<br />
73,3 Stunden.<br />
• Die effektiven Arbeitszeiten entsprechen<br />
nicht unbedingt den erfassten Arbeitszeiten.<br />
Als Folge des Arbeitsgesetzes<br />
werden, gerade in chirurgischen Fächern,<br />
nicht mehr alle Stunden aufgeschrieben.<br />
• Bei den Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes<br />
geht es nicht nur um die<br />
wöchentliche Höchstarbeitszeit. Genau<br />
so wichtig sind die Bestimmungen betreffend<br />
Ruhezeiten, Arbeitstage am<br />
Stück, Nachtarbeit und – wichtig im<br />
Gesundheitswesen – betreffend Pikettdienst<br />
usw. Diese Punkte werden überhaupt<br />
nicht berücksichtigt, obwohl aus<br />
zahlreichen Studien hervorgeht, dass<br />
sie für die Arbeitssicherheit entscheidend<br />
sind.<br />
• Es ist zudem offensichtlich, dass eine<br />
Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit<br />
ohne Prozessoptimierungen und<br />
Neuorganisation den Stress nicht mindert,<br />
zumal der Kostendruck gleichzeitig<br />
noch einen Personalabbau zur<br />
Folge hatte. Hinzu kommt, dass die<br />
administrativen Aufgaben, gerade bei<br />
den Assistenzärzten, weiter zugenommen<br />
haben. Es ist daher unzulässig,<br />
die Einführung der 50-Stunden-<br />
Woche für den Stress verantwortlich<br />
zu machen und eine Korrelation zu<br />
Mortalität und Komplikationen herzustellen.<br />
• Die Stichprobe der Patienten ist mit<br />
rund 1300 viel zu gering und zu wenig<br />
vergleichbar. So gab es deutlich mehr<br />
Wahleingriffe und weniger Notfälle in<br />
der Gruppe von 2001–2004. Über den<br />
Case-Mix und den Case-Load ist ansonsten<br />
wenig bekannt.<br />
• Aus der Studie ist auch nicht ersichtlich,<br />
welchen Anteil Assistenz- und Oberärztinnen<br />
und -ärzte an der Behandlung<br />
hatten. Immerhin gilt das Arbeitsgesetz<br />
nur für sie. Die Leitenden Ärzte und die<br />
Chefärzte erfassen ihre Arbeitszeit nach<br />
wie vor nicht.<br />
8 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Politik<br />
Offenbar ging es den Autoren in erster<br />
Linie darum, das Arbeitsgesetz ein weiteres<br />
Mal zu diskreditieren.<br />
Arbeitsgruppe Spitäler<br />
des SECO<br />
Auf Druck einiger Spitäler hat das SECO<br />
(Staatssekretariat für Wirtschaft) die paritätisch<br />
aus Spitälern und Personalverbänden<br />
zusammengesetzte Arbeitsgruppe<br />
Spitäler wieder reaktiviert. Eine erste Sitzung<br />
findet im März, also nach Redaktionsschluss<br />
statt. Wir werden im nächsten<br />
Journal informieren.<br />
■<br />
publix.ch<br />
jobmed.ch<br />
Lassen Sie sich von<br />
Ihrem Wunschjob finden.<br />
Und nicht umgekehrt.<br />
jobmed.ch ist das Stellen-Portal<br />
für Ärztinnen und Ärzte. Mit dem<br />
bequemen E-Mail-Suchabo lassen<br />
Sie sich von Ihrem Wunschjob<br />
fin den, statt lange zu suchen.<br />
jobmed.ch –<br />
die besseren Arzt-Stellen<br />
In Zusammenarbeit mit<br />
transparent – exklusiv –<br />
massgeschneidert<br />
Ins_Kopfueber_86x133_060109.indd 1<br />
6.1.2009 16:19:55 Uhr<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
9
Politik<br />
Auf den PUNKT gebracht<br />
… old soldiers never die,<br />
they just fade away …<br />
Ich erinnere mich noch gut<br />
an jenen Morgen ungefähr<br />
1996, als ich meinen Dienst<br />
als Assistenzarzt in der<br />
Chirurgie antrat und mir<br />
eröffnet wurde, dass die<br />
Spitalleitung beschlossen<br />
habe, die Dienstessen zu<br />
streichen. Dies war der berühmte<br />
Tropfen zu viel in<br />
ein bereits bis zum Rand<br />
gefülltes Fass von Abbaumassnahmen<br />
unter stetem<br />
Aufbürden zusätzlicher<br />
Aufgaben. Ich konnte diese Entwicklung<br />
nicht mehr tolerieren und als einer der<br />
dienstältesten Assistenzärzte nicht mehr<br />
länger mit ansehen, wie wir Frontkämpfer<br />
im stets saurer werdenden Regen stehen<br />
gelassen wurden. Es waren nicht einmal<br />
die langen Arbeitstage oder -wochen, die<br />
mir zu schaffen machten. Wenn auch das<br />
Gefühl nach über hundert Stunden Arbeit<br />
am Stück im Spital etwas Unheimliches<br />
an sich hatte. Nein, es waren die fehlende<br />
Wertschätzung und Wahrnehmung unserer<br />
Leistung, die mich bewogen, den Spitaldirektor<br />
aufzusuchen. Er hörte mich<br />
höflich an, gab dann jedoch seinem Bedauern<br />
Ausdruck, dass ich wohl inhaltlich<br />
durchaus Recht hätte, für meine Forderungen<br />
und Anliegen jedoch keine rechtliche<br />
oder administrative Grundlage bestünden.<br />
Ich beschloss, dies zu ändern –<br />
und so begann meine <strong>VSAO</strong>-Geschichte.<br />
Wir alle erleben den stets schnelleren<br />
Wandel weg von der qualitativen hin zur<br />
ökonomischen Prämisse unweigerlich<br />
mehr oder weniger hautnah mit und unterliegen<br />
diesem Druck. Diese zentrale<br />
Herausforderung führte mich dann in die<br />
diversen Gremien des <strong>VSAO</strong>, zuerst in den<br />
Vorstand der Sektion Bern.<br />
Wenn ich nun im Frühjahr <strong>2012</strong> auf meine<br />
vier Präsidialjahre im <strong>VSAO</strong> und die<br />
vergangene Zeit zurückblicke, so ist doch<br />
einiges geschehen. Prägte beispielsweise<br />
in meiner frühen Weiterbildungszeit noch<br />
der Begriff «Ärzte-Schwemme» die Diskussionen,<br />
wurde später das Gegenteil<br />
Realität. Aber nicht nur die demografischen<br />
Bedingungen haben sich geändert,<br />
auch in Hinblick auf die Arbeitsbedingungen<br />
und die Position der Assistenz- und<br />
Oberärzte konnte manches verbessert<br />
werden.<br />
Damit ein Berufsverband zielgerichtet und<br />
effizient für die Anliegen seiner Mitglieder<br />
arbeitet, braucht es vor allem eines, nämlich<br />
die Mitglieder! Sie müssen den Verband<br />
nicht nur finanziell mittels Entrichtung<br />
des Jahresbeitrages tragen, sondern<br />
ihn auch inhaltlich füllen: Was sind die<br />
Bedürfnisse? Was die Wünsche? Und wie<br />
sollen sie umgesetzt werden? Um die verschiedenen<br />
Anliegen entgegennehmen<br />
und strukturieren zu können, aber auch,<br />
um gegenüber unseren Partnern ein Gesicht<br />
zu erhalten, hat sich der <strong>VSAO</strong> mit<br />
dem vom ZV beschlossenen Modell der<br />
Geschäftsstellen der Sektionen strukturell<br />
gefestigt. Weiter ist es gelungen, das Team<br />
des Zentralsekretariates unter der Leitung<br />
von Simon Stettler als koordinierende und<br />
die Sektionen unterstützende Institution<br />
an seinem neuen Standort im Hauptbahnhof<br />
Bern zu verankern. Das Zentralsekretariat<br />
ist nicht nur den mandatierten<br />
Mitgliedern, die vor und nach den Sitzungen<br />
den raschen Gleisanschluss schätzen,<br />
sondern auch den Vertretern der Sektionen<br />
näher gerückt. Der Geschäftsausschuss<br />
(GA) besteht mittlerweile aus Mitgliedern<br />
aller grösseren Sektionen, und<br />
auch die Reintegration respektive die<br />
Wiederbelebung kleinerer Sektionen<br />
konnte unterstützt werden.<br />
Die Aussenwirkung des <strong>VSAO</strong> ist klar erkennbar:<br />
Wir sind dabei, wenn es um<br />
Weiterbildung geht, sei dies im SIWF oder<br />
im BAG. Auch die Standespolitik prägen<br />
wir aktiv mit und vernetzen uns auf Ebene<br />
GA mit dem ZV der FMH, indem dort<br />
mit Gert Printzen ein GA-Mitglied Einsitz<br />
genommen hat, sodass die Wege kurz<br />
bleiben. Bezüglich Arbeitsbedingungen ist<br />
das SECO aktiv geworden. Seine Tätigkeit<br />
ist im Zeitalter der DRG respektive sinkender<br />
Base-Rates eine wesentliche Hilfe zur<br />
Aufrechterhaltung eines gesunden Verhältnisses<br />
von Arbeit und Freizeit.<br />
Wenn ich an das Gespräch mit meinem<br />
damaligen Spitaldirektor zurückdenke,<br />
haben sich die Grundlagen geändert: Die<br />
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung stehen<br />
nicht mehr als Bittsteller, sondern als<br />
Partner da, die respektiert werden. Bezüglich<br />
Wertschätzung ihrer Arbeit und auch<br />
Wert der Weiterbildung besteht gegenüber<br />
unserem ökonomisch geprägten Umfeld<br />
sicher noch Klärungspotenzial. Nun stehe<br />
ich in meinem 48. Altersjahr und bin be-<br />
10 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Politik<br />
reits mehr als drei Jahre nicht mehr am<br />
Spital respektive kurativ tätig, sondern<br />
arbeite bei einer Sozialversicherung konzeptionell<br />
und begutachtend. Deshalb<br />
habe ich mich entschlossen, die präsidialen<br />
Führungsaufgaben dieses Verbandes<br />
der jungen Spitalärztinnen und -ärzte<br />
weiterzugeben. Ich bin überzeugt, dass in<br />
der aktuellen Entwicklungsphase unseres<br />
Verbandes der Weg an dessen Spitze von<br />
nachrückenden jüngeren Kolleginnen<br />
und Kollegen in Angriff genommen wird.<br />
All jenen, die mir in den vergangenen<br />
Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben<br />
und mir diese interessante standespolitische<br />
Tätigkeit ermöglicht haben, danke<br />
ich herzlich dafür. Auch in Zukunft werde<br />
ich mich gerne weiter für die Ziele einer<br />
qualitätsorientierten medizinischen Versorgung<br />
und deren Grundlagen einsetzen,<br />
sodass der Kontakt zum <strong>VSAO</strong> gewiss nicht<br />
abreissen wird.<br />
Dem <strong>VSAO</strong> wünsche ich weiterhin aktive<br />
und kritische Mitglieder, angeregte Diskussionen<br />
und breit abgestützte Lösungen<br />
zum Wohle aller.<br />
■<br />
Herzlich Euer Christoph Bosshard,<br />
Präsident <strong>VSAO</strong><br />
... so, I just fade away – goodbye!<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
11
weiterbildung<br />
Bauplan der Weiterbildung<br />
Die Adjektive «kurz» oder «einfach» passen nicht, um die Struktur der Weiterbildung in der Schweiz<br />
zu beschreiben. Zu komplex ist das Gefüge, zu vielfältig die Beteiligten. Trotzdem soll der nachfolgende<br />
Text eine Übersicht bieten und zusätzlich aufzeigen, in welchen Gremien der <strong>VSAO</strong> offiziell<br />
beteiligt ist.<br />
Sonja Trüstedt, <strong>VSAO</strong> Basel, GA-Mitglied Ressort Weiterbildung<br />
Das Medizinalberufegesetz MedGB<br />
regelt in groben Zügen alles rund um die<br />
universitäre Ausbildung sowie hinsichtlich<br />
der Weiter- und Fortbildung. Neben<br />
Zulassungsformalitäten, Zielen der Ausund<br />
Weiterbildung, Kompetenzen ordnet<br />
es u.a. die Qualitätssicherung der eidgenössischen<br />
Facharzttitel und die eigenverantwortliche<br />
Tätigkeit als Arzt oder Ärztin.<br />
Obwohl die Weiterbildung gemäss Gesetz<br />
an eine private Organisation delegiert<br />
werden darf, behält der Bund die Oberaufsicht.<br />
Hierbei stehen dem Eidgenössischen<br />
Departement des Inneren (EDI) der<br />
Schweizer Akkreditierungsrat und die Medizinalberufekommission<br />
zur Seite.<br />
Die Medizinalberufekommission<br />
MEBEKO ist ein Gremium bestehend<br />
aus 21 von Bundesrat gewählten Personen,<br />
der <strong>VSAO</strong> ist mit einem Sitz vertreten.<br />
Die Kommission entscheidet über Anerkennung<br />
ausländischer Diplome und<br />
Weiterbildungstitel. Als Beratungsorgan<br />
nimmt sie zu fachspezifischen und qualitätsbezogenen<br />
Aspekten der Aus- und<br />
Weiterbildung Stellung. Sie berichtet dem<br />
EDI und dem Schweizerischen Akkreditierungsrat<br />
regelmässig. Diese Berichte orientieren<br />
auch bei Problemen der Aus- und<br />
Weiterbildung und zeigen Massnahmen<br />
zur Erhöhung deren Qualität auf.<br />
Das Schweizerische Institut der<br />
Weiter- und Fortbildung SIWF ist<br />
ein eigenständiges Institut der Verbindung<br />
der Schweizer Ärzte (FMH) und ist für<br />
den ganzen Bereich der Weiter- und Fortbildung<br />
zuständig. Damit ist es die wichtigste<br />
Organisation für die Mitglieder des<br />
<strong>VSAO</strong>. Das SIWF ist verantwortlich für die<br />
Weiterbildungsordnung WBO, die<br />
eine für alle Fachgesellschaften gültige<br />
Interpretation und Ergänzung zum<br />
MedGB darstellt. Diese regelt zum Beispiel<br />
die Mutterschaftsabsenzen oder Anrechenbarkeit<br />
des geleisteten Militärdienstes<br />
auf die Weiterbildungsdauer. Auf die WBO<br />
aufbauend haben die Fachgesellschaften<br />
ihre jeweiligen Weiterbildungsprogramme<br />
für die Weiterbildungsgänge<br />
erstellt. Alle 45 eidgenössischen Titel werden<br />
in einem 7-jährigen Turnus durch das<br />
EDI akkreditiert. Alle Programme sind<br />
auf der FMH-Webseite einsehbar. Hier findet<br />
man das Wesentliche zu den aktuellen<br />
Anforderungen für den jeweiligen Facharzttitel.<br />
Das SIWF erteilt allen FMH-<br />
Mitgliedern unentgeltlich Auskunft über<br />
ihren jeweiligen Weiterbildungsstand respektive<br />
die noch benötigten Voraussetzungen<br />
zur Erlangung des angestrebten Facharzttitels.<br />
Das SIWF anerkennt auch Weiterbildungsstätten<br />
und kontrolliert diese einerseits<br />
mittels der jährlichen Assistentenumfrage<br />
zur Weiterbildungsqualität<br />
oder aber per Visitation (mehr dazu<br />
im separaten Artikel). Jede Weiterbildungsstätte<br />
muss ein eigenes Weiterbildungskonzept<br />
ausarbeiten. Dieses ist<br />
ebenso wie die Resultate der Umfrage der<br />
Weiterbildungsqualität auf der FMH-Webseite<br />
einsehbar. Auch die anerkannten<br />
Weiterbildungsstätten mitsamt der<br />
Maximaldauer respektive Kategorie sind<br />
aufgelistet. Nur an diesen wird die Weiterbildung<br />
ohne weitere Rückfragen anerkannt.<br />
Den Vorstand des SIWF bilden 18 Mitglieder,<br />
Delegierte der grossen Fachgesellschaften,<br />
der Fakultäten, des <strong>VSAO</strong> sowie<br />
des Verbands leitender Spitalärzte VLSS<br />
und elf ständige Gäste aus den offiziellen<br />
Instituten. Im 54-köpfigen Plenum sind<br />
zwei weitere <strong>VSAO</strong>-Delegierte vertreten.<br />
Das SIWF finanziert sich vorwiegend über<br />
Titelgebühren. Rechenschaft gewährt es<br />
gegenüber der Ärztekammer, dem<br />
«Parlament» der FMH. Hier stellt der <strong>VSAO</strong><br />
40 der 200 Sitze.<br />
Neben diesen primären Strukturen gibt es<br />
weitere Organisationen, die direkt wie indirekt<br />
die Weiterbildung beeinflussen.<br />
Die schweizerische Gesundheitspolitik ist<br />
föderalistisch aufgebaut. Seit 2003 besteht<br />
der «Dialog nationale Gesundheitspolitik»<br />
als ständige Plattform, in<br />
der sich seitens der Eidgenossenschaft der<br />
Vorsteher des Eidgenössischen Departements<br />
des Innern (neu Bundesrat Alain<br />
Berset) und Vertreter des Bundesamts für<br />
Gesundheit, Statistik und Obsan (Schweizerisches<br />
Gesundheitsobservatorium) so-<br />
Journée de réflexion <strong>2012</strong><br />
Ärztliche Weiterbildung in der Schweiz: Wo stehen wir heute? Was tut sich international?<br />
Welche Entwicklungen sind unabänderlich? Und welche Trends gilt es frühzeitig<br />
umzusetzen? Der Themenkreis rund um die Weiterbildung ist weit. Nach einigen<br />
Jahren der Pause organisierte das Schweizer Institut für ärztliche Weiter- und<br />
Fortbildung SIWF und das Collège de Doyens (Vereinigung der Dekane) der medizinischen<br />
Fakultäten Ende Januar wieder eine gemeinsame Tagung, an der die Probleme<br />
und Strategien der ärztlichen Bildung diskutiert wurden. Gegliedert in drei<br />
Themenblöcken wurden verschiedenste Bereiche von Akkreditierung und deren<br />
Folgen bis hin zu Zertifikatwildwuchs beleuchtet. Neben den Delegierten der Fakultäten<br />
der sechs Universitäten, der SMIFK (Schweizerischen medizinischen Interfakultätskommission),<br />
nahmen als wichtige Partnerinstitutionen auch der <strong>VSAO</strong>,<br />
vertreten durch Ryan Tandjung und Sonja Trüstedt, die SAMW (Schweizerische<br />
Akademie für Medizinische Wissenschaften) und die MEBEKO teil.<br />
12 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
weiterbildung<br />
wie auf der kantonalen Seite die Leitung<br />
der kantonalen GesundheitsdirektorInnenKonferenz<br />
GDK beteiligen.<br />
Eines der Projekte ist die Plattform Zukunft<br />
ärztliche Bildung (vgl. auch<br />
Berichte in früheren <strong>VSAO</strong>-Journalen und<br />
auf der <strong>VSAO</strong>-Homepage). Seit September<br />
2010 werden die verschiedenen grossen<br />
Herausforderungen in der ärztlichen Bildung<br />
von allen Beteiligten gemeinsam<br />
angegangen. 18 Vereinigungen, darunter<br />
auch der <strong>VSAO</strong>, erarbeiten unter der Leitung<br />
des BAG Lösungsvorschläge zu den<br />
verschiedenen Problemfeldern. Die<br />
Stammplattform beauftragte ihrerseits<br />
Arbeitsgruppen zu spezifischen Themenkreisen<br />
Stellung zu beziehen, so zur Finanzierung<br />
der ärztlichen Weiterbildung,<br />
zur Abstimmung der<br />
ärztlichen Aus-Weiter-und Fortbildung<br />
und neu initiiert zur Frage der<br />
Interprofessionalität. ■<br />
Quellen:<br />
– www.nationalegesundheit.ch<br />
– www.bag.admin.ch ➝ Themen ➝<br />
Gesundheitsberufe ➝ MedGB/Medizinalberufekommission/Plattform<br />
Zukunft (inkl. Auflistung aller<br />
beteiligten Organisationen und Behörden)<br />
– www.siwf.ch<br />
Offen für Neues?<br />
Visitationen bilden ein Element für das Überprüfen und Sicherstellen<br />
der Weiterbildungsqualität an einer Weiterbildungsstätte.<br />
Ein Visitationsteam, bestehend aus Vertretern des<br />
SIWF, der entsprechenden Fachgesellschaft und des <strong>VSAO</strong>,<br />
besucht die Klinik; vor Ort können die Umsetzung des Weiterbildungskonzeptes<br />
und die Verhältnisse überprüft werden. Ziel<br />
ist es, im Sinne einer positiv-konstruktiven Rückmeldung<br />
mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen und zu nutzen.<br />
Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte, die gerne für den<br />
<strong>VSAO</strong> Visitationen begleiten möchten, melden sich bei Béatrice<br />
Bertschi, unserer Sachbearbeiterin für Weiterbildung/Visitationen<br />
im <strong>VSAO</strong> (bertschi@vsao.ch).<br />
Feedback-Pool<br />
(D)ein kleiner, aber wertvoller<br />
Beitrag für eine gute<br />
Weiter- und Fortbildung<br />
Um im Bereich der ärztlichen Weiter- und Fortbildung Meinungen<br />
zu einem Thema unserer Mitglieder einholen zu<br />
können, wurde der Feedback-Pool eingerichtet.<br />
Macht mit, und helft dem <strong>VSAO</strong> damit, den Horizont im Ressort<br />
Weiterbildung etwas zu erweitern und Überlegungen<br />
breiter abzustützen.<br />
Weitere Infos unter www.vsao.ch und Anmeldung per E-Mail<br />
an bertschi@vsao.ch.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
13
weiterbildung<br />
Bewährtes Kontrollinstrument<br />
Am 12. Januar <strong>2012</strong> lud das Schweizerische Institut für ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung<br />
(SIWF) zu einer Visitatorentagung ein. Ziel der Veranstaltung war es, die Anwesenden über<br />
neuigkeiten bei den Visitationen zu informieren und Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch<br />
zu bieten. Eingeladen waren auch die mittlerweile über 70 <strong>VSAO</strong>-Vertreterinnen und -Vertreter.<br />
Ryan Tandjung, GA-Mitglied Ressort Weiterbildung<br />
Seit fast zehn Jahren werden kontinuierlich<br />
Visitationen durchgeführt, um die<br />
Qualität der Weiterbildungsstätten zu prüfen.<br />
Ursprünglich war die FMH damit<br />
betraut, seit der Gründung des SIWF fällt<br />
diese Aufgabe in dessen Zuständigkeitsbereich.<br />
Visitationen sind das zentrale Element<br />
zur Überprüfung der Weiterbildungsqualität<br />
an den einzelnen Weiterbildungsstätten.<br />
Seit der Einführung des<br />
Medizinalberufegesetzes (MedBG) ist die<br />
Weiterbildung staatlich geregelt; der Bundesrat<br />
übertrug dem SIWF unter anderem<br />
die Qualitätssicherung der ärztlichen Weiterbildung.<br />
Dreierteam vor Ort<br />
Ein Visitationsteam besteht aus einem<br />
Vertreter der jeweiligen Fachgesellschaft<br />
(Visitationsleiter), einem fachfremden<br />
Experten, der im Auftrag des SIWF die<br />
Visitation begleitet, und einem Vertreter<br />
unseres Verbandes. Im Vorfeld der Visitation<br />
machen sich die Visitatoren anhand<br />
einer umfangreichen Dokumentation mit<br />
der Weiterbildungsstätte vertraut. Diese<br />
Unterlagen enthalten unter anderem vom<br />
Leiter der Weiterbildungsstätte und den<br />
Weiterzubildenden ausgefüllte Fragebogen,<br />
das entsprechende Weiterbildungskonzept<br />
und zusätzliche Informationen<br />
zur Weiterbildung, z.B. das Fortbildungsprogramm,<br />
der Operationskatalog etc. In<br />
einem nächsten Schritt erfolgt der Besuch<br />
vor Ort. Die eigentliche Visitation dauert<br />
in der Regel einen halben Tag und besteht<br />
aus verschiedenen Interviews mit Vertretern<br />
aller Kaderstufen und den Weiterzubildenden<br />
sowie einer Besichtigung der<br />
relevanten Einrichtungen.<br />
Visitiert werden grundsätzlich jene Weiterbildungsstätten,<br />
die einen Leiterwechsel<br />
hatten, eine höhere Einstufung gemäss<br />
Weiterbildungsprogramm beantragen<br />
oder wiederholt in der SIWF Umfrage negativ<br />
bewertet wurden. Angesichts der<br />
hohen Anzahl an Weiterbildungsstätten<br />
(rund 2000 Kliniken und 1000 Arztpraxen)<br />
konnten bisher noch in fast keinem<br />
Fachgebiet regelmässige Visitationen ausserhalb<br />
der oben genannten Punkte<br />
durchgeführt werden.<br />
Vertraute Probleme<br />
Ziel der Visitation ist es, die Qualität der<br />
Weiterbildung zu überprüfen. Die Visitation<br />
erfolgt in der Regel in einer sehr kollegialen<br />
und kooperativen Atmosphäre.<br />
Nicht selten ist es so, dass die Beteiligten<br />
ähnliche Herausforderungen und Probleme<br />
aus der eigenen Klinik kennen; und<br />
manchmal können bereits während der<br />
Visitation Lösungsansätze gefunden werden.<br />
Die Visitation wird mit einem Bericht<br />
abgeschlossen. Auf der Basis des Weiterbildungsprogrammes<br />
und des Visitationsberichtes<br />
fällt die Weiterbildungsstättenkommission<br />
des SIWF den Entscheid über<br />
die Zulassung der Weiterbildung. Diese<br />
Kommission kann Empfehlungen und<br />
bindende Auflagen aussprechen, die zu<br />
einer Revisitation oder – bei Nichtbeachtung<br />
– zu einer Aberkennung der Einstufung<br />
führen kann.<br />
Neuigkeiten<br />
aus dem SIWF<br />
An der Tagung vom 12. Januar standen<br />
neben dem gegenseitigen Austausch und<br />
Vorträgen von erfahrenen Visitatoren<br />
Information über Neuerungen bei der<br />
Weiterbildung im Vordergrund. Organisatorisch<br />
ging es zum einen um die Vereinfachung<br />
und Vereinheitlichung der Dokumente,<br />
zum andern um die Neuorganisation<br />
von Weiterbildungsstätten mit weniger<br />
als fünf Weiterzubildenden. Seit<br />
2011 werden diese sogenannten kleinen<br />
Weiterbildungsstätten in der Regel durch<br />
zwei statt drei Personen visitiert. Das Visitationsteam<br />
besteht dann aus dem Visitationsleiter<br />
vonseiten der Fachgesellschaft<br />
und einem Vertreter unseres Verbandes.<br />
Politisch waren die Resultate der Akkreditierung<br />
durch das Bundesamt für Gesundheit<br />
im Jahre 2010 und das neue Finanzierungsmodell<br />
PEP («Pragmatisch»,<br />
«Einfach», «Pauschal» ) für die Weiterbildung<br />
(s. <strong>VSAO</strong> Journal 5/11) von speziel<br />
lem Interesse. Im neuen Finanzierungsmodell<br />
soll künftig die Liste der<br />
anerkannten Weiterbildungsstätten der<br />
FMH bzw. des SIWF als Grundlage für den<br />
Finanzierungsbeitrag gelten. Diese Verknüpfung<br />
wird die Tätigkeiten des SIWF<br />
(und damit auch unserer Vertreter in den<br />
entsprechenden Gremien) zusätzlich aufwerten.<br />
Offen, oder mindestens nicht abschliessend<br />
geklärt, ist im Moment noch, wie die<br />
Arztpraxen bzw. Lehrstätten für die Praxisassistenz<br />
hinsichtlich der Weiterbildungsqualität<br />
effizient und sinnvoll beurteilt<br />
werden können.<br />
Was kann jeder<br />
einzelne tun?<br />
Visitationen sind wichtige Instrumente in<br />
der Qualitätssicherung der Weiterbildung.<br />
Diese Instrumente können nur funktionieren,<br />
wenn wir aktiv mitarbeiten, sei es<br />
als Visitator des <strong>VSAO</strong> oder aber als engagierter<br />
Mitarbeiter, welcher den Visitationsteams<br />
wertvolle Inputs und Feedbacks<br />
zu seiner Weiterbildungsstätte gibt.<br />
Zudem möchte ich alle Mitglieder dazu<br />
einladen, die Fragebogen der jährlichen<br />
SIWF-Umfrage ehrlich und vollständig zu<br />
beantworten. Nur wenn wir uns wirklich<br />
alle aktiv um unsere Weiterbildung kümmern,<br />
können wir eine gute Weiterbildung<br />
erwarten.<br />
■<br />
14 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
weiterbildung<br />
Fit für Facharztprüfung Innere Medizin<br />
Bereits zum zweiten Mal wird im UniversitätsSpital Zürich ein Repekurs für Ärztinnen und Ärzte angeboten, die am 20. Juni <strong>2012</strong><br />
die Facharztprüfung für Allgemeine Innere Medizin ablegen möchten.<br />
Der Kurs findet am Freitag/Samstag, 4./5. Mai <strong>2012</strong> statt.<br />
Um das Repetitorium ganz auf die Anforderungen der Prüfung auszurichten, haben die Referenten den MKSAP-14- und 15-Fragenkatalog<br />
durchgearbeitet und typische Fragen ausgewählt. Anhand dieser Fragen werden jeweils besonders prüfungsrelevante<br />
Themen aus dem Fachgebiet repetiert.<br />
Die Teilnehmenden des letzten Jahres waren sehr zufrieden mit dem Kurs und haben ihn sehr positiv bewertet.<br />
Der Kurs dauert zwei Tage. Da dieser Kurs nicht gesponsert ist, muss ein Unkostenbeitrag von CHF 300.– erhoben werden. Darin<br />
enthalten sind die Kursunterlagen und die Verpflegung.<br />
Eine Anmeldung ist notwendig.<br />
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.medikusz.ch.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
15
weiterbildung<br />
Informationen des Berner Instituts<br />
für Hausarztmedizin<br />
Das Berner Institut für Hausarztmedizin<br />
BIHAM bietet auch <strong>2012</strong> Interessantes für<br />
Assistenzärzte mit Weiterbildungsziel AIM<br />
Curriculum Hausarzt/Praxisinternist:<br />
Rotationsstellen<br />
Für die fachspezifische Weiterbildung stehen<br />
mit dem neuen Weiterbildungstitel<br />
AIM der FMH nur noch zwei Jahre zur<br />
Verfügung. Wir vermitteln sechsmonatige<br />
Rotationsstellen mit auf die Hausarztmedizin<br />
ausgerichteten Lernzielen:<br />
Jeweils auf März und September ist<br />
die neu geschaffene Rotationsstelle Orthopädie<br />
zu besetzen:<br />
Orthopädie, Universitätsklinik für orthopädische<br />
Chirurgie Inselspital Bern,<br />
Prof. Dr. K. Siebenrock<br />
Es muss weder Nacht- noch Wochenenddienst<br />
geleistet werden! Vorgesehen ist eine<br />
tageweise Teilnahme an den verschiedenen<br />
Sprechstunden.<br />
Voraussetzung für die Stelle ist eine gute<br />
Vorbildung in Innerer Medizin.<br />
Auf September <strong>2012</strong> ist die Rotationsstelle<br />
Chirurgie zu besetzen:<br />
Allgemeine Chirurgie, Regionalspital<br />
Emmental/Chirurgische Klinik Burgdorf,<br />
PD Dr. med. S. Vorburger<br />
Voraussetzung für die Stelle sind mindestens<br />
zwei Jahre klinische Vorbildung.<br />
Unsere weiteren Rotationsstellen sind bis<br />
August 2013 ausgebucht; Bewerbungen<br />
sind ab Mitte <strong>2012</strong> wieder möglich. Bitte<br />
erkundigen Sie sich, welche Perioden noch<br />
zu besetzen sind:<br />
ORL, Universitätsklinik für HNO Inselspital<br />
Bern, Prof. Dr. M. Caversaccio<br />
Psychiatrie, Privatklinik Wyss Münchenbuchsee,<br />
Dr. med. F. Caduff<br />
Radiologie, SNB Tiefenau, Dr. med.<br />
U. Vogt (drei Monate)<br />
Bewerbungen (und Anfragen) bitte an das<br />
BIHAM richten (regina.ahrens@biham.<br />
unibe.ch); die Unterlagen werden bei Eignung<br />
für die Stelle an den jeweiligen Chefarzt<br />
weitergeleitet.<br />
Kantonal-bernische<br />
Praxis assistenz<br />
Der Grosse Rat hat im Januar <strong>2012</strong> einen<br />
mehrjährigen Verpflichtungskredit für<br />
jährlich 21 Praxisassistenzstellen<br />
gutgeheissen.<br />
Bewerbungen für das Jahr 2013 können<br />
ab sofort eingereicht werden.<br />
Weitere Angaben finden Sie auf unserer<br />
Homepage.<br />
Weiterbildungskurse<br />
Auch <strong>2012</strong> bieten wir praxisrelevante Weiterbildungskurse<br />
für angehende Grundversorger<br />
an:<br />
Ophthalmologie<br />
in der Hausarztpraxis<br />
Die Teilnehmer kennen die klinischen<br />
Bilder der häufigsten ophthalmologischen<br />
Probleme in der Allgemeinpraxis und<br />
können die notwendigen Therapien/<br />
Massnahmen einleiten.<br />
Mittwoch, 2. Mai <strong>2012</strong>, 14–17 Uhr, Dr.<br />
med. A. Klaeger, Ophtalmologe in der Praxis<br />
Pädiatrische Notfälle<br />
in der Hausarztpraxis<br />
Management der häufigsten Krankheiten<br />
im Säuglings- und Kindesalter. Erkennen<br />
und Therapie von Notfallsituationen. Notfallmedikamente<br />
für den Notfallkoffer.<br />
Mittwoch, 6. Juni <strong>2012</strong>, 14–17 Uhr, Dr.<br />
med. R. Temperli, Praxispädiater<br />
Dermatologie<br />
in der Hausarztpraxis<br />
Management von annulären Dermatosen.<br />
Vorgehen bei Pilzinfektionen der Haut,<br />
Haare und Nägel.<br />
Donnerstag, 6. September <strong>2012</strong>, Dr. med.<br />
B. Göschke, Dermatologe in der Praxis<br />
Immobilisationstechnik<br />
in der Praxis<br />
Vertiefen der Immobilisationsgrundsätze,<br />
Erlernen der gängigsten Applikationen<br />
mit rigiden und semirigiden Kunststoffmaterialien.<br />
Mittwoch, 28. November <strong>2012</strong>, 13.30–<br />
18 Uhr, D. Bühlmann, Leiter Operationspflege-Equipe,<br />
Klinik für orthopädische<br />
Chirurgie Inselspital Bern<br />
Interessierte Assistenzärzte können sich<br />
auf unserer Homepage unter Weiterbildung<br />
direkt für die Kurse anmelden. Die<br />
Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung<br />
verbindlich!<br />
Dr. Regina Ahrens, FMH Allgemeinmedizin,<br />
Mitarbeiterin Lehre<br />
Berner Institut für Hausarztmedizin<br />
BIHAM, Universität Bern<br />
Murtenstrasse 11, 3010 Bern<br />
Tel. +41 (0)31 632 89 91<br />
Fax +41 (0)31 632 89 90<br />
regina.ahrens@biham.unibe.ch<br />
www.biham.unibe.ch ■<br />
16 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
weiterbildung<br />
A B C D E F ...<br />
a b c d e f ...<br />
LESEN LERNEN<br />
Fokussieren mit Filtern<br />
Lukas Staub, Redaktionsmitglied <strong>VSAO</strong>-Journal<br />
Der letzte Beitrag zeigte, wie sich Fragen<br />
des klinischen Alltags in bestimmte Fragetypen<br />
einteilen und dann mithilfe der<br />
PICO-Formulierung in ihre Einzelteile<br />
zerlegen lassen. Im nächsten Schritt soll<br />
in PubMed die relevante Literatur herausgesucht<br />
werden.<br />
Mit der allgemeinen Suchmaske von Pub-<br />
Med (http://www.pubmed.gov) sind sicher<br />
alle vertraut. Die PICO-Komponenten<br />
können hier direkt in der Suchzeile eingegeben<br />
werden. Dabei sieht die generelle<br />
Struktur der Frage wie folgt aus:<br />
––<br />
(Population OR Synonym1 OR<br />
Synonym2 …) AND<br />
––<br />
(Intervention OR Synonym1 OR<br />
Synonym2 …) AND<br />
––<br />
(Comparator OR Synonym1 OR<br />
Synonym2 …) AND<br />
––<br />
(Outcome OR Synonym1 OR<br />
Synonym2 …)<br />
Es sind nicht immer alle vier Komponenten<br />
notwendig; besonders Comparator<br />
und Outcome können je nach Fragestellung<br />
zu restriktiv sein. Ein nützliches<br />
Zusatzzeichen ist *, welches als Stellvertretersymbol<br />
für weitere Zeichen steht. So<br />
ist child* gleichbedeutend mit (child<br />
OR child’s OR children OR childhood).<br />
Unser Beispiel (s. Folge 1, Journal 1/12)<br />
betraf die Prävention von tiefen Beinvenenthrombosen<br />
auf Langstreckenflügen<br />
mittels Kompressionsstrümpfen. In diesem<br />
Fall könnte die Frage so lauten:<br />
(flight* OR travel) AND stocking*<br />
AND (DVT OR thrombosis). Es resultieren<br />
etwas über 60 Artikel – viel zu<br />
viele und sicher nicht alle relevant für<br />
unsere einfache Frage!<br />
Zum Glück bietet PubMed die weniger<br />
bekannte Sektion Clinical Queries an,<br />
in welcher zusätzliche Filter gesetzt werden<br />
können, um das Suchresultat sinnvoll<br />
einzuschränken. Die Clinical Queries<br />
sind in der Rubrik PubMed Tools leicht<br />
zu finden. Wenn wir hier genau wie oben<br />
beschrieben die Suchbegriffe in der Suchzeile<br />
eingeben und auf Search klicken,<br />
erscheinen die zwei Pull-down-Menüs<br />
Category und Scope.<br />
In Category kann man den Fragetyp wählen,<br />
wobei die Optionen Etiology, Diagnosis,<br />
Therapy, Prognosis und<br />
Clinical prediction guides zur Verfügung<br />
stehen. Dabei wird der Umstand<br />
genutzt, dass je nach Fragetyp unterschiedliche<br />
Studiendesigns im Vordergrund<br />
stehen, um die Frage zu beantworten.<br />
PubMed sucht uns die jeweils am<br />
besten geeigneten Designs heraus.<br />
Im Scope kann zwischen einer breiten<br />
(sensitiven) und engen (spezifischen)<br />
Suche ausgewählt werden, um die Suchresultate<br />
weiter zu begrenzen. In unserem<br />
Beispiel liefert die Suche mit den<br />
Filtern Therapy und Narrow neun<br />
klinische Studien und sechs systematische<br />
Reviews (darunter ein relativ neuer<br />
Cochrane Review). Das sieht schon besser<br />
aus. Jetzt müssen wir das beste Paper<br />
auswählen und dieses korrekt interpretieren.<br />
Aber das ist das Thema des nächsten<br />
Follow-ups.<br />
■<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
17
<strong>VSAO</strong><br />
Sektion Basel<br />
Minusstunden<br />
Treffen Assistentensprecherinnen<br />
und Assistentensprecher<br />
Als eines der Ziele für das Jahr <strong>2012</strong> hat<br />
sich der Vorstand des <strong>VSAO</strong> Basel vorgenommen,<br />
mit allen Spitaldirektionen der<br />
grossen Spitäler regelmässig Gespräche zu<br />
führen.<br />
Eines der Themen wird in diesem Jahr die<br />
Minusstundenregelung sein. Gemäss den<br />
jeweiligen Verordnungen ergibt sowohl im<br />
Baselbiet wie auch im Stadtkanton erst<br />
eine geleistete wöchentliche Arbeitszeit<br />
von unter 46 Stunden einen Minussaldo.<br />
Diese Regelung geht in den Spitälern allerdings<br />
gerne vergessen. Dies soll sich in<br />
Zukunft ändern.<br />
Im Universitätsspital Basel wurde zu einem<br />
Treffen mit allen Assistentensprecherinnen<br />
und Assistentensprechern eingeladen.<br />
Dabei ging es auch darum, den Anwesenden<br />
Dirk Bareiss vorzustellen. Er ist<br />
einer der Ärztevertreter in der neu gewählten<br />
internen Betriebskommission im Universitätsspital<br />
Basel und zugleich assoziiertes<br />
Vorstandsmitglied im <strong>VSAO</strong> Basel. Da<br />
die Spitäler ihre internen Betriebskommissionen<br />
ausbauen wollen, ist es enorm<br />
wichtig, dass der <strong>VSAO</strong> Basel dort präsent<br />
ist und die Anliegen seiner Mitglieder einbringen<br />
kann. Treffen mit den Assistentensprecherinnen<br />
und Assistentensprechern,<br />
dem <strong>VSAO</strong> Basel und Mitgliedern der Betriebskommission<br />
sollen deshalb in Zukunft<br />
regelmässig stattfinden. ■<br />
Mitgliederversammlung<br />
Die jährliche Mitgliederversammlung<br />
findet am 9. Mai <strong>2012</strong> statt. Bitte dieses<br />
Datum jetzt schon reservieren.<br />
Claudia von Wartburg,<br />
Geschäftsführerin <strong>VSAO</strong> Basel<br />
Sektion Bern<br />
Einigung bei<br />
Lohnverhandlungen<br />
Lohnabschluss mit GAV-Spitälern<br />
Wie im letzten Journal berichtet, haben<br />
sich die GAV-Sozialpartner im alten Jahr<br />
erst in Bezug auf den Teuerungsausgleich<br />
geeinigt und vereinbart, dass die Summe<br />
für individuelle Lohnerhöhungen im ersten<br />
Quartal <strong>2012</strong> verhandelt wird. Inzwischen<br />
konnte eine Einigung erzielt werden.<br />
Der vollständige Lohnbeschluss<br />
lautet wie folgt:<br />
3. Zusätzlich verpflichten sich die Arbeitgeber,<br />
bei positivem Rechnungsabschluss<br />
die Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter mit Einmalprämien am<br />
Erfolg teilhaben zu lassen. Die Personalverbände<br />
werden über Höhe<br />
und Modalitäten informiert.<br />
4. Weil das «Lohnjahr» in Zukunft von<br />
<strong>April</strong> bis März dauert, gelten die versicherten<br />
Lohnanpassungen von<br />
1. <strong>April</strong> <strong>2012</strong> bis 31. März 2013.<br />
Medienkonferenz<br />
der Personalverbände<br />
Wie jedes Jahr haben die Personalverbände<br />
im Kanton Bern am 15. Februar <strong>2012</strong><br />
der Öffentlichkeit ihre Forderungen betreffend<br />
Lohnentwicklung und Arbeitsbedingungen<br />
vorgestellt. Näheres dazu auf<br />
unserer Website www.vsao-bern.ch. ■<br />
Rosmarie Glauser,<br />
Geschäftsführerin Sektion Bern<br />
1. Das Lohnsummenwachstum beträgt<br />
gesamthaft 1,2%. Für den Teuerungsausgleich<br />
stehen 0,4% zur Verfügung,<br />
für den Stufenanstieg 0,8%.<br />
2. Der Teuerungsausgleich wird ab<br />
1. Januar <strong>2012</strong> gewährt, der Stufenanstieg<br />
ab 1. <strong>April</strong> <strong>2012</strong>. Teuerungsausgleich<br />
und individuelle Gehaltserhöhungen<br />
werden ab 1. <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
versichert.<br />
Einladung zur Mitglieder versammlung <strong>2012</strong><br />
Die ordentliche Mitgliederversammlung des <strong>VSAO</strong> Bern findet am<br />
Donnerstag, 26. <strong>April</strong> <strong>2012</strong>, um 19.00 Uhr im Restaurant Tramdepot<br />
in Bern statt.<br />
Ab 18.30 Uhr Apéro, um 19.00 Uhr beginnt die Mitgliederversammlung mit den<br />
statutarischen Geschäften, Informationen und Diskussionsmöglichkeiten. Anschliessend<br />
gibts ein Nachtessen sowie die jährliche Tombola. Detailliertere Informationen<br />
folgen per Post und auf unserer Homepage www.vsao-bern.ch.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
19
<strong>VSAO</strong><br />
Sektion Neuenburg<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen<br />
Die AMINE startet in ein Jahr <strong>2012</strong> voller<br />
Herausforderungen. Am 1. Januar <strong>2012</strong><br />
sind wir dem <strong>VSAO</strong> beigetreten. Die neue<br />
Zusammenarbeit trägt bereits erste Früchte.<br />
So haben wir eine bedeutende finanzielle<br />
Unterstützung erhalten, die es uns<br />
ermöglicht, eine eigene Geschäftsstelle<br />
unter der Leitung von Joël Vuilleumier,<br />
Rechtsanwalt, zu betreiben. Er wird uns<br />
in sämtlichen Rechtsfragen beistehen und<br />
die Mitglieder der AMINE in ihren Anliegen<br />
unterstützen. Die Koordinaten der<br />
Geschäftsstelle sind auf der Website des<br />
<strong>VSAO</strong> aufgeführt.<br />
Unser Ziel in diesem Jahr ist die Neuverhandlung<br />
des geltenden Gesamtarbeitsvertrags<br />
(GAV) aus dem Jahre 2006. Dieser<br />
wird in den meisten Abteilungen des Hôpital<br />
neuchâtelois kaum eingehalten, insbesondere<br />
was die Stellenbeschriebe, die<br />
Überstunden und die als Bereitschaftsdienste<br />
verkappten Pikettdienste angeht.<br />
Die bevorstehenden Verhandlungen werden<br />
hart sein. Deshalb haben wir mit<br />
wichtigen Verbündeten, wie der Gewerkschaft<br />
SYNA, Kontakt aufgenommen, um<br />
das bestmögliche Ergebnis in den Verhandlungen<br />
zu erzielen.<br />
Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung unseres<br />
Bekanntheitsgrades. Zu diesem Zweck<br />
haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet.<br />
Diese soll den Kameradschaftsgeist bei<br />
den Assistenz- und Oberärztinnen und<br />
-ärzten fördern. Geplant sind gesellige<br />
Anlässen und eventuell der Betrieb eines<br />
Standes am bekannten Winzerfest. Wir<br />
erhoffen uns damit, die Arbeit in unserem<br />
Kanton attraktiver zu machen. Zudem<br />
sind wir der Meinung, dass ein ausgeglichenes<br />
Privatleben die Motivation und die<br />
Effizienz am Arbeitsplatz erhöhen. Weiter<br />
möchten wir den neuen Assistenzärztinnen<br />
und -ärzten die Möglichkeit geben,<br />
sich mit älteren Kollegen über organisatorische<br />
Probleme, Stress am Arbeitsplatz<br />
usw. auszutauschen. Es hat immer noch<br />
zu viele neue Kollegen, die sich mit Antidepressiva<br />
und anderen Benzodiazepinen<br />
dopen, um in dieser harten Welt zu überleben.<br />
Wir werden unsere Attraktivität<br />
stärken, wenn wir den zukünftigen Assistenz-<br />
und Oberärztinnen und -ärzten im<br />
Kanton angenehme Rahmenbedingungen<br />
bieten. Dies wird letztlich auch unseren<br />
Patienten zugutekommen. ■<br />
Herzliche Grüsse<br />
Mikael Sacristan,<br />
Präsident der Sektion Neuenburg<br />
Sektion Solothurn<br />
Der Stein kommt<br />
ins Rollen<br />
Die Sektion Solothurn hat die Mitgliederversammlung<br />
dieses Jahr am 20. März im<br />
Bürgerspital in Solothurn abgehalten.<br />
Nach einem Apéro und der Erledigung der<br />
statuarischen Traktanden blickte der Präsident<br />
in seinem Bericht auf das vergangene<br />
Jahr zurück und schilderte kurz die<br />
laufenden und künftigen Geschäfte. Anschliessend<br />
berichtete unser Verbandsjurist<br />
Ricky Vultier über sein Referat «Umsetzung<br />
des Arbeitsgesetzes in mittelgrossen<br />
Spitälern», das er anlässlich einer<br />
Kadertagung der Medizinischen Klinik<br />
des Bürgerspitals gehalten hatte.<br />
In ebendieser Klinik der SoH haben unter<br />
dem letzten Chefarzt die meisten Verstösse<br />
gegen die gesetzlichen Vorschriften stattgefunden,<br />
sodass sich der jetzige Chef mit<br />
einer Unmenge von akkumulierten Überstunden<br />
konfrontiert sieht. Gleichzeit bestanden<br />
Dienstplanstrukturen und ein<br />
Mangel an ärztlichem Personal, die gesetzeskonforme<br />
Arbeitszeiten unmöglich<br />
machten. Nun aber wird der Versuch eines<br />
wirklichen Neuanfangs gemacht. Dass<br />
hierbei die Expertise von Ricky Vultier in<br />
Anspruch genommen wurde und der neue<br />
Chefarzt auf diesem Weg auch aktiv den<br />
Kontakt zum <strong>VSAO</strong> gesucht hat, freut uns<br />
sehr, und wir hoffen auf eine gute und<br />
konstruktive Zusammenarbeit.<br />
Im Zuge der aufgelaufenen Probleme im<br />
Bürgerspital haben wir wieder einen engeren<br />
Kontakt zu den Assistenz- und Oberärztinnen<br />
und -ärzten der Klinik aufbauen<br />
können; mit Anna Lam und Eva Kifmann<br />
haben wir ferner zwei neue Vorstandsmitglieder<br />
gewonnen.<br />
Im vergangenen Jahr intensivierten wir<br />
anlässlich einer Mitgliederbefragung den<br />
Kontakt zu den Psychiatrischen Diensten.<br />
Auf diese Weise ist es uns gelungen, die<br />
beiden Oberärzte Volker Böckmann und<br />
Marino Urbinello als neue Vorstandsmitglieder<br />
zu gewinnen. Momentan fehlt uns<br />
nur noch ein Vorstandsmitglied aus dem<br />
Spital Olten. Wir streben im laufenden<br />
Jahr an, diese Lücke zu schliessen.<br />
Problemfall SoH<br />
Nebst den unzulässigen Arbeitszeiten hat<br />
der <strong>VSAO</strong> aufgedeckt und moniert, dass<br />
die bisherige Praxis der Überstundenauszahlung<br />
der SoH nicht korrekt war. Alle<br />
Überstunden müssen mit einem Zuschlag<br />
von 25 Prozent ausgezahlt werden, was<br />
bisher nicht praktiziert worden ist. Verhandlungen<br />
mit der Personalabteilung<br />
haben bewirkt, dass seit Januar <strong>2012</strong> automatisch<br />
alle Überstundenauszahlungen<br />
mit dem Zuschlag erfolgen. Wie mit den<br />
früher nicht korrekt ausgezahlten Überstunden<br />
umgegangen wird, wird zurzeit<br />
noch verhandelt. Wir wollen erreichen,<br />
dass sich die SoH aktiv um die geschuldete<br />
Nachzahlung kümmert. Es gibt eine<br />
Verjährungsfrist von fünf Jahren. Wir rufen<br />
alle Assistenz- und Oberärzte, die zwischen<br />
2007 und 2011 Überstunden ausgezahlt<br />
bekommen haben, auf, sich selber<br />
aktiv bei der SoH zu melden und den<br />
Zuschlag nachzufordern (Adresse, E-<br />
Mail-Adresse und Telefon siehe Lohnabrechnung).<br />
Vergesst nicht, ein aktuelles<br />
Konto anzugeben.<br />
Ein weiteres Thema bleibt die Umsetzung<br />
des Anspruchs auf 104 Ruhetage pro Jahr<br />
für alle Ober- und Assistenzärzte der SoH.<br />
Das bedeutet, dass entweder alle Wochenenden<br />
frei sind, oder es für jeden gearbeiteten<br />
Wochenend- und Feiertagsdienst<br />
einen freien Tag gibt. Der Personalchef hat<br />
eine Überprüfung dieser Regelung durchführen<br />
lassen und ist zum Ergebnis ge-<br />
20 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
<strong>VSAO</strong><br />
kommen, dass diese Regelung bei etwa<br />
zehn Prozent der Ärzte nicht eingehalten<br />
wird. Wir denken, hier handelt es sich vor<br />
allem um Oberärzte, da diese Regelung<br />
wahrscheinlich durch die Nachtdienstregelungen<br />
bei den meisten Assistenten eingehalten<br />
werden kann. Wir werden mittels<br />
einer neuerlichen Umfrage bei den Oberärzten<br />
aller Kliniken ermitteln, ob hier<br />
Handlungsbedarf besteht. Aber wir bitten<br />
auch alle Assistenzärztinnen und -ärzte,<br />
bei denen diese Regelung nicht umgesetzt<br />
wird, sich zu melden, am besten direkt<br />
beim Präsidenten (siehe www.vsao.ch unter<br />
Sektionen). Bislang ist noch nicht recht<br />
abzusehen, wie sich die DRG-Einführung<br />
in der SoH auswirken wird. Auf jeden Fall<br />
ist eine kritische Begleitung durch die Sektion<br />
nötig. Wir rufen alle Mitglieder auf,<br />
uns Probleme zu melden, die sich in diesem<br />
Zusammenhang ergeben. ■<br />
Felix Kurth,<br />
Präsident Sektion Solothurn<br />
Sektion Waadt<br />
Rückblick 2011<br />
und<br />
Ausblick <strong>2012</strong><br />
Der Verband hat das Jahr 2011 mit einer<br />
positiven Note abgeschlossen: Diverse Probleme,<br />
die in Zusammenhang mit den<br />
Arbeitsbedingungen und der Weiterbildung<br />
in verschiedenen Kliniken des Kantons<br />
aufgetaucht waren, konnten zum<br />
Wohle der dort arbeitenden Ärztinnen und<br />
Ärzte gelöst werden. In anderen Kliniken<br />
werden noch zum Teil erhebliche Bemühungen<br />
nötig sein, um die seit nun 6 Jahren<br />
gültigen gesetzlichen Vorschriften<br />
einzuhalten, und vor allem um eine qualitativ<br />
hochstehende Weiterbildung zu<br />
gewährleisten. Der Vorstand der ASMAV<br />
wird sich weiterhin dafür engagieren.<br />
Ende 2011 konnte zudem ein Projekt für<br />
die Karriereplanung der Ärzte im CHUV<br />
ins Leben gerufen werden. Dieses System,<br />
welches weiter unten beschrieben wird,<br />
soll den Ärzten in Weiterbildung eine bessere<br />
Karriereplanung ermöglichen. Dies<br />
durch eine klarere Definition der Rollen<br />
der Chefärzte einerseits und der Assistenzund<br />
Oberärztinnen- und -ärzte andererseits<br />
sowie durch die Einführung einer<br />
Richtlinie und eines neuen Weiterbildungsplans.<br />
Der Vorstand der ASMAV, der<br />
eng an der Ausarbeitung des Projektes<br />
beteiligt war, begrüsst die Arbeit, die innerhalb<br />
der ärztlichen Leitung des CHUV<br />
vollbracht wurde. Letztere verfolgt die<br />
Probleme der Ärzte in Ausbildung aufmerksam<br />
mit. Es gilt nun die korrekte<br />
Implementierung dieses Systems zu überwachen<br />
und dafür zu sorgen, dass dieses<br />
innert nützlicher Frist auf kantonaler<br />
Ebene umgesetzt werden kann.<br />
Schliesslich feiern wir <strong>2012</strong> das zehnjährige<br />
Jubiläum des Bleistiftstreiks im Kanton<br />
Waadt. Dieser 2003 von den damaligen<br />
Assistenz- und Oberärzten lancierte<br />
Streik, hat zur Unterzeichnung des ersten<br />
öffentlich-rechtlichen Gesamtarbeitsvertrages<br />
geführt. Damit konnten erstmals<br />
gute Arbeitsbedingungen und eine qualitativ<br />
gute Weiterbildung vertraglich garantiert<br />
werden. Anlässlich dieses Jubiläums<br />
werden während des ganzen Jahres<br />
<strong>2012</strong> Aktionen und Anlässe stattfinden.<br />
Gleichzeitig werden wir im zweiten Halbjahr<br />
eine Umfrage bei den Mitgliedern<br />
durchführen.<br />
Trotz der wesentlichen Verbesserung der<br />
Arbeitsbedingungen im vergangenen<br />
Jahrzehnt, dürfen wir nicht vergessen,<br />
dass die Situation bei weitem nicht in allen<br />
Kliniken und Spitälern des Kantons<br />
rosig ist. Der Einsatz der Verbandsmitglieder<br />
ist also für die Erarbeitung von Lösungen<br />
entscheidend, sei es mit oder ohne<br />
Unterstützung des Vorstands. Die Mitarbeit<br />
in letzterem ist auch unerlässlich, um<br />
die Aufgaben des Verbandes sicherzustellen.<br />
Wir laden deshalb alle interessierten<br />
Personen ein, sich bei unserem Sekretariat<br />
zu melden (asmav@asmav.ch).<br />
Wir wünschen Ihnen sowohl beruflich als<br />
privat ein erfolgreiches Jahr <strong>2012</strong>. ■<br />
Freundliche Grüsse<br />
Julien Vaucher, Präsident<br />
Maryline Foerster Pidoux,<br />
Vize-Präsidentin<br />
Anja Zyska Cherix, Vize-Präsidentin<br />
Strukturierung der ärztlichen<br />
Weiter bildungen in die spezifischen<br />
Lehrgänge A, B, C, D oder X<br />
Eine Besonderheit der Weiterbildung in<br />
der Schweiz ist, dass die diplomierten Ärzte<br />
ihre Weiterbildung selber organisieren<br />
können. Weiterbildungsstellen können frei<br />
besetzt werden. Um einen Facharzttitel zu<br />
erlangen, muss ein vom SIWF (Schweizerisches<br />
Institut für ärztliche Weiter- und<br />
Fortbildung) definierter Anforderungskatalog<br />
erfüllt werden. Die Dauer der Weiterbildung<br />
wird in der Regel auf 5 oder<br />
6 Jahre festgelegt. In der Realität dauert<br />
die Weiterbildung im Durchschnitt 8 Jahre<br />
und nicht selten trifft man Ärzte an, die<br />
über 9 Jahre in verschiedenen Spitälern<br />
gearbeitet haben und noch immer keinen<br />
Facharzttitel besitzen.<br />
In der heutigen Situation, die von Ärztemangel<br />
und Umwälzungen in der Spitalfinanzierung<br />
gekennzeichnet ist, gehört<br />
die Reorganisation der Weiterbildung<br />
zu den prioritären Vorhaben des CHUV.<br />
Die Erwartungen an eine Weiterbildung<br />
sind vielfältig. Die Weiterbildung muss den<br />
Bedürfnissen der Bevölkerung, des Spitalbetriebs<br />
und der jeweiligen Abteilung gerecht<br />
werden und schliesslich den Nachwuchs<br />
im akademischen Bereich, im<br />
Spital und in der Grundversorgung sicherstellen.<br />
Zudem haben verschiedene Umfragen<br />
bei den Ärzten in Weiterbildung<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
21
<strong>VSAO</strong><br />
gezeigt (SwissMedCareer, Austrittsgespräche<br />
im CHUV), dass ihre Hauptsorge das<br />
Nichtvorhandensein eines klaren Karriereplans<br />
ist. Dazu kommt der Wunsch<br />
nach einer besseren Vereinbarkeit von<br />
Privat- und Berufsleben, die eine bessere<br />
Strukturierung der Weiterbildung erfordert.<br />
Lehrgang A<br />
Akademischer Nachwuchs: Für Ärzte,<br />
die ihre Karriere im akademischen<br />
Bereich bzw. als Kaderärzte in Universitäts-<br />
oder Kantonsspitälern planen.<br />
Lehrgang B<br />
Spitalbedürfnisse: Für Ärzte, die eine<br />
Stelle als Kaderarzt im nicht akademischen<br />
Bereich anvisieren: FHV, ausserkantonale<br />
Partnerspitäler, eventuell<br />
CHUV.<br />
Lehrgang C<br />
Praxen, Kliniken: Für Ärzte, die primär<br />
als Grundversorger oder in einer<br />
Privatklinik tätig sein wollen.<br />
Lehrgang D<br />
Diverses: Für Ärzte, die sich nicht in<br />
der Fachrichtung spezialisieren wollen,<br />
in welcher sie gerade arbeiten.<br />
Orientierung X<br />
Noch ohne Karriereplan: Für Ärzte, die<br />
am Anfang ihrer Weiterbildung stehen<br />
und noch keine Ziele definiert haben.<br />
Um die Effizienz der Weiterbildungscurricula<br />
zu verbessern, insbesondere um die<br />
Weiterbildungsdauer zu verkürzen, hat<br />
das CHUV neulich ein Weiterbildungskonzept<br />
mit den spezifischen Lehrgängen A,<br />
B, C, D oder X eingeführt (siehe Kasten).<br />
Dieses Konzept hat zum Ziel, den Assistenzärzten<br />
eine bessere Planung der Weiterbildung<br />
in verschiedenen Fachrichtungen<br />
zu ermöglichen sowie dessen Kohärenz<br />
sicherzustellen und gleichzeitig den<br />
potentiellen Nachwuchs zu orten.<br />
Das Weiterbildungsprogramm<br />
Der gewählte Lehrgang wird zusätzlich zu<br />
den fachspezifischen Zielen im Weiterbildungsprogramm<br />
aufgeführt. Der Chefarzt<br />
muss jedem neuen Arzt die jeweiligen<br />
Herausforderungen der oben erwähnten<br />
Lehrgänge aufzeigen. Die beiden Parteien<br />
legen anschliessend gemeinsam den<br />
Lehrgang fest. Dieser neue Ansatz soll einen<br />
offenen Dialog zwischen den beiden<br />
Parteien ermöglichen und zu einer regelmässigen<br />
konstruktiven Evaluation hinsichtlich<br />
der spezifischen Ziele und einer<br />
möglichen Neuorientierung führen. Das<br />
Büro Ärzte von morgen der ärztlichen<br />
Direktion des CHUV steht für weitere Auskünfte<br />
gerne zur Verfügung.<br />
Für weitere Informationen<br />
Büro Ärzte von morgen des CHUV:<br />
olivia.chatelan@chuv.ch<br />
Dr med. Sandra Deriaz, Assistentin,<br />
Ärztliche Direktion, CHUV<br />
sandra.deriaz@chuv.ch<br />
Stellenportal<br />
unter<br />
www.asmav.ch<br />
Das Stellenportal unter www.asmav.ch<br />
hat ein neues Gesicht bekommen!<br />
Die Darstellung wurde überarbeitet, um<br />
––<br />
die Lesbarkeit zu verbessern<br />
––<br />
die Benutzung zu vereinfachen<br />
(Filterfunktion)<br />
––<br />
eine verbesserte Druckversion <br />
anzubieten.<br />
Es besteht neu auch die Möglichkeit für<br />
bestimmte Stellen, das PDF-Dokument<br />
mit dem Inserat downzuloaden.<br />
Sie finden den Stellenanzeiger auf<br />
der Website der ASMAV: www.asmav.ch<br />
Zugriff: Menu principal ➛ Offres d’emplois<br />
Erinnerung –<br />
Internetplattform<br />
für<br />
Teilzeitarbeit<br />
Die Plattform für Teilzeitarbeit, die auch<br />
von der ASMAV ins Leben gerufen wurde,<br />
erfreut sich einer grossen Nachfrage seit<br />
ihrer Inbetriebnahme im Herbst 2011.<br />
Die Vorteile der Plattform für<br />
Teilzeitarbeit:<br />
Für die Ärzte<br />
Dort können Ärzte, die eine Teilzeitanstellung<br />
(jobsharing) suchen, einen Ansprechpartner<br />
finden, der Ihnen die Bewerbung<br />
in den entsprechenden Kliniken<br />
erleichtert.<br />
Für die Arbeitgeber<br />
Die zukünftigen Arbeitgeber, die Teilzeitmitarbeiter<br />
suchen, können diese Plattform<br />
auch zur Kandidatensuche benutzen.<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
auf der Website der ASMAV:<br />
www.asmav.ch<br />
Zugriff: Menu principal ➛ Plate-forme<br />
temps partiels<br />
■<br />
22 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
<strong>VSAO</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
23
<strong>VSAO</strong><br />
§<br />
Rechtsberatung<br />
Dr. iur. Rudolf M. Reck, Präsident<br />
und Jurist Zürcher Spitalärztinnen<br />
und Spitalärzte <strong>VSAO</strong>-ZH<br />
Fall 1:<br />
Ich arbeite seit fünf Jahren<br />
als angestellte Ärztin in einer<br />
Praxis. Nun möchte ich<br />
mich selbständig machen.<br />
Darf ich den Patientenstamm<br />
«mitnehmen»? Und<br />
darf ich die Patienten aktiv<br />
über meine neue Praxis informieren?<br />
Vertraglich ist<br />
dazu nichts vereinbart worden.<br />
Der Vertrag enthält<br />
auch kein Konkurrenzverbot.<br />
Die im Rahmen einer Anstellung betreuten<br />
Patienten sind Patienten der Praxis<br />
und werden im Namen und auf Rechnung<br />
des Praxisinhabers behandelt. Sie zählen<br />
also, man möge die Wortwahl entschuldigen,<br />
«zum Geschäftsbereich» des Praxisinhabers.<br />
Da jedoch kein Konkurrenzverbot<br />
vereinbart wurde, ist die Weiterbehandlung<br />
der Patienten in der neuen<br />
Praxis rechtlich unproblematisch. Angesichts<br />
des Grundsatzes der freien Arztwahl<br />
ist ohnehin fraglich, wieweit ein Konkurrenzverbot<br />
gerichtlich überhaupt durchgesetzt<br />
werden könnte.<br />
Hingegen ist es, zumindest während der<br />
verbleibenden Dauer der Anstellung, ohne<br />
Einwilligung des Praxisinhabers nicht<br />
erlaubt, aktiv Patienten in der Sprechstunde<br />
über die geplante Praxiseröffnung zu<br />
informieren. Ebenfalls nicht erlaubt ist die<br />
Mitnahme einer Adresskartei oder gar von<br />
Krankengeschichten. Will ein Patient von<br />
sich aus Informationen haben, darf natürlich<br />
kurz geantwortet werden (Rechtsquellen:<br />
Gesundheitsgesetz, Obligationenrecht,<br />
Standesordnung).<br />
Fall 2:<br />
Die fristlose Kündigung<br />
darf von Mitarbeitenden<br />
ausgesprochen werden,<br />
wenn beispielsweise trotz<br />
Hinweis an die Vorgesetzten<br />
die Anstellungsbedingungen<br />
unzumutbar bleiben.<br />
Die Anforderungen<br />
an die fristlose Kündigung<br />
sind streng. Im Folgenden<br />
wird aus einem von der<br />
Rechtsberatungsstelle<br />
des <strong>VSAO</strong>-ZH formulierten<br />
Kündigungsschreiben zitiert.<br />
Der betreffende Assistenzarzt<br />
hatte sich verzweifelt<br />
an die Rechtsberatungsstelle<br />
gewandt, nachdem<br />
er monatelang Dienste von<br />
zehn bis zwölf Tagen am<br />
Stück und Beanspruchungen<br />
mit Tagen ohne jede<br />
Arbeitspause durchgestanden<br />
hatte:<br />
«Hiermit kündige ich mein<br />
Arbeitsverhältnis fristlos,<br />
weil mir die Fortsetzung<br />
des Arbeitsverhältnisses<br />
unter den gegebenen Umständen<br />
nicht länger zuzumuten<br />
ist.<br />
Obschon ich mehrfach auf<br />
die untragbaren Verhältnisse<br />
hingewiesen habe, letztmals<br />
im Gespräch mit dem<br />
zuständigen Chefarzt, ist<br />
keine spürbare Änderung<br />
eingetreten und solche Änderungen<br />
sind auch nicht<br />
absehbar, sodass ich mich<br />
zum erwähnten Schritt gezwungen<br />
sehe.<br />
Die wesentlichsten Mängel<br />
bestehen in der fortgesetzten<br />
und massiven Missachtung<br />
der Höchstarbeitszeiten,<br />
der Ruhezeit- und der<br />
Pausenvorschriften des Arbeitsgesetzes<br />
in einem die<br />
Gesundheit gefährdenden<br />
Ausmass, ergänzt durch<br />
fortgesetzte Diffamierung<br />
und entwertendes Verhalten<br />
meines direkten Vorgesetzten,<br />
des leitenden Arztes<br />
Dr. Z mir gegenüber.<br />
Anzumerken ist ferner,<br />
dass Dr. Z, entgegen der<br />
Grundlage meiner Anstellung,<br />
in Aussicht gestellt<br />
hat, die mir zustehende<br />
Weiterbildung zu verweigern,<br />
falls ich nicht pariere.<br />
Bis heute hat sich ein Überzeitsaldo<br />
von mehreren<br />
hundert Stunden akkumuliert.<br />
Die angesammelte<br />
Überzeit ist mit dem gesetzlichen<br />
Zuschlag von 25<br />
Prozent finanziell zu kompensieren.<br />
Der Saldo ist zusammen<br />
mit dem Lohn auszurichten.<br />
Ferner verlange<br />
ich gleichzeitig Zustellung<br />
des mir zustehenden guten<br />
Arbeitszeugnisses bzw. des<br />
entsprechenden Weiterbildungsevaluationsprotokolls<br />
bis Ende dieses Monats.<br />
Eine Nachforderung<br />
wegen Nichterfüllung der<br />
gesetzlichen bzw. vertraglichen<br />
Leistungen durch das<br />
Spital behalte ich mir ausdrücklich<br />
vor.»<br />
Grundsätzlich wende man sich in solchen<br />
Fällen zunächst persönlich an den direkt<br />
verantwortlichen Vorgesetzten. Falls keine<br />
Änderung eintritt, sollte man die übernächste<br />
Hierarchiestufe, z.B. den Chefarzt<br />
oder die Spitalleitung, involvieren. Die<br />
schriftliche Dokumentation (ausgedrucktes<br />
Mail, Protokoll, Aktennotiz, evtl. ein-<br />
24 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
<strong>VSAO</strong><br />
geschriebener Brief) ist empfehlenswert.<br />
Später hat sich die zuständige regionale<br />
Arbeitsvermittlungsstelle beim Rechtsdienst<br />
<strong>VSAO</strong>-ZH gemeldet und eine Bestätigung<br />
gewünscht. Angesichts der Auskunft<br />
und der dokumentierten Umstände<br />
wurde auf eine Kürzung der Arbeitslosenentschädigung<br />
durch sogenannte Einstelltage<br />
verzichtet (Rechtsquellen: Arbeitsgesetz,<br />
kantonales Personalrecht,<br />
Obligationenrecht).<br />
Es bleibt in solchen Fällen die Frage, ob<br />
sich nach derartigen Vorkommnissen etwas<br />
ändert. Oft ist dies nicht der Fall. Im<br />
Rahmen der Rechtsberatung stehen aber<br />
die individuelle Beratung und rasche Hilfe<br />
für die betroffenen Mitglieder im Vordergrund.<br />
<br />
■<br />
Geglückter Start<br />
Wer für seine Kinder einen Kitaplatz sucht, muss einen langen Atem haben. Oftmals bestehen<br />
endlose Wartelisten und wenig Hoffnung auf schnelle Besserung. Der <strong>VSAO</strong> bietet seinen Mitgliedern<br />
seit einem Jahr Unterstützung bei der Suche nach Kitaplätzen an. Mit Erfolg, wie eine<br />
erste Auswertung zeigt.<br />
Beatrice Sahli, stv. Leiterin Mitgliedschaftswesen<br />
Seit März 2011 bieten wir unsere Dienstleistung<br />
«Vermittlung von Kitaplätzen»<br />
an. Regelmässig erhalten wir Anfragen<br />
von Mitgliedern, die von unserer Unterstützung<br />
profitieren möchten. Innerhalb<br />
eines Jahres haben wir über 50 Anfragen<br />
bearbeitet. Ein grosser Teil der Anfragen<br />
betreffen die Kantone Bern, Zürich und<br />
Genf.<br />
Unsere Vorabklärungen haben sich in der<br />
Praxis bestätigt: Es ist oftmals aufwendig<br />
und schwierig, einen Platz zu finden.<br />
Manchmal reichen wenige Telefonate,<br />
und man hat einen freien Platz gefunden,<br />
in der Regel sind aber zehn bis zwanzig<br />
Telefonate nötig. Und nicht immer hat<br />
man danach einen definitiven Platz, sondern<br />
kann sich lediglich auf die Warteliste<br />
setzen lassen.<br />
Erfreulicherweise konnten wir trotz den<br />
nicht ganz einfachen Voraussetzungen,<br />
eine ganze Reihe von Kitaplätzen vermitteln.<br />
Leider ist es uns nicht möglich, dort<br />
Kitaplätze zu finden, wo es keine freien<br />
Plätze gibt. Hier setzt deshalb unser zweites<br />
Projekt an. Zurzeit führt die Prognos<br />
AG im Auftrag des <strong>VSAO</strong> eine Studie in<br />
Form einer Kosten-Nutzen-Analyse zum<br />
Thema «Familienfreundliche Massnahmen<br />
in Spitälern» durch. Wir werden im<br />
<strong>VSAO</strong>-Journal und auf unserer Website<br />
regelmässig darüber berichten.<br />
Ende 2011 haben wir zudem bei allen<br />
Mitgliedern, die bis dahin von unserer<br />
Kitavermittlung profitiert haben, eine<br />
Umfrage durchgeführt. Die Auswertung<br />
zeigte, dass über 90 Prozent die Dienstleistung<br />
sinnvoll finden. Ausserdem erachten<br />
drei Viertel der Umfrageteilnehmer unsere<br />
Rückmeldungen hilfreich und vier von<br />
fünf der Befragten würden unsere Unterstützung<br />
weiterempfehlen oder erneut<br />
nutzen.<br />
Wir versuchen, unsere Dienstleistung stetig<br />
zu optimieren. Deshalb sind wir für<br />
jede Rückmeldung dankbar, die wir von<br />
unseren Mitgliedern, und insbesondere<br />
von den Nutzern, der Kitavermittlung erhalten.<br />
Ihre Feedbacks können Sie uns<br />
jederzeit an sekretariat@vsao.ch zukommen<br />
lassen.<br />
■<br />
Kitaplatz gesucht – der <strong>VSAO</strong> hilft<br />
Wenn Sie einen Betreuungsplatz für Ihr Kind suchen, denken Sie daran: Seit März unterstützt<br />
Ihr Verband Sie bei dieser zeitaufwendigen Aufgabe. Eine Anfrage mittels Online-Formular beim <strong>VSAO</strong> genügt und Sie<br />
erhalten Informationen zu verfügbaren Plätzen in Ihrer Wunschregion und die entsprechenden Kontaktdaten<br />
der Tagesstätten. Weitere wichtige Informationen und das Formular finden sie unter der neuen Rubrik Arztberuf und Familie<br />
auf der <strong>VSAO</strong>-Homepage www.vsao.ch.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
25
<strong>VSAO</strong><br />
-Inside<br />
Tanja Kuster<br />
Wohnort: Grasswil<br />
Im <strong>VSAO</strong> seit: August 2010<br />
Funktion im <strong>VSAO</strong>: Lernende<br />
Der <strong>VSAO</strong> für dich in drei Worten:<br />
ein attraktiver Arbeitgeber<br />
Was machst du neben der Arbeit?<br />
Bei Eishockey-Matches zuschauen<br />
(Freund), fotografieren, Musik hören,<br />
shoppen, mit Kollegen ausgehen.<br />
Was ist dein grösster Wunsch?<br />
Glücklich und gesund sein und bleiben.<br />
Welches sind deine Hauptaufgaben im<br />
Verband?<br />
Mitgliederverwaltung, Beantworten von Mitgliederanfragen,<br />
Mitarbeit in verschiedenen<br />
Projekten (z.B. MediFuture-Kongress).<br />
Wieso <strong>VSAO</strong>?<br />
Die Arbeit war von Anfang an interessant<br />
und vielseitig, und ich fühlte mich rasch<br />
in einem tollen Team integriert. So ist mir<br />
z.B. die erste Begegnung mit unserem<br />
Verbandspräsidenten Christoph Bosshard<br />
in sehr guter Erinnerung geblieben. Er<br />
kam unkompliziert und herzlich auf<br />
mich zu, und ich fühlte mich von Anfang<br />
an ernst und «für voll» genommen. Das<br />
hat mich sehr gefreut.<br />
Was gefällt dir an deinen Aufgaben am<br />
besten?<br />
Die Abwechslung und Vielseitigkeit meiner<br />
Arbeit und die Kontakte mit den Mitgliedern.<br />
Wie sieht deine berufliche Laufbahn<br />
aus?<br />
Nach dem Abschluss der Schule und vor<br />
meiner Lehre im <strong>VSAO</strong> habe ich ein Zwischenjahr<br />
in der Romandie eingeschaltet.<br />
Die Lehre dauert noch bis übernächsten<br />
Sommer. Danach würde ich gerne die<br />
Berufsmaturitätsschule absolvier ■<br />
Sonja Trüstedt<br />
Wohnort: Gempen, ein richtiges<br />
Feriendorf<br />
Im <strong>VSAO</strong> seit: Ungefähr seit Sommer<br />
2008<br />
Funktion im <strong>VSAO</strong>: Co-Präsidentin<br />
Sektion beider Basel, GA-Mitglied<br />
(Ressortleiterin Weiterbildung),<br />
Arbeitsgruppenleitung<br />
neues Arztbild, <strong>VSAO</strong>-Delegierte<br />
Plattform Zukunft (Bundesamt<br />
für Gesundheit), Arbeitsgruppe<br />
Harmonisierung Aus-, Weiter- und<br />
Fortbildung, Ärztekammer-Ersatzdelegierte<br />
Arbeitsort und Funktion im Spital:<br />
Universitätsspital Basel, Departement<br />
für Anästhesie, Oberärztin,<br />
80 Prozent<br />
Der <strong>VSAO</strong> für dich in drei Worten:<br />
Veränderung, anerkannter Partner,<br />
Kollegen<br />
Was machst du neben der Arbeit?<br />
Fotografieren, Tauchen, Handarbeiten,<br />
Wandern, auch mit Schneeschuhen.<br />
Was ist dein grösster Wunsch?<br />
Für die Jungärzte: unbestrittene Gleichwertigkeit<br />
von Weiterbildungsaktivitäten<br />
und Forschung und Dienstleistung. Warum?<br />
Weil die Intention, das medizinische<br />
Wissen vorwärtszubringen, gleich wichtig<br />
ist für die beste Patientenversorgung wie<br />
die Persönlichkeitsbildung und der Erwerb<br />
von Fähigkeiten und ebenfalls gleich<br />
wichtig wie die tägliche Anwendung dieses<br />
Könnens.<br />
Für mich persönlich: Am Lebensende auf<br />
ein sinnerfülltes Leben zurückschauen zu<br />
können und mit mir zufrieden zu sein.<br />
Wieso <strong>VSAO</strong>?<br />
Es ist der einzige Verein, wo wir Jungärzte<br />
uns für unsere Anliegen engagieren und<br />
etwas bewirken können.<br />
26 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Was gefällt dir an deinen Aufgaben am<br />
besten?<br />
Meine Persönlichkeitsentwicklung: Der<br />
<strong>VSAO</strong> bietet mir eine Umgebung, wo ich<br />
mich zusätzlich zum Spital betätigen und<br />
entwickeln kann, mal in einer Führungsrolle,<br />
mal als Meinungsführerin, mal als<br />
Delegierte in Gremien usw.<br />
Wie sieht deine berufliche Laufbahn aus?<br />
Nach dem Staatsexamen kam ich zuerst<br />
in ein Kleinstspital in der Ostschweiz mit<br />
gemischten Diensten und 36-Stunden-<br />
Schichten. Dort habe ich zum ersten Mal<br />
vom <strong>VSAO</strong> profitiert: Unsere Überstunden<br />
wurden zu 100 Prozent ausbezahlt, nachdem<br />
sich ein Kollege mit der Unterstützung<br />
des <strong>VSAO</strong> für uns eingesetzt hatte.<br />
Anschliessend war ich rund drei Jahre<br />
Anästhesieassistentin im Kantonsspital<br />
Baden. Dann folgte ein Wechsel nach<br />
St. Gallen und schliesslich nach Basel, wo<br />
ich bei der Basler Sektion anklopfte. Zu<br />
diesem Zeitpunkt war ich schon Fachärztin.<br />
Zwar war ich immer eine <strong>VSAO</strong>-Sympathisantin;<br />
für eine aktive Mitarbeit benötigte<br />
ich aber eine langfristige Perspektive<br />
ohne ständige Spitalwechsel. ■
fokus<br />
Nicht Mann, noch Frau<br />
Ist es ein Mädchen oder ein Bub? Diese Frage lässt sich nicht immer eindeutig beantworten. Sprach<br />
man früher von Intersexualität, ist heute der Begriff Disorders of Sex Development (DSD) geläufig.<br />
Geändert hat sich auch die Sichtweise der Medizin: Menschen mit DSD werden nicht mehr automatisch<br />
operativ einem Geschlecht zugeordnet. Die Selbstbestimmung der Betroffenen ist ins Zentrum<br />
gerückt.<br />
Christine Aebi-Ochsner, Chefärztin Pädiatrie, Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendmedizin,<br />
spez. Endokrinologie und Diabetologie, Kinderspital Wildermeth am SZB<br />
Jährlich kommen in der Schweiz rund<br />
80 000 Kinder zur Welt; bei fünfzehn bis<br />
zwanzig der Neugeborenen ist das Genitale<br />
nicht eindeutig zuzuordnen. Es ist<br />
also unklar, welchem Geschlecht sie angehören.<br />
In diesen Fällen ist die wichtigste<br />
Frage nicht: «Ist das Kind gesund?»,<br />
sondern: «Was ist es, ein Bub oder ein<br />
Mädchen?» Etwas dazwischen gibt es<br />
nicht, weder ontologisch, noch zivilstandesamtlich.<br />
Sprach man früher von<br />
«Zwittern», «Hermaphroditen» oder «Intersexuellen»,<br />
bezeichnet man heute dieses<br />
Phänomen als Disorders of Sex Development<br />
(DSD). Neben der Nomenklatur<br />
hat sich auch die Sichtweise der Medizin<br />
und daraus folgend die Behandlung von<br />
Menschen mit DSD verändert (s. Kasten).<br />
Dualität und<br />
Einheitsmensch<br />
«Gott schuf Mann und Frau», sagt die<br />
Bibel, und die monotheistischen Religionen<br />
zementieren diese Dualität, die uns<br />
naturgegeben und unverrückbar erscheint<br />
– der Mann hat einen Penis, die Frau eine<br />
Vagina. Dass diese Sichtweise aber über<br />
Jahrhunderte nicht die einzige war, zeigen<br />
uns verschiedenste Beispiele. So etwa die<br />
Schriften von Galen (2. Jahrhundert.<br />
n. Chr.) oder die wunderbaren Zeichnungen<br />
von Leonardo da Vinci (1452–1519).<br />
Galen, der römische Arzt, lehrte seine<br />
Schüler, dass Penis und Vagina das Gleiche<br />
seien; die Vagina sei ein eingestülpter<br />
Penis und umgekehrt. Leonardo da Vinci<br />
zeichnet diesen Einheitsmenschen in seinen<br />
Anatomiestudien. Demnach gab es<br />
von der Antike bis ins 18. Jahrhundert die<br />
Idee eines einzigen Geschlechts in zwei<br />
verschiedenen Ausführungen. Die perfekte,<br />
heisse, männliche sowie eine etwas<br />
weniger perfekte, kühlere, weibliche Form.<br />
Dazwischen gab es alle Variationen der<br />
Natur, die uns ja auch heute bekannt sind.<br />
Neben den androgyne Frauen, sogenannten<br />
Mannweibern, waren verweiblichte<br />
Männer in allen Schattierungen akzeptiert:<br />
Die Betroffenen akzentuierten ihr<br />
Anderssein häufig durch entsprechende<br />
Kleidung.<br />
Erst im 18. Jahrhundert begann sich diese<br />
Ansicht zu ändern. Das Ein-Geschlecht-<br />
Modell musste aus politischen und philosophischen<br />
Gründen dem Zwei-Ge-<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
29
fokus<br />
Summary of Consensus Statement on intersex disorders and their management<br />
A. Hughes. Arch Dis Child, 91:544, Fig. 15: Classification of disorders of sex development<br />
Disorders of<br />
Sex Development<br />
Anlässlich der «Internationalen Consensus<br />
Conference on Intersex Disorders<br />
and their Management» wurden<br />
Richtlinien erarbeitet und im August<br />
2006 im PEDIATRICS publiziert, wonach<br />
eine neue Einteilung der «Intersexualität»<br />
erfolgte und Empfehlungen<br />
zur Betreuung der Betroffenen<br />
abgegeben wurden. Demnach wurde<br />
die Nomenklatur, v.a. auch aufgrund<br />
neuer genetischer, molekularbiologischer<br />
und endokrinologischer Erkenntnisse<br />
in Disorders of Sex Development<br />
geändert. Bezeichnungen wie<br />
Intersexualität, Hermaphroditismus<br />
usw. wurden entsprechend verlassen.<br />
(Pediatrics, Vol 118, <strong>Nr</strong> 2, August 2006)<br />
schlechter-Modell weichen. Wie es dazu<br />
kam, ist eine sehr komplexe und komplizierte<br />
Geschichte und hat viel mit Vorherrschaft,<br />
Individualismus, Kampf, Gleichstellung<br />
sowie Paternalismus zu tun.<br />
Die Medizingeschichte bildet diese Entwicklung<br />
ebenso ab, ist sie doch zu weiten<br />
Teilen auch Kulturgeschichte. Der Umgang<br />
mit Menschen mit DSD ist vorab<br />
historisch und kulturell bedingt. Was in<br />
manchen Kulturen zu vernichten ist, ist<br />
in anderen Kulturen gottähnlich. In vielen<br />
afrikanischen Ländern werden Neugeborene<br />
mit nicht klar definiertem Genitale<br />
getötet oder ausgesetzt, in Indien<br />
hingegen werden androgyne Menschen<br />
angebetet und verehrt.<br />
Operativ zugeordnet<br />
In den 50er- und 60er-Jahren des letzten<br />
Jahrhunderts wurden praktisch alle in der<br />
westlichen Welt geborenen Menschen mit<br />
DSD «korrigiert». Voraussetzung bildeten<br />
die innovativen operativtechnischen Möglichkeiten<br />
und die herrschende Lehrmeinung,<br />
dass v.a. die Erziehung und Umgebung<br />
das Kind zum Mann oder zur Frau<br />
werden lasse (Theorie von John Money).<br />
Die Entscheidung, welches Geschlecht das<br />
Kind erhalten solle, wurde durch den Chirurgen<br />
getroffen. Vielfach wurden die Eltern<br />
nicht orientiert, die Patienten schon<br />
gar nicht.<br />
Noch im Jahr 2000, anlässlich des Abschiedssymposiums<br />
eines abtretenden<br />
Chirurgen, löste die Infragestellung dieses<br />
Vorgehens einen Sturm der Entrüstung<br />
aus. Die Idee, es gebe doch nur Männer<br />
und Frauen und dazwischen gar nichts,<br />
dominierte die Diskussion. Doch der Widerspruch<br />
regte sich bereits vorher. In den<br />
letzten Jahren des 20. Jahrhunderts, hatten<br />
betroffene Menschen ihr Schweigen<br />
gebrochen. Sie informierten sich, fanden<br />
Unterstützung in Selbsthilfegruppen, vereinigten<br />
sich in Foren im Internet (www.<br />
infointersex.ch, www.netzwerk-dsd.de),<br />
gelangten an die Medien usw. Die Probleme<br />
und Anliegen der Menschen mit DSD<br />
wurden öffentlich. Diese Anliegen gipfeln<br />
in dem Wunsch, nicht a priori in die Kategorie<br />
der Zweigeschlechtlichkeit gepresst<br />
zu werden. Nicht von Ärzten zugeordnet<br />
zu werden, die meinen, es besser zu wissen.<br />
Nicht sich dem Zwang von Menschen<br />
30 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
fokus<br />
beugen zu müssen, die überzeugt davon<br />
sind, dass die eindeutige Geschlechtszugehörigkeit<br />
unsere Gesellschaft stabilisiert<br />
und ordnend beeinflusst. Und für die ein<br />
Dazwischen nicht vorgesehen ist. Viele der<br />
Menschen mit DSD wünschen sich heute<br />
ein drittes Geschlecht.<br />
Normalisierung statt Tabu<br />
Obwohl DSD immer noch weitgehend ein<br />
Tabuthema ist, ist die Betreuung heute<br />
anders als noch vor zehn Jahren. Wird ein<br />
Kind mit DSD geboren, ist dies nach wie<br />
vor ein Schock für die Eltern. Es ist deshalb<br />
äusserst wichtig, dass diese Familien<br />
von einem informierten Team betreut und<br />
beraten werden. Operative Eingriffe werden<br />
nur nach sorgfältiger Abwägung<br />
durchgeführt, oft nur bei medizinischer<br />
Indikation, z. B. bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen<br />
oder Problemen mit dem<br />
Stuhlgang. Kosmetische «Korrektur»-<br />
Operationen vor dem Pubertätsalter werden<br />
hingegen meist nicht mehr durchgeführt.<br />
Und schliesslich ist heute der<br />
Patient ist ein ganz wichtiger Partner in<br />
der Entscheidfindung. Das ist Ausdruck<br />
einer kulturellen Änderung in der Medizin,<br />
die mit «Empowerment of the Patient»<br />
einhergeht und den Arzt zu einem<br />
Partner und nicht zum Gott macht.<br />
Wir sind der Meinung, dass die bisher<br />
tabuisierte Thematik der DSD durch Aufklärung<br />
einer breiten Bevölkerung an<br />
Brisanz verlieren und «normalisiert»<br />
werden sollte. So soll es künftig möglich<br />
sein, Kinder ruhig und unaufgeregt als<br />
Kinder aufwachsen zu lassen, ohne ständige<br />
operative Korrektureingriffe, ohne<br />
Stigmatisierung, ohne Leid und Ausgrenzung.<br />
■<br />
inische Onkologie Allergologie Klinische Immunologie Nephrologie<br />
inmedizin Neurochirurgie Anästhesiologie Neurologie<br />
Nuklearmedizin Arbeitsmedizin Ophthalmologie Chirurgie Orthopädische Chirurgie Traumatologie<br />
logie Venerologie Oto-Rhino-Laryngologie Endokrinologie Diabetologie<br />
logie Gastroenterologie Pharmazeutische Medizin<br />
ologie Geburtshilfe Physikalische Medizin Rehabilitation Hämatologie<br />
rurgie Ophthalmologie Plastische<br />
etische Chirurgie Herzchirurgie Thorakale Gefässchirurgie Pneumologie Infektiologie Innere Medizin<br />
ntion Intensivmedizin Psychiatrie Psychotherapie Kardiologie Radiologie<br />
erchirurgie Gesichtschirurgie Radio-Onkologie Strahlentherapie Kinder-<br />
ugendmedizin Rechtsmedizin Kinder- und Jugendpsychiatrie Rheumatologie Kinderchirurgie<br />
pen- und Reisemedizin Klinische Pharmakologie<br />
Gesucht: Ärztinnen<br />
und Ärzte<br />
xikologie Urologie Komplementärmedizin Medizinische Genetik<br />
Gefunden werden statt suchen:<br />
jobmed.ch ist das Stellen-Portal<br />
für Ärztin nen und Ärzte. Mit<br />
dem bequemen E-Mail-Such abo<br />
lassen Sie sich von Ihrem Wunschjob<br />
finden, statt lange selber<br />
zu suchen.<br />
In Zusammenarbeit mit<br />
transparent – exklusiv –<br />
massgeschneidert<br />
publix.ch<br />
jobmed.ch – die besseren Arzt-Stellen<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
31<br />
Ins_Typo_86x133_060109.indd 1<br />
6.1.2009 16:19:24 Uhr
fokus<br />
Sie gegen ihn<br />
Vergewaltigungsprozesse hinterlassen bisweilen einen schalen Nachgeschmack, da die Wahrheit<br />
nicht immer eruierbar ist. Manchmal sind es nicht Lügengebilde, welche den wahren Sachverhalten<br />
verstellen, sondern unterschiedliche Realitätswahrnehmungen und missverständliche Interpretationen.<br />
Vergewaltigungsopfer sollten deshalb möglichst schnell professionelle Hilfe suchen.<br />
Henriette Haas, Professorin für forensische Psychologie Universität Zürich und<br />
Christiane Trapp, Rechtsanwältin un d Notarin<br />
In jüngster Zeit sind gleich mehrere Strafanzeigen<br />
gegen Prominente wegen Vergewaltigung<br />
publik geworden. Verfolgt man<br />
die Berichterstattung in den Medien, stellt<br />
sich die Frage, wie im Vergewaltigungsprozess<br />
verhindert werden könnte, dass<br />
trotz umfassenden Beweiserhebungen<br />
keine oder nur eine teilweise Rekonstruktion<br />
des Tathergangs erfolgen kann. Wissenschaftlich<br />
betrachtet, ist es nicht ungewöhnlich,<br />
wenn die Wahrheit über<br />
gewisse Ereignisse aus der Retrospektive<br />
nicht mehr eruierbar ist. Die Folgen für<br />
die betroffenen Menschen sind allerdings<br />
gravierend – sozial und oft auch gesundheitlich.<br />
Mit einer guten interdisziplinären<br />
Zusammenarbeit wären einige dieser<br />
Desaster zu verhindern, wenn zumindest<br />
einer der Tatbetroffenen sich vorher fachlichen<br />
Rat einholte.<br />
Komplexe Konstellationen<br />
Wie entstehen die besonders schwierigen<br />
Beweislagen im Vergewaltigungsprozess?<br />
Einige Szenarien beruhen darauf, dass ein<br />
Prozessbeteiligter bewusst lügt. Krasse<br />
Unwahrheiten können aber in den Einvernahmen<br />
oft aufgedeckt werden, weil sich<br />
Lügner in Widersprüche verstricken. Daneben<br />
sind auch Konstellationen anzutreffen,<br />
in denen sowohl das mutmassliche<br />
Opfer (Anzeigeerstatterin) als auch<br />
der Beschuldigte meinen, in Treu und<br />
Glauben zu handeln. Dann wird es<br />
schwierig, herauszufinden – geschweige<br />
denn nachzuweisen –, ob überhaupt ein<br />
Unrecht geschehen ist und wenn ja, wem.<br />
Aus psychologischer Sicht bieten diese Fälle<br />
aufgrund der Tatsache, dass die Dinge<br />
nicht eindeutig liegen, eine besondere<br />
Herausforderung.<br />
Eine beweismässig undurchsichtige Konstellation<br />
entsteht beispielsweise dann,<br />
wenn ein Paar sado-masochistische Sexualpraktiken<br />
lebt. Sowohl medizinisch<br />
als auch juristisch sind diese für die Beteiligten<br />
mit hohen Risiken verbunden.<br />
Der Sadomasochismus scheint der biologischen<br />
Lustsuche zu widersprechen, und<br />
das macht es auch für Fachpersonen<br />
schwer, den Betroffenen empathisch zu<br />
begegnen. Wissenschaftlich wird kontrovers<br />
diskutiert, ob die SM-Paraphilie eine<br />
Störung – oder die Kompensation einer<br />
solchen – darstellt, oder ob sie einfach<br />
eine zufallsbedingte statistische Devianz<br />
darstellt. Sofern die Betroffenen nicht unter<br />
ihrer Präferenz leiden, spielt die Frage<br />
der Ätiologie in der ärztlichen Sprechstunde<br />
keine Rolle.<br />
Grenze festlegen<br />
Gesundheitliche und soziale Risiken beim<br />
SM-Sex existieren allerdings jenseits einer<br />
psychiatrischen Pathologisierung. Anfänglich<br />
einvernehmliche Handlungen<br />
können sich leicht in solche verwandeln,<br />
die nicht mehr im gegenseitigen Einverständnis<br />
erfolgen. Denkbar ist, dass einer<br />
der Partner in der Erregung spontan die<br />
Wagnisse heraufschraubt und dabei die<br />
Grenzen des anderen massiv überschreitet.<br />
Jemand könnte ohnmächtig werden<br />
und gar nicht mehr in der Lage sein, zu<br />
kommunizieren, wohingegen der Partner<br />
dies vielleicht in einem ersten Moment gar<br />
nicht bemerkt. Besonders hoch sind diese<br />
Risiken weiter, wenn «rough sex» zur Versöhnung<br />
nach Konflikten eingesetzt wird<br />
und der Übergang vom Konflikt zum Sex<br />
bereits vor der verbalen Versöhnung stattfindet.<br />
Gemäss den Angaben der einschlägigen<br />
Milieus (z.B. www.SM.de) ist darum präventiv<br />
zu beachten, dass SM-Sex nur praktiziert<br />
werden sollte, wenn zuvor eine<br />
Vereinbarung über den Rahmen dieser<br />
Handlungen getroffen wurde nach der<br />
Maxime «safe-sane-consensual». Dies<br />
beinhaltet, dass die Partner über ihre Beziehung<br />
und ihre Sexualität offen reden<br />
müssen. Es müssen u.a. klare und unmissverständliche<br />
Zeichen zum sofortigen<br />
Abbruch einer Handlung festgelegt werden.<br />
Nur durch eine entsprechende Einwilligung<br />
ist allfälliges strafrechtlich relevantes<br />
Verhalten gerechtfertigt. Fehlt sie,<br />
steht der dominante Partner mit einem<br />
Bein im Gefängnis und der Submissive<br />
riskiert, Opfer eines Verbrechens zu werden.<br />
Einwilligungen in krasse sexuell<br />
motivierte Handlungen, die den Tod oder<br />
schwere Körperverletzung zur Folge haben,<br />
sind jedoch unmöglich (siehe Stratenwerth<br />
2011, S. 211 ff.).<br />
Ferner kann sich eine Beziehung mit SM-<br />
Sexualität nur dann in eine gute Richtung<br />
entwickeln, wenn beide Partner zueinander<br />
grundsätzlich ehrlich sind. Ein<br />
32 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
fokus<br />
Erschleichen von masochistischer Unterwerfung<br />
durch ein elaboriertes und langfristiges<br />
Lügengebäude widerspricht dem<br />
Konsens unter Erwachsenen.<br />
Subjektive Wahrheit<br />
Ein für die Beweisführung ebenfalls<br />
schwieriges Szenario entsteht durch<br />
Wahrnehmungsdifferenzen, Quellenamnesie<br />
und Selbstsuggestion. Diese psychologischen<br />
Mechanismen (oft kombiniert)<br />
trifft man sehr häufig in Rechtsstreitigkeiten<br />
jeglicher Art. Jemand hat das Gefühl,<br />
ihm sei ein Unrecht zugefügt worden und<br />
setzt nun alle Puzzlesteinchen, die dies<br />
aus seiner Sicht bestätigen, zu einem Bild<br />
zusammen. Diese subjektive Version des<br />
Vorfalls wird emotional aufgeladen, überall<br />
herumerzählt und verunmöglicht es<br />
fortan, allfällige Irrtümer einzugestehen.<br />
So verirren sich manche Leute in aussichtslose<br />
Prozesse.<br />
Missverständnisse fangen oft bei der<br />
Wahrnehmung an. Kommunikation –<br />
seien es Gespräche, Mimik oder Körperkontakt<br />
– beruht sowohl auf der Interpretation<br />
des Senders der Signale als auch auf<br />
derjenigen des Empfängers. In der Tat gibt<br />
es gefährliche Gewalt- und Sexualverbrecher,<br />
die ihre Opfer nur durch Blicke und<br />
Andeutungen in grosse, durchaus berechtigte<br />
Angst versetzen können. Nun gibt es<br />
aber auch das umgekehrte: äusserst sensible<br />
Seelen, die deutliche Worte, eine<br />
verbale Zurückweisung, eine Kritik, einen<br />
strengen Blick oder eine kräftige Umarmung<br />
als einen «Gewaltakt» oder eine<br />
«Drohung» deuten.<br />
Verfälschte Erinnerungen<br />
Eine weitere Verfälschung der Erinnerung<br />
entsteht durch die Quellenamnesie. Der<br />
Begriff bezieht sich darauf, dass man die<br />
Inhalte einer Erinnerung viel besser speichert<br />
als die Randdaten (nämlich Zeit,<br />
Ort, Quelle usw.). So wird im selber zusammen<br />
gebastelten Abbild des Vorfalls<br />
die präzise Chronologie der inneren und<br />
der äusseren Ereignisse und der Gespräche<br />
über den Vorfall durcheinandergebracht.<br />
Durch geschickt konzipierte Experimente<br />
(Loftus et al., zusammengefasst<br />
in Haas 2003) ist belegt, dass man ca.<br />
einem Viertel der (psychisch unauffälligen)<br />
Bevölkerung künstliche Erinnerungen<br />
suggerieren kann, die die Betroffenen<br />
nachher nicht mehr von den authentischen<br />
Erinnerungen an ihre Vergangenheit<br />
unterscheiden können. Zum Beispiel<br />
könnte im Gedächtnis einer Anzeigeerstatterin<br />
wegen Vergewaltigung innerhalb<br />
der Paarbeziehung durcheinandergeraten,<br />
wann genau ihr innerer<br />
Entschluss mit dem Partner zu brechen,<br />
gefallen war. War es vor, während oder erst<br />
nach dem letzten Sexualakt?<br />
Selbstsuggestion äussert sich darin, dass<br />
diejenigen Fakten, die gegen die eigenen<br />
Überzeugungen und Interessen sprechen,<br />
oft als irrelevant abgetan oder gar ganz<br />
aus den Erinnerungen ausgeblendet werden.<br />
Unnötig zu erwähnen, welche Macht<br />
die verdrängten Fakten dann in einem<br />
Strafprozess entfalten.<br />
Last, but not least entsteht ein für das Opfer<br />
gefährliches Szenario, wenn es frühere<br />
Aussagen zurückzieht (oder zurückziehen<br />
will). Dabei spielen Abhängigkeitsverhältnisse<br />
zwischen Tätern und ihren Opfern,<br />
Drohungen von Täterseite, aber auch<br />
emotionale Ambivalenzen von der Opferseite<br />
her eine grosse Rolle.<br />
Grundsätzlich ist jeder Fall anders, und<br />
man kann weder generell für die anzeigenden<br />
Frauen noch generell für die beschuldigten<br />
Männer die Hand ins Feuer<br />
legen.<br />
Konsequenzen für die<br />
ärztliche Sprechstunde<br />
Mediziner sind manchmal die ersten<br />
Fachleute, die von den Geschehnissen und<br />
somit von den genannten Risiken erfahren.<br />
Dadurch haben sie die Möglichkeit,<br />
ihren Patientinnen und Patienten mit Rat<br />
und Tat beizustehen, was bei guter Mitwirkung<br />
der Letzteren viele der erwähnten<br />
Szenarien verhindern kann. Folgende<br />
Präventionsstrategien ergeben sich aus<br />
den beschriebenen Szenarien:<br />
• Gesprächstherapeutische Begleitung<br />
von Patienten, von denen man erfährt,<br />
dass sie SM-Sex praktizieren. Es handelt<br />
sich u.a. darum, sie über die Wichtigkeit<br />
von Vereinbarungen und die<br />
Notwendigkeit absoluter Ehrlichkeit in<br />
solchen Beziehungen aufzuklären. Von<br />
Miller und Rollnick (2002) wurde eine<br />
spezielle Gesprächsführungstechnik<br />
entwickelt, um Situationen zu besprechen,<br />
in denen sich die Patienten grossen<br />
Risiken aussetzen oder gesundheitsschädigendes<br />
Verhalten an den<br />
Tag legen. Dieses sogenannte Motivational<br />
Interview hilft den Patienten,<br />
von sich aus mehr Verantwortung für<br />
ihr Verhalten zu übernehmen.<br />
• Opfern von sexueller oder anderer Gewalt<br />
kann man raten, sich nach einem<br />
Delikt unverzüglich in ärztliche Obhut<br />
zu begeben, bevor sie Anzeige erstatten<br />
oder sich an eine Beratungsstelle wenden.<br />
Für die behandelnden Ärzte geben<br />
die rechtsmedizinischen Institute Onlinemerkblätter<br />
für die Untersuchung<br />
ab und sind rund um die Uhr im Einsatz.<br />
Die Frage einer Anzeige muss<br />
nämlich oft schnell entschieden werden,<br />
damit die Spuren am Tatort, an<br />
der Täterschaft und ihren Werkzeugen<br />
ebenfalls noch gesichert werden können.<br />
• Beratung von Patienten bevor sie ein<br />
Verfahren in Gang setzen. De jure kann<br />
natürlich jedermann im Alleingang<br />
eine Strafanzeige erstatten. De facto ist<br />
aber angesichts der Komplexität der<br />
Rechtsmaterie dringend davon abzuraten,<br />
dies ohne anwaltliche Beratung zu<br />
tun. Behandelnde Ärzte können auch<br />
ohne Weiteres eine neutrale, juristische<br />
Meinung über die Beweislage zuhanden<br />
ihrer Patienten einholen, indem sie<br />
mit der Staatsanwaltschaft telefonieren<br />
und den Fall anonymisiert schildern.<br />
Falls sie sich zu Anzeige entschliessen,<br />
müssen sich die Opfer im Klaren sein,<br />
dass sie unter Umständen verpflichtet<br />
sind, alle Fakten offenzulegen. Manche<br />
Opfer wollen einen Teil der Geschehnisse<br />
aus Scham verheimlichen (z.B. eigenes<br />
Risikoverhalten). Dies führt dann<br />
dazu, dass ihre Aussage unglaubhaft<br />
erscheint und sie re-traumatisiert und<br />
evtl. wegen eines Delikts gegen die<br />
Rechtspflege sogar selber strafverfolgt<br />
werden. Sollte jemand in der ersten<br />
Einvernahme unbedachterweise Dinge<br />
verheimlicht oder falsch dargestellt haben,<br />
muss mit der Rechtsvertretung<br />
besprochen werden, wie dies gegebenenfalls<br />
zu korrigieren ist.<br />
• Zukünftigen Anzeige erstatterinnen ist<br />
zu raten, den Vorfall auch aus der Sicht<br />
der Gegenseite zu betrachten und an<br />
alle Indizien und Belege zu denken, die<br />
gegen sie selber sprechen könnten. Alle<br />
unangenehmen Fakten müssen der<br />
eigenen Rechtsvertretung von Anfang<br />
an mitgeteilt werden, sonst sind deren<br />
Bemühungen unweigerlich zum Scheitern<br />
verurteilt. 1 Dafür stehen den Opfern<br />
als Verfahrensbeteiligten bzw. als<br />
Privatklägerschaft die zur Wahrung<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
33
fokus<br />
ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte<br />
einer Partei zu. Sie können<br />
also (wiederum besser in Absprache mit<br />
der Rechtsvertretung) selber im Verfahren<br />
entsprechende Beweisanträge stellen<br />
und Eingaben machen.<br />
Die meisten Menschen, selbst gut ausgebildete,<br />
haben keine Ahnung, wie restlos<br />
gründlich ein Sachverhalt vor Gericht<br />
bewiesen werden muss, damit sie als Opfer<br />
ihre Rechte durchsetzen können und welche<br />
existenziellen Risiken sie eingehen,<br />
wenn sie unüberlegt bei der Polizei Strafanzeige<br />
erstatten. Da es sich bei vielen<br />
Fällen um Offizialdelikte handelt, läuft<br />
ein Verfahren automatisch weiter, auch<br />
wenn das Opfer es sich später anders überlegt.<br />
Selbstverständlich sollen Fälle mit<br />
ausreichender Beweislage möglichst vor<br />
Gericht kommen. Selbst wenn die Vergangenheit<br />
nicht rückgängig gemacht werden<br />
kann, kann es für die Opfer eine sinnerfüllende<br />
Aufgabe sein, weitere Machenschaften<br />
zu stoppen, um damit anderen<br />
Menschen viel Unglück zu ersparen. ■<br />
Literaturverzeichnis<br />
Bohling, F. (Jan. <strong>2012</strong> online). SM.de. Informationen<br />
zum Sadomasochismus. http://www.<br />
sm.de/<br />
Haas, H. (2003). Psychologie de la déposition,<br />
victimologie et techniques d’entretien. Recherches<br />
juridiques lausannoises, Edition<br />
Schulthess. ISBN 3 7255 4581 2.<br />
Haas, H. (2003). Observer et rédiger des documents<br />
en psychologie légale. Série: Actualités<br />
psychologiques N° 14, Institut de psychologie,<br />
Université de Lausanne. ISSN 1420-9284.<br />
Loftus, E.F. & Pickrell, J.E. (1995). The formation<br />
of false memories. Psychiatric Annals, 25:<br />
720–725.<br />
Miller, W.R. und Rollnick, S. (2002). Motivational<br />
Interviewing. Preparing People for<br />
Change. 2nd edition New York: The Guilford<br />
Press.<br />
Stratenwerth, G. (2011). Schweizerisches Strafrecht.<br />
Allgemeiner Teil I. Die Straftat. 4. Aufl.<br />
Bern: Stämpfli AG.<br />
1 Ähnliches gilt übrigens für Leute, die einen<br />
Zivilprozess anstreben. Denn auch dort ist die<br />
Gefahr riesig, aufgrund mangelnden Fachwissens<br />
und des Verdrängens unangenehmer<br />
Fakten eine Prozessniederlage zu generieren.<br />
republica<br />
Personenversicherung<br />
Sach-/Vermögensversicherung<br />
Laufbahnplanung<br />
Vorsorge-/Finanzberatung<br />
Ehre, wem Ehre gebührt.<br />
Als Mitglied profitieren Sie von exklusiven Angeboten.<br />
Zum Beispiel von einem kostenlosen Versicherungs-Check-up<br />
Schicken Sie jetzt Ihre Versicherungsunterlagen ein!<br />
➔ www.mediservice-vsao.ch<br />
34 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
fokus<br />
HIV-Präventionskampagnen<br />
bei schwulen Männern<br />
Männer, die Sex mit Männern haben, sind 30 Jahre nach dem ersten Auftreten von HIV und Aids<br />
immer noch im Fokus der Prävention. Denn obwohl sich diese Bevölkerungsgruppe überdurchschnittlich<br />
gut schützt und regelmässig testet, steigen die HIV-Neuinfektionen wieder an. Ein neuer,<br />
unkonventioneller Aktionsplan mit der Kampagne «Break The Chain» soll die Neuinfektionen nun<br />
halbieren helfen.<br />
Mark Bächer, Geschäftsleiter Life Science Communication<br />
Auf den ersten Blick erscheint es paradox:<br />
Schwule und andere Männer, die Sex mit<br />
Männern haben (MSM), testen sich relativ<br />
häufig. Eine HIV-Infektion wird deshalb<br />
früh erkannt: Rund 40 Prozent der HIV-<br />
Diagnosen erfolgen bei MSM innert sechs<br />
Monaten nach der Ansteckung – bei der<br />
heterosexuellen Bevölkerung sind es nur<br />
knapp 15 Prozent im gleichen Zeitraum. 1<br />
Das Risikobewusstsein ist nach wie vor<br />
hoch, ebenso das Schutzverhalten: Bei<br />
«Sex unter Männern:<br />
Für eine bessere sexuelle<br />
Gesundheit <strong>2012</strong>»<br />
Bundesamt für Gesundheit<br />
(BAG), Dezember 2011<br />
Sexkontakten ausserhalb der Beziehung<br />
schützen sich über 80 Prozent der MSM<br />
mit dem Präservativ. 2 Und dennoch nehmen<br />
die HIV-Infektionen in dieser Bevölkerungsgruppe<br />
stetig zu: Von 2001 bis<br />
2010 haben sich die gemeldeten HIV-Diagnosen<br />
von jährlich 141 auf 277 verdoppelt.<br />
Heute betreffen 50 Prozent aller Neuinfektionen<br />
schwule Männer. 3 Wie lassen sich<br />
solche Widersprüche erklären?<br />
Viele Neuinfektionen<br />
trotz Schutzverhalten<br />
Seit Aufkommen der antiretroviralen Therapien<br />
ab 1996 hat das Präventionsverhalten<br />
unter schwulen Männern zweifellos<br />
gelitten. Die tödliche Bedrohung des damals<br />
nicht behandelbaren Krankheitsbildes<br />
Aids war eine wichtige Antriebskraft für<br />
das Schutzverhalten. In den letzten Jahren<br />
sind denn auch eine Zunahme sexueller<br />
Kontakte ausserhalb der Beziehung sowie<br />
das häufigere Praktizieren von ungeschütztem<br />
Analverkehr mit Gelegenheitspartnern<br />
zu beobachten. Dies alleine<br />
erklärt noch nicht, weshalb die Veränderungen<br />
im Sexualverhalten von MSM einen<br />
so grossen Einfluss auf den Verlauf der<br />
Epidemie haben. Hinweise auf weitere<br />
Faktoren liefert ein mathematisches Modell<br />
4 , welches das Bundesamt für Gesundheit<br />
(BAG) von niederländischen Forschern<br />
erstellen liess. Zwei Zahlen aus dem Modell<br />
haben die Verantwortlichen aufhorchen<br />
lassen: In rund 80 Prozent der Fälle gehen<br />
die Neuinfektionen von jemandem aus, der<br />
noch nicht weiss, dass er HIV-positiv ist.<br />
Gleichzeitig kennen nur 13 Prozent der<br />
MSM ihren positiven HIV-Status nicht. Die<br />
Schlussfolgerung daraus ist, dass HIV vor<br />
allem vor der Diagnose weitergegeben<br />
wird, insbesondere während der mehrwöchigen<br />
Primoinfektionsphase.<br />
Parallele Sexbeziehungen<br />
als Risiko<br />
Die Infektiosität während der HIV-Primoinfektionsphase<br />
ist 20- bis 100-mal höher<br />
als in der späteren Latenzphase. In Beratungsgesprächen<br />
der Gesundheitszentren<br />
für schwule Männer, im Checkpoint Zürich<br />
und Genf, schält sich heraus, dass sich<br />
HIV-Neuinfektionen häufig in Konstellationen<br />
paralleler Sexbeziehungen ereignen.<br />
Männer in festen Partnerschaften haben<br />
Sexkontakte mit anderen Partnern, zu<br />
denen sie ein intimes Verhältnis pflegen.<br />
In solchen sexuellen Netzwerken verlässt<br />
man sich oft gegenseitig auf ein negatives<br />
Testresultat und lässt das Präservativ weg.<br />
Gleichzeitig trifft man mit dem festen Partner<br />
Abmachungen, um das HIV-Risiko zu<br />
mindern, beispielsweise Präservativgebrauch<br />
bei Sexkontakten ausserhalb der<br />
Beziehung. Werden diese Abmachungen<br />
nicht eingehalten, können in Teilpopulationen<br />
mit einer hohen Anzahl HIV-Primoinfektionen<br />
sogenannte Infektionsketten<br />
entstehen. Das Virus wird innert kurzer<br />
Zeit auf diverse involvierte Personen übertragen,<br />
oft inklusive den festen Partner.<br />
Nicht Freude am Sex<br />
verderben<br />
Solche Erkenntnisse helfen der Prävention,<br />
sich auf die wesentlichen Settings der<br />
HIV-Übertragung zu konzentrieren und<br />
wirkungsvoll zu intervenieren. Bereits<br />
2008 hatte die Aids-Hilfe Schweiz zusammen<br />
mit der Kommunikationsagentur<br />
Life Science Communication eine neuartige<br />
Präventionskampagne entwickelt. Ziel<br />
der Aktion «Mission Possible» war, dass<br />
sich während drei Monaten dank konsequentem<br />
Safer Sex unter schwulen Männern<br />
keine HIV-Neuinfektionen ereignen.<br />
Dadurch würden sich die Primoinfektio-<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
35
fokus<br />
nen «auswachsen», so die Idee. An die<br />
Aktion anschliessende, kostenlose HIV-<br />
Tests würden ein zuverlässiges Resultat<br />
liefern, da sich dann die Teilnehmer ausserhalb<br />
des diagnostischen Fensters befänden.<br />
Am Schluss der Aktion sollten die<br />
Teilnehmer entweder ihren HIV-Status<br />
kennen oder sich zumindest nicht mehr<br />
in einer HIV-Primoinfektion befinden.<br />
«Mission Possible» verfolgte einen lustvollen<br />
Ansatz und unterschied sich damit von<br />
früheren HIV-Präventions-Kampagnen.<br />
Ein freches Corporate Design und zahlreiche<br />
Gadgets verliehen der Aktion hohe<br />
Szenenpräsenz. Die gesamte Gay-Community<br />
wurde in die Aktivitäten einbezogen,<br />
und Szenenbetriebe konnten sich mit<br />
einem Beitrag beteiligen. Eine Kampagnen-Website<br />
mit Fotogalerie, Broschüren,<br />
eine Plakate- und Inseratekampagne, ein<br />
Blog, MMS-Mitteilungen und Online-<br />
Wettbewerbe gewährleisteten sowohl die<br />
nötige Information als auch Motivation,<br />
um die drei Monate durchzuhalten.<br />
«Break The Chain»<br />
Die HIV-Neuinfektionen bei MSM sind<br />
Ende 2008 deutlich gesunken. 5 Ob dies das<br />
Resultat von «Mission Possible» war, ist<br />
nicht wissenschaftlich belegt. Andere<br />
plausible Erklärungen fehlen jedoch. Deshalb<br />
hat das BAG entschieden, eine weitere,<br />
ähnliche Aktion im Frühling <strong>2012</strong><br />
durchzuführen. Die Projektleitung übernehmen<br />
diesmal Gesundheitszentren für<br />
schwule Männer, Checkpoint Zürich und<br />
Genf. «Break The Chain» soll schwule<br />
Männer dazu bewegen, diesmal einen<br />
Monat lang konsequent HIV-Infektionen<br />
zu verhindern, denn eine dreimonatige<br />
Aktion hat sich als sehr lange erwiesen.<br />
Zentraler Mechanismus von «Break The<br />
Chain» ist eine Applikation auf dem Mobiltelefon<br />
und im Internet, die mittels eines<br />
simplen Fragebogen ermittelt, ob jemand<br />
möglicherweise Teil einer<br />
Infektionskette ist. Entsprechend generiert<br />
die Applikation Vorschläge, wie man sich<br />
an «Break The Chain» beteiligen kann.<br />
Daraus wählen die Teilnehmer den Beitrag<br />
aus, der ihnen am meisten zusagt.<br />
Am Ende des Monats steht wieder eine<br />
Gratis-Testaktion, bei der sich Teilnehmer<br />
zusammen mit ihrem Partner testen lassen.<br />
Das BAG will «Break The Chain»<br />
jährlich wiederholen und auf weitere europäische<br />
Gay-Zentren ausdehnen. Dies<br />
soll es ermöglichen, die jährlichen HIV-<br />
Neuinfektionen wieder auf 100 Fälle zu<br />
senken.<br />
■<br />
1 HIV-Quartalszahlen per 30. September 2011,<br />
Bundesamt für Gesundheit<br />
2 Lociciro, S., Dubois-Arber, F. und Jeannin, A.<br />
(2010): Les comportements face au VIH/SIDA<br />
des hommes qui ont des relations sexuelles<br />
avec des hommes. Résultats de Gaysurvey<br />
2009. Lausanne. Institut universitaire de médecine<br />
sociale et préventive.<br />
3 HIV-Quartalszahlen per 30. September 2011,<br />
Bundesamt für Gesundheit<br />
4 van Sighem A., Vidondo B., Glass T., Bucher<br />
H.,Vernazza P., Gebhardt M., de Wolf F., Derendinger<br />
S., Jeannin A., Bezemer D., Low N.,<br />
Staub R., Fraser Ch., and the Swiss HIV Cohort<br />
Study (2011): The resurgent HIV epidemic<br />
among men having sex with men in Switzerland:<br />
a mathematical model approach, Poster<br />
IAS Rome 2011.<br />
5 Nationales Programm HIV und andere sexuell<br />
übertragbare Infektionen (NPHS <strong>2012</strong> –<br />
2017), Bundesamt für Gesundheit (BAG),<br />
Bern, 2010.<br />
36 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
fokus<br />
Die Feminisierung und ihre Folgen<br />
Die Zahl der Medizinstudentinnen steigt kontinuierlich. Im Jahr 2009 legten 61,5 Prozent Frauen ein<br />
medizinisches Staatsexamen ab. Gleichzeitig arbeiteten 34,6 Prozent Ärztinnen im Beruf, aber nur<br />
9,9 Prozent hatten eine Chefarztposition inne. 1 Es stellt sich die Frage, weshalb das so ist und was<br />
dagegen getan werden kann.<br />
Dr. Christiane Roth, Generalsekretärin Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe SGGG<br />
Besonders Fachgesellschaften, die von<br />
Frauen gerne gewählt werden, wie die<br />
Kinder- und Jugendmedizin, die Gynäkologie<br />
und Geburtshilfe oder andere, müssen<br />
sich mit den Aspekten der Feminisierung<br />
auseinandersetzen. Soll doch die<br />
Versorgung der Bevölkerung mit Fachärztinnen<br />
und Fachärzten aller Richtungen<br />
auch in Zukunft sichergestellt sein. Mit<br />
dem Erwerb des Arztdiploms mit Mitte<br />
zwanzig fängt für Ärztinnen und Ärzte<br />
ihre praktische Weiterbildung in Bezug<br />
auf eine Fachrichtung an. Diese Möglichkeiten<br />
sind heute fast unbeschränkt. Frau<br />
und Mann müssen sich jedoch möglichst<br />
früh für eine Ausrichtung entscheiden, die<br />
ihren Neigungen, Fähigkeiten und Wünschen<br />
entspricht. Dass das nicht immer<br />
einfach ist, ist unbestritten. Vor allem<br />
dann, wenn neben der Berufswahl auch<br />
die Familienplanung ein wichtiges Thema<br />
ist. Die medizinischen Fachgesellschaften<br />
sind sich dieser Problematik heute zunehmend<br />
bewusst und setzen sich damit auseinander.<br />
Ziel muss es sein, die Weiterbildung<br />
so zu gestalten, dass in vernünftiger<br />
Zeit ein Facharzttitel erreicht werden<br />
kann, der es dem Arzt und auch der Ärztin<br />
erlaubt, den Beruf in eigener Verantwortung<br />
auszuüben, d.h., dass er und sie auch<br />
davon leben kann, sei es im Spital oder in<br />
der Praxis. Dies gibt die notwendige Sicherheit,<br />
Zufriedenheit und Anerkennung,<br />
die Menschen brauchen, um in der Gesellschaft<br />
zu bestehen.<br />
Feminisierung integrieren<br />
Ein mögliches Modell, diesen Bedürfnissen<br />
zu entsprechen, wäre eine Etappierung<br />
der Weiterbildung. Eine solche Etappe mit<br />
einem Spezialarzttitel vorläufig abzuschliessen,<br />
ist eine gute Voraussetzung für<br />
Frauen, um eine Familienpause einzubauen.<br />
Zu einem späteren Zeitpunkt kann<br />
dann die Weiterbildung wieder aufgenommen<br />
werden, um Zusatzkompetenzen zu<br />
erwerben. Diese können beispielweise zum<br />
Erwerb eines Schwerpunkts oder eines<br />
Fähigkeitsausweises führen. Gerade in<br />
Disziplinen, in denen zunehmend auch<br />
seitens der Patientinnen Ärztinnen gewünscht<br />
werden, sind dies gute Voraussetzungen,<br />
um im Beruf zu bleiben und die<br />
Versorgungssicherheit zu garantieren.<br />
Gynécologie suisse, die Schweizerische<br />
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
(SGGG), hat über ein neues Weiterbildungsprogramm,<br />
das 2008 in Kraft<br />
gesetzt wurde versucht, der Entwicklung<br />
auch in Bezug auf die Feminisierung<br />
Rechnung zu tragen. Basierend darauf,<br />
kann eine Ärztin oder ein Arzt innert fünf<br />
Jahren einen Facharzttitel erwerben. Fachärzte<br />
sind somit befähigt, den Beruf in<br />
eigener Verantwortung auszuüben. Diese<br />
Sicherheit ist nicht zu unterschätzen. Es<br />
gibt heute schon mehrere gute Beispiele<br />
von Facharztträgerinnen, die ihre Lebensund<br />
Familienplanung darauf ausgerichtet<br />
haben und zufrieden damit sind. Zufriedene<br />
Menschen sind auch eher bereit, neue<br />
Herausforderungen zu suchen und mehr<br />
Verantwortung zu übernehmen.<br />
Alte Vorurteile<br />
Nicht nur die Feminisierung hat Einfluss<br />
auf die Medizinkarrieren. Die junge Generation<br />
der Ärztinnen und Ärzte – also<br />
die «new generation» – ist nicht mehr<br />
bedingungslos bereit, uneingeschränkt<br />
hohe Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen.<br />
Auch aufgrund dessen hat der Gesetzgeber<br />
die Arbeitszeiten für Assistenz- und Oberärzte<br />
drastisch gesenkt. Die Erfahrung<br />
zeigt jedoch, dass die 50-Stunden-Woche<br />
die Probleme nur teilweise löst und neue<br />
Schwierigkeiten hervorruft. So verdeutlicht<br />
eine kürzlich durchgeführte Studie,<br />
dass die Qualität der Arbeit am Patienten<br />
durch die Arbeitszeitreduktion nicht besser,<br />
sondern schlechter geworden ist. Ferner<br />
hätte sich die ärztliche Weiterbildungsphase<br />
unnötig verlängert und die<br />
generelle Zufriedenheit wäre gesunken.<br />
Berufstätige Ärztinnen mit Kindern werden<br />
trotz diesen neueren Anpassungen<br />
auch heute noch kritisch beobachtet. Dies<br />
führt dazu, dass die Frauen mit Schuldgefühlen<br />
leben und dieser Umstand ihre<br />
Situation zusätzlich belastet. Ärzte-Väter,<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
37
fokus<br />
die eine Teilzeitbeschäftigung suchen,<br />
werden weiterhin abgestempelt. Mann<br />
und Frau wird mehr oder weniger ungeschminkt<br />
zu verstehen gegeben, dass für<br />
eine Karriere im Spital oder in der Wissenschaft<br />
ein 150-Prozent-Einsatz notwendig<br />
sei. Einzig in der freien Praxis ist es möglich,<br />
das Arbeitspensum – oft mit Kolleginnen<br />
und Kollegen zusammen – so zu<br />
organisieren, dass die Work-Life-Balance<br />
ihrer semantischer Bedeutung gerecht<br />
wird.<br />
Essenzielle Vorbilder<br />
Es muss das Anliegen aller medizinischen<br />
Fachgesellschaften und Standesorganisationen<br />
sein, die jungen Ärztinnen und<br />
Ärzte zu unterstützen, damit sie fachlich<br />
und menschlich kompetent als Nachfolgegeneration<br />
im Spital, an der Universität<br />
und in der Praxis ihre Verantwortung<br />
übernehmen können. Wichtig ist die Integration<br />
der aktuellen und künftigen<br />
Bedürfnisse in die Weiterbildungsprogramme.<br />
Daneben braucht es in erster<br />
Linie Dozentinnen und Dozenten sowie<br />
Chefärztinnen und Chefärzte, die die jungen<br />
Leute für ihr Fach und ihre Disziplin<br />
schon während des Studiums und später<br />
im Spital oder im Forschungslabor begeistern<br />
können. Vorbilder sind auch heute<br />
gefragt. Meiner Meinung nach gibt es<br />
nichts Schöneres, als jüngere Menschen<br />
auf ihrem Weg in die Berufswelt zu begleiten.<br />
Sie an unseren Erfahrungen teilhaben<br />
zu lassen und ihnen über unsere<br />
Netzwerke Kontakte zu ermöglichen, die<br />
ihnen weiterhelfen und ihnen Sicherheit<br />
und Selbstvertrauen geben. Gerade in einer<br />
Gesellschaft, die primär kritisiert,<br />
bevor sie differenziert, ist dies bedeutend.<br />
Es braucht eine gelebte Überzeugung, dass<br />
Ärztinnen und Ärzte ein Anrecht auf ein<br />
erfülltes Berufs- und Familienleben haben.<br />
Dies erfordert ein Engagement für<br />
familienfreundliche Arbeitsbedingungen.<br />
Die Weiterbildungsprogramme jeder<br />
Fachdisziplin müssen es ermöglichen, ein<br />
gutes Kompetenzniveau in einer vernünftigen<br />
Zeit zu erreichen. Auf ein solches<br />
kann zu einem späteren Zeitpunkt weiter<br />
aufgebaut werden. Damit werden Voraussetzungen<br />
geschaffen, die es erlauben,<br />
eine Spitallaufbahn ins Auge zu fassen<br />
und die Leitung einer Klinik zu übernehmen.<br />
Um dem finanziellen Spannungsfeld<br />
Rechnung zu tragen, müssen Finanzierungsmodelle<br />
angeboten werden, die es<br />
zulassen, den Schritt in die Selbständigkeit<br />
mit einer vertretbaren finanziellen<br />
Belastung zu wagen. Ich bin überzeugt,<br />
dass wir auf diese Weise Ärztinnen und<br />
Ärzte motivieren können, ihren Beruf mit<br />
Freude und Begeisterung auszuüben – in<br />
welcher Fachdisziplin auch immer.<br />
Literatur<br />
Kraft E. et al.: Ärzteschaft in der Schweiz und<br />
deren Aus- und Weiterbildung. Schweiz. Ärztezeitung.<br />
2009;90(45):1733–35.<br />
Buddberg-Fischer B.: Karriereentwicklungen von<br />
Frauen und Männern in der Medizin.<br />
Schweiz. Ärztezeitung. 2001;82(35):1838–44.<br />
1 Kraft E., Hersperger M.: Ärzteschaft in der<br />
Schweiz – die Feminisierung der Medizin.<br />
Schweiz. Ärztezeitung. 2009;90(47):1823–5.<br />
38 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Perspektiven<br />
Neues zum lokalisierten Prostatakarzinom<br />
Feinere Filter – bessere Behandlung<br />
Das Prostatakarzinom ist eine der am weitesten verbreiteten Krebserkrankungen überhaupt. Dank<br />
Vorsorgeuntersuchung werden Karzinome früh erkannt. Allerdings ist das blosse Vorhandensein<br />
von Karzinomzellen noch kein Grund, aktiv zu werden. Wichtig ist es, nach ausgiebiger Aufklärung<br />
und «informed consent» auch bezüglich etwaiger Nebenwirkungen, gezielt zu diagnostizieren<br />
und zu therapieren sowie eine Überdiagnostik und -therapie zu vermeiden.<br />
Marco Randazzo, Assistenzarzt Urologie, Franz Recker, Chefarzt Urologie Kantonsspital Aarau<br />
Das Prostatakarzinom stellt in der<br />
Schweiz mit einer Mortalität von vier bis<br />
fünf Prozent nach dem Bronchialkarzinom<br />
die zweithäufigste maligne Todesursache<br />
beim Mann dar. Aber auch der Tod<br />
mit dem Karzinom bei drei bis fünf Prozent<br />
der Männer bedeutet eine belastende<br />
Morbidität mit palliativen Eingriffen und<br />
systemischen Therapien (Abb. 1). Dies ist<br />
die Spitze des Eisbergs. Die zugrunde liegende<br />
autoptische Prävalenz reicht bis zu<br />
50 Prozent, d.h., die meisten Männer sterben<br />
mit Karzinomzellen, die zeitlebens<br />
nie klinisch in Erscheinung treten.<br />
Betrachtet man die ausufernden Zahlen<br />
aus den USA, wo das Lebenszeitrisiko mittlerweile<br />
17 Prozent beträgt, die Diagnose<br />
Prostatakrebs zu bekommen (und damit<br />
zweifach über dem Prozentsatz der Morbidität<br />
liegt), so stellt sich neben dem kurativen<br />
Aspekt auch das Problem der<br />
Überdiagnostik und -therapie deutlich<br />
dar. Auch wenn die Inzidenz selbst in Massenscreeningprogrammen<br />
in Europa nur<br />
halb so hoch ist, so muss man bei uns<br />
auch von einer Überdiagnostik von aktuell<br />
ca. 50 Prozent ausgehen. Diese Überdiagnostik<br />
gilt es anzugehen. Die Zielsetzung<br />
besteht folglich darin, das behandlungswürdige<br />
Karzinom frühzeitig zu<br />
entdecken, aber nicht jedes früh entdeckte<br />
Karzinom zu behandeln. Selbst unter<br />
Berücksichtigung einer stetig steigenden<br />
Lebenserwartung, hat doch ein 70-Jähriger<br />
heutzutage noch eine durchschnittliche<br />
Lebenserwartung von 15 Jahren<br />
(Abb. 2), stellt sich hier ein gravierendes<br />
Problem.<br />
Thema Früherkennung<br />
In Analogie zum Mamma- und Colonkarzinom<br />
hat man insbesondere in den letzten<br />
eineinhalb Jahrzehnten die Früherkennung<br />
zum Thema gemacht. Zumal<br />
mit dem im Blut nachweisbaren Eiweiss,<br />
dem prostataspezifischen Antigen (PSA),<br />
erstmals ein Marker zur Verfügung steht,<br />
der ausschliesslich in der Prostata gebildet<br />
wird. Insbesondere zwei weltweit durchgeführte<br />
Studien, die European Randomized<br />
Screening Study of Prostate Cancer<br />
(ERSPC) und die Prostate Lung Cervix<br />
Ovarian Study (PLCO), haben viel zum<br />
Verständnis des Tumors und seines Markers<br />
PSA beigetragen, sodass man nach<br />
kontrovers geführter Diskussion der letzten<br />
Jahre heute datenbasierte und differenziertere<br />
Aussagen sowohl in der Diagnostik<br />
als auch in der Therapie machen<br />
kann.<br />
Es kristallisiert sich ein intelligenter Einsatz<br />
des PSA beim aufgeklärten Mann<br />
zwischen 50 und 70 Jahren heraus, der<br />
nach Information über Risiko, Therapieoptionen<br />
und Nebenwirkungen den PSA-<br />
Test bejaht (individual decision making).<br />
Diese Aufklärungsunterlagen sind in<br />
Kurz- und ausführlicher Version erhältlich<br />
[1, 2] (Abb. 3). PSA spielt in diesem<br />
Rahmen den «Gatekeeper» als Eingangsuntersuchung.<br />
Es gibt kein Karzinom, das<br />
kein PSA ausschüttet.<br />
Abb. 1: Bei einer Prävalenz von ca. 50 Prozent besteht die Gefahr einer<br />
Überdiagnostik und Übertherapie (Lebenszeitrisiko Prostatakrebs in den<br />
USA: 17 Prozent).<br />
Zielgenau testen<br />
PSA ist ein Risikostratifizierer für die zukünftige<br />
Entwicklung eines Prostatakarzinoms.<br />
Die Schweizer ERSPC-Daten<br />
zeigen, dass 50- bis 70-Jährige mit einem<br />
PSA 0–0.9 innerhalb von acht Jahren<br />
praktisch kein aggressives Karzinom<br />
entwickeln (0,08 Prozent), d.h., diese<br />
Gruppe benötigt keinen Verlaufs-PSA-Test<br />
für acht Jahre. Immerhin macht diese<br />
Gruppe die Hälfte aller Männer im Risikoalter<br />
zwischen 50 bis 70 Jahren aus<br />
(n = 489554/n = 979109). Hier können<br />
unnötige Tests vermieden werden.<br />
Männer mit PSA 1–1.99 entwickeln innerhalb<br />
von acht Jahren nur marginalst (
Perspektiven<br />
Prozent) ein aggressives Karzinom und<br />
damit ist es ebenfalls erlaubt, die PSA-Intervalle<br />
entsprechend auszudehnen (fünf<br />
Jahre oder mehr). Immerhin sind dies<br />
weitere 25 Prozent der Altersbevölkerung,<br />
denen eine regelmässige PSA-Kontrolle<br />
erspart werden kann. D.h., der Schritt weg<br />
von der Früherkennung für jeden hin zu<br />
einem Gesundheitsprogramm für Risikoträger<br />
kann gemacht werden. Diese Daten<br />
stimmen mit Langzeitbeobachtungen<br />
überein, bei denen Männer im Alter von<br />
60 Jahren mit einem PSA 3,0 ng/ml kann durch Risikokalkulatoren<br />
verbessert werden.<br />
Im Schweizer Arm der ERSPC hatten von<br />
5000 Männern 14,9 Prozent einen Wert<br />
>3.0 ng/ml und damit eine Biopsieindikation.<br />
Ungefähr jeder vierte bis fünfte<br />
dieser Männerw zeigte ein Karzinom, von<br />
denen ca. zwei Drittel behandlungswürdig<br />
waren (Abb. 4). Die daraus sowie aus den<br />
niederländischen Daten gewonnenen Erkenntnisse<br />
haben den Einsatz des PSA<br />
weiter selektioniert und zur Schaffung<br />
eines im Internet verfügbaren Risikokalkulators<br />
geführt [4]. Er basiert auf PSA,<br />
Prostatavolumen und familiärer Vorgeschichte<br />
und ermöglicht die Einsparung<br />
von rund 30 Prozent der Prostatabiopsien.<br />
Abb. 2: Kontinuierlich steigende Lebenserwartung mit zunehmendem<br />
Risiko von Alterserkrankungen.<br />
Abb. 3: Sorgfältige Aufklärung für Männer im Risikoalter.<br />
Screening<br />
Nur die ERSPC-Studie ist in der Lage, die<br />
Frage PSA-Screening vs. «no Screening»<br />
anzugehen. Die darin enthaltene schwedische<br />
Studie mit dem längsten Follow-up<br />
von 14 Jahren zeigt eine Reduktion der<br />
Mortalität um 50 Prozent. Die «number<br />
necessary to treat», um ein Leben zu retten,<br />
liegt bei acht bis zwölf Personen und<br />
damit in einem vergleichbaren Bereich<br />
wie das Mamma- oder Colonscreening.<br />
Die neuesten ERSPC-Daten werden zurzeit<br />
publiziert (NEJM). Um ein Gefühl zu<br />
vermitteln, was im klinischen Alltag die<br />
NNtreat bedeutet, sei auch der ACE-Hemmer<br />
herangezogen: Es müssen 210 Patienten<br />
behandelt werden, um einen Infarkt<br />
zu verhindern [5]. Die Harms dieser Therapien<br />
sind notabene nicht zu vergleichen<br />
und sind bei den zu operierenden/bestrahlenden<br />
Patienten natürlich wesentlich<br />
schwerwiegender.<br />
Der amerikanische PLCO-Trial kann u.a.<br />
aufgrund seiner Kontamination der Kontrollgruppe<br />
(PSA-Teste hatten mindestens<br />
56 Prozent) nicht zur Frage des Screeningbenefits<br />
heranzogen werden. In der<br />
neuesten Publikation Anfang <strong>2012</strong> im<br />
JNCI [6] rücken selbst die Autoren des<br />
PLCO-Trials erstmals von ihrer ersten Aussage<br />
von 2009 im NEJM ab, dass das PSA-<br />
Screening keinen Benefit bringt. Der<br />
Studien-designer Prorok hält neu fest,<br />
dass ihre Studie nur die Frage des opportunistischen<br />
Screenings (56 Prozent) gegen<br />
annual Screening (sechs Jahre lang)<br />
angehen kann [7]. Damit entfällt auch die<br />
wesentlichste Grundlage zur viel diskutierten<br />
aktuellen Vernehmlassung der<br />
US-Prostate-Cancer-Services-Taskforce<br />
mit Recommendation D zur Vorsorge [8].<br />
Die leidige Diskussion, welche Studie zur<br />
Vorsorge jetzt relevant sei, ist damit beantwortet.<br />
Mit den gewonnenen Daten muss<br />
vorsichtig umgegangen werden. Vorsorge<br />
reduziert einerseits die Mortalität am Karzinom,<br />
führt aber auch zu einer Überdiagnostik/Übertherapie!<br />
Der Lead-Time-<br />
Effekt führt dazu, dass die Lebenserwartung<br />
mehr als zehn Jahre sein sollte, wenn<br />
das Thema Vorsorge angesprochen wird.<br />
Kontrollierte<br />
Beobachtung<br />
Die Übertherapie von klinisch insignifikanten<br />
Karzinomen ist ein besonders<br />
anzugehendes Problem, zumal die Ne-<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
41
Perspektiven<br />
schaft für Urologie hat zu deren Erfassung<br />
im letzten Jahr eine entsprechende Datenbank<br />
für Active-Surveillance-Patienten<br />
ins Leben gerufen (SIPCAS). Die Active<br />
Surveillance vollzieht sich mittels PSA-<br />
Kontrollen sowie Verlaufsbiopsien. Das<br />
Progressionsrisiko liegt hier zwischen 25<br />
und 30 Prozent [10, 11, 12, 13]. Für diese<br />
Männer kommt prinzipiell eine kurative<br />
Therapie auch nach langjähriger Überwachung<br />
nicht zu spät, wobei keine onkologischen<br />
Nachteile zu erwarten sind [14].<br />
Den übrigen Männern bleiben auf diesem<br />
Wege aber die Kollateraleffekte einer Radikaloperation<br />
oder einer Strahlentherapie<br />
erspart.<br />
Die psychologische Belastung der Active-<br />
Surveillance-Männer und ihrer Partnerinnen<br />
ist in den Händen erfahrener Urologen<br />
als sehr gering zu sehen [13, 15].<br />
Insgesamt ist die Active Surveillance dementsprechend<br />
eine sichere und insbesondere<br />
stressarme Überwachungsstrategie<br />
für Männer mit insignifikantem Prostatakarzinom.<br />
Abb. 4: Anteil der Männer pro steigendem PSA-Intervall. Steigendes Risiko<br />
des Tumorbefalles und abnehmende Wahrscheinlichkeit einer kurativen<br />
Therapie (pT2).<br />
Abb. 5: Vorhersageparameter für das Vorliegen eines nicht therapiebedürftigen<br />
Karzinoms.<br />
benwirkungen der Therapien die Lebensqualität<br />
einschränken können (erektile/<br />
gastrointestinale Dysfunktion/Inkontinenz).<br />
Innerhalb der ERSPC-Studie mit<br />
der aktiven Aufforderung zum Screening<br />
lag die Überdiagnostik bei 54 Prozent.<br />
Diesen Männern eine Therapie ersparen<br />
zu können, ist Aufgabe der sogenannten<br />
Active-Surveillance-Strategie, der kontrollierten<br />
Beobachtung. Findet sich ein Karzinom<br />
in der Biopsie, so entscheiden Nomogramme<br />
mit histologischen, laborchemischen<br />
und volumetrischen Angaben<br />
über eine Therapiewürdigkeit [9]. Auch<br />
hier ist eine Reduktion der Behandlungen<br />
durch Active Surveillance möglich (bis zu<br />
25 bis 40 Prozent). Der ERSPC Risk Indicator<br />
gibt hierzu wichtige Entscheidungshilfen<br />
(Abb. 5). Die Schweizerische Gesell-<br />
Weitere Entwicklungen<br />
In der Labordiagnostik werden neue, spezifischere<br />
Tumormarker untersucht. Im<br />
Serum ist dies ein Kallekrein (-2) pro-PSA<br />
[16], im Urin PCA3 [17] und TMPRSS2.<br />
ERG Gen Fusion [18]. Zielsetzung ist insbesondere<br />
eine bessere Vorhersage des<br />
aggressiven Karzinoms.<br />
In der bildgebenden Diagnostik eröffnet<br />
sich durch neue Ultraschallmethoden<br />
(Histoscanning) und multimodale kernspintomographische<br />
Untersuchungen ein<br />
vielversprechendes, weites Feld. Die neuen<br />
Methoden können einerseits die Tumorlokalisationen<br />
und deren Ausmasse besser<br />
erfassen, andererseits die unterschiedlichen<br />
Aggressivitätsstufen abbilden [19,<br />
20]. Dies unterstützt die präzisere Punktionstechnik<br />
und hilft weiter, unnötige<br />
Therapien zu verhindern.<br />
Nicht jedes früh erkannte Prostatakarzinom<br />
muss behandelt werden, aber das<br />
behandlungswürdige muss früh erkannt<br />
werden! Dazu sind einerseits die Instrumente<br />
zur spezifischeren Diagnostik vorhanden,<br />
andererseits liegen die Kalkulatoren<br />
vor, um unnötige Therapien zu<br />
vermeiden.<br />
■<br />
1 http://www.urologie.ch/v2/IMG/pdf/informationen_zur_prostatakrebsvorsorge.pdf<br />
2 http://www.urologie.ch/v2/IMG/pdf/information_an_interessierte_prostatakrebsvorsorge.pdf<br />
3 Vickers AJ, Bianco FJ, Serio AM, 2010: Prostate<br />
specific antigen concentration at age 60<br />
and death or metastasis from prostate cancer:<br />
case control study BMJ 341:c4521.<br />
4 http://www.prostatecancer-riskcalculator.<br />
com/via.html<br />
5 http://ktclearinghouse.ca/cebm/glossary/<br />
nnt/gastrointestinal<br />
6 G. Andriole, P. Prorok: Prostate cancer screening<br />
in the randomized prostate lung, colorectal,<br />
and ovarian cancer screening trial:<br />
Mortality results after 13 years of follow up. J<br />
Nat Cancer Institute <strong>2012</strong>; 104: 1–8.<br />
7 www.medscape.com Januar 6, <strong>2012</strong>-01-23.<br />
8 www.sciencedirect.com journal homepage:<br />
www.europeanurology.com<br />
9 Steyerberg E.W.: J.Urol.2007 177:107–112.<br />
10 Carter HB, Kettermann A, Warlick C, Metter<br />
EJ, Landis P, Walsh PC, Epstein JI: Expectant<br />
42 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Perspektiven<br />
managepatientst of prostate cancer with curative<br />
intent: an update of the Johns Hopkins<br />
experience. J Urol 2007;178:2359–2364; discussion<br />
2364–2355.<br />
11 Klotz L, Zhang L, Lam A, Nam R, Mamedov<br />
A, Loblaw A: Clinical results of long-term<br />
follow-up of a large, active surveillance cohort<br />
with localized prostate cancer. J Clin<br />
Oncol; 28:126–131, 2010.<br />
12 Seiler (a) D, Randazzo M, Bass J, Bauer S,<br />
Baumgartner M, Huber A, Kurrer M, Kwiatkowski<br />
M, Recker F. Active Surveillance – Erfahrung<br />
des ERSPC-Zentrums Aarau 62.<br />
Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft<br />
für Urologie, Düsseldorf 2010.<br />
13 Seiler (b) D, Zeh N, Randazzo M, Künzler A,<br />
Schönberger M, Möltgen T, Kwiatkowski M,<br />
Recker F. Führt Active Surveillance zu partnerschaftlichem<br />
Stress? 66. Jahreskongress<br />
der Schweizerischen Gesellschaft für Urologie,<br />
Lausanne 2010 14.<br />
14 Warlick C, Trock BJ, Landis P, Epstein JI and<br />
Carter HB: Pathological outcomes are similar<br />
for patients in an expectant managepatientst<br />
program undergoing delayed surgical intervention<br />
compared to those undergoing immediate<br />
intervention. J Natl Cancer Inst; 98:<br />
355, 2006.<br />
15 van den Bergh RC, Essink-Bot ML, Roobol MJ,<br />
Schroder FH, Bangma CH, Steyerberg EW. Do<br />
anxiety and distress increase during active<br />
surveillance for low risk prostate cancer? J<br />
Urol;183(5):1786-91, 2010.<br />
16 Catalona WJ, Partin AW Sanda MG (2011) A<br />
multicenter study of (-2)pro prostate specific<br />
antigen combined with prostate specific antigen<br />
and free prostate specific antigen for<br />
prostate cancer detection in 2.0 to 10.0 ng/ml<br />
prostate specific antigen range. J Urol.<br />
185:1650–55.<br />
17 Roobol MJ, Schröder FH, van Leuwen P (2010)<br />
Performance of the prostate cancer antigen<br />
3 (PCA3) gene and prostate specific antigen<br />
in prescreened men:exploring the value of<br />
PCA3 for first line diagnostic Eur Urol<br />
58:475–81.<br />
18 Salami SS, Schmidt F., Laxman B, (2011)<br />
Combining urinary detection of TMPRSS2:ERG<br />
and CaP3 with serum PSA to predict diagnosis<br />
of prostate cancer Urol Oncol.<br />
19 Initial Experience With Identifying High-<br />
Grade Prostate Cancer Using Diffusion-<br />
Weighted MR Imaging (DWI) in Patients<br />
With a Gleason Score ≤3 + 3 = 6 Upon Schematic<br />
TRUS-Guided Biopsy: A Radical Prostatectomy<br />
Correlated Series.<br />
Somford DM, Hambrock T, Hulsbergen-van<br />
de Kaa CA, Fütterer JJ, van Oort IM, van Basten<br />
JP, Karthaus HF, Witjes JA, Barentsz JO.<br />
Invest Radol. <strong>2012</strong> Jan 30. [Epub ahead of<br />
print]<br />
20 Predictive value of MRI in the localization,<br />
staging, volume estimation, assessment of<br />
aggressiveness, and guidance of radiotherapy<br />
and biopsies in prostate cancer.<br />
Yakar D, Debats OA, Bomers JG, Schouten MG,<br />
Vos PC, van Lin E, Fütterer JJ, Barentsz JO.<br />
J Magn Reson Imaging. <strong>2012</strong> Jan;35(1):20–<br />
31. doi: 10.1002/jmri.22790.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
43
Perspektiven<br />
Aus der «praxis»*<br />
Medizinische Onkologie, Luzerner Kantonsspital, Luzern<br />
Das Prostatakarzinom:<br />
Eine Übersicht aktueller<br />
Behandlungsstrategien*<br />
Prostate Cancer: A Review of Therapeutic Strategies<br />
R.C. Winterhalder<br />
Das Prostatakarzinom ist die häufigste<br />
Tumorkrankheit des Mannes und zeigt<br />
mit einem mittleren Erkrankungsalter<br />
von 68 Jahren die höchste alterspezifische<br />
Krebsinzidenz. Aus epidemiologischer<br />
Sicht wird mit einer Zunahme der Häufigkeit<br />
von rund 30% in den nächsten 20 Jahren<br />
gerechnet. Schon heute wird diese<br />
Diagnose in der Schweiz über 4000-mal<br />
pro Jahr gestellt und über 1300 Patienten<br />
versterben an den Krankheitsfolgen.<br />
Verschiedenste Therapieoptionen werden<br />
eingesetzt um in frühen Stadien Heilung<br />
und bei fortgeschrittenem Leiden bestmögliche<br />
Palliation zu erreichen.<br />
Das lokalisierte<br />
Prostata-karzinom<br />
Bei einem 68-jährigen, gesunden Mann<br />
wurde wegen eines PSA von 9.2 ng/ml und<br />
zunehmenden Miktionsbeschwerden die<br />
Verdachtsdiagnose eines radiologisch lokalisierten<br />
Prostatakarzinoms gestellt.<br />
Die Stanzbiopsien zeigten ein wenig differenziertes<br />
Adenokarzinom mit einem<br />
Gleason-Score von 9.<br />
Die folgenden Therapieoptionen stehen<br />
uns heute in dieser Situation zur Auswahl:<br />
1. Expektatives Verhalten <br />
(active surveillance)<br />
2. Radiotherapie (perkutan Strahlen-<br />
therapie oder Brachytherapie)<br />
3. Radikale Prostatektomie<br />
Expektatives Verhalten<br />
Die Idee dieser Strategie ist es, eine kurative<br />
Therapie zu initiieren, wenn eine<br />
Tumorprogression eintritt, bei stabilem<br />
Verhalten der Krankheit jedoch die Toxizität<br />
der Therapie zumindest temporär zu<br />
vermeiden. In Frage kommt dieses Vorgehen<br />
nicht nur bei Patienten mit schweren<br />
Komorbiditäten, die eine kurative Therapie<br />
verbieten, sondern auch bei Betroffenen<br />
über 65 Jahren mit so genannt «guten»<br />
Prognosefaktoren (Tumor klinisch<br />
nicht palpabel, Gleason 3 Jahre, geringer Karzinomanteil<br />
in den systematisch entnommenen<br />
Biopsien). Oftmals können Nomogramme<br />
(wie unter www.uroweb.org) zur<br />
Entscheidungs hilfe eingesetzt werden.<br />
Entscheidet man sich gemeinsam mit<br />
dem Patienten für diesen Weg, ist eine<br />
engmaschige Kontrolle notwendig: PSA-<br />
Messung und digitale rektale Untersuchung<br />
(DRE) 3-monatlich während<br />
zwei Jahren; wiederholte Biopsien nach<br />
drei Monaten und/oder einem Jahr; bei<br />
stabilem Verhalten Ausdehnung der Untersuchungen<br />
auf 6-monatlich bis jährlich.<br />
Ein aktives Vorgehen wird empfohlen,<br />
wenn die PSA-Verdopplungszeit kürzer als<br />
drei Jahre wird, bei auffälliger DRE oder<br />
einer Progression zu einem höheren<br />
Gleason-Score.<br />
Mit Einhalten dieser Regeln konnte gezeigt<br />
werden, dass das Gesamtüberleben<br />
vergleichbar mit einer radikalen Prostatektomie<br />
ist [1]. Dieses Vorgehen bedingt<br />
aber eine intensive Kommunika tion mit<br />
dem Patienten, da die Be lastung, eine<br />
kurative Option nicht zu ergreifen, erheblich<br />
sein kann, aber gegen die unerwünschten<br />
Wirkungen anderer Therapien<br />
abgewogen werden muss (Tab. 2).<br />
Abb. 1: Computertomographische<br />
Aufnahme implantierter Seeds.<br />
Radiotherapie<br />
Die Strahlentherapie ist eine weitere Option<br />
in der Behandlung des lokalisierten<br />
Prostatakarzinoms. Am häufigsten wird<br />
dabei die konventionelle transku tane Bestrahlung<br />
eingesetzt, vor allem auch bei<br />
Patienten mit Verdacht auf eine extraprostatische<br />
Ausdehnung. Es gibt leider bisher<br />
keine Studie mit Randomisierung zwischen<br />
operativem Vorgehen und Radiotherapie,<br />
aber in den vor liegenden Daten<br />
sind die Langzeit resultate bezüglich<br />
Krankheitskontrolle vergleichbar [2]. In<br />
einer retrospektiven Analyse mit über<br />
2900 Patienten zeigten die Radiotherapie<br />
mit >72 Gy und die radikale Operation ein<br />
krankheitsfreies Überleben nach 5 Jahren<br />
von je 81% [3]. Ein Vorteil dieser nichtinvasiven<br />
Therapie liegt in der niedrigeren<br />
Rate schwerer Urininkontinenz [4] dafür<br />
werden rektale Blutungen in bis zu 18%<br />
der Fälle und Impotenz in 40–60% beobachtet<br />
[5,6].<br />
Eine weitere Form der Bestrahlung ist die<br />
Brachytherapie, bei der radioaktive Seeds<br />
unter transrektaler sonographischer Führung<br />
direkt in die Prostata implantiert<br />
werden (Abb. 1). Das Ziel ist es, bei optimaler<br />
Krebskontrolle minimale Nebenwirkungen<br />
zu haben. Patienten mit niedrigem<br />
Risiko (Tab. 1), haben mit dieser<br />
* Referat an der Zentralschweizer Internistenwoche,<br />
Engelberg, 24.–28.11.2008<br />
Im Artikel verwendete Abkürzungen:<br />
DRE Digitale rektale Untersuchung<br />
HRPC Hormonrefraktäres Prostatakarzinom<br />
44 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Perspektiven<br />
Risikogruppe Klinisches Stadium Gleason-Score PSA (ng/ml)<br />
Low risk T1c–T2a #6 20<br />
Tab. 1: Risikogruppen des Prostatakarzinoms.<br />
Therapie<br />
Expektatives Verhalten<br />
Radiotherapie<br />
Radikale Prostatektomie<br />
Androgenentzug<br />
Chemotherapie<br />
Tab. 2: Potentielle Therapiekomplikationen.<br />
Mögliche Komplikationen<br />
Krankheitsprogression<br />
Psychische Belastung / Angst<br />
Miktionsbeschwerden<br />
Impotenz<br />
Strahlenproktitis<br />
Perioperative Mortalität<br />
Impotenz<br />
Inkontinenz<br />
Hitzewallungen<br />
Verlust Leistungsfähigkeit / Fatigue<br />
Impotenz / Libidoverlust<br />
Kognitive Einbussen / Depression<br />
Anämie<br />
Osteoporose und Frakturen<br />
Risiko Diabetes / kardiovaskulär<br />
Febrile Neutropenie<br />
Anämie<br />
Fatigue<br />
Neuropathie<br />
Anorexie und Gewichtsverlust<br />
gilt deshalb nicht als indiziert. Dieser<br />
Vorteil konnte hingegen mit einer adjuvanten<br />
Therapie nachgewiesen werden.<br />
Sowohl Studien mit LH-RH-Analoga als<br />
auch Antiandrogenen zeigten ein verbessertes<br />
progressionsfreies Überleben, vor<br />
allem bei lokal fortgeschrittenen Tumoren<br />
und bei Lymphknotenmetastasen [12,13].<br />
Das metastasierte<br />
Prostatakarzinom<br />
Drei Jahre nach Diagnosestellung und<br />
radikaler Prostatektomie wurden bei unserem<br />
Patienten ein massiv erhöhtes PSA<br />
gemessen (511 ng/ml) und bei Rückenschmerzen<br />
skelettszintigraphisch multiple<br />
Knochenmetastasen nachgewiesen<br />
(Abb. 2).<br />
Hormontherapie<br />
Beim metastasierten Prostatakarzinom ist<br />
die Hormontherapie Standard. Bei asymptomatischen<br />
Patienten wird der optima-<br />
Methode nach sieben Jahren ein krankheitsfreies<br />
Überleben von 93% [2,7]. Nach<br />
einem Jahr waren über 50% der Patienten<br />
in der sexuellen Funktion kaum gestört<br />
(nur 29% nach Operation).<br />
In der Praxis gilt eine neoadjuvante Hormontherapie<br />
drei Monate vor einer Radiotherapie<br />
bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem<br />
Karzinom trotz ge ringem<br />
Evidenzgrad als Standard [8]. Der Nutzen<br />
einer adjuvanten dreijährigen Hormontherapie<br />
mit einem LH-RH-Analogon ist<br />
hingegen klar belegt und führt neben einem<br />
signifikant verlängerten progressionsfreien<br />
Intervall nach fünf Jahren (74%<br />
vs. 40%; p = 0.0001) auch zu einem verbesserten<br />
Gesamtüberleben (78% vs. 62%;<br />
p = 0.0002) [9].<br />
Radikale Prostatektomie<br />
Die nervenschonende radikale Prostatektomie<br />
wird heute sowohl offen retropubisch,<br />
laparoskopisch als auch Roboterassistiert<br />
durchgeführt. In der einzigen<br />
prospektiv-randomisierten Studie mit<br />
expektativem Vorgehen versus aktive Therapie,<br />
zeigte die radikale Prostatektomie<br />
nach zehn Jahren eine Reduktion des<br />
krankheitsspezifischen und des Gesamt-<br />
Überlebens [10]. Die hauptsächlichen<br />
Nebenwirkungen sind Inkontinenz (20%<br />
nach zwei Jahren) und sexuelle Dysfunktion.<br />
Im Gegensatz zur Radiotherapie<br />
zeigen diese Komplikationen im Verlauf<br />
aber eine Besserungstendenz [11]. Anders<br />
als bei der Strahlentherapie sinkt nach<br />
radikaler Operation das PSA auf unmessbare<br />
Werte ab, was die Nachsorge vereinfacht.<br />
Ausserdem kann im Falle eines lokalen<br />
Rezidivs die Strahlentherapie als<br />
zweite Behandlungslinie eingesetzt werden.<br />
Bisher konnte mit einer neoadjuvanten<br />
Hormontherapie vor radikaler Prostatektomie<br />
keine Verbesserung des progressionsfreien<br />
Überlebens gezeigt werden; sie<br />
Abb. 2: Skelettszintigraphischer<br />
Nachweis von Knochenmetastasen.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
45
Perspektiven<br />
1. Stufe Orchiektomie/LH-RH-Agonist<br />
kontinuierlich/intermittierend<br />
2. Stufe + Antiandrogen<br />
3. Stufe Absetzen des Antiandrogens<br />
4. Stufe Steroide +/– Ketokonazole,<br />
ev. Finasteride<br />
Tab. 3: Palliative Hormontherapie<br />
Key messages<br />
• Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebskrankheit des Mannes, und sie nimmt<br />
weiter zu.<br />
• Beim lokalisierten Prostatakarzinom besteht mit der Radiotherapie und der radikalen<br />
Prostatektomie ein kurativer Therapieansatz.<br />
• Im fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium wird zwischen hormonempfindlichen<br />
und refraktären Prostatakarzinomen unterschieden.<br />
Lernfragen<br />
1. Welche Therapieoptionen bestehen beim lokalisierten Prostatakarzinom?<br />
2. Kennen Sie die verschiedenen Linien der palliativen Hormontherapie?<br />
3. Welche Chemotherapie zeigte bisher einen Überlebensvorteil?<br />
(Antworten am Schluss des Artikels)<br />
le Zeitpunkt des Therapiestarts kontrovers<br />
beurteilt, und bisher wurden keine definitiven<br />
Empfehlungen formuliert [14]. Allerdings<br />
kann ein früh zeitiger Androgenentzug<br />
eine deutliche Verzögerung der<br />
symptomatischen Progression erreichen,<br />
ein wichtiges pallia tives Therapieziel [15].<br />
Bei klinisch nachweisbaren Metastasen ist<br />
daher eine sofortige Hormontherapie zu<br />
empfehlen, um Symptome zu lindern und<br />
Komplikationen (wie Spinalkanal kompres<br />
sion, Frakturen, Miktionsstörungen)<br />
zu verhindern sowie das Auftreten extraskelettaler<br />
Metastasen zu reduzieren. Als<br />
Standardtherapie gilt die chirurgische<br />
oder medikamentöse Kastration, in der<br />
Regel mit LH-RH-Analoga. Die intermittierende<br />
Androgenblockade zeigt bei weniger<br />
Langzeittoxizität, keinen Nachteil<br />
hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens<br />
gegenüber der kontinuier lichen<br />
Blockade [16]. Die Antiandrogen-Monotherapie<br />
mit Bicalutamid 150 mg wurde<br />
in Studien im Vergleich zur kastrationsbasierten<br />
Therapie geprüft. Dabei zeigte<br />
sich ein kleiner Überlebensvorteil zugunsten<br />
der Kastration bei Patienten mit höherer<br />
Tumorlast (PSA >400 ng/ml) [17].<br />
Bei Progression unter einer Monothe rapie<br />
erfolgt als zweite Behandlungslinie eine<br />
kombinierte Androgenblockade (LH-RH-<br />
Analoga und Antiandrogen) und bei erneuter<br />
Progression unter der Kombination<br />
sollte zuerst das Anti androgen abgesetzt<br />
werden (Tab. 3). Im Sinne eines<br />
«withdrawal syndrome» sieht man nach<br />
einem Ansprechen auf die Zweitlinientherapie<br />
in über 10% einen nochmaligen<br />
Therapieeffekt.<br />
Tertiäre Hormonmanipulationen sind<br />
möglich durch den Einsatz von Steroiden<br />
und einer Hemmung der Steroidbiosynthese<br />
(z.B. Ketokonazol), sowie mit 5-Alpha-Reduktasehemmern<br />
wie Finasteride.<br />
Kommt es trotz Ausschöpfen aller endokrinen<br />
Therapiemöglichkeiten zu einer<br />
weiteren Progression, spricht man von<br />
einem hormonrefrak tären Prostatakarzinom<br />
(HRPC). Wenige Daten weisen daraufhin,<br />
dass trotz Progression die LH-RH-<br />
Analoga nicht abgesetzt werden sollten, da<br />
eine raschere Progredienz und eine verkürzte<br />
Überlebenszeit zu erwarten ist [18].<br />
Chemotherapie<br />
Lange Zeit wurde das HRPC als chemoresistent<br />
betrachtet. Erst Mitte der 90er<br />
Jahre konnte in randomisierten Studien<br />
ein palliativer Effekt von Mitoxantron<br />
und Prednison gezeigt werden. Man fand<br />
zwar keinen Überlebensvorteil, jedoch<br />
eine Verbesserung der Lebensqualität<br />
(QoL) und der Schmerzen [19,20]. Im<br />
Jahr 2004 zeigten zwei randomisierte<br />
Studien einen Überlebensvorteil von Docetaxel<br />
gegenüber Mitoxantrone. In der<br />
TAX-327-Studie zeigte die Behandlung<br />
mit Docetaxel alle drei Wochen ein signifikant<br />
besseres mittleres Überleben von<br />
19.2 Monaten (p = 0.004), hingegen im<br />
Behandlungsarm mit wöchentlicher Applikation<br />
von Docetaxel nur 17.8 Monate<br />
und unter Mitoxantrone 16.3 Monate<br />
[21]. In der Southwest Oncology Group-<br />
Studie 99-16 verglich man Doce ta xel plus<br />
Estramustine mit Mitoxantrone plus<br />
Prednison [22]. Auch hier konnte ein<br />
Überlebensvorteil für die taxanhaltige<br />
Kombination gezeigt werden (medianes<br />
Überleben 17.5 versus 15.6 Monate, p =<br />
0.02), allerdings fand sich als Preis für<br />
diese moderate Verbesserung eine deutlich<br />
erhöhte Toxizität. Eine weitere Studie<br />
zeigte ausserdem, dass der Zusatz von<br />
Estramustine keinen Beitrag zur Verbesserung<br />
des Überlebens leistet, aber klar<br />
für die erhöhte Nebenwirkungsrate verantwortlich<br />
ist [23]. Heute gilt deshalb die<br />
Therapie mit Docetaxel plus Prednison<br />
als bevorzugte Behandlungsoption bei<br />
Patienten mit HRPC.<br />
Neue Entwicklungen<br />
Bisher existieren nur sehr wenige Therapieoptionen<br />
für das hormonrefraktäre<br />
Prostatakarzinom und das Überleben<br />
beträgt bei Einleitung der Standardtherapie<br />
mit Docetaxel knapp 20 Monate.<br />
Vielversprechende Ansätze richten sich wie<br />
das Abiraterone gegen die hormonelle<br />
Achse. Auch neuere Zytostatika wie das<br />
Epothilonanalogon Ixabepilon, Kombinationen<br />
mit VEGF-Inhibitoren (z.B. Bevacizumab)<br />
oder immunothe rapeutische<br />
Ansätze mit Impfungen (GVAX) oder monoklonalen<br />
Antikörpern (wie Ipilimumab)<br />
werden intensiv in Studien untersucht<br />
und führen hoffentlich in den<br />
nächsten Jahren zu er weiterten therapeutischen<br />
Möglichkeiten mit verbessertem<br />
Überleben unserer Patienten. ■<br />
Korrespondenzadresse<br />
Dr. med. Ralph C. Winterhalder<br />
Medizinische Onkologie<br />
Luzerner Kantonsspital<br />
6000 Luzern 16<br />
ralph.winterhalder@ksl.ch<br />
Bibliographie<br />
1 Parker C. Active surveillance: towards a new<br />
paradigm in the management of early prostate<br />
cancer. Lancet Oncol 2004; 5:101-6<br />
2 Zelefsky MJ, Kuban DA, Levy LB, et al. Multiinstitutional<br />
analysis of long-term outcome<br />
for stages T1-T2 prostate cancer treated with<br />
permanent seed implantation. Int J Radiat<br />
Oncol Biol Phys 2007; 67:327-33<br />
3 Kupelian PA, Potters L, Khuntia D, et al. Radical<br />
prostatectomy, external beam radiotherapy<br />
Perspektiven<br />
4 Litwin MS, Gore JL, Kwan L, et al. Quality of<br />
life after surgery external beam irradiation<br />
or brachytherapy for early-stage prostate<br />
cancer. Cancer 2007; 109:2239-47<br />
5 Zietman AL, DeSilvio ML, Slater JD, et al.<br />
Comparison of conventional-dose vs highdose<br />
conformal radiation therapy in clinically<br />
localized adenocarcinoma of the prostate:<br />
a randomized controlled trial. JAMA<br />
2005; 294:1233-9<br />
6 Brown MW, Brooks JP, Albert PS, et al. An<br />
analysis of erectile function after intensity<br />
modulated radiation therapy for localized<br />
prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic<br />
Dis 2007; 10:189-93<br />
7 Merrick GS, Butler WM, Wallner KE, et al.<br />
Permanent interstitial brachytherapy in<br />
younger patients with clinically organ-defined<br />
prostate cancer. Urology 2004; 64:754-9<br />
8 Pilepich MV, Winter K, John MJ, et al. Phase<br />
III radiation therapy oncology group RTOG)<br />
trial 86-10 of androgen deprivation adjuvant<br />
to definitive radiotherapy in locally advanced<br />
carcinoma of the prostate. Int J Radiat<br />
Oncol Biol Phys 2001; 50:1243-52<br />
9 Bolla M, Collette L, Blank L, et al. Long-term<br />
results with immediate androgen suppression<br />
and external irradiation in patients with<br />
locally advanced prostate cancer: a phase III<br />
randomized trial. Lancet 2002; 360:103-6<br />
10 Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, et al.<br />
Radical prostatectomy versus wathful waiting<br />
in early prostate cancer. N Engl J Med<br />
2005; 352:1977-84<br />
11 Sanda MG, Dunn RL, Michalski J, et al. Quality<br />
of life and satisfaction with outcome<br />
among prostate-cancer survivors. N Engl J<br />
Med 2008; 358:1250-61<br />
12 Prayer-Galetti T, Zattoni F, Capizzi A, et al.<br />
Disease-free survival in patients with pathological<br />
«C-stage» prostate cancer at radical<br />
retropubic prostatectomy submitted to adjuvant<br />
hormonal treatment. Eur Urol 2000;<br />
38:504(Abs48)<br />
13 McLeod DG, Iversen P, See W, et al. on behalf<br />
of the «Casodex» Early Prostate Cancer Trialists’<br />
Group. Bicalutamide 150 mg plus<br />
standard care vs standard care alone for<br />
early prostate cancer. BJU Int 2006; 97:247-<br />
54<br />
14 Heidenreich A, Aus G, Bolla M, et al. EAU<br />
Guidelines on Prostate Cancer. Eur Urol<br />
2008; 53:68-80<br />
15 Nair B, Wilt T, MacDonald R, et al. Early<br />
versus deferred androgen suppression in the<br />
treatment of advanced prostatic cancer.<br />
Cochrane Database Syst Rev 2002;<br />
(1):CD003506<br />
16 Seruga B, Tannock IF. Intermittent androgen<br />
blockade should be regarded as standard<br />
therapy in prostate cancer. Nat Clin Pract<br />
Oncol. 2008; 5:574-6<br />
17 Tyrrell CJ, Kaisary AV, Iversen P, et al. A randomized<br />
comparison of Caseodex (bicalutamide)<br />
150 mg monotherapy versus castration<br />
in the treatment of metastatic and locally<br />
advanced prostate cancer. Eur Urol<br />
1998; 33:447-56<br />
18 Taylor CD, Elson P, Trump DL. Importance<br />
of continued testicular suppression in hormone-refractory<br />
prostate cancer. J Clin Oncol<br />
1993; 11:2167-72<br />
19 Tannock IF, Osoba D, Stockler MR, et al.<br />
Chemotherapy with mitoxantrone plus prednisone<br />
or prednisone alone for symptomatic<br />
hormone-resistenat prostate cancer: A Canadian<br />
randomized trial with palliative end<br />
points. J Clin Oncol 1996; 14:1756-64<br />
20 Kantoff PW, Halabi S, Conaway M, et al. Hydrocartisone<br />
with or without mitoxantrone<br />
in men with hormone-refractory prostate<br />
cancer: Results of the Cancer and Leucemia<br />
Group B 9182 study. J Clin Oncol 1999;<br />
17:2506-13<br />
21 Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. Docetaxel<br />
plus prednisone or mitoxantrone plus<br />
prednisone for advanced proste cancer. N<br />
Engl J Med 2004; 351:1502-12<br />
22 Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH, et al.<br />
Docetaxel and estra mustine compared with<br />
mitoxantrone plus prednisone for advanced<br />
refractory prostate cancer. N Engl J Med<br />
2004; 351:1513-20<br />
23 Machiels JP, Mazzeo F, Clausse M, et al. Prospective<br />
randomized study comparing docetaxel,<br />
estramustine and prednisone with<br />
docetaxel and prednisone in metastatic<br />
hormone-refractory prostate cancer. J Clin<br />
Oncol 2008; 26:5261-8<br />
Antworten zu den Lernfragen<br />
1. Expektatives Verhalten, Radiotherapie, radikale<br />
Prostatektomie.<br />
2. 1. Kastration (LH-RH-Analoga oder Orchiektomie),<br />
2. kombinierte Antiandrogenblockade,<br />
3. Antiandrogen-Entzug, 4.<br />
Steroide, Ketokonazol, Finasteride.<br />
3. Docetaxel alle 3 Wochen plus Prednison.<br />
Zusammenfassung<br />
Bei jeder dritten Krebsdiagnose des<br />
Mannes handelt es sich um ein Prostatakarzinom<br />
und es wird mit einer<br />
weiteren Zunahme der Häufigkeit in<br />
den nächsten Jahren gerechnet. Das<br />
mittlere Alter bei Diagnose beträgt 68<br />
Jahre. In der Schweiz werden jährlich<br />
rund 4000 neue Prostatakarzinome<br />
diagnostiziert, was bedeutet, dass jeder<br />
siebte Mann mit dieser Diagnose konfrontiert<br />
wird. Stadienabhängig kommen<br />
neben Chirurgie und Strahlentherapie<br />
auch Systemtherapien wie<br />
Hormonablation und Chemotherapie<br />
in Frage. Ziel dieses Beitrages ist es,<br />
eine Übersicht über die heutigen Therapiestrategien<br />
zu vermitteln.<br />
Schlüsselwörter: Prostatakarzinom<br />
– Prostatektomie, radikale –<br />
Radio therapie – Hormontherapie –<br />
Chemotherapie<br />
Résumé<br />
Le cancer de la prostate représente un<br />
cas sur trois des nouveaux cancers<br />
chez l’homme et l’on peut s’attendre à<br />
une augmentation constante de son<br />
incidence au cours des prochaines<br />
années. L’âge médian de son diagnostic<br />
se situe à 68 ans et il y a environ<br />
4000 nouveaux cas de cancer de la<br />
prostate chaque année. Environ 1<br />
homme sur 7 risque de voir un jour le<br />
diagnostic de cancer de la prostate<br />
pose chez lui. Les stratégies thérapeutiques<br />
dépendent du stade évolutif et<br />
comportent la chirurgie, la radiothérapie<br />
et des traitements systémiques<br />
comme la suppression hormonale et la<br />
chimiothérapie. Le but de cet article est<br />
de présenter les stratégies modernes de<br />
traitement du cancer de la prostate.<br />
Mots-clés: cancer de la prostate –<br />
prostatectomie radicale – radiothérapie<br />
– traitement hormonal – chimiothérapie<br />
Abstract<br />
Every third new cancer in men is a<br />
prostate cancer and we expect a steadily<br />
increase of the incidence in the<br />
next years. The median age at diagnosis<br />
is 68 years and we see about 4000<br />
new prostate cancer patients every<br />
year. Approximately 1 in 7 men will<br />
eventually be diagnosed with PC. Stage<br />
dependent treatment strategies may<br />
include surgery, radiotherapy and systemic<br />
treatments like hormonal ablation<br />
and chemotherapy. The aim of<br />
this article is to give an overview of<br />
modern treatment strategies.<br />
Key words: prostate cancer – radical<br />
prostatectomy – radiotherapy – hormonal<br />
therapy – chemotherapy<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
47
Perspektiven<br />
Unglaubliche Fallgeschichten<br />
aus der Medizin<br />
Ein hellhöriger Arzt<br />
Eigentlich kam der ältere Patient ins Krankenhaus, weil er sich den Finger in einer<br />
Stalltür gequetscht hatte. Was den Verletzten aber fast genauso beschäftigte, war sein<br />
schwacher Pfiff. Er arbeitete als Berufspfeifer beim Radio. Wenn er seiner Frau morgens<br />
quer durch einen Park zupfiff, hörte sie ihn. So war es noch die letzten zwei Tage gewesen.<br />
Nicht aber heute.<br />
In den Ohren des Arztes, der sich eine akustische Kostprobe geben liess, klang der Pfiff<br />
kräftig – doch es war nicht das Pfeifen, das der Patient von sich gewohnt war. Da vor<br />
allem hohe Töne über weite Strecken getragen werden, fehlte dem Pfiff wohl eine bestimmte<br />
Tonhöhe, die der Mann sonst zustande brachte, vermutete der Arzt. Das führte<br />
ihn auf die richtige Spur: beginnender Risus sardonicus. Das «sardonische Lachen» ist<br />
ein Lachen, an dem die Seele unbeteiligt ist. Die Betroffenen können nicht anders, als<br />
hämisch zu grinsen. Ihre verkrampften Gesichtsmuskeln zwingen ihnen diesen Gesichtsausdruck<br />
auf. Und wegen dieser Verkrampfung pfiff der Patient vermutlich nicht<br />
mehr wie gewohnt. Der Risus sardonicus ist ein erstes Anzeichen für eine lebensgefährliche<br />
Vergiftung. Über eine Wunde gelangen Sporen von Tetanusbakterien in den Körper.<br />
Diese Sporen kommen praktisch überall vor, auch in Erde und Strassenstaub. Geschlossene,<br />
von Haut und Fleisch bedeckte Stichwunden sind der idea le Platz für sie. Denn bei<br />
Abwesenheit von Sauerstoff keimen sie aus und vermehren sich. In der Wunde produzieren<br />
die Bakterien namens Clostridium tetani ein teuflisches Gift, das mit einer Geschwindigkeit<br />
von rund fünf Millimetern pro Stunde über die Nervenbahnen in Richtung<br />
Rückenmark und Hirn wandert. Im Rückenmark hemmt es bestimmte Nervenzellen.<br />
Was dann passiert, lässt sich mit einem Lichtschalter vergleichen, der zusätzlich einen<br />
Dimmer hat. Mit solchen Schaltern kann man das Licht sowohl ein- und ausschalten<br />
als auch fein regulieren. Das Gleiche passiert normalerweise bei den Muskeln: Ein<br />
«Schalter» ist für Ein-Aus zuständig, ein anderer fürs feine Abstimmen, je nachdem,<br />
ob man eine zerbrechliche Ming-Vase in der Hand hält oder beim Seilziehen zupacken<br />
muss. Das Tetanusgift bewirkt, dass die Übertragung von hemmenden und die Muskelkraft<br />
modulierenden Nervenimpulsen im Rückenmark blockiert wird. Die Folge: Nervenreize<br />
aus dem Hirn werden – vom Rückenmark ungebremst und ungefiltert – an<br />
die Muskeln weitergeleitet. Um bei dem Bild mit dem Lichtschalter zu bleiben: Das Licht<br />
geht entweder voll an, oder es bleibt ganz aus. Der Dimmer ist kaputt. Zunächst fühlt<br />
sich Wundstarrkrampf an wie eine Grippe. Dann aber zeigt er sein wahres Gesicht. Beim<br />
geringsten Anlass – ein Lichtstrahl, ein Geräusch oder eine Berührung genügen – verkrampfen<br />
sich die Muskeln der Erkrankten aufs Heftigste. Wer jemals einen schmerzhaften<br />
Waden- oder Zehenkrampf hatte, kann sich ausmalen, wie sich das am ganzen<br />
Körper anfühlt. Da die Nerven, die vom Hirn zum Gesicht führen, kurz sind, machen<br />
sich die ersten Anzeichen oft im Gesicht bemerkbar. Später ziehen sich auch die langen<br />
Rückenmuskeln zusammen und der Patient muss, bei vollem Bewusstsein, unwillkürlich<br />
eine «Brücke» machen. Schliesslich gehen die Verkrampfungen in zuckende Krämpfe<br />
über. Unter der extremen Anspannung brechen sogar Wirbel. Dank der Impfung sind<br />
Tetanusfälle in westlichen Ländern sehr selten geworden; in der Schweiz treten jährlich<br />
ein bis drei Fälle auf.<br />
Helfen kann man den schwer Leidenden nur bedingt (deshalb empfiehlt sich die Impfung).<br />
Wundversorgung, Gabe von Tetanusgift-Antikörpern, muskelentspannende Medikamente,<br />
Narkose und notfalls wochenlange, maschinelle Beatmung kommen als<br />
Behandlung infrage. Trotzdem sterben 10 bis 20 Prozent der Erkrankten. Der Berufspfeifer<br />
überlebte – wohl auch dank seinem hellhörigen Arzt. <br />
■<br />
48 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
mediservice Vsao-asmac<br />
Briefkasten<br />
Klaus Hasler<br />
Versicherungsberater<br />
MEDISERVICE <strong>VSAO</strong>-ASMAC<br />
Führerausweisentzug – wie kann ich mich dagegen wehren?<br />
Nach einem Autounfall wurde mir als zusätzliche Administrativmassnahme<br />
der Führerausweis entzogen. Ich bin beruflich aufs Auto angewiesen.<br />
Wer hilft mir beim Rekurs?<br />
Beim Rekurs gegen eine Administrativmassnahme braucht es ein profundes Wissen der<br />
einschlägigen Gesetze und Verordnungen, aber auch viel Zeit. Am besten sorgt man vor<br />
und beschafft sich fachkundige und jederzeit einsatzbereite Berater und Helfer durch<br />
den Abschluss einer Verkehrsrechtsschutz-Versicherung. Diese Versicherung steht den<br />
Versicherten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte kompetent zur Seite und übernimmt<br />
darüber hinaus auch die Kosten rechtlicher Auseinandersetzungen.<br />
Die Rechtsschutzversicherung wird die zusätzliche Administrativmassnahme sorgfältig<br />
prüfen und abklären, ob die Verfügung allen rechtlichen Grundlagen entspricht. Sie<br />
wird sodann in Ihrem Namen mit den zuständigen Behörden über die Modalitäten des<br />
Entzugs des Führerausweises verhandeln, damit Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit so<br />
wenig wie möglich eingeschränkt werden. Die Experten der Versicherung werden dabei<br />
beispielsweise auf Ihre bisherige Fahrpraxis hinweisen, falls diese zu keinen Beanstandungen<br />
Anlass gab. Zudem könnte eine einlässliche Analyse des Unfallhergangs durch<br />
die juristischen Fachleute der Versicherung ergeben, dass ein gravierendes Mitverschulden<br />
anderer am Unfall Beteiligter vorliegt, was Sie entlasten könnte. Voraussetzung für<br />
diese gezielten und erfolgversprechenden Bemühungen der Verkehrsrechtsschutz-Versicherung<br />
ist natürlich, dass man rechtzeitig für den Versicherungsschutz sorgt, also nicht<br />
wartet, bis ein Unfall passiert.<br />
■<br />
Haben Sie Fragen, rufen Sie uns an: 031 350 44 22.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
49
mediservice <strong>VSAO</strong>-asmac<br />
Mehr Sicherheit durch Telematik<br />
Die Telematiktechnologie ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Die Telematik – eine Wortverbindung<br />
aus Telekommunikation und Informatik – findet sich in den verschiedensten Bereichen des Alltags.<br />
Nicht nur im Gesundheitswesen spielt die moderne Technologie eine immer grössere Rolle, auch die<br />
Sicherheit im Strassenverkehr kann durch die intelligenten Systeme massiv erhöht werden.<br />
Thomas Lanfermann, Leiter Motorfahrzeugversicherungen Allianz Suisse<br />
Die grosse Mehrheit der Ärzte geht davon<br />
aus, dass sowohl die Telematik als auch<br />
die Telemedizin im Gesundheitswesen<br />
generell an Bedeutung gewinnen werden<br />
– das hat eine Umfrage der Bundesärztekammer<br />
in Deutschland aus dem Jahr<br />
2010 ergeben. Danach erwarten 75 Prozent<br />
der Ärzteschaft im medizinischen<br />
Alltag einen Bedeutungszuwachs der telematischer<br />
Systeme. Ebenso viele sehen<br />
beispielsweise einen hohen Nutzen in der<br />
Speicherung von Notfalldaten. Beim Einsatz<br />
sowohl der Telematik als auch der<br />
Telemedizin überwiegen aus Sicht der<br />
Ärzte prinzipiell die Vorteile.<br />
Was für das Gesundheitswesen gilt, trifft<br />
auch für den Bereich Strassenverkehr zu.<br />
Zum einen trägt die Telematik dazu bei,<br />
die Verkehrsströme wirksamer zu lenken<br />
und dadurch eine effizientere Nutzung der<br />
Ressourcen zu erreichen. Zum anderen<br />
erhöht der Einsatz der modernen Technologie<br />
aber auch die Sicherheit im Strassenverkehr<br />
massiv.<br />
Einige verkehrstelematische Anwendungen<br />
sind heute in der Schweiz bereits im<br />
Einsatz und weitgehend akzeptiert. Dazu<br />
gehören etwa Parkleitsysteme in Städten,<br />
die Fahrzeuglenker zu freien Parkplätzen<br />
weisen. Aber auch Flottenmanagementsysteme,<br />
die Leerfahrten auf Strasse und<br />
Schiene vermeiden helfen. Allerdings<br />
hinkt die Schweiz hier gegenüber anderen<br />
Ländern in der Entwicklung etwas hinterher.<br />
Fast alle anderen europäischen Länder<br />
setzen die Telematik schon vermehrt<br />
ein, insbesondere im Individualverkehr.<br />
Im Notfall entscheiden<br />
Sekunden<br />
Ein Beispiel: Durch einen Sekundenschlaf<br />
gerät ein Fahrer von der Fahrbahn, prallt<br />
gegen einen Baum und verletzt sich<br />
schwer. Er ist selbst nicht mehr in der<br />
Lage, Rettungskräfte zu alarmieren. Szenen<br />
wie diese sind leider fast alltäglich.<br />
Allein in der Schweiz sind nach Angaben<br />
des Bundesamtes für Statistik im Jahr<br />
2009 327 Menschen im Strassenverkehr<br />
ums Leben gekommen. Die Tendenz ist<br />
zwar erfreulicherweise rückläufig, was<br />
unter anderem auf die Einführung von<br />
Vorschriften wie der Gurtpflicht, dem obligatorischen<br />
Kindersitz und neuen technischen<br />
Entwicklungen wie Airbag und<br />
Fahrassistenzsystemen zurückzuführen<br />
ist. Dennoch hätten vermutlich einige<br />
Leben gerettet oder schwerste Unfallfolgen<br />
verhindert werden können, wenn die Rettungskräfte<br />
nur wenige Minuten schneller<br />
am Unfallort gewesen wären. Telematiksysteme<br />
können hier lebensrettend wirken,<br />
denn sie verfügen in der Regel über<br />
ein automatisches Notrufsystem. Dieses<br />
nimmt bei Unfällen mit einer entsprechenden<br />
Krafteinwirkung Verbindung zu<br />
einer Notrufzentrale auf. Ist der Fahrzeuglenker<br />
nicht mehr in der Lage, über die<br />
Gegensprechanlage zu antworten, werden<br />
unverzüglich die Rettungskräfte alarmiert.<br />
Die Allianz Suisse ist ein Versicherungspartner vom MEDISERVICE <strong>VSAO</strong>-ASMAC<br />
für die Motorfahrzeugversicherung.<br />
Falls Sie Fragen haben oder eine Offerte wünschen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.<br />
Wir beraten Sie gerne.<br />
Exklusive Angebote für mediservice vsao-Mitglieder<br />
• 031 350 44 22 – wir sind für Sie da.<br />
• www.mediservice-vsao.ch – und ich weiss mehr.<br />
• www.medizinkarriere.ch – die Karriereplattform<br />
mit Entscheidungshilfen<br />
50 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
mediservice Vsao-asmac<br />
Weniger Schäden<br />
Derzeit sind solche Telematiksysteme<br />
häufig lediglich als Sonderausstattung in<br />
hochpreisigen Neufahrzeugen im Einsatz.<br />
Aber auch die Versicherungsgesellschaften<br />
haben den grossen Nutzen der<br />
Technologie bereits erkannt und bieten<br />
sie einem breiten Publikum an. So hat die<br />
Allianz Suisse als erste Versicherungsgesellschaft<br />
in der Schweiz mit der Allianz<br />
Helpbox ® im vergangenen Jahr ein kostengünstiges<br />
telematisches Produkt lanciert<br />
und dabei auf eine klassische Winwin-Situation<br />
gesetzt. Denn internationalen<br />
Studien zufolge verringert sich die<br />
Schadenhäufigkeit nach dem Einbau<br />
eines Telematiksystems um rund 25 Prozent.<br />
Offensichtlich spielt die psychologische<br />
Komponente eine wichtige Rolle: Die<br />
Fahrweise wird nach dem Einbau eines<br />
solchen Gerätes defensiver, der Fahrer<br />
verursacht weniger Schäden. Zeichnet<br />
diese Technologie doch auch Unfalldaten<br />
auf, um den Hergang zu objektivieren.<br />
Dies motiviert zusätzlich zu einer vorausschauenderen<br />
Fahrweise.<br />
Viele Vorteile<br />
Der Nutzen ist aber nicht allein auf den<br />
automatischen Notruf beschränkt. Im<br />
Falle einer Panne oder eines «leichteren»<br />
Unfalls können die Nutzerinnen und Nutzer<br />
der meisten Telematiksysteme bei einer<br />
Notrufzentrale schnelle Hilfe über eine<br />
Bedientaste im Fahrzeug anfordern –<br />
mittels SOS-Soforthilfe. Und dank der<br />
GPS-Technologie ist auch ein Diebstahlschutz<br />
gleich mit an Bord. Das gestohlene<br />
Fahrzeug kann schnell geortet und lokalisiert<br />
werden, und die Behörden können<br />
bei Bedarf die notwendigen Schritte einleiten.<br />
Unternehmenskunden mit Flottenmanagementsystemen<br />
können durch den optimierten<br />
Fahrzeugeinsatz teure Standzeiten<br />
reduzieren, Leerfahrten vermeiden<br />
und erhalten somit eine verbesserte Kontrolle<br />
von Auslieferungen und Lenkzeiten.<br />
Sie reduzieren folgich Kosten bei gleichzeitig<br />
mehr Effizienz.<br />
Telematiklösungen sind also ebenso einfach<br />
wie genial und tragen zur Erhöhung<br />
der Sicherheit im Verkehr und zu einer<br />
optimierten Ausnutzung der Verkehrsinfrastruktur<br />
bei. Das ist die Mobilität der<br />
Zukunft, die auch wir als Versicherungsgesellschaft<br />
gerne unterstützen! ■<br />
Einfache Funktionsweise<br />
Mittlerweile gibt es viele verschiedene<br />
Anbieter für Telematikanwendungen. Die<br />
Funktionsweise ist in der Regel fast identisch:<br />
In den Neu- oder Gebrauchtwagen<br />
des Kunden wird eine sogenannte On<br />
Board Unit (OBU) eingebaut, die automatisch<br />
oder per Knopfdruck die Verbindung<br />
zwischen Fahrzeug, Telematikplattform<br />
und Notrufzentrale herstellt. Die On<br />
Board Unit verfügt in der Regel über eine<br />
GPS-Funktion (Global Positioning System),<br />
welche die schnelle und punktgenaue<br />
Ortung des verunfallten bzw. gestohlenen<br />
Fahrzeugs sicherstellt. Sie ist<br />
zudem mit einer SIM-Karte ausgerüstet,<br />
die jederzeit eine Verbindung mit dem<br />
Mobilfunknetz zur Übertragung der Notrufsignale<br />
und Gewährleistung der Kommunikation<br />
herstellt. Zudem verfügt die<br />
OBU häufig über einen Unfalldatenschreiber,<br />
der zusätzlich bei einer gewissen<br />
Kräfteeinwirkung auf das Fahrzeug<br />
automatisch Unfalldaten aufzeichnet.<br />
Die Notrufe werden 365 Tage im Jahr<br />
rund um die Uhr von einer Notrufzentrale<br />
entgegengenommen. Sehr kostengünstige<br />
Geräte nutzen dabei das Natel als<br />
OBU – was voraussetzt, dass dieses stets<br />
im Auto an der richtigen Stelle liegt und<br />
eingeschaltet ist.<br />
<strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC<br />
51
Vereinfachte Steuerabrechnung<br />
für Nebenbeschäftigung<br />
von Werner A. Räber, Dr. Thomas Fischer & Partner AG/Baar<br />
Das bereits am 1. Januar 2008 in Kraft<br />
getretene Bundesgesetz über Massnahmen<br />
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit hat<br />
gewisse Änderungen im Sozialversicherungs-<br />
und Steuerrecht mit sich gebracht,<br />
die den Wenigsten bekannt sind. Mit diesem<br />
Gesetz und den gleichzeitig vorgenommenen<br />
Anpassungen insbesondere in<br />
den Steuergesetzen wurde ein vereinfachtes<br />
Verfahren für die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge<br />
und der Einkommenssteuer<br />
eingeführt. Für kleine<br />
Arbeitsentgelte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit<br />
kann die Steuer zu einem<br />
attraktiven Sondersatz abgerechnet werden.<br />
Die Steuer von insgesamt 5 Prozent<br />
(4,5 Prozent Staats- und Gemeindesteuer<br />
sowie 0,5 Prozent direkte Bundessteuer) ist<br />
unabhängig vom Wohnsitz und wird ohne<br />
Berücksichtigung der übrigen Einkünfte<br />
und ohne Abzugsmöglichkeiten erhoben.<br />
Der einheitliche Satz gilt dabei unabhängig<br />
davon, ob ein Arbeitnehmer quellensteuerpflichtig<br />
ist oder nicht. Die im vereinfachten<br />
Abrechnungsverfahren versteuerten<br />
Einkünfte werden zudem im<br />
Rahmen des ordentlichen Veranlagungsverfahrens<br />
nicht mehr berücksichtigt,<br />
auch nicht zur Satzbestimmung. Allerdings<br />
wird im ordentlichen Steuerformular<br />
die Deklaration der vereinfacht versteuerten<br />
Einkünfte trotzdem verlangt, allerdings<br />
rein zu Informationszwecken.<br />
Dieses Verfahren ist für den Arbeitgeber<br />
eine enorme administrative Erleichterung<br />
und für den Arbeitnehmer in der Regel<br />
steuergünstiger als das ordentliche Verfahren.<br />
Die Abrechnung und der Bezug<br />
der Sozialversicherungsbeiträge und der<br />
Steuer erfolgen nur einmal im Jahr, und<br />
zwar für beide Abgaben durch die zuständige<br />
AHV-Ausgleichskasse. Der Arbeitgeber<br />
zieht die Quellensteuer von 5 Prozent vom<br />
AHV-pflichtigen Lohn ab und leitet sie<br />
zusammen mit den Sozialversicherungsabgaben<br />
an die Ausgleichskasse weiter.<br />
Der Arbeitnehmer erhält eine Bescheinigung<br />
über die abgelieferte Steuer, welche<br />
er seiner Steuerdeklaration beilegt.<br />
Allerdings kann das freiwillige vereinfachte<br />
Abrechnungsverfahren nur in kleinen<br />
Verhältnissen angewandt werden,<br />
typischerweise für privates Hauspersonal,<br />
weil Höchstgrenzen sowohl für den einzelnen<br />
Lohn wie auch die gesamt Lohnsumme<br />
festgelegt worden sind (vgl. Kästchen).<br />
Das AHV-Merkblatt mit weiteren<br />
Informationen zum vereinfachten Abrechnungsverfahren<br />
finden Sie hier:<br />
http://www.ahv-iv.info/andere/00134/<br />
00139/index.html?lang=de. ■<br />
Voraussetzungen für die vereinfachte Abrechnung:<br />
– Der Lohn pro Arbeitnehmer darf pro Jahr CHF 20 880 nicht übersteigen (Eintrittsschwelle<br />
2. Säule, Stand <strong>2012</strong>);<br />
– die gesamte Lohnsumme des Betriebes oder Haushaltes darf pro Jahr CHF 55 680<br />
nicht übersteigen (doppelte maximale jährliche Altersrente der AHV, Stand <strong>2012</strong>);<br />
– die Löhne des gesamten Personals müssen im vereinfachten Verfahren abgerechnet<br />
werden;<br />
– die Abrechnungs- und Zahlungsverpflichtungen müssen ordnungsgemäss eingehalten<br />
werden<br />
52 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>
Impressum<br />
Kontaktadressen der sektionen<br />
<strong>Nr</strong>. 2 • 31. Jahrgang • <strong>April</strong> <strong>2012</strong><br />
Herausgeber/Verlag<br />
AG<br />
<strong>VSAO</strong> Sektion Aargau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Telefon 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
MEDISERVICE <strong>VSAO</strong>-ASMAC<br />
Bahnhofplatz 10 A, Postfach 7255, 3001 Bern<br />
Telefon 031 350 44 88, Fax 031 350 44 89<br />
journal@vsao.ch, journal@asmac.ch<br />
www.vsao.ch, www.asmac.ch<br />
Im Auftrag des <strong>VSAO</strong><br />
Redaktion<br />
Catherine Aeschbacher (Chefredaktorin/ca),<br />
Jan Vontobel (jv), Sophie Yammine (sy)<br />
Geschäftsausschuss <strong>VSAO</strong><br />
Christoph Bosshard, Präsident<br />
Raphael Stolz, Vizepräsident<br />
Fabrice Dami, Marie-Claire Desax, Guillaume Favre,<br />
Gert Printzen, Miodrag Savic, Daniel Schröpfer,<br />
Urs Sieber, Ryan Tandjung,<br />
Kristina Tänzler, Sonja Truestedt,<br />
Nicola Rüegsegger (swimsa)<br />
Druck, Herstellung und Versand<br />
Stämpfli Publikationen AG<br />
Wölflistrasse 1, CH-3001 Bern<br />
Telefon +41 31 300 66 66, info@staempfli.com<br />
www.staempfli.com<br />
Layout: Tom Wegner<br />
Inserate<br />
Axel Springer Schweiz AG, Fachmedien<br />
Förrlibuckstrasse 70, Postfach, 8021 Zürich<br />
Telefon 043 444 51 02, Fax 043 444 51 01<br />
vsao@fachmedien.ch<br />
Auflagen<br />
21 027 Expl. Druckauflage<br />
20 468 Expl. WEMF-geprüft 2010<br />
Erscheinungshäufigkeit: 6 Hefte pro Jahr.<br />
Für <strong>VSAO</strong>-Mitglieder im Jahresbeitrag inbegriffen.<br />
ISSN 1422-2086<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 3/<strong>2012</strong> erscheint im Juni <strong>2012</strong>.<br />
Thema: Grenzen<br />
© <strong>2012</strong> by <strong>VSAO</strong>, 3001 Bern<br />
Printed in Switzerland<br />
BL/BS<br />
BE<br />
FR<br />
<strong>VSAO</strong> Sektion beider Basel,<br />
Geschäftsleiterin und Sekretariat: lic. iur. Claudia von Wartburg, Advokatin,<br />
Hauptstrasse 104, 4102 Binningen, Telefon 061 421 05 95,<br />
Fax 061 421 25 60, sekretariat@vbao.ch, www.vbao.ch<br />
<strong>VSAO</strong> Sektion Bern, Geschäftsführerin: Rosmarie Glauser, Fürsprecherin,<br />
Schwarztorstrasse 22, 3007 Bern, Telefon 031 381 39 39, Fax 031 381 82 41,<br />
bern@vsao.ch, www.vsao-bern.ch<br />
ASMAF Section Fribourg, case postale, 1708 Fribourg,<br />
webmaster@asmaf.ch, www.asmaf.ch<br />
GE AMIG c/o HUG, case postale 23, rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 14,<br />
amig@amig.ch, www.amig.ch<br />
GR<br />
JU<br />
NE<br />
<strong>VSAO</strong> Sektion Graubünden, Geschäftsstelle: Steffen Heintze,<br />
<strong>VSAO</strong> Graubünden, Postfach 13, 7154 Ruschein, info@vsao-gr.ch<br />
ASMAC Sektion Jura, Dr. med. Carlos Munoz,<br />
Chemin des Vauches 7, 2900 Porrentruy, Telefon 032 465 65 65,<br />
cfmunoz@bluewin.ch<br />
amine@asmac.ch<br />
SG/AI/AR <strong>VSAO</strong> Sektion St.Gallen-Appenzell, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Telefon 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
SO<br />
TI<br />
TG<br />
VD<br />
VS<br />
<strong>VSAO</strong> Sektion Solothurn, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Telefon 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ASMACT, Associazione Medici Assistenti e Capiclinica<br />
Ticinesi, Avv. Marina Pietra Ponti, Viale S. Franscini 17,<br />
6904 Lugano, telefono 091 922 95 22, fax 091 923 61 71,<br />
pietraponti@ticino.com<br />
<strong>VSAO</strong> Sektion Thurgau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Telefon 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ASMAV, case postale 9, 1011 Lausanne-CHUV,<br />
www.asmav.ch, asmav@asmav.ch<br />
ASMAVAL, Jessika Mermoud,<br />
rte de Chippis 55a, 1950 Sion, jessika.mermoud@hopitalvs.ch<br />
Zentralschweiz<br />
<strong>VSAO</strong> Sektion Zentralschweiz, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Telefon 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
Gütesiegel Q-Publikation<br />
des Verbandes Schweizer Medien<br />
ZH<br />
Zürcher Spitalärzte und Spitalärztinnen <strong>VSAO</strong>, Dr. R. M. Reck,<br />
Bahnhofstrasse 3, 8610 Uster, Telefon 044 941 46 78, Fax 044 941 46 67,<br />
vsao-zh@bluewin.ch; www.vsao-zuerich.ch<br />
54 <strong>VSAO</strong> <strong>JOURNAL</strong> ASMAC <strong>Nr</strong>. 2 <strong>April</strong> <strong>2012</strong>