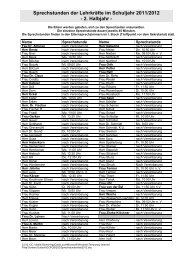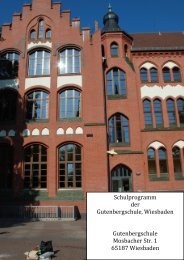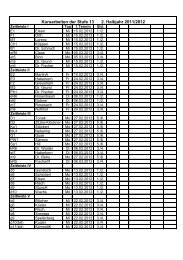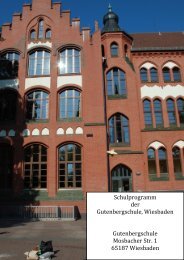Programmheft Musik / Tanztheater / Film - Gutenbergschule ...
Programmheft Musik / Tanztheater / Film - Gutenbergschule ...
Programmheft Musik / Tanztheater / Film - Gutenbergschule ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
antike Herkunft aber niemals verleugnenden Kultur. Es kann kein Zufall<br />
gewesen sein, dass Theodorakis dieses Hauptwerk Nerudas für sich entdeckte<br />
und 13 Teile daraus zu einem abendfüllenden Oratorium zusammenfügte<br />
– einerseits zwar eine Komprimierung des gigantischen literarischen<br />
Werkes, andererseits aber mit seinem überschwänglichen Gestus<br />
ebenfalls eine Monumentalität. Zwei Großpathetiker fanden sich da, zwei<br />
einsam und quer in der Kunst des eher spröden 20. Jahrhunderts<br />
Dastehende. Zwei, die es verstehen, das Leben zu feiern. Zwei, denen der<br />
mitreißende Appell an Menschenmassen keinerlei Skrupel bereitet.<br />
Tragendes Element des Oratoriums ist der Chor. Er wird kaum jemals in<br />
der durchpolyphonisierten Weise behandelt wie in der mitteleuropäischen<br />
Tradition, aber auch keineswegs stereotyp. So gibt es neben strophisch<br />
Volksliedhaftem etwa die inbrünstigen, vom dunklen Stimmklang beherrschten<br />
Reminiszenzen an die orthodoxe Liturgie und ihre feierliche<br />
a-cappella-Kunst (am deutlichsten im getragenen Fis-Dur-Adagio des<br />
zweiten Stückes „Voy a vivir“, „Ich werde leben“). Fast durchgehend ist<br />
der „antiphonische“ Duktus: der Solist oder die Solistin intonieren eine<br />
Melodie, die dann vom singenden Kollektiv aufgegriffen, wiederholt,<br />
modifiziert wird. Auch dieses sozusagen dramatisierende, den musikalischen<br />
Ablauf jedenfalls ungemein lebendig haltende Prinzip funktioniert<br />
sehr variabel: Mal hebt sich die Einzelstimme als Teil der „Gemeinschaft“<br />
kaum vom Chor ab, mal peitscht sie mit ihrem Schwung die kollektiven<br />
Energien heraus, dann wieder überbietet sie das chorische Pathos durch<br />
ekstatische Alleingänge. Eine besondere Funktion hat der Chor in dem Satz<br />
„Lautaro“, wo er zunächst zu dem Lied der Solostimme nur plakative<br />
Einwürfe (des Titelworts ) beiträgt, bis er im Schlussabschnitt fast senza<br />
tempo auf Fermaten-Akkorden einrastet und in einem abgründig-ruhevollen<br />
Largo verklingt. Im Gedicht ist dabei – in kunstvoll verschlüsselten,<br />
verrätselten Metaphern - vom Tod eines Kämpfers die Rede.<br />
Aufs Ganze gesehen überwiegt in diesen liedhaft-chorischen Monumenten<br />
ein Lapidarstil, wie man ihn von einigen Werken Strawinskys und von<br />
Carl Orffs „Carmina burana“ her kennt. Da es Theodorakis um großflächige<br />
Einheiten geht, benutzt er gerne auch Ostinato-Bildungen, also vielfach<br />
21