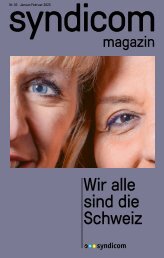Arbeit in der Crowd
Die Chancen und insbesondere die Gefahren des Erwerbslebens der Crowdworker – syndicom durchleuchtet diese wachsende Branche von Freischaffenden aus gewerkschaftlicher Sicht.
Die Chancen und insbesondere die Gefahren des Erwerbslebens der Crowdworker – syndicom durchleuchtet diese wachsende Branche von Freischaffenden aus gewerkschaftlicher Sicht.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
syndicom<br />
Nr. 1 Sep–Okt 2017<br />
magaz<strong>in</strong><br />
<strong>Arbeit</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Crowd</strong>
Anzeige<br />
Inhalt<br />
4 Teamporträt<br />
5 Kurz und bündig<br />
6 Die an<strong>der</strong>e Seite<br />
7 Gastautor<br />
8 Dossier: <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g<br />
16 <strong>Arbeit</strong>swelt<br />
19 GAV für Velokuriere<br />
22 Politik<br />
24 Recht so!<br />
25 1000 Worte<br />
26 Freizeit<br />
28 Bisch im Bild<br />
30 Aus dem Leben von ...<br />
31 Kreuzworträtsel<br />
32 Interaktiv<br />
Bis zu<br />
10 %<br />
Prämien<br />
sparen<br />
Liebe Leser<strong>in</strong>nen und Leser<br />
Here<strong>in</strong>spaziert! Willkommen zur Erstausgabe<br />
des neuen syndicom-Magaz<strong>in</strong>s. Es ersche<strong>in</strong>t<br />
ab sofort alle zwei Monate und befasst sich<br />
vertieft mit e<strong>in</strong>em Thema, das unsere Gewerkschaft<br />
beson<strong>der</strong>s beschäftigt. In diesem ersten<br />
Heft versuchen wir, <strong>Arbeit</strong>sformen auszuleuchten,<br />
die mit <strong>der</strong> Digitalisierung weiterh<strong>in</strong> an<br />
Gewicht gew<strong>in</strong>nen. Es geht um «<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g»<br />
und die sogenannte «Shar<strong>in</strong>g Economy». Die<br />
Freelancer, von denen viele schon lange bei<br />
syndicom organisiert s<strong>in</strong>d, kennen die Tücken<br />
des freien Marktes bestens. Als Gewerkschaft<br />
ist es uns gelungen, vor allem im Medienbereich<br />
anerkannte Regeln durchzusetzen: Es braucht<br />
M<strong>in</strong>destlöhne, Sozialleistungen, Infrastrukturentschädigungen.<br />
syndicom for<strong>der</strong>t auch e<strong>in</strong>e<br />
Zertifizierung <strong>der</strong> Plattformen und klare Regeln<br />
für Auftraggeber, die <strong>Crowd</strong>worker beschäftigen.<br />
Damit die neuen <strong>Arbeit</strong>sformen e<strong>in</strong>e Zukunft<br />
haben und nicht zur Prekarisierung breiter<br />
Bevölkerungsschichten Hand bieten können.<br />
Denn Fortschritt bedeutet nicht <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
globale Profitmaximierung für e<strong>in</strong>ige wenige,<br />
son<strong>der</strong>n, dass es allen besser geht!<br />
5<br />
8<br />
19<br />
Wir freuen uns über Feedback<br />
N<strong>in</strong>a Scheu<br />
E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache Onl<strong>in</strong>e-Krankenkasse und persönliche Beratung?<br />
Als Mitglied von syndicom bekommen Sie beides<br />
und erst noch günstiger. Jetzt mit nur e<strong>in</strong> paar Klicks wechseln:<br />
kpt.ch/syndicom
4 Teamporträt<br />
GAV-Swisscom-Strategiegruppe<br />
Kurz und<br />
bündig<br />
Aufstand <strong>in</strong> den Redaktionen? \ Risotto statt E<strong>in</strong>heitsbrei <strong>in</strong><br />
Bern \ Poststellenkahlschlag im Parlament \ my.syndicom.ch \<br />
pensionierte.syndicom.ch \ Neu: Leserbriefe im Netz<br />
5<br />
Michelle Geneviève Crapella-Papet (37)<br />
Wohnt <strong>in</strong> Ennetbürgen (NW) und<br />
arbeitet seit 2006 bei Swisscom.<br />
E<strong>in</strong>gestiegen bei <strong>der</strong> KMU-Betreuung <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Adm<strong>in</strong>istration, bildete sie sich<br />
weiter zum technischen Support und<br />
zur Fachspezialist<strong>in</strong>. Die diplomierte<br />
Mentaltra<strong>in</strong>er<strong>in</strong> ist schon seit jungen<br />
Jahren Mitglied bei syndicom.<br />
Urs Zumbach (53)<br />
Aus Schliern bei Köniz BE, arbeitet seit<br />
1981 <strong>in</strong> den verschiedensten Aufgaben<br />
bei Swisscom <strong>in</strong> Bern. Momentan<br />
treibt er als Solution Designer AllIP die<br />
Umstellung <strong>der</strong> «alten» Telefonnetze<br />
für die Gross- und Grösstkunden voran.<br />
Yannick Loigerot (47)<br />
Stammt aus Galmiz (FR) und ist seit<br />
1987 <strong>in</strong> verschiedenen Funktionen bei<br />
Swisscom tätig, zuerst <strong>in</strong> Genf, dann<br />
<strong>in</strong> Bern und heute <strong>in</strong> Freiburg. Derzeit<br />
ist er als Security Manager für die<br />
late<strong>in</strong>ische Schweiz verantwortlich.<br />
Text: Riccardo Turla<br />
Bild: Jens Friedrich<br />
Wir wussten, was wir<br />
2012 erreicht hatten,<br />
und was wir zurückstellen<br />
mussten.<br />
«Der Startschuss für unsere GAV-<br />
Swisscom-Strategiegruppe erfolgte<br />
gleich nach Abschluss <strong>der</strong> GAV-<br />
Verhandlungen von 2012. Denn<br />
nach den Verhandlungen ist vor den<br />
Verhandlungen. Wir konnten den<br />
Groove des Teams von 2012 mitnehmen.<br />
Wir waren uns bewusst,<br />
was wir im GAV 2013 erreicht hatten,<br />
und was wir zurückstellen mussten.<br />
So war uns von Anfang an klar,<br />
bei welchen Punkten wir Potenzial<br />
für weitere Verbesserungen hatten.<br />
Wir wussten also genau, <strong>in</strong> welche<br />
Richtung wir gehen wollten.<br />
Drei Jahre lang haben wir uns<br />
zwei- bis viermal im Jahr getroffen,<br />
um unsere For<strong>der</strong>ungen zu formulieren<br />
und neue Themen aufzugreifen,<br />
vor allem Themen rund<br />
um die Digitalisierung, wie zum<br />
Beispiel die Entgrenzung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>,<br />
die ständige Erreichbarkeit, den<br />
Datenschutz und das <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g.<br />
Manche Treffen waren e<strong>in</strong>tägig,<br />
manche waren zweitägig. Dann<br />
trafen wir 2016 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Strategiegruppe<br />
die Entscheidung, mit welchen For<strong>der</strong>ungen<br />
und mit welchen Leuten wir<br />
<strong>in</strong> die neuen Verhandlungen steigen<br />
wollen. Die Verhandlungsdelegation<br />
besteht aus rund e<strong>in</strong>em Dutzend<br />
syndicom-Mitglie<strong>der</strong>n und -Mitarbeitenden.<br />
H<strong>in</strong>zu kommt von Gewerkschaftsseite<br />
die transfair- Gruppe,<br />
wobei <strong>der</strong> Lead bei syndicom ist.<br />
Wir haben also 2016 unsere<br />
Vor arbeit abgeschlossen und den<br />
syndicom-Mitglie<strong>der</strong>n die For<strong>der</strong>ungen<br />
präsentiert. Die Firmenkonferenz<br />
Swisscom Group hat uns<br />
dann mit e<strong>in</strong>em umfangreichen<br />
For<strong>der</strong>ungskatalog den Verhandlungsauftrag<br />
erteilt.<br />
Bei genauerer Betrachtung <strong>der</strong><br />
Verhandlungsdelegation sieht man:<br />
Wir s<strong>in</strong>d so aufgestellt, dass wir die<br />
Swisscom als Ganzes repräsentieren.<br />
Wir haben Spezialist<strong>in</strong>nen und<br />
Spezialisten aus allen Bereichen und<br />
allen Landesteilen dr<strong>in</strong> – und decken<br />
so die ganze Palette ab. Wichtig ist,<br />
dass wir uns gegenseitig vertrauen;<br />
es können sich alle e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen, und<br />
alle wissen, dass sie dazugehören<br />
und ernst genommen werden. Es ist<br />
wirklich e<strong>in</strong> guter Groove <strong>in</strong> diesem<br />
Team. Es ist sehr gut zusammengestellt,<br />
wir haben e<strong>in</strong>e sehr gute<br />
Zusammenarbeit – es rockt!»<br />
Aufstand <strong>in</strong> den Redaktionen?<br />
Nötig wärs!<br />
Nur zwei Tage nach <strong>der</strong> Bekanntgabe<br />
von sechs Kündigungen und <strong>der</strong><br />
Zusammenlegung von «20m<strong>in</strong>utes» und<br />
«LeMat<strong>in</strong>» <strong>in</strong> <strong>der</strong> Romandie verkündete<br />
Tamedia die folgenschwerste Restrukturierung<br />
seit Bestehen des Verlagshauses:<br />
Ab 2018 sollen nur noch zwei<br />
«Kompetenzzentren» alle Zeitungen des<br />
Unternehmens mit identischen Inhalten<br />
beliefern. Man müsse sparen, heisst es,<br />
und gleichzeitig gibt Tamedia haushohe<br />
Gew<strong>in</strong>ne bekannt. Aber auch R<strong>in</strong>gier<br />
verkündete Restrukturierungen und<br />
Entlassungen im «Blick»-Newsroom,<br />
und die NZZ spart sich die Kulturkorrespondenten,<br />
weil Chefredaktor Erich<br />
Gujer glaubt, dass jedeR RedaktorIn<br />
über alles schreiben können sollte.<br />
syndicom steht mit den Redaktionen <strong>in</strong><br />
Kontakt und unterstützt sie — nicht nur<br />
<strong>in</strong> ihrem Protest, son<strong>der</strong>n auch <strong>in</strong> ihrer<br />
Sorge um die publizistische Vielfalt und<br />
den demokratischen Diskurs <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Schweiz. (nsc)<br />
Risotto statt E<strong>in</strong>heitsbrei<br />
Schon am 17. August machten die<br />
Redaktionen von «Berner Zeitung» und<br />
«Der Bund» auf die drohende Restrukturierung<br />
aufmerksam. Erstmals <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Geschichte <strong>der</strong> Berner Medien taten<br />
sich die konkurrierenden Redaktionen<br />
zusammen und veranstalteten e<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>sames «Risotto-Essen gegen<br />
den E<strong>in</strong>heitsbrei». E<strong>in</strong>heitsbrei erwartet<br />
die Leser<strong>in</strong>nen und Leser, sobald<br />
Tamedia die Redaktionen durch die<br />
beiden Kompetenzzentren ersetzt:<br />
identische Inhalte <strong>in</strong> identisch gestalteten<br />
Zeitungen — nur <strong>der</strong>en Namen<br />
werden sich unterscheiden und e<strong>in</strong>ige<br />
lokal e<strong>in</strong>gefärbte Kommentare. (nsc)<br />
Protestwebsite: bernermedien.ch<br />
Parlament parliert über Post<br />
Nach <strong>der</strong> monatelangen Kampagne von<br />
syndicom ist <strong>der</strong> Poststellen-Kahlschlag<br />
jetzt auf Bundesebene angekommen.<br />
Mehr als e<strong>in</strong> Dutzend Vorstösse s<strong>in</strong>d<br />
im Parlament hängig, und alle gehen<br />
<strong>in</strong> die gleiche Richtung: Der Post<br />
müssen engere Leitplanken gesetzt<br />
werden, damit <strong>der</strong> Service public nicht<br />
gefährdet wird. Die Kommissionen<br />
bei<strong>der</strong> Räte und <strong>der</strong> Nationalrat haben<br />
e<strong>in</strong>e entsprechende Motion bereits<br />
befürwortet. Es fehlt nur noch <strong>der</strong><br />
Stän<strong>der</strong>at. Im letzten Moment versucht<br />
Bundespräsident<strong>in</strong> Leuthard, sich <strong>der</strong><br />
Diskussion zu entledigen, <strong>in</strong>dem sie<br />
e<strong>in</strong>e <strong>Arbeit</strong>sgruppe aller Beteiligten<br />
e<strong>in</strong>setzt. Bis Redaktionsschluss ist bei<br />
syndicom aber noch ke<strong>in</strong>e entsprechende<br />
E<strong>in</strong>ladung e<strong>in</strong>gegangen. E<strong>in</strong>e<br />
Diskussion unter Ausschluss des<br />
Personals wäre e<strong>in</strong> Affront und würde<br />
sicher nicht zu Entspannung <strong>der</strong><br />
Situation beitragen. Die Gefahr<br />
besteht, dass Fakten geschaffen<br />
werden, bevor neue Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
erarbeitet s<strong>in</strong>d. (dro)<br />
Mitglie<strong>der</strong>daten selbst bearbeiten<br />
auf my.syndicom.ch<br />
Ab sofort ist die neue syndicom-Website<br />
onl<strong>in</strong>e. Sie ist jetzt besser lesbar<br />
auf Smartphones und Tablets, vor allem<br />
aber richtet sie sich stärker nach den<br />
Bedürfnissen <strong>der</strong> Gewerkschaftsmitglie<strong>der</strong>.<br />
Neu ist auch <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>bereich<br />
my.syndicom.ch. Hier können<br />
syndicom-Mitglie<strong>der</strong> ihre Daten<br />
e<strong>in</strong> sehen und, z. B. bei e<strong>in</strong>em Adresso<strong>der</strong><br />
Stellenwechsel, selbst korrigieren.<br />
Wer Kurse besucht o<strong>der</strong> Dienstleistungen<br />
<strong>in</strong> Anspruch genommen hat,<br />
f<strong>in</strong>det hier e<strong>in</strong>en Überblick. Also:<br />
Mitglie<strong>der</strong>nummer bereitlegen und auf<br />
my.syndicom.ch Log<strong>in</strong> anfor<strong>der</strong>n. (nsc)<br />
pensionierte.syndicom.ch<br />
Für unsere pensionierten Mitglie<strong>der</strong><br />
haben wir auf unserer Website den<br />
Bereich pensionierte.syndicom.ch<br />
e<strong>in</strong>gerichtet. Hier f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong>teressante<br />
Artikel sowie Veranstaltungsh<strong>in</strong>weise<br />
und E<strong>in</strong>ladungen o<strong>der</strong> Berichte<br />
vergangener Ausflüge und Versammlungen.<br />
Bitte schickt uns eure Beiträge<br />
an redaktion@syndicom.ch. (nsc)<br />
Leserbriefe im Netz<br />
Auch die Zuschriften unserer Leser<strong>in</strong>nen<br />
und Leser werden ab sofort auf<br />
unserer Internetseite publiziert. Wir<br />
behalten uns aber Kürzungen vor. Und<br />
nach wie vor gilt: Anonyme Zuschriften<br />
werden nicht veröffentlicht. (nsc)<br />
Agenda<br />
September<br />
22.<br />
Mit syndicom <strong>in</strong> die «Arena»:<br />
Mitglie<strong>der</strong>besuch bei SRF<br />
23. bis 24.<br />
syndicom-Jugendkonferenz<br />
Jugendherberge Solothurn<br />
Oktober<br />
3. / 12. / 17.<br />
Buchtreff <strong>in</strong> Bern, Hotel National, 19 Uhr<br />
12. <strong>in</strong> Zürich, Rest. Cooperativo, 19 Uhr<br />
17. <strong>in</strong> Basel, Restaurant P<strong>in</strong>ar, 19 Uhr<br />
Treffpunkt für BuchhändlerInnen<br />
9.<br />
... und wer spricht vom<br />
Journalismus?<br />
Was den Journalismus wirklich bedroht.<br />
Podium mit Nick Lüthi (Mo<strong>der</strong>ator,<br />
Medienwoche), Claudia Blumer<br />
(Tages-Anzeiger), Franz Fischl<strong>in</strong> (SRF)<br />
18 Uhr, Zentrum Karl <strong>der</strong> Grosse, Zürich<br />
21.<br />
Reporterforum Schweiz<br />
9 bis 19 Uhr, Volkshaus Zürich<br />
Infos: reporter-forum.ch<br />
28.<br />
Alles rund ums Geld: Erfolgreich Löhne<br />
und Honorare verhandeln. Kurs <strong>in</strong> Bern.<br />
Infos und Anmeldung:<br />
philippe.wenger@syndicom.ch<br />
November<br />
4. und 18.<br />
Vom Selbstverständnis zur Durchsetzung<br />
— Kommunikation für Frauen.<br />
Weiterbildung. Hotel Ador, Bern<br />
20.<br />
syndicom-Kongress <strong>in</strong> Basel<br />
Der Kongress stellt die Weichen für<br />
die Gewerkschaftspolitik 2018–2021<br />
26.<br />
Berner Medientag<br />
Infos: bernermedientag.ch<br />
syndicom.ch/agenda
6 Die an<strong>der</strong>e<br />
Seite<br />
1<br />
Wor<strong>in</strong> seht ihr die Vorteile<br />
e<strong>in</strong>es Gesamtarbeitsvertrags?<br />
Gut wäre die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeit.<br />
O<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest mehr Druck auf<br />
Firmen, die sich Vorteile verschaffen,<br />
<strong>in</strong>dem sie gesetzlichen Graubereiche<br />
bei den <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen ihres<br />
Personals nutzen. Der GAV ist e<strong>in</strong> Teil<br />
des grossen Ganzen, das sich aus<br />
Politik, Gesetz, Marktentwicklung<br />
usw. zusammensetzt. Zusammen mit<br />
branchenübergreifenden Massnahmen<br />
<strong>in</strong> all diesen Bereichen kann<br />
e<strong>in</strong> GAV zu e<strong>in</strong>em fairen Wettbewerb<br />
beitragen.<br />
4<br />
Wie bewertet ihr das Lohnniveau<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Branche?<br />
Die Anfor<strong>der</strong>ungen an Fahrradkuriere<br />
s<strong>in</strong>d sehr unterschiedlich und<br />
damit auch die Löhne. Beim Lieferdienst<br />
für Restaurants stehen wir oft<br />
<strong>in</strong> Konkurrenz zu Pizzakurieren. Der<br />
Druck ist dort stark, mir s<strong>in</strong>d Firmen<br />
bekannt, die Stundenlöhne unter<br />
20 Franken bezahlen. Unter den<br />
Fahrradkurierfirmen ist <strong>der</strong> Veloblitz<br />
bezüglich Lohn und <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen<br />
kaum zu überbieten. Geht<br />
es um kompliziertere logistische<br />
Aufgaben, haben wir Leute im<br />
Betrieb, die Stundenlöhne von mehr<br />
als 40 Franken erreichen.<br />
Christian Schutter,<br />
gelernter Geigenbauer, ist Geschäftsleitungsmitglied<br />
bei <strong>der</strong> Genossenschaft Veloblitz Zürich. Er hat an<br />
den Verhandlungen für den neuen Gesamtarbeitsvertrag<br />
<strong>der</strong> Velokuriere mit syndicom teilgenommen.<br />
2<br />
Wie e<strong>in</strong>igt ihr euch im Konfliktfall<br />
mit den Mitarbeitenden?<br />
So, wie unser Unternehmen organisiert<br />
ist, müssen die Beteiligten e<strong>in</strong><br />
lösungsorientiertes Verhalten zeigen,<br />
an<strong>der</strong>enfalls ist die Situation für<br />
alle sehr belastend und schadet dem<br />
Gesamtbetrieb. Unzufriedenheit<br />
braucht Kanäle, um produktiv zu se<strong>in</strong><br />
und nicht <strong>in</strong> Stagnation und Genörgel<br />
abzudriften. Viel Kommunikation<br />
und Transparenz tragen zum nötigen<br />
Bewusstse<strong>in</strong> bei. Sie s<strong>in</strong>d wohl mit<br />
e<strong>in</strong> Grund für den Erfolg von Veloblitz<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren.<br />
5<br />
Wie hoch ist <strong>der</strong> Frauenanteil<br />
im Betrieb und weshalb?<br />
Bei den Kurieren haben wir e<strong>in</strong><br />
Verhältnis von 1:15. An den Personalentscheiden<br />
liegt das def<strong>in</strong>itiv<br />
nicht – wir bekommen e<strong>in</strong>fach viel<br />
seltener Bewerbungen von Frauen.<br />
Die Me<strong>in</strong>ung, Fahrradkuriere<br />
müssten e<strong>in</strong>fach mit e<strong>in</strong>er Sendung<br />
von Kunde zu Kunde bolzen, ist weit<br />
verbreitet. Da hätten Männer eventuell<br />
physische Vorteile. Sie stimmt<br />
aber überhaupt nicht – es geht<br />
vielmehr um e<strong>in</strong>e sehr ausgeklügelte<br />
Logistik.<br />
3<br />
Gibt es im Betrieb e<strong>in</strong>e Personalkommission?<br />
Bei uns ist das Personal auf ganz<br />
unterschiedlichen Ebenen <strong>in</strong> die<br />
Betriebsführung e<strong>in</strong>gebunden –<br />
nicht nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Personalkommission.<br />
Rund die Hälfte <strong>der</strong> Angestellten<br />
s<strong>in</strong>d Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Genossenschaft<br />
und damit Mitbesitzende des<br />
Unternehmens. Es gibt regelmässige<br />
Belegschaftssitzungen, damit sich<br />
Mitarbeitende, Geschäftsleitung und<br />
Verwaltung austauschen können.<br />
Und wir haben auch e<strong>in</strong>e paritätische<br />
Personalvorsorgekommission.<br />
6<br />
Was regt euch an den Gewerkschaften<br />
richtig auf?<br />
Manchmal sche<strong>in</strong>t es, als hätten sie<br />
sich noch nicht an die Gegebenheiten<br />
<strong>der</strong> aktuellen, temporeichen Zeit<br />
angepasst. Aus me<strong>in</strong>er Position, als<br />
Geschäftsführer e<strong>in</strong>es per Def<strong>in</strong>ition<br />
sehr schnellen und flexiblen Betriebs,<br />
ist es schwierig, wenn sich<br />
Gewerkschaften an den vergangenen<br />
Zeiten ausrichten.<br />
Text: S<strong>in</strong>a Bühler<br />
Bild: Tom Kawara<br />
Gastautor<br />
Begeistert war ich, als die ersten<br />
Mobility-Autos bereitstanden. Man teilt Ressourcen,<br />
schont den Planeten. Geme<strong>in</strong>s<strong>in</strong>n nicht<br />
nur als <strong>in</strong>tellektuelles, politisches Konzept, son<strong>der</strong>n<br />
als gelebter Alltag. Ich war unter den ersten,<br />
die sich e<strong>in</strong>e Airbnb-Unterkunft buchten.<br />
Auch Uber fand ich toll. Konnte man doch das<br />
Taximonopol brechen und die Kontrolle wie<strong>der</strong><br />
den Bürgern zurückgeben. Euphorisch blickte<br />
ich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Zukunft, <strong>in</strong> <strong>der</strong> wir <strong>Arbeit</strong>, Zeit und<br />
Eigentum teilen und so Gier und Verschwendung<br />
überw<strong>in</strong>den können. «Shared economy rulez!».<br />
Vor Kurzem wurde das UberPOP-Angebot <strong>in</strong> Zürich<br />
e<strong>in</strong>gestellt. Gut. Ich freue mich über jedes<br />
Uber-Verbot <strong>in</strong> je<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Stadt. Ich nehme<br />
mit Genugtuung die Aktionen von Anwohnern<br />
<strong>in</strong> Palma de Mallorca und an<strong>der</strong>en Städten gegen<br />
Airbnb wahr. Ich reagiere mit Befriedigung<br />
auf die Reglementierung <strong>der</strong> «gelben Pest», <strong>der</strong><br />
«shared bicycles», aus S<strong>in</strong>gapur. Was ist geschehen?<br />
Die Idee traf auf Menschen. Und Menschen<br />
f<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>en Weg, mit guten, <strong>in</strong>novativen<br />
Konzepten alte, schlechte Gewohnheiten weiterzuführen.<br />
Gier trifft Innovation. Uber machte<br />
aus <strong>der</strong> «shar<strong>in</strong>g economy» e<strong>in</strong>en mult<strong>in</strong>ationalen<br />
Konzern, <strong>der</strong> die Fahrer ausnutzt und ohne<br />
Versicherung fahren lässt. Unternehmen mieten<br />
massenhaft Wohnungen <strong>in</strong> Innenstädten, um<br />
per Airbnb die Hotelreglemente zu unterlaufen.<br />
oBike benutzt die «geschärten» Velos, um per<br />
App Benutzerdaten zu erheben und zu verhökern.<br />
Peer-to-Bus<strong>in</strong>ess-Plattformen verkommen<br />
zu mo<strong>der</strong>nen Sklavenmärkten, auf denen Menschen<br />
ihre <strong>Arbeit</strong> für 5 Dollar pro Stunde anbieten,<br />
da global ke<strong>in</strong> Schutz o<strong>der</strong> M<strong>in</strong>destlohn<br />
e<strong>in</strong>for<strong>der</strong>bar ist. Und natürlich brauchts Regeln,<br />
die M<strong>in</strong>deststandards <strong>in</strong> <strong>Arbeit</strong>srecht, Datenschutz,<br />
Urheberrecht und Sozialversicherung<br />
garantieren. Doch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er globalen Wirtschaft<br />
ist das kaum ganzheitlich umzusetzen. Deshalb<br />
s<strong>in</strong>d die Branchenverbände gefor<strong>der</strong>t, unter<br />
Druck <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmer, Regeln aufzustellen,<br />
verb<strong>in</strong>dlich umzusetzen und e<strong>in</strong>zuhalten.<br />
Geteiltes Leid,<br />
ungeteilter Profit<br />
Réda Philippe El Arbi<br />
Freier Journalist, Blogger, Texter,<br />
Kommunikatiönler – Pr<strong>in</strong>t, Onl<strong>in</strong>e, Social<br />
Media, Beratung, Mediation. Kaffee,<br />
Zigaretten: «Me<strong>in</strong>e professionelle<br />
Identität f<strong>in</strong>det sich irgendwo zwischen<br />
wan<strong>der</strong>nden arabischen Geschichtenerzählern,<br />
italienischen Marktschreiern<br />
und e<strong>in</strong>em altmodischen Telegrafen.»<br />
7
Dossier<br />
Fotos: Vernetzt arbeiten im Colab<br />
H<strong>in</strong>tergrund: Alles schon mal dagewesen?<br />
Neue Studie über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz<br />
9<br />
<strong>Arbeit</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Crowd</strong>
10 Dossier<br />
<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g: Alles<br />
schon mal dagewesen?<br />
<strong>Crowd</strong>worker erledigen für wenig Geld und<br />
ohne jeglichen rechtlichen und sozialen<br />
Schutz kle<strong>in</strong>e Aufträge im Internet. Die<br />
jahrhun<strong>der</strong>tealte Heimarbeit, <strong>in</strong>klusive ihrer<br />
prekären <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen, erlebt <strong>der</strong>zeit<br />
e<strong>in</strong>e Renaissance. Entsteht hier e<strong>in</strong> neues,<br />
digitales Prekariat?<br />
Text: Andres Eberhard<br />
Bil<strong>der</strong>: Tom Kawara<br />
E<strong>in</strong>en Werbetext schreiben für 3 Franken, für 15 Franken<br />
jemanden von Zürich nach W<strong>in</strong>terthur chauffieren, für<br />
20 Franken über Skype an e<strong>in</strong>er Umfrage teilnehmen. Die<br />
Digitalisierung macht es möglich, über das Internet o<strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>e App <strong>in</strong>nerhalb von kurzer Zeit <strong>Arbeit</strong> zu f<strong>in</strong>den. Bereits<br />
ist von e<strong>in</strong>er «Gig Economy» die Rede, e<strong>in</strong>em Heer<br />
von <strong>Arbeit</strong>nehmenden, die sich <strong>in</strong> Zukunft mit vielen<br />
Kle<strong>in</strong>staufträgen (Gigs) über Wasser halten.<br />
Wie gemacht für diese neue, flexible Form <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
ist das sogenannte <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g. Firmen schreiben<br />
über digitale Plattformen wie Freelancer.com o<strong>der</strong><br />
Upwork.com Aufträge aus, <strong>Arbeit</strong>nehmende können sich<br />
darauf bewerben. Oft wird synonym von «<strong>Crowd</strong>sourc<strong>in</strong>g»<br />
gesprochen, weil es für die Auftraggeber e<strong>in</strong> Outsourc<strong>in</strong>g<br />
von <strong>Arbeit</strong> an e<strong>in</strong>e undef<strong>in</strong>ierte Masse von Leuten (<strong>Crowd</strong>)<br />
bedeutet. Was wie e<strong>in</strong> eben erst aufgekommener Trend<br />
kl<strong>in</strong>gt, ist <strong>in</strong> Wahrheit gar nicht so neu. Letztlich s<strong>in</strong>d<br />
<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g und an<strong>der</strong>e flexible <strong>Arbeit</strong>sformen des<br />
digitalen Zeitalters e<strong>in</strong> Zeichen für e<strong>in</strong>e Renaissance <strong>der</strong><br />
alten Heimarbeit: <strong>Arbeit</strong>geberInnen lagern <strong>Arbeit</strong>en an<br />
formell selbstständige Dienstleistende aus, statt dafür<br />
Personal anzustellen – hauptsächlich, um Geld zu sparen,<br />
teilweise auch, um vom technischen Know-how o<strong>der</strong> von<br />
den Ideen <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>enden zu profitieren.<br />
Die neuen <strong>Crowd</strong>worker kämpfen mit denselben Problemen<br />
wie die alten Heimarbeiter, wie sie es bis Mitte des<br />
20. Jahrhun<strong>der</strong>ts <strong>in</strong> Export<strong>in</strong>dustrien zuhauf gab: sehr<br />
schlecht entlöhnt und auf Ver<strong>der</strong>b den Launen <strong>der</strong> Konjunktur<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelner <strong>Arbeit</strong>geben<strong>der</strong> ausgesetzt. Wirtschaftliche<br />
Risiken und ihre sozialen Folgen tragen sie<br />
ausnahmslos selbst. Wurden HeimarbeiterInnen früher<br />
per Stange Garn entlohnt, erhalten <strong>Crowd</strong>workerInnen<br />
heute e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en Obolus für das Testen e<strong>in</strong>er Software.<br />
Die Blütezeit <strong>der</strong> Heimarbeit<br />
Heimarbeit gibt es schon seit dem 16. Jahrhun<strong>der</strong>t. Kaufleute<br />
aus <strong>der</strong> Stadt engagierten Handwerker vom Land als<br />
billige <strong>Arbeit</strong>skräfte. Die grosse Blütezeit erlebte die<br />
Heimarbeit mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung des Verlagssystems ab<br />
dem 17. Jahrhun<strong>der</strong>t. Der Herstellungsprozess wurde <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>zelne <strong>Arbeit</strong>sschritte zerlegt, die von jeweils an<strong>der</strong>en<br />
SpezialistInnen <strong>in</strong> Heimarbeit ausgeführt wurden. In <strong>der</strong><br />
Textil<strong>in</strong>dustrie beispielsweise lieferten Kaufleute Rohstoffe<br />
(beispielsweise Baumwolle) o<strong>der</strong> Zwischenprodukte<br />
(wie Garn) sowie die notwendigen Werkzeuge an die<br />
Haushalte, liessen sie dort verarbeiten (z. B. zu Tüchern)<br />
und exportierten sie danach. So wurde etwa im Kanton<br />
Zürich e<strong>in</strong> Grossteil <strong>der</strong> Baumwolle, Seide und Wolle <strong>in</strong><br />
Heimarbeit auf dem Land verarbeitet. In Tausenden von<br />
privaten Stuben und Kellern standen Spulrä<strong>der</strong> und Webstühle.<br />
E<strong>in</strong> Grossteil <strong>der</strong> ländlichen Familien lebte bis<br />
Mitte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts von diesen E<strong>in</strong>künften. Bezahlt<br />
wurden sie pro Stange o<strong>der</strong> Gewicht, <strong>Arbeit</strong>sausfälle<br />
wurden nicht entschädigt. Auch Uhren wurden über viele<br />
Jahre h<strong>in</strong>weg hauptsächlich <strong>in</strong> Heimarbeit gefertigt.<br />
Mitte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts waren für e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige Uhr<br />
über 50 <strong>Arbeit</strong>sschritte notwendig, die von den jeweiligen<br />
SpezialistInnen zu Hause o<strong>der</strong> <strong>in</strong> Ateliers ausgeführt wurden.<br />
Vielerorts waren ganze Familien mit <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> beschäftigt<br />
– auch K<strong>in</strong><strong>der</strong>. Die <strong>Arbeit</strong> war für die ländliche<br />
Bevölkerung e<strong>in</strong>e wirtschaftlich notwendige Nebenbeschäftigung<br />
zur landwirtschaftlichen Feldarbeit. «Der<br />
Verdienst war ordentlich und die K<strong>in</strong><strong>der</strong> zahlreich», wie<br />
sich e<strong>in</strong> jurassischer Uhrenmacher <strong>in</strong> <strong>der</strong> «Gewerblichen<br />
Rundschau» von 1909 er<strong>in</strong>nerte. Doch mit <strong>der</strong> aufkommenden<br />
Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
wurden die Verdienste kle<strong>in</strong>er, die <strong>Arbeit</strong>szeiten länger,<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> arbeit häufiger. Unzählige Heimarbeiter<strong>in</strong>nen und<br />
Heimarbeiter mussten ihre Dörfer verlassen, um <strong>Arbeit</strong> <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Fabrik anzunehmen. Aus kle<strong>in</strong>bäuerlichen Heimarbeitenden<br />
wurde das lohnabhängige Fabrikproletarieriat.<br />
Während Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts noch 68 000 Mitarbeitende<br />
<strong>in</strong> den Schweizer Export<strong>in</strong>dustrien <strong>in</strong> Heimarbeit<br />
tätig waren, waren es zu Beg<strong>in</strong>n des 2. Weltkriegs<br />
noch 12 300. Wenig später war Heimarbeit praktisch<br />
verschwunden – es gab sie primär noch als schlecht bezahlten<br />
Zusatzverdienst für Hausfrauen aus entlegenen<br />
Bergregionen. Erst mit dem Aufkommen <strong>der</strong> neuen<br />
Kommunikationstechnologien, mit <strong>der</strong> Verbreitung von<br />
Computer und Internet ab Ende des Jahrhun<strong>der</strong>ts sollten<br />
Firmen wie<strong>der</strong> vermehrt <strong>Arbeit</strong> auslagern – womit die<br />
Renaissance <strong>der</strong> Heimarbeit e<strong>in</strong>geleitet wurde.<br />
«Was für uns<br />
e<strong>in</strong> prekärer<br />
Lohn wäre,<br />
ist für In<strong>der</strong><br />
o<strong>der</strong> Bulgaren<br />
e<strong>in</strong> gutes<br />
E<strong>in</strong>kommen.»
<strong>Arbeit</strong>en im Co-Work<strong>in</strong>g-Space: Man teilt<br />
sich Büro und Infrastruktur, kann sich über<br />
Projekte austauschen o<strong>der</strong> auch e<strong>in</strong>fach<br />
Kaffee tr<strong>in</strong>ken.<br />
13<br />
nehmen. Tatsächlich s<strong>in</strong>d die Parallelen zwischen alter<br />
Heimarbeit und neuen Formen wie <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g augensche<strong>in</strong>lich.<br />
Doch gibt es e<strong>in</strong>en wichtigen Unterschied.<br />
Geschah Heimarbeit früher aus e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen<br />
Notwendigkeit heraus, wählen heute viele gut ausgebildete<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmende freiwillig die Heimarbeit mitsamt<br />
ihren prekären Bed<strong>in</strong>gungen. E<strong>in</strong> Grund dafür ist <strong>der</strong><br />
Trend h<strong>in</strong> zur Flexibilisierung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>. Viele wollen<br />
zeitlich und örtlich ungebunden arbeiten. Manche wollen<br />
schlicht die K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung gleichberechtigt aufteilen.<br />
In jüngeren Generationen hat sich zudem e<strong>in</strong>e Gruppe<br />
Die persönliche Freiheit<br />
ist <strong>der</strong> digitalen Bohème<br />
wichtiger als regulierte<br />
<strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen.<br />
cherheit ver liehen, fand die Gesellschaft darauf e<strong>in</strong>e Antwort.<br />
In jahrzehntelanger <strong>Arbeit</strong> erschuf man soziale Sicherheitsnetze<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Überzeugung, dass es für <strong>in</strong>dividu elle<br />
Not e<strong>in</strong>e kollektive Verantwortung gibt. Mit <strong>der</strong> Digitalisierung<br />
än<strong>der</strong>n sich die <strong>Arbeit</strong>sverhältnisse erneut radikal<br />
– e<strong>in</strong>erseits aus wirtschaftlichen Zwängen heraus, an<strong>der</strong>erseits<br />
wegen verän<strong>der</strong>ter gesellschaftlicher Normen.<br />
Noch aber hängt die Mehrheit <strong>der</strong> Errungenschaften des<br />
mo<strong>der</strong>nen Sozialstaats, erkämpft über mehr als hun<strong>der</strong>t<br />
Jahre, an traditionellen Vollzeit-Lohnarbeitsverhältnissen:<br />
Pen sions- und Krankenversicherung, Krankentaggeld<br />
und Mutterschutz, <strong>Arbeit</strong>szeitbeschränkungen und<br />
Feiertage, betriebliche Mitbestimmung o<strong>der</strong> Kollektivverträge.<br />
Die Gesellschaft wird also erneut gefor<strong>der</strong>t se<strong>in</strong>, ihr<br />
Sozialsystem grundlegend anzupassen, damit aus den<br />
neuen Selbstständigen – e<strong>in</strong>er Mischung aus digitalem<br />
Prekariat und digitaler Bohème – nicht die VerliererInnen<br />
dieser neuen, digitalen Revolution werden, die permanent<br />
mit prekären <strong>Arbeit</strong>sverhältnissen leben müssen.<br />
syndicom.ch/crowdwork<strong>in</strong>g<br />
Studie von Meissner/Weissbrodt:<br />
ta-swiss.ch/flexible-neue-arbeitswelt<br />
Die «neue» Heimarbeit über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen<br />
gibt es seit rund zehn Jahren und dem Aufkommen von<br />
sozialen Netzwerken.<br />
Für Firmen ist auslagern rational, für <strong>Arbeit</strong>er prekär<br />
Warum aber wurde es für Firmen auf e<strong>in</strong>mal wie<strong>der</strong> <strong>in</strong>teressant,<br />
<strong>Arbeit</strong> an Externe zu vergeben, statt sie <strong>in</strong>tern im<br />
Betrieb zu erledigen? Der britische Ökonom Ronald<br />
Coase sah die Antwort auf diese Frage im Jahr 1937 vorweg<br />
– und sollte damit später den Nobelpreis für Wirtschaft<br />
gew<strong>in</strong>nen. Je mehr Zeit und Mühe es koste, um für<br />
jeden e<strong>in</strong>zelnen <strong>Arbeit</strong>sschritt externe Dienst leisterInnen<br />
zu suchen, desto rationaler sei es, eigenes Personal anzustellen.<br />
Er nannte diese Aufwände «Transaktions kosten».<br />
Mit <strong>der</strong> Digitalisierung s<strong>in</strong>d nun diese Trans aktionskosten<br />
drastisch gesunken. Plötzlich ist es möglich, mit wenigen<br />
Klicks selbst kle<strong>in</strong>ste <strong>Arbeit</strong>saufträge auf e<strong>in</strong>em Markt<br />
mit Tausenden Dienstleistenden aus zuschreiben – zum<br />
Beispiel über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen. Mit an<strong>der</strong>en<br />
Worten: Das Auslagern von <strong>Arbeit</strong> ist viel günstiger und<br />
für Firmen damit <strong>in</strong>teressanter ge worden.<br />
Was bedeutet das für die neuen Selbstständigen, die<br />
diese <strong>Arbeit</strong>en ausführen? Beispiel <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g: Oft<br />
erledigen die neuen HeimarbeiterInnen monoton-repetitive<br />
<strong>Arbeit</strong>en für wenige Franken, Euro o<strong>der</strong> Dollar pro<br />
Stunde und ohne jeglichen arbeitsrechtlichen Schutz.<br />
Kommt dazu, dass Betreibenden von <strong>Crowd</strong>fund<strong>in</strong>g-Plattformen<br />
von e<strong>in</strong>em rechtlichen Graubereich profitieren.<br />
Im Netz verschwimmen Landesgrenzen, weswegen Firmen<br />
<strong>Arbeit</strong>sverträge kurzerhand durch ihre allgeme<strong>in</strong>en<br />
Geschäftsbed<strong>in</strong>gungen ersetzen. Dass dies rechtlich auf<br />
Dauer standhält, ist zwar unwahrsche<strong>in</strong>lich. Jedoch ist es<br />
aufgrund des grenzüberschreitenden und meist anonymen<br />
Felds <strong>der</strong> digitalen <strong>Arbeit</strong> noch immer schwierig, <strong>Arbeit</strong>srecht<br />
zu kontrollieren, geschweige denn, es flächendeckend<br />
durchzusetzen.<br />
Menschen, die mit <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Aufträgen ihren<br />
Hauptverdienst bestreiten, werden auch «Clickworker»<br />
genannt. In Vollzeit gebe es sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz jedoch noch<br />
kaum, me<strong>in</strong>t Professor Jan Marco Leimeister, <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Experte<br />
am Institut für Wirtschafts<strong>in</strong>formatik <strong>der</strong><br />
Uni St. Gallen. «Für SchweizerInnen s<strong>in</strong>d <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-<br />
Auf träge eher Dritt- bis Fünftjobs.» <strong>Arbeit</strong> über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen<br />
würde während Leerlaufzeiten als<br />
e<strong>in</strong>fach verfügbarer Zuverdienst dienen, Abwechslung zu<br />
an<strong>der</strong>en Tätigkeiten bieten o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Kundenakquise<br />
helfen. Was es h<strong>in</strong> gegen sicher gebe, seien Schweizer<br />
Firmen, die auslän dische <strong>Crowd</strong>worker beauftragen, die<br />
<strong>in</strong> ihren Heimatlän<strong>der</strong>n von diesen E<strong>in</strong>künften leben.<br />
Leimeister betont, dass dies nicht durchwegs negativ ist.<br />
«Was für uns e<strong>in</strong> prekärer Lohn wäre, ist für In<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
Bulgaren e<strong>in</strong> gutes E<strong>in</strong>kommen.»<br />
Digitales Prekariat o<strong>der</strong> digitale Bohème?<br />
Kritiker sehen das Aufkommen <strong>der</strong> neuen Heimarbeit als<br />
Zeichen für e<strong>in</strong> ausbeuterisches System o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Rückkehr<br />
zum Taylorismus. Von e<strong>in</strong>em «digitalen Prekariat»<br />
ist die Rede, von <strong>Arbeit</strong> auf Abruf und e<strong>in</strong>em Heer von<br />
Tagelöhnern und Sche<strong>in</strong>selbstständigen, die ke<strong>in</strong>e <strong>Arbeit</strong><br />
f<strong>in</strong>den und darum für Hungerlöhne Kle<strong>in</strong>staufträge an-<br />
von S<strong>in</strong>n suchenden <strong>Arbeit</strong>nehmenden herausgebildet,<br />
denen persönliche Freiheit und Selbstständigkeit wichtiger<br />
s<strong>in</strong>d als Entlöhnung o<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen. Dem<br />
Stereotyp nach leben sie <strong>in</strong> Bali, machen morgens Yoga<br />
und abends Party, dazwischen bearbeiten sie am Laptop<br />
Projekte für globale Auftraggeber. Wohlgemerkt schreiben<br />
Firmen auf <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen nicht nur<br />
repetitive, für Unqualifizierte geeignete <strong>Arbeit</strong>en wie das<br />
Testen von Software aus, son<strong>der</strong>n suchen dort auch nach<br />
Kreativen, die ihnen e<strong>in</strong> neues Logo gestalten o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Werbespruch texten. Es gibt also nicht nur das «digitale<br />
Prekariat», son<strong>der</strong>n eben auch die «digitale Bohème».<br />
Sozialsystem neu denken<br />
Was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn die Zukunft<br />
<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> aus immer mehr solchen «neuen Selbstständigen»<br />
besteht? Der Ökonom Jens Meissner von <strong>der</strong> Hochschule<br />
Luzern und <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>spsychologe Johann Weichbrodt<br />
von <strong>der</strong> Fachhochschule Nordwestschweiz haben<br />
sich unter an<strong>der</strong>em diese Frage gestellt. In ihrer Studie<br />
«Flexible neue <strong>Arbeit</strong>swelt» haben sie mehrere Szenarien<br />
zur Zukunft <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> erarbeitet. E<strong>in</strong>es davon war die Verschiebung<br />
h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Mehrheit <strong>der</strong> Bevölkerung, die als<br />
Selbstständige arbeitet. Die Autoren schreiben, dass dies<br />
volkswirtschaftlich vor allem negative Konsequenzen hätte.<br />
Weichbrodt sagt: «Die soziale Absicherung wäre weitgehend<br />
ungeklärt, da unser Sozialsystem auf Festanstellungen<br />
ausgerichtet ist.» Ausserdem würden E<strong>in</strong>bussen<br />
bei den Steuere<strong>in</strong>nahmen anfallen – e<strong>in</strong>erseits, weil <strong>Arbeit</strong>nehmende<br />
tendenziell weniger verdienen würden, an<strong>der</strong>erseits,<br />
weil es durch Kryptowährungen wie Bitco<strong>in</strong><br />
leichter würde, E<strong>in</strong>kommen nicht anzugeben. Weichbrodt<br />
betont aber, dass es sich bei diesen Szenarien um<br />
Gedankenspiele handelt: «Dass dieses Szenario e<strong>in</strong>trifft,<br />
ist unwahrsche<strong>in</strong>lich.» Mit <strong>der</strong> Studie habe man lediglich<br />
aufzeigen wollen, dass das Sozialsystem grundlegend<br />
überdacht werden muss, falls sich flexiblere <strong>Arbeit</strong>sformen<br />
<strong>in</strong> Zukunft durchsetzen sollten. Als die Industrialisierung<br />
Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts viele <strong>Arbeit</strong>erInnen<br />
aus ihren sozialen Netzen herausriss, die e<strong>in</strong>e gewisse Si-<br />
Die Digitalisierung hat grosse Auswirkungen<br />
– gerade für die Frauen<br />
Die Chancen und Risiken <strong>der</strong> Digitalisierung s<strong>in</strong>d nicht für<br />
alle <strong>Arbeit</strong>nehmendengruppen gleich. Unter den bedrohten<br />
Berufen bef<strong>in</strong>den sich viele typische «Frauenberufe».<br />
Werden ke<strong>in</strong>e Massnahmen getroffen, um Frauen für die<br />
wachsenden Berufsfel<strong>der</strong> zu qualifizieren, droht e<strong>in</strong>e<br />
Prekarisierung <strong>der</strong> Frauen im Tieflohnbereich. Die notwendigen<br />
Investitionen <strong>in</strong> die Weiterbildung müssen deshalb<br />
allen offenstehen! Das ist ke<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit, wie<br />
Studien des Bundesamts für Statistik belegen. Männer<br />
erhalten von ihren <strong>Arbeit</strong>gebern mehr Geld und <strong>Arbeit</strong>szeit<br />
für die Weiterbildung als ihre Kolleg<strong>in</strong>nen. E<strong>in</strong> Grund: das Bild<br />
des Mannes als Hauptverdienen<strong>der</strong>. Unternehmen müssen<br />
hier endlich umdenken. Sonst werden Frauen zur Manövriermasse.<br />
Die Flexibilisierung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> birgt Chancen, weil<br />
sie die Vere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und Familie vere<strong>in</strong>facht.<br />
Gleichzeitig erhöht das Weiterbildungsdiktat die Mehrfachbelastung<br />
<strong>der</strong> Frauen, die noch immer den Grossteil <strong>der</strong><br />
Betreuungsarbeit übernehmen. Und noch immer verdienen<br />
Frauen für gleichwertige <strong>Arbeit</strong> 20 Prozent weniger.<br />
Patrizia Mord<strong>in</strong>i<br />
Leiter<strong>in</strong> Gleichstellung, Mitglied <strong>der</strong> Geschäftsleitung
Studie: <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g ist <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Schweiz häufiger als man denkt<br />
<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz: Immer mehr Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz suchen<br />
<strong>Arbeit</strong> über Internet-Plattformen. Die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Studie<br />
auf e<strong>in</strong>en Blick:<br />
14 Dossier 15<br />
Fast jedeR fünfte Erwerbstätige <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz<br />
nutzt <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g. Das geht aus e<strong>in</strong>er neuen<br />
Onl<strong>in</strong>e-Studie <strong>der</strong> Universität von Hertfordshire<br />
und Ipsos MORI <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit <strong>der</strong><br />
Foundation for European Progressive Studies<br />
(FEPS), UNI Europa und syndicom hervor.<br />
Schweizer <strong>Crowd</strong>worker<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
pro Woche<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
pro Monat<br />
10.0 %<br />
12.7 %<br />
Vergleich mit an<strong>der</strong>en<br />
europäischen Län<strong>der</strong>n<br />
Grossbritannien<br />
Schweden<br />
Nie<strong>der</strong>lande<br />
Deutschland<br />
Österreich<br />
Schweiz<br />
Text: Andres Eberhard<br />
Mit 18% <strong>der</strong> Befragten fanden deutlich mehr <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Schweiz wohnhafte Personen über Onl<strong>in</strong>e-Plattformen<br />
<strong>Arbeit</strong> als <strong>in</strong> den meisten an<strong>der</strong>en eutropäischen Län<strong>der</strong>n,<br />
wie Vergleiche mit Deutschland, Grossbritannien,<br />
Schweden und den Nie<strong>der</strong>landen zeigen, wo die gleiche<br />
Studie 2016 durchgeführt wurde. E<strong>in</strong>zig Österreich kam<br />
auf e<strong>in</strong>en noch höheren Wert. Sogar 32% <strong>der</strong> Schweizer<br />
und Schweizer<strong>in</strong>nen suchten nach <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g- <strong>Arbeit</strong>,<br />
jedoch nicht alle erfolgreich.<br />
Als <strong>Crowd</strong>worker wurde <strong>in</strong> <strong>der</strong> Studie bezeichnet, wer<br />
über Onl<strong>in</strong>e-Plattformen e<strong>in</strong>e <strong>Arbeit</strong> gefunden hatte.<br />
<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g umfasst <strong>in</strong> dieser Def<strong>in</strong>ition <strong>der</strong> Studienautoren<br />
also nicht nur <strong>Arbeit</strong> am eigenen Computer (wie<br />
Upwork), son<strong>der</strong>n auch Fahr- und Auslieferdienste (wie<br />
Uber) sowie Putz- o<strong>der</strong> technische <strong>Arbeit</strong>en bei an<strong>der</strong>en zu<br />
Hause (wie Mila). Bed<strong>in</strong>gung war aber stets, dass die <strong>Arbeit</strong><br />
über e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>e-Plattform vermittelt wurde.<br />
Meist e<strong>in</strong> Nebenverdienst<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
im letzten<br />
Jahr<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
suchend<br />
17.0 %<br />
<strong>Crowd</strong>work nach Alter<br />
45–54<br />
14.9 %<br />
55–64<br />
9.8 %<br />
65–70<br />
4.6 %<br />
16–24<br />
25.3 %<br />
32.2 %<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
pro Woche<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
pro Monat<br />
<strong>Crowd</strong>work im<br />
letzten Jahr<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
suchend<br />
Für die meisten bedeutete <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g nur e<strong>in</strong> Zuverdienst.<br />
Trotzdem gab jedeR vierte <strong>Crowd</strong>workerIn (26%)<br />
an, dass die entsprechenden Aufträge mehr als die Hälfte<br />
se<strong>in</strong>er bzw. ihrer E<strong>in</strong>nahmen ausmachten. Das entspricht<br />
rund 4,7% <strong>der</strong> arbeitenden Bevölkerung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz.<br />
Für wie<strong>der</strong>um rund die Hälfte davon stellte <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g<br />
sogar die e<strong>in</strong>zige E<strong>in</strong>nahmequelle dar.<br />
Auffallend ist, dass die meisten <strong>Crowd</strong>workerInnen<br />
meh rere unterschiedliche <strong>Arbeit</strong>en ausführten. «Das<br />
heisst, dass sie alles machten, was sie f<strong>in</strong>den konnten»,<br />
erklärt Studienleiter<strong>in</strong> Prof. Ursula Huws. Ihre These:<br />
«Möglicherweise handelt es sich um Saisonarbeiter, die<br />
während Leerzeiten an<strong>der</strong>e <strong>Arbeit</strong> suchen.»<br />
Eher jünger, eher männlich, eher Tess<strong>in</strong>er<br />
Wer s<strong>in</strong>d die <strong>Crowd</strong>worker? Gemäss <strong>der</strong> Studie f<strong>in</strong>den sie<br />
sich <strong>in</strong> allen Gesellschaftsschichten; darunter s<strong>in</strong>d jedoch<br />
etwas mehr Jüngere und etwas mehr Männer. Mehr als jedeR<br />
Zweite (52%) hat e<strong>in</strong>en Vollzeitjob, 21% s<strong>in</strong>d Teilzeitangestellte,<br />
9% Selbstständige, jeweils 5% Studierende<br />
und RentnerInnen sowie 3% Vollzeiteltern. Auch bezüglich<br />
ihrer Herkunft gab es Unterschiede: Prozentual am<br />
meisten <strong>Crowd</strong>workerInnen fanden sich im Tess<strong>in</strong>, am<br />
wenigsten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ostschweiz. Bei <strong>der</strong> Studie handelt es<br />
sich um e<strong>in</strong>e repräsentative Onl<strong>in</strong>e-Umfrage unter 2001 <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Schweiz wohnhaften Personen im Alter zwischen 16<br />
und 70 Jahren.<br />
Weitere Infos zur Studie über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g<br />
auf unserer brandneuen Website:<br />
syndicom.ch/crowdwork<strong>in</strong>g<br />
Fotostrecke<br />
Die Bil<strong>der</strong> zu diesem Themendossier machte <strong>der</strong> freischaffende<br />
Fotograf Tom Kawara im «Colab Impact Hub» <strong>in</strong> Zürich.<br />
Co-Work<strong>in</strong>g-Spaces wie das Colab im Impact Hub <strong>in</strong> Zürich<br />
vermitteln nicht nur Büroarbeitsplätze und die nötige<br />
Infrastruktur, son<strong>der</strong>n vernetzen auch ihre Mitglie<strong>der</strong> sowie<br />
<strong>der</strong>en Projekte untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> o<strong>der</strong> veranstalten geme<strong>in</strong>same<br />
Events und Programme. Neben Sitzungsräumen und E<strong>in</strong>zelarbeitsplätzen<br />
f<strong>in</strong>den sich hier auch Geme<strong>in</strong>schaftsräume<br />
und e<strong>in</strong> Café, wo man sich austauschen kann.<br />
zurich.impacthub.ch — kawara.com<br />
35–44<br />
20.3 %<br />
25–34<br />
25.1 %<br />
Anteil <strong>Crowd</strong>work als<br />
E<strong>in</strong>kommensquelle im<br />
Bereich Onl<strong>in</strong>e-Wirtschaft<br />
Airbnb<br />
Verkauf von selbst<br />
hergestellten Produkten<br />
Produkteverkauf auf<br />
eigener Webseite<br />
<strong>Crowd</strong>work<br />
Gew<strong>in</strong>norientierter<br />
Weiterverkauf<br />
Verkauf von eigenem Hab<br />
und Gut auf e<strong>in</strong>er Webseite<br />
12.3 %<br />
14.0 %<br />
17.7 %<br />
18.2 %<br />
48.5 %<br />
65.1 %<br />
Erwerbsstatus<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
Alle<br />
<strong>Crowd</strong>worker<br />
00 % 05 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %<br />
Häufige<br />
<strong>Crowd</strong>worker<br />
Vollzeit beschäftigt<br />
Teilzeit beschäftigt<br />
Selbständig<br />
Vollzeit-Eltern<br />
Pensioniert<br />
Studierend<br />
50 % und mehr<br />
des E<strong>in</strong>kommens<br />
aus <strong>Crowd</strong>work
E<strong>in</strong>e bessere<br />
16 17<br />
«Für uns <strong>Arbeit</strong>geber ist es ganz wichtig, dass im GAV Standards def<strong>in</strong>iert s<strong>in</strong>d,<br />
die für die ganze Branche Gültigkeit haben sollen.» Peter Weigelt, Präsident contactswiss<br />
<strong>Arbeit</strong>swelt<br />
Aktive Mitglie<strong>der</strong> diskutieren über Ziele und die Zukunft <strong>der</strong> Gewerkschaft. (© Samuel Bauhofer)<br />
Fairlog: syndicom,<br />
SEV und Unia spannen<br />
zusammen<br />
Der Strassentransport ist e<strong>in</strong> weitgehend<br />
unregulierter Bereich, <strong>der</strong> aber<br />
kont<strong>in</strong>uierlich wächst. Nicht zuletzt<br />
deshalb, weil grosse Firmen ihre<br />
Gütertransporte auslagern. Auch die<br />
Post hat vor e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Jahren ihre<br />
Lastwagenflotte mit Fahrzeugen über<br />
3,5 Tonnen ausgemustert und die Aufträge<br />
an Private vergeben. Die Firmen<br />
sprechen von betriebswirtschaftlicher<br />
Effizienz und me<strong>in</strong>en damit wohl das<br />
tiefere Lohnniveau <strong>in</strong> diesem Sektor.<br />
Die LKW-Logistik greift <strong>in</strong> Branchen,<br />
die sowohl syndicom, <strong>der</strong> SEV<br />
syndicom schützt<br />
Berufstätige <strong>in</strong> allen<br />
<strong>Arbeit</strong>sformen: e<strong>in</strong><br />
strategisches Ziel<br />
unserer Gewerkschaft<br />
Dass <strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> Berufstätigen <strong>in</strong><br />
allen <strong>Arbeit</strong>sformen am syndicom-<br />
Kongress im November zu e<strong>in</strong>em <strong>der</strong><br />
vier strategischen Ziele erklärt werden<br />
soll, zeigt dessen Wichtigkeit und<br />
Dr<strong>in</strong>glichkeit. Denn mit <strong>der</strong> zunehmenden<br />
Digitalisierung breiten sich<br />
diese <strong>Arbeit</strong>sformen immer mehr aus.<br />
«Unser Ziel ist es, die soziale Absicherung<br />
und Erwerbslage [<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>enden<br />
<strong>in</strong> neuen <strong>Arbeit</strong>sformen] zu verbessern<br />
und zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, dass sie<br />
unfreiwillig <strong>in</strong> diese <strong>Arbeit</strong>sformen<br />
gedrängt werden», hält das Strategiepapier<br />
fest. Umgesetzt werden soll<br />
dieses Ziel unter an<strong>der</strong>em durch mehr<br />
Sozialversicherungsschutz, die Zertifizierung<br />
von Plattformen, die kollektive<br />
Regelung <strong>der</strong> Entschädigungen<br />
und den Schutz des geistigen Eigentums<br />
von Freischaffenden.<br />
Die vier strategischen Ziele wurden<br />
mit dem Zentralvorstand erarbeitet<br />
und bef<strong>in</strong>den sich zurzeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten<br />
Vernehmlassungsrunde bei den<br />
Gremien. Die weiteren strategischen<br />
Ziele betreffen die Mitglie<strong>der</strong>entwicklung,<br />
die Weiterentwicklung <strong>der</strong> Gesamtarbeitsverträge<br />
und das Recht<br />
auf lebenslange Aus- und Weiterbildung.<br />
Die Gremien können bis zum<br />
Kongress Anträge zum Strategie papier<br />
stellen. (Christian Capacoel)<br />
syndicom.ch/kongress2017<br />
und die Unia zu e<strong>in</strong>em gewissen Teil<br />
abdecken. Der logische Schritt war<br />
deshalb, dass die drei Gewerkschaften<br />
e<strong>in</strong>e Kooperation aufbauen und den<br />
geme<strong>in</strong>samen Vere<strong>in</strong> Fairlog gründeten.<br />
Fairlog soll für die drei Gewerkschaften<br />
den Weg bereiten, um mittelfristig<br />
die gesamte Branche zu regulieren.<br />
(David Roth)<br />
Die GAV-Politik von<br />
syndicom im Zeichen<br />
<strong>der</strong> Digitalisierung<br />
Contact- und Callcenter:<br />
e<strong>in</strong> GAV für die gesamte Branche<br />
Der GAV-Beitritt von CallNet.ch als weiterem Sozialpartner –<br />
neben <strong>der</strong> Gewerkschaft syndicom und dem <strong>Arbeit</strong>geberverband<br />
contactswiss – ist e<strong>in</strong> wichtiger Schritt zur Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkerklärung<br />
des Gesamtarbeitsvertrages.<br />
Die flächendeckende Regelung <strong>der</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen durch die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlicherklärung<br />
ist e<strong>in</strong>e<br />
Notwendigkeit, da die Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an die Unternehmen und die Mitarbeitenden<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Contact- und Callcenter-Branche<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
markant gestiegen s<strong>in</strong>d. Immer strengere<br />
Qualitätsstandards, zunehmende<br />
Standardisierung und gleichzeitig<br />
grössere Kundenorientierung werden<br />
von den Agent<strong>in</strong>nen und Agenten als<br />
selbstverständlich vorausgesetzt. Diese<br />
leiden unter den sich wi<strong>der</strong>sprechenden<br />
Zielen von Wirtschaftlichkeit<br />
und <strong>in</strong>dividueller Betreuung <strong>der</strong><br />
Die Unterzeichner des GAV: Dieter Fischer, Giorgio Pard<strong>in</strong>i und Peter Weigelt (vlnr). (© zvg)<br />
Während die Öffentlichkeit weiterh<strong>in</strong><br />
fleissig über die Digitalisierung diskutiert,<br />
arbeiten wir <strong>in</strong> den Gesamtarbeitsverträgen<br />
(GAV) an konkreten<br />
Lösungen für die gewerkschaftlichen<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> digitalen <strong>Arbeit</strong>swelt.<br />
Der GAV Sunrise ist <strong>der</strong><br />
erste GAV, <strong>der</strong> unter dieser Prämisse<br />
erneuert wurde – mit zwei wichtigen<br />
Fortschritten. Erstmals wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
GAV das explizite Recht auf Ab schalten<br />
festgeschrieben. E<strong>in</strong> Meilenste<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er zunehmend entgrenzten <strong>Arbeit</strong>swelt.<br />
Sunrise-Mitarbeitende haben<br />
das Recht, ausserhalb <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>szeiten<br />
nicht erreichbar zu se<strong>in</strong>. Zusätzlich<br />
konnte <strong>der</strong> Anspruch auf angemessene<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
zur Erhaltung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>smarktfähigkeit<br />
im GAV vere<strong>in</strong>bart werden. In<br />
den kommenden GAV-Verhandlungen<br />
wollen wir weitere Fortschritte<br />
erzielen. Dazu gehört auch die Regulierung<br />
und Zertifizierung von <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen.<br />
Wer e<strong>in</strong>e<br />
digitale Plattform betreibt, hat sicherzustellen,<br />
dass ke<strong>in</strong> Sozial- o<strong>der</strong><br />
Lohndump<strong>in</strong>g stattf<strong>in</strong>det sowie Sozialversicherungsbeiträge<br />
und Steuern<br />
bezahlt werden. Mit e<strong>in</strong>er solchen For<strong>der</strong>ung<br />
kann syndicom e<strong>in</strong>en Beitrag<br />
leisten, damit Unternehmen ihr<br />
Geschäfts risiko nicht an Plattformen<br />
auslagern und auf die <strong>Arbeit</strong>enden abwälzen<br />
können.<br />
Daniel Hügli ist Zentralsekretär Sektor ICT<br />
und betreut die Contact- und Callcenter.<br />
Kund<strong>in</strong>nen und Kunden. In diesem<br />
Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit<br />
und Kundenorientierung bietet <strong>der</strong><br />
GAV mit se<strong>in</strong>en M<strong>in</strong>imalstandards bei<br />
den <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>en wirksamen<br />
Schutz vor Lohn- und Sozialdump<strong>in</strong>g,<br />
von dem auch die Unternehmen<br />
profitieren. Der GAV för<strong>der</strong>t<br />
e<strong>in</strong>en fairen, mit gleich langen<br />
Spiessen geführten Wettbewerb, <strong>der</strong><br />
über die Qualität <strong>der</strong> Dienstleistungen<br />
und nicht über die Personalkosten<br />
geführt wird.<br />
Vorteile auch für die <strong>Arbeit</strong>geber<br />
Der Präsident des <strong>Arbeit</strong>geberverbandes<br />
contactswiss, Peter Weigelt, ist<br />
sich sicher: «Für uns <strong>Arbeit</strong>geber ist es<br />
ganz wichtig, dass wir e<strong>in</strong>e erklärte Sozialpartnerschaft<br />
haben und verständliche<br />
Branchenstandards def<strong>in</strong>iert<br />
s<strong>in</strong>d, die nicht nur für uns gelten, son<strong>der</strong>n<br />
für die gesamte Branche Gültigkeit<br />
haben sollen.» Auf die Frage, warum<br />
man sich erst jetzt mit den an<strong>der</strong>en<br />
Verbandspartnern e<strong>in</strong>igen konnte, erläutert<br />
Peter Weigelt: «Die Branche ist<br />
neu, sehr breit strukturiert und stetig<br />
wachsend. Da muss zuerst e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong><br />
gewisser Leidensdruck entstehen, bis<br />
man sich zusammenrauft.» Dieter<br />
Fischer, Präsident CallNet.ch, betont<br />
se<strong>in</strong>erseits: «Der GAV ist e<strong>in</strong> Mittel,<br />
um resistente Marktteilnehmer über<br />
die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>d licherklärung<br />
besser anzugehen. Dies ist angesichts<br />
des generell zunehmenden Druckes<br />
auf die Branche und im Speziellen mit<br />
Blick auf die auslandsnahen Randregionen<br />
zentral.» (Christian Capacoel)<br />
syndicom.ch/branchen/ccc
18 <strong>Arbeit</strong>swelt<br />
Flexibilität ist zwar gewünscht, aber es braucht trotzdem<br />
auch gute <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen<br />
«Die übrige Branche sollte e<strong>in</strong>en verbesserten GAV mit uns verhandeln.» Daniel Münger<br />
19<br />
Profit e<strong>in</strong>stecken und die Risiken<br />
den <strong>Arbeit</strong>nehmenden überlassen<br />
Am Beispiel des Zürcher Kurierdienstes notime lässt sich<br />
das Ungleichgewicht <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>sverhältnisse dokumentieren.<br />
Die KurierInnen haben viele Pflichten und ke<strong>in</strong>e Rechte.<br />
Bei notime hapert es bei den <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen. (© Franziska Scheidegger)<br />
Der GAV <strong>der</strong> Velokuriere<br />
kommt – Poststellenkampagne<br />
geht weiter<br />
Seit rund zwei Jahren versucht sich<br />
das Start-up-Unternehmen notime auf<br />
dem Schweizer Warenlieferungsmarkt<br />
zu etablieren. Als hochflexibler<br />
Dienstleister schaltet es sich zwischen<br />
Onl<strong>in</strong>e-Shops und KundInnen, um<br />
laut Eigenwerbung e<strong>in</strong>e «Full-Service-Lösung<br />
für Same-Day- und<br />
zeitfenster basierte Lieferungen» zu<br />
bieten. notime hat rasch expandiert:<br />
Bereits <strong>in</strong> acht Schweizer Städten unterhält<br />
die Firma eigene Liefernetzwerke<br />
mit <strong>in</strong>sgesamt über 400 VelokurierInnen.<br />
Dabei arbeitet notime mit<br />
namhaften Firmen zusammen – unter<br />
an<strong>der</strong>em mit <strong>der</strong> Post und <strong>der</strong> SBB.<br />
E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Kuriere s<strong>in</strong>d nicht Angestellte<br />
<strong>der</strong> Firma, son<strong>der</strong>n nutzen<br />
<strong>der</strong>en Technologie als Selbstständige.<br />
«Diese Flexibilität ist grundsätzlich<br />
ganz nach me<strong>in</strong>em Geschmack», sagt<br />
e<strong>in</strong> notime-Kurier, <strong>der</strong> anonym bleiben<br />
möchte. Dafür akzeptiert er den<br />
etwas tieferen Stundenlohn, den er im<br />
Vergleich zu früheren Kurierjobs erhält.<br />
Die Schichten <strong>der</strong> Kuriere werden<br />
zwei Wochen im Voraus verteilt –<br />
und hier wird das Ar beits verhältnis<br />
schwierig. Denn je öfter man für notime<br />
fährt, desto früher darf man onl<strong>in</strong>e<br />
die Schichten belegen. «Ich kam<br />
<strong>in</strong> letzter Zeit nicht oft zum Ar beiten,<br />
weshalb für mich zuletzt nur noch<br />
Stand-by-Schichten übrigblieben»,<br />
sagt <strong>der</strong> Mittzwanziger. Stand-by, das<br />
heisst: ständig bereit se<strong>in</strong>, um <strong>in</strong>nert<br />
zwanzig M<strong>in</strong>uten E<strong>in</strong>sätze zu fahren.<br />
Bleiben Aufträge aus, gibt es fünf<br />
Franken pro Stunde. Während <strong>der</strong><br />
Bereitschaftszeit ist es untersagt, für<br />
an<strong>der</strong>e Kurierdienste zu arbeiten.<br />
Gemäss <strong>Arbeit</strong>svertrag muss sich <strong>der</strong><br />
Velokurier ausserdem selbst gegen Erwerbsausfälle<br />
und Unfall versichern.<br />
Für alle Schäden kommt er selbst auf.<br />
E<strong>in</strong>e Kündigungsfrist gibt es nicht.<br />
Laut Rahmenvere<strong>in</strong>barung obliegt<br />
es ihm auch, Sozialversicherungen abzuschliessen.<br />
«Diese Abgaben haben<br />
wir den Selbstständigen bisher aber<br />
zusätzlich zum Stundenlohn ausgezahlt»,<br />
sagt Philipp Antoni, Mitbegrün<strong>der</strong><br />
von notime. Im März liess die<br />
Firma verlauten, künftig sämtliche<br />
Kuriere <strong>in</strong> reguläre Anstellungsverhältnisse<br />
e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den. Bis zum 1. Oktober<br />
sollen die neuen <strong>Arbeit</strong>sverträge<br />
unterzeichnet werden, sagt Antoni:<br />
«Wir fanden e<strong>in</strong>e Lösung, die sehr gut<br />
funktioniert.» Gleichzeitig betont er:<br />
«Die Flexibilität <strong>der</strong> Fahrer soll erhalten<br />
bleiben.» So sollen KurierInnen<br />
etwa weiterh<strong>in</strong> Be reitschaftsdienst<br />
leisten, dabei aber besser entlöhnt<br />
werden. Man darf also gespannt se<strong>in</strong>.<br />
(Raphael Albisser)<br />
Alles zum neuen GAV <strong>der</strong> Velokuriere:<br />
syndicom.ch/branchen/logistik/velokuriere<br />
Logistik ist e<strong>in</strong> Wachstumsmarkt.<br />
Speziell trifft das auf die Branche<br />
Kurier-Express und Paket zu. Zwar hat<br />
syndicom da e<strong>in</strong>en Gesamtarbeitsvertrag<br />
(GAV), aber um auch <strong>in</strong> Zukunft<br />
angemessene <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen zu<br />
garantieren, genügt das nicht. Umso<br />
wichtiger ist es, dass wir mit den Velokurieren<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en, aber zukunftsträchtigen<br />
Bereich e<strong>in</strong>en guten<br />
GAV abschliessen kön nen. Die übrige<br />
Branche ist gut beraten, sich mit syndicom<br />
auf e<strong>in</strong>en verbesserten GAV zu<br />
e<strong>in</strong>igen. Denn für logistische Dienstleistungen<br />
<strong>in</strong> hoher Qualität braucht<br />
es faire <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Schon fast e<strong>in</strong> Jahr dauert unser<br />
jüngster Kampf für e<strong>in</strong> gut ausgebautes<br />
Post stellennetz. Mit e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiven<br />
Kampagne gelang es, die Post unter<br />
hohen Rechtfertigungsdruck zu<br />
stellen. Zehntausende von Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürgern sowie die Mehrheit<br />
<strong>der</strong> betroffenen Angestellten haben<br />
sich an <strong>der</strong> Kam pagne beteiligt. Geme<strong>in</strong>sam<br />
mit ihnen ist es syndicom<br />
gelungen, hohen politischen Druck<br />
aufzubauen. Im Parlament werden<br />
<strong>der</strong>zeit zwei Vorstösse diskutiert, die<br />
e<strong>in</strong>e Überarbeitung des Postgesetzes<br />
for<strong>der</strong>n. Das s<strong>in</strong>d Erfolgsansätze, aber<br />
noch ke<strong>in</strong>e Erfolgsmeldungen. Die<br />
Post hat ihr Lobby<strong>in</strong>g und ihre<br />
PR-Kampagne <strong>in</strong> den letzten Monaten<br />
massiv verstärkt. Wir werden ihr die<br />
Stirn bieten.<br />
Daniel Münger ist Leiter des Sektors Logistik<br />
und Mitglied <strong>der</strong> syndicom-Geschäftsleitung.<br />
Mit dem GAV ans Ziel: Velokuriere müssen nicht nur schnell se<strong>in</strong>. (© Peter Klaunzer/Keystone)<br />
Hello Velo – hallo GAV<br />
Velokurierdienste: Sie s<strong>in</strong>d jung, ökologisch und unkompliziert.<br />
Und sie arbeiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sektor, dem schon bald Tiefstlöhne<br />
drohen, weil Milliardenkonzerne den Markt übernehmen wollen.<br />
Höchste Zeit für e<strong>in</strong>en Gesamtarbeitsvertrag.<br />
Die Velokurierdienste <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz<br />
können auf e<strong>in</strong>e dreissig jährige Erfolgs<br />
geschichte zurückbli cken. 1988<br />
wurde das erste Velokurierunternehmen<br />
<strong>in</strong> Luzern gegründet, und bald<br />
darauf waren <strong>in</strong> je<strong>der</strong> grösseren<br />
Schweizer Stadt die rasenden Fahrrä<strong>der</strong><br />
anzutreffen.<br />
Die Dienstleistung ist überall e<strong>in</strong>e<br />
ähnliche, aber die Organisationsformen<br />
decken die ganze Vielfalt <strong>der</strong><br />
Unternehmensformen ab – Vere<strong>in</strong>e,<br />
Ge nossenschaften, Aktiengesellschaften.<br />
Geme<strong>in</strong>sam ist ihnen allen, dass<br />
sie nach <strong>der</strong> Revision des Postgesetzes<br />
2013 verpflichtet waren, e<strong>in</strong>en sozialpartnerschaftlichen<br />
Dialog zu starten.<br />
Nach e<strong>in</strong>em anfänglichen Abtasten<br />
entstand e<strong>in</strong> sehr konstruktiver<br />
Prozess, an dessen Ende nun <strong>der</strong> unterschriftsreife<br />
Gesamtarbeitsvertrag<br />
(GAV) steht.<br />
Dafür war es auch höchste Zeit.<br />
Denn die Branche ist mit den Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Digitalisierung ganz<br />
direkt konfrontiert. Die Besteller, Hersteller<br />
und Lieferanten werden über<br />
digitale Plattformen koord<strong>in</strong>iert. Das<br />
wird realistischerweise die Zukunft<br />
se<strong>in</strong>. Konkurrenten versuchen den<br />
Markt mit zweifelhaften Methoden zu<br />
erobern, sie beschäftigen Sche<strong>in</strong>selbstständige<br />
o<strong>der</strong> zw<strong>in</strong>gen ihre Angestellten<br />
zu <strong>Arbeit</strong> auf Abruf.<br />
Jetzt stellt sich die Frage, <strong>in</strong> welchem<br />
Rahmen diese <strong>Arbeit</strong> stattf<strong>in</strong>det.<br />
E<strong>in</strong> Blick nach Deutschland zeigt:<br />
Aus beuterische <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen<br />
s<strong>in</strong>d bei den Kurierfirmen Foodora<br />
und Deliveroo bereits an <strong>der</strong> Tagesordnung.<br />
H<strong>in</strong>ter diesen Firmen stehen<br />
globale Milliardenkonzerne, die<br />
ge rade dabei s<strong>in</strong>d, die ganze Branche<br />
auf den Kopf zu stellen. Der Preis- und<br />
Lohnspirale gegen unten können<br />
die Schweizer Velokuriere mit e<strong>in</strong>er<br />
fortschritt lichen Sozialpartnerschaft<br />
entge genwirken. Mit dem GAV-Abschluss<br />
zeigen die Sozialpartner, dass<br />
Digitalisierung auch an<strong>der</strong>s aussehen<br />
kann und dass <strong>der</strong> technologische<br />
Fortschritt nicht auf Kosten <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmenden<br />
gehen muss, son<strong>der</strong>n<br />
zum Nutzen aller gestaltet werden<br />
kann.<br />
Velokuriere, die unter den GAV<br />
fallen, profitieren neu von e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>destlohn,<br />
klar geregelten Nacht- und<br />
Sonn tagszuschlägen, neu vere<strong>in</strong>barten<br />
<strong>Arbeit</strong>szeiten, Lohnfortzahlungen<br />
bei Krankheit und vielem mehr, das<br />
auch <strong>in</strong> klassischen Gesamtarbeitsverträgen<br />
zu f<strong>in</strong>den ist. Dabei wird<br />
aber genügend Spielraum für die jeweiligen<br />
Eigenheiten <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Velokurierdienste gelassen.<br />
Nächstes Ziel von syndicom und<br />
dem <strong>Arbeit</strong>geberverband swissmessengerlogistics<br />
ist die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärung (AVE). Dafür bestehen<br />
gute Chancen, solange die<br />
Velokuriere den Markt noch weitgehend<br />
alle<strong>in</strong>e bestreiten. Konkurrenzanbieter<br />
wie notime (siehe Artikel auf<br />
Seite 18) haben noch e<strong>in</strong>e sehr ger<strong>in</strong>ge<br />
Marktabdeckung. Sollten aber auch <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Schweiz <strong>in</strong>ternationale Konzerne<br />
<strong>in</strong> den Markt e<strong>in</strong>steigen, dürfte es bald<br />
eng werden. Umso wichtiger werden<br />
<strong>der</strong> GAV und dessen Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>d<br />
lichkeit se<strong>in</strong>. (David Roth)<br />
syndicom.ch/branchen/logistik/velokuriere
20 <strong>Arbeit</strong>swelt<br />
«Demokratie braucht unabhängige Medien» Roland Kreuzer<br />
400 Millionen Franken zahlten R<strong>in</strong>gier und Tamedia für das Stellenportal jobs.ch.<br />
E<strong>in</strong>e Investition, die sich nach Googles Markte<strong>in</strong>tritt kaum noch auszahlen wird.<br />
21<br />
Medienvielfalt för<strong>der</strong>n,<br />
statt «Fake News»<br />
schlucken<br />
Demokratie braucht unabhängige<br />
Medien und Qualitätsjournalismus.<br />
Abhängigkeit von Inserenten gefährdet<br />
die Freiheit <strong>der</strong> Medien. Ebenso<br />
fatal ist, dass Google, Facebook & Co.<br />
Werbegel<strong>der</strong> im Informationsumfeld<br />
absaugen, ohne diese <strong>in</strong> die Publizistik<br />
zu <strong>in</strong>vestieren. Auch die Profitmaximierung<br />
von Tamedia ist e<strong>in</strong> Angriff<br />
auf Vielfalt und Qualität, weil E<strong>in</strong>nahmenrückgänge<br />
bei den Pr<strong>in</strong>tmedien<br />
beim Personal e<strong>in</strong>gespart werden,<br />
während jährlich 50 Millionen <strong>in</strong> die<br />
Taschen <strong>der</strong> Besitzer und <strong>der</strong> Teppichetage<br />
fliessen. Jetzt braucht es den<br />
Druck <strong>der</strong> Zivilgesellschaft: Öffentliche<br />
Journalismus för<strong>der</strong>ung ist nötig,<br />
die Verteilung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>gel<strong>der</strong><br />
muss an e<strong>in</strong>en Informationsauftrag<br />
und e<strong>in</strong>en GAV geknüpft se<strong>in</strong>. Plattformprojekte<br />
wie Fijou und WePublish<br />
s<strong>in</strong>d zu unterstützen, damit unabhängige<br />
Medien ihre Ressourcen <strong>in</strong><br />
die journalistische <strong>Arbeit</strong> <strong>in</strong>vestieren<br />
können. Bis e<strong>in</strong>e kanalunabhängige<br />
För<strong>der</strong>ung des Journalismus garantiert<br />
ist, braucht es die Zustellverbilligung<br />
für die Regional- und Mitglie<strong>der</strong>presse.<br />
Und zuerst müssen wir die<br />
Attacke auf die Gebührenf<strong>in</strong>anzierung<br />
<strong>der</strong> SRG bachab schicken, unabhängig<br />
davon, ob sie als «No Billag»<br />
o<strong>der</strong> getarnt als «Halbierung» daherkommt.<br />
Roland Kreuzer ist Leiter des Sektors Medien<br />
und Mitglied <strong>der</strong> syndicom-Geschäftsleitung.<br />
FilmstudentInnen verteilten am Festival <strong>in</strong> Locarno Flyer, um auf die Bedeutung <strong>der</strong> SRG für die Filmför<strong>der</strong>ung aufmerksam zu machen. (© N<strong>in</strong>a Scheu)<br />
Die Medienretter formieren sich<br />
Applaus aus Tausenden von Händen gab es im August für e<strong>in</strong>en<br />
Filmtrailer am Festival <strong>in</strong> Locarno mit <strong>der</strong> Botschaft «SaveThe-<br />
Media.ch». Die Reaktion des Publikums zeigt, dass die Sorge um<br />
Vielfalt und Qualität nicht nur die Medienschaffenden umtreibt.<br />
H<strong>in</strong>ter savethemedia.ch steht die Vere<strong>in</strong>igung<br />
«média pour tous – medien<br />
für alle – media per tutti», <strong>der</strong> auch<br />
syndicom angehört: Kulturschaffende,<br />
JournalistInnen und ihre Verbände,<br />
die nach f<strong>in</strong>anzierbaren Auswegen<br />
aus <strong>der</strong> drohenden Misere suchen,<br />
und mit Veranstaltungen und Aktionen,<br />
wie jener am Festival <strong>in</strong> Locarno,<br />
das gesellschaftliche Bewusstse<strong>in</strong><br />
sensibilisieren wollen für die Bedeutung<br />
e<strong>in</strong>er starken und unabhängigen<br />
Medienlandschaft <strong>in</strong> <strong>der</strong> Demokratie.<br />
Plattformen als Hoffnung<br />
Zu den Initiativen von «medien für<br />
alle» gehört auch die Ideenwerkstatt<br />
rund um die Association pour le f<strong>in</strong>ancement<br />
du journalisme, «Fijou», <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Romandie. Die Fijou tüftelt an e<strong>in</strong>em<br />
Modell, das die F<strong>in</strong>anzierung von unabhängigem<br />
Journalismus nach dem<br />
Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Filmför<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Westschweiz umsetzen will. Die Branche<br />
selbst würde sich über e<strong>in</strong>e Plattform<br />
zusammenschliessen, f<strong>in</strong>anziert<br />
würde sie von Stiftungen, Privaten und<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Hand aufgrund klarer<br />
Kriterien.<br />
Ähnliche Gedanken hegen die Macher<br />
von WePublish.ch, die ebenfalls<br />
im August an die Öffentlichkeit getreten<br />
s<strong>in</strong>d. Hier ist die Idee, den Medienschaffenden<br />
direkt e<strong>in</strong>e Plattform zur<br />
Verfügung zu stellen, auf <strong>der</strong> Artikel<br />
publiziert und algorithmisch gezielt<br />
verbreitet werden können. Hansi<br />
Voigt, Journalist, Unternehmer und<br />
prom<strong>in</strong>enter Kopf h<strong>in</strong>ter WePublish,<br />
hofft für die technische Umsetzung<br />
auf Unterstützung aus <strong>der</strong> Haushaltabgabe<br />
für Radio und Fernsehen. Für<br />
die F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> In halte wären<br />
die e<strong>in</strong>zelnen Akteure selbst verantwortlich.<br />
Möglich wäre alles: Werbung,<br />
Micropayment, Abonnements, Stiftungen<br />
o<strong>der</strong> öffentliche Gel<strong>der</strong>. Garantiert<br />
werden müsste aus syndicom-Sicht<br />
jedoch, dass die auf <strong>der</strong><br />
Plattform verbreiteten Inhalte zu fairen<br />
Konditionen (am besten mit e<strong>in</strong>em<br />
GAV) produziert würden. Nach<br />
Redaktionsschluss wird sich die Eidg.<br />
Me dien kommis sion, EMEK, unter<br />
an<strong>der</strong>em auch zu diesen Vorschlägen<br />
äussern. Ihr Präsident Ottfried Jarren<br />
gab im Vorfeld zu erkennen, dass dar<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>teressante Ansätze für die Zukunft<br />
e<strong>in</strong>es relevanten Journalismus<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz zu f<strong>in</strong>den seien. Ob die<br />
Vorschläge <strong>der</strong> EMEK ihre Spuren im<br />
neuen Mediengesetz h<strong>in</strong>terlassen<br />
werden, bleibt abzuwarten.<br />
Mitreden und dem Journalismus<br />
e<strong>in</strong>e Stimme geben<br />
Wir laden alle dazu e<strong>in</strong>, sich im<br />
Web über die verschiedenen Projekte<br />
schlau zu machen – und sie mit uns zu<br />
diskutieren. Ebenfalls zur Diskussion<br />
laden wir an den Podien «... und wer<br />
spricht vom Journalismus?» zur<br />
«No Billag»-Initiative (siehe Agenda<br />
Seite 5 und immer aktualisiert auf<br />
unserer Website). Wir s<strong>in</strong>d überzeugt,<br />
dass dem Journalismus mit e<strong>in</strong>er<br />
Beschränkung o<strong>der</strong> gar Total absage<br />
an den medialen Service public<br />
grosser, vielleicht sogar irreparabler<br />
Schaden zugefügt würde. (N<strong>in</strong>a Scheu)<br />
Eidg. Medienkommission: emek.adm<strong>in</strong>.ch<br />
Filmtrailer Locarno: savethemedia.ch<br />
medien für alle: mfa-mpt.ch<br />
Plattform Deutschschweiz: wepublish.ch<br />
«Le Temps» über Fijou: http://bit.ly/2viMIDa<br />
Verlieren die Verlage das<br />
Stellengeschäft e<strong>in</strong> zweites Mal?<br />
Ereignisse <strong>der</strong> Geschichte, besagt e<strong>in</strong> Karl Marx zugeschriebenes<br />
Bonmot, wie<strong>der</strong>holen sich stets zweimal:<br />
das e<strong>in</strong>e Mal als Tragödie, das an<strong>der</strong>e Mal als Farce.<br />
jobs.google.com gräbt den hiesigen Stellenportalen bald das Wasser ab. (© David Goldmann/Keystone)<br />
Die jüngere Mediengeschichte ist an<br />
Tragödien nicht arm. Als e<strong>in</strong> solcher<br />
Schicksalsschlag mit spürbaren Auswirkungen<br />
bis heute gilt geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Verlust des Anzeigengeschäfts an<br />
branchenfremde Unternehmen. Was<br />
lange Jahre zum Gedeihen <strong>der</strong> Publizistik<br />
beitrug, bröckelte allmählich<br />
weg.<br />
Schon vor zehn Jahren war <strong>der</strong> «Tages-<br />
Anzeiger» angehalten, nicht mehr<br />
mit den Erträgen aus dem Stellenanzeiger<br />
zu rechnen. Und so ist es seither<br />
geblieben. Das grosse Geld machten<br />
<strong>der</strong>weil f<strong>in</strong>dige Jungunternehmer, die<br />
im richtigen Moment den Braten gerochen<br />
hatten und merkten, dass die<br />
Stellensuche onl<strong>in</strong>e geschmeidiger<br />
läuft als auf Papier. Für die Zeitungsverlage<br />
schien <strong>der</strong> Zug abgefahren.<br />
Wer zu spät kommt, den bestraft das<br />
Leben. Wenn das irgendwo gilt, dann<br />
im Internet. Es sei denn, man nimmt<br />
richtig viel Geld <strong>in</strong> die Hand. Das<br />
haben dann auch R<strong>in</strong>gier und Tamedia<br />
getan, als sie 2012 für fast 400 Millionen<br />
Franken jobs.ch kauften. Seither<br />
entwickle sich das Stellengeschäft<br />
«erfreulich». Doch die Freude droht<br />
nicht mehr von langer Dauer zu se<strong>in</strong>,<br />
denn am Horizont dräut Ungemach.<br />
Die Geschichte dürfte sich wie<strong>der</strong>holen.<br />
E<strong>in</strong> zweites Mal den Stellenmarkt<br />
zu verlieren, diesmal den digitalen,<br />
das wäre dann die Farce. Wenn<br />
Google als Mitbewerber auftaucht,<br />
darf man dieses Szenario mit Fug als<br />
realistisch betrachten.<br />
Google schluckt den Stellenmarkt<br />
Im Mai startete <strong>der</strong> Internetkonzern<br />
e<strong>in</strong>e Suchfunktion für offene Stellen.<br />
Das kann man nicht an<strong>der</strong>s denn als<br />
Angriff auf alle aktuellen Anbieter im<br />
Jobgeschäft verstehen. Google weiss<br />
das Nutzungsverhalten auf se<strong>in</strong>er<br />
Seite. Schon heute tippen Suchende<br />
ihren Stellenwunsch <strong>in</strong> das Google-<br />
E<strong>in</strong>gabefeld. Da sche<strong>in</strong>t es nur folgerichtig,<br />
darauf e<strong>in</strong>en neuen Geschäftszweig<br />
aufzubauen. Googles Gefrässigkeit<br />
kennt ke<strong>in</strong>e Grenzen. Das wissen<br />
auch R<strong>in</strong>gier und Tamedia. Dennoch<br />
hoffen sie, dem Giganten etwas entgegenhalten<br />
zu können, wenn er denn<br />
e<strong>in</strong>mal den Schweizer Markt betritt.<br />
Beide glauben vor allem mit <strong>der</strong><br />
lokalen Verankerung punkten zu können.<br />
Das kl<strong>in</strong>gt eher nach e<strong>in</strong>em<br />
Strohhalm, an den man sich mangels<br />
Erfolg versprechen<strong>der</strong> Abwehrstrategien<br />
klammert. Am Ende bleibt <strong>der</strong><br />
schwache Trost, dass e<strong>in</strong> zweiter Verlust<br />
des Stellenmarkts immerh<strong>in</strong> den<br />
Journalis mus nicht noch e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong><br />
Mitleidenschaft ziehen würde. Der<br />
verfügt auch so kaum noch über angemessene<br />
Ressourcen. (Nick Lüthi)<br />
syndicom.ch/branchen/presse
22 Politik<br />
Giorgio Pard<strong>in</strong>i leitet den<br />
Sektor ICT und ist Mitglied<br />
<strong>der</strong> syndicom-Geschäftsleitung.<br />
syndicom hat sich<br />
<strong>in</strong> den vergangenen Jahren<br />
vertieft mit den Folgen<br />
<strong>der</strong> Digitalisierung für die<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmenden ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>gesetzt<br />
und e<strong>in</strong>e<br />
Studie veröffentlicht, die<br />
auf unserer Website zum<br />
Download bereitsteht.<br />
Interview: Christian Capacoel<br />
Bild: Sébastien Bourqu<strong>in</strong><br />
Wir for<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e<br />
Zertifizierung<br />
Immer mehr Branchen und Unternehmen<br />
setzen auf das Pr<strong>in</strong>zip<br />
<strong>Crowd</strong>- o<strong>der</strong> Clickworker, am<br />
e<strong>in</strong>fachsten über e<strong>in</strong>e Plattform.<br />
Zum<strong>in</strong>dest ist das <strong>der</strong> E<strong>in</strong>druck,<br />
den man gew<strong>in</strong>nt, wenn man<br />
den Medienberichten <strong>der</strong> letzten<br />
Monate folgt. Der Begriff Clickworker<br />
wurde erstmals von <strong>der</strong><br />
NASA benutzt, als sie im Jahr 2000<br />
die breite Öffentlichkeit aufrief,<br />
bei <strong>der</strong> Klassifizierung von Marsaufnahmen<br />
mitzuhelfen. IBM<br />
brachte 2011 das Wort <strong>Crowd</strong>worker<br />
mit ihrem «Liquid Challenge Program»<br />
endgültig <strong>in</strong>s Bewusstse<strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> breiten Bevölkerung. Mit dem<br />
vere<strong>in</strong>facht ausgedrückten Pr<strong>in</strong>zip<br />
«mehr Freelancer, weniger Festangestellte»<br />
sollten 30 Prozent <strong>der</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>splätze e<strong>in</strong>gespart werden.<br />
Wo stehen wir nun mit dieser<br />
Entwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz, und<br />
wie wollen wir als Gewerkschaft mit<br />
dieser Herausfor<strong>der</strong>ung umgehen?<br />
Giorgio Pard<strong>in</strong>i, Leiter des Sektors<br />
ICT (Information and Communications<br />
Technology), nimmt Stellung.<br />
syndicom: Im Jahr 2011 hat die<br />
Ankündigung des «Liquid Challenge<br />
Program» bei IBM grosse Wellen<br />
geworfen. Erwartet wurde e<strong>in</strong><br />
massiver Stellenabbau und e<strong>in</strong>e<br />
immer grössere Ausdehnung des<br />
Programms. Wo steht IBM diesbezüglich<br />
heute? Setzt sie voll auf<br />
das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> <strong>Crowd</strong>worker, und<br />
reduziert sie die Stammbelegschaft<br />
immer mehr?<br />
Giorgio Pard<strong>in</strong>i: IBM setzt ständig<br />
Kostensenkungsmassnahmen um.<br />
Zum Beispiel, <strong>in</strong>dem die Stammbelegschaft<br />
restrukturiert und<br />
relokalisiert wird. Aktuell drohen<br />
bis zu 8000 Entlassungen weltweit.<br />
Damit nimmt die Gefahr zu, dass<br />
noch mehr Aufgaben ausgelagert<br />
und durch <strong>Crowd</strong>worker erledigt<br />
werden.<br />
Wie schätzen Sie die kommende<br />
Entwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz e<strong>in</strong>?<br />
E<strong>in</strong>e neue Studie, die von syndicom<br />
mitf<strong>in</strong>anziert wurde (siehe Seite 14<br />
und Dossier) , zeigt aufgrund e<strong>in</strong>er<br />
Internetumfrage e<strong>in</strong>e hohe Teilnahme<br />
<strong>der</strong> Schweizer<strong>in</strong>nen und<br />
Schweizer <strong>in</strong> <strong>der</strong> Plattformökonomie.<br />
Knapp e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> Befragten<br />
haben im vergangenen Jahr versucht,<br />
<strong>Arbeit</strong> über Onl<strong>in</strong>e-Plattformen<br />
zu erhalten. Von den Befragten<br />
haben 18,2 Prozent tatsächlich e<strong>in</strong>e<br />
solche <strong>Arbeit</strong> gefunden. Von diesen<br />
<strong>Crowd</strong>workern haben 12,5 Prozent<br />
geantwortet, dass dies ihre e<strong>in</strong>zige<br />
E<strong>in</strong>kommensquelle sei. Die häufigsten<br />
<strong>Arbeit</strong>en, die <strong>Crowd</strong>worker <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Schweiz verrichteten, waren das<br />
Erledigen von Kle<strong>in</strong>staufträgen und<br />
Click work<strong>in</strong>g. Aufgrund des<br />
leistungsfähigen Bildungssystems<br />
und <strong>der</strong> ausgezeichneten Infrastruktur<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz ist davon auszugehen,<br />
dass <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g künftig<br />
e<strong>in</strong>e noch bedeuten<strong>der</strong>e Rolle<br />
spielen wird.<br />
Swisscom betreibt mit MILA<br />
bereits e<strong>in</strong>e Plattform. Was s<strong>in</strong>d<br />
die Erfahrungen da?<br />
MILA verb<strong>in</strong>det den Endnutzer –<br />
z. B. e<strong>in</strong>e Swisscom-Kund<strong>in</strong> – mit<br />
e<strong>in</strong>em Service- Erbr<strong>in</strong>ger – z. B.<br />
e<strong>in</strong>em Swisscom-Servicetechniker,<br />
Elektro <strong>in</strong>stallationsbetrieb o<strong>der</strong><br />
«Swisscom-Friend». Die Kund<strong>in</strong><br />
kann auf MILA auswählen, von wem<br />
sie den Service beziehen will. Am<br />
meisten bezahlt sie für den Swisscom-Techniker,<br />
am wenigsten<br />
üblicherweise für den «Swisscom-<br />
Friend», also den hilfsbereiten<br />
Swisscom-Kunden.<br />
Dies ist nichts an<strong>der</strong>es als e<strong>in</strong><br />
Out sourc<strong>in</strong>g von Aufgaben an die<br />
MILA- <strong>Crowd</strong>. Die Risiken, die sich<br />
mit e<strong>in</strong>em solchen <strong>Crowd</strong>sourc<strong>in</strong>g<br />
ergeben, s<strong>in</strong>d vielfältig: mangelhafte<br />
Qualität <strong>der</strong> Dienstleistung,<br />
Lohn- und Sozialdump<strong>in</strong>g, Schwarzarbeit<br />
und so weiter.<br />
Wo liegen die grossen gewerkschaftlichen<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> diesen<br />
Bereichen?<br />
Wer garantiert e<strong>in</strong>e korrekte Entschädigung<br />
und stellt sicher, dass<br />
die Rechte <strong>der</strong> <strong>Crowd</strong>worker<br />
gewährt werden? Wir s<strong>in</strong>d <strong>der</strong><br />
Auffassung, dass sowohl das<br />
«Tatsächlich s<strong>in</strong>d wir besorgt über die e<strong>in</strong>seitige Ausrichtung <strong>der</strong> Strategie des Bundesrates. Wir<br />
haben zuletzt mehrmals <strong>in</strong>terveniert und nun zum Beispiel erreicht, dass syndicom im Sound<strong>in</strong>gboard<br />
für die erste Konferenz des Bundes zum Thema ‹Digitale Schweiz› vertreten ist.»<br />
«Unternehmen,<br />
die <strong>Arbeit</strong> an<br />
die <strong>Crowd</strong><br />
aus lagern,<br />
haben ebenso<br />
Ver antwortung<br />
zu übernehmen,<br />
wie die<br />
<strong>Crowd</strong> work-<br />
Plattformen.»<br />
Unternehmen, das Tätigkeiten an<br />
die <strong>Crowd</strong> auslagert, als auch<br />
die <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattform<br />
Verantwortung zu übernehmen<br />
haben. Beide haben dafür zu<br />
sorgen, dass die <strong>Arbeit</strong>enden Schutz<br />
geniessen, beson<strong>der</strong>s <strong>in</strong> den<br />
Bereichen <strong>Arbeit</strong>s- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen,<br />
Sozialversicherungsansprüche,<br />
Sche<strong>in</strong>selbstständigkeit und<br />
geistiges Eigentum. Über die<br />
Zertifizierung von <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen<br />
und entsprechende<br />
Labels können wir dazu beitragen,<br />
dass nur solche Plattformen<br />
zum Zug kommen, die diese<br />
Kriterien erfüllen.<br />
Die Ausbreitung von <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g<br />
ist aber auch e<strong>in</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
für uns als Gewerkschaft: Wie<br />
können wir die <strong>Crowd</strong>worker besser<br />
organisieren und vernetzen, damit<br />
sie mit unserer Unterstützung ihre<br />
<strong>in</strong>dividuellen und kollektiven<br />
Rechte geltend machen können?<br />
Und welche spezifischen Dienstleistungen<br />
können wir ihnen bieten?<br />
Der Bundesrat hat im Juni 2017<br />
die Broschüre «Digi tale Schweiz»<br />
publiziert und e<strong>in</strong>en «Dialog<br />
‹Digitale Schweiz› » e<strong>in</strong>be rufen. Es<br />
fällt auf, dass die <strong>Arbeit</strong>nehmenden<br />
und die Fragen nach <strong>der</strong> Zukunft<br />
<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> dar<strong>in</strong> nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge<br />
Rolle spielen.<br />
Tatsächlich s<strong>in</strong>d wir besorgt über<br />
die e<strong>in</strong>seitige Ausrichtung <strong>der</strong><br />
Strategie des Bundesrates. Wir<br />
haben <strong>in</strong> den letzten Monaten<br />
mehrmals an verschiedenen Stellen<br />
<strong>in</strong>terveniert und nun erreicht, dass<br />
syndicom im Sound<strong>in</strong>gboard für die<br />
erste Konferenz des Bundes zum<br />
Thema «Digitale Schweiz» vertreten<br />
ist.<br />
Welche Themen kann man <strong>in</strong>nerhalb<br />
<strong>der</strong> Sozialpartnerschaft bzw.<br />
mit den Gesamtarbeitsverträgen<br />
regeln?<br />
Mit <strong>der</strong> Sozialpartnerschaft zwischen<br />
Gewerkschaften und Unternehmen<br />
bzw. ihren Verbänden<br />
haben wir <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz e<strong>in</strong> wirkungsvolles<br />
Instrument, um schnell<br />
auf Verän<strong>der</strong>ungen zu reagieren.<br />
Wenn die Sozialpartnerschaft<br />
gleichberechtigt auf Augenhöhe<br />
gelebt wird, dann können ausbalancierte<br />
Lösungen gefunden werden,<br />
die die <strong>Arbeit</strong>nehmenden stärken –<br />
ohne die Wettbewerbsfähigkeit <strong>der</strong><br />
Schweiz zu schmälern.<br />
Die Digitalisierung ist e<strong>in</strong>e Chance,<br />
die bewährte Sozialpartnerschaft<br />
zu erneuern und zu erweitern. In<br />
Gesamtarbeitsverträgen können<br />
beispielsweise das Recht auf<br />
Privatsphäre und Datenschutz<br />
am <strong>Arbeit</strong>splatz, e<strong>in</strong>e weitgehende<br />
<strong>Arbeit</strong>szeitsouveränität für die<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmenden bis zur <strong>Arbeit</strong>szeitverkürzung<br />
sowie Mass nahmen<br />
gegen die Entgrenzung<br />
<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>, wie z. B. das Recht<br />
auf Abschalten, geregelt werden.<br />
Wo müsste auf gesetz licher Ebene<br />
angesetzt werden, um auf diese<br />
Herausfor <strong>der</strong>ungen reagieren zu<br />
können? Welche Ansätze schweben<br />
syndicom vor?<br />
Der Gesetz geber hat dafür zu<br />
sorgen, dass e<strong>in</strong> wirksames Recht<br />
auf <strong>Arbeit</strong> fest geschrieben wird und<br />
allen <strong>Arbeit</strong>enden – auch jenen <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Crowd</strong> – kollektive <strong>Arbeit</strong>srechte<br />
und Sozial versicherungsansprüche<br />
gewährt werden. Da mit <strong>der</strong> fortschreitenden<br />
Digitalisierung<br />
gewisse Tätigkeiten automatisiert<br />
werden, ist es entscheidend, dass<br />
die Bildung und die <strong>Arbeit</strong>slosenversicherung<br />
entsprechend ausgerichtet<br />
werden. Möglichst viele Beschäftigte<br />
sollen die Möglichkeit haben,<br />
sich für neu entstehende Tätigkeitsprofile<br />
zu qualifizieren.<br />
Wenn <strong>Arbeit</strong>en automatisiert und<br />
nicht mehr von Lohnabhängigen<br />
erledigt werden, dann hat dies auch<br />
Folgen für das Steuersystem. Ob<br />
nun z. B. Roboter o<strong>der</strong> Daten besteuert<br />
werden – die Steuere<strong>in</strong>nahmen<br />
müssen ausreichend se<strong>in</strong>, damit<br />
alle, die kürzere o<strong>der</strong> längere Zeit<br />
aus dem <strong>Arbeit</strong>sprozess ausscheiden,<br />
e<strong>in</strong>e gesicherte Existenz <strong>in</strong><br />
Würde haben. Schliesslich müssen<br />
die Rechte <strong>der</strong> Personen an ihren<br />
Daten im Rahmen des Datenschutzes<br />
gestärkt werden: Me<strong>in</strong>e Daten<br />
gehören mir!<br />
Welche Aktivitäten hat syndicom<br />
geplant, um diese Diskussion<br />
voranzutreiben?<br />
Unser Kongress im November ist<br />
ganz <strong>der</strong> Digita lisierung gewidmet.<br />
Wir werden dort unsere Positionen<br />
und nächsten Aktivitäten diskutieren<br />
und beschliessen.<br />
Dossier und Downloads:<br />
syndicom.ch/crowdwork<strong>in</strong>g<br />
syndicom.ch/digitalisierung<br />
23
24<br />
Recht so!<br />
1000 Worte<br />
TomZ<br />
25<br />
Fragen an den syndicom-Rechtsdienst:<br />
Ich nehme regelmässig Aufträge von verschiedenen Plattformen<br />
im Internet an. Wer gilt da als me<strong>in</strong> <strong>Arbeit</strong>geber?<br />
<strong>Arbeit</strong>e ich für die Betreiber <strong>der</strong> Plattform o<strong>der</strong> arbeite ich<br />
direkt für die Anbieter des Auftrags, <strong>der</strong> mir über die Plattform<br />
vermittelt wird? Ich b<strong>in</strong> im Schnitt rund 20 Stunden<br />
pro Woche mit solchen <strong>Arbeit</strong>en, vor allem im Text- und<br />
Bildbereich, beschäftigt. Und da me<strong>in</strong>e festen Aufträge<br />
seltener werden, b<strong>in</strong> ich vermehrt auf diese E<strong>in</strong>kommensmöglichkeiten<br />
angewiesen.<br />
Welche Aspekte bezüglich Vorsorge und Versicherungen<br />
fallen für mich <strong>in</strong>s Gewicht? Wie muss ich die Sozialversicherungen<br />
abrechnen: Hälftig mit den Auftraggebern o<strong>der</strong><br />
muss ich wie Selbstständigerwerbende selbst abrechnen?<br />
Die Vermittler stellen auf ihrer Website ke<strong>in</strong>e Infos zur<br />
Verfügung und auf den Auszahlungen ist ke<strong>in</strong>erlei Abzug<br />
vermerkt. Ich b<strong>in</strong> ja ke<strong>in</strong>e Firma, darum denke ich, dass ich<br />
Erwerb aus unselbstständiger <strong>Arbeit</strong> erziele. Habe ich also<br />
Anrecht auf AHV-Abzüge, und kann ich diese e<strong>in</strong>for<strong>der</strong>n?<br />
Zu guter Letzt möchte ich im Alter nicht auf e<strong>in</strong>e Pensionskassenrente<br />
verzichten. Wie kann ich mich bei so vielen<br />
verschiedenen Auftrags- und <strong>Arbeit</strong>gebern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Pensionskasse<br />
ver sichern? Welche Alternativen stehen mir zur<br />
Verfügung? Und wie kann ich etwaige Vorsorgeversicherungen<br />
bei den Steuern <strong>in</strong> Abzug br<strong>in</strong>gen?<br />
Antwort<br />
Je nachdem, ob du über e<strong>in</strong>en<br />
Vermittler wie z. B. Jovoto.com o<strong>der</strong><br />
Atizo.com o<strong>der</strong> direkt für e<strong>in</strong>e Firma<br />
arbeitest, gelten unterschiedliche<br />
rechtliche Bestimmungen (Maklervertrag,<br />
Werkvertrag, Auftrag,<br />
<strong>Arbeit</strong>svertrag). Welcher Vertrag<br />
anwendbar ist, hat z. B. E<strong>in</strong>fluss<br />
darauf, <strong>in</strong> welchem Umfang du für<br />
Fehler haftest, welche Leistung du<br />
schuldest, ob e<strong>in</strong> Wi<strong>der</strong>rufs- o<strong>der</strong><br />
Rücktrittsrecht besteht usw. Ganz<br />
wichtig: Kläre dies vorgängig und<br />
lies die Bed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> Vermittler/<br />
Anbieter aufmerksam – <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e,<br />
was Urheberrecht, Datenschutz<br />
sowie Datensicherheit betrifft.<br />
Die Vermittler/Anbieter wollen dich<br />
nicht als Angestellte. Sonst müssten<br />
sie dich versichern und die Beiträge<br />
hälftig bezahlen. Ob du selbstständig<br />
bist o<strong>der</strong> nicht, entscheidet die<br />
AHV-Ausgleichskasse de<strong>in</strong>es Wohnsitzkantons,<br />
und zwar anhand de<strong>in</strong>er<br />
Angaben. Es ist daher wichtig, die<br />
notwendigen Anfor<strong>der</strong>ungen zu<br />
kennen, bevor du dich anmeldest.<br />
Weitergehende Informationen dazu<br />
f<strong>in</strong>dest du auf <strong>der</strong> Homepage <strong>der</strong><br />
kantonalen Ausgleichskasse. Merke:<br />
Zahle zum<strong>in</strong>dest den jährlichen<br />
M<strong>in</strong>imalbeitrag an die AHV (aktuell<br />
Fr. 478.–), wenn du <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em<br />
Anstellungsverhältnis bist o<strong>der</strong> de<strong>in</strong>E<br />
EhepartnerIn nicht arbeitet.<br />
Gewisse Branchenverbände bieten<br />
e<strong>in</strong>e kollektive Vorsorgelösung für<br />
ihre Mitglie<strong>der</strong> an. Die «PK Freelance»<br />
von syndicom wurde extra für<br />
freie Medienschaffende e<strong>in</strong>gerichtet.<br />
Ansonsten hast du die Möglichkeit,<br />
dich als E<strong>in</strong>zelperson bei <strong>der</strong> Stiftung<br />
Auffange<strong>in</strong>richtung (chaeis.ch)<br />
zu versichern. Die dritte Möglichkeit<br />
besteht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er privaten Vorsorge<br />
lösung bei e<strong>in</strong>er Versicherung<br />
o<strong>der</strong> Bank (Säule 3a o<strong>der</strong> Säule 3b).<br />
Beachte, dass nur die Säule 3a bei<br />
den Steuern abzugsfähig ist.<br />
Es gibt zahlreiche weitere Fragen,<br />
die sich beim <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g stellen.<br />
Diese kann dir de<strong>in</strong>e Gewerkschaft<br />
beantworten. Denk e<strong>in</strong>fach daran:<br />
Du und de<strong>in</strong>e <strong>Arbeit</strong> s<strong>in</strong>d es wert,<br />
fair entlöhnt zu werden.<br />
syndicom.ch/recht/rechtso
26 Freizeit<br />
Tipps<br />
Anzeige<br />
Gegner wollen schwache AHV<br />
und Rentenalter 67<br />
Kurzfilmperlen: Das 15. shnit<br />
<strong>Arbeit</strong>geberverband, Worldwide Gewerbeverband, Shortfilmfestival Banken und Versicherungen tragen. Sie<br />
Weiterkommen Economiesuisse & Co. bekämpfen die wollen die AHV mit e<strong>in</strong>em Ne<strong>in</strong> schwächen<br />
und <strong>in</strong> die Defizitwirtschaft treiben.<br />
mit Weiterbildung Altersvorsorge 2020. Die gleichen Kreise<br />
Das 15. «shnit Woldwide Shortfilmfestival»<br />
geht <strong>der</strong> vom AHV 18. be-<br />
bis zum Um Rentenalter 67 durchzusetzen.<br />
haben bereits die E<strong>in</strong>führung<br />
Für <strong>Crowd</strong>workerInnen kämpft. s<strong>in</strong>d ständige<br />
Updates mittels Kursen ent-<br />
dem neuen Label «Worldwide»<br />
29. Oktober über die Bühne. Mit<br />
scheidend. Für Freischaffende ohne (ehem. «Inter national») betonen<br />
Die<br />
die<br />
AHV steht Wie<strong>der</strong>eröffnung für Solidarität des und Stabilität.<br />
Sie hat Museums für alle mit für tiefen Kommunikation<br />
und mittleren<br />
geregeltes Anstellungsver hältnis Veranstalter die simultane Austragung<br />
auf <strong>der</strong> ganzen Welt. In<br />
s<strong>in</strong>d Weiterbildungen oft zu teuer,<br />
Löhnen<br />
<strong>der</strong><br />
das beste Preis-Leistungsverhältnis.<br />
In Das ke<strong>in</strong>er Museum an<strong>der</strong>en für Kommunikation Form <strong>der</strong> Al-<br />
weil ke<strong>in</strong> <strong>Arbeit</strong>geber für die Kurskosten<br />
aufkommt. Auch darum ist <strong>in</strong> Bern zu erleben, wo es auch<br />
Schweiz gibt es das Kurzfilmfestival<br />
e<strong>in</strong>e Mitgliedschaft bei syndicom dieses Jahr über 20 000 Besucher<strong>in</strong>nen<br />
und Besucher anzieht. Daneben e<strong>in</strong>jährigen Umbauphase wie<strong>der</strong><br />
tersvorsorge ist seit kriegt dem 19. das August Gros nach <strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Leute<br />
gerade für Freischaffende äusserst<br />
für e<strong>in</strong>en Franken Beitrag mehr Rentenfranken.<br />
Räumlichkeiten Der AHV-Zuschlag und ei-<br />
br<strong>in</strong>gt<br />
<strong>in</strong>teressant: Die Gewerkschaften ist das Kurzfilmfestival aber auch eröffnet. Es wartet mit neu gestalte-<br />
unterstützen die Weiter bildung<br />
<strong>in</strong> vielen K<strong>in</strong>os rund um den Globus<br />
ihrer Mitglie<strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziell. syndicom<br />
übernimmt zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>en rend des Festivalzeitraums e<strong>in</strong>e<br />
Konzept auf: Kuratoren s<strong>in</strong>d aktiv <strong>in</strong><br />
Weil ihnen präsent die (shnit Solidarität<br />
CINEMAS), wo deshalb wäh-<br />
mehr nem sozialen schweiz weit Ausgleich. e<strong>in</strong>zigartigen Aus all<br />
Teil <strong>der</strong> Kurskosten zwischen ihrer Mitglie<strong>der</strong> Arm und Reich Auswahl <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>der</strong> diesjährigen AHV zu shnit- diesen Gründen die Aus stel braucht lung e<strong>in</strong>gebettet. es am 24. So September<br />
e<strong>in</strong> rückt doppeltes <strong>der</strong> Mensch JA zur gleich Altersvorsor-<br />
doppelt <strong>in</strong><br />
bei zahlreichen stark anerkannten ist. Die Leute sollen Filme alle<strong>in</strong>e des <strong>in</strong>ternationalen für sich Wettbewerbs<br />
gezeigt wird. Es werden<br />
Instituten; und bei Movendo, dem<br />
vorsorgen. Und dazu das Geld zu den ge 2020.<br />
Bildungs<strong>in</strong>stitut <strong>der</strong> Gewerkschaften,<br />
können sie sogar ganz übernommen<br />
werden.<br />
Für syndicom-Mitglie<strong>der</strong> aus <strong>der</strong><br />
voraussichtlich K<strong>in</strong>os <strong>in</strong> allen Landesteilen<br />
<strong>der</strong> Schweiz am Festival<br />
teilnehmen. Auf shnit.org folgen<br />
mehr Infos.<br />
Zweimal Ja stimmen<br />
den Mittelpunkt: als Subjekt, aber<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Rolle des Besuchers gleichzeitig<br />
auch als Objekt.<br />
Das Museum fokussiert neu vermehrt<br />
auf mo<strong>der</strong>ne Kommunikation<br />
und legt aktuellste Trends und<br />
grafischen Industrie, <strong>der</strong> visuellen<br />
Se<strong>in</strong>e Preise vergibt das<br />
Kommunikation und den Medien Kurzfilm festival unter an<strong>der</strong>em<br />
Mittel offen. Alles dreht sich um<br />
gibt es auch spannende Die Altersvorsorge Angebote auch 2020 mithilfe besteht des shnit-Publikums, aus zwei Vorlagen. die Frage, Der wie Zusatzf<strong>in</strong>anzierung<br />
Menschen sich heute<br />
für die AHV sowie <strong>der</strong> eigentlichen Reform. Wird e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> beiden Vor-<br />
auf helias.ch. Beson<strong>der</strong>s attraktive das im <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Stil über die vernetzen und verb<strong>in</strong>den.<br />
Softwarekurse, darunter Tipps und Pub likumspreise <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Neu ist <strong>der</strong> Ausstellung auch e<strong>in</strong><br />
Tricks für die gängigen lagen Adobe-Programme<br />
abgelehnt, scheitert Kategorien abstimmt. die ganze Dabei Reform. lockt Deshalb Theorieraum unbed<strong>in</strong>gt angeglie<strong>der</strong>t. zweimal Hier<br />
wie Photoshop, Illustrator das Festival mit dem p<strong>in</strong>ken Logo bricht das Museum das Wissen-<br />
Ja stimmen.<br />
und InDesign, aber auch für zahlreiche<br />
vor allem die Zielgruppe <strong>der</strong> 20- bis schaftliche auf e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache Spra-<br />
Nischenprodukte.<br />
30-Jährigen. Aber auch ältere und che herunter, um die heutigen<br />
Auf movendo.ch bieten e<strong>in</strong> zelne jüngere Semester fehlen nicht am Erkenntnisse über die entscheidenden<br />
Kurse gutes H<strong>in</strong>tergrundwissen<br />
shnit. Dies auch dank verschiedenen<br />
Faktoren <strong>der</strong> Kommunikation<br />
für die beson<strong>der</strong>e Situation von Freischaffenden.<br />
Neuerungen: So f<strong>in</strong>den<br />
greifbar zu vermitteln.<br />
Zum Beispiel «Aktuelle die Screen<strong>in</strong>gs für Schulklassen<br />
Mit den Neuerungen verblüfft<br />
Formen <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>szeit: Chancen (shnitEXPLORE) <strong>in</strong> Bern neu direkt das Museum, weil es mit den<br />
und Gefahren» (9.11. <strong>in</strong> Olten) sowie am Festival statt.<br />
e<strong>in</strong>gängigsten kommunikativen<br />
Software- bzw. <strong>Arbeit</strong>s<strong>in</strong>strumentkurse<br />
Weiterh<strong>in</strong> garantieren die<br />
Mitteln das Fach Kommunikation<br />
o<strong>der</strong> Nützliches über die<br />
Locations beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tengerechte<br />
durchleuchtet. Das Konzept ist e<strong>in</strong><br />
Sozialversicherungen. Folgende Die Organisationen kompakten<br />
Kurse sparen den Interessierten vere<strong>in</strong>zelt auch Synchronüberset-<br />
früheren, bei dem die BesucherIn-<br />
Zugänge, vertreten untertitelte e<strong>in</strong>e Ja-Parole Filme und zur Altersvorsorge grosser Fortschritt 2020: gegenüber dem<br />
viel Recherchearbeit,<br />
Gewerkschaften<br />
lohnen sich<br />
und <strong>Arbeit</strong>nehmerorganisationen:<br />
zungen <strong>in</strong> Gebärdensprache.<br />
SGB,<br />
(ric)<br />
Unia, SEV,<br />
nen<br />
Syndicom,<br />
Kommunikation<br />
VPOD, AvenirSocial,<br />
als LesegaraNto,<br />
kapers, Nautilus, PVB, SBPV, SMPV, SMV, SSM; TravailSuisse; Syna, OCST; Transfair, LCH, ZV,<br />
zeitlich also allemal. (ric)<br />
Parcours historisch vermittelt<br />
Kaufm. Verband; Angestellte Schweiz, SBK, SKO, VSPB;<br />
bekamen. (ric)<br />
Parteien: BDP, CVP, EVP, GLP, shnit.org, Grüne, SP, 18.–22. JCVP, Oktober Junge 2017 Grüne; <strong>in</strong> Bern Rentnerorganisationen: Seniorenrat,<br />
Das komplette<br />
VASOS,<br />
Kursangebot<br />
Pro<br />
und<br />
Senectute; Frauenorganisationen:<br />
E<strong>in</strong>zelticket Fr. 16.– (Studierende/<br />
alliance F, SKF, EFS, Landfrauen;<br />
Helvetiastrasse 16, Bern – mfk.ch<br />
Anmeldeformulare f<strong>in</strong>den sich auf<br />
Kultur-Legi: Fr. 13.–), Tagespass Fr. 43.–<br />
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr<br />
movendo.ch sowie Wirtschaftsverbände: helias.ch<br />
Centre patronal, (33.–), Festival FER, Fr. 98.– CVCI; (78.–) Bundesrat, Parlament, E<strong>in</strong>tritte: die Sozialdirektorenkonferenz<br />
Fr. 5.– bis Fr. 15.–<br />
und <strong>der</strong> Städteverband<br />
Renten<br />
sichern.<br />
AHV<br />
stärken.<br />
Impressum: Komitee Ja zur Altersvorsorge 2020, c/o SGB, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
28 Bisch im Bild<br />
Die Entscheidungen <strong>der</strong> Post br<strong>in</strong>gen die Menschen auf die Strasse: Die<br />
Ankündigung, dass 600 Poststellen geschlossen und 1200 Stellen abgebaut<br />
werden sollen, hat im ganzen Land zu e<strong>in</strong>em kollektiven Aufschrei geführt.<br />
1. Bern, 1. Mai (© Susanne Oehler)<br />
2. Wassen, 20. Mai (© Peter Lienert)<br />
3. Marsch von Puidoux nach Chexbres, 6. Mai (© Philippe Morerod)<br />
4. Zizers, 5. Mai (© syndicom)<br />
5. Zürich, 8. Oktober (© syndicom)<br />
6. Genf, 1. Mai (© Demir Sönmez)<br />
7. Basel, 19. November (© František Matouš)<br />
8. Neuchâtel, 27. Februar (© BNJ)<br />
9. Bell<strong>in</strong>zona, 8. Mai (© syndicom)<br />
29<br />
2<br />
6<br />
3<br />
1<br />
8<br />
7<br />
5<br />
4<br />
9
30 Aus dem<br />
Leben von ...<br />
Mart<strong>in</strong> Bichsel<br />
Viele Leidenschaften, e<strong>in</strong>e Kamera<br />
Impressum<br />
Redaktion: Riccardo Turla, Giovanni Valerio,<br />
Marie Chevalley, œil extérieur: N<strong>in</strong>a Scheu<br />
Tel. 058 817 18 18, redaktion@syndicom.ch<br />
Fotos ohne ©copyright-Vermerk: zVg<br />
Art Direction und Design: Büro4, Zürich<br />
Layout und Korrektorat: Stämpfli AG, Bern<br />
Druck: Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Bern<br />
Adressän<strong>der</strong>ungen: syndicom, Adressverwaltung,<br />
Monbijoustrasse 33, Postfach, 3001 Bern<br />
Tel. 058 817 18 18, Fax 058 817 18 17<br />
Inserate: priska.zuercher@syndicom.ch<br />
Abobestellung: <strong>in</strong>fo@syndicom.ch<br />
Abopreis ist im Mitglie<strong>der</strong>beitrag <strong>in</strong>begriffen. Für<br />
Nicht-Mitglie<strong>der</strong>: Fr. 50.– (Inland), Fr. 70.– (Ausland)<br />
Verleger<strong>in</strong>: syndicom – Gewerkschaft<br />
Medien und Kommunikation, Monbijoustr. 33,<br />
Postfach, 3001 Bern.<br />
Das syndicom-Magaz<strong>in</strong> ersche<strong>in</strong>t 6 Mal im Jahr.<br />
Ausgabe Nr. 2/17 ersche<strong>in</strong>t am 24. November<br />
Redaktionsschluss: 2. Oktober.<br />
31<br />
Der freischaffende Fotograf Mart<strong>in</strong><br />
Bichsel (44) ist seit 2003 Gewerkschaftsmitglied<br />
und engagierte sich<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Freienkommission des Sektors<br />
Medien von syndicom. Nebst Auftragsarbeiten<br />
verfolgt <strong>der</strong> Berner eigene<br />
künstlerische Projekte. Er porträtierte<br />
Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> Bern und setzt sich für<br />
e<strong>in</strong>e solidarischere Gesellschaft e<strong>in</strong>.<br />
Text: Theodora Peter<br />
Bild: Marco Zanoni<br />
E<strong>in</strong> Glücksfall als<br />
Sprungbrett <strong>in</strong><br />
die Selbstständigkeit.<br />
«Je<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>stag ist an<strong>der</strong>s. Steht<br />
auswärts e<strong>in</strong> Fotoauftrag an, radle<br />
ich direkt von me<strong>in</strong>er Wohnung<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Berner Länggasse an den<br />
Bahnhof. Die Ausrüstung schultere<br />
ich im Rucksack. Das Klappvelo<br />
nehme ich gleich mit <strong>in</strong> den Zug, so<br />
b<strong>in</strong> ich auch vor Ort mobil. Ich habe<br />
ke<strong>in</strong> Auto und will auch ke<strong>in</strong>es. Das<br />
wäre nur nötig, wenn ich als Festangestellter<br />
für e<strong>in</strong>e Tageszeitung<br />
arbeiten würde, wovon ich anfänglich<br />
noch träumte. Dass es nicht so<br />
weit kam, bereue ich nicht. Ich b<strong>in</strong><br />
froh, muss ich nicht von e<strong>in</strong>em<br />
Term<strong>in</strong> zum an<strong>der</strong>en hetzen. Dafür<br />
riskiere ich als Freier, dass es immer<br />
wie<strong>der</strong> flaue Monate gibt. In den<br />
letzten Jahren ist me<strong>in</strong>e Auftragslage<br />
stabiler geworden. Zum Glück habe<br />
ich treue Kunden, die mich regelmässig<br />
buchen, etwa die Wohnbaugenossenschaften<br />
Schweiz.<br />
Eigentlich b<strong>in</strong> ich gelernter Sportartikelverkäufer.<br />
Nach <strong>der</strong> Lehre<br />
erfüllte ich mir e<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dheitstraum<br />
und wurde Flight Attendant<br />
bei <strong>der</strong> Swissair. Die Lust am Reisen<br />
nutzte sich aber schnell ab. Auf den<br />
Geschmack des Fotografierens<br />
brachte mich e<strong>in</strong> Freund auf e<strong>in</strong>er<br />
geme<strong>in</strong>samen Reise nach Madrid.<br />
Zurück <strong>in</strong> Bern richteten wir <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>em Badezimmer e<strong>in</strong> Fotolabor<br />
e<strong>in</strong> und entwickelten unsere ersten<br />
Bil<strong>der</strong>. Mit 25 Jahren nahm ich<br />
schliesslich die autodidaktische<br />
Fotografenausbildung GaF <strong>in</strong><br />
Angriff. Me<strong>in</strong>en Lebensunterhalt<br />
verdiente ich nebenbei als Velokurier,<br />
was für mich mehr als e<strong>in</strong><br />
Brotjob war. Ich fühlte mich dort<br />
als Teil e<strong>in</strong>er Familie.<br />
Freischaffend b<strong>in</strong> ich seit<br />
2001 – dank e<strong>in</strong>em Glücksfall. Ich<br />
bekam den Auftrag, 300 Häuser zu<br />
fotografieren und war für e<strong>in</strong> Jahr<br />
sorgenfrei. So konnte ich ohne<br />
Existenz ängste me<strong>in</strong>e Selbstständigkeit<br />
aufbauen. Wenig später trat ich<br />
<strong>der</strong> Gewerkschaft – damals comedia<br />
– bei. Es war mir wichtig, bei<br />
Problemen e<strong>in</strong>en Ansprechpartner<br />
zu haben. Viel profitiert habe ich<br />
auch von den Weiterbildungsangeboten<br />
für Freie. Dabei merkte ich,<br />
wie wichtig die Vernetzung ist.<br />
Deshalb engagierte ich mich auch <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Freienkommission.<br />
Wenn ich nicht auswärts für<br />
e<strong>in</strong>en Auftrag unterwegs b<strong>in</strong>, verbr<strong>in</strong>ge<br />
ich den Tag mit Fotobearbeitung<br />
und Bürokram <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em<br />
Atelier im PROGR. Das Kulturzentrum<br />
mit über 70 Ateliers ist e<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>spirierendes Biotop. Hier engagiere<br />
ich mich ehrenamtlich im ‹Kreativ-Asyl›<br />
für Flüchtl<strong>in</strong>ge. Auch privat<br />
begleite ich Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> <strong>der</strong>en<br />
hürdenreichen Alltag. Dabei entstanden<br />
Porträts, die ich bereits <strong>in</strong><br />
mehreren Ausstellungen zeigen<br />
konnte. Am Abend bleibe ich nicht<br />
allzu lange im Büro. Manchmal gehe<br />
ich noch an e<strong>in</strong>e Sitzung <strong>der</strong> Regionalgruppe<br />
von Public Eye. Dort setze<br />
ich mich unter an<strong>der</strong>em für die<br />
Konzernverantwortungs<strong>in</strong>itiative<br />
e<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>e gerechtere Welt sche<strong>in</strong>t<br />
mir unabd<strong>in</strong>gbar.»<br />
mart<strong>in</strong>bichsel.ch<br />
Anzeige<br />
Spezialofferte<br />
Bestellen Sie Ihre AgipPLUS Karte<br />
• ohne Spesen<br />
• ohne Gebühr<br />
• Rabatt 4.5 Rp/lt Treibstoff (Bleifrei und Diesel)<br />
(auf den Eni/Agip-Tankstellen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz und <strong>in</strong> Liechtenste<strong>in</strong>)<br />
Verlangen Sie Ihren Kartenantrag beim Zentralsekretariat<br />
+41 (0)58 817 18 18 - mail@syndicom.ch<br />
Das syndicom-Kreuzworträtsel<br />
Zu gew<strong>in</strong>nen gibt es e<strong>in</strong> Cold Pack,<br />
gespendet von unserem Dienstleistungs-Partner<br />
KPT. Das Lösungswort<br />
wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> nächsten Ausgabe zusammen<br />
mit dem Namen <strong>der</strong> Gew<strong>in</strong>ner<strong>in</strong><br />
o<strong>der</strong> des Gew<strong>in</strong>ners veröffentlicht.<br />
Lösungswort und Absen<strong>der</strong> auf e<strong>in</strong>er<br />
A6-Postkarte senden an: syndicom-<br />
Zeitung, Monbijoustrasse 33, Postfach,<br />
3001 Bern. E<strong>in</strong>sendeschluss: 2. Oktober.<br />
Die Gew<strong>in</strong>ner<strong>in</strong><br />
Die Lösung des syndicom-Kreuzworträtsels<br />
aus <strong>der</strong> syndicom Zeitung<br />
Nr. 5/2017 lautet: GAV TOOL. Gewonnen<br />
hat Gertrud Waldburger aus Zürich. Sie<br />
erhält Reka-Checks im Wert von<br />
50 Franken von unserer<br />
Dienstleistungs- Partner<strong>in</strong> Reka. Wir<br />
gratulieren herzlich!<br />
-4.5<br />
Rp pro Liter
32 Interaktiv<br />
syndicom social<br />
Warum Web First<br />
Interaktiv: Auf dieser Seite wollen wir<br />
Diskussionen sichtbar machen<br />
Die besten, spannendsten o<strong>der</strong> auch<br />
kontroversesten Kommentare, die uns<br />
über die sozialen Medien erreichen,<br />
werden <strong>in</strong> Zukunft an dieser Stelle<br />
veröffentlicht. Damit auch jene <strong>in</strong> die<br />
Diskussionen e<strong>in</strong>bezogen werden, die<br />
sich nicht auf Facebook, Twitter und<br />
Instagram tummeln mögen.<br />
Der Zentralvorstand hat bestimmt,<br />
dass syndicom ihre Mitglie<strong>der</strong><br />
aktueller und schneller <strong>in</strong>formieren<br />
soll. Der schnellste Kanal ist das<br />
Internet – und darum lautet die<br />
neue Strategie «Web first». Die<br />
Kommunikation zwischen <strong>der</strong><br />
Gewerkschaft und euch Mitglie<strong>der</strong>n<br />
läuft <strong>in</strong> beide Richtungen schneller,<br />
präziser und vor allem direkter.<br />
Facebook_Fan24<br />
Das ist e<strong>in</strong> frei erfundenes Beispiel, das dir zeigen soll,<br />
wie de<strong>in</strong> Facebook-Kommentar <strong>in</strong> Zukunft aussehen<br />
könnte, wenn er auch im syndicom Magaz<strong>in</strong> ersche<strong>in</strong>t.<br />
facebook.com/syndicom für die Bewegung<br />
Diskutiert mit uns auf Facebook, erfahrt alles über unsere<br />
Aktionen, Petitionen und Demos, entdeckt unsere Fotos<br />
und Videos! Postet eure Me<strong>in</strong>ung als Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
syndicom-Gruppe und abonniert die Seite syndcom CH


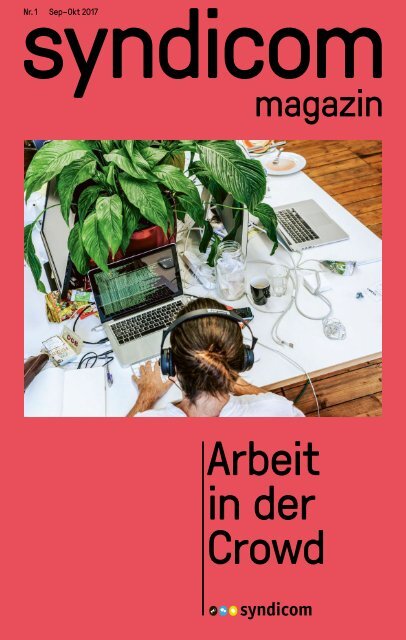


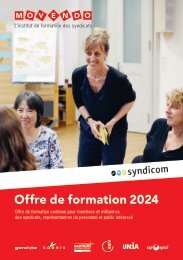



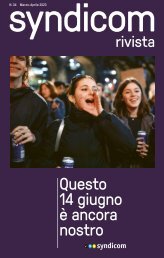

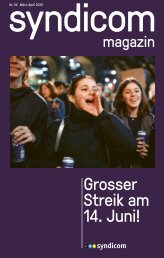


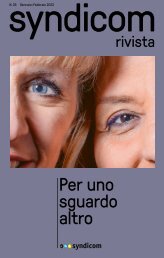
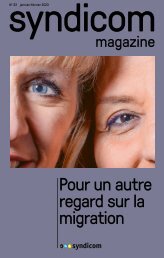
![2202456_[230122]_Syndicom_33_2023_DE_LOW_150_dpi](https://img.yumpu.com/67501302/1/164x260/2202456-230122-syndicom-33-2023-de-low-150-dpi.jpg?quality=85)