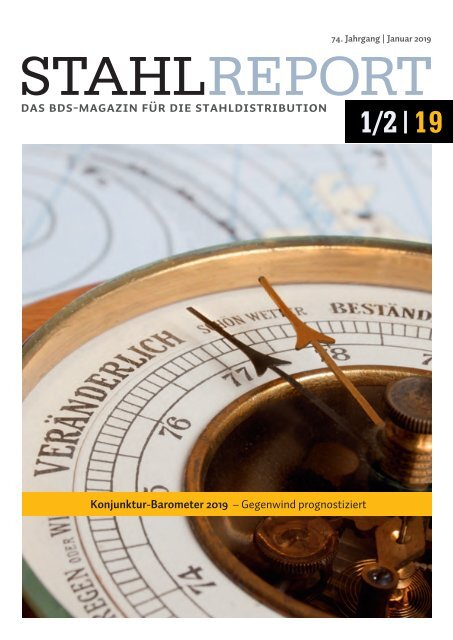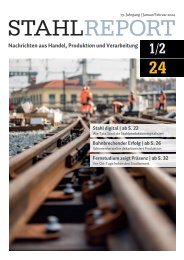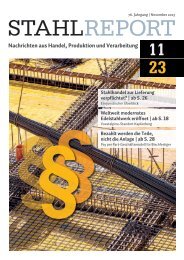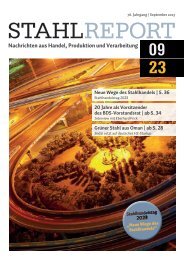Stahlreport 2019.01
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
74. Jahrgang | Januar 2019<br />
STAHLREPORT<br />
Das BDS-Magazin für die Stahldistribution<br />
1/2|19<br />
Konjunktur-Barometer 2019 – Gegenwind prognostiziert
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Dipl.-Ing. Jochen Adams<br />
Dr. rer. nat. Peter Drodten<br />
Dipl.-Ing. Jochen Adams<br />
Dr. rer. nat. Peter Drodten<br />
1. Auflage<br />
27. Auflage<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Ludwig Felser<br />
4. Auflage<br />
Dipl.-Ing. Jochen Adams<br />
Dr. rer. nat. Peter Drodten<br />
Dipl.-Ing. Wolfgang Drodten<br />
Starker Stahl<br />
braucht<br />
starke Bücher<br />
Unverzichtbar im Arbeitsalltag –<br />
BDS-Fachbücher<br />
Herstellung und Anwendungsgebiete<br />
Stahlrohre und Rohrzubehör<br />
Dr. Axel Willauschus<br />
Dr. Axel Willauschus<br />
Stahlrohre und Rohrzubehör<br />
Herstellung und Anwendungsgebiete<br />
Format DIN A5 | veredeltes Softcover |<br />
308 Seiten | 1. Auflage Nov. 2015 |<br />
49,00 € zzgl. MwSt., Verpackung & Versand<br />
Empfehlungen, Ausrüstung und Umsetzung<br />
Ladungssicherung<br />
im Stahlhandel<br />
Recommendations, Equipment and Execution<br />
Cargo Security<br />
for Steel Distribution<br />
Ludwig Felser<br />
Ladungssicherung<br />
im Stahlhandel<br />
Empfehlungen, Ausrüstung und Umsetzung<br />
Format DIN A4, dt./engl. | hochwertiges<br />
Hardcover | 89 Seiten, 168 Abbildungen<br />
1. Auflage – Sep. 2013 |<br />
39,00 € zzgl. MwSt., Verpackung & Versand<br />
Herstellung, Normung und Eigenschaften<br />
Langerzeugnisse aus Stahl<br />
Production, Standards and Properties<br />
Long Products made of Steel<br />
Dipl.-Ing. Jochen Adams,<br />
Dr. rer. nat. Peter Drodten<br />
Langerzeugnisse aus Stahl<br />
Herstellung, Eigenschaften und<br />
Prüfung<br />
Format DIN A4, dt./engl. | hochwertiges<br />
Hardcover | 128 Seiten, 99 Abbildungen<br />
1. Auflage – Sep. 2013 | 119,00 €<br />
zzgl. MwSt., Verpackung & Versand<br />
Kommentar für den praxisorientierten Anwender<br />
aus Handel und Industriee<br />
EN-Normen für<br />
Rohre und Rohrzubehör<br />
Dr. Axel Willauschus<br />
Dr. Axel Willauschus<br />
EN-Normen für Stahlrohre<br />
und Rohrzubehör<br />
Format DIN A5 | veredeltes Softcover<br />
ca. 560 Seiten | 4. Auflage – Sept. 2017 |<br />
36,45 € zzgl. MwSt., Verpackung & Versand<br />
Ein material-, produkt- und anarbeitungskundliches<br />
Nachschlagewerk für den Stahlhandel<br />
Stahl-Lexikon<br />
Manfred Feurer<br />
Prof. Dr. Joachim Lueg<br />
Heinz Schürmann<br />
Manfred Feurer, Prof. Dr. Joachim Lueg,<br />
Heinz Schürmann<br />
Stahl-Lexikon<br />
Eine Material-, Produkt- und<br />
Anarbeitungskunde<br />
Format DIN A5 | veredeltes Softcover |<br />
339 Seiten, 75 Abbildungen | 27. Auflage –<br />
Nov. 2009 | 49,00 € zzgl. MwSt.,<br />
Verpackung & Versand<br />
Prüfbescheinigungen nach<br />
EN 10204 in der Praxis<br />
Peter Henseler<br />
1. Auflage<br />
Peter Henseler<br />
Prüfbescheinigungen nach<br />
EN 10204 in der Praxis<br />
Format DIN A5 | veredeltes Softcover |<br />
ca. 100 Seiten | 1. Auflage – 2011 | 45,79 €<br />
zzgl. MwSt., Verpackung & Versand<br />
Herstellung, Eigenschaften und Prüfung<br />
Flacherzeugnisse aus Stahl<br />
Production, Properties and Testing<br />
Flat Products made of Steel<br />
Dipl.-Ing. Jochen Adams,<br />
Dr. rer. nat. Peter Drodten<br />
Flacherzeugnisse aus Stahl<br />
Herstellung, Eigenschaften und Prüfung<br />
Format DIN A4, dt./engl. | hochwertiges<br />
Hardcover | 130 Seiten, 120 Abbildungen<br />
1. Auflage – Dez. 2010 | 119,00 €<br />
zzgl. MwSt., Verpackung & Versand<br />
Herstellung, Eigenschaften und Verarbeitung<br />
Edelstahl Rostfrei<br />
Production, Properties and Processing<br />
Stainless Steel<br />
Dipl.-Ing. Jochen Adams, Dr. rer. nat. Peter<br />
Drodten, Dipl.-Ing. Wolfgang Drodten<br />
Edelstahl Rostfrei<br />
Herstellung, Eigenschaften und<br />
Verarbeitung<br />
Format DIN A4, dt./engl. | hochwertiges<br />
Hardcover | 144 Seiten, 104 Abbildungen<br />
1. Auflage – Dez. 2009 | 99,00 €<br />
zzgl. MwSt., Verpackung & Versand<br />
Bestellen Sie per Telefax: 02 11/8 64 97-22 oder per E-Mail: info-BDS@stahlhandel.com<br />
BDS AG – Bundesverband Deutscher Stahlhandel – www.stahlhandel.com
50 Jahre BDS –<br />
Eine reife Leistung<br />
EDITORIAL<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen<br />
der Stahldistribution!<br />
In meiner Position als Vorsitzender des BDS-Vorstandsrats<br />
lade ich Sie herzlich zum diesjährigen<br />
Stahlhandelstag ein, der am 19. und 20. September<br />
in Neuss stattfinden wird. Der BDS richtet diese<br />
Großveranstaltung, welche mit mehr als 350 Teilnehmern<br />
aus dem deutschsprachigen In- und<br />
Eberhard Frick<br />
Ausland zu den Höhepunkten auf dem Veranstaltungskalender<br />
zählt, bereits zum 27. Mal aus.<br />
Die Besonderheit des Ereignisses erschließt sich uns, wenn wir<br />
den Tagungsort, nämlich Neuss im Rheinland, genauer betrachten:<br />
Die Stadt wurde als römisches Militärlager (lateinisch „Novaesium“)<br />
an der linken Rheinseite gegründet. Daher gehört Neuss zu den<br />
ältesten Städten Deutschlands. Immerhin feierte man im Jahr 1984<br />
sein 2.000-jähriges Bestehen.<br />
Aus BDS-Sicht ist es jedoch ein Ereignis aus der Neuzeit, welches<br />
den Stahlhandelstag und das historische Neuss miteinander verbindet.<br />
Denn in Neuss wurde 1969 der Bundesverband Deutscher<br />
Stahlhandel, hervorgegangen aus der Fusion seiner regionalen Vorgängerverbände,<br />
in der dortigen Stadthalle gegründet. Der BDS<br />
wird deswegen an seinen Geburtsort zurückkehren: Wir werden<br />
dieses Ereignis in genau dieser Stadthalle anlässlich des kommenden<br />
Stahlhandelstages würdigen. Darüber hinaus werden wir über alle<br />
aktuellen Themen „rund um den Stahl“ diskutieren. Freuen Sie<br />
sich mit mir gemeinsam, insbesondere aufgrund des derzeit spannenden<br />
Marktumfelds, auf den Austausch mit hochkarätigen Vortragsrednern<br />
aus den Bereichen Produktion, Handel und Verarbeitung.<br />
Eine weitere Veranstaltung des BDS prägt den Jahresstart 2019:<br />
Der gemeinsam mit der Edelstahlhandelsvereinigung ausgerichtete<br />
„DigiDay“ am 7. Februar in Düsseldorf. Auf dem Fachtag zur Digitalisierung,<br />
der im Vorfeld bereits auf viel positives Interesse<br />
gestoßen ist, referieren namhafte Experten und Marktteilnehmer<br />
zu aktuellen Ansätzen der Vernetzung im Stahlhandel. Auch in<br />
dieser Ausgabe des <strong>Stahlreport</strong>s finden Sie Beiträge zur Digitalisierung<br />
(siehe z.B. Seite 6 bis 13).<br />
Wir sehen uns wieder – spätestens am 19. und 20. September<br />
2019 in Neuss.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Eberhard Frick, Vorsitzender des BDS-Vorstandsrats<br />
INHALT<br />
PERSÖNLICHES<br />
4 Kurznachrichten<br />
STAHLHANDEL<br />
6 Voß Edelstahlhandel: Zwei Kooperationen, ein Ziel<br />
12 XOM Materials – Der Stahlhandel-Digitalisierer<br />
14 Mechel positioniert sich<br />
18 Fraunhofer-Studie: Stahlhandel mit Nachholbedarf<br />
bei der Digitalisierung<br />
STAHLVERARBEITUNG<br />
20 4.700 Eisenbahnbrückenlager für Bangkok<br />
22 Edler Stahlbau für Porsche<br />
23 Auffangwannen aus Edelstahl<br />
STAHLPRODUKTION<br />
24 DEW – Ersatz für kritische Legierungselemente<br />
ANARBEITUNG & LOGISTIK<br />
26 Feuerverzinken verlängert Feuerwiderstandsdauer<br />
MESSEN UND MÄRKTE<br />
28 Konjunktur mit Gegenwind<br />
29 Bauwirtschaft – Weiter auf Wachstumskurs<br />
30 Maschinenbau – Robust in schwierigem Umfeld<br />
32 Verarbeitendes Gewerbe – Auftragseingang<br />
34 BGA – Großhandelsklima am Scheideweg<br />
36 EU-Safeguards – Stahleinfuhren reglementiert<br />
38 Messe Bau 2019 – Material und mehr<br />
39 Messen Intec und Z – Sonderschau verbindet<br />
40 Rückblick auf die EuroBLECH 2018<br />
BDS<br />
44 Research: Keine Herbststürme zum Jahresende<br />
46 Berufsbildung – Der Zauberwürfel<br />
48 BDS-Umfrage: überbetriebliche Ausbildungsbegleitung<br />
49 BDS-Fernstudium – neuer Jahrgang startet<br />
WISSENSWERTES<br />
50 Werkstoff-Forschung – den Kaltrissen auf der Spur<br />
52 Digitalverband Bitkom – Digital-affiner Handel<br />
54 Digitalisierung – Veränderungen gestalten<br />
VERBÄNDE & POLITIK<br />
56 Brücken aus Stahl –<br />
Fachseminar & Verbandsaktivitäten<br />
58 Automobiler Leichtbau – Dritte Projektphase<br />
60 Verbundgruppe EDE – Evolutionärer Prozess<br />
LIFESTEEL<br />
62 Skulpturen aus Edelstahl – Material & Möglichkeiten<br />
64 Metallgewebe für Universitätsgebäude<br />
66 Ancofer – Visitenkarte aus Stahl<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
3
Persönliches<br />
Kurznachrichten<br />
Fotos: privat<br />
Petra Jung<br />
und<br />
Susanne<br />
Wagner<br />
verbindet, dass sie im<br />
Bundesverband Deutscher<br />
Stahlhandel<br />
(BDS) Office-Managerin<br />
ist bzw. war. Zeitlich<br />
passend zum Umzug des BDS zum Jahreswechsel<br />
innerhalb von Düsseldorf (von der<br />
Max Planck-Straße in die Wiesenstraße) hatte<br />
Susanne Wagner nach gut zehn Verbandsjahren<br />
entschieden, sich künftig neuen beruflichen<br />
Herausforderungen<br />
zu stellen. Und<br />
Petra Jung nahm<br />
diese Gelegenheit<br />
wahr, ihre jahrzehntelange<br />
Stahlerfahrung<br />
im verbandlichen<br />
Umfeld künftig für die<br />
BDS AG nutzbar zu<br />
machen.<br />
Andreas Schwenter und<br />
Stephan Karle<br />
sind in der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung<br />
Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen<br />
e.V. (BDSV) als Präsident<br />
bzw. als stellvertretender Präsident<br />
einstimmig wiedergewählt worden. Neue<br />
Schatzmeisterin ist die Stuttgarter Unternehmerin<br />
Stefanie Gottschick-Rieger. Sie folgt im<br />
Amt ihrem Vater Günter Gottschick, der nach<br />
15 Jahren nicht mehr angetreten war. Die Mitgliederversammlung<br />
fand im Rahmen der<br />
BDSV-Jahrestagung Ende November in Stuttgart<br />
statt. Leitthema der Veranstaltung war die<br />
Digitalisierung der Stahlrecyclingbranche.<br />
Heinz Jörg Fuhrmann<br />
ist von der Mitgliederversammlung des Bundesverbands<br />
der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zu<br />
einem der Vizepräsidenten in dessen Präsidium<br />
gewählt worden. Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann<br />
ist Vorsitzender des Vorstands der Salzgitter<br />
AG. Der BDI ist die Spitzenorganisation<br />
der deutschen Industrie und deren Dienstleister.<br />
Er spricht für etwa 40 Branchenverbände und<br />
mehr als 100.000 Unternehmen mit rund 8 Mio.<br />
Beschäftigten. Prof. Fuhrmann repräsentiert im<br />
Führungsgremium des BDI die deutsche Stahlindustrie<br />
mit ihrem Verband, der Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl. Seine zweite zweijährige Amtszeit<br />
als BDI-Präsident hat unterdessen Dieter Kempf<br />
angetreten.<br />
Hannes Zapf<br />
ist seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender der<br />
Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und<br />
Wohnungsbau e.V.<br />
(DGfM), die bei ihrem<br />
Unternehmertag 2018<br />
in Berlin die Weichen<br />
für die Zukunft der<br />
deutschen Mauerwerksindustrie<br />
zu stellen<br />
versucht hat: Mit<br />
der neuen „Strategie<br />
2030“ sollen auf Basis<br />
wissenschaftlicher<br />
Studien erstmals für die Branche relevante<br />
Trends und Entwicklungen, konkrete Handlungsfelder<br />
und Forderungen an die Politik definiert<br />
werden. Zudem geben unabhängige Experten<br />
für dieses Konzept Denkanstöße, wie sich<br />
die deutsche Baulandschaft in den nächsten<br />
Jahrzehnten verändern wird, und beurteilen das<br />
Potenzial von Mauerwerk bei der Gestaltung<br />
künftiger baulicher Konzepte. Bereits seit einigen<br />
Wochen finden Interessierte auf www.mauerwerk.online<br />
eine Microsite, die das gesamte,<br />
von Dr. Hannes Zapf maßgeblich vertretende<br />
Strategiepapier und alle darin zitierten Studien<br />
in vollem Umfang zum Download bereitstellt.<br />
Inga Stein-Barthelmes<br />
leitet seit September beim Hauptverband der<br />
Deutschen Bauindustrie den neu gegründeten<br />
Bereich Politik und Kommunikation. Für diese<br />
Funktion wurden zwei bisher eigenständige<br />
Zweige des Verbands zusammengelegt.<br />
Foto: DGfM<br />
Bernd Leukert<br />
hat als Vorstand der SAP SE den Vorsitz des<br />
Lenkungskreises der Plattform Industrie 4.0<br />
zum Jahreswechsel turnusmäßig an Dr. Frank<br />
Melzer, Vorstand der Festo AG & Co. KG, übergeben.<br />
In seiner Amtszeit möchte der den<br />
Fokus auf die Technologieentwicklung legen,<br />
insbesondere auf „die Weiterentwicklung<br />
dezentraler, autonomer Systeme und künstlicher<br />
Intelligenz, die uns hervorragende Werkzeuge<br />
liefern, um künftig industrielle Produktionsprozesse<br />
zu optimieren.“ Ein weiterer<br />
Schwerpunkt werde die Qualifizierung und Weiterbildung<br />
von Fachkräften sein, die im Beruf<br />
stehen. Die Plattform Industrie 4.0 ist das zentrale<br />
Netzwerk in Deutschland, um die digitale<br />
Transformation in der Produktion voranzubringen.<br />
Im Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft,<br />
Wissenschaft, Gewerkschaften und Verbänden<br />
wirken über 350 Akteure aus mehr als<br />
150 Organisationen aktiv in der Plattform mit.<br />
Klaus Keysberg<br />
ist seit dem Jahreswechsel Vorstandsvorsitzender<br />
von Thyssenkrupp Materials Services – als<br />
Nachfolger von Joachim Limberg, der pensionsbedingt<br />
aus dem Unternehmen ausgeschieden<br />
ist. Der neue CEO (Chief Executive Officer) war<br />
in der Gesellschaft zuvor Finanzvorstand.<br />
Außerdem ist Ilse Henne als Chief Operating<br />
Officer (COO) in den Vorstand der Business<br />
Area aufgerückt. „Mit diesen beiden Entscheidungen<br />
ist der neue Vorstand des Geschäftsbereichs<br />
Materials Services hervorragend aufgestellt“,<br />
kommentierte Guido Kerkhoff,<br />
Vorstandsvorsitztender der Thyssenkrupp AG,<br />
diese Personalentscheidungen.<br />
Michael Henke<br />
ist als Mitglied in die Deutsche Akademie der<br />
Technikwissenschaften (acatech) aufgenommen<br />
worden. Nach Prof. Michael ten Hompel<br />
(2011) und Prof. Axel Kuhn (2012) ist Prof.<br />
Michael Henke damit der dritte Vertreter des<br />
Fraunhofer IML, dem diese Ehre zuteil geworden<br />
ist. Henke ist Inhaber des Lehrstuhls für<br />
Unternehmenslogistik<br />
an der Technischen<br />
Universität Dortmund<br />
und Institutsleiter am<br />
Fraunhofer-Institut für<br />
Materialfluss und<br />
Logistik IML. Die Aufnahme<br />
neuer Mitglieder<br />
in die Akademie<br />
erfolgt durch Zuwahl.<br />
Vorausgesetzt werden<br />
eine hohe wissenschaftliche Reputation sowie<br />
die Bereitschaft, in den acatech-Themennetzwerken<br />
und -Projekten mitzuarbeiten. Die acatech<br />
vertritt die deutschen Technikwissenschaften<br />
im In- und Ausland in selbstbestimmter,<br />
unabhängiger und gemeinwohlorientierter<br />
Weise. Die Akademie berät sowohl Politik als<br />
auch Gesellschaft in technikwissenschaftlichen<br />
und technologiepolitischen Belangen.<br />
C. L. Theodor Wuppermann<br />
ist zum Jahreswechsel als Sprecher des Vorstands<br />
der Wuppermann<br />
AG in den lange<br />
geplanten Ruhestand<br />
getreten. Für 17 Jahre<br />
hatte er das Familienunternehmen<br />
in der<br />
fünften Generation<br />
geführt. Anfang 2002<br />
war Dr. Wuppermann<br />
in den Vorstand der<br />
Foto: IML<br />
Foto: Wuppermann<br />
4 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Foto: IML<br />
Unternehmensholding eingetreten und hatte als<br />
CFO die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen,<br />
Personal und IT übernommen. Nach dem<br />
Tod von Gerd Edgar Wuppermann 2010 verantwortete<br />
Theodor Wuppermann zusätzlich die<br />
Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Recht sowie<br />
die Sprecherfunktion im Vorstand. Seit Anfang<br />
2019 setzt sich die Führung des Familienunternehmens<br />
erstmals in der 146-jährigen<br />
Geschichte ausschließlich aus familienexternen<br />
Mitgliedern zusammen. Die Wuppermann-<br />
Gruppe ist ein in der Stahlverarbeitung tätiges<br />
mittelständisches Familienunternehmen mit<br />
Sitz in Leverkusen.<br />
Michael ten Hompel<br />
ist einer von zwei Bürgern des Ruhrgebiets<br />
2018. Die Jury unter Vorsitz von NRW-Wirtschaftsminister<br />
Prof. Dr. Andreas Pinkwart<br />
begründet die Auszeichnung<br />
des<br />
geschäftsführenden<br />
Institutsleiter des<br />
Fraunhofer IM, damit,<br />
dass Prof. Dr. Dr h.c.<br />
Michael ten Hompels<br />
digitale Innovationen<br />
Lösungen für eine<br />
zukunftsweisende<br />
Logistik bieten, die<br />
rund um den Globus in zur Anwendung kommen.<br />
Er setze Maßstäbe für den Innovationsstandort<br />
Ruhr, die für die Verwirklichung einer<br />
Industrie 4.0 essentiell sind. Darüber hinaus<br />
habe er die Digitalisierung des Logistikstandorts<br />
Ruhr und damit die Zukunftsfähigkeit der<br />
Region wegbereitend vorangetrieben. Geehrt<br />
und gefeiert werden die neuen Bürger des<br />
Ruhrgebiets am 25.2.19 in Dortmund.<br />
Reinhard Winkelgrund<br />
ist im vergangenen Jahr aus Altersgründen aus<br />
den Diensten der Wirtschaftsvereinigung (WV)<br />
Stahl ausgeschieden, in der Öffentlichkeit fast<br />
unbemerkt. Verbunden bleibt sein Name aber<br />
trotzdem mit der Etablierung eines innovativen<br />
Werkstoffmarketings für Stahl – vor allem in den<br />
1990-ger Jahren, als erfolgreich der Grundstein<br />
für das nachhaltige Image dieses Materials<br />
gelegt wurde. Dr. rer. pol. Reinhard Winkelgrund<br />
hatte im Juli 2018 sein 65. Lebensjahr vollendet<br />
und danach sein Berufsleben beendet, in dessen<br />
Verlauf er zum Leiter Marketing und Kommunikation<br />
der WV Stahl aufgestiegen war und<br />
das Stahl-Informationszentrum geprägt hatte.<br />
Geblieben ist aus dieser Zeit z.B. die regelmäßige<br />
Auslobung des Stahl-Innovationspreises.<br />
Foto: Nordwest<br />
Martin Bertinchamp und<br />
Jörg Simon<br />
haben die traditionelle Spende der Nordwest<br />
Handel AG zum Jahresende überreicht. An verschiedene<br />
soziale Organisationen ging eine<br />
Spende von insgesamt 15.000 €. Interims-Vorstandsvorsitzender<br />
Martin Bertinchamp (r.) und<br />
Finanzvorstand Jörg Simon (l.) übergaben entsprechende<br />
Schecks dem Frauenhaus der Stadt<br />
Dortmund, dem Verein Löwenherz und Passgenau,<br />
einer Initiative der Dortmunder Diakonie.<br />
Annehmende waren Klaus Bullmann und Rolf-<br />
Jürgen Neumann (2.v.l. und 2.v.r.), Förderverein<br />
Löwenherz, Susanne Thoma (3.v.l.), Passgenau,<br />
und Anita Legde-Pähler (3.v.r.), Frauenhaus<br />
Dortmund.<br />
Fernando Espada<br />
ist neuer Präsident von EUROMETAL, der europäischen<br />
Vereinigung von lagerhaltenden Stahlhändlern<br />
sowie Stahl<br />
Service-Centern und<br />
Steel-Tradern. Die<br />
Generalversammlung<br />
wählte den CEO von<br />
Tata Steel Distrubution<br />
Spain Anfang<br />
Dezember in dieses<br />
Foto: Eurometal<br />
Amt – als Nachfolger<br />
von Jens Lauber, der<br />
bei Tata Steel Europe<br />
neue Aufgaben übernommen hat.<br />
Armin Laschet<br />
ist nicht nur nordrhein-westfälischer Ministerpräsident,<br />
sondern seit dem 1.1.19 zudem<br />
deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter<br />
und als solcher u.a. auch zuständig für Fragen<br />
der beruflichen Bildung. Diese Regelung geht<br />
auf den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag<br />
von 1963 zurück: Mit dem Kulturbevollmächtigten,<br />
der im Rang eines Bundesministers<br />
die Interessen der Bundesrepublik und der 16<br />
Bundesländer gegenüber dem Nachbarland vertritt,<br />
hat Frankreich einen direkten Ansprechpartner<br />
für Bildungs- und Kulturangelegenheiten,<br />
die in Deutschland Ländersache sind.<br />
Foto: Tschorn Foto: FLG<br />
Entsprechend hat die Bundesregierung auf Vorschlag<br />
der Ministerpräsidentenkonferenz Armin<br />
Laschet für vier Jahre für diese Aufgabe bestellt<br />
– als Nachfolger des Hamburger Regierungschefs<br />
Peter Tschentscher.<br />
Friedhelm Loh<br />
setzt auch weiterhin auf den Nachwuchs: Im<br />
November zeichnete der namensgebende Motor<br />
der Friedhelm Loh Group (FLG) die Preisträger<br />
des diesjährigen Wettbewerbs des zweiten Ausbildungsjahres<br />
aus. 55 junge Menschen hatten<br />
sich in diesem Zusammenhang kreativ mit der<br />
Digitalisierung beschäftigt. Die weltweit tätige<br />
Unternehmensgruppe steht u.a. für die Verarbeitung<br />
von Stahl und Aluminium. Das in Bad Camberg<br />
auch von Prof. Dr. Friedhelm Loh gefeierte<br />
Siegerteam gewann eine Reise nach Leipzig.<br />
Jochen Haußmann<br />
hatte auf der Messe AMB im September in<br />
Stuttgart als FDP-Landtagsabgeordneter aus<br />
dem Wahlkreis Schorndorf den Messestand der<br />
Tschorn GmbH besucht und erhielt für Ende<br />
November eine Einladung einem Firmenbesuch<br />
bei dem Urbacher Familienunternehmen. Den<br />
Grundstein für das Geschäft hatte Franz<br />
Tschorn gelegt, der Vater des aktuellen<br />
Geschäftsführers Ralf Tschorn (l.). Der ließ es<br />
sich nicht nehmen, seinen Gast selber zu führen<br />
– nach dem Motto „Politik trifft Produktion“.<br />
Seit 1986 ist die Tschorn GmbH in Urbach auf<br />
die Herstellung von hochwertigen Mess- und<br />
Spannmitteln für die zerspanende Industrie spezialisiert.<br />
Hergestellt werden Produkte zur Nullpunktermittlung,<br />
Werkstückspannung, Werkzeugspannung<br />
und zur Werkzeugmessung.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
5
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
Voß Edelstahlhandel: über 8.000 Artikel, zehn Lagerstandorte in ganz Europa und 10.000 t Stahlprodukte auf Lager<br />
Voß Edelstahl kooperiert mit Mapudo und steel.shop<br />
Vernetzte Sortimente –<br />
zwei Kooperationen, ein Ziel<br />
Für Voß Edelstahlhandel sind Digitalisierung und Vernetzung keine Fremdworte. Mit „Voss Online“,<br />
einem nur für registrierte Kunden geöffneten Onlineshop, hat das norddeutsche Handelsunternehmen<br />
für Edelstahl- und NE-Metalle schon früh Standards gesetzt. Nun kooperiert Voß Edelstahlhandel<br />
darüber hinaus parallel mit dem Online-Marktplatz Mapudo (Mapudo GmbH) sowie der Webshop-<br />
Lösung steel.shop (Montanstahl GmbH).<br />
Markus Fischer,<br />
Geschäftsführer der<br />
Voß Edelstahlhandel<br />
GmbH & Co. KG (2. v.l.),<br />
Niklas Friederichsen<br />
(3.v.l.) und Christian<br />
Sprinkmeyer (r.), beide<br />
Geschäftsführer der<br />
Mapudo GmbH), im<br />
Gespräch mit Markus<br />
Huneke, Redaktion<br />
<strong>Stahlreport</strong>.<br />
Foto: BDS<br />
6 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Kooperation eins:<br />
Voß & Mapudo<br />
Was steckt da hin ter? Über<br />
die Hintergründe der Kooperation<br />
zwischen Voß und Mapudo, welche<br />
Zie le die Beteiligten damit verfolgen<br />
und welche Vorteile sich dadurch<br />
für Kunden ergeben, hat der <strong>Stahlreport</strong><br />
mit Markus Fischer, Ge -<br />
schäftsführer der Voß Edelstahlhandel<br />
GmbH & Co. KG sowie den<br />
beiden Mapudo-Geschäftsführern<br />
Niklas Friederichsen und Christian<br />
Sprinkmeyer gesprochen.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Herr Fischer, Sie haben<br />
mit „Voss Online“ einen eigenen<br />
Webshop entwickelt. Warum nun<br />
die Kooperation mit gleich zwei<br />
anderen Anbietern digitaler Lösungen<br />
für den Stahlhandel – Mapudo<br />
und steel.shop?<br />
Markus Fischer: Um es von<br />
Anfang an ganz klar zu machen: Wir<br />
bieten unsere Produkte und Dienstleistungen<br />
selbst weder über<br />
Mapudo noch über steel.shop an.<br />
Wir sind als Voß Edelstahlhandel<br />
dort nicht sichtbar. Das würde auch<br />
Foto/Grafik: Voß Edelstahl<br />
nicht zu unserem Grundsatz entsprechen,<br />
strikt nur Händler als Kunden<br />
zu bedienen. Wir gehen nicht<br />
an seine Endkunden. Bei beiden<br />
Kooperationen mit Mapudo und mit<br />
steel.shop geht es vielmehr darum,<br />
unsere Kunden auf dem Weg Richtung<br />
online zu unterstützen. Wenn<br />
einer unserer Kunden sich auf<br />
Mapudo oder mit steel.shop präsentieren<br />
möchte, können wir ihm unser<br />
Portfolio digital bereitstellen. Oder<br />
richtiger gesagt: Unser Kunde – und<br />
nur unser Kunde – kann das Voß-<br />
Sortiment für seine Präsentation nutzen<br />
und digital auf einen Schlag darstellen.<br />
Der Endkunde sieht nicht,<br />
dass dieses oder jenes Produkt von<br />
Voß kommt. Der Endkunde sieht<br />
das, was er sehen soll, nämlich die<br />
Kompetenz seines Händlers. Das ist<br />
ja offline auch heute schon so.<br />
„Um es ganz klar zu<br />
machen: Wir bieten<br />
unsere Produkte und<br />
Dienstleistungen selbst<br />
weder über Mapudo<br />
noch über steel.shop an.<br />
Es geht darum, unsere<br />
Kunden auf dem Weg<br />
Richtung online zu<br />
unterstützen.“<br />
Markus Fischer,<br />
Geschäftsführer Voß Edelstahlhandel<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Sie erweitern also das<br />
Spektrum, mit dem Ihr Kunde Ihr<br />
Sortiment und Ihre Dienstleistungen<br />
nutzen kann.<br />
Markus Fischer: Richtig, die<br />
beiden Kooperation mit Mapudo und<br />
steel.shop sind eine Erweiterung der<br />
Möglichkeiten. Unser Händlerkunde<br />
kann auf Mapudo sein oder<br />
steel.shop nutzen und seine Aufträge<br />
an uns trotzdem noch telefonisch<br />
durchgeben, faxen oder persönlich<br />
vorbeikommen, wenn er das möchte.<br />
Wir geben nicht vor, wie er seine<br />
Artikel anbietet, sondern offerieren<br />
ihm nur Möglichkeiten. Wir gehen<br />
den Weg der Digitalisierung mit ihm<br />
mit. Wenn unsere Kunden über<br />
Mapudo oder steel.shop digital anbieten<br />
wollen, haben wir dafür bereits<br />
die Voraussetzungen geschaffen.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Welche Voraussetzungen<br />
sind das?<br />
Markus Fischer: Wir haben<br />
unsere Daten, also Artikelstammdaten,<br />
Verfügbarkeiten, Preisinformationen<br />
sowohl Mapudo als auch<br />
steel.shop bereitgestellt und standardisiert.<br />
Kunden von Voß Edelstahl<br />
können also, wenn sie ihr Sortiment<br />
mit Mapudo oder steel.shop<br />
vernetzen, damit zugleich auch auf<br />
unser Sortiment zugreifen. Denn<br />
die 8.000 Artikel von Voß Edelstahlhandel<br />
kennen beide schon.<br />
Niklas Friederichsen: Um<br />
einen Händler auf Mapudo sichtbar<br />
zu schalten, binden wir in der Regel<br />
nur Artikel ein, die lagerseitig verfügbar<br />
sind. Dadurch, dass wir die<br />
Artikel von Voß Edelstahl nun bereits<br />
kennen und eingebunden haben,<br />
können Anbieter auf Mapudo ihr<br />
eigenes Sortiment virtuell mit wenig<br />
Aufwand um das Sortiment von Voß<br />
erweitern. Wir gleichen ab, welche<br />
Artikel ergänzt werden können.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Einmalig müssen Händler,<br />
die auf Mapudo anbieten, also<br />
zu Beginn ihre Daten abgleichen.<br />
Wie hoch ist der Aufwand danach?<br />
Niklas Friederichsen: Richtig,<br />
der Prozess läuft so ab, dass wir die<br />
Daten vom Anbieter aufnehmen,<br />
aufbereiten und in unsere Logik der<br />
Produktdatenbeschreibung und<br />
Kategorisierung überführen. Im<br />
Aufbereiten der Produktdaten aus<br />
verschiedenen Formaten sind wir<br />
mittlerweile aber sehr gut geworden.<br />
Für Kunden geht es oft mehr<br />
darum, die Bepreisung ihrer Produkte<br />
festzulegen. Das ist für viele<br />
der eigentliche Aufwand – und das<br />
ist kein technischer Aufwand. Da<br />
geht es um betriebswirtschaftliche<br />
Entscheidungen, die der Kunde für<br />
sich treffen muss. Wenn die Daten<br />
aber einmal im System sind, müssen<br />
im Laufe der Zeit nur relativ<br />
einfache Anpassungen vorgenommen<br />
werden, sodass sich der fortlaufende<br />
Aufwand sehr in Grenzen<br />
hält.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Unterstützt Mapudo<br />
seine Anbieter bei der Preisfindung? q<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
7
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
q Niklas Friederichsen: Wir sind in<br />
diesem Punkt sehr weit gegangen,<br />
denn das ist für die Anbieter natürlich<br />
ein wichtiges Thema. Offline, am<br />
Telefon kann ich als Lieferant im<br />
Verkaufsgespräch den Preis flexibel<br />
ermitteln. Online geht das nicht. Aber<br />
auch online muss ein aus der Branche<br />
kommender Kunde, wenn er das<br />
Angebot sieht, sagen: das passt. Um<br />
das zu erreichen, können Händler<br />
ihre Preise auf Mapudo sehr individuell<br />
gestalten. Zum Beispiel können<br />
Preis-Mengen-Staffelungen, Lieferkosten<br />
und diverse Anarbeitungskosten<br />
abgebildet werden. Die Preissetzung<br />
selbst ist aber immer Sache<br />
des Anbieters. Da nimmt Mapudo<br />
ihm die Entscheidung nicht ab.<br />
Markus Fischer: Wobei das<br />
Pricing für die über 8.000 Voß-<br />
Kooperation zwei: Voß & steelshop<br />
Webshop integriert Voß-Sortiment<br />
für Händlerkunden<br />
steel.shop ist ein klassischer<br />
Webshop, der jedoch anders als viele<br />
Standard-Shopsysteme speziell für<br />
den Stahlhandel entwickelt wurde.<br />
Hinter der Lösung steht kein branchenfremdes<br />
Software- oder IT-Haus,<br />
sondern die Montanstahl GmbH in<br />
Oelde, eine Vertriebsgesellschaft der<br />
Schweizer Montanstahl AG – einem<br />
weltweit agierenden Hersteller von<br />
Profilen und Stangen aus Stahl und<br />
Edelstahl.<br />
Mit dem Ziel, den digitalen Markt<br />
voranzubringen und die Transaktionskosten<br />
in der Branche zu senken,<br />
beschäftigt sich das Unternehmen<br />
schon seit Jahren mit dem Thema<br />
Digitalisierung und ist mit seiner<br />
Shoplösung erfolgreich im Markt<br />
unterwegs.<br />
Auch für Filippo Stumm, Co-<br />
Founder von steel.shop, ist eine<br />
grundsätzliche Problematik des<br />
Online-Stahlhandels, dass einkaufenden<br />
Kunden häufig nicht dasselbe<br />
Sortiment geboten wird wie offline.<br />
Grund dafür ist, dass üblicherweise<br />
nur die Preise der lagergeführten<br />
Produkte im ERP-System hinterlegt<br />
sind und somit nur diese online angeboten<br />
werden können. Die Preise der<br />
Zukaufartikel sind im Allgemeinen<br />
ohne Rücksprache mit den Lieferanten<br />
nicht bekannt. Durch dieses reduzierte<br />
Angebot entsteht für den Shopnutzer<br />
ein Nachteil. „Wir haben daher<br />
gemeinsam mit Voß Edelstahl die<br />
Potenziale ausgelotet, wie wir den<br />
digitalen Handel hier voranbringen<br />
können und sogar Vorteile gegenüber<br />
dem offline Vertrieb schaffen können“,<br />
erläutert Filippo Stumm.<br />
Die Lösung: steel.shop und Voß<br />
Edelstahlhandel haben ihre Systeme<br />
miteinander vernetzt. Kunden von<br />
Voß, die für ihre Marktpräsenz auf<br />
steel.shop setzen, können somit<br />
außer ihrem eigenen Sortiment<br />
zusätzlich das Sortiment von Voß<br />
Edelstahlhandel online anbieten –<br />
und zwar unter eigener Flagge. Voß<br />
Edelstahlhandel tritt selbst nicht in<br />
Erscheinung. Die nötigen Produktdaten<br />
werden dabei normaktuell von<br />
steel.shop bereit gestellt.<br />
„Für viele Händler ist das attraktiv“,<br />
bewertet Filippo Stumm diesen<br />
Vorteil für steel.shop-Betreiber.<br />
„Einerseits können sie ihr Sortiment<br />
ohne zusätzliche Lagerkosten erweitern<br />
und das auch digital abbilden.<br />
Dazu kommt, dass den Käufern<br />
potentiell ein breiteres Produkt-Portfolio<br />
zur Verfügung steht – Stichwort:<br />
one-stop-shopping“, so Filippo<br />
Stumm weiter.<br />
Filippo Stumm (l.), Co-Founder von<br />
steel.shop, hat Oliver Ellermann,<br />
Vorstand des Bundesverbands Deutscher<br />
Stahlhandel, die Kooperation von<br />
steel.shop und Voß Edelstahlhandel<br />
erläutert.<br />
Fotos, 3: BDS<br />
8 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Artikel, also die Preise, die wir<br />
mit dem jeweiligen Händler vereinbart<br />
haben, schon hinterlegt<br />
sind und er sich nur noch darüber<br />
Gedanken machen muss, wie er<br />
selbst das an seine Kunden weitergibt.<br />
Christian Sprinkmeyer: Die<br />
Herausforderung liegt darin, denjenigen<br />
Käufern auf Mapudo, die<br />
zum ersten Mal kaufen und für die<br />
daher auch bei keinem der Anbieter<br />
individuelle Preise bei Mapudo hinterlegt<br />
sind, einen so interessanten<br />
Preis anzuzeigen, dass sie sich für<br />
den Kauf entscheiden. Wobei der<br />
Preis bei weitem nicht allein entscheidend<br />
ist, sondern auch andere<br />
Entscheidungskriterien wichtig sind<br />
– Service und Liefergeschwindigkeit,<br />
um nur zwei zu nennen. q<br />
Voß-Kunden, die sich für steel.shop<br />
entscheiden, können im eigenen<br />
Shop definieren, welche Artikel sie<br />
von Voß zukaufen und welche sie<br />
im eigenen Lager führen möchten.<br />
Alle Zukaufartikel können dank der<br />
verfügbaren Schnittstelle zu Voß<br />
direkt digital bepreist und angeboten<br />
werden“, erklärt Filippo Stumm.<br />
Pricing-Tool ermöglicht<br />
schnelle Anpassungen<br />
Eine wichtige Fragestellung für<br />
Händler, die mit steel.shop starten,<br />
ist die Konfiguration von Lagerbeständen<br />
und Preisen. Dabei ist laut<br />
Filippo Stumm auch das Tempo entscheidend,<br />
das der Händler bei der<br />
Umsetzung anstrebt: „Der Shopbetreiber<br />
kann im ersten Schritt der<br />
Umsetzung auch ohne Preise live<br />
gehen und Anfragen generieren. Im<br />
zweiten Schritt hat er die Möglichkeit,<br />
die Preise für Lager- und<br />
Zukaufartikel zu bestimmen und<br />
somit Bestellungen über den Shop<br />
zu generieren“, sagt Filippo Stumm.<br />
Sind alle Daten aber erst einmal im<br />
System, müssen Unternehmen diese<br />
nun nur noch kontinuierlich anpassen.<br />
„Dazu haben wir ein Pricing-<br />
Tool integriert, mit dem entsprechende<br />
Änderungen sehr schnell<br />
durchgeführt werden können“, so<br />
Stumm.<br />
„Die meisten Kunden entscheiden<br />
sich für steel.shop, weil sie es<br />
als zusätzliches Kundenbindungstool<br />
sehen. Sie bieten ihren Kunden<br />
damit einfach eine weitere Möglichkeit<br />
einzukaufen, neben Fax, Telefon<br />
und E-Mail“, erklärt der Co-Founder.<br />
Voß Edelstahl setzt dabei übrigens<br />
nicht nur auf steel.shop. Auch mit<br />
Mapudo, einem Marktplatz für Stahlund<br />
NE-Metalle, kooperiert das Edelstahl-<br />
und NE-Metall-Handelsunternehmen<br />
mit Hauptsitz in Neu<br />
Wulmstorf bei Hamburg.<br />
Als einer der ersten Anbieter<br />
einer spezialisierten Shoplösung für<br />
den Stahlhandel blickt steel.shop mitt-<br />
lerweile auf eine lange Entwicklungsund<br />
Erfahrungshistorie zurück. Aus<br />
den Kinderschuhen ist die Shop-Software<br />
der Montanstahl GmbH längst<br />
herausgewachsen. Kunden, die<br />
steel.shop als individuelle Lösung<br />
einsetzen, können leistungsstarke<br />
Instrumente nutzen – unter anderem<br />
eine große Produktdatenbank mit<br />
über 400.000 normaktuellen Artikeln,<br />
inklusive Geometriedaten, Maßbezeichnungen<br />
und weiterer Daten. Das<br />
System lässt sich darüber hinaus an<br />
das eigene ERP-System anbinden. Als<br />
klassischer Webshop lässt sich<br />
steel.shop voll in das eigene Firmendesign<br />
integrieren. 2<br />
Umfassende internationale Logistikkette: Voß ist Partner für alle Langprodukt-Anforderungen in Edelstahl,<br />
Aluminium, Buntmetall und Stahlrohre.<br />
Foto: Voß Edelstahl<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
9
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
Haupsitz von Voß Edelstahlhandel in Neu Wulmstorf bei Hamburg.<br />
Foto: Voß Edelstahl<br />
q Markus Fischer: Wir reden bei<br />
Online-Bestellungen ja ohnehin von<br />
Aufträgen im kleinlosigen Bereich,<br />
die mehr oder weniger austauschbar<br />
sind und oft vor allem schnell geliefert<br />
werden sollen. Kein Großverbraucher<br />
deckt seinen Jahresbedarf<br />
online. Da müssen Menschen miteinander<br />
reden, es geht um Besonderheiten,<br />
man muss sich abstimmen.<br />
Wovon wir hier reden, ist das<br />
klassische schnelle Zukauf- bzw.<br />
Spotgeschäft – und dafür muss<br />
online alles passen.<br />
Der Vorteil von Online-Bestellungen<br />
liegt darin, Arbeit zu sparen.<br />
Wenn man davon ausgeht, dass ein<br />
großer Teil der Angebote, die an<br />
Kunden rausgehen, letztlich nicht<br />
zu einer Bestellung führen, ist das<br />
ein Thema. Wenn wir da in der<br />
Abwicklung von Klein- und Kleinstaufträgen<br />
effizienter werden können,<br />
ist das zu begrüßen.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Welche Auswirkungen<br />
hat das auf Ihren Vertrieb?<br />
Markus Fischer: Ganz klar: Es<br />
geht nicht darum, den Vertrieb zu<br />
ersetzen. Im Gegenteil. Unsere Ver-<br />
„Am Telefon kann ich als<br />
Lieferant im Verkaufs -<br />
gespräch den Preis<br />
flexibel ermitteln. Online<br />
geht das nicht. Aber<br />
auch online muss ein<br />
echter, aus der Branche<br />
kommender Kunde,<br />
sagen: das passt.“<br />
Niklas Friederichsen,<br />
Geschäftsführer Mapudo GmbH<br />
triebler haben dank der digitalen<br />
Instrumente qualifiziertere Gespräche<br />
mit Kunden. Es ist richtig, viele<br />
sehen diesen Wandel mit Sorge. Wir<br />
denken aber, dass er eine Chance<br />
dazu ist, mit Kunden intensiver ins<br />
Gespräch zu kommen und für solche<br />
Gespräche braucht es Vertriebsmitarbeiter<br />
aus Fleisch und Blut.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Was ist der Vorteil für<br />
Händler und Kunden, Mapudo zu nutzen?<br />
Niklas Friederichsen: Online zu<br />
sein, bietet an sich ja keinen Mehrwert.<br />
Jeder Anbieter muss sich überlegen,<br />
welche Kunden er online<br />
erreichen möchte und für diese Kunden<br />
das passende Paket aus Sortiment,<br />
Preisen und Anarbeitungsumfang<br />
zusammenstellen. Online<br />
einzukaufen darf für den Kunden<br />
aber auch nicht zum Nachteil werden.<br />
Wir stoßen immer wieder auf<br />
das Thema, dass ein Kunde, der<br />
offline alle gewünschten Produkte<br />
be kommt, denselben Bedarf online<br />
nicht aus einer Hand bekommt, da<br />
auf Mapudo bisher nur die lagerseitig<br />
verfügbaren Produkte zu sehen<br />
sind. Dieser Kunde hat online also<br />
einen Nachteil. Daher ist es für uns<br />
sehr wichtig, ihm auf Mapudo das<br />
zu bieten, was er auch offline<br />
gewohnt ist – nämlich alles bei einer<br />
Bestellung zu bekommen. Das ist<br />
der Mehrwert und daher ist die<br />
Kooperation mit Voß Edelstahl für<br />
uns sehr spannend.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Meine Herren, vielen<br />
Dank für das Gespräch.<br />
Kontakt<br />
Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG<br />
21629 Neu Wulmstorf<br />
www.voss-edelstahl.com<br />
Tel. 49 40 700165-0<br />
Mapudo GmbH<br />
40233 Düsseldorf<br />
www.mapudo.com<br />
Tel. +49 211 17607160<br />
Montanstahl GmbH/steel.shop<br />
59302 Oelde<br />
www.steel.shop<br />
Tel. +49 2522 9370222<br />
10 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Es ist soweit: der DigiDay 2019 startet<br />
Digitalisierung im Stahlhandel<br />
Bereits im Vorfeld ist der ausgebuchte DigiDay 2019, der erstmals die Digitalisierung im Stahlhandel<br />
als eigenständiges Thema in den Fokus, rückt, auf großes Interesse gestoßen. Nun startet die<br />
gemeinsam vom BDS und der Edelstahlhandelsvereingung ausgerichtete Fachveranstaltung am<br />
7.2. Schwerpunktmäßig geht es dabei in einer ganzen Reihe von Expertenvorträgen um Konzepte<br />
und Produkte rund um die Digitalsisierung – mit einem speziellen Fokus auf den Stahlhandel.<br />
AGENDA<br />
Aktuelle Ideen zur Digitalisierung<br />
9:00 – 9:40 Uhr Der Nutzen beim Kunden diktiert die<br />
Gesetze der Digitalisierung<br />
Ralf Niemeier, VisiTrans<br />
9:40 – 10:00 Uhr Maschinen-Verfügbarkeit steigern,<br />
Prozesskosten senken<br />
Valentin Kaltenbach, stahlbau24.online<br />
Intelligente Warenwirtschaft mit maßgeschneiderten<br />
ERP-Systemen<br />
10:00 – 10:20 Uhr „Wer sind Sie? Andy Analog oder<br />
Dietmar Digital?“<br />
Hürden des Stahlhandels meistern –<br />
digitale Zukunft im Fokus!<br />
Andreas Wanstrath, GWS<br />
10:20 – 10:40 Uhr KI/STEEL in der Praxis –<br />
Erfahrungsbericht der Seidel Stahlrohr<br />
GmbH<br />
Patrick Debus, Seidel Stahlrohr & Jan<br />
Kamps, KI Systemgefährten<br />
10:40 – 11:00 Uhr Herausforderungen im Stahlhandel –<br />
ERP und Industrie 4.0<br />
Peter Uhl, SHComputersysteme<br />
11:00 – 11:30 Uhr Pause<br />
Digitalisierung aus Sicht der Stahlhändler<br />
11:30 – 12:00 Uhr Everything is possible. YOUNITED.<br />
Kundenorientierte Digitalisierung des<br />
Salzgitter Mannesmann Stahlhandels<br />
Thomas Schöler, SalzgitterMannesmann<br />
Handel<br />
12:00 – 12:30 Uhr Digitalisierung im Stahlhandel<br />
Markus Fischer, Thorsten Studemund,<br />
Voss Edelstahlhandel<br />
12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause<br />
[ Veranstaltungsort ]<br />
Van der Valk Airporthotel Düsseldorf<br />
Am Hülserhof 57 · 40472 Düsseldorf · Tel +49 211 200630<br />
Stahldistribution: Zu Tradition kommt Moderne<br />
13:30 – 13:50 Uhr Digitale Vertriebskanäle richtig nutzen<br />
Niklas Friederichsen, Mapudo<br />
13:50 – 14:10 Uhr „Stahldistribution 4.0“, Marktplätze<br />
als Schlüssel zur Digitalisierung und<br />
Innovation<br />
Tim Milde, XOM-Materials<br />
14:10 – 14:30 Uhr DIGITALE TRANSFORMATION –<br />
Die Zukunft des Stahlverkaufs<br />
Filippo Stumm, steel.shop<br />
14:30 – 15:00 Uhr Pause<br />
Intelligente Warenwirtschaft mit maßgeschneiderten<br />
ERP-Systemen II<br />
15:00 – 15:20 Uhr ERP-Warenwirtschaftssystem<br />
UNITRADE – 100% Modulintegration<br />
für digitale Prozessabwicklung<br />
Maximilian Kleibrink, SE PADERSOFT<br />
15:20 – 15:40 Uhr Digitale Landkarte für den Stahlhandel<br />
Bernd Rech, Nissen & Velten Software<br />
15:40 – 16:00 Uhr Von der Online-Bestellung bis zum<br />
Kunden – Digitalisierung zum Anfassen<br />
Simon Pfennings, OttComputer<br />
Partner und Sponsoren des DigiDay 2019<br />
z GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH,<br />
Münster<br />
z KI GmbH, Bielefeld<br />
z Mapudo GmbH, Düsseldorf<br />
z MONTANSTAHL GmbH – steel.shop, Oelde<br />
z Nissen & Velten Software GmbH, Stockach<br />
z OttComputer GmbH, Langenfeld<br />
z SalzgitterMannesmann Handel, Düsseldorf<br />
z SE Padersoft GmbH & Co. KG, Paderborn<br />
z SHComputersysteme GmbH, Speyer<br />
z STAHLBAU24 GmbH, Berlin<br />
z VisiTrans GmbH, Obermoschel<br />
z Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf<br />
z XOM-Materials GmbH, Berlin<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
11
Stahlhandel<br />
Bericht/Nachricht<br />
XOM Materials auf dem BDS-DigiDay 2019<br />
Der Stahlhandel-Digitalisierer<br />
Die Digitalisierung im Stahlhandel steht auf dem DigiDay 2019 des Bundesverbands Deutscher<br />
Stahlhandel (BDS) und der Edelstahlhandelsvereinigung (EHV) am 7. Februar in Düsseldorf im<br />
Fokus. Als eines der treibenden Unternehmen für die Vernetzung der Branche wird das Berliner<br />
Startup XOM Materials dabei sein. Einer der drei jungen Gründer, Tim Milde, ist als COO von<br />
XOM Materials verantwortlich für Marketing und Vertrieb und bringt bereits mehr als zehn<br />
Jahre Erfahrung im Stahlhandel mit (siehe <strong>Stahlreport</strong> 5.2018).<br />
Die XOM Materials GmbH hat<br />
sich die Vision einer komplett digitalisierten<br />
und effizienteren Handelsstruktur<br />
nicht nur für die Stahlindustrie,<br />
sondern auch für den<br />
Aluminium-, Kupfer- und Kunststoffmarkt<br />
auf die Fahnen geschrieben.<br />
Kostenvorteile und Umsatzsteigerungen<br />
bieten Chancen sowohl für<br />
Hersteller wie auch Händler, Zulieferer<br />
und zwischengeschaltete Dienstleister<br />
sowie Endkunden. XOM Materials<br />
ist ein ambitioniertes, noch recht<br />
junges Unternehmen: Die Plattform<br />
ging im März 2018 live. Seither hat<br />
sie deutlich an Fahrt aufgenommen:<br />
Mehrere namhafte Unternehmen nutzen<br />
XOM Materials bereits für den<br />
digitalen Handel und vertreiben ihre<br />
Metall- und Kunststoffprodukte über<br />
die unabhängige Plattform. Wie XOM<br />
Materials die Entwicklung selbst<br />
beurteilt, welche Erfahrungen das<br />
Unternehmen im ersten Jahr gesammelt<br />
hat und in welche Richtung die<br />
Ambitionen sich nun entwickeln,<br />
darüber haben wir von <strong>Stahlreport</strong><br />
mit COO Tim Milde gesprochen:<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Herr Milde, Sie haben<br />
mit XOM Materials nun das erste<br />
Jahr hinter sich. Wie beurteilen Sie<br />
den Start Ihres Unternehmens?<br />
Tim Milde: Wir hatten uns von<br />
Anfang an viel vorgenommen und<br />
auch viel schon erreicht, worauf wir<br />
ruhig einmal stolz zurückblicken<br />
dürfen. Unser erstes Jahr war naturgemäß<br />
sehr stark davon geprägt, uns<br />
dem Markt vorzustellen. Wir haben<br />
eine komplett neue Plattform aus<br />
dem Boden gestampft, deren Ziel,<br />
als unabhängiges Portal die Industrie<br />
„Wir helfen dabei, den Handel<br />
in der Werkstoffindustrie<br />
weiter zu digitalisieren<br />
und effizienter zu gestalten.“<br />
Tim Milde,<br />
COO von XOM Materials<br />
12 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
zu digitalisieren, auch mit vielen<br />
Vertrauensvorbehalten empfangen<br />
wurde. Diese Hürde vor allem auf<br />
Händlerseite mussten wir erst einmal<br />
nehmen, doch in der Zwischenzeit<br />
haben sich wichtige Early Adopters<br />
bereits selbst ein Bild von den<br />
Funktionalitäten von XOM Materials<br />
gemacht. Und dass sie nicht einfach<br />
nur dabeigeblieben sind, sondern<br />
gemeinsam mit den Kunden für signifikante<br />
Umsätze über die Plattform<br />
allein in diesem ersten Jahr gesorgt<br />
haben, zeigt, dass wir auf dem richtigen<br />
Weg sind. Wir sind inzwischen<br />
an den Standorten Berlin und Duisburg<br />
in Deutschland sowie in<br />
Atlanta, USA, vor Ort und haben strategische<br />
Partner und Kunden überall<br />
auf der Welt gewonnen.<br />
Was waren denn Ihre Highlights im<br />
ersten Jahr und was Ihre bedeutendsten<br />
Lektionen?<br />
Wir sind mit einigen Vorannahmen<br />
in den Stahl- und Werkstoffmarkt<br />
gestartet. Mit einigen davon lagen wir<br />
richtig, mit anderen nicht. Wir haben<br />
uns jedoch immer umgehend den<br />
Erfahrungen angepasst und legen nun<br />
noch mehr Wert auf den Auf- und Ausbau<br />
einer vertrauensvollen und engen<br />
Kundenbindung. Auf diese Weise<br />
konnten wir auch die Features unserer<br />
Plattform besser an den tatsächlichen<br />
Bedürfnissen der Kunden entlang entwickeln<br />
und feintunen. Mit diesem<br />
Wissen und dem Feedback unserer<br />
Kunden entsteht in diesem Prozess<br />
ein passgenaues Produkt. Bei allem<br />
was wir tun, ist die enge Kundenorientierung<br />
die für uns wichtigste Aufgabe<br />
und Maxime.<br />
Wie reagiert denn die Industrie auf<br />
den Launch von XOM Materials?<br />
Viele Unternehmen, die wir anfänglich<br />
angesprochen hatten, waren der<br />
neuen Idee gegenüber etwas zurückhaltend<br />
und reagierten mit einer großen<br />
Portion Skepsis. Nichtsdestotrotz<br />
haben wir wie erwähnt die<br />
ersten Anwender überzeugen können,<br />
darunter wichtige Marktteilnehmer<br />
auf der Hersteller- und<br />
Händlerseite, so dass sich nun langsam<br />
die öffentliche Wahrnehmung<br />
spürbar zu drehen beginnt. Durch<br />
die konstante Verbesserung und<br />
Erweiterung unserer Plattform erhalten<br />
wir mehr und mehr positives<br />
Feedback und das Interesse wird<br />
auch künftig noch weiter zunehmen.<br />
Was dürfen wir in der näheren Zukunft<br />
von XOM Materials erwarten?<br />
Wir haben viele Pläne für die Zukunft,<br />
was sowohl die Erweiterung der Features<br />
von XOM Materials als auch der<br />
Märkte und Marktteilnehmer angeht.<br />
Als nächstes planen wir die Implementierung<br />
von ergänzenden Offline-<br />
Prozessen entlang unserer Online-<br />
Lösungen, vor allem in Bezug auf die<br />
Konfigurierung der Produkte und die<br />
tatsächliche Transaktion des Bestellvorgangs<br />
inklusive logistischer<br />
Aspekte. Und damit sind wir mit unseren<br />
Ideen noch lange nicht am Ende.<br />
Durch den engen Austausch mit unseren<br />
Kunden, also Herstellern, Händlern,<br />
Lieferanten, Käufern und Drittdienstleistern,<br />
passen wir uns immer<br />
weiter den bislang ungenügend erfüllten<br />
Bedürfnissen des Marktes an und<br />
helfen somit, den Handel in der Werkstoffindustrie<br />
weiter zu digitalisieren<br />
und effizienter zu gestalten.<br />
Wir danken für das Gespräch,<br />
Herr Milde!<br />
Lingemann Stahlgroßhandel und Stahlkontor werden Teil der EHG-Gruppe<br />
Ostwestfälische Stahlhändler übernommen<br />
Die EHG Stahlzentrum GmbH & Co<br />
OG mit Sitz in Dornbirn (Österreich) hat die<br />
Lingemann Stahlgroßhandel GmbH und die<br />
Stahlkontor GmbH übernommen und die<br />
Unternehmen in die europaweit tätige EHG-<br />
Gruppe eingegliedert. Im Rahmen einer langfristig<br />
angelegten Unternehmernachfolge hat<br />
der bisherige Alleingesellschafter Lorenz Lingemann<br />
alle Anteile seiner in vierter Familiengeneration<br />
geführten Unternehmen an die<br />
EHG Stahlzentrum GmbH & Co OG übertragen.<br />
EHG ist ein europäischer Anbieter für stahlund<br />
metallverarbeitende Unternehmen aus<br />
Gewerbe, Industrie, Handwerk und Handel<br />
und beschäftigt an neun Standorten in<br />
Deutschland, Österreich, der Schweiz und<br />
Rumänien heute rund 300 Mitarbeitende.<br />
Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die EHG<br />
einen konsolidierten Gruppenumsatz von<br />
165 Mio. €.<br />
„Mit dem Verkauf an die EHG hat Herr Lingemann<br />
die langfristige Zukunft der Lingemann<br />
Stahlgroßhandel GmbH und der Stahlkontor<br />
GmbH gesichert“, sagte Detlef<br />
Schwer, Geschäftsführer am Standort Bad<br />
Oeynhausen. „Wir können nun zudem ein<br />
noch breiteres Materialangebot und noch<br />
umfangreichere Dienstleistungen in Logistik<br />
und Anarbeitung anbieten – ganz getreu<br />
unserem Motto: Alles aus einer Hand.“<br />
„Die beiden Unternehmen passen mit ihrem<br />
Leistungsangebot hervorragend zu uns«,<br />
begründen Dr. Markus Lutz und Stefan<br />
Girardi, Geschäftsführer der EHG Stahlzentrum<br />
GmbH & Co OG, ihre Entscheidung.<br />
„Mit ihrer Kompetenz im Rohrlaserschneiden<br />
gewinnen wir auch eine neue Anarbeitungstechnologie<br />
für unsere Gruppe, weiten unser<br />
Marktgebiet in Zentraleuropa aus und sind<br />
damit noch näher bei unseren Kunden. Wir<br />
freuen uns sehr, die erfahrenen Kolleginnen<br />
und Kollegen bei uns begrüßen zu dürfen.“<br />
Die Lingemann Stahlgroßhandel GmbH vermarktet<br />
Rohre, Walzstahl und Flachprodukte<br />
in diversen Handelsgüten und deren Bearbeitung.<br />
Am Standort Bad Oeynhausen beschäftigt<br />
das Unternehmen 38 Mitarbeitende. Die<br />
Stahlkontor GmbH ist spezialisiert auf den<br />
Handel von Qualitätsstahl, Blankstahl und<br />
Edelstahl. Am Standort Bad Oeynhausen sind<br />
30 Mitarbeitende beschäftigt.<br />
Beide Unternehmen erwirtschafteten im<br />
Geschäftsjahr 2018 einen konsolidierten<br />
Umsatz von 30 Mio. €.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
13
Stahlhandel<br />
Bericht/Nachricht<br />
Bild: Mechel<br />
Über sein Lager in Antwerpen bietet der russische Produzent Mechel ein Stahlprofil-Sortiment mit 15 Produkten für den europäischen Markt an.<br />
Walzprofile aus Antwerpener Lager<br />
Mechel positioniert sich<br />
Einmal mehr ist Antwerpen Dreh- und Angelpunkt für Stahllieferungen in die europäischen<br />
Länder: Über sein Lager in der belgischen Hafenstadt bietet der russische Stahlproduzent<br />
Mechel OAO sein Sortiment an Stahlprofilen auf dem europäischen Markt an. Die Profile<br />
entsprechen der europäischen Norm DIN EN 10025-2 und sind vom TÜV Rheinland gemäß der<br />
EU-Bauproduktenverordnung und der EU-Druckgeräterichtlinie zertifiziert. Sie tragen das<br />
CE-Siegel und dürfen auf dem europäischen Markt vertrieben werden.<br />
[ Kontakt ]<br />
Mechel Service<br />
Belgium BVBA<br />
Generaal<br />
Lemanstraat 27<br />
2018 Antwerpen<br />
Belgien<br />
www.mechel.com<br />
info.msbelgium@<br />
mechel.com<br />
Das Mechel-Sortiment für die<br />
europäische Baubranche umfasst 15<br />
verschiedene Stahlprofile mit einer<br />
Länge von 12 m aus den Stahlsorten<br />
S235JR und S355JR. Die hohe Qualität<br />
der Profile habe bereits mehr<br />
als 90 Kunden in Belgien, Deutschland,<br />
Österreich, Tschechien, Serbien,<br />
Litauen sowie Lettland überzeugt,<br />
so das Unternehmen.<br />
Die Walzprofile werden von der<br />
Chelyabinsk Metallurgical Plant produziert,<br />
einem der größten russischen<br />
Werke mit vollem metallurgischem<br />
Zyklus zur Herstellung von<br />
Qualitätsstahl und Edelstahl. 2013<br />
wurde in dem Werk ein neues Schie-<br />
nen- und Trägerwalzwerk in Betrieb<br />
genommen. Das neue Walzwerk ist<br />
dem Unternehmen nach die erste<br />
komplexe und universelle Fertigungsanlage<br />
für qualitativ hochwertige<br />
Walzprofile mit einer Länge von<br />
12,5 bis 100 m. Die Kapazität der<br />
Anlage beträgt bis zu 1,1 Mio. t pro<br />
Jahr. Das Werk produziert mehr als<br />
50 verschiedene Walzprofilarten<br />
nach russischen Standards, 15 Profile<br />
nach EU-Standards und vier<br />
Schienenarten. An der Erweiterung<br />
des Sortiments werde ständig gearbeitet,<br />
im Laufe des Jahres 2019<br />
könne man ein noch größeres Spektrum<br />
an Stahlprofilen auf dem westeuropäischen<br />
Markt anbieten. Im<br />
vergangenen Jahr hat Mechel auf<br />
der Messe InnoTrans in Berlin gehärtete<br />
und ungehärtete Schienen von<br />
100 m Länge vorgestellt.<br />
Über zehn Jahre in<br />
Westeuropa aktiv<br />
Mechel Service Belgium BVBA mit<br />
Hauptsitz in der belgischen Stadt<br />
Antwerpen vertreibt Produkte der<br />
Mechel-Holding (unter anderem der<br />
Werke Izhstal, Urals Stamping Plant,<br />
Chelyabinsk Metallurgical Plant)<br />
bereits seit mehr als zehn Jahren<br />
auf dem westeuropäischen Markt.<br />
Die Vertriebseinheit hat sich auf den<br />
14 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Mechel Service Belgium hat sich auf den Verkauf von Profilstahl aus Kohlenstoffstahl<br />
und Spezialstahl sowie von geschmiedeten Stahlprofilen und Walzprofilen spezialisiert.<br />
Verkauf von Profilstahl aus Kohlenstoffstahl<br />
und Spezialstahl sowie von<br />
geschmiedeten Stahlprofilen und<br />
Walzprofilen spezialisiert. Die Produkte<br />
werden in 24 Ländern der EU<br />
sowie im Nahen Osten, den USA und<br />
Japan vertrieben.<br />
Mechel OAO, gegründet im Jahr<br />
2003, ist einer der Weltmarktführer<br />
der Bergbau- und Metallurgiebranche.<br />
Zu dem Unternehmen gehören<br />
Produktionsbetriebe in elf Gebieten<br />
Russlands. Darunter befinden sich<br />
Kohle-, Erz-, Stahl-, Walzgut-, Ferrolegierungs-,<br />
Wärme- und Stromproduzenten.<br />
All diese Betriebe<br />
gehören zu einer Produktionskette:<br />
von der Rohstoffgewinnung bis hin<br />
zu Erzeugnissen mit hoher Wertschöpfung.<br />
Zur Holding zählen<br />
ebenfalls drei Handelshäfen, eigene<br />
Mechel-Lieferspektrum<br />
„Walzprofile“<br />
HEA180/200/220/240/300<br />
HEB180/200/220/240/300<br />
IPE 160/180/220/240/300<br />
Logistikunternehmen sowie Vertriebs-<br />
und Servicenetze. Mechel-<br />
Produkte werden sowohl auf dem<br />
russischen Markt als auch international<br />
vertrieben. Die Metallholding<br />
Mechel verfügt über mehr als 80<br />
Unterabteilungen sowie 18 Servicecenter.<br />
Ebenfalls zu Mechel gehört<br />
das russische Unternehmen Mechel<br />
Service OOO, ein Tochterunternehmen<br />
der Holding, das in den GUS-<br />
Staaten sowie West- und Osteuropa<br />
mit Untereinheiten aktiv ist. 2<br />
BESUCHEN SIE UNS<br />
LOGIMAT | 19. – 21. Februar | Stuttgart<br />
Halle 1 / Stand C40<br />
Aus Ideen<br />
werden<br />
Lösungen<br />
Rittal-Magazin betop<br />
kostenlos als Webmagazin<br />
Das Unternehmensmagazin der Friedhelm Loh-<br />
Group gibt es ab sofort auch als Webmagazin für<br />
mobiles Lesen mit exklusiven Zusatzinhalten.<br />
Anhand des Vorbilds „Wald“ als vernetztes System<br />
beleuchtet die aktuelle Ausgabe die Vernetzung<br />
von Akteuren, Prozessen und Informationen<br />
in industriellen Zusammenhängen. In dem Magazin<br />
sind immer wieder auch Beiträge über das<br />
Stahl-Service-Center der Friedhelm Loh-Group,<br />
Stahlo Stahlservice GmbH & Co. KG enthalten.<br />
[ Info ]<br />
____ fehr ist führend in Lagerlogistik.<br />
Seit 1968 sind wir auf hochqualitative<br />
und hocheffiziente Lagerlösungen<br />
spezialisiert. Mit typisch Schweizer<br />
Know-how, Präzision und Weltoffen heit<br />
entwickeln wir innovative Logistikkonzepte.<br />
Modernste Technik und<br />
durchgängige Lager- und Handlingskonzepte<br />
sichern den perfekten<br />
Materialfluss von der Einlagerung bis<br />
zum Abtransport, vom Produzenten<br />
bis zum Verbraucher. Was können wir<br />
für Sie tun?<br />
Link zum Magazin: https://betop.friedhelm-loh-group.de<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
15<br />
Fehr Lagerlogistik AG<br />
In der Au 5, CH-8406 Winterthur<br />
T +41 (0) 52 260 56 56<br />
info@fehr.net<br />
www.fehr.net
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
thyssenkrupp Materials Processing Europe –<br />
Werkstoff-Kompetenz für die Automobilindustrie<br />
Stahlservice – technische<br />
Kundenberatung wird wichtiger<br />
Die zunehmende Variantenvielfalt ist eines der kennzeichnendsten Merkmale gegenwärtiger<br />
Industrieproduktion. Die Fertigungsprozesse werden mit wachsender Vielfalt<br />
komplexer, erfordern mehr Planung und Kontrolle und einen höheren Bedarf an<br />
spezifischem Know-how. Ein prädestinierter Partner für die Verarbeitung von Stahl<br />
sind die Stahl-Service-Center, hat die thyssenkrupp Materials Processing Europe<br />
GmbH erkannt. Dazu hat das Unternehmen schon länger eine technische eine<br />
technische Kundenberatung installiert – und diese in den letzten Jahren verstärkt<br />
ausgebaut. Das kommt Kunden in der Automobilindustrie entgegen.<br />
Bild: thyssenkrupp<br />
Marcus Wöhl, CEO thyssenkrupp<br />
Materials Processing Europe<br />
Insbesondere im Automobilbau<br />
mit seinen hohen Qualitätsanforderungen<br />
ist die Beherrschung auch sehr<br />
komplexer Prozesse entscheidend.<br />
Unregelmäßigkeiten in der Produktion<br />
sind gerade in dieser Branche sehr<br />
teuer. Dabei sind die Herausforderungen<br />
für die Automobilhersteller derzeit<br />
anspruchsvoll.<br />
Die Branche ist im Wandel: Nicht<br />
nur die steigende Variantenvielfalt verändert<br />
die Produktion. Auch das CO 2<br />
-<br />
Thema treibt die Produzenten um. Um<br />
die vorgeschriebenen Grenzwerte bei<br />
den Emissionen zu erreichen, sollen<br />
die Fahrzeuge leichter werden. Dazu<br />
sind entsprechende Werkstoffe notwendig<br />
– wie die hochfesten Stähle,<br />
auf deren Entwicklung viele Stahlhersteller<br />
sich konzentriert haben. Gleichzeitig<br />
sollen die Fahrzeuge komfortabler<br />
und sicherer werden – was sie tendenziell<br />
aber wieder schwerer macht. Ein<br />
weiterer Punkt mit noch nicht absehbaren<br />
Auswirkungen für die Branche<br />
ist die Elektromobilität.<br />
Werkstoff-Kompetenz gefragt<br />
Eine Folge dieser Entwicklungen ist,<br />
dass OEMs wie Zulieferer vermehrt auf<br />
ihre Werkstoff-Lieferanten zugehen<br />
und Unterstützung bei technischen<br />
Detailfragen suchen. Dem ist thyssenkrupp<br />
Materials Processing Europe entgegengekommen<br />
und hat einen technischen<br />
Vertrieb installiert. Der Ansatz<br />
ist einfach: „Je mehr Fehler wir bei<br />
einem Projekt in Zusammenarbeit mit<br />
einem Kunden von Anfang an vermeiden,<br />
desto weniger Kosten enstehen in<br />
den nachgeschalteten Prozessen“,<br />
erklärt Marcus Wöhl, CEO bei thyssenkrupp<br />
Materials Processing Europe.<br />
Technische Kundenberatung und<br />
Vertrieb der werksunabhängigen Unternehmensgruppe<br />
arbeiten bei Kundenprojekten<br />
eng verzahnt, um sowohl<br />
technisch wie kaufmännisch bestmögliche<br />
Ergebnisse zu erreichen. Ein Beispiel:<br />
Mit dem Know-how seiner Werkstoffspezialisten<br />
kann thyssenkrupp<br />
Materials Processing Europe die Standzeiten<br />
der Pressen in den Werken oft<br />
verbessern. Da Standzeiten gerade in<br />
der Automobilproduktion sehr teuer<br />
sind, besteht daran großes Interesse.<br />
„Wir können den eingesetzten<br />
Werkstoff anhand von Gefüge und<br />
Dickentoleranz modifizieren und optimieren“,<br />
erläutert Hans-Ernst Steczka,<br />
Technischer Kundenberater bei thyssenkrupp<br />
Materials Processing Europe.<br />
„Wir ändern möglichweise die Haspeltemperatur<br />
oder beeinflussen vielleicht<br />
„Wir stellen ja nicht<br />
nur Material in den<br />
Wareneingang unserer<br />
Kunden. Wir sind ein<br />
Entwicklungspartner.“<br />
Gökhan Gula,<br />
Technischer Kunden berater,<br />
Projektingenieur thyssenkrupp Materials<br />
Processing Europe GmbH<br />
nochmal den Rekristallisationsprozess<br />
und haben viele weitere Parameter im<br />
Blick“, sagt sein Kollege Gökhan Gula,<br />
Technischer Kundenberater und Projektingenier<br />
bei thyssenkrupp Materials<br />
Processing Europe.<br />
Normativ wird dabei an den Prozessen<br />
nichts geändert, alle Justierungen<br />
bleiben innerhalb der einmal festgelegten<br />
Parameter, die Stahlgüte wird<br />
nicht gewechselt. Das ginge bei den<br />
auf sehr hohe Ansprüche ausgelegten<br />
und daher äußerst restriktiven Qualitätssicherungssystemen<br />
der Automobilproduzenten<br />
auch gar nicht.<br />
Auch Verarbeitungsschritte<br />
im Blick<br />
Dabei wird nicht nur auf die Projektphase<br />
selbst geschaut. Auch die folgenden<br />
Verarbeitungsschritte haben die<br />
Werkstoffexperten des Stahlspezialisten<br />
im Blick, um gegebenenfalls korrigierend<br />
einzugreifen. „Diese Feinjustierung<br />
macht unsere Kompetenz aus<br />
und da glauben wir, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal<br />
haben“, betont Hans-<br />
Ernst Steczka.<br />
Je mehr Fehler am Anfang vermieden<br />
werden, desto weniger Kosten entstehen<br />
im Laufe der Fertigung – das<br />
leuchtet ein. Und wie nehmen Kunden<br />
die technische Kundenberatung an?<br />
„Wenn Sie über die Jahre immer wieder<br />
zu Gesprächen eingeladen werden,<br />
haben Sie vermutlich nicht alles ganz<br />
falsch gemacht“, schmunzelt der technische<br />
Kundenberater. 2<br />
16 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
StaR<br />
Stahlrohrhandelsgesellschaft mbH<br />
das Unternehmen<br />
- kompetente Mitarbeiter<br />
- 40 Jahre Markterfahrung<br />
für uns<br />
selbstverständlich!<br />
- 10.000 Tonnen Bestand an Stahlrohren<br />
Machen Sie sich unsere Stärken zu Ihrem Vorteil !<br />
Ihr StaRo-Team<br />
Faire Preise und korrekte Abwicklung •<br />
unser Lieferprogramm<br />
Nahtlose Stahlrohre<br />
in allen gängigen EN, ASTM und API-Normen<br />
• aus Material S355J2H, S235JRH, S235J2H<br />
• Abmessungsbereich von 10,2 - 660 mm<br />
Wandstärke 2 - 100 mm<br />
APZ EN 10204 / 3.1.b<br />
Geschweißte Stahlrohre<br />
in allen gängigen EN, ASTM und API-Normen<br />
von 17,2 bis 1620 mm<br />
längs- oder spiralnahtgeschweißt<br />
• aus Material S355J2H, S235JRH<br />
• Abmessungsbereich von 17,2 - 1620 mm<br />
Wandstärke 2 - 50 mm<br />
APZ EN 10204 / 3.1.b<br />
StaRo<br />
Niederlassung<br />
Stahlrohrhandelsgesellschaft<br />
Hamburg<br />
mbH<br />
Tel.: +49 40 30 20 20 6-0<br />
Merkurring 33-35<br />
Fax: +49 40 30 20 20 6-21<br />
D-22143 Hamburg - Germany<br />
e-mail: hamburg@staro-gmbh.de<br />
Stahlbauhohlprofile<br />
warm- und kaltgefertigt<br />
in allen gängigen EN, ASTM und API-Normen<br />
• aus Material S355J2H, S235JRH, S235J2H<br />
• Abmessungsbereich von 40 - 500 mm<br />
Wandstärke 2,9 - 25 mm<br />
APZ EN 10204 / 3.1.b<br />
Präzisions-Stahlrohre<br />
nahtlos und geschweißt<br />
in allen gängigen EN, ASTM und API-Normen<br />
Abmessungsbereich von 4 mm - 210 mm<br />
alle bekannten Güten<br />
Auf Anfrage erhalten Sie bearbeitete Rohre<br />
• als Zuschnitte<br />
• mit PE-Ummantelung<br />
• gestrahlt und geprimert<br />
Eine Liste aller lieferbaren Maße/Gewichte erhalten Sie auf Anfrage.<br />
www.staro-gmbh.de<br />
www.staro-gmbh.de<br />
Niederlassung Eicklingen<br />
Schmiedekamp 38<br />
29358 Eicklingen<br />
Tel.: +49 5149 98 76 1-0<br />
Fax: +49 5149 98 76 1-20<br />
e-mail: info@staro-gmbh.de<br />
Tel.: +49(0)40<br />
Niederlassung<br />
30 20 206-0<br />
Eicklingen<br />
Tel.: +49 5149 98 76 1-0<br />
Fax: +49(0)40 30 20 206-20<br />
Fax: +49 5149 98 76 1-20<br />
eMail: hamburg@staro-gmbh.de<br />
e-mail: info@staro-gmbh.de
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
Fraunhofer Studie zu Indstrie 4.0 im Stahl- und Metallhandel<br />
Nachholbedarf bei der Digitalisierung<br />
Den aktuellen Stand und künftige Bedarfe von Digitalisierungslösungen im Stahl- und Metallhandel<br />
hat eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA)<br />
untersucht. Dazu haben die Stuttgarter Forscher über 60 Unternehmen aus dem Metallhandelsumfeld<br />
sowie weitere Experten befragt. Demnach wird die Digitalisierung klar als Werkzeug zur Bewältigung<br />
aktueller und künftiger Herausforderungen gesehen, konkrete Lösungen fehlten aber noch<br />
weitgehend oder würden nicht genutzt.<br />
Industrie 4.0-Konzepte und<br />
Lösungen sind in den verschiedenen<br />
Industrie-Branchen unterschiedlich<br />
stark verbreitet. Besonders der<br />
Metall- und Stahlhandel hinkt dem<br />
Fortschritt hinterher, so die Studie<br />
des Fraunhofer IPA. So<br />
gaben fast 80 % der Studienteilnehmer<br />
an, keine<br />
Erfahrung mit Industrie<br />
4.0-Anwendungen zu<br />
haben. Dies zeige sich<br />
deutlich im Umgang mit<br />
Steuer- und Prozessdaten:<br />
Sowohl die Erfassung<br />
als auch die Speicherung<br />
erfolgt demnach<br />
zum größten Teil nicht digital, sondern<br />
in Papierform oder lokal in der<br />
Maschinensteuerung – ohne Möglichkeiten<br />
eines Datenzugriffs von<br />
außerhalb.<br />
Fokus auf internen Projekten<br />
Die bereits umgesetzten Industrie<br />
4.0-Anwendungen befassen sich der<br />
Befragung zufolge schwerpunktmä-<br />
„Nicht alles bei ,Industrie 4.0‘ ist ein<br />
Allheilmittel, aber es gibt für jedes<br />
Unternehmen Optimierungspotenziale,<br />
die mit der Digitalisierung<br />
abgeschöpft werden können.“<br />
ßig mit der Datenerfassung und der<br />
Vernetzung im Unternehmen selbst,<br />
wobei der größte Zuwachs zukünftig<br />
bei Applikationen für die Prozessüberwachung<br />
gesehen werde.<br />
Bereits in anderen Branchen verfügbare<br />
Industrie 4.0-Anwendungen<br />
decken sich zwar zum größten Teil<br />
mit den Anforderungen des Stahlund<br />
Metallhandels, werden bisher<br />
aber – wenn überhaupt – nur in<br />
geringer Ausprägung genutzt.<br />
Die Studie zur Digitalisierung<br />
im Metallhandel des Fraunhofer IPA<br />
zeigt, dass Industrie 4.0-Ansätze von<br />
der Branche zwar als adäquates Mit-<br />
tel gesehen wird, um bestehende<br />
wie künftige Herausforderungen zu<br />
bewältigen, gleichzeitig aber im<br />
Gesamten noch wenig Erfahrung mit<br />
der eigenen Digitalisierung gemacht<br />
wurde. Aber es sei ein deutlicher<br />
Wandel erkennbar, resümmiert<br />
die Studie. So geht die<br />
Branche selbst davon aus,<br />
zukünftig verstärkt Teil<br />
einer digitalisierten Fertigungskette<br />
zu werden.<br />
Einige Fragen zur Studie<br />
hat dem <strong>Stahlreport</strong> M.Sc.<br />
Ing. Florian Schumpp, Fachthemenleiter<br />
Anarbeitung<br />
am Fraunhofer IPA, beantwortet.<br />
<strong>Stahlreport</strong>: Was soll die Studie aus<br />
Ihrer Sicht leisten?<br />
Florian Schumpp: Die erarbeitete<br />
Studie soll einen Überblick zum<br />
aktuellen Stand und der Entwicklungstendenz<br />
der Branche zu Industrie<br />
4.0, Digitalisierung und der Nutzung<br />
von Prozessdaten geben und<br />
18 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Florian Schumpp,<br />
Fachthemenleiter<br />
Anarbeitung im<br />
Fraunhofer IPA<br />
„Wenn Unternehmen anhand gelungener<br />
Referenzanwendungen ein konkreter<br />
Nutzen dargestellt werden kann, steigen<br />
die Akzeptanz und damit auch der Anteil<br />
an Digitalisierungsbefürwortern.“<br />
Bildquelle: Fraunhofer IPA<br />
damit die Möglichkeit schaffen, dass<br />
sich Unternehmen selbst ein Bild<br />
machen können, ob und wenn ja wie<br />
die Digitalisierung für sie künftig<br />
zum Thema wird oder weitere<br />
Schritte der Digitalisierung aussehen<br />
können. Die Studie dient sozusagen<br />
als Motivator, sich mit dem Thema<br />
auseinanderzusetzen.<br />
Ein Ergebnis ist, dass der Stahl- und<br />
Metallhandel bei der Digitalisierung<br />
hinten an ist. Was können Stahlhandelsunternehmen<br />
aus Ihrer Sicht<br />
tun, um aufzuholen?<br />
Wichtig ist, dass die Unternehmen<br />
keine Berührungsängste zeigen, und<br />
sich – auch wenn sie bisher ausschließlich<br />
„analog“ arbeiten – offen<br />
und ohne Ressentiments mit der<br />
Digitalisierung auseinandersetzen.<br />
Nicht alles bei „Industrie 4.0“ ist ein<br />
Allheilmittel, aber es gibt für jedes<br />
Unternehmen Optimierungspotenziale,<br />
die mit der Digitalisierung<br />
abgeschöpft werden können.<br />
Bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten<br />
ist gerade bei<br />
wenig Erfahrung darauf zu achten,<br />
die Schrittweite überschaubar zu<br />
halten – z.B. über kleine Pilotprojekte<br />
mit unmittelbar erkennbarem Nutzen<br />
und niedrigem Budget. Denkbar<br />
ist für Stahl- und Metallhandelsunternehmen<br />
etwa die Implementierung<br />
einer Prozessüberwachung<br />
einer Maschine als Einstieg. Der zeitliche<br />
und personelle Aufwand sind<br />
gering, man kann damit Erfahrungen<br />
sammeln und diese für weitere Digitalisierung<br />
im Unternehmen nutzen.<br />
Ziehen Sie als Forschungsinstitut,<br />
das sich mit seinen Projekten zum<br />
Teil an diese Branche wendet, eigene<br />
Schlüsse aus der Studie – etwa bei<br />
der Ausrichtung künftiger Projekte?<br />
Am Fraunhofer IPA besteht seit dem<br />
letzten Jahr eine neue Organisationsstruktur,<br />
welche die Kompetenzen<br />
des Instituts in Themenbereiche<br />
rund um die Produktionstechnik und<br />
Automatisierung bündelt. Zudem<br />
werden in einem neuen Zentrum für<br />
Cyberphysische Systeme Grundlagen<br />
im Bereich der Digitalisierung und<br />
entsprechende Umsetzungen erarbeitet.<br />
Damit werden bereits viele<br />
der aktuellen und künftigen Themen,<br />
welche auch die Stahl- und Metallhandelsbrache<br />
betreffen, adressiert<br />
und in bedarfsgerechte und praxistaugliche<br />
Lösungen für Kleine und<br />
Mittlere Unternehmen überführt.<br />
Ein aktuelles Projekt, gefördert<br />
durch das Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung, befasst sich<br />
mit der Entwicklung einer digitalen<br />
Kollaborationsplattform für die an<br />
der Anarbeitung beteiligten Unternehmen<br />
im Stahl- und Metallhandel.<br />
Das Projekt versteht sich als Schrittmacherprojekt<br />
und nimmt bereits<br />
einige Aspekte der Studie wie Assistenzsysteme,<br />
Prozessüberwachung<br />
von Maschinen und digitale Verknüpfung<br />
zwischen Produktionspartnern<br />
mit auf.<br />
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist,<br />
dass nur etwa 60 % aller befragten<br />
Unternehmen überhaupt Industrie 4.0-<br />
Anwendungen umsetzen möchten.<br />
Was steckt aus Ihrer Sicht hinter diesem<br />
Wert?<br />
Die Teilnehmer der Studie, wie unserer<br />
Kenntnis nach übrigens auch die<br />
gesamte Branche des Stahl- und Metallhandels,<br />
setzen sich zu über 80 % aus<br />
kleinst-, klein- und mittelständischen<br />
Unternehmen zusammen, die häufig<br />
sehr konservativ geprägt sind. Es wird<br />
auf Bewährtes gesetzt und es herrscht<br />
ein sehr großer Sicherheitsgedanke,<br />
der im Sinne der Unternehmensverantwortung<br />
natürlich berechtigt ist.<br />
Skepsis gegenüber der Digitalisierung<br />
von Unternehmens- und<br />
Produktionsprozessen herrscht vermutlich<br />
auf Grund nur weniger Referenzen<br />
für gelungene Einführungen<br />
– speziell für KMU. Dadurch sind<br />
den Unternehmen offensichtlich die<br />
monetären Mehrwerte und organisatorischen<br />
Potenziale, die in Digitalisierungslösungen<br />
schlummern,<br />
nicht deutlich genug. Wenn diesen<br />
Unternehmen ein konkreter eigener<br />
Nutzen dargestellt werden kann, beispielsweise<br />
durch gelungene Digitalisierungslösungen<br />
anhand Referenzanwendungen,<br />
steigen die Akzeptanz<br />
und damit auch der Anteil an Digitalisierungsbefürwortern.<br />
2<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
19
Stahlverarbeitung<br />
Bericht<br />
Die „Red Line“ in Bangkok wird in Hochlage<br />
auf 22 m hohen Viadukten geführt. Jede<br />
Fahrtrichtung hat ein eigenes Viadukt mit je<br />
zwei Fahrspuren.<br />
Maurer liefert langlebige und wartungsfreie Lager in tropisches Klima<br />
4.700 Eisenbahnbrückenlager für Bangkok<br />
Bangkok baut sein Nahverkehrsnetz aus: Die komplett neue „Red Line“ wird als Hochbahn<br />
verlaufen. Das Münchener Stahlbauunternehmen MAURER SE lieferte dafür exakt 4.712 Kalottenlager.<br />
In Thailand werden damit erstmals langlebige und wartungsfreie Lager aus den Gleitmaterialien<br />
MSM® und MSA® eingesetzt.<br />
Die neue „Red Line“ – der Name leitet sich aus<br />
dem Farbcode des dortigen Nahverkehrssystems ab –<br />
ist Teil eines Masterplans der Regierung, die ÖPNV-<br />
Kapazitäten in der Metropolregion zu erhöhen. Sie verläuft<br />
vom ebenfalls im Bau befindlichen neuen Hauptbahnhof<br />
„Bang Sue Grand Station“ in den Norden und<br />
in den Westen der Millionenmetropole.<br />
Der nördliche Streckenabschnitt hat neun Stationen,<br />
ist knapp 22 km lang und verläuft durchgehend als<br />
Hochbahn. In jede Fahrtrichtung verlaufen getrennte<br />
Gleise, getragen von 22 m hohen Viadukten. Insgesamt<br />
reihen sich so pro Richtung 589 Einfeldträger mit durchschnittlich<br />
36 m Spannweite aneinander.<br />
Neue Technologie für die neue Bahn<br />
In Thailand werden für Eisenbahnbrücken traditionell<br />
Elastomer- oder Topflager eingesetzt. Doch Elastomerlager<br />
haben den Nachteil der Einfederung durch Verkehrslasten,<br />
Topflager dagegen nur eine geringe<br />
Lebensdauer, zudem erlauben sie nur eingeschränkte<br />
Funktionskontrollen. „Wir konnten den Bauherrn SRT<br />
(State Railway of Thailand) davon überzeugen, dass<br />
Kalottenlager mit MSM- und MSA-Technologie die<br />
zeitgemäße Lösung für die neue Bahnlinie sind“,<br />
erklärte Georg M. Wolff, CEO der Civil Engineering<br />
Solutions (Thailand). „Die Lager ermöglichen eine<br />
wartungs- und verschleißarme Lastabtragung und<br />
Bewegung.“<br />
Große Menge Lager in hoher Qualität<br />
Hintergrund sind die Materialeigenschaften der eingesetzten<br />
Werkstoffe: Der Gleitwerkstoff MSM (Maurer<br />
Sliding Material) nimmt hohe Lasten auf und trägt sie<br />
ab, auch in Kombination mit hohen akkumulierten Gleitwegen<br />
und Temperaturen. Die Kalotten bestehen aus<br />
MSA (Maurer Sliding Alloy), einer Metall-Gleitlegierung,<br />
die auch bei tropischem Klima oder mariner Umgebung<br />
nicht korrodiert. Miteinander garantierten MSM und<br />
MSA eine einzigartig lange Lebensdauer der Brückenlager,<br />
so das Unternehmen.<br />
20 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Stahl ∙ Edelstahl ∙ Anschlagrohre ∙ Bauelemente<br />
100 % Leistung<br />
bis zum Anschlag!<br />
Die Einfeldträger liegen auf je vier Lagern.<br />
Im Bild ein längsbewegliches Führungslager für eine Auflast von bis zu 6 MN.<br />
Fotos: Maurer<br />
Jeder Einfeldträger liegt auf vier<br />
Lagern: einem allseitig beweglichen<br />
Lager, einem querbeweglichen und<br />
einem längsbeweglichen Führungslager<br />
sowie einem Festlager. Sie tragen<br />
Auflasten zwischen 3.579 und<br />
8.715 kN und haben einen Durchmesser<br />
von bis zu 700 mm. Sie leiten<br />
das Gewicht der Tragwerke und die<br />
Verkehrslasten zwängungsfrei in die<br />
Pfeiler und erlauben die klimabedingten<br />
Längenänderungen der Viadukte.<br />
Die Herausforderung sei gewesen,<br />
die große Menge von 4.712<br />
Das Stahlbauunternehmen Maurer SE<br />
Kalottenlagern in hoher Qualität<br />
günstig und termingerecht zu liefern.<br />
Hier habe Maurer seine Erfahrung<br />
als weltweiter Lieferant für Großprojekte<br />
ausspielen können. Gefertigt<br />
wurden die Lager 2015/16 in<br />
Bhopal bei Maurer India. Die MSA-<br />
Kalotten und MSM-Gleitplatten wurden<br />
aus München geliefert.<br />
Der Einbau erfolgt durch den<br />
Kunden Italian-Thai Development<br />
PCL, dem größten Bauunternehmen<br />
Thailands. Die Eröffnung der Red<br />
Line ist für Januar 2021 geplant. 2<br />
Maurer SE ist ein Spezialist im Maschinen- und Stahlbau mit weltweit<br />
über 1.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen konzentriert sich auf Bauwerkschutzsysteme<br />
(Brückenlager, Fahrbahnübergänge, Erdbebenvorrichtungen,<br />
Schwingungsdämpfer und Monitoringsysteme). Es entwickelt<br />
und fertigt darüber hinaus Schwingungsisolierung von Gebäuden und<br />
Maschinen, Achterbahnen, Riesenrädern sowie Sonderkonstruktionen im<br />
Stahlbau.<br />
Maurer ist an vielen spektakulären Großprojekten beteiligt, z.B. den weltgrößten<br />
Brückenlagern in Wasirabad, erdbebensicheren Dehnfugen an<br />
den Bosporus-Brücken, semiaktiven Schwingungsdämpfern im Donau<br />
City Tower oder Druck-Zug-Lagern für das Zenitstadion St. Petersburg. Im<br />
Stahlbau zählen die BMW Welt und das Flughafenterminal II in München<br />
zu den Vorzeigeobjekten.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
21<br />
Standard, Systeme, Anschlagrohre<br />
aus Edelstahl und das<br />
volle Zubehörprogramm.<br />
Bundesweit und immer zu<br />
mindestens 90 % auf Lager.<br />
Metallbau<br />
Stahlbau<br />
Fahrzeug- / Landmaschinen- /<br />
<br />
Maschinenschutzeinrichtung<br />
Maschinenbau und Anlagenbau<br />
Regalbau und Lagersysteme<br />
Containerbau<br />
Möbel- / Laden- / Innenausbau<br />
Klima- und Solartechnik<br />
Peter Drösser GmbH<br />
Ackerstraße 144<br />
51065 Köln<br />
Fon +49 221 6789-0<br />
info@droesser.de<br />
www.droesser.de
Stahlverarbeitung<br />
XXXXX BerichteA XXXXX<br />
Fotos: Atlas Ward<br />
Der Look des neuen Porsche-Zentrums Wiesbaden ist mit seiner abgerundeten<br />
Schauraum-Fassade ein Blickfang.<br />
Atlas Ward liefert anspruchsvolle Stahlkonstruktion<br />
für Porsche-Zentrum Wiesbaden<br />
Edler Stahlbau für Porsche<br />
Bei der Inszenierung einer automobilen Premium-Marke spielt<br />
auch die Architektur der Verkaufshäuser eine nicht unbedeutende<br />
Rolle. So trägt der Look des neuen Porsche Zentrums Wiesbaden<br />
eine klare Handschrift: zurückhaltend, hochwertig, weg vom<br />
Massentrend allseits transparenter Glaspaläste. Die Stuttgarter<br />
Sportwagenschmiede zielt damit auf Originalität, Tradition und<br />
Moderne zugleich.<br />
Im Inneren wurde<br />
das Stahlhallengerüst<br />
an einen massiven<br />
Betonkern angeschlossen.<br />
Dabei<br />
gründen die Innenstützen<br />
auf verschiedenen<br />
Niveaus, etwa<br />
auf hochgelagerten<br />
Galerieebenen.<br />
Damit der hohe Anspruch in<br />
jedem Detail sichtbar wird, mussten<br />
die beteiligten Bauunternehmen –<br />
der internationale Stahlhallenhersteller<br />
Atlas Ward und ein rheinland-pfälzischer<br />
Industrie- und<br />
Gewerbebauer – ihr Können auspacken.<br />
Eine Standardkonstruktion für<br />
den Komplex aus Verkaufs- und Ausstellungsräumen,<br />
Büros, Lager sowie<br />
Kfz-Werkstatt samt Waschanlage<br />
kam somit nicht in Frage.<br />
In aufwändiger Abstimmungsarbeit<br />
wurde das Stahlhallengerüst<br />
mittels gebogener Träger an die<br />
geschwungene äußere Form des<br />
optisch dominanten Schauraums<br />
angepasst und im Inneren an einen<br />
massiven Betonkern angeschlossen.<br />
Dabei gründen die Innenstützen auf<br />
verschiedenen Niveaus, etwa auf<br />
hochgelagerten Galerieebenen. Zum<br />
Stahlpaket gehörten außerdem eine<br />
kleine Überdachung für Gebrauchtwagen<br />
und ein separates Lagergebäude.<br />
Blick in die „Schmuckschatulle“<br />
Blickfang des Baukomplexes auf insgesamt<br />
rund 3.000 m 2 bebauter Fläche<br />
ist die abgerundete Schauraum-Fassade.<br />
Die moderne, silbermetallische<br />
Fassade aus Aluminium-Verbundplatten<br />
ziehen sich im typischen Erscheinungsbild<br />
der Porsche-Zentren von<br />
der Attika-Oberkante nach unten. Sie<br />
gewähren nur durch den verglasten,<br />
ebenfalls gerundeten Sichtschlitz<br />
darunter Einblick ins Innere – quasi<br />
der „Blick in die Schmuckschatulle“<br />
auf ausgewählte Porsche-Fahrzeuge.<br />
Der dezent und edel gehaltene Innenbereich<br />
beschränkt sich in der Farbgebung<br />
auf die Farbtöne Weiß, Grau<br />
und Schwarz. An den gerundeten<br />
Schauraum schließen sich das Lager<br />
und der rechteckige Werkstattkörper<br />
an, der eine wärmegedämmte Kassettenwand<br />
und Stahltrapezprofile<br />
erhielt.<br />
Für die Bauherren, die das neue<br />
Wiesbadener Zentrum im Oktober<br />
2017 offiziell eröffneten, war das<br />
rund 8,5 Mio. € teure Vorhaben eine<br />
Investition in die Zukunft: „Wir sind<br />
sehr zufrieden mit der baulichen<br />
Konstruktion und Umsetzung, die<br />
uns eine hochmoderne und verbesserte<br />
Standort- und Geschäftsbasis<br />
für die steigende Nachfrage verschafft“,<br />
sagt Christian Scherer,<br />
Geschäftsführender Gesellschafter<br />
der Scherer Unternehmensgruppe,<br />
die zusammen mit der Firmengruppe<br />
Rossel das Porsche-Zentrum Wiesbaden<br />
sowie weitere Autohäuser in<br />
der hessischen Landeshauptstadt<br />
betreibt, aber auch überregional<br />
aktiv ist. 2<br />
22 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Sichere Lagerung aggressiver und brennbarer Gefahrstoffe<br />
Auffangwannen aus Edelstahl<br />
Für jeden Gefahrstoff eine passende Lagerlösung – damit wirbt das Rendsburger Unternehmen<br />
Protectoplus. Eines der hochwertigsten Materialien, die der Gefahrgut-Experte dafür verwendet,<br />
ist Edelstahl: Denn mit Auffangwannen aus nichtrostendem Stahl können wassergefährdende,<br />
aggressive und brennbare Gefahrstoffe beständig und sicher gelagert werden.<br />
Allrounder: Edelstahl-Auffangwanne SWE2 mit Gitterrost.<br />
IBC-Auffangwanne aus Edelstahl GSE 1 mit Gitterrost.<br />
Aggressive Chemikalien wie<br />
Säuren oder Laugen fressen sich<br />
durch viele der Materialien, aus<br />
denen herkömmliche Lagerbehälten<br />
hergestellt sind. Schwefel-, Salzsäure<br />
& Co. bedürfen daher einer besonders<br />
sorgfältigen und sicheren Lagerung.<br />
Für den betrieblichen Umweltschutz<br />
sind speziell für diesen Zweck<br />
geeignetet Auffangwannen unverzichtbar.<br />
Mit ihrer Hilfe lassen sich<br />
Gefahrstoffe sicher abstellen und<br />
lagern – egal ob in sogenannten Intermediat<br />
Bulk Containern (IBC), in Fässern<br />
oder in Kanistern.<br />
Sind die zu lagernden Flüssigkeiten<br />
nicht nur chemisch aggressiv,<br />
sondern auch noch brennbar – wie<br />
beispielsweise Essigsäure –, können<br />
diese nicht mit einer Kunststoffwanne<br />
aufgefangen werden. Hierfür<br />
ist Edelstahl erforderlich. Dieser<br />
Werkstoff kommt in der Regel dann<br />
zum Einsatz, wenn große mechanische<br />
Stabilität mit hoher chemischer<br />
Widerstandsfähigkeit einhergehen<br />
muss.<br />
Aggressiv und brennbar –<br />
ein Fall für Edelstahl<br />
Eine Spezialistin für solche Lagerlösungen<br />
ist die Protectoplus Lagerund<br />
Umwelttechnik GmbH. Die Auffangwannen<br />
des Unternehmens aus<br />
den Werkstoffen 1.4301 sowie<br />
1.4571 entsprechen den Anforderungen<br />
der DIN 6601 (die den<br />
Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen regelt) und bieten eine hohe<br />
Beständigkeit besonders gegenüber<br />
aggressiven Medien. Die Spezial-<br />
Über PROTECTO<br />
Der mittelständische Fachbetrieb Protectoplus Lager- und Umwelttechnik<br />
GmbH zählt sich zu den führenden Entwicklern und Herstellern von hochwertigen<br />
Qualitätsprodukten rund um den betrieblichen Umweltschutz.<br />
Unter dem Markennamen PROTECTO plant, konstruiert, fertigt, vertreibt<br />
und installiert das Unternehmen, das sich auf die sichere Lagerung von<br />
wassergefährdenden, entzündbaren, toxischen, brandfördernden oder<br />
gesundheitsgefährdenden Stoffen spezialisiert hat, seit 25 Jahren ausgereifte<br />
Standardprodukte ebenso wie individuelle Lösungen.<br />
www.protecto.de<br />
wannen sind zugelassen zur Lagerung<br />
von wassergefährdenden und<br />
brennbaren Flüssigkeiten.<br />
Alle Edelstahl-Auffangwannen<br />
des Herstellers bestehen aus hochwertigem,<br />
widerstandsfähigem Edelstahl<br />
und verfügen über eine besonders<br />
stabile, sichere Konstruktion,<br />
einen Gitterrost sowie über praktische<br />
Gabeltaschen. Auf Wunsch sind die<br />
Behälter auch in anderen Werkstoffvarianten<br />
sowie in individuellen Größen<br />
und Ausführungen lieferbar. 2<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
23
Stahlproduktion<br />
Bericht/Nachrichten<br />
Bild: Deutsche Edelstahlwerke (DEW)<br />
Deutsche Edelstahlwerke (DEW) entwickeln Thermodur 2727 IP<br />
Ersatz für kritische<br />
Legierungselemente im Stahl<br />
Erst die Legierungselemente machen Stahl zu dem vielseitigen<br />
Werkstoff, der er ist – und verleihen ihm Eigenschaften wie Festigkeit<br />
und Verschleißbeständigkeit. Allerdings sind manche dieser Elemente<br />
nicht immer verlässlich verfügbar. Die Deutschen Edelstahlwerke<br />
(DEW), ein Unternehmen der SCHMOLZ + BICKENBACH<br />
Gruppe, haben daher einen Werkzeugstahl aus leicht verfügbaren<br />
Rohstoffen entwickelt: Thermodur 2727 IP. Dieser Werkstoff basiert<br />
auf den Legierungselementen Nickel und Aluminium. Anwender<br />
seien damit unabhängiger von teuren und ressourcenkritischen<br />
Elementen wie Wolfram und Chrom.<br />
Bei Thermodur 2727 IP kommt<br />
die intermetallische Phase – daher der<br />
Namenszusatz IP – Nickelaluminid<br />
(NiAl) zum Einsatz. Die DEW entwickelten<br />
den IP-Stahl im Rahmen eines<br />
öffentlich geförderten Projektes zusammen<br />
mit der RWTH Aachen und der FH<br />
Südwestfalen. Als Anwendungsfall<br />
stand dabei der Aluminiumdruckguss<br />
im Fokus. Messen muss sich der Thermodur<br />
2727 IP daher mit dem dafür<br />
häufig eingesetzten Werkstoff 1.2367.<br />
Dieser weist unter anderem eine exzellente<br />
Warmfestigkeit und eine hervorragende<br />
Temperaturwechselbeständigkeit<br />
auf.<br />
Schon ein ähnliches Eigenschaftsprofil<br />
mit Blick auf die Temperaturwechselbeständigkeit<br />
wäre für das neue<br />
Legierungskonzept als Erfolg zu werten<br />
gewesen. Doch der IP-Stahl hat die<br />
Erwartungen offenbar sogar übertroffen:<br />
Seine Temperaturwechselbeständigkeit<br />
sei besser als die des Vergleichswerkstoffs,<br />
sowohl seine maximale Härte als<br />
Ein Druckgussteil aus<br />
Aluminium: Der Aluminiumdruckguss<br />
stand bei<br />
der Entwicklung von<br />
Thermodur 2727 IP im<br />
Fokus.<br />
auch die Daueranlassbeständigkeit<br />
lägen höher, so die DEW.<br />
Gleichzeitig habe man die die ressourcenkritischen<br />
Elemente um mehr<br />
als 60 % reduzieren können, so die<br />
DEW weiter. Um für die neue Stahlsorte<br />
eine Härte bis 55 HRC zu erreichen,<br />
konnte allerdings auf Kohlenstoff mit<br />
einem Massenanteil von 0,3 bis 0,4 %<br />
nicht verzichtet werden. Die Wahl fiel<br />
für Thermodur 2727 IP auf Nickelaluminid,<br />
weil die Verbindung keine<br />
Legierungsbestandteile mit hoher Affinität<br />
zum Kohlenstoff aufweist.<br />
Im Ergebnis erhielten Anwender<br />
einen besseren Stahl bei gleichzeitig<br />
höherer Versorgungssicherheit und<br />
Berechenbarkeit. Die Stahlsorte ist<br />
bislang nur im nicht umgeschmolzenen<br />
Zustand erhältlich. Gemeinsam<br />
mit Anwendern entwickeln und testen<br />
die DEW den Werkstoff derzeit weiter.<br />
Er berge auch Potenzial als möglicher<br />
Werkstoff für das Gasverdüsen und<br />
die additive Fertigung. 2<br />
Verlässliche Infrastruktur angemahnt<br />
Stahlindustrie sieht Handlungsbedarf<br />
bei Verkehrswegen<br />
Die derzeitige Verkehrssituation<br />
stellt die Stahlunternehmen in Deutschland<br />
vor Herausforderungen. Das<br />
mahnte die Düsseldorfer Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl in einer Mitteilung an. Das<br />
starke Niedrigwasser im Sommer und<br />
Herbst 2018 auf zentralen Wasserstraßen,<br />
insbesondere auf dem Rhein, habe<br />
dazu geführt, dass Binnenschiffe nur zu<br />
einem Teil oder gar nicht mehr beladen<br />
werden konnten.<br />
Da die Stahlindustrie in Deutschland<br />
einen wesentlichen Teil ihrer Einsatzstoffe<br />
per Binnenschiff erhält – pro Jahr<br />
rund 35 Mio. t Rohstoffe – , Ausweichkapazitäten<br />
auf der Schiene nur begrenzt<br />
zur Verfügung stehen und der Straßengüterverkehr<br />
für solche Volumina ohnehin<br />
nicht geeignet sei, sei die Versorgung<br />
der Stahlunternehmen gefährdet. „Die<br />
Stahlindustrie in Deutschland ist auf verlässliche<br />
Verkehrsinfrastrukturen angewiesen“,<br />
erklärte Hans Jürgen Kerkhoff,<br />
Präsident der Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl. Die Politik müsse alle Möglichkeiten<br />
ergreifen, damit die nachhaltigen<br />
Verkehrsträger Binnenschiff und Bahn<br />
besser genutzt werden können.<br />
Kerkhoff sprach sich für eine zügige<br />
Umsetzung der geplanten Optimierungen<br />
der Fahrrinnentiefe zwischen Duisburg<br />
und Dormagen sowie am Mittelrhein aus.<br />
Auch im Schienengüterverkehr bestehe<br />
Handlungsbedarf: Während die sogenannte<br />
Betuwe-Linie als Bestandteil des<br />
europäischen Güterverkehrskorridors<br />
Rotterdam-Genua bereits 2007 auf niederländischer<br />
Seite fertiggestellt worden<br />
sei, habe man deren Fortführung bis<br />
Oberhausen in Form eines dritten Gleises<br />
bis heute nicht einmal planfestgestellt.<br />
„Ohne umfassende Ausbaumaßnahmen<br />
kann der Schienengüterverkehr<br />
der künftigen Nachfrage nicht gerecht<br />
werden“, so Kerkhoff weiter. Wichtig<br />
seien vor allem der rasche Ausbau des<br />
Netzes für 740 m lange Züge, der Ausbau<br />
von Eisenbahnknoten und die Netz-<br />
Digitalisierung.<br />
24 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Schoeller Werk investiert in Qualitätssicherung<br />
Komplexe Rohrgeometrien präzise vermessen<br />
Das Schoeller Werk hat seine Qualitätsabteilung um eine leistungsstarke<br />
und hochgenaue Messmaschine erweitert. Der Experte<br />
für längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre setzt zur systematischen<br />
Erfassung von Prüf- und Messergebnissen künftig ein STRATO-Apex<br />
9106 von Mitutoyo ein. Die Koordinatenmessmaschine (KMM)<br />
kommt unter anderem im Vorfeld der Serienfertigung von Rohren<br />
zur Anwendung – beispielsweise bei der Erstbemusterung nach<br />
Automobilstandard.<br />
Mit der neuen Messmaschine ist das Schoeller Werk in der Lage,<br />
selbst komplexere Geometrien von Rohren einfacher zu vermessen<br />
und Prüfmittel vor ihrem Einsatz eigenständig zu kalibrieren. Denn<br />
vor allem in der Automobilindustrie müssen Zulieferer anspruchsvolle<br />
Anforderungen erfüllen, bevor Bauteile in Serie gefertigt werden<br />
dürfen.<br />
„Die neue KMM liefert uns präzise und reproduzierbare Ergebnisse<br />
ohne Bedienereinflüsse“, berichten Martin Klein, zuständig für die<br />
Prüfmittelüberwachung beim Schoeller Werk, und Walter Hammermüller,<br />
Qualitätsmanagement. Mit der STRATO-Apex 9106 lassen<br />
sich nicht nur umfangreiche Vermessungen von Rohrgeometrien<br />
durchführen, sondern die Ergebnisse auch systematisch erfassen.<br />
Bild: Schoeller Werk<br />
Ein weiteres Einsatzgebiet für die neue KMM ist die Kalibrierung von<br />
Prüfmitteln. Darüber hinaus sind SPC-Messungen (SPC = statistic<br />
process control, statistische Prozesssteuerung) möglich, um Toleranzen<br />
festzulegen und die Leistungsfähigkeit von Maschinen in der<br />
Rohrherstellung zu bestimmen. Damit die Messmaschine dauerhaft<br />
exakte Ergebnisse liefert, wurde eigens ein Kalibrierraum im Technikum<br />
errichtet, der gleichbleibende Umgebungsparameter sicherstellt.<br />
Bildzeile: Das Schoeller Werk hat seine Qualitätsabteilung um eine<br />
leistungsstarke und hochgenaue Koordinatenmessmaschine erweitert.<br />
Damit ist das Unternehmen künftig in der Lage, selbst komplexere<br />
Geometrien von Rohren einfacher zu vermessen und Prüfmittel<br />
vor ihrem Einsatz eigenständig zu kalibrieren.<br />
Vo<br />
ollautomatischer Entnahmeroboter<br />
Kommissionierung o ng der Bügel<br />
nach hK Kundenbedarf<br />
d Erfüllt höchsteh Sicherheits-<br />
h i<br />
anforderungen<br />
Logistische sche Integration<br />
ti<br />
W<br />
artungsarm<br />
Präzise und programmgesteuert entnimmt<br />
der Roboter die fertig produzierten Bügel<br />
in verschiedenen Formen und Größen<br />
vom Bügelautomaten und platziert sie je<br />
nach Anforderungen auf verschiedensten<br />
Ablageplätzen.<br />
Progress Maschinenn & Automation AG<br />
Julius-Durst-Str. 100<br />
I-39042 Brixen<br />
Te<br />
el. +39 0472 979 100<br />
info@ @progress-m.com<br />
www.progress-m.com
Anarbeitung<br />
und Logistik<br />
Bericht/Nachrichten<br />
Ein umfangreiches<br />
Forschungsprojekt<br />
der TU München hat<br />
die Verbesserung des<br />
Feuerwiderstands<br />
durch Feuerverzinken<br />
intensiv untersucht,<br />
u. a. durch Brandversuche.<br />
Fotos: TU München<br />
Feuerverzinken verlängert die Feuerwiderstandsdauer von Stahl<br />
Mehr als nur Korrosionsschutz<br />
Der Korrosionsschutz durch Feuerverzinken verbessert die Feuerwiderstandsdauer von<br />
Stahl. Dies ergab ein aktuelles Forschungsprojekt der Technischen Universität München.<br />
Hierdurch sei zukünftig bei einer Fülle von Stahlbauten eine deutlich wirtschaftlichere<br />
Lösung durch eine Feuerverzinkung möglich.<br />
Der Feuerwiderstand eines<br />
Bauteils steht für die Dauer, während<br />
der es im Brandfall seine Funktion<br />
behält. Dabei muss das Bauteil die<br />
Tragfähigkeit sicherstellen. Nicht<br />
selten verfehlen Stahlkonstruktionen<br />
dem Institut Feuerverzinken zufolge<br />
ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen<br />
eine geforderte Feuerwiderstandsklasse<br />
von R30 (früher<br />
F30), die im Brandfall für mindestens<br />
30 min eine funktionierende Tragfähigkeit<br />
fordert. Die Folge ist, dass<br />
passive Brandschutzmaßnahmen für<br />
Stahlbauteile wie Verkleidungen,<br />
Spritzputze oder Brandschutzbeschichtungen<br />
eingesetzt werden<br />
müssen.<br />
Passive Brandschutzmaßnahmen<br />
sind kostspielig und bewegen sich<br />
in Höhe von 10 bis 15 % der Rohbaukosten<br />
(ab Oberkante UG). Zudem<br />
müssen sie auf der Baustelle aufgebracht<br />
werden. Dies führe als Folge<br />
häufig zu einer Bevorzugung der<br />
Betonbauweise. Durch eine im Werk<br />
aufgebrachte Feuerverzinkung können<br />
derartige Stahlkonstruktionen<br />
nun die geforderte Feuerwiderstandsklasse<br />
von R30 häufig erreichen.<br />
Zusätzliche passive Brandschutzmaßnahmen<br />
seien nicht mehr erforderlich.<br />
Der Einsatz feuerverzinkter<br />
Profile trage damit wesentlich zur<br />
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
und Wettbewerbsfähigkeit von Stahlund<br />
Stahlverbundkonstruktionen im<br />
Vergleich zur marktbeherrschenden<br />
Betonbauweise bei.<br />
Ein Rechenmodell<br />
ermöglicht die<br />
Ermittlung des Feuerwiderstands<br />
von<br />
feuerverzinkten<br />
Stahlkonstruktionen<br />
und damit den<br />
unmittelbaren Praxistransfer.<br />
26 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Feuerverzinkte Stähle<br />
verringern Bauteil-Erwärmung<br />
Die Verbesserung des Feuerwiderstands<br />
basiert auf einer verringerten<br />
Emissivität von feuerverzinkten<br />
Stählen. Emissivität ist ein Maß<br />
dafür, wie stark ein Material Wärmestrahlung<br />
mit seiner Umgebung<br />
austauscht. Gerade in der Anfangsphase<br />
eines Brandes führen verringerte<br />
Werte der Emissivität zu<br />
einer deutlich verzögerten Erwärmung<br />
der Bauteile und können insbesondere<br />
bei Bauteilen mit einer<br />
ausreichenden Massivität wesentlich<br />
dazu beitragen, einen geforderten<br />
Feuerwiderstand von R30<br />
zu erreichen.<br />
Ein umfangreiches Forschungsprojekt<br />
am Lehrstuhl für Metallbau<br />
der TU München hat die Veränderung<br />
des Feuerwiderstands durch<br />
Feuerverzinken intensiv untersucht.<br />
Empirische Studien durch Brandversuche<br />
gehörten ebenso dazu wie<br />
komplexe Simulationen. Darauf aufbauend<br />
wurde ein Rechenmodell<br />
entwickelt, das die Quantifizierung<br />
und Berechnung dieser Verbesserung<br />
möglich macht.<br />
„Durch die Konzipierung eines<br />
Rechenmodells, das es erlaubt, den<br />
Feuerwiderstand von feuerverzinkten<br />
Stahlkonstruktionen zu berechnen,<br />
ist ein unmittelbarer Praxistransfer<br />
unserer Forschungsarbeiten<br />
gegeben. Fachleute, die Brandschutz<br />
für Stahl planen, haben mit der Feuerverzinkung<br />
jetzt eine neue Option.<br />
Für die Feuerverzinkung ergeben<br />
sich hierdurch völlig neue Anwendungsmöglichkeiten<br />
jenseits des<br />
Korrosionsschutzes und für den<br />
Stahlbau werden verbesserte Wettbewerbschancen<br />
geschaffen“, sagt<br />
Prof. Dr. Martin Mensinger, Inhaber<br />
des Lehrstuhls für Metallbau.<br />
In Kürze werde das Berechnungsmodell<br />
publiziert und für die<br />
Praxis verfügbar sein, so der Industrieverband<br />
Feuerverzinken. Das<br />
Forschungsprojekt der TU München<br />
wurde fachlich begleitet durch die<br />
Forschungsvereinigungen Gemeinschaftsausschuss<br />
Verzinken (GAV),<br />
Forschungsvereinigung Stahlanwendung<br />
(FOSTA) und den Deutschen<br />
Ausschuss für Stahlbau<br />
(DASt). 2<br />
Bildquelle: Initiative Zink<br />
Stahlbolzen-Beschichtung<br />
Neue Waffe im Kampf gegen Korrosion<br />
Im Zuge der Weiterentwicklung des<br />
Stahlbolzens m2 hat die Schweizer Mungo<br />
Befestigungstechnik AG neue Wege in der<br />
Beschichtung von Stahlbolzen beschritten.<br />
Dank neuster Technologie aus der Automobil-<br />
und Elektroindustrie hat das Unternehmen<br />
die neue, ultradünne und 100% chromfreie<br />
Beschichtung GreenTec ® entwickelt.<br />
Die hohe Korrosionsbeständigkeit (Salzsprühtest<br />
gemäß DIN EN ISO 9227 NSS,<br />
dem Unternehmen zufolge durch unabhängiges<br />
Prüfinstitut erfolgreich getestet) sowie<br />
außerordentliche Verschleissbeständigkeit<br />
(Versetzvorgang mit Hammerschlägen)<br />
garantierten eine bis zu zehnmal höhere<br />
Lebensdauer als herkömmliche Stahl- oder<br />
Feuerverzinkungen. Aus diesem Grund<br />
könne der Bolzen auch im unbewitterten<br />
Außenbereich vielfältig eingesetzt werden.<br />
Dank neuester Clipgeometrie würden<br />
höchste Lasten und Biegemomente bei sehr<br />
geringen Rand- und Achsabständen<br />
erreicht, was den Dübel zum perfekten Allrounder<br />
für unterschiedlichste Anwendungen<br />
im Innen- und Aussenbereich mache.<br />
Dank der Europäisch technischen Bewertung<br />
(ETB) für Einzelbefestigungen im ungerissenen<br />
Beton ist der Bolzen auch für statisch<br />
relevante Befestigungen zugelassen.<br />
Der geringe Einschlagwiderstand, das<br />
schnelle Aufbringen des benötigten Drehmoments<br />
sowie die hilfreiche Setztiefenmarkierung<br />
ermöglichten ein kraft- und kostensparendes<br />
Arbeiten auf der Baustelle.<br />
Die gewählten Vorsitzenden der Initiative Zink mit dem Geschäftsleiter(v. l.): Frank Neumann, seit Juli<br />
Leiter der Geschäftsstelle der Initiative Zink, Bodo Schauries, Metallwerk Dinslaken GmbH & Co. KG,<br />
Alexander Hofmann, Wiegel Gruppe, Ulrich Grillo, Grillo-Werke AG (1. Vorsitzender)<br />
Ulrich Grillo neuer Vorsitzender der Strategiegruppe<br />
Neuwahlen bei der Initiative Zink<br />
Auf der Herbstsitzung des Lenkungsgremiums<br />
der Initiative ZINK fand am 19.<br />
November 2018 in Düsseldorf die Wahl der<br />
neuen Vorsitzenden der Strategiegruppe<br />
Zink statt. Turnusgemäß erfolgte die Besetzung<br />
dieser Ämter für drei Jahre. Die Strategiegruppe<br />
steuert die Ausrichtung der<br />
Öffentlichkeitsarbeit der Initiative Zink rund<br />
um den Werkstoff.<br />
Neuer Vorsitzender des Lenkungsgremiums<br />
ist Ulrich Grillo, Vorstandsvorsitzender der<br />
Grillo-Werke AG, Duisburg. Als Stellvertreter<br />
ist Alexander Hofmann, Wiegel-Gruppe,<br />
gewählt worden. Bodo Schauries, Metallwerk<br />
Dinslaken, wurde im Amt bestätigt.<br />
Weiteres Thema der Tagung war die wegen<br />
der wachsenden Mitgliederzahl der Initiative<br />
Zink erforderliche angepasste Strategie.<br />
Eine zukunftsweisende Positionierung<br />
des Metalls Zink in all seinen Anwendungsbereichen<br />
werde dabei nun berücksichtigt.<br />
[ Info ]<br />
Weitere Informationen zur Initiative Zink unter<br />
www.initiative-zink.de.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
27
Messen<br />
und Märkte<br />
Spezial: Konjunktur<br />
Eurozone und Deutschland 2019 – Prognosen der Wirtschaftsinstitute<br />
Konjunktur mit Gegenwind<br />
„Der Aufschwung stößt an seine Grenzen“, titelte das Kieler Institut für Weltwirtschaft in seinem<br />
aktuellen Konjunkturausblickt – und senkte seine BIP-Prognose für Deutschland für die kommenden<br />
beiden Jahre von 2,0 auf 1,8 %. Nach einer Konjunktur-Delle im dritten Quartal 2018 dürfte es Anfang<br />
2019 in Deutschland zunächst zu einer Erholung kommen, insgesamt habe die deutsche Wirtschaft<br />
aber die Spätphase des seit über fünf Jahren anhaltenden Aufschwungs erreicht. Mit leicht<br />
unterschiedlichen Gewichtungen urteilen andere Wirtschaftsinstitute ähnlich. Ein Überblick.<br />
Nach Schwankungen im Jahresverlauf<br />
2018, dürfte sich<br />
„das konjunkturelle Grundmuster“<br />
wieder durchsetzen, bei dem der<br />
obere Wendepunkt in Sichtweite<br />
gerate: „Der Aufschwung trägt noch<br />
in das nächste Jahr, im Jahresverlauf<br />
2019 dürfte aber allmählich der<br />
Abschwung einsetzen“, sagte Stefan<br />
Kooths, Leiter des Prognosezentrums<br />
am IfW Kiel im Dezember.<br />
Zahlreiche Risiken<br />
verstärken Unsicherheit<br />
Der Ausblick für die kommenden<br />
beiden Jahre ist allerdings durch<br />
zahlreiche Unsicherheiten geprägt:<br />
Angesichts der hohen Auslastung<br />
der Produktionskapazitäten kann<br />
die deutsche Industrie nicht mehr<br />
so dynamisch expandieren und<br />
werde anfälliger für Störungen, so<br />
die Kieler Forscher.<br />
Hinzu kommen außenwirtschaftliche<br />
Risikofaktoren: der schwelende<br />
Handelskonflikt zwischen den USA<br />
und China, die unsichere Lage in<br />
Italien, der Brexit, auch die politische<br />
Lage in Frankreich.<br />
Sorgen übertrieben?<br />
Die Sorgen vor einer Rezession seien<br />
übertrieben, mahnt das Deutsche<br />
Institut für Wirtschaftsforschung in<br />
Berlin. Das schwächer als erwartet<br />
ausfallende Wachstum der deutschen<br />
Wirtschaft im vergangenen<br />
Jahr (+1,5 % nach DIW-Angaben),<br />
wertet dessen Konjunkturchef Claus<br />
Michelsen „als eine Normalisierung<br />
nach Jahren des überdurchschnittlichen<br />
Wachstums“. Für 2019 ist<br />
nach Einschätzung des DIW mit<br />
1,6 % ein Wachstum in ähnlicher<br />
Größenordnung zu erwarten.<br />
Auch das DIW weist auf die negativen<br />
Auswirkungen des vorübergehenden<br />
Produktionsstopps in der<br />
Automobilindustrie im Sommer hin.<br />
Nach und nach dürften die Kfz-<br />
Hersteller aber einen Großteil der<br />
ausgebliebenen Verkäufe – und<br />
schließlich auch der Produktion –<br />
nachholen.<br />
Neben Problemen in der Automobilindustrie<br />
werden auch die ausländischen<br />
Absatzmärkte, die erheblichen<br />
konjunkturellen Risiken<br />
ausgesetzt seien, an Schwung verlieren,<br />
meint das Leibniz-Institut für<br />
Wirtschaftsforschung an der Universiät<br />
München – und hat die Konjunkturprognose<br />
vom Herbst 2018<br />
Prognosen Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019<br />
IfW Institut für Weltwirtschaft, Kiel 1,8 %<br />
RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen 1,7 %<br />
DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Berlin 1,6 %<br />
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt a.M. 1,6 %<br />
Ifo Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V 1,1 %<br />
Quelle: BDS, nach Zahlen der Wirtschaftsinstitute<br />
28 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Bauwirtschaft in guter Verfassung<br />
Weiter auf Wachstumskurs<br />
„Die europäische<br />
Wirtschaft befindet<br />
sich nach wie vor in der<br />
Expansion. Die Zeichen<br />
stehen zwar auf Abkühlung<br />
der Konjunktur. Ich bleibe<br />
dennoch optimistisch, dass<br />
wir bei deutlich positiven<br />
Wachstumsraten bleiben.“<br />
Dr. Jörg Zeuner,<br />
Chefvolkswirt der KfW<br />
deutlich nach unten revidiert. Für<br />
2018 rechnet es mit einer Zunahme<br />
des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts<br />
von 1,5 % für 2019 nur<br />
noch mit 1,1 %.<br />
Aufgrund der größeren Anzahl<br />
an Arbeitstagen beschleunige sich<br />
die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts<br />
im Jahr 2020 auf dann wieder<br />
auf 1,6 %. Kalenderbereinigt liegt<br />
die Rate allerdings nur bei 1,3 %.<br />
Insgesamt, so das Institut, dürfte die<br />
Überauslastung der deutschen Wirtschaft<br />
abnehmen und sich der<br />
Beschäftigungsaufbau verlangsamen.<br />
Die hohe Kapazitätsauslastung<br />
der Unternehmen zeige, dass es<br />
anhaltenden Bedarf für Investitionen<br />
gebe. Trotz der langsamen<br />
Rückführung der geldpolitischen<br />
Unterstützung dürften die Finanzierungskonditionen<br />
für die Unternehmen<br />
günstig bleiben, meint die<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
(KfW). 2<br />
Das deutsche Bauhauptgewerbe verzeichnete 2018 das sechste aufeinanderfolgende<br />
Jahr mit einer realen Umsatzsteigerung, nominal<br />
blieb das Wachstum mit 6 % auf dem hohen Niveau des Jahres 2017,<br />
sagte Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen<br />
Bauindustrie, in einem Beitrag für die Allgemeine Bauzeitschrift<br />
Anfang Januar. Vor diesem Hintergrund sei man für 2019 entsprechend<br />
zuversichtlich.<br />
Hübner erwartete, dass sich<br />
das Wachstum der Bautätigkeit in<br />
2019 auf hohem Niveau fortsetzen<br />
wird. „Für 2019 gehen wir von<br />
einem nominalen Umsatzplus von<br />
6 % aus“, sagte der Verbandspräsident.<br />
Der Wohnungsbau werde ein<br />
nominales Umsatzplus von 5,5 %<br />
erzielen. „Davon sind wir überzeugt,<br />
wenn wir die ersten drei Quartale<br />
2018 auswerten. Mit rd. 320 000 fertiggestellten<br />
Wohnungen werden wir<br />
allerdings auch im neuen Jahr die<br />
politische Zielvorgabe deutlich verfehlen“,<br />
so Hübner weiter. Die deutsche<br />
Bauindustrie setze daher<br />
zukünftig verstärkt auf die serielle<br />
Bauproduktion von Typengebäuden.<br />
Durch stationäre Vorfertigung bis<br />
hin zur Produktion von Modulen baue<br />
man nicht nur schneller, sondern<br />
auch kostengünstiger. Der Wirtschaftsbau<br />
werde nach Einschätzung des<br />
Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie<br />
im neuen Jahr den schwieriger<br />
gewordenen gesamtkonjunkturellen<br />
Rahmenbedingungen trotzen. Betroffen<br />
wäre die deutsche Bauwirtschaft erst<br />
dann, wenn deutsche Industrieunternehmen<br />
aufgrund verschlechterter<br />
Absatzerwartungen im Ausland ihre<br />
Investitionen – darunter auch in Bauten<br />
– im Inland zurückfahren würden.<br />
Dafür gebe es aber bislang noch keine<br />
Anzeichen. Nach langen Jahren der<br />
Investitionszurückhaltung zeige sich<br />
auch bei der öffentlichen Hand ein<br />
deutliches Wachstum. „Wir halten also<br />
fest: Die deutsche Bauwirtschaft ist<br />
insgesamt in einer sehr guten Verfassung<br />
und auf dem Weg, ihre Kapazitäten<br />
weiter an die steigende Nachfrage<br />
anzupassen“, unterstrich Hübner. 2<br />
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe in Deutschland<br />
Nominal, Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten, Januar–Oktober 2018 in %<br />
Bauhauptgewerbe insgesamt 9,7 %<br />
Hochbau 7,8 %<br />
Tiefbau 11,7 %<br />
Wohnungsbau 9,9 %<br />
Wirtschaftsbau 13,6 %<br />
Wirtschaftshochbau 7,4 %<br />
Wirtschaftstiefbau 23,4 %<br />
Öffentlicher Bau 5,4 %<br />
Öffentlicher Hochbau 2,6 %<br />
Straßenbau 9,5 %<br />
Sonstiger Tiefbau 1,1 %<br />
Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Statistisches Bundesamt<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
29
Messen<br />
und Märkte<br />
Spezial: Konjunktur<br />
Maschinenbau<br />
Robust in schwierigem Umfeld<br />
Für den Maschinenbau in Deutschland war 2018 ein erfolgreiches Jahr – trotz vieler Verunsicherungen.<br />
Bis einschließlich Oktober wies die Branche ein Produktionsplus von 3,7 % auf, sagte VDMA-Präsident<br />
Carl Martin Welcker Ende des vergangenen Jahres. Die Auftragseingänge im Maschinenbau erreichten<br />
im gleichen Zeitraum ein Plus von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das kommende Jahr rechnen die<br />
VDMA-Volkswirte allerdings nur noch mit einem Produktionswachstum von real 2 % im Maschinenbau.<br />
Positiv sei, dass die Aufträge<br />
in den Büchern derzeit im Durchschnitt<br />
noch eine Reichweite von<br />
8,6 Monaten haben, sagte Welcker.<br />
Doch zugleich bestünden viele Risiken:<br />
der anhaltende Handelsdisput<br />
der USA mit China, die Gefahr eines<br />
harten Brexits, die Sanktionen<br />
gegen Russland sowie die Verschuldungskrise<br />
Italiens seien nur die<br />
offensichtlichsten Hürden für das<br />
weitere Wachstum.<br />
Vom Inlandsmarkt erhofft sich<br />
der Maschinenbau dagegen einen<br />
weiter anhaltenden Schwung: Die<br />
Investitionen haben hierzulande<br />
zwar bereits angezogen, sind aber<br />
immer noch unterdurchschnittlich.<br />
„Zudem werden Automatisierungslösungen,<br />
die der Maschinenbau<br />
anbietet, gerade in Zeiten knapper<br />
Fachkräfte für viele Unternehmen<br />
unverzichtbar“, sagte der VDMA-<br />
Präsident.<br />
Die Exporte der Maschinenbauer<br />
aus Deutschland legten in<br />
„Wir müssen damit<br />
rechnen, dass all diese<br />
Einschränkungen des<br />
freien Handels sich auch<br />
im Maschinenbau stärker<br />
bemerkbar machen.“<br />
Carl Martin Welcker, VDMA-Präsident<br />
Bild: VDMA<br />
den ersten neun Monaten 2018 um<br />
nominal 5,2 % auf 131,9 Mrd. € zu.<br />
Wichtigste Zielländer waren China<br />
(+11,4 % auf 14,23 Mrd. €) und USA<br />
(+6,9 % auf 14,16 Mrd. €). Exporte<br />
nach China werden aber künftig<br />
voraussichtlich von einer schächeren<br />
chinesischen Binnenkonjunktur,<br />
die auch unter den US-Strafzöllen<br />
leidet, sowie steigenden Arbeitsund<br />
Produktionskosten in dem Land<br />
gebremst. Die Konjunktur in den<br />
Vereinigten Staaten profitiert derzeit<br />
noch von abgesenkten Unternehmenssteuern,<br />
allerdings würden<br />
auch dort die Inlandsinvestitionen<br />
schon wieder schwächer, so Welcker.<br />
2<br />
Entwicklung der deutschen Maschinenproduktion<br />
Reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent<br />
14<br />
12,7<br />
12<br />
10<br />
9,3<br />
8<br />
6<br />
4<br />
3,9<br />
5<br />
2<br />
1,2<br />
1,1 0,8<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
-0,3<br />
Prognose<br />
-1,2<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019<br />
Quelle: VDMA<br />
30 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
PcW-Befragung zum<br />
Maschinenbau<br />
Wachstumserwartungen im<br />
Maschinenbau brechen ein<br />
Vierteljährlich führt die Unternehmensberatung<br />
Pricewaterhouse-Coopers<br />
(PwC) eine Befragung unter den Führungskräften<br />
des deutschen Maschinen-<br />
und Anlagenbaus durch. Die aktuelle<br />
Befragung im vierten Quartal 2018<br />
zeige, dass die sich eintrübende wirtschaftliche<br />
Stimmung auch vor dem<br />
deutschen Maschinenbau nicht Halt<br />
mache: Nur jeder fünfte Befragte (22<br />
%) blickte zum Jahreswechsel optimistisch<br />
auf die Weltwirtschaft in 2019.<br />
An eine positive Konjunkturentwicklung<br />
in Deutschland glauben aktuell<br />
nur noch 56 %. Beide Werte haben sich<br />
damit negativ zum Vorwert entwickelt.<br />
Foto: KfW<br />
Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW<br />
Die negativen Erwartungen spiegeln<br />
sich auch in den rückläufigen Umsatzprognosen<br />
der Maschinenbauer wider:<br />
Für ihre Branche gehen die befragten<br />
Entscheider für 2019 nur noch von<br />
einem durchschnittlichen Wachstum<br />
von 1,4 % aus – ein Rückgang um mehr<br />
als zwei Drittel verglichen mit dem<br />
Vorquartal (4,9 %).<br />
„Der Maschinenbau muss sich auf<br />
turbulentere Zeiten einstellen”, analysierte<br />
Dr. Klaus-Peter Gushurst, Leiter<br />
des Bereichs Industries & Innovation<br />
und Experte für den Maschinenbau<br />
bei PwC. „Neben der allgemeinen<br />
Konjunkturabkühlung verheißen vor<br />
allem die angekündigten Sparprogramme<br />
der Automobilindustrie sowie<br />
die Unwägbarkeiten im Außenhandel,<br />
Stichwort Brexit, Prognosen für China<br />
und US-Zölle, keinen einfachen Start<br />
ins neue Jahr.“<br />
Positiv sei indes die weiterhin stabile<br />
Auslastung: Sie liegt bei knapp 94 % –<br />
sieben von zehn Unternehmen arbeiten<br />
laut PwC weiterhin am Kapazitätslimit.<br />
[ Info ]<br />
Mehr zum PwC-Maschinenbau-Barometer<br />
unter: www.pwc.de/maschinenbaubarometer<br />
KfW-Kreditmarktausblick<br />
Kreditvergabe an Unternehmen vorerst sehr kräftig<br />
Das von KfW-Research für<br />
Deutschland geschätzte Kreditneugeschäft<br />
der Banken mit Unternehmen<br />
und Selbstständigen ist im dritten<br />
Quartal 2018 erneut außerordentlich<br />
stark um 9,6 % im Vorjahresvergleich<br />
gewachsen. Die Kreditvergabe an<br />
Unternehmen legte der Bank zufolge<br />
damit das neunte Quartal in Folge zu.<br />
Im zweiten Quartal 2018 war es<br />
genau die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums,<br />
die wesentlich zu<br />
steigender Dynamik des Kreditneugeschäfts<br />
beigetragen haben dürfte, so<br />
die Kreditanstalt. Die konjunkturelle<br />
Abkühlung kam offensichtlich für viele<br />
Unternehmen überraschend, sodass<br />
diese Lager aufbauen mussten, die in<br />
der Regel über kürzer laufende Kredite<br />
refinanziert werden. Tatsächlich<br />
sei auch im Frühjahr 2018 bei den<br />
neu vergebenen Krediten in den kurzund<br />
mittelfristigen Laufzeiten ein<br />
besonders hoher Zuwachs beobachtbar<br />
gewesen.<br />
Im dritten Quartal 2018 sei keine weitere<br />
Zunahme mehr bei den Wachstumsraten<br />
der Kredite mit kürzerer<br />
Laufzeit zu verzeichnen gewesen. Das<br />
Motiv für die Kreditaufnahme scheint<br />
sich im Sommer wieder weg vom<br />
Zweck der Lagerhaltung und hin zur<br />
Absicht der Investitionsfinanzierung<br />
bewegt zu haben, wie auch der jüngste<br />
Bank Lending Survey signalisiert.<br />
Die zuvor sehr kräftige deutsche Konjunktur<br />
mit dem Jahr 2017 als Höhepunkt<br />
werde sich 2018 und 2019 „auf<br />
das Niveau des Wachstumspotenzials<br />
leicht abkühlen“, sagte Dr. Jörg Zeuner,<br />
Chefvolkswirt der KfW. „Für das<br />
Kreditneugeschäft der Banken mit<br />
Unternehmen bedeutet das zweierlei:<br />
Erstens dürfte der Bedarf an eher kurzfristigen<br />
Krediten zur Lagerfinanzierung<br />
weiter zurückgehen und zweitens<br />
sollte auch das Wachstum der Kredite<br />
für Investitionszwecke, also das der<br />
längerfristigen Darlehen, etwas nachgeben“,<br />
sagte Zeuner weiter.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
31
Messen<br />
und Märkte<br />
Spezial: Konjunktur<br />
Verarbeitendes Gewerbe: Prognose des IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index<br />
Rückläufiger Auftragseingang<br />
dämpft Industriewachstum<br />
Auch im Dezember 2018 hat sich das Wachstum der deutschen Industrie weiter abgeschwächt.<br />
Das signalisiert der saisonbereinigte IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index (EMI), der im letzten<br />
Monat des vergangenen Jahres leicht auf 51,5 Punkte von vormals 51,8 gesunken ist. Dieser Wert ist der<br />
niedrigste seit März 2016; gleichzeitig gab der deutsche Industrie-Einkäufer-Index nun schon den fünften<br />
Monat in Folge nach. Die Mehrheit der befragten Manager blickt eher pessimistisch in die Zukunft.<br />
Foto: Dirk Uebele/BME e.V<br />
Die fallende Zahl der Neuaufträge<br />
mache dem Verarbeitenden<br />
Gewerbe in Deutschland weiter zu<br />
schaffen, so der englische Finanzdienstleister<br />
IHS Markit. Zahlreiche<br />
Umfrageteilnehmer berichteten in<br />
diesem Zusammenhang von der<br />
wachsenden Zurückhaltung bei vielen<br />
Unternehmen und Kunden sowie<br />
von der nach wie vor nur verhaltenen<br />
Nachfrage in der Automobilindustrie.<br />
„Die deutsche Industrie<br />
muss sich 2019 auf<br />
deutlich stärkeren<br />
Gegenwind einstellen.“<br />
Dr. Silvius Grobosch,<br />
Hauptgeschäftsführer des<br />
Bundesverbandes Materialwirtschaft,<br />
Einkauf und Logistik e.V. (BME)<br />
„Die deutsche Industrie muss sich<br />
2019 auf deutlich stärkeren Gegenwind<br />
einstellen“, betonte Dr. Silvius<br />
Grobosch, Hauptgeschäftsführer des<br />
Bundesverbandes Materialwirtschaft,<br />
Einkauf und Logistik e.V. (BME),<br />
Anfang Januar. Der Kostendruck<br />
bleibe seiner Einschätzung nach<br />
„auch in den kommenden Wochen<br />
weiter hoch“. Allerdings könnten die<br />
Einkäufer von den relativ niedrigen<br />
Rohstoffpreisen profitieren.<br />
Positive Trendwende<br />
zur Jahresmitte?<br />
„Die vor rund einem Jahr begonnene<br />
konjunkturelle Abkühlung setzt sich<br />
laut EMI derzeit noch fort. Die Chancen<br />
stehen aber gut, dass es im Laufe<br />
dieses Jahres zu einer Trendwende<br />
kommt“, kommentierte Dr. Gertrud<br />
R. Traud, Chefvolkswirtin der Helaba<br />
Landesbank Hessen-Thüringen,<br />
32 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
ebenfalls Anfang Januar auf BME-<br />
Anfrage die aktuellen EMI-Daten.<br />
Wachstumsfördernd seien insbesondere<br />
zwei Faktoren: zum einen<br />
eine expansivere Fiskalpolitik in<br />
Deutschland, Europa, aber auch<br />
voraussichtlich in China, und zum<br />
anderen der stark gefallene Ölpreis.<br />
„Somit erwarten wir, dass das deutsche<br />
Bruttoinlandsprodukt 2019 mit<br />
rund 1,5 % weiterhin oberhalb der<br />
Beschäftigungsschwelle wachsen<br />
wird“, teilte die Helaba-Bankdirektorin<br />
mit.<br />
„Die Anspannung in der Industrie<br />
nimmt zu“, bewertete DIHK-Konjunkturexpertin<br />
Sophia Krietenbrink die<br />
aktuellen EMI-Daten. Die handelspolitischen<br />
Verwerfungen und die<br />
Herausforderungen in der Automobilindustrie<br />
seien 2018 deutlich zu spüren<br />
gewesen. Im neuen Jahr schaffe<br />
der Brexit zusätzliche Unsicherheit.<br />
Die Sorgen um die schwächere Nachfrage<br />
im In- und Ausland würden laut<br />
DIHK-Konjunkturumfrage insgesamt<br />
spürbar zunehmen. Angesichts dieser<br />
Unwägbarkeiten gingen auch die<br />
Investitionsabsichten der Industrieunternehmen<br />
merklich zurück.<br />
„Die globale Nachrichtenlage<br />
beschert uns Stimmungsschwankungen<br />
zwischen Erleichterung und<br />
Sorgen“, sagte Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt<br />
der DekaBank. Als Risikofaktoren,<br />
die auch 2019 auf der<br />
Tagesordnung blieben, nannte er<br />
den Handelskonflikt zwischen USA<br />
und China, die Situation in Italien,<br />
den Brexit sowie auch die Proteste<br />
in Frankreich.<br />
„Die Anspannung in der<br />
Industrie nimmt zu.“<br />
Sophia Krietenbrink,<br />
Konjunkturexpertin Deutsche Industrieund<br />
Handelskammer<br />
Niedriger Rohölpreis macht<br />
Fracking unrentabel<br />
Mit Blick auf die jüngste Entwicklung<br />
des EMI-Teilindex „Einkaufspreise“<br />
sagte Dr. Heinz-Jürgen Büchner,<br />
Managing Director der IKB<br />
Deutsche Industriebank AG: „Der<br />
stärker als erwartet gesunkene Rohölpreis<br />
hat schon auf große Teile<br />
der Wertschöpfungskette in der<br />
Kunststoffproduktion durchgeschlagen.<br />
Hier sehen wir noch weiteres<br />
Potenzial für Preissenkungen. Der<br />
aktuelle Rohölpreis macht zudem<br />
erste Frackingprojekte unrentabel.<br />
Die beschlossenen Kürzungen der<br />
OPEC-Fördermenge könnten allerdings<br />
bald für eine Trendumkehr<br />
sorgen.“<br />
Die Entwicklung einiger<br />
EMI-Teilindizes im Überblick<br />
Industrieproduktion: Das Produktionsniveau<br />
wuchs im Dezember<br />
2018 so kräftig wie seit drei Monaten<br />
nicht mehr. Nichtsdestotrotz war es<br />
eine der schwächsten Zuwachsraten<br />
seit Beginn der Wachstumsphase<br />
vor mehr als fünfeinhalb Jahren. Das<br />
Plus ging dabei fast ausschließlich<br />
auf Zuwächse im Konsumgüterbereich<br />
zurück, wo mehr Neuaufträge<br />
die Produktion ankurbelten.<br />
Auftragseingang insgesamt/<br />
Export: Zum Jahresende 2018 fiel<br />
das Minus beim Auftragseingang<br />
erneut größer aus. Der dritte Rückgang<br />
hintereinander beförderte den<br />
Teilindex auf den tiefsten Stand seit<br />
November 2014. Einige Umfrageteilnehmer<br />
verwiesen auf die niedrigere<br />
Nachfrage in der Automobilindustrie,<br />
Über den EMI<br />
Foto: DIHK Jens Schicke<br />
während andere meinten, die generelle<br />
Unsicherheit vieler Kunden<br />
wirke sich negativ auf die Verkaufszahlen<br />
aus. Die Hersteller von Vorleistungsgütern<br />
registrierten die<br />
deutlichsten Einbußen. Im Bereich<br />
Investitionsgüter fiel das Minus ebenfalls<br />
markant aus. Der saisonbereinigte<br />
Teilindex Exportorder rutschte<br />
weiter ab und notierte auf dem tiefsten<br />
Stand seit Dezember 2012.<br />
Jahresausblick: Der Teilindex blieb<br />
auch im Dezember unter der<br />
Schwelle von 50,0 Punkten, womit<br />
er zum dritten Mal hintereinander<br />
signalisierte, dass die Mehrheit der<br />
befragten Manager eher pessimistisch<br />
in die Zukunft blicke. Wie<br />
schon in den Vormonaten sorgten<br />
allen voran die strauchelnde Automobilindustrie,<br />
die Ungewissheiten<br />
in Verbindung mit dem Brexit sowie<br />
die Handelskonflikte für Sorgenfalten<br />
in den Chefetagen des Verarbeitenden<br />
Gewerbes. 2<br />
Der IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index (EMI) gibt einen allgemeinen<br />
Überblick über die konjunkturelle Lage in der deutschen Industrie.<br />
Der Index erscheint seit 1996 unter Schirmherrschaft des Bundesverbandes<br />
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME). Er wird vom<br />
Anbieter von Unternehmens-, Finanz- und Wirtschaftsinformationen IHS<br />
Markit mit Hauptsitz in London erstellt und beruht auf der Befragung von<br />
500 Einkaufsleitern/Geschäftsführern der verarbeitenden Industrie in<br />
Deutschland (nach Branche, Größe, Region repräsentativ für die deutsche<br />
Wirtschaft ausgewählt). Der EMI orientiert sich am Vorbild des US-Purchasing<br />
Manager’s Index (Markit U.S.-PMI).<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
33
Messen<br />
und Märkte<br />
Spezial: Konjunktur<br />
BGA rechnet 2019 mit minimalem Umsatzwachstum<br />
Großhandelsklima:<br />
Indikator am Scheideweg<br />
Der BGA-Großhandelsindikator ist zum Jahreswechsel 2018/19 trotz solider Lage spürbar um sieben<br />
Punkte gesunken – auf knapp über 124 Punkte. Schätzen die Unternehmer die Lage mit 132 Punkten in<br />
etwa auf Vorjahresniveau ein, sind die Erwartungen deutlich zurückgegangen. Dieser Teilindikator fiel<br />
um rund 16 Punkte auf nur noch 117 Punkte.<br />
Ursächlich hierfür sind dem<br />
Bundesverband Großhandel, Außenhandel,<br />
Dienstleistungen e.V. (BGA)<br />
zufolge ausreichende Kapazitäten<br />
bei rückläufigen Auftragseingängen.<br />
Sowohl das wirtschaftliche als auch<br />
das wirtschaftspolitische Umfeld<br />
überzeugten die Unternehmen nicht,<br />
zusätzliche Investitionen zu tätigen,<br />
so der Verband. Unternehmen<br />
monierten vor allem Geschäfts- und<br />
Investitionshürden sowie das Fehlen<br />
von Fachkräften und Auszubildenden<br />
in Deutschland.<br />
Der BGA rechnet vor diesem Hintergrund<br />
im Großhandel für das Jahr<br />
2018 mit einem realen Wachstum<br />
von 0,6 % und einem nominalen<br />
Wachstum von gut 3 %. Dies ergibt<br />
einen neuen Umsatzrekord von fast<br />
1.300 Mrd. € – wobei eben ein nicht<br />
unerheblicher Teil des Zuwachses<br />
auf steigenden Preisen infolge knapper<br />
Ressourcen und erhöhter Energiekosten<br />
basiert.<br />
Die Preisentwicklung werde<br />
nach BGA-Einschätzung auch 2019<br />
anhalten, die Umsätze aber auf<br />
Grund des verhaltenen Ausblicks<br />
nur um 2,5 % steigen und der reale<br />
Zuwachs sogar lediglich 0,1 % betragen.<br />
Nominal ergibt dies ein Umsatzvolumen<br />
in Höhe von 1.327 Mrd. €<br />
im Jahr 2019.<br />
Die nachlassende Dynamik schlage<br />
sich auch auf die Gesamtwirtschaftsleistung<br />
nieder. Hier erwartet der<br />
BGA für 2019 einen Anstieg von real<br />
1,3 % nach einem BIP-Wachstum von<br />
1,6 % im Jahr 2018.<br />
Politisches und staatliches<br />
Handeln beschleunigen<br />
„Es gilt politisches und staatliches<br />
Handeln zu beschleunigen, um bei<br />
dem Veränderungstempo des digitalen<br />
Wandels mitzukommen und<br />
nicht abgehängt zu werden“, so der<br />
BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann.<br />
Hier müsse die Politik ansetzen:<br />
Staat und Unternehmen besser aufstellen<br />
und sie agiler machen,<br />
„anstatt die Steuergelder mit der<br />
Gießkanne großzügig zu verteilen“,<br />
mahnte der BGA-Präsident weiter.<br />
Auf der Prioritätenliste der Unter-<br />
Dr. Holger Bingmann, BGA-Präsident<br />
nehmen steht der Ausbau der digitalen<br />
Infrastruktur ganz weit oben.<br />
Mehr als jedes zweite Unternehmen<br />
sehe hier den dringendsten politischen<br />
Handlungsbedarf. Es folgt die<br />
Modernisierung des Steuerrechts mit<br />
dem klaren Wunsch nach Entlastungen<br />
und vor allem Erleichterung für<br />
alle. Zwei von drei Unternehmen<br />
sähen nach der US-Steuerreform<br />
bestehenden Handlungsbedarf auch<br />
in Deutschland.<br />
„Wir alle spüren: Derzeit werden<br />
die Karten neu gemischt, politisch<br />
wie technologisch. Und da haben<br />
wir als viertgrößte Volkswirtschaft<br />
der Welt mit unseren Fähigkeiten<br />
und Möglichkeiten einen klaren<br />
Wettbewerbsvorteil und eine sehr<br />
gute Ausgangsbasis – eine viel bessere<br />
als die meisten anderen“, so<br />
Bingmann abschließend. 2<br />
Foto: BGA<br />
34 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Nachholbedarf bei Inlandsinvestitionen<br />
Umformtechnik hält Rekordniveau<br />
Die Umformtechnik hat sich im vergangenen<br />
Jahr „wieder als Zugpferd positioniert“,<br />
so Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer<br />
des Branchenverbands VDW (Verein<br />
Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) im<br />
November in Frankfurt am Main. Während<br />
die Zerspanung rückläufig ist, holt die<br />
Umformung aufgrund von Großaufträgen im<br />
Pressenbau auf, so der Verbandschef weiter.<br />
Vor allem im Inland sei der Nachholbedarf<br />
bei den Investitionen in Umformtechnik<br />
noch nicht abgeschlossen. Die ausländischen<br />
Bestellungen entwickeln sich innerhalb<br />
der Eurozone und in den Nicht-Euro-<br />
Ländern im Gleichschritt.<br />
Die Kapazitäten waren bei den Herstellern<br />
von Umformtechnik laut VDW im Oktober<br />
dieses Jahres zu 93,1 % ausgelastet. Im Vergleich<br />
zum Juli ist das ein Anstieg von rund<br />
5 %. Eine ähnlich hohe Auslastung wurde<br />
zuletzt im Juli 2012 gemessen. „Kapazitätsengpässe<br />
sind die meist genannte Herausforderung<br />
für die Unternehmen neben der<br />
Schwierigkeit, geeignetes Personal zu finden“,<br />
sagte Schäfer.<br />
Die Umformtechnik steuert etwa rund 30 %<br />
zur Gesamtproduktion der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie<br />
bei. Im vergangenen<br />
Jahr waren das rund 3 Mrd. €.<br />
Im dritten Quartal 2018 war der Umsatz in<br />
der Umformtechnik mit einem Zuwachs von<br />
14 % ähnlich gut gelaufen wie in der Zerspanung.<br />
Der VDW erwartet einen Produktionszuwachs<br />
für 2018 um 8 % auf ein Volumen<br />
von über 17 Mrd. €. Allerdings wies Schäfer<br />
ausdrücklich darauf hin, dass Branchenkonjunktur<br />
und Firmenentwicklungen wieder<br />
stärker auseinanderlaufen.<br />
Deutsche Hersteller von Umformtechnik<br />
Q3 2018 Auftragseingang: +14 %<br />
Bestellungen aus dem Inland: +12 %<br />
Bestellungen aus dem Ausland +16 %<br />
Q1-Q3 2018 gesamt: +12 %<br />
Bestellungen aus dem Inland: +20 %<br />
Bestellungen aus dem Ausland: +8 %<br />
Bildquelle: VDW, Renishaw<br />
3D-gedruckter Werkzeugeinsatz für den<br />
Kunststoff-Spritzguss<br />
Messen und Kongresse<br />
Ankündigungen und Berichte<br />
Messen und die sie oft begleitenden<br />
Kongresse zeigen aktuelle Entwicklungen zu<br />
Produkten und Dienstleistungen auf, sind<br />
Spiegel der Märkte und Orte der beruflichen<br />
Bildung. Das sind nur drei von vielen Gründen,<br />
warum die Redaktion dieser Fachzeitschrift<br />
solche Veranstaltungen als branchenrelevant<br />
identifiziert, sie ankündigt und<br />
über sie berichtet.<br />
Für das erste Halbjahr 2019 betrifft das die<br />
nachfolgend aufgeführten Events, wobei die<br />
BAU (14.-19.1.19 in München) – zeitlich<br />
nahe am Redaktionsschluss für dieses Heft<br />
– den Auftakt darstellt. Deshalb gibt es<br />
nebenstehend lediglich eine erste Bilanz,<br />
der im Heft 3/19 eine ausführliche Berichterstattung<br />
folgt:<br />
z LEARNTEC 2019; Internationale Fachmesse<br />
und Kongress (für digitale Bildung<br />
in Schule, Hochschule und Beruf); 29.-<br />
31.1.19; Karlsruhe<br />
z Intec; Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen,<br />
Fertigungs- und Automatisierungstechnik;<br />
5.-8.2.19; Leipzig<br />
z Z; Internationale Zuliefermesse für Teile,<br />
Komponenten, Module und Technologien;<br />
5.-8.2.19; Leipzig<br />
z LogiMAT 2019; Internationale Fachmesse<br />
und Kongress für Intralogistik-Lösungen<br />
und Prozessmanagement; 19.-21.2.19;<br />
Stuttgart<br />
z didacta; Bildungsmesse; 19.-23.2.19, Köln<br />
z Internationale Handwerksmesse IHM<br />
2019; 13.-17.3.19, München<br />
z HANNOVER MESSE; Weltleitmesse der<br />
Industrie; 1.-5.4.19; Hannover<br />
z bauma 2019; Weltleitmesse für Baumaschinen;<br />
8.-14.4.19; München<br />
z Stainless 2019; International Stainless<br />
Steel Fair; 15.-16.5.19; Brünn/Tschechische<br />
Republik<br />
z Moulding Expo 2019; Internationale Fachmesse<br />
des Werkzeug-, Modell- und Formenbaus:<br />
21.-24.7.19, Stuttgart<br />
z The Bright Worl d of Metals (GIFA, METEC,<br />
THERMPROCESS, NEWCAST); Technologiemessen;<br />
25.-29.6.19, Düsseldorf<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
35
Messen<br />
und Märkte<br />
Spezial: Safeguard-Maßnahmen<br />
EU- Safeguards – Endgültige Schutzmaßnahmen in Sicht<br />
Stahleinfuhren bleiben reglementiert<br />
Die von der EU-Kommission im Juli des letzten Jahres beschlossene 200-tägige Periode vorläufiger<br />
Schutzmaßnahmen für die Einfuhren von Stahlprodukten neigt sich dem Ende entgegen.<br />
Zum 3. Februar 2019 läuft diese Regelung aus. Jörg Feger, Bereichsleiter BDS-Research, schaut<br />
für den <strong>Stahlreport</strong> kurz zurück und richtet dann den Blick nach vorne.<br />
Im Rahmen der vorläufigen<br />
Maßnahmen fällt auf, dass für die Einfuhr<br />
der meisten Flacherzeugnisse<br />
noch bis zum letzten Tag ausreichende<br />
Kontingente vorhanden waren, bei<br />
Walzdraht, Betonstabstahl und Hohlprofilen<br />
zum Beispiel aber schon zur<br />
Weihnachtszeit keine oder kaum mehr<br />
zollfreie Einfuhren möglich waren.<br />
Hier haben sich also die von der EU-<br />
Kommission gewährten Quoten für<br />
den Bedarf des Marktes als zu gering<br />
erwiesen.<br />
Ende Dezember 2018 informierte<br />
die EU-Kommission per Amtsblatt<br />
darüber, dass im Falle eines Beschlusses<br />
von endgültigen Maßnahmen im<br />
Anschluss an die vorläufigen Maßnahmen<br />
spätestens am 1. Februar 2019<br />
eine entsprechende Durchführungsverordnung<br />
veröffentlicht würde.<br />
Anfang Januar veröffentlichte die Welthandelsorganisation<br />
(WTO) eine Notifikation<br />
der Europäischen Union, in<br />
der diese die WTO über die mögliche<br />
Ausgestaltung endgültiger Maßnahmen<br />
informierte. Dieser Vorschlag<br />
wurde am 16. Januar von den Mitgliedsstaaten<br />
der EU angenommen.<br />
Es gilt daher als höchstwahrscheinlich,<br />
dass folgende Regelungen ab dem 4.<br />
Februar 2019 in Kraft treten werden:<br />
z Es wird Importkontingente bis Juli<br />
2021 geben.<br />
z Dieser Zeitraum könnte in drei<br />
Betrachtungsperioden aufgeteilt werden<br />
(Februar 2019 bis Juli 2019, Juli<br />
2019 bis Juli 2020 und Juli 2020 bis<br />
Juli 2021).<br />
z Die betroffenen Produktgruppen orientieren<br />
sich größtenteils an den Produktgruppen,<br />
die den vorläufigen<br />
Maßnahmen unterlagen. Es sind<br />
jedoch folgende vier Produktgruppen<br />
neu hinzugekommen: „Quartobleche<br />
rostfrei“, Oberbau, „Andere nahtlose<br />
Rohre“ und „Unlegierte Stabstähle<br />
blank“. Die Produktgruppe Tragrohre<br />
wurde gestrichen. Die Produktgruppen<br />
„Nicht kornorientierte Elektrobleche“<br />
und „Bleche mit metallischem<br />
Überzug“ wurden weiter<br />
aufgeteilt.<br />
z Wie bei den vorläufigen Maßnahmen<br />
würden die Kontingente pro Produktgruppe<br />
gebildet werden. Diese Kontingente<br />
könnten sich nach den<br />
durchschnittlichen Importen im Zeitraum<br />
2015 bis 2017 bemessen,<br />
zuzüglich eines Aufschlags von 5 %.<br />
Pro Betrachtungszeitraum würden<br />
jeweils weitere 5 % zugeschlagen, so<br />
dass die Quoten im Laufe der Zeit<br />
zunehmen würden.<br />
z Für „bedeutende“ Lieferländer werden<br />
individuelle länderspezifische<br />
Kontingente in Erwägung gezogen,<br />
so dass die Gesamtmenge des jeweiligen<br />
Kontingents für eine Produktgruppe<br />
in länderspezifische Teilmengen<br />
für „bedeutende Lieferländer“<br />
und eine Restmenge für alle übrigen<br />
Länder aufgeteilt würde. Eine Ausnahme<br />
soll jedoch bei Warmbreitband<br />
gemacht werden. Hier könnte<br />
es keine länderspezifische Betrachtung<br />
geben, so dass die Kontingente<br />
für diese Kategorie für Einfuhren aus<br />
allen Ländern gelten würden.<br />
z Die länderspezifischen Kontingente<br />
für „bedeutende“ Lieferländer würden<br />
für die oben genannten Betrachtungsperioden<br />
gelten. Die restlichen<br />
Kontingente für die übrigen Länder<br />
sollen dagegen quartalsweise eingeteilt<br />
werden, wobei nicht genutzte<br />
Mengen auch im darauffolgenden<br />
Quartal in Anspruch genommen werden<br />
könnten. Schließlich sollten<br />
nicht ausgeschöpfte restliche Kontingente<br />
auch für Einfuhren aus<br />
„bedeutenden“ Lieferländern zur<br />
Verfügung stehen, jedoch nur im<br />
letzten Quartal.<br />
z Nach Erreichen der Quote würde<br />
25 % Schutzzoll erhoben.<br />
Mit der Veröffentlichung der endgültigen<br />
Entscheidung durch die EU-Kommission<br />
im Amtsblatt ist in der letzten<br />
Januarwoche bzw. spätestens am 1.<br />
Februar zu rechnen. 2<br />
36 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
FVK und IBU: Stellungname zu den Safeguard-Maßnahmen<br />
Stahlverarbeiter<br />
beklagen Preiserhöhungen<br />
Keine pauschalen Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte ohne<br />
Berücksichtigung der Warenkategorien. Keine Länderquoten und<br />
marktgerechter Zugang zu Stahlprodukten. Und keine Spekulationen<br />
über Handelsströme als Kriterium für die Einführung von Importquoten:<br />
Mit diesen Forderungen setzen der Industrieverband Blechumformung<br />
e. V. (IBU) und die Fachvereinigung Kaltwalzwerke e. V.<br />
(FVK) ihren Kampf gegen die von der EU-Kommission im Juli vorläufig<br />
verhängten Safeguard-Maßnahmen fort. Sie sollen eine vermutete<br />
Umlenkung von Stahlprodukten nach Europa – ausgelöst durch<br />
US-Einfuhrzölle – verhindern.<br />
Kurz vor Ablauf der im Sommer<br />
gesetzten 200-Tage-Frist unterstrichen<br />
der Industrieverband Blechumformung<br />
und die Fachvereinigung<br />
Kaltwalzwerke in einem Schreiben<br />
an das Bundesministerium für Wirtschaft<br />
und Energie: „Verlierer der<br />
Importquoteneinführung wären die<br />
stahlverarbeitenden Branchen und<br />
ihre rund 4,2 Mio. Mitarbeiter. Gewinner<br />
wäre die Stahlindustrie. Sie hat<br />
schon jetzt in den für viele IBU-Mitglieder<br />
relevanten Warenkategorien<br />
gute Absätze. Das zeigen sowohl die<br />
Wirtschaftsindikatoren der Welthandelsorganisation<br />
(WTO) als auch die<br />
Unternehmensergebnisse wichtiger<br />
Flachstahlproduzenten.“<br />
Wettbewerbsfähige Versorgung<br />
überlebenswichtig<br />
Den „Schutzbedürftigen“, denen die<br />
Safeguards helfen sollen, geht es<br />
also gut, meinen die Fachvereinigung<br />
Kaltwalzwerke und der Industrieverband<br />
Blechumformung. Die<br />
Stahlverarbeiter, darunter viele Autozulieferer,<br />
litten, so die Verbände:<br />
„Unsere Mitgliedsunternehmen aus<br />
der meist mittelständischen Zuliefererindustrie<br />
haben einen Materialkostenanteil<br />
von fast 60 %. Die ausreichende<br />
Versorgung mit Stahl zu<br />
international wettbewerbsfähigen<br />
Preisen ist für sie überlebenswichtig.<br />
Stahlimporte sichern die Produktion<br />
in Deutschland“, betonte IBU-<br />
Geschäftsführer Bernhard Jacobs.<br />
Die Verbände machten klar,<br />
nicht generell gegen Schutzmaßnahmen<br />
zu sein. Sie halten diese aber<br />
für die relevanten Warenkategorien<br />
für überzogen: Es fehle die Differenzierung.<br />
„Wir sehen hier keine aktuelle,<br />
durch externe Ereignisse ausgelöste<br />
‚Schocksituation’ für die<br />
stahlproduzierende Industrie. Stahl<br />
ist nicht gleich Stahl. Kein EU-Verwender<br />
wird Warmbreitband statt<br />
Großrohren einführen, um Kosten<br />
zu sparen. Damit kann er gar nicht<br />
arbeiten.“<br />
Entwicklung der Handelsströme<br />
offen<br />
Als externe Auslöser für die Safeguards<br />
gelten die 2017 eingeleiteten<br />
und im März 2018 verhängten<br />
US-Zölle auf Stahlimporte. Die EU-<br />
Kommission beleuchte bei der<br />
Schutzmaßnahmen-Entscheidung<br />
allerdings schwerpunktmäßig den<br />
Zeitraum von 2013 bis 2016. „Wenn<br />
es um eine durch die US-Zölle ausgelöste<br />
unvorhersehbare Entwicklung<br />
geht, dann sollte die Kommission<br />
auch das entsprechende<br />
Zeitfenster berücksichtigen“, kritisiert<br />
der IBU. In dieser Phase seien<br />
die Importe nämlich weder signifikant<br />
gestiegen noch gesunken – das<br />
belegten Zahlen von Eurostat bis<br />
September 2018.<br />
Auch die von der EU offenbar<br />
erwogenen länderspezifischen<br />
Importkontingente lehnt der IBU ab.<br />
Für den Verband wäre das eine drastische<br />
Einschränkung der Versorgung<br />
der Stahlverarbeiter und eine „weitgehende<br />
Eliminierung des Importwettbewerbs,<br />
der zu erheblichen<br />
Preisanstiegen führen würde.“ 2<br />
Statement zu<br />
Safeguard-Maßnahmen<br />
Stahlhersteller:<br />
Kommissionsvorschlag<br />
geht nicht weit genug<br />
Am 22. Dezember 2018 hat<br />
die Europäische Kommission ihre<br />
Vorschläge für endgültige Safeguard-Maßnahmen<br />
an die EU-Mitgliedsstaaten<br />
übermittelt. Am 16.<br />
Januar 2019 haben die Mitgliedsstaaten<br />
über den Kommissionsvorschlag<br />
entscheiden. Die Umwandlung<br />
der vorläufigen<br />
Safeguard-Maßnahmen in endgültige<br />
Maßnahmen sei ein notwendiger<br />
Schritt, sagte Hans Jürgen Kerkhoff,<br />
Präsident der Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl, im Januar.<br />
Allerdings seien die Vorschläge der<br />
Europäischen Kommission für eine<br />
konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen<br />
ungeeignet, die Stahlindustrie<br />
vor den massiven Handelsumlenkungen<br />
effektiv zu schützen, so<br />
der Verbandspräsident weiter. Kerkhoff<br />
zufolge seien die Stahlimporte<br />
in die EU bereits in 2018 als Folge<br />
der US-Zölle um 10 % gestiegen. Er<br />
kritisierte, dass die die Maßnahmen<br />
nun sogar weiter verwässert würden,<br />
indem unter anderem die Zollkontingente,<br />
also die Menge an<br />
Importen, die weiter zollfrei in die<br />
EU importiert werden kann, schrittweise<br />
erhöht werde.<br />
Die Lockerung der Kontingente sei<br />
„umso unverständlicher, da die<br />
Umlenkungseffekte künftig auch<br />
nach Ansicht der Kommission eher<br />
noch zunehmen werden“. Der Kommissionsvorschlag,<br />
so Kerkhoff,<br />
müsse dringend nachgebessert werden.<br />
„Andernfalls droht die Hauptlast<br />
des US-Protektionismus auf die<br />
Stahlindustrie in Europa abgewälzt<br />
zu werden“, beklagte Hans Jürgen<br />
Kerkhoff.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
37
Messen<br />
und Märkte<br />
Berichte/Nachricht<br />
Der Gemeinschaftsstand<br />
des Bauforums<br />
Stahl auf der<br />
Bau in München –<br />
am zweiten Messetag<br />
Foto: StudioLoske<br />
Messe Bau in München<br />
Material und mehr<br />
Die Münchner Baumesse erschloss sich dem Besucher auch in diesem Jahr (14.-19.1.) anhand ihrer konsequenten<br />
Gliederung nach Materialien (Stahl in Halle B2), durch die Integration einzelne Angebote<br />
systematisierender Verbandsaktivitäten (z.B. des Bauforums Stahl beispielsweise) und – erstmals in<br />
dieser Intensität – mit Hilfe einer Konkretisierung des allumfassenden Digitalisierungsthemas unter<br />
dem Kürzel BIM. Produkte und Dienstleistungen ausstellender Firmen und Organisationen werden<br />
schwerpunktmäßig im nächsten Heft vorgestellt, der Rahmen dafür wird nachfolgend beschrieben.<br />
Dieser Rahmen setzt sich aus<br />
wirtschaftlichen und technischen<br />
Elementen zusammen:<br />
z Die Baukonjunktur boomt nach wie<br />
vor und immer wieder tauchen<br />
zusätzliche Bauaufgaben auf. Das<br />
führt inzwischen dazu, dass diese<br />
Herausforderungen nicht mehr<br />
allein durch Neubau erledigt werden<br />
können, sondern zunehmend<br />
im Bestand erledigt werden müssen.<br />
z Um dies qualitativ hochwertig<br />
gestalten zu können, setzt die Baubranche<br />
zunehmend auf BIM. Diese<br />
Methode der optimalen Planung,<br />
Ausführung und Bewirtschaftung<br />
von Bauwerken (Building Information<br />
Modeling) ist durch den gegenwärtigen<br />
Megatrend der Digitalisierung<br />
erst realisierbar geworden.<br />
Die wirtschaftlichen Entwicklungen<br />
der Branche beobachtet u.a. der Bundesverband<br />
Deutscher Baustoff-Fachhandel<br />
e.V. (BDB) besonders intensiv.<br />
Sein Hauptgeschäftsführer<br />
berichtete in München davon, dass<br />
der Umsatz von 15,3 Mrd. € in 2018<br />
gegenüber dem Vorjahr ein Plus von<br />
5 % ausgemacht habe. Die Bedeutung<br />
der rund 900 Mitgliedsunternehmen<br />
leite sich aber auch aus deren etwa<br />
2.400 Niederlassungen ab, die auch<br />
für Botschaften an die Märkte stehen.<br />
Verband und Wissenschaft<br />
Davon produziert der BDB regelmäßig<br />
viele in Verbindung mit der Wissenschaft.<br />
In diesem Zusammenhang<br />
präsentierte das Pestel-Institut aus<br />
Hannover in der bayerischen Landeshauptstadt<br />
die Studien „Wohnen<br />
65plus“ zu altersbezogenen Defiziten<br />
auf dem Immobilienmarkt sowie die<br />
„Wohn-Prognose 2025“ zu dem sich<br />
abzeichnenden Bedarf.<br />
Lösungen zu dessen Deckung<br />
präsentierte in München ebenfalls<br />
auf einer Pressekonferenz das Bauforum<br />
Stahl. Für die verbandliche<br />
Vertretung des Stahlbaus in Deutschland<br />
kündigte der neue Geschäftsführer<br />
im zweiköpfigen Führungsteam<br />
des bauforumstahl e.V., Dr.<br />
Rolf Heddrich, in Absprache mit seinem<br />
Kollegen Gregor Machura an,<br />
den Marktanteil des Stahlbaus bis<br />
2025 gegenüber heute um 20 % steigern<br />
zu wollen. Noch in diesem Jahr<br />
will das Team die Mitgliederzahl von<br />
350 auf 400 erhöhen.<br />
Technische Werkzeuge auf diesem<br />
Weg wurden auf dem Gemeinschaftstand<br />
des Forums angesprochen.<br />
Das Spektrum reichte von der<br />
Umweltdeklaration für Baustähle,<br />
dem Ingenieurpreis des Deutschen<br />
Stahlbaus 2019 und einem umfassendes<br />
Vortragsprogramm bis hin<br />
zu der Ankündigung, die Nachwuchsförderung<br />
zu intensivieren –<br />
u.a. durch eine erste Berufsfachmesse<br />
für den Stahlbau am 9.11.19<br />
an einem noch festzulegenden Standort<br />
in Nordrhein-Westfalen. 2<br />
[ Info ]<br />
Die BAU fand vom 11. bis 16.1.2021 wieder<br />
in München statt, die digital Bau findet<br />
vom 11.-13.2.20 in Köln statt.<br />
38 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Das Logo der Learntec …<br />
… und das Logo der Didacta.<br />
Messen Intec und Z<br />
Sonderschau verbindet<br />
Das traditionelle Leipziger Messeduo zur Metallbearbeitung<br />
(Intec) und für die Zulieferindustrie (Z) bietet in diesem Jahr<br />
(5.-8.2.) nicht nur diese Verbindung, sondern zeigt beispielsweise<br />
über die Sonderschau „Additiv + Hybrid“, wie sich die Welten<br />
der Fertigungstechnologien derzeit einander annähern. Dies ist<br />
nur eine von zahlreichen Thematiken, die auf der Messe in der<br />
sächsischen Metropole die Präsentationen über Produkte und<br />
Dienstleistungen von rund 1.300 Ausstellern ergänzen.<br />
Zwei Events und ein Thema<br />
Die Bildungsrealität auf<br />
Learntec und Didacta<br />
Bestimmt die Lerntechnik die<br />
Didaktik, oder beeinflussen didaktische<br />
Überlegungen die zu verwendende Technik?<br />
Vor diese vermeintliche Alternative –<br />
in Wirklichkeit geht es immer um die<br />
Frage der optimalen Lernrealität – sieht<br />
sich mancher Zeitgenosse angesichts der<br />
beiden bevorstehenden Bildungsevents<br />
gestellt: Vom 29.-31.1.19 findet in Karlsruhe<br />
die Learntec statt, zwischen dem<br />
19. und 23.2.19 bietet Köln die Didacta.<br />
Auf der Intec erwartet die<br />
Besucher ein umfangreiches Angebot<br />
an Fertigungstechnik für die<br />
Metallbearbeitung, Automatisierungstechnik<br />
für vor- und nachgelagerte<br />
Prozesse in der Produktion,<br />
aber auch Technik und Ausrüstungen<br />
für Werkstatt und Betrieb. Technologieführer<br />
aus dem Werkzeugmaschinenbau,<br />
renommierte<br />
Anbieter von Präzisionswerkzeugen<br />
und Spezialisten für Automatisierungslösungen<br />
aus dem In- und Ausland<br />
präsentieren ihr Leistungsspektrum.<br />
In diesem Zusammenhang<br />
zeigen die großen deutschen Maschinenbauzentren<br />
Baden-Württemberg,<br />
Sachsen, Nordrhein-Westfalen sowie<br />
Bayern eine starke Präsenz.<br />
Partnerveranstaltung<br />
Als Partner zur Intec geht zeitgleich<br />
die Zuliefermesse Z an den Start. Sie<br />
bietet speziell Zulieferern der mittleren<br />
Produktionsstufen eine Plattform<br />
für ihre Positionierung am<br />
Markt. Mit innovativen Ideen und<br />
anspruchsvollen Produkten wollen<br />
die Zulieferer eine auf die Bedürfnisse<br />
der Industrie zugeschnittene<br />
Ausstellung präsentieren. Es geht<br />
um Teile und Komponenten aus<br />
Metallen, Kunststoffen sowie neuartigen<br />
Materialien.<br />
Das Fachprogramm des Messeverbunds<br />
will mit Foren, Workshops<br />
und Sonderschauen vielfältige Informationen<br />
zu den Zukunftstehemen<br />
der beteiligten Branchen bieten.<br />
So präsentiert die für Intec und Z<br />
2019 neu konzipierte Sonderschau<br />
mit integriertem Fachforum „Additiv<br />
+ Hybrid – Neue Fertigungstechnologien<br />
im Einsatz“ beispielsweise<br />
Anwendungen sowie Trends für intelligente<br />
Verfahrenskombinationen und<br />
verdeutlicht, wie sich in der Kombination<br />
klassischer Fertigungsverfahren<br />
mit neuartigen Technologien die<br />
Grenzen herkömmlicher Prozesse<br />
überwinden lassen. Auf einer Sonderfläche<br />
werden Exponate und<br />
Anwendungsbeispiele vorgestellt. Das<br />
Fachforum gibt an allen Messetagen<br />
Einblick in den aktuellen Stand der<br />
Technik und bietet Beispiele für<br />
bereits in der Praxis eingesetzte<br />
Lösungen, u.a. Möglichkeiten der<br />
Funktionsintegration und Vorteile<br />
durch Multimaterial-Fertigung. 2<br />
Über 300 Aussteller aus 14 Nationen präsentieren<br />
auf der LEARNTEC die neuesten<br />
Anwendungen, Programme und Lösungen<br />
für die digitale Bildung in Schule sowie für<br />
die akademische und berufliche Bildung.<br />
Mehr als 10.000 Entscheider werden in<br />
Baden erwartet, wo für sie außer der<br />
Messe auch wieder ein Kongress vorbereitet<br />
worden ist.<br />
Etwa 800 Unternehmen aus rund 40 Ländern<br />
sind auf der didacta vertreten, die<br />
sich eher traditionell nach vier Zielgruppen<br />
gliedert: frühe Bildung, Schule/Hochschule<br />
und berufliche sowie digitale Bildung.<br />
Aktuelle und eher politische Fragen<br />
aus diesen Bereichen werden auf dem<br />
begleitenden Kongress aufgegriffen.<br />
Im Mittelpunkt steht in beiden Fällen die<br />
Lernrealität – entweder als klassische<br />
Präsenzveranstaltung, in Form von Augumented<br />
Reality, bei der es um eine computergestützt<br />
erweiterte Bildung geht, als<br />
Virtual Reality oder von vornherein in den<br />
zahlreichen Mischformen einer Mixed<br />
Reality. Ein solches Blended Learning<br />
optimiert in vielen Fällen die Entscheidung<br />
über die angesprochene Alternative<br />
und verbindet die beiden Bildungsgipfel<br />
am Rhein.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
39
Messen<br />
und Märkte<br />
Berichte<br />
Eurotech liefert Hebegerät zum Handling von langen Stahlplatten<br />
Ein Vakuum-Riese zum<br />
Schwenken von Platten<br />
Die Eurotech Vertriebs GmbH hat ein 14 m langes Hebegerät an einen Kunden in Frankreich geliefert.<br />
Das große eT-Hover Hebegerät des Vakuumspezialisten ist in der Lage, Platten mit einer Gesamtlänge<br />
von 16 bis 18 m zu heben und um 90° zu schwenken.<br />
Genau 14 m misst das eT-<br />
Hover, das an den französischen<br />
Anlagenspezialisten Ziemex geliefert<br />
wurde. Ziemex konstruiert, fertigt<br />
und installiert hochwertige Behälter<br />
und Anlagen aus Stahl, Edelstahl<br />
und Aluminium für verschiedenste<br />
Industriebereiche. Bei der Produktion<br />
müssen unter anderem sehr<br />
große Metallplatten gehandhabt werden.<br />
Hier vertraute das Unternehmen<br />
dem Erfahrungsschatz der euro-<br />
TECH Vertriebs GmbH.<br />
Um Platten mit einer maximalen<br />
Länge von 18 m zu heben, beträgt<br />
die Gesamtlänge des Gerätes 14 m.<br />
Damit das eT-Hover auch für weniger<br />
lange Platten einsetzbar ist, lassen<br />
sich die teleskopierbaren Traversen<br />
auf eine Gesamtlänge von 10 m verkürzen.<br />
Mit Hilfe seiner 52 Saugplatten<br />
trägt das Gerät bis zu 2 t<br />
Last. Der hydraulische Schwenkantrieb<br />
schwenkt die zu hebenden Platten<br />
um 90°. Somit können die Platten<br />
sowohl vertikal als auch horizontal<br />
transportiert werden. Ebenso<br />
lassen sich Platten aus Glas, Kunststoff<br />
oder Holz mit dem Gerät handhaben.<br />
Auch für Baustellen-Einsatz<br />
geeignet<br />
Die Bedienung des eT-Hover Hebegeräts<br />
erfolgt durch eine Kabelfernbedienung<br />
mit 10 m Kabellänge. In<br />
dieser sind alle wichtigen Funktionen<br />
wie Saugen, Belüften und Schwenken<br />
integriert. Zum schnellen Lösen der<br />
Last ist eine Abblaseinrichtung eingebaut.<br />
Das eT-Hover verfügt über<br />
zwei getrennte und überwachte Saugkreise<br />
und kann somit auch auf Baustellen<br />
zum Einsatz kommen.<br />
Die Sauger lassen sich auf der Quertraverse<br />
verschieben und sind einzeln<br />
über einen Kugelhahn absperrbar. Die<br />
Quertraversen sind ebenfalls verstellbar.<br />
An den Quertraversen sind die<br />
Sauger mit Kreuzklemmstücken montiert<br />
und gefedert aufgehängt. Das<br />
Hebegerät verfügt wie alle Hebegeräte<br />
von Eurotech über mehrere Sicherheits-<br />
und Warneinrichtungen nach<br />
DIN EN 13155 zur Verhinderung von<br />
Fehlbedienung und Gefahren.<br />
Eurotech bietet Handling- und<br />
Transportlösungen im Bereich der<br />
Vakuumtechnik. Das Unternehmen<br />
entwickelt kundenspezifische Vakuumsysteme<br />
und -komponenten für<br />
automatisierte Handhabungsaufgaben.<br />
Mit dem Eurotech-Baukastensystem<br />
ist eine flexible Anpassung<br />
der Komponenten an die jeweiligen<br />
Kundenwünsche sowie ein schnelles<br />
kostengünstiges Austauschen von<br />
Ersatzteilen möglich, wirbt der Hersteller.<br />
2<br />
Elegant schwenkt der eT-Hover von Eurotech eine große Platte um 45°<br />
Bildquelle: Eurotech<br />
40 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Bildquelle: STM Stein-Moser<br />
Ökologisch attraktiv: beim Wasserstrahlschneiden entstehen während des<br />
Betriebs weder Gase noch Staube.<br />
Wie Produktionsdaten in einem Netzwerk ausgetauscht und<br />
genutzt werden können, steht bei STM im Fokus.<br />
STM – Einstieg in eine vollautomatisierte Produktion<br />
Industrie 4.0-integriertes<br />
Wasserstrahl-Schneiden<br />
Der österreichische Wasserstrahl-Spezialist Stein-Moser GmbH (STM) hat im vergangenen Jahr auf der<br />
EuroBLECH eine Kombination aus Machine-to-Machine (M2M)-fähigen Hochleistungssystemen und<br />
ganzheitlicher Applikationsberatung präsentiert. Damit will das Unternehmen kleinen und mittleren<br />
Betrieben den Einstieg in „IIoT“-basierte Prozesse vereinfachen (IIot = Industrial Internet of Things).<br />
STM-Anlagen ermöglichten<br />
den Datenaustausch über alle aktuell<br />
möglichen Schnittstellen – von<br />
der Arbeitsvorbereitung, CRM- und<br />
Prozessleitsystemen bis hin zu<br />
genormten Schnittstellen wie ProfiNET,<br />
ProfiBUS, UDP-Protokoll oder<br />
OPC-Server (siehe Infokasten).<br />
Mit STM-Wasserstrahl-Schneidanlagen<br />
seien Materialien aller Art<br />
ohne Umrüstaufwand vollautomatisch<br />
und energieeffizient zu schneiden<br />
– ob als Sonderanfertigung oder<br />
in Serie. Zusätzlich haben die Ingenieure<br />
von STM profundes Knowhow<br />
entwickelt, wie Produktionsdaten<br />
in einem mehr oder wenigen<br />
offenen Netzwerk ausgetauscht und<br />
genutzt werden können, so das<br />
Unternehmen.<br />
Vorteile des<br />
Wasserstrahl-Schneidens<br />
Vorteile der Wasserstrahl-Schneidtechnologie<br />
seien eine hohe Präzision,<br />
geringe Schnittbreiten und<br />
hohe Schnittkantenqualität. In einem<br />
Arbeitsgang seien beliebig komplexe<br />
und filigrane Schnittfolgen möglich<br />
– und zwar ohne Aufhärtungen,<br />
Materialspannungen und thermische<br />
Veränderungen. Zudem wiesen<br />
die Schneidanlagen eine hohe Verschleißfestigkeit<br />
auf.<br />
In punkto Wirtschaftlichkeit<br />
überzeuge die Wasserstrahltechnologie<br />
vor allem durch den hohen<br />
Automatisierungsgrad, minimale<br />
Werkzeugkosten sowie geringen<br />
Materialverlust. Die sonst übliche<br />
Nachbearbeitung durch thermische<br />
Verformung oder Grate falle vollständig<br />
weg, betont STM. Der Wartungsbedarf<br />
sei ebenfalls gering,<br />
Info<br />
ProfiBUS<br />
ProfiNET<br />
UDP-Protokoll<br />
OPC-Server<br />
Probleme könnten meist per Fernwartung<br />
schnell und kostengünstig<br />
gelöst werden.<br />
STM ist ein etablierter Anbieter<br />
von Wasserstrahl-Schneidsystemen<br />
mit Sitz in Eben, Österreich, und<br />
Schweinfurt, Deutschland. Seit<br />
über 20 Jahren entwickelt das<br />
Unternehmen Produktionslösungen<br />
vor allem für die Stahl-, Aluminium-,<br />
Metall-, Kunststoff-, Steinund<br />
Glasindustrie, die sich vor<br />
allem durch Effizienz, Bedienungskomfort<br />
und Verschleißfestigkeit<br />
auszeichneten. 2<br />
Process Field Bus, ein Kommunikationsstandard in der<br />
Automatisierungstechnik<br />
Process Field Network, ein offener Industriestandard<br />
für die Kommunikation in der Automatisierung<br />
User Datagram Protocol, ein Netzwerkprotokoll zum<br />
Austausch von Daten in Rechnernetzwerken<br />
Open Platform Communications Server, Software-<br />
Schnittstelle für den Datenaustausch aus verschiedenen<br />
Quellen in der Automatisierungstechnik<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
41
Messen<br />
und Märkte<br />
Nachrichten<br />
Bildquelle: H.P. Kaysser<br />
Verschiedene Muster von individuellen Blechteilen<br />
Laserteile4you – vom Prototyp bis zur Serie online bestellen<br />
Individuelle Laserteile übers Internet<br />
Das Online-Portal Laserteile4you hat auf der internationalen<br />
Technologiemesse EuroBLECH im vergangenen Jahr seine Neuheiten<br />
und technischen Weiterentwicklungen präsentiert: die Stanz- und<br />
Stanz-Lasertechnologie sowie den 2D-Grafik-Editor.<br />
Der 2D-Grafik-Editor erlaubt die Überarbeitung von DXF- und STEP-<br />
Daten während der Online-Anfrage. So können hochgeladene Zeichnungen<br />
von Laserteilen geprüft und bei Bedarf geändert werden,<br />
zugleich können auch geplante Bearbeitungen und Umformungen<br />
zugeordnet, ergänzt oder korrigiert werden.<br />
Hinter Laserteile4you, einer Dienstleistung der Stuttgarter H.P. Kaysser<br />
GmbH + Co. KG Systemlösungen in Metall, steckt ein Technologie-Konzept,<br />
das seit 2010 Software, Hardware und Dienstleistungen<br />
intelligent miteinander verknüpft. Individuelle Aufträge über Laserzuschnitte,<br />
Blechbiegeteile und Stanz-Laserbearbeitungen können auf<br />
dem Portal jederzeit durch den Kunden vollautomatisch kalkuliert<br />
und direkt online beauftragt werden, wirbt das Unternehmen. Bestellungen<br />
sind im Fein- oder Dickblechbereich sowie auch vom Prototyp<br />
bis zur Serie möglich – einfaches Handling und anwenderfreundliche<br />
Benutzerführung inklusive. Der gesamte Bestellvorgang werde von<br />
der Angebotserstellung über die Auftragsannahme und Fertigung bis<br />
zur Auslieferung prozesssicher und zuverlässig abgewickelt, so das<br />
Unternehmen weiter.<br />
Kunden profitierten von mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Laserbearbeitung<br />
und einer großen Auswahl bei den Materialien Stahlblech,<br />
Edelstahl, Aluminium und Buntmetall. Das Portal werde kontinuierlich<br />
erweitert und mit vielseitigen Fertigungsoptionen ausgebaut. Als<br />
familiengeführter Mittelständler produziert das Dienstleistungsunternehmen<br />
mit über 400 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
in Nellmersbach bei Stuttgart.<br />
Informationen aus erster Hand<br />
Intralogistik zu Gast in Stuttgart<br />
Unter dem Motto „Intralogistik aus<br />
erster Hand: Intelligent – Effizient – Innovativ“<br />
präsentiert sich die LogiMAT 2019 (19.-<br />
21.2.19) mit über 1.600 internationalen<br />
Ausstellern in zehn Hallen des Stuttgarter<br />
Messegeländes auf 120.000 m 2 Ausstellungsfläche.<br />
Sie gilt als führende Fachmesse<br />
für Intralogistik-Lösungen sowie Prozessmanagement<br />
und will über bewährte Konzepte,<br />
richtungsweisende Trends sowie Innovationen<br />
informieren – wie drei von vielen Beispielen<br />
zeigen.<br />
Auf das Fachpublikum, so verspricht es der<br />
Veranstalter, wartet in einem spannenden<br />
Mix aus mittelständischen Unternehmen<br />
und Global Playern mit zahlreichen Weltpremieren<br />
ein kompletter Überblick über die<br />
aktuellen Produkte und Innovationen der<br />
Intralogistik-Branche. Im Mittelpunkt stehen<br />
die wesentlichen Treiber und Herausforderungen<br />
der Intralogistik: Industrie 4.0,<br />
Künstliche Intelligenz und die durchgängige<br />
Digitalisierung der Prozesse entlang der<br />
Supply Chain. Darüber hinaus geht es um<br />
die Vernetzung von Intralogistik, Produktion<br />
und Handel.<br />
Unter der Ansage „Messe mit Mehrwert“<br />
sollen die Besucher außer von den Präsentationen<br />
auch von einem umfangreichen<br />
Rahmenprogramm profitieren. Ein Beispiel:<br />
An den 31 Vortragsreihen beteiligen sich<br />
auf den Foren direkt in den Hallen mehr als<br />
100 Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft.<br />
Bereits zum sechsten Mal findet im Rahmen<br />
der Stuttgarter Intralogistikmesse die Trade-<br />
World statt. Der Kongress will innovative<br />
Lösungen zur Entwicklung und operativen<br />
Umsetzung digitaler Handelsprozesse aufzeigen.<br />
In Sachen Produkt- und Servicepräsentationen<br />
haben zahlreiche Aussteller im Vorfeld<br />
des Events ihre Präsentationspläne veröffentlicht<br />
und dem erwarteten Publikum so<br />
einen Ausblick auf den Besuchsnutzen<br />
gegeben:<br />
z Die AIT Goehner GmbH präsentiert ein in<br />
Zusammenarbeit mit der Wanzl Metallwarenfabrik<br />
GmbH entwickeltes automatisiertes<br />
Kassensystem ohne Personaleinsatz für den<br />
Betrieb eines 24 h-Shops.<br />
z Linde Material Handling empfiehlt sich als<br />
Intralogistiker mit umfassendem Projektgeschäft,<br />
dessen Leistungsspektrum von der<br />
Planung bis zur Realisierung von Komplettlösungen<br />
mit Lager- und Transportsystemen<br />
reicht, diese mit einer Lagerverwaltungs-<br />
Software verknüpft und dabei alle Abstufungen<br />
der Automatisierung umfasst.<br />
z Den aktuellen Status von Warenlieferungen<br />
soll eine erstmals präsentierte App der SPE-<br />
DION GmbH transparent machen. Die digitalisierte<br />
Übertragung von Echtzeit-Statusmeldungen<br />
via Telematik soll die Effizienz<br />
der logistischen Abläufe erhöhen.<br />
42 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Reed Exhibitions übernimmt Mack Brooks Exhibitions<br />
Messe EuroBLECH in neuen Händen<br />
Messeveranstalter Reed Exhibitions,<br />
Teil der RELX Group, hat im Januar den<br />
Abschluss eines Vertrages zum Kauf von<br />
Mack Brooks Exhibitions bekannt gegeben.<br />
Damit erweitert das britsche Unternehmen<br />
sein globales Portfolio um „herausragende,<br />
branchenführende Marken“.<br />
Mack Brooks Exhibitions (St. Albans, Großbritannien)<br />
wurde 1965 gegründet und organisiert<br />
mehr als 30 B2B-Veranstaltungen für<br />
neun Branchen in 14 Ländern, darunter in<br />
Deutschland und Großbritannien. Zu den<br />
wichtigsten Veranstaltungen gehören die<br />
EuroBLECH (Blechbearbeitung), inter airport<br />
(Flughafenausrüstung und -technologie),<br />
Fastener Fair (Verbindungs- und Befestigungstechnik),<br />
Chemspec (Fein- und Spezialchemie),<br />
RAILTEX (Schienenverkehrsausrüstung),<br />
ICE Europe (Papier-, Folien- und<br />
Folienverarbeitung), CCE (Herstellung und<br />
Verarbeitung von Wellpappe und Faltschachteln),<br />
PSE Europe (Polyurethanverarbeitung)<br />
und InPrint (Drucktechnologie in der industriellen<br />
Fertigung). Auch außerhalb Deutschlands<br />
und Großbritanniens hat der Messeveranstalter<br />
viele dieser Marken erfolgreich<br />
positioniert.<br />
„Ich freue mich für unsere Kunden und Mitarbeiter<br />
und sehe eine äußerst positive<br />
Zukunft für Mack Brooks als Teil von Reed<br />
Exhibitions. Unsere Veranstaltungen und<br />
Kunden werden enorm von der globalen<br />
Reichweite von Reed Exhibitions und von<br />
Investitionen in neue Technologien profitieren,<br />
um neue Geschäftsmöglichkeiten zu<br />
generieren. Ich bin stolz auf das Unternehmen,<br />
das wir aufgebaut haben, und freue<br />
mich, es in so erfahrenen Händen für das<br />
nächste Kapitel seiner Entwicklung zu<br />
sehen“, sagte Stephen Brooks, Vorsitzender<br />
von Mack Brooks.<br />
„Mack Brooks passt hervorragend zum<br />
bestehenden Portfolio von Reed Exhibitions.<br />
Die Kombination beider Unternehmen wird<br />
für alle Beteiligten, einschließlich Kunden<br />
und Mitarbeiter, einen großen Mehrwert<br />
schaffen“, so Chet Burchett, CEO von Reed<br />
Foto: Reed Exhibitions<br />
Die EuroBLECH steht nun unter der Regie von<br />
Reed Exhibitions. Kunden sollen unter anderem<br />
von neuen digitalen Tools vom der Transaktion<br />
profitieren.<br />
Exhibitions. Reed Exhibitions ist einer der<br />
weltweit führenden Veranstalter von Messen<br />
mit über 500 Veranstaltungen in 30 Ländern.<br />
Das Unternehmen ist eine Tochter des<br />
britischen Medienkonzerns RELX Group,<br />
einer globalen Anbieterin von Informationen<br />
und Analysen für Fach- und Geschäftskunden<br />
aus allen Branchen. Sie beschäftigt rund<br />
30.000 Mitarbeiter, von denen rund die<br />
Hälfte in Nordamerika tätig ist.<br />
Stuttgarter Sägetagung 2018<br />
Sägen ist Teil einer hochautomatisierten Wertschöpfungskette<br />
Die Stuttgarter Säge-Tagung 2018<br />
hat im vergangenen Dezember die Potenziale<br />
der Sägetechnologie sowie neue technische<br />
Lösungen und Forschungsan sätze<br />
für Anwender, Werkzeug- und Maschinenhersteller<br />
vorgestellt und diskutiert. Auf<br />
dem Fachtag des Fraunhofer-Instituts für<br />
Produktionstechnik und Automatisierung<br />
(IPA) sowie des Instituts für Werkzeugmaschinen<br />
(IfW) der Universität Stuttgart ging<br />
es dabei konkret unter anderem um das<br />
„automatische Richten von Sägewerkzeugen“<br />
(SM Motion Control GmbH), den<br />
„idealen Materialfluss für eine optimale<br />
Maschinenauslastung“ (Remmert GmbH)<br />
und „Lösungen für den Aluminiumschnitt“<br />
(Schelling Anlagenbau GmbH, Österreich).<br />
Mit der Veranstaltung nehmen das Fraunhofer<br />
IPA und das IfW der Universität Stuttgart<br />
den Trend der Anwender auf, die<br />
Werkstückhandhabung vermehrt in den<br />
Fokus zu rücken. Ziel ist es, den Aufwand<br />
dabei zu verringern und nachfolgende Fertigungsschritte<br />
zu reduzieren. Ein Ansatz<br />
Den Aufwand bei der Werkstückhandhabung verringern und nachfolgende Fertigungsschritte<br />
reduzieren – dazu gab die Stuttgarter Sägetagung 2018 Einblick in eine große Bandbreite<br />
verschiedener Ansätze und Lösungen.<br />
dazu ist, den Sägeprozess quali tativ hochwertiger<br />
zu gestalten und Folgeprozesse zu<br />
integrieren, bei gleichzeitiger hoher Stückleistung<br />
und geringen Werkzeugkosten.<br />
Damit gewinne der Sägeprozess als Teil<br />
einer hochautomatisierten Wertschöpfungskette<br />
an Bedeutung. Welche konkreten<br />
Projekte und Lösungen es dazu auf<br />
dem Markt derzeit gibt und welche wissenschaftlichen<br />
Ansätze verfolgt werden, hat<br />
die Sägetagung in einer großen Bandbreite<br />
an Beiträgen gezeigt. Vorgestellt wurden<br />
dabei auch die Ergebnisse der Studie „Digitalisierung<br />
im Branchenfokus Stahl- und<br />
Metallhandel“ des Fraunhofer IPA (siehe<br />
dazu S. 18/19).<br />
Bild: Fraunhofer IPA<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
43
BDS<br />
Research<br />
Neueste Zahlen aus dem Bereich Research<br />
Keine Herbststürme zum Jahresende<br />
Nachdem im September erstmals im vergangenen Jahr die Nachfrage der Verbraucher spürbar nachgelassen<br />
hatte, konnte der Oktober diese kurze Schwächephase wieder kompensieren. Auch der November<br />
2018 lief ordentlich, wenn auch recht unspektakulär. Die weltweiten Konjunkturerwartungen haben<br />
sich in den vergangenen Wochen etwas eingetrübt. Handelskriege und der bevorstehende Brexit führen<br />
zu zunehmenden Unsicherheiten. Die meisten stahlverarbeitenden Branchen in Europa sind jedoch<br />
weiterhin gut oder sehr gut beschäftigt und erwarten auch für 2019 weiteres Wachstum.<br />
Foto: privat<br />
Jörg Feger, Bereichsleiter<br />
Research im<br />
Bundesverband<br />
Deutscher Stahlhandel<br />
(BDS), berichtet<br />
zusammenfassend<br />
angesichts der ihm<br />
bis einschließlich<br />
November 2018<br />
vorliegenden Zahlen.<br />
[ Info ]<br />
Fragen zu den<br />
genannten statistischen<br />
Größen beantwortet<br />
im Bundesverband<br />
Deutscher<br />
Stahlhandel (BDS)<br />
Jörg Feger, Bereichsleiter<br />
Research:<br />
Feger-BDS@stahlhandel.com<br />
Lagerabsatz<br />
Das Jahr 2018 war gut gestartet. Im<br />
Januar konnten knapp 997.000 t Walzstahlfertigerzeugnisse<br />
abgesetzt werden.<br />
Dies ist der beste Januarwert seit<br />
sechs Jahren. Im Februar wurde ein<br />
Lagerabsatz von 931.000 t verzeichnet.<br />
Die Tonnage im März war mit<br />
986.000 t im Vergleich zum starken<br />
Vorjahresmonat rückläufig. Hier spielten<br />
aber auch die wenigen Arbeitstage<br />
und die Osterferien eine nicht zu verachtende<br />
Rolle. Der entsprechende<br />
Ausgleicheffekt konnte im April mit<br />
einem Lagerabsatz von 954.000 t festgestellt<br />
werden. Der Mai war zwar mit<br />
einem Absatz von 948.000 t im Vergleich<br />
zum Vorjahresmonat rückläufig,<br />
auf die wenigen Arbeitstage heruntergerechnet,<br />
ist die erzielte Tonnage<br />
aber sehr ordentlich.<br />
Außerordentlich gut liefen dann die<br />
Geschäfte in den Monaten Juni und Juli.<br />
In beiden Monaten wurden knapp über<br />
1 Mio. t Walzstahlfertigerzeugnisse<br />
abgesetzt. Der August lag dann zwar<br />
leicht unter Vorjahresniveau, wies aber<br />
mit etwas über 950.000 t Lagerabsatz<br />
ebenfalls einen ordentlichen Wert aus.<br />
Im September war der Lagerabsatz recht<br />
verhalten. Es wurden an 20 Werktagen<br />
nur knapp 902.000 t Walzstahlfertigerzeugnisse<br />
ausgeliefert.<br />
Der Oktober zeigte dann eine spürbare<br />
Gegenbewegung. Mit einem<br />
Lagerabsatz von 1,01 Mio. t konnte<br />
der bisherige Bestwert des Jahres aus<br />
dem Juni noch einmal leicht gesteigert<br />
werden. Im November wies der Lagerabsatz<br />
958.000 t aus. Insgesamt wurde<br />
in den ersten elf Monaten des Jahres<br />
2018 bei Walzstahlfertigerzeugnissen<br />
2,1 % mehr Tonnage im Vergleich zum<br />
Vorjahreszeitraum abgesetzt. Bei Rohren<br />
wurden sogar deutlichere<br />
Zuwächse verzeichnet.<br />
Lagerbestand<br />
Ende 2017 wurden von der deutschen<br />
Stahldistribution 2,12 Mio. t Walzstahlfertigerzeugnisse<br />
bevorratet.<br />
Dies ist der niedrigste Bestand seit<br />
Dezember 2015. Zum Jahresstart<br />
2018 setzte der übliche Lageraufbau<br />
ein. Dieser gestaltete sich bis März<br />
recht dynamisch. Im April setzte ein<br />
Bestandsabbau ein. Im Mai und Juni<br />
wurde das Niveau nahezu fortgeschrieben.<br />
Im Juli wurde dann sehr<br />
deutlich um fast 130.000 t aufgestockt.<br />
Ende Juli wurden 2,56 Mio. t<br />
Bestand gemeldet.<br />
Im August wurden die Bestände<br />
auf 2,51 Mio. t reduziert. Im September<br />
legte der Bestand, vor allem getrieben<br />
durch oberflächenveredelte Flacherzeugnisse,<br />
leicht auf 2,53 Mio. t zu.<br />
Der Oktober war von einem leichten<br />
Bestandsrückgang bei fast allen Produkten<br />
auf 2,51 Mio. t geprägt. Das<br />
Jahresende im Blick wurden im<br />
November die Bestände deutlich auf<br />
2,31 Mio. t heruntergefahren. Dabei<br />
lag der branchenweite Lagerbestand<br />
im Vergleich zum Vorjahresmonat<br />
um knapp 7 % höher.<br />
Lagerreichweite<br />
Bei ordentlichen Absätzen und nun<br />
auch wieder recht schlanken Beständen<br />
lag die durchschnittliche Lagerreichweite<br />
im November bei 2,4 Monaten<br />
bzw. 72 Tagen (vgl. Abbildung 1).<br />
Lagerverkaufspreise<br />
Den Angaben des BDS-Marktinformationsverfahrens<br />
für durchschnittliche<br />
Verkaufspreise im kleinlosigen<br />
Bereich zufolge setzte sich der teilweise<br />
recht starke Preisanstieg, der<br />
im Jahr 2016 angefangen hatte, im<br />
Jahr 2017 fort. Auch in den ersten beiden<br />
Monaten des Jahres 2018 konnten<br />
bei fast allen Produkten Preissteigerungen<br />
festgestellt werden.<br />
Zwischen März und Mai gestaltete<br />
sich das Bild differenzierter. Große Veränderungen<br />
wurden dabei jedoch nicht<br />
festgestellt. In den Monaten Juni bis<br />
September waren die Preise bei fast<br />
allen Produkten wieder im Aufwärtstrend.<br />
Der Oktober und der November<br />
zeigten sich uneinheitlich. Mitunter<br />
wurden auch sinkende Preise beobachtet.<br />
Das Niveau lag dabei Ende November<br />
2018 bei fast allen Produkten ein<br />
gutes Stück über dem des Vorjahresmonats<br />
(vgl. Abbildungen 2 und 3). 2<br />
44 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Quelle Bild 2 u. 3: BDS Quelle: Statistisches Bundesamt/BDS<br />
lagerAbsatz und Lagerreichweite der Stahldistribution Abb. 1<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Preisentwicklung bei Langprodukten Abb. 2<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
Index (Januar 2010 = 100)<br />
Formstahl Breitflanschträger Stabstahl Betonstahl in Stäben Betonstahlmatten<br />
Preisentwicklung bei Flachprodukten und Rohren Abb. 3<br />
Index (Januar 2010 = 100)<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
n Absatzindex (2007 = 100)<br />
n Lagerreichweite in Tagen<br />
200<br />
180<br />
160<br />
100 100<br />
92<br />
97 97<br />
90 93<br />
99<br />
101<br />
96 95 100<br />
101<br />
96<br />
96<br />
140<br />
89<br />
90<br />
120<br />
100<br />
80<br />
62<br />
60<br />
84 78 78 75 75 66 102 72 78 78 75 75 72 78 78 84 75 72<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Ø<br />
2014<br />
Ø<br />
2015<br />
Ø<br />
2016<br />
Ø<br />
2017<br />
Ø<br />
2018<br />
Nov.<br />
2017<br />
Dez.<br />
2017<br />
Jan.<br />
2018<br />
Feb.<br />
2018<br />
Mär.<br />
2018<br />
Apr.<br />
2018<br />
Mai<br />
2018<br />
Juni<br />
2018<br />
Juli<br />
2018<br />
Aug.<br />
2018<br />
Sep.<br />
2018<br />
Okt.<br />
2018<br />
Nov.<br />
2018<br />
1. Q. 2010<br />
2. Q. 2010<br />
3. Q. 2010<br />
4. Q. 2010<br />
1. Q. 2011<br />
2. Q. 2011<br />
3. Q. 2011<br />
4. Q. 2011<br />
1. Q. 2012<br />
2. Q. 2012<br />
3. Q. 2012<br />
4. Q. 2012<br />
1. Q. 2013<br />
2. Q. 2013<br />
3. Q. 2013<br />
4. Q. 2013<br />
1. Q. 2014<br />
2. Q. 2014<br />
3. Q. 2014<br />
4. Q. 2014<br />
1. Q. 2015<br />
2. Q. 2015<br />
3. Q. 2015<br />
4. Q. 2015<br />
1. Q. 2016<br />
2. Q. 2016<br />
3. Q. 2016<br />
4. Q. 2016<br />
1. Q. 2017<br />
2. Q. 2017<br />
3. Q. 2017<br />
4. Q. 2017<br />
1. Q. 2018<br />
2. Q. 2018<br />
3. Q. 2018<br />
4. Q. 2018<br />
1. Q. 2010<br />
2. Q. 2010<br />
3. Q. 2010<br />
4. Q. 2010<br />
1. Q. 2011<br />
2. Q. 2011<br />
3. Q. 2011<br />
4. Q. 2011<br />
1. Q. 2012<br />
2. Q. 2012<br />
3. Q. 2012<br />
4. Q. 2012<br />
1. Q. 2013<br />
2. Q. 2013<br />
3. Q. 2013<br />
4. Q. 2013<br />
1. Q. 2014<br />
2. Q. 2014<br />
3. Q. 2014<br />
4. Q. 2014<br />
1. Q. 2015<br />
2. Q. 2015<br />
3. Q. 2015<br />
4. Q. 2015<br />
1. Q. 2016<br />
2. Q. 2016<br />
3. Q. 2016<br />
4. Q. 2016<br />
1. Q. 2017<br />
2. Q. 2017<br />
3. Q. 2017<br />
4. Q. 2017<br />
1. Q. 2018<br />
2. Q. 2018<br />
3. Q. 2018<br />
4. Q. 2018<br />
Quartoblech Bandblech Kaltgewalztes Blech OV Blech Quad. & RE-Rohr Nahtloses Rohr<br />
Absatz und Lagerreichweite<br />
der<br />
Stahldistribution<br />
Preisentwicklung<br />
bei Langprodukten<br />
Preisentwicklung bei<br />
Flachprodukten und<br />
Rohren<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
45
BDS<br />
Berufsbildung<br />
Ein passendes Muster für die<br />
Dimensionen der Berufsbildung<br />
des Stahlhandels: Der Zauberwürfel<br />
ist fast so alt wie der BDS.<br />
Quelle: BDS<br />
Wie Berufsbildung im Stahlhandel funktioniert<br />
Der Zauberwürfel<br />
Als vor 50 Jahren der BDS gegründet wurde, kam kurz darauf ein Geschicklichkeitsspiel in Mode, das<br />
bis heute ein Bild dafür liefert, wie Berufsbildung im Stahlhandel funktioniert: Die einzelnen Elemente<br />
des sogenannten Zauberwürfels muss man in drei Dimensionen so gegeneinander verschieben, dass<br />
die gewünschte Farbe ganzflächig zu sehen bzw. – im übertragenen Sinn – das passende Lernangebot<br />
erkennbar ist.<br />
Die Dimensionen der Berufsbildung im Bundesverband<br />
Deutscher Stahlhandel (BDS) haben sich im<br />
Laufe der fünf Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt:<br />
Das gilt für die<br />
z Formen, nämlich Veranstaltungen und Veröffentlichungen,<br />
ebenso wie für die<br />
z einzuführenden Inhalte in den Bereichen der Technik,<br />
Wirtschaft und der Methoden sowie für die<br />
z Zielgruppen, denen jeweils unterschiedliche Lernniveaus<br />
zugeordnet werden.<br />
Für alle drei angesprochene Dimensionen lassen sich<br />
zudem branchenspezifisch jeweils dominierende Trends<br />
definieren:<br />
z Gemischte Formen aus Veröffentlichungen und Veranstaltungen,<br />
die sich als Blended Learning vor allem<br />
im Fernunterricht konkretisiert haben.<br />
z Der lange geführte Streit über die Dominanz von Tech-<br />
nik oder Wirtschaft in den Berufsbildern der Stahldistribution<br />
ist durch die sukzessive Ergänzung methodischer<br />
Inhalte entschärft worden.<br />
z Und die Zielgruppen bestimmen sich seit mehr als<br />
zehn Jahren anhand der handlungsorientierten Festlegungen<br />
des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR).<br />
Auch in diesem Heft des <strong>Stahlreport</strong> wird nebenstehend<br />
über aktuelle Entwicklungen und zukunftsorientierte<br />
Angebote in der BDS-Berufsbildung berichtet; beispielsweise<br />
von den Seminaren zur Stahlkunde bis zum Fernstudium,<br />
von offenen Lernmaterialien bis zur überbetrieblichen<br />
Ausbildungsbegleitung.<br />
Sie alle lassen sich – wie von Zauberhand – in das<br />
beschriebene Konzept einordnen, dessen historische<br />
Entwicklung in fünf Jahrzehnten BDS an dieser Stelle<br />
in den nächsten Monaten wiederholt aufgegriffen werden<br />
wird. 2<br />
46 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Mitglieder des FDL-Arbeitskreises Pädagogik<br />
bei dem Treffen in Saarbrücken<br />
Foto: FDL<br />
Open Educational Resources<br />
Treffen des FDL-Arbeitskreises Pädagogik<br />
Der BDS hat sein Fernstudium für die<br />
beiden laufenden Jahrgänge zum 1.1.19 auf<br />
die Bildungsplattform OpenOLAT umgestellt.<br />
Dass dies eigentlich mehr als nur<br />
eine technische Änderung ist, wurde am<br />
17.1.19 in Saarbrücken deutlich. Dort<br />
beschäftigte sich der Arbeitskreis Pädagogik<br />
im FDL unter Beteiligung des verbandlichen<br />
Stahlhandels mit Open Educational<br />
Resources – also auch mit dem Prinzip der<br />
Offenheit in der Bildung.<br />
Mit der Jahrtausendwende ist weltweit eine<br />
Bewegung mit dem Ziel entstanden, im<br />
Internet Bildungsmaterialien offen zugänglich<br />
zu machen. Das gilt für Bilder und Grafiken<br />
ebenso wie für Videos, Musik und für<br />
textliche Inhalte. Solche Quellen könnten<br />
künftig sowohl Studenten als auch Autoren,<br />
Referenten und Prüfer im BDS-Fernstudium<br />
nutzen, sofern sie die Linzenzregeln beachten<br />
und das Prinzip beherzigen, dass Nehmende<br />
auch geben können müssen.<br />
Über diese Zusammenhänge und deren<br />
Bedeutung für die künftige Entwicklung von<br />
Lernmaterialien und Prüfungsleistungen referierte<br />
in Saarbrücken Dr. Markus Lermen (TU<br />
Kaiserslautern), Präsidiumsmitglied im Forum<br />
DistancE Learning (FDL). Dem Fernlernverband<br />
gehört als Mitglied auch der Bundesverband<br />
Deutscher Stahlhandel (BDS). Sein<br />
Bereichsleiter Berufsbildung, Dr. Ludger Wolfgart,<br />
ist Sprecher der Fachgruppe der Anbieter<br />
von Fernunterricht im FDL.<br />
So ist die Entscheidung des BDS für eine<br />
technisch komfortablere Lösung mit<br />
OpenOLAT, die übrigens auch bessere virtuelle<br />
Seminare ermöglicht, mit der Chance<br />
verbunden, über Open Educational Resources<br />
(OER) zusätzliche inhaltliche und didaktische<br />
Potenziale zu erschließen. Deshalb<br />
werden die Ausführungen von Dr. Markus<br />
Lermen und weitere Aussagen zum Thema<br />
ggf. Eingang in ein entsprechendes Studienmodul<br />
finden sowie auch zum Gegenstand<br />
interner Weiterbildungen werden müssen.<br />
Drei Angebote<br />
Flyer zu Stahlkunde-Seminaren<br />
Die Technik der Stahlherstellung und damit das Einstellen der Eigenschaften, die mit dem Material<br />
verkauft werden, war und ist für Werkstoffhändler entscheidendes Thema. Deshalb hat der BDS sein<br />
entsprechendes Seminarangebot zur Stahlkunde für 2019 erstmals in einem Flyer zusammengefasst.<br />
Das Faltblatt, das diesem Heft<br />
beiliegt, umfasst drei inhaltsgleiche<br />
Veranstaltungen, die vom<br />
z 6.-8.3.19 in Dortmund,<br />
z 20.-22.8.29 in Gröditz und vom<br />
z 3.-5.12.19 in Gengenbach<br />
stattfinden.<br />
Referent ist in allen drei Fällen Prof.<br />
Dr.-Ing. Joachim Lueg, der seit über<br />
20 Jahren an der Fachhochschule<br />
Dortmund in der Fakultät Maschinenbau<br />
die Fächer Werkstoffkunde<br />
und Spanlose Umformung lehrt. Fast<br />
ebenso lange hat er auch Erfahrungen<br />
mit Unterricht im nicht-akademischen<br />
Bereich. In beiden Fällen<br />
setzt er auf didaktische Reduktion,<br />
die den Lehrstoff auf das Wesentliche<br />
konzentriert. Dabei unterstützt ihn,<br />
dass zu den Stahlkunde-Seminaren<br />
immer auch Betriebsbesichtigungen<br />
gehören, welche die Stahlerzeugung<br />
anschaulich machen. Didaktisch hilfreich<br />
ist zudem die Behandlung von<br />
Reklamationsfällen. Weitere Themen<br />
der Seminare sind u.a.<br />
z das Stahlgefüge,<br />
z die Stahlkennwerte,<br />
z Verfahren der Werkstoffprüfung,<br />
z die Einteilung und Normung der<br />
Stähle,<br />
z wichtige Stahlsorten,<br />
z Wärmebehandlung sowie<br />
z Korrosion und Korrosionsschutz.<br />
Die Seminare zur Stahlkunde richten<br />
sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
des Stahlhandels, die für ihre<br />
Tätigkeit grundlegendes materialkundliches<br />
Wissen zum Werkstoff<br />
Stahl erwerben möchten. Auf dieser<br />
Basis wollen sie Kunden qualifiziert<br />
beraten, in Reklamationsfällen fachgerecht<br />
argumentieren und sachgerecht<br />
entscheiden können.<br />
Die Veranstaltungen orientieren<br />
sich an der Stufe 6 des Deutschen<br />
Qualifikationsrahmens und sind deshalb<br />
für Auszubildende (DQR-Stufen<br />
4 und 5) nur bedingt geeignet. 2<br />
[ Info ]<br />
Anmeldungen sind online unter<br />
www.stahlhandel.com/seminare möglich.<br />
Weitere Informationen gibt es bei<br />
Bedarf unter 0211/86497-0 oder via<br />
E-Mail: Wynands-BDS@stahlhandel.com<br />
Quelle: BDS<br />
Mit diesem Flyer bewirbt<br />
der BDS die drei inhaltsgleichen<br />
Stahlkunde-<br />
Seminare, die in diesem<br />
Jahr stattfinden.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
47
BDS<br />
Berufsbildung<br />
Blended Learning zur Technik<br />
Umfrage zur<br />
überbetrieblichen Ausbildungsbegleitung<br />
In einer nicht repräsentativen Ausbildungsumfrage hat der BDS bei in diesen Bereichen<br />
Verantwortlichen deren Vorstellungen für verbandliche Hilfe zu überbetrieblichen<br />
Herausforderungen dieser Art ermittelt: Die Befragten wünschen vor allem Unterstützung<br />
in Form von Blended Learning zu technischen Themen.<br />
Die Teilnehmer der Untersuchung<br />
sind inzwischen über die<br />
Ergebnisse und auch darüber informiert,<br />
dass der Bundesverband Deutscher<br />
Stahlhandel (BDS) nun zeitnah<br />
prüfen wird, wie die gewünschte<br />
Unterstützung geleistet werden kann<br />
– auch etwa durch die Nutzung von<br />
Förderprogrammen.<br />
Trotz der geringen Fallzahlen sind<br />
die Ergebnisse der Ausbildungsumfrage<br />
vom Ende des vergangenen Jahres<br />
nachfolgend prozentual wiedergegeben,<br />
um Abstufungen bei den<br />
Antworten auch quantitativ möglich<br />
zu machen:<br />
Formen und Themen<br />
Die abgefragte überbetriebliche Ausbildungsbegleitung<br />
sollte nach einhelliger<br />
Meinung (100 %) in der Form<br />
von Blended Learning – also als Kombination<br />
von Fernunterricht und Präsenzveranstaltungen<br />
– angeboten<br />
werden. Die gemeinsamen Treffen<br />
sollten vor allem für begleitete Besichtigungen<br />
in der Stahlerzeugung und<br />
-verarbeitung genutzt werden, meinten<br />
96 % der Befragten.<br />
z Bei den gewünschten Lerninhalten<br />
dominieren in der Technik Themen<br />
der Produktkunde (100 %), gefolgt<br />
von der Werkstoffkunde (86 %) und<br />
der Anarbeitung (71 %). An zusätzlichen<br />
Teilthemen wurden je einmal<br />
„Arbeitsabläufe“ und die „Herstellung<br />
der Vorprodukte“ genannt.<br />
z Insgesamt etwas weniger favorisiert<br />
wurden die vorgegebenen Themen<br />
der Wirtschaft. Bei den erfolgten<br />
Nennungen dominierte der um<br />
„-stechniken“ verstärkte „Verkauf“<br />
(71 %) – gefolgt von „Logistik“ (57 %),<br />
„Marketing“ (43 %) und „Recht“<br />
(29 %). Substitutionsmöglichkeiten<br />
für Stahl wurden ebenso einmal thematisiert<br />
wie „Industrie 4.0“.<br />
z „Lernmanagement“ (71 %), „Präsentation“<br />
(57 %), „Rhetorik“ (43 %).<br />
So lautet die ermittelte Reihenfolge<br />
für die Themen der Methodik. Zu<br />
ihnen gab es nur eine ergänzende<br />
Nennung: „Sozialverhalten im<br />
betrieblichen Kontext“.<br />
Ertrag und Aufwand<br />
Ziel des Lernens ist nach Ansicht<br />
der Befragten auch das Bestehen von<br />
Prüfungen. Dabei geht es aber weniger<br />
um Vorbereitungen für das Fachgespräch<br />
(59 %), das angehende Kaufleute<br />
absolvieren müssen, stärker<br />
befürwortet werden eigene „Lernerfolgskontrollen<br />
für Teilnehmer/<br />
innen“ (69 %).<br />
Die Antworten auf die Fragen<br />
nach dem zeitlichen und finanziellen<br />
Aufwand, den die Unternehmen im<br />
Zusammenhang mit einer überbetrieblichen<br />
Ausbildungsbegleitung<br />
zu tragen bereit sind, erbrachten die<br />
meisten Meldungen für einen<br />
Tag/Halbjahr (43 %), kombiniert mit<br />
einem logistischen Aufwand von<br />
zwei Stunden/ Schulung (42 %) und<br />
einem finanziellen Investment von<br />
durchschnittlich 186 € pro Teilnehmer/Halbjahr.<br />
Beteiligte und Berufe<br />
An der Umfrage beteiligt haben sich<br />
eher in der Nachwuchsförderung<br />
bereits engagierte Unternehmen. Die<br />
Ausbildungsquote (Auszubildende<br />
in Relation zu allen Mitarbeitern)<br />
liegt bei den Beteiligten im Durchschnitt<br />
bei 7 % (zwischen 2,9 % und<br />
9,2 %). Insgesamt sind durch die Teilnehmenden<br />
4.026 Mitarbeiter der<br />
Branche vertreten und 283 Auszubildende.<br />
Sie lernen in unterschiedlichen<br />
Ausbildungsberufen. Zwar sind bei<br />
den Antwortenden immer auch Kaufleute<br />
im Groß- und Außenhandel<br />
sowie Fachkräfte für Lagerlogistik<br />
genannt. Das Spektrum der vertretenen<br />
Ausbildungsberufe umfasst – in<br />
dieser Reihenfolge – aber auch Kaufleute<br />
für Büromanagement sowie –<br />
je gleichauf – Berufskraftfahrer und<br />
Kaufleute für E-Commerce bzw. Industrie-<br />
und Informatikkaufleute. 2<br />
48 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Betriebswirte Stahlhandel<br />
Neuer Jahrgang im<br />
BDS-Fernstudium startet<br />
Zum 23. Mal startet zum Juli 2019 ein neuer Jahrgang im BDS-Fernstudium,<br />
das mindestens 15 Interessierten die Möglichkeit bietet, sich innerhalb von<br />
drei Jahren berufsbegleitend technisch, wirtschaftlich und methodisch<br />
zum/zur „Betriebswirt/in Stahlhandel (BDS)“ weiterzubilden. Ein solcher<br />
Abschluss, der im berufsbildenden Bereich auf DQR-Stufe 7 mit dem akademischen<br />
Master vergleichbar und staatlich zugelassen, qualitätsgesichert<br />
sowie markenrechtlich geschützt ist, hat sich inzwischen für rund 500 Absolventen<br />
der Branche und darüber hinaus bewährt. Seit 2017 wird das Fernstudium<br />
digitalisiert angeboten, inzwischen auf einer Openolat-Plattform.<br />
Das Fernstudium beim BDS<br />
bietet im Wechsel Phasen des Selbstlernens<br />
anhand von rund 60 Studienmodulen,<br />
fast ebenso viele virtuelle<br />
Seminare über OpenOLAT/vitero und<br />
zudem ein halbes Dutzend Präsenzveranstaltungen<br />
an, die vor allem zur<br />
Einführung sowie für Leistungsnachweise<br />
und zur studentischen Gruppenbildung<br />
dienen. Studiert wird in<br />
den Fachbereichen Technik (insbesondere<br />
Werkstoff- und Produktkunde<br />
sowie Anarbeitung), Wirtschaft<br />
(vor allem kaufmännisches Knowhow<br />
und Führungsfähigkeit) sowie<br />
Methoden (speziell in den Bereichen<br />
Selbst- und Sozialkompetenz).<br />
Die Lernziele dieses Angebots<br />
sind auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen<br />
anhand des Deutschen<br />
Qualifikationsrahmens (DQR) formuliert,<br />
der sämtliche schulischen,<br />
akademischen und beruflichen<br />
Abschlüsse in ein insgesamt achtstufiges<br />
System einordnet und damit<br />
nicht gleich, aber vergleichbar macht<br />
– z.B. den beruflichen Betriebswirt<br />
und den universitären Master. Ziele<br />
dieses Fernstudiums sind demnach<br />
– allgemein formuliert – die Befähigung<br />
von Branchenmitarbeiterinnen<br />
und -mitarbeitern<br />
z zur Lösung von neuen und komplexen<br />
Aufgaben,<br />
z zur eigenverantwortlichen Steuerung<br />
von Prozessen sowie<br />
z zum Umgang mit häufigen und<br />
unvorhersehbaren Veränderungen<br />
in einem strategieorientierten<br />
beruflichen Tätigkeitsfeld.<br />
Die entsprechenden Fähigkeiten gliedern<br />
sich in Fachkompetenz, bestehend<br />
aus Wissen und Fertigkeiten,<br />
sowie personaler Kompetenz zur<br />
selbständigen Arbeit und in Teams.<br />
Kontrolliert wird der Lernerfolg<br />
über Einsendeaufgaben zu den Studienmodulen,<br />
in drei jeweils schriftlichen<br />
und mündlichen Prüfungen<br />
sowie über eine zu erstellende Studienarbeit.<br />
Außerdem müssen die<br />
Absolventen über die Ausbildereignung<br />
verfügen. Voraussetzungen zur<br />
Zulassung sind mindestens eine<br />
abgeschlossene Berufsausbildung,<br />
zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung<br />
wenigstens fünf Jahre Berufspraxis,<br />
eine studienbegleitende Berufstätigkeit<br />
in der Branche sowie ein internetfähiger<br />
Arbeits-/Lernplatz.<br />
Der angebotene betriebswirtschaftliche<br />
Abschluss ist nach DIN<br />
EN ISO 9001:2015 zertifiziert, bei<br />
der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht<br />
(ZFU) unter der Nummer<br />
689217 zugelassen, sowie durch das<br />
Deutsche Patent- und Markenamt<br />
geschützt.<br />
Der BDS hat angekündigt, im<br />
Februar 2019 die ersten Termine für<br />
den neuen Jahrgang bekantzugeben<br />
und die entsprechenden Studiendokumente<br />
zu veröffentlichen.<br />
Einzelheiten zum Fernstudium<br />
ergeben sich auch aus dem diesem<br />
<strong>Stahlreport</strong> beiliegenden Flyer. 2<br />
[ Info ]<br />
Weitere Informationsunterlagen<br />
(Studien- und Prüfungsordnung, Zahlungsplan,<br />
Anmeldeformular) können<br />
beim BDS angefordert werden: BDS AG,<br />
Wiesenstraße 21; 0211/86497-0;<br />
Wynands-BDS@stahlhandel.com.<br />
Quelle: BDS<br />
Sie bringen<br />
Motivation mit?<br />
Wir liefern das<br />
Know-how!<br />
Machen Sie berufliche Karriere durch ein<br />
berufsbegleitendes Fernstudium<br />
fern-studium<br />
Betriebswirt Stahlhandel (BDS)<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Mit diesem Flyer wirbt<br />
der BDS für die 23. Auflage<br />
seines Fernstudiums<br />
(Jahrgang 2019)<br />
vom Juli 2019 bis zum<br />
Juni 2022.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
49
Wissenswertes<br />
Bericht/Nachrichten<br />
Foto: Fraunhofer IWM<br />
Werkstoffforschung<br />
Den Kaltrissen auf der Spur<br />
Hochfeste Stähle spielen im modernen Fahrzeug- und Maschinenbau<br />
eine wesentliche Rolle. Werden diese Stähle bei der Herstellung<br />
von Bauteilen geschweißt, können bewegliche Wasserstoffatome<br />
im Material Probleme verursachen: Die Atome sammeln sich<br />
langsam an Bauteilbereichen mit hohen Eigenspannungen an und<br />
machen dort den Stahl spröde. Die Folge sind sogenannte Kaltrisse,<br />
die für Bauteilausschuss sorgen können. Dr. Frank Schweizer<br />
vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM hat eine<br />
Simulations-Methodik entwickelt, mit der Bauteilhersteller diese<br />
Kaltrissneigung bewerten und ihre Produktion entsprechend<br />
anpassen können.<br />
Lichtmikroskopische<br />
Aufnahme eine<br />
Schweißnahtgefüges<br />
einer Schweißverbindung.<br />
Die Hersteller von Fahrzeugund<br />
Maschinenbauteilen nutzen häufig<br />
hochfeste Stähle: zur Materialeinsparung<br />
für den Leichtbau und für<br />
crashrelevante Strukturbauteile, die<br />
besonders hohe Festigkeiten benötigen.<br />
Beim Schweißen dieser Bauteile<br />
tragen vielfältige Faktoren dazu bei,<br />
dass sich ungewollt feine Risse bilden<br />
können, sich ausbreiten und sogar<br />
möglicherweise zum Bauteilausschuss<br />
führen.Diese Faktoren sind nur sehr<br />
schwer oder gar nicht durch Experimente<br />
zu erfassen. Eine weitere<br />
Schwierigkeit: Die Zeitspanne, in der<br />
die Risse entstehen, ist vergleichsweise<br />
lang – sie können während des Schweißens<br />
innerhalb weniger Sekunden<br />
oder auch noch nach mehreren Tagen<br />
auftreten.<br />
Damit Bauteilhersteller die Ausschussrate<br />
bei hochfesten Stählen verringern<br />
können, hat Dr. Frank Schweizer<br />
vom Fraunhofer IWM im Rahmen<br />
seiner Dissertation bereits industriell<br />
eingesetzte Methoden der numerischen<br />
Schweißsimulation entsprechend<br />
weiterentwickelt. Damit kann<br />
er nun im Computer die Geschehnisse<br />
an ganz begrenzten Bauteilorten nachstellen.<br />
Das funktioniert sogar für sehr<br />
schnelle Temperaturwechsel zwischen<br />
Raum- und Schmelztemperatur, wie<br />
sie beim Schweißen auftreten.<br />
„Die Besonderheit an der neuen<br />
Methode ist, dass sie auch die Wirkung<br />
sogenannter Wasserstofffallen berücksichtigt“,<br />
so Schweizer. Er fand für<br />
unterschiedliche Laserschweißverbindungen<br />
heraus, dass bei geringen Wasserstoffkonzentrationen<br />
die Wasserstofffallen<br />
einen großen Einfluss auf<br />
den „beweglichen“ Wasserstoffanteil<br />
haben. Bei höherem Wasserstoffgehalt<br />
wird das thermomechanische Materialverhalten<br />
zunehmend ausschlaggebend<br />
für die Rissbildung. Die Simulationsergebnisse<br />
dienen als Grundlage,<br />
Laserschweißprozesse zu optimieren<br />
und Bauteilausschuss nachhaltig zu<br />
verhindern: „Die Laser-Prozessparameter<br />
lassen sich nun so anpassen,<br />
dass die Wechselwirkungen der Kaltriss-Risikofaktoren<br />
so gering wie möglich<br />
bleiben“, sagt Schweizer. Zudem<br />
können genauere Vor- und Nachwärmtemperaturen<br />
sowie die passgenaue<br />
Glühdauer aus der Simulation ermittelt<br />
werden. „Auch bei der Planung von<br />
Bauteilen nutzt die Simulation: Anhand<br />
der Daten lassen sich günstigere Bauteilformen<br />
ableiten, um den Eigenspannungszustand<br />
lokal zu verbessern<br />
und Risse zu vermeiden“, erläutert<br />
Schweizer.<br />
Als Datengrundlage für die von<br />
Schweizer erweiterten numerischen<br />
Schweißsimulationen dienten charakteristische<br />
Werkstoffkennwerte dreier<br />
unterschiedlicher hochfester Stähle:<br />
eines Wälzlager-, eines Martensitphasen-<br />
und eines Feinkornbaustahls. 2<br />
Berufsbildpositionen<br />
Neue Standards für die Ausbildung setzen<br />
Die zuständigen Bundesministerien BMBF sowie BMWi und das<br />
BIBB planen eine Modernisierung der Standardberufsbildpositionen.<br />
Dabei geht es um Lerninhalte, die in allen Ausbildungsordnungen verbindlich<br />
enthalten sind und deshalb von allen ausbildenden Unternehmen<br />
während der Ausbildung vermittelt werden müssen.<br />
Konkret sieht ein Vorschlag vor:<br />
z Die bisherigen Standardberufsbildpositionen „Berufsausbildung,<br />
Arbeits- und Tarifrecht“ und „Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes“<br />
könnten zu der neuen Standardberufsbildposition<br />
„Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie der für<br />
den Arbeitsplatz wesentlichen Rechtsvorschriften, insbesondere des<br />
Arbeits- und Tarifrechts“ zusammengeführt werden.<br />
z Zudem gibt es Überlegungen, die aktuelle Standardberufsbildposition<br />
„Umweltschutz“ zu einer Standardberufsbildposition „Nachhaltigkeit“<br />
weiterzuentwickeln.<br />
z Darüber hinaus soll eine ganz neue Standardberufsbildposition geschaffen<br />
werden – unter der Überschrift „Datenschutz und Datensicherheit;<br />
Digitalisierung“.<br />
z Die Standardberufsbildposition „Sicherheit und Gesundheitsschutz“<br />
ist im Wesentlichen unverändert.<br />
Die entsprechenden Arbeiten laufen im Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
(BIBB) in Abstimmung mit dem Bundesbildungsministerium<br />
(BMBF) und dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi). Die Sozialpartner<br />
sind im vergangenen Herbst aufgefordert worden, zu diesen<br />
Überlegungen Stellung zu beziehen.<br />
50 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Forschungsprojekt<br />
Bombenentschärfung per Laser<br />
Zukunft Stahl<br />
Handelsblatt Jahrestagung<br />
Die nächste Handelsblatt-Jahrestagung<br />
„Zukunft Stahl“ findet am 20. und<br />
21.3.19 in Düsseldorf statt. Trotz der sich<br />
zuletzt wieder erholenden Nachfrage stehe<br />
die Stahlbranche vor großen Herausforderungen,<br />
meinen die Veranstalter:<br />
Während europäische Hersteller mit deutlich<br />
steigenden Ausgaben für CO 2<br />
-Zertifikate<br />
belastet würden, bedrohe der Zollstreit<br />
zwischen den USA und China das weltweite<br />
Wirtschaftswachstum. Wie darauf reagieren?<br />
Auch darüber soll auf Jahrestagung<br />
diskutiert werden.<br />
Eine Antwort auf die wachsenden Bedrohungen<br />
liege in der Technologie und biete so ein<br />
weiteres Thema: Immer mehr Hersteller forschen<br />
an klimaneutralen Prozessen in der<br />
Stahlproduktion, ersetzen Kokskohle mit<br />
Wasserstoff oder verarbeiten die Emissionen<br />
zu anderen Produkten weiter. Zumeist handelt<br />
es sich zwar um Versuchsprojekte –<br />
doch der Weg zur CO 2<br />
-freien Stahlproduktion<br />
scheine bereits vorgezeichnet.<br />
Folgende Detailthemen stehen dieses Jahr<br />
außerdem im Mittelpunkt:<br />
z Globale Entwicklungen und regionale Perspektiven<br />
z Digitale Transformation im Stahlhandel<br />
z Innovationen für den Mittelstand<br />
z Stahl in der Elektromobilität<br />
z Energieeffizienz in der Stahlindustrie<br />
Vorgesehen sind u.a. die folgenden Referenten:<br />
z Hans Jürgen Kerkhoff (Präsident der Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl)<br />
z Frank Koch (Vorsitzender der Geschäftsführung,<br />
Georgsmarienhütte Holding GmbH)<br />
z Sigmar Gabriel (Bundesminister a.D.)<br />
z Prof. Dr.-Ing. Katja Windt (Mitglied der<br />
Geschäftsführung, SMS group GmbH)<br />
z Dr. Gunar Ernis (Data Scientist, Frauenhofer-<br />
Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme<br />
IAIS)<br />
[ Info ]<br />
Das detaillierte Programm der Handelsblatt<br />
Jahrestagung „Zukunft Stahl“ ist abrufbar unter:<br />
bit.ly/Stahl2019Programm.<br />
Metallographie-Tagung<br />
Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. veranstaltet vom 18. bis 20.9.19 im Rahmen<br />
der Dresdner WerkstoffWoche die 53. Metallographie-Tagung. Dresden ist ein traditioneller<br />
Standort für Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Materialographie.<br />
Geplant ist ein wissenschaftlicher Kongress, der ein breites Themenspektrum aus allen<br />
Bereichen der Materialographie abdeckt und wie immer von einer industriellen Ausstellung<br />
ergänzt wird. Die Besonderheit in diesem Jahr besteht in dem umfangreichen Begleitprogramm,<br />
das die Werkstoffwoche 2019 auch den Besuchern der Metallographie-Tagung bietet.<br />
Weitere Informationen gibt es unter metallographie@dgm.de.<br />
MBI Stahl Tag<br />
Der nächste MBI Stahl Tag findet am 24./25.9.19 in Frankfurt/M. statt. Das hat Martin<br />
Brückner Infosource jetzt angekündigt und mitgeteilt, es werde um wichtige Entscheidungsgrundlagen<br />
gezielt für den Einkauf von Stahl gehen. Ein Programm wurde noch nicht<br />
veröffentlicht, bis Ende Januar 2019 lediglich ein Frühbucher-Angebot mit finanziellen Vorteilen<br />
formuliert. Weitere Einzelheiten gibt es im Netz unter www.mbi-metalsource.de<br />
Düsseldorfer Edelstahltage<br />
Mit begleitender Fachausstellung finden am 20. und 21.3.19 in Düsseldorf die diesjährigen<br />
Edelstahltage statt – als zentrales Diskussions- und Informationsforum der Branche, wie es<br />
in der Einladung heißt. Realisiert wird ein überarbeitetes Konzept an einem neuen Veranstaltungsort<br />
in der Altstadt. Das Treffen wird in Kooperation von der Informationsstelle<br />
Edelstahl Rostfrei, der Edelstahlhandelsvereinigung und FocusRostfrei organisiert. Informations-<br />
und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter s.avvisati@focus-rostfrei.com.<br />
Blindgänger sind in vielen Teilen<br />
der Welt eine ernsthafte Bedrohung der<br />
zivilen Sicherheit. Um diese Bomben<br />
zukünftig sicherer entschärfen zu können,<br />
arbeitet das LZH gemeinsam mit<br />
Partnern in einem Forschungsprojekt an<br />
einer laserbasierten Lösung.<br />
Die Herausforderungen und Gefahren bei<br />
herkömmlichen Entschärfungsmethoden<br />
sind enorm und noch immer hochaktuell:<br />
Die Menge der in Deutschland noch unter<br />
der Erde verborgenen Kampfmittel lässt<br />
sich zwar nur schwer vorhersagen, Schätzungen<br />
des Kampfmittelräumdienstes<br />
Hamburg (KRD) zufolge liegen aber noch<br />
etwa 60.000 t davon im Boden. Beim Entschärfungsvorgang<br />
besteht insbesondere<br />
bei komplexen Zündsystemen ein extrem<br />
hohes Risiko der ungewollten Detonation.<br />
Häufig bleibt als letzte Möglichkeit dann<br />
nur die Sprengung des Kampfmittels.<br />
Im Projekt DEFLAG erarbeiten die Projektpartner<br />
Laser Zentrum Hannover e.V.<br />
(LZH) und die LASER on Demand GmbH<br />
ein Verfahren, mit dem die Bomben durch<br />
eine gezielte Deflagration entschärft werden<br />
sollen. Im Gegensatz zu einer Detonation<br />
entsteht bei der Deflagration eine<br />
geringere Druckwelle, und der Sprengstoff<br />
wird nur zu einem geringen Teil umgesetzt.<br />
Um das zu erreichen, kerben die Projektpartner<br />
die Bombenhülle mit Laserstrahlung<br />
ein und lösen in einem zweiten<br />
Schritt die Deflagration aus. Wesentlich<br />
für das Projekt ist es, eine kritische Temperaturgrenze<br />
auf der Materialunterseite<br />
nicht zu überschreiten, Material aus der<br />
Abtragnut auszutreiben, sowie die Prozessmobilität<br />
zu gewährleisten. Den Wissenschaftlern<br />
am LZH ist es mit einem<br />
kombinierten Schmelz- und Brennabtragprozess<br />
bisher gelungen, bis zu 25 mm<br />
dicke Stahlbleche entsprechend einzukerben.<br />
Dabei erreichen sie mit einer<br />
externen Gaszufuhr eine Abtragstiefe von<br />
bis zu 16 mm.<br />
In Zusammenarbeit mit dem KRD soll<br />
eine feldtaugliche und automatisierte<br />
Bearbeitungsplattform entstehen, um<br />
selbst gefährliche Blindgänger sicher zu<br />
entschärfen.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
51
Wissenswertes<br />
Bericht/Nachrichten<br />
Umfrageergebnisse<br />
Digital-affiner Handel<br />
Die allermeisten Unternehmen stehen der Digitalisierung offen<br />
gegenüber, besonders gilt das aber für Großunternehmen<br />
und für den Handel. Das zeigt der Digital Office Index 2018 des<br />
Digitalverbands Bitkom – eine repräsentative Befragung von 1.106<br />
Unternehmen ab 20 Mitarbeitern.<br />
Deckblatt des DGB-<br />
Ausbildungsreports.<br />
studie<br />
Themensch werpunkt<br />
d<br />
r<br />
kt:<br />
Arbeitszeitin<br />
e<br />
Ausbildung<br />
A usbil dungsrep ort 201<br />
8<br />
w<br />
ww.jugend.<br />
dgb.de /aus<br />
bildung<br />
Demnach ist jedes zehnte Unternehmen<br />
(10 %) sehr aufgeschlossen<br />
und 64 % sind eher aufgeschlossen,<br />
wenn es um das Thema Digitalisierung<br />
geht. Jedes fünfte Unternehmen (21 %)<br />
ist noch unentschieden, lediglich 4 %<br />
lehnen die Digitalisierung ab.<br />
Besonders aufgeschlossen zeigen<br />
sich Großunternehmen ab 500 Mitarbeitern<br />
– und die Handelsbranche:<br />
z So sind bei den Großunternehmen<br />
82 % sehr bzw. eher aufgeschlossen<br />
(Durchschnitt: 74 %). Bei den kleinen<br />
Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern<br />
sind es 73 %.<br />
z Besonders digital-affin zeigt sich der<br />
Handel: 82 % der Händler geben an,<br />
sehr bzw. eher aufgeschlossen zu sein.<br />
Es folgen Banken und Finanzdienstleister<br />
mit 78 % sowie der Maschinenund<br />
Anlagenbau mit 77 %. Auf den<br />
hinteren Plätzen liegen die Bereiche<br />
Chemie und Pharma (72 % aufgeschlossen)<br />
sowie sonstige Dienstleistungen<br />
(68 % aufgeschlossen).<br />
„Wir haben diese Daten im Digital<br />
Office Index jetzt zum zweiten Mal<br />
erhoben – mit wieder vergleichbar<br />
hohen Werten“, sagte Achim Berg,<br />
Präsident im Bundesverband Informationswirtschaft,<br />
Telekommunikation<br />
und neue Medien e.V. (BIT-<br />
KOM). „Beim Blick auf die Branchen<br />
ist interessant, dass vor allem der<br />
Handel der Digitalisierung offen<br />
gegenübersteht, obwohl gerade dort<br />
in Folge der Digitalisierung viele<br />
neue Wettbewerber auf den Markt<br />
drängen. Andererseits bietet die<br />
Digitalisierung auch besonders interessante<br />
Möglichkeiten für diese<br />
Unternehmen und eröffnet selbst<br />
kleinen Einzelhändlern globale Verkaufschancen.“<br />
Fragt man die Unternehmen<br />
übrigens, ob sie die Digitalisierung<br />
eher als Chance oder Risiko begreifen,<br />
überwiegen mit großer Mehrheit<br />
die positiven Aussichten. So<br />
sagen neun von zehn Unternehmen<br />
(88 %), dass die Digitalisierung für<br />
sie eher eine Chance ist. Jedes<br />
zehnte Unternehmen (11 %) sieht<br />
eher das Risiko. 1 % mochte sich<br />
dazu nicht äußern. 2<br />
Ausbildungsreport<br />
Kritik zu Kaufleuten<br />
In Zeiten aufwändiger Suche<br />
nach den immer weniger zur Verfügung<br />
stehenden Bewerber*innen um Ausbildungsplätze,<br />
finden Untersuchungen zu<br />
entsprechenden Sachverhalten erhöhte<br />
Aufmerksamkeit. So ging es im Herbst<br />
des vergangenen Jahres dem DGB-Ausbildungsreport<br />
2018, in dem die Situation<br />
der Kaufleute im Groß- und Außenhandel<br />
besonders kritisiert wurde.<br />
Zwar landet in der Analyse des Deutschen<br />
Gewerkschaftsbundes (DGB) der<br />
Beruf des Kaufmanns/der Kauffrau im<br />
Groß- und Außenhandel in der Gesamtbewertung<br />
im Mittelfeld, der Bundesverband<br />
Großhandel Außenhandel Dienstleistungen<br />
e.V. (BGA) kommentierte es<br />
jedoch als besonders bedenklich, dass<br />
bei der Bewertung die fachliche Qualität<br />
der Ausbildung im Betrieb als besonders<br />
schlecht abgeschnitten hat. In dieses<br />
Kriterium fließen u.a. ein: die Einhaltung<br />
des Ausbildungsplans, die Verrichtung<br />
von ausbildungsfremden Tätigkeiten,<br />
das Vorhandensein und die Verfügbarkeit<br />
von Ausbildern am Arbeitsplatz<br />
sowie die Zufriedenheit mit der Erklärung<br />
von Arbeitsvorgängen.<br />
Quelle: bitkom<br />
Eher eine Chance: Die große Mehrheit ist der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossen.<br />
Die Befragung der Auszubildenden für<br />
die vorliegende Erhebung fand überwiegend<br />
im Rahmen der sogenannten<br />
Berufsschultouren der DGB-Gewerkschaftsjugend<br />
statt. Dabei handelt es<br />
sich um Bildungsangebote für Oberstufenzentren<br />
bzw. Berufsschulen. Insgesamt<br />
wurden die Angaben von 14.959<br />
Auszubildenden aller Branchen aus den<br />
25 meistfrequentierten Ausbildungsberufen<br />
in die Auswertung aufgenommen.<br />
52 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Ausbildungsvergütungen<br />
Wieder stärker angestiegen<br />
Die tariflichen Ausbildungsvergütungen<br />
sind 2018 im bundesweiten Durchschnitt<br />
um 3,7 % gestiegen. Diese Zunahme<br />
fiel stärker aus als 2017 (2,6 %). Bundesweit<br />
lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen<br />
2018 bei durchschnittlich 908 €<br />
brutto im Monat; In Westdeutschland wurde<br />
ein durchschnittlicher Betrag von 913 €<br />
erreicht, in Ostdeutschland waren es 859 €.<br />
Dies hat das BIBB mitgeteilt.<br />
Prozentual wurden die tariflichen Ausbildungsvergütungen<br />
2018 im Osten (3,9 %)<br />
etwas stärker erhöht als im Westen (3,6 %).<br />
Der Abstand im Tarifniveau blieb aber<br />
unverändert: Im Osten wurden wie im Vorjahr<br />
94 % der westdeutschen Vergütungshöhe<br />
erreicht.<br />
Ermittelt wurden die durchschnittlichen<br />
Vergütungen für 181 Berufe in West- und<br />
153 Berufe in Ostdeutschland. Auf die einbezogenen<br />
Berufe entfielen 89 % aller Ausbildungsverhältnisse.<br />
Das Bundesinstitut für<br />
Berufsbildung (BIBB) wertet die tariflichen<br />
Ausbildungsvergütungen seit 1976 jährlich<br />
zum 1. Oktober aus.<br />
Besonders hoch lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen<br />
im Handwerksberuf Maurer/-in<br />
mit monatlich 1.159 € im gesamtdeutschen<br />
Durchschnitt (Westdeutschland:<br />
1.175 €, Ostdeutschland: 975 €). Hohe tarifliche<br />
Vergütungen wurden beispielsweise<br />
auch in den Berufen Mechatroniker/-in<br />
(gesamt: 1.088 €, West: 1.091 €, Ost: 1.070<br />
€), Industriekaufmann/-frau (gesamt: 1.047<br />
€, West: 1.051 €, Ost: 981 €) und Kaufmann/-frau<br />
für Versicherungen und Finanzen<br />
(einheitlich: 1.035 €) gezahlt.<br />
Vergleichsweise niedrig waren die tariflichen<br />
Vergütungsdurchschnitte 2018 zum<br />
Beispiel in den Berufen Maler/-in und<br />
Lackierer/-in (einheitlich: 718 €), Bäcker/-in<br />
(einheitlich: 678 €), Florist/-in (gesamt:<br />
617 €, West: 622 €, Ost: 587 €), Friseur/-in<br />
(gesamt: 584 €, West: 606 €, Ost: 387 €)<br />
sowie Schornsteinfeger/-in (einheitlich:<br />
518 €).<br />
E-Commerce vs<br />
Groß- und Außenhandel<br />
Neu abgeschlossene<br />
Ausbildungsverträge<br />
Das BIBB hat aktuelle Zahlen zu<br />
den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen<br />
zum 30.9.18 veröffentlicht.<br />
Darunter sind erstmals auch offizielle<br />
Zahlen zum erfolgreich gestarteten E-<br />
Commerce-Kaufmann und Details zum<br />
Rückgang bei den Kaufleuten im Großund<br />
Außenhandel.<br />
Gesamtwirtschaftlich ist die Zahl der neu<br />
abgeschlossenen Ausbildungsverträge<br />
nach den Angaben aus dem Bundesinstitut<br />
für Berufsbildung (BIBB) um 1,6 %<br />
gestiegen. Dies ist allein auf einen<br />
Zuwachs bei männlichen Azubis (+3,0 %)<br />
zurückzuführen. Bei weiblichen Azubis<br />
gab es dagegen erneut einen Rückgang<br />
(-0,9 %).<br />
Festzustellen ist vor allem ein Zuwachs<br />
z.B. bei den Fachkräften für Lagerlogistik<br />
(+4,6 %), bei Fachlageristen (+2,6 %)<br />
sowie bei Berufskraftfahrern (+9,4 %).<br />
Auffällig ist der Rückgang in handelsaffinen<br />
kaufmännischen Berufen, wie Kaufmann<br />
für Büromanagement (-2,6 %), Kaufmann<br />
für Dialogmarketing (-5,0 %),<br />
Kaufmann für Marketingkommunikation<br />
(-7,0 %) sowie Kaufmann im Einzelhandel<br />
(-3,0 % bzw. -732 Verträge).<br />
Besonders deutlich ist auch der Rückgang<br />
beim Kaufmann im Groß- und<br />
Außenhandel mit -6,3 % (-906 Verträge)<br />
ausgefallen. Profitiert hat davon offensichtlich<br />
der neue Beruf Kaufmann im E-<br />
Commerce, der mit 1.284 Neuabschlüssen<br />
bis zum 30.9.18 gestartet ist. Er<br />
steht damit auf Rang 78 der Ausbildungsberufe.<br />
Wie viele E-Commerce-Kaufleute<br />
im Groß- und Außenhandel gelandet sind,<br />
das ist allerdings noch nicht bekannt.<br />
Quelle: BIBB<br />
Kontinuierliche Entwicklung nach oben: die tariflichen Ausbildungsvergütungen.<br />
Für den/die Kaufmann/Kauffrau im<br />
Groß- und Außenhandel bedeutet diese<br />
Entwicklung einen Rückfall in der Liste<br />
der häufigsten Ausbildungsberufe von<br />
Platz sieben auf Platz zehn. Zwischen Jungen<br />
und Mädchen getrennt betrachtet,<br />
liegt der Beruf aber unverändert jeweils<br />
auf Rang neun.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
53
Wissenswertes<br />
Bericht/Nachrichten<br />
Foto: IPK Fraunhofer<br />
Industriearbeitsplatz 4.0<br />
Standpunktpapier zur Digitalisierung<br />
Veränderungen menschengerecht gestalten<br />
Die WGP Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik hat in ihrem Standpunktpapier<br />
„Industriearbeitsplatz 2025“ im vergangenen Jahr gesellschaftliche Folgen von Digitalisierung und<br />
Vernetzung der deutschen Industrie analysiert. Ziel der entsprechenden Forschungsarbeiten auf der<br />
Basis eines Stufenmodells ist es, die Veränderungen möglichst menschengerecht zu gestalten; eines<br />
der Ergebnisse: Das Bildungssystem ist der Engpass.<br />
Foto: IFW Hannover<br />
„Jede industrielle Revolution,<br />
und als solche wird ja Industrie 4.0<br />
bezeichnet, geht mit immensen gesellschaftlichen<br />
Umwälzungen einher. Wir<br />
wollen als Zusammenschluss deutscher<br />
Professoren der Produktionstechnik<br />
unser Know-how einbringen, um diese<br />
Umwälzungen möglichst menschengerecht<br />
zu gestalten“, sagt Prof. Berend<br />
Denkena, Präsident der WGP und Leiter<br />
des Instituts für Fertigungstechnik und<br />
Werkzeugmaschinen IFW der Universität<br />
Hannover. Hierfür haben die Autoren<br />
ein neues Modell entwickelt, das<br />
den Automatisierungsgrad in der<br />
Industrie analysiert und zeigt, in welche<br />
Richtung Handlungsbedarf besteht.<br />
„Jede industrielle<br />
Revolution… geht<br />
mit immensen<br />
gesellschaftlichen<br />
Umwälzungen<br />
einher.“<br />
Prof. Berend Denkena,<br />
Präsident der WGP<br />
Stufenmodell als Basis<br />
Die WGP-Professoren haben sich am<br />
Stufenmodell für autonomes Fahren<br />
orientiert. Unterschiedliche Automatisierungsstufen<br />
beschreiben dabei<br />
den Weg hin zur Vollautomatisierung.<br />
Diese Stufen werden auf drei unterschiedliche<br />
Dimensionen angewendet:<br />
die Material- und Informationsflüsse<br />
(Vernetzung), den Anlagenzustand<br />
(Betriebszustand) und den jeweiligen<br />
Produktionsprozess.<br />
„Unternehmen können dieses<br />
Modell nutzen, um den Automatisierungsgrad<br />
ihrer unterschiedlichen<br />
Produktionsprozesse zu bestimmen<br />
und daraus abzuleiten, wo Handlungsbedarfe<br />
bestehen“, berichtet Prof. Peter<br />
Groche, Initiator des WGP-Standpunktpapiers<br />
und Leiter des Instituts für<br />
Produktionstechnik und Umformmaschinen<br />
(PtU) der TU Darmstadt. Dabei<br />
geht es nicht nur darum zu eruieren,<br />
ob weiter automatisiert oder auf weitere<br />
Automatisierung verzichtet werden<br />
sollte, sondern auch um die Gestaltung<br />
des künftigen Arbeitsplatzes.<br />
So werden zum Beispiel Weiterbildungsbedarfe<br />
der Mitarbeiter frühzeitig<br />
erkennbar. „Wir benötigen auch<br />
für die Produktion eine Roadmap der<br />
Automatisierung, im Rahmen derer<br />
wir Arbeitsplätze zukunftsorientiert<br />
ausrichten können“, ergänzt Prof. Jörg<br />
Krüger, Leiter des Fachgebiets Industrielle<br />
Automatisierungstechnik im<br />
Institut für Werkzeugmaschinen und<br />
Fabrikbetrieb (IWF) der TU Berlin<br />
sowie Leiter des Geschäftsfeldes Automatisierungstechnik<br />
des Fraunhofer<br />
Instituts für Produktionsanlagen und<br />
Konstruktionstechnik IPK in Berlin:<br />
„Ältere Modelle werden dem nicht<br />
gerecht. Gerade die zukünftige Verbindung<br />
des Menschen mit maschinell<br />
lernenden Systemen in der Fabrik<br />
müssen wir genauer betrachten.“<br />
„Anhand unseres Modells haben<br />
wir auch den derzeitigen und den<br />
künftigen technologischen Stand im<br />
deutschen produzierenden Gewerbe<br />
analysiert“, so Groche. „Denn nur mit<br />
wissenschaftlich fundiertem Wissen<br />
kann man Antworten auf gesellschaftlich<br />
relevante Fragen finden – bezogen<br />
auf Hoffnungen, genauso wie auf<br />
Ängste etwa vor massivem Verlust an<br />
Arbeitsplätzen.“ Es habe sich gezeigt,<br />
54 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
dass es bis zur Vollautomatisierung<br />
der deutschen Industrie noch ein weiter<br />
Weg ist. Dennoch müsse man<br />
davon ausgehen, dass künftig die Optimierung<br />
von Produktionsanlagen und<br />
-prozessen nicht mehr nur von Menschen,<br />
sondern zunehmend von den<br />
Maschinen selbst übernommen wird.<br />
In der WGP ist man davon überzeugt,<br />
dass Menschen auch in vollautomatisierten<br />
Fabriken längerfristig<br />
nicht überflüssig werden. „Auch<br />
selbstlernende Produktionssysteme<br />
müssen von Facharbeiterinnen und<br />
Facharbeitern zum Lernen angeleitet<br />
werden“, ist sich Prof. Bernd-Arno<br />
Behrens, Leiter des Instituts für<br />
Umformtechnik und Umformmaschinen<br />
(IFUM) der Leibniz Universität<br />
Hannover, sicher. „Und autonome Teilsysteme<br />
einer Produktionsanlage müssen<br />
überwacht und instand gehalten<br />
werden. Zudem eröffnen beispielsweise<br />
datenbasierte Dienstleistungen<br />
und maschinelles Lernen ganz neue<br />
Geschäftsmodelle, für die Mitarbeiter<br />
mit neuen Qualifikationsprofilen benötigt<br />
werden.“<br />
Nicht zuletzt, so die Annahme der<br />
Autoren, könnte Industrie 4.0 dafür<br />
sorgen, dass einfache Tätigkeiten im<br />
eigenen Land wieder lukrativer werden,<br />
so dass das ein oder andere Unternehmen<br />
ins Ausland verlegte Produktionsschritte<br />
nach Deutschland<br />
zurückholen könnte. Damit wäre die<br />
Produktionsverantwortung wieder<br />
unter einem Dach vereint. „Es kann<br />
einen nicht zu unterschätzenden<br />
unternehmerischen Vorteil bedeuten,<br />
die gesamte Prozesskette an einem<br />
Standort überblicken zu können“, so<br />
Behrens.<br />
Eine zentrale Rolle spielen Mitarbeiter<br />
aber auch unter einem ganz<br />
anderen Gesichtspunkt. So sei der<br />
Wettbewerbsvorsprung deutscher<br />
Fabriken unter anderem in der hohen<br />
Qualifikation ihrer Mitarbeiter begründet.<br />
„Mit Blick auf den Standort<br />
Deutschland im internationalen Wettbewerb<br />
sind hochqualifizierte Mitarbeiter,<br />
die sich durch ein hohes<br />
Prozessverständnis auszeichnen, ebenfalls<br />
ein Pfund, mit dem wir wuchern<br />
können“, so Behrens. „Nur wenn wir<br />
diesen Qualifikationsvorsprung aufrecht<br />
erhalten, kann auch der Wettbewerbsvorteil<br />
des Hochlohnlandes<br />
Deutschland in näherer Zukunft gehalten<br />
werden, weil die Mitarbeiter selbst<br />
bei zunehmender Automatisierung in<br />
der Lage sind, den Prozess nachzuvollziehen<br />
und – wenn nötig – entsprechend<br />
einzugreifen.“<br />
Foto: PtU Darmstadt<br />
Bildungssystem als Engpass<br />
Solle dieser Wettbewerbsvorsprung<br />
gehalten werden, müsse das Bildungssystem<br />
jedoch zeitnah angepasst werden,<br />
mahnen die WGP-Professoren.<br />
Schon jetzt würden Fachkräfte mit<br />
Kenntnissen beispielsweise in IT und<br />
Mechatronik händeringend gesucht.<br />
„Unser Aus- und Weiterbildungssystem<br />
ist viel zu starr“, moniert Prof.<br />
Jens Wulfsberg, Leiter des Laboratoriums<br />
Fertigungstechnik (LaFT) der<br />
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.<br />
„Wir müssen Berufsschullehrer,<br />
Professoren und alle Mediatoren in<br />
Sachen Digitalisierung auf den neuesten<br />
Stand der Dinge bringen“, fordert<br />
Wulfsberg. „Das könnten wir<br />
durch Updateschulungen in unseren<br />
Forschungseinrichtungen erreichen.<br />
Deswegen sollten sich Unternehmen<br />
und Forschungseinrichtungen weiter<br />
verzahnen und beispielsweise Trainer<br />
austauschen.“<br />
So ließe sich ein Wissenstransfer<br />
in beide Richtungen stark beschleunigen.<br />
2<br />
„Unternehmen können<br />
dieses Modell nutzen,<br />
um den Automatisierungsgrad<br />
ihrer<br />
Produktionsprozesse<br />
zu bestimmen…“<br />
Prof. Peter Groche, Leiter des<br />
Instituts für Produktionstechnik und<br />
Umformmaschinen, TU Darmstadt<br />
Hauptstadtinitiative<br />
Industrie und Start-ups<br />
Industrie und Start-ups zusammenbringen<br />
will eine Vereinsinitiative, die zu einer entsprechenden<br />
Auftaktveranstaltung für den<br />
20.2.19 nach Berlin in das Haus der Deutschen<br />
Wirtschaft eingeladen hat. Sie trägt den Namen<br />
4OPMC (OpenProduction & Maintenance Community).<br />
In der Hauptstadt sollen sich Anlagenbetreiber,<br />
Technologie- und Serviceanbieter, Forschungsinstitute<br />
sowie Verbände treffen,<br />
um unter dem Titel „4OPMC Ecosystems“<br />
gemeinsam die digitale Zukunft der deutschen<br />
Industrie zu gestalten. Im Fokus sollen<br />
die Veränderungen der Industrie im<br />
Zuge der Digitalisierung und die Auswirkungen<br />
der digitalen Transformation auf industrielle<br />
Arbeitsplätze stehen.<br />
„Wir freuen uns sehr, die Staatsministerin<br />
und Beauftragte der Bundesregierung für<br />
Digitalisierung, Dorothee Bär, und den BDI-<br />
Präsidenten Prof. Dieter Kempf zu diesem<br />
Anlass an unserer Seite zu wissen“, verkündete<br />
der 4OPMC-Vorstandsvorsitzende Dr.<br />
Andreas Weber.<br />
[ Info ]<br />
Anmeldungen für die „4OPMC Ecosystems“<br />
werden über den folgenden Link entgegengenommen:<br />
www.4opmc.com/ecosystems.<br />
Symposium über<br />
Verbunde<br />
Das 22. Symposium „Verbundwerkstoffe<br />
und Werkstoffverbunde“ der Deutschen<br />
Gesellschaft für Materialkunde (DGM)<br />
vom 26.-28.6.19 in Kaiserslautern verspricht,<br />
alle Fragestellungen aus Forschung<br />
und Wissenschaft zu Verbundwerkstoffen<br />
mit polymerer, metallischer<br />
oder keramischer Matrix zu behandeln.<br />
Dabei wird der Bogen von mikrostrukturellen<br />
Grundlagen bis hin zu Anwendungsbeispielen<br />
gespannt. In dem Symposium<br />
wird erstmals ein Schwerpunkt auf Poster-Pitches<br />
gesetzt. Über diesen Ansatz<br />
sollen kompakte Drei-Minuten-Vorträge<br />
einen möglichst umfassenden Überblick<br />
über die Tagungsthemen geben.<br />
[ Info ]<br />
Weitere Informationen gibt es unter<br />
https://verbund2019.dgm.de.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
55
Verbände<br />
und Politik<br />
Berichte/Nachricht<br />
ArcelorMittal thematisierte bei einem Seminar<br />
in Berlin den Zusammenhang zwischen<br />
betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten<br />
im Brückenbau und empfahl auf diesem<br />
Weg Stahl als dafür vorteilhaften Baustoff.<br />
Stahl baut Brücken<br />
Fachseminar von ArcelorMittal<br />
und Verbandsaktivitäten<br />
Brücken aus Stahl sind bekannt. Dass dieser Werkstoff aber auch andere Verbindungen ermöglicht,<br />
hat ein Seminar gezeigt, zu dem ArcelorMittal Mitte November nach Berlin eingeladen hatte.<br />
Die Veranstaltung machte nämlich auch deutlich, wie intensiv die betriebswirtschaftlichen<br />
Aufwendungen für den Brückenbau mit volkswirtschaftlichen Kosten in Verbindung gebracht werden<br />
müssen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte zeitlich parallel dazu in Frankfurt/M. eine Verbändeinitiative.<br />
Das Impulsreferat „Baukosten<br />
vs. volkswirtschaftliche Kosten von<br />
Brücken“ hielt in der deutschen<br />
Hauptstadt Dipl.-Ing. Manfred Hermann<br />
vom Karlsruher Institut für<br />
Technologie. Er informierte darin<br />
nicht nur über den zunehmend<br />
schlechten Zustand von Bücken (vor<br />
allem) im Süden Deutschlands sowie<br />
in Berlin, er präsentierte zudem auch<br />
Untersuchungsergebnisse seines<br />
Hauses über die volkswirtschaftlichen<br />
Folgekosten der in diesem<br />
Zusammenhang einzurichtenden<br />
Baustellen – durch Unfälle und Staus,<br />
die zeitlichen Aufwand und zunehmende<br />
Emissionen bedeuten. Pro<br />
Staustunde sei im Geschäftsverkehr<br />
mit 20 € zu rechnen, im privaten<br />
Bereich mit 9 €/h.<br />
Fast zeitgleich erhielt diese Argumentation<br />
Unterstützung durch sieben<br />
Wirtschaftsverbände, unter ihnen<br />
der Bundesverband der Deutschen<br />
Industrie und die Deutsche Bauindustrie,<br />
die in Frankfurt/M. den<br />
schlechten Zustand von Brücken in<br />
Deutschland beklagten, weil auch<br />
deshalb die Genehmigungsverfahren<br />
für Großraum- und Schwertransporte<br />
in vielen Bundesländern noch immer<br />
viel zu umständlich und langsam<br />
seien. Einstimmig hatten die Verbände<br />
auf dem diesjährigen Verkehrsforum<br />
in der Mainmetropole dazu<br />
Verbesserungen angemahnt: Sie fordern<br />
deutlich mehr Investitionen in<br />
die Infrastruktur, insbesondere in<br />
die Ertüchtigung maroder Brücken,<br />
eine Aufstockung der Planungsmittel<br />
für Ingenieure in den zuständigen<br />
Behörden und eine bessere Zusammenarbeit<br />
unter den Bundesländern,<br />
die durch Datenaustausch Transparenz<br />
über Verkehrsbehinderungen<br />
und Baustellen schaffen sollen.<br />
Vorteilhafte Lösungen<br />
Dass und warum Stahl in diesen<br />
Zusammenhängen vorteilhafte technische<br />
Lösungen und durch eine Verkürzung<br />
der Bauzeit insbesondere<br />
zeitliche Verbesserungen erbringen<br />
kann, machten in dem Seminar der<br />
ArcelorMittal Germany die weiteren<br />
Referenten deutlich, deren Ausführungen<br />
auf Bauherren,- planer und<br />
-ausführende abzielten und – vor<br />
allem im Vergleich mit alternativen<br />
Konstruktionsmaterialien – zu einer<br />
Gesamtkostenbetrachtung aus Herstellung<br />
und Unterhalt aufforderten:<br />
z „Entwicklungen in der Verbundbauweise“<br />
stellte Dr.-Ing. Günter<br />
Seidl, SSF Ingenieure AG, dar.<br />
z „Effiziente Lösungen mit Walzprofilen<br />
für dauerhafte Brücken“<br />
brachte Dennis Rademacher (Head<br />
of Development and Technical Advisory<br />
– Bridges ArcelorMittal Europe<br />
– Long Products) nahe.<br />
z Über die „Ausführung von Trogstrecken<br />
und Brückenwiderlagern“<br />
referierte Hans-Uwe Kalle (Leiter<br />
der technischen Abteilung Arcelor-<br />
Mittal Commercial Long Deutschland).<br />
z Und Dr.-Ing. Oliver Hechler (Head<br />
of Technical Marketing and Promotion,<br />
ArcelorMittal Europe – Long<br />
Products) steuerte „Anwendungsbereiche<br />
und Bedeutung von Stahl<br />
im Verkehrswege-/Infrastrukturbau“<br />
bei. 2<br />
56 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Vereinfachung der Bildungsförderung<br />
Tagung der Ebert-Stiftung<br />
zur Finanzierung der<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
Die „Finanzierung der Aus- und Weiterbildung“ gehört zu den<br />
wichtigsten Faktoren beim „Lernen für Morgen“. Mit dieser<br />
Erkenntnis hatte die Friedrich Ebert-Stiftung Mitte November zu<br />
einer gleichnamigen Tagung nach Berlin eingeladen. Die dafür<br />
erstellte Übersicht zu den vorhandenen rund 100 Finanzierungsinstrumenten<br />
machte die eigentliche Herausforderung deutlich: Verbesserung<br />
des Fördersystems durch Vereinfachung. Dabei könnte<br />
aus sozialdemokratischer Sicht der Deutsche Qualifikationsrahmen<br />
eine entscheidende Rolle spielen.<br />
In der ersten Diskussionsrunde<br />
der Tagung hatte es der<br />
bildungspolitische Sprecher der SPD-<br />
Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek,<br />
vor über 100 Teilnehmern auf<br />
den Punkt gebracht: Seine Partei<br />
befinde sich zur Bildungspolitik derzeit<br />
in einem offenen Diskussionsprozess,<br />
der z.B. auch die Rolle der<br />
Hochschulen in einer veränderten<br />
Arbeitswelt umfasse und damit ganzheitlich<br />
ausgerichtet sei. Auf diese<br />
Weise machte er deutlich, wie wichtig<br />
z.B. solche Konferenzen gerade jetzt<br />
zur politischen Willensbildung sind,<br />
für die im Koalitionsvertrag die wichtigen<br />
Themen genannt worden seien.<br />
Fördermittel<br />
Dazu gehören auch die von der Friedrich<br />
Ebert-Stiftung (FES) für die<br />
Tagung nach den Zielgruppen Schüler,<br />
Studierende, Erwerbslose und<br />
Erwerbstätige systematisierten Förderprogramme.<br />
In letztgenanntem<br />
Zusammenhang reicht das Spektrum<br />
der Maßnahmen u.a. vom Aufstiegs-<br />
BAföG über Weiterbildungsstipendien<br />
und Bildungsgutscheine bis hin<br />
zu Spar- und Prämienmodellen. Eine<br />
Übersicht dazu bietet die Website<br />
https://weiterbildungsguide.test.de/t<br />
ools/foerdermittel/main_page. Angesichts<br />
dieser Vielfalt war es auf der<br />
FES-Tagung Konsens, dass die Menge<br />
der Förderprogramme gestrafft und<br />
nach veränderten Kriterien neu systematisiert<br />
werden muss.<br />
Als Kriterium für diese Neuordnung<br />
brachte bei der Tagung in<br />
einer zweiten Diskussionsrunde Dr.<br />
Ernst Dieter Rossmann MdB den<br />
Deutschen Qualifikationsrahmen<br />
(DQR) und dessen europäisches<br />
Pendant ins Gespräch. Der Sozialdemokrat<br />
ist Vorsitzender des Ausschusses<br />
für Bildung, Forschung<br />
und Technikfolgenabschätzung im<br />
Deutschen Bundestag. Eine solche<br />
DQR-Orientierung biete z.B. die<br />
Möglichkeit, für akademische und<br />
berufliche Bildungsabschlüsse individuell<br />
erworbene Kompetenzen<br />
mit denen, die im gesellschaftlichen<br />
Interesse liegen, abzugleichen und<br />
die Fördervolumina auf dieser Basis<br />
auf den unterschiedlichen Niveaustufen<br />
mit volkswirtschaftlichen<br />
Notwendigkeiten in Einklang zu<br />
bringen.<br />
An weiterführenden Ideen wurden<br />
auf der Tagung in Berlin außerdem<br />
das Modell einer Arbeitsversicherung<br />
(statt Versicherung gegen<br />
Arbeitslosigkeit) sowie die Möglichkeiten<br />
diskutiert, die ein persönliches<br />
Chancenkonto bietet, mit dem<br />
frei zu wählende Maßnahmen in<br />
einer definierten Größenordnung<br />
finanziert werden können. 2<br />
EHV-Mitgliederversammlung 2018<br />
Logistik und<br />
Automobilindustrie<br />
Zur Mitgliederversammlung<br />
2018 hatte die EHV Ende November<br />
des vergangenen Jahres eingeladen.<br />
Neben dem verbandsinternen Teil für<br />
Mitgliedsunternehmen hatte die EHV<br />
in Düsseldorf dabei auch wieder einen<br />
öffentlichen Veranstaltungspart mit<br />
Vorträgen zu aktuellen Themen ausgerichtet.<br />
Anmoderiert von Ralf Winterfeld,<br />
Geschäftsführer der Edelstahlhandelsvereinigung<br />
(EHV), berichtete Jürgen<br />
Gotthart, Prokurist der Duisburger<br />
Bartl Spedition GmbH, über die<br />
„Herausforderung des Edelstahlhandels<br />
aus der Sicht der Logistik“. Im<br />
Mittelpunkt standen dabei der akute<br />
Fahrermangel in seiner Branche sowie<br />
die schwierige Verkehrssituation mit<br />
zu vollen Straßen und langen Wartezeiten.<br />
Kunden der Speditionen könnten<br />
Schwierigkeiten aber oft abmildern<br />
oder umgehen, indem sie frühzeitig auf<br />
ihre Dienstleister zugingen, empfahl<br />
der Logistiker. Auch Instrumente wie<br />
Zeitfenstermanagement-Systeme<br />
könnten helfen, Ressourcen besser<br />
auszunutzen.<br />
Weiteren Input gab Dr. Manuel Kallweit,<br />
Leiter der Abteilung Märkte, Analysen,<br />
Rohstoffe, Statistik, vom Verband<br />
der Automobilindustrie e.V.<br />
(VDA). Er sprach über „Herausforderungen<br />
für die Automobilindustrie“.<br />
Dabei ging er auch auf die Diesel- und<br />
Abgas-Problematik ein und machte auf<br />
die Verzerrung aufmerksam, die in der<br />
öffentlichen Wahrnehmung der Problematik<br />
herrsche. So seien die Stickoxidemissionen<br />
im Straßenverkehr seit<br />
1990 um 70 % gesunken – trotz einer<br />
von 1990 bis heute um etwa die Hälfte<br />
gesteigerten Verkehrsleistung. „Die<br />
Luft in Deutschland ist also immer sauberer<br />
geworden. Wir haben kein Flächenproblem,<br />
sondern Überschreitungen<br />
der Jahresgrenzwerte an einigen<br />
Hotspots“, sagte Kallweit.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
57
Verbände<br />
und Politik<br />
Berichte/Nachrichten<br />
Die durch die Initiative<br />
seit 2013 in<br />
Phase I (Pkw, 42 kg),<br />
Phase II (Leichtes<br />
Nutzfahrzeug, 99 kg)<br />
und Phase III (Hybrid<br />
Pkw, 93 kg) gehobenen<br />
Leichtbaupotenziale<br />
mit Massivformteilen<br />
aus Stahl.<br />
Fotos, 2: Initiative Massiver Leichtbau<br />
Leichtere Automobile mit Stahl<br />
Dritte Projektphase<br />
erfolgreich abgeschlossen<br />
Das Gewicht von Fahrzeugen weiter zu reduzieren ist eine der entscheidenden Herausforderungen<br />
für die Automobilindustrie in naher Zukunft. Stahl behält dabei dank seiner Leichtbauqualitäten<br />
eine zentrale Rolle. Die Initiative Massiver Leichtbau, eine Kooperation von Unternehmen aus der<br />
Stahlbranche und der Massivumformung, zeigt seit 2013 diese Potenziale auf. Jetzt wurde die dritte<br />
Projektphase erfolgreich abgeschlossen.<br />
Das nun beendete Teilprojekt<br />
startete im Juli 2017 mit 39 Kooperationspartnern<br />
aus Westeuropa,<br />
USA und Japan – mit der Demontage<br />
und Dokumentation eines Hybrid-<br />
Pkw durch die fka Forschungsgesellschaft<br />
Kraftfahrwesen mbH,<br />
Aachen. In gleicher Weise wurden<br />
Getriebe, Kardanwelle und Hinterachse<br />
eines schweren Nutzfahrzeugs<br />
demontiert.<br />
In einem Workshop im Januar<br />
2018 beim fka in Aachen konnten<br />
80 Vertreter der projektbeteiligten<br />
Unternehmen die über 4.000 ausliegenden<br />
Bauteile selbst beurteilen<br />
und im Hinblick auf mögliche Leichtbaumaßnahmen<br />
inspizieren.<br />
z Bei dem Hybrid-Pkw mit einer Referenzmasse<br />
von 816 kg summieren<br />
sich diese Leichtbauansätze im<br />
Ergebnis auf eine Gewichtsreduzierung<br />
von insgesamt 93 kg.<br />
z Für den Lkw-Antriebsstrang mit<br />
einer Referenzmasse von 909 kg<br />
können die Experten eine<br />
Gewichtsreduzierung um insgesamt<br />
124 kg in Aussicht stellen.<br />
Dr.-Ing. Hans-Willi Raedt, Sprecher der<br />
Leichtbauinitiative und Vice President<br />
Advanced Engineering der Hirschvogel<br />
Automotive Group.<br />
In dem im vergangenen Oktober im<br />
Stahl-Zentrum in Düsseldorf durchgeführten<br />
Abschlusskolloquium mit<br />
den Kooperationspartnern der Initiative<br />
wurden die wesentlichen<br />
Ergebnisse präsentiert. Die Sprecher<br />
der Initiative, Dr. Hans-Willi Raedt<br />
von der Hirschvogel Automotive<br />
Group für die Massivumformer sowie<br />
Dr. Thomas Wurm von der Georgsmarienhütte<br />
GmbH für die Stahlbranche,<br />
führten durch das Vortragsprogramm.<br />
Die Teilnehmer,<br />
Fachleute für Stahlwerkstoffe und<br />
Massivumformverfahren, hatten viel<br />
Gelegenheit für fachlichen Austausch.<br />
Nun stehen die beteiligten Zulieferer<br />
vor der Aufgabe, ihre Lösungsvorschläge<br />
den bestehenden und<br />
potenziellen Kunden zu vermitteln<br />
sowie Überzeugungsarbeit bei Entwicklern,<br />
Konstrukteuren und Einkäufern<br />
zu leisten, denn: Weniger<br />
Gewicht bedeutet geringere CO 2<br />
-<br />
Emissionen durch Reduzierung des<br />
Kraftstoffverbrauchs, bessere Material-<br />
und Ressourceneffizienz, höhere<br />
Zuladungsmöglichkeiten, eine Erhöhung<br />
des Fahrerlebnisses und der<br />
Fahrsicherheit sowie last but not<br />
least einen unverzichtbaren Beitrag<br />
für die Umwelt. 2<br />
58 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Verbände mahnen die politischen Entscheider<br />
Digitalisierung weckt Wünsche<br />
Zahlreiche Verbände haben das politische Geschehen der vergangenen Monate rund um die<br />
Digitalisierung dazu genutzt, insbesondere gegenüber der Politik die Notwendigkeit von Fortschritten<br />
anzumahnen und dafür Inhalte zu formulieren. Es ging dabei Bitkom um den Digitalgipfel der<br />
Bundesregierung und VDMA sowie VDE um das Kooperationsverbot in Bildungsfragen.<br />
Der Bundesverband Informationswirtschaft,<br />
Telekommunikation<br />
und neue Medien e.V. (Bitkom) hatte<br />
Anfang Dezember an Politik und<br />
Wirtschaft appelliert, die Chancen<br />
neuer Technologien wie Künstliche<br />
Intelligenz (KI) noch stärker zu nutzen.<br />
Zum Digitalgipfel der Bundesregierung,<br />
der KI in den Mittelpunkt<br />
gestellt hatte, sagte Bitkom-Präsident<br />
Achim Berg auf einer gemeinsamen<br />
Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister<br />
Peter Altmaier:<br />
„Deutschland will KI – und Deutschland<br />
kann KI.“ Die deutsche Wirtschaft<br />
hängt auch nach Ansicht einer<br />
großen Mehrheit der Bundesbürger<br />
vom Einsatz Künstlicher Intelligenz<br />
ab: Zwei Drittel (64 %) sind der Meinung,<br />
dass der Wohlstand hierzulande<br />
in Gefahr gerät, wenn Deutschland<br />
bei der KI nicht zu den<br />
führenden Nationen gehört. Das ist<br />
eines der Ergebnisse einer repräsentativen<br />
Umfrage im Auftrag des Digitalverbands<br />
Bitkom.<br />
Im Streit des Bundesrates über<br />
eine Verfassungsänderung zur<br />
Lockerung des Kooperationsverbotes<br />
von Bund und Ländern mahnte Dr.<br />
Jörg Friedrich, Leiter der Bildungsabteilung<br />
im Verband Deutscher<br />
Maschinen- und Anlagenbau<br />
(VDMA): „Die Schule wird durch die<br />
Digitalisierung mehr und mehr von<br />
der gesellschaftlichen Entwicklung<br />
abgehängt.“ Es bestehe deshalb hoher<br />
Investitionsbedarf. „Wenn die Länder<br />
aber weiterhin in Kleinstaatenmanier<br />
gegen die Aufhebung des Kooperationsverbots<br />
schießen, ist Deutschlands<br />
starke Stellung als führende<br />
Industrienation ernsthaft in Gefahr.<br />
Denn unsere Wettbewerbsfähigkeit<br />
hängt zuallererst von gut ausgebildeten<br />
Fachkräften ab.“ Deshalb sollten<br />
die vom Bund angebotenen Investitionsmittel<br />
für die Ausstattung von<br />
Schulen genutzt werden dürfen.<br />
Die 5 Mrd. €, welche die Bundesregierung<br />
in die digitale Bildungsoffensive<br />
stecken möchte, griff – ebenfalls<br />
zum Jahresende – der Verband<br />
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik<br />
e.V. (VDE) auf. „Die<br />
derzeit bekannten Pläne zur Umsetzung<br />
einer digitalen Bildung greifen<br />
nicht nur zu kurz, sie greifen auch<br />
fehl.“ Die digitale Bildung scheitere<br />
nicht am Geld und dafür anzuschaffender<br />
Ausstattung, sondern vor<br />
allem an den realitätsfernen Lehrplänen<br />
in Bezug auf Technik und<br />
Informatik. Das beklagte Ansgar<br />
Hinz, VDE-Vorstandsvorsitzender<br />
und Chief Executive Officer. 2<br />
Forum DistancE-Learning<br />
Die Hauptstadt Berlin nutzen<br />
Das FDL, der Fachverband für Fernlernen<br />
und Lernmedien, unterhält seit 2003<br />
eine Geschäftsstelle mit hauptamtlichen<br />
Mitarbeitern. Diese hat nun nach 15 Jahren<br />
Hamburg verlassen und neue Räumlichkeiten<br />
in Berlin bezogen. „Der Umzug ist eine<br />
Investition in die Zukunft“, so Verbandspräsident<br />
Mirco Fretter. „Wir gehen diesen<br />
Schritt, um auch örtlich die Nähe zum politischen<br />
Geschehen zu signalisieren.“<br />
Rund 1.500 Vereine und Verbände haben<br />
laut Angaben der DGVM (Deutsche Gesellschaft<br />
für Verbandsmanagement e.V.) und<br />
des Deutschen Verbände Forums ihren Sitz<br />
in Berlin. Nun reiht sich auch das Forum<br />
DistancE-Learning (FDL) in diese Liste ein.<br />
„Dabei ist die Regierungsnähe nicht der einzige<br />
ausschlaggebende Standortfaktor für<br />
unseren Umzug nach Berlin“, ergänzte<br />
Michael Lammersdorf, Geschäftsführer des<br />
Verbandes. Denn die rund 120 Mitglieder<br />
des Verbandes, unter ihnen die führenden<br />
Fernunterrichtsanbieter und Fernhochschulen<br />
Deutschlands, verteilen sich mit ihren<br />
Standorten auf das gesamte Bundesgebiet.<br />
„Mit unserer Geschäftsstelle in Berlin bieten<br />
wir nun allen Mitgliedern eine zentrale<br />
und gut erreichbare Anlaufstelle für ihre<br />
Belange rund ums Thema Fernunterricht<br />
und Fernstudium.“<br />
Das FDL ist im November 2003 aus dem<br />
seit 1969 bestehenden Deutschen Fernschulverband<br />
e. V. (DFV) hervorgegangen.<br />
Seine zurzeit über 120 Mitglieder – unter<br />
ihnen auch der Bundesverband Deutscher<br />
Stahlhandel (BDS) – sind Experten des<br />
mediengestützten und tutoriell betreuten<br />
Lernens – seien es Unternehmen, Institutionen<br />
oder Privatpersonen. Damit bietet der<br />
Verband eine gemeinsame Gesprächs- und<br />
Aktionsplattform für die DistancE-Learning-<br />
Branche.<br />
FDL:<br />
Fernstudientag nutzen<br />
Der FDL hat dazu aufgerufen, den 14.<br />
bundesweiten Fernstudientag am<br />
22.2.19 zu nutzen, um entsprechende<br />
Angebote publik zu machen. Fernlernen<br />
als nachhaltige Form der Bildung setzt<br />
sich wegen seiner ökonomischen, ökologischen<br />
und sozialen Vorteile beim<br />
Erwerb von Wissen und Fähigkeiten<br />
immer mehr durch. Das Forum DistancE<br />
Learning (FDL), seit diesem Jahr mit Sitz<br />
in Berlin, hält Informationen zu den Möglichkeiten<br />
der Nutzung des diesjährigen<br />
Fernstudientages bereit. (www.forum-distance-learning.de).<br />
[ Kontakt ]<br />
Forum DistancE-Learning<br />
Der Fachverband für Fernlernen und<br />
Lernmedien e.V.<br />
Schwedenstr. 14, 13357 Berlin<br />
Tel. 030 767 586970<br />
geschaeftsstelle@forum-distance-learning.de<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
59
Verbände<br />
und Politik<br />
Bericht/Nachrichten<br />
In der Geschäftsführung<br />
personell verstärkt<br />
und mit veränderten<br />
Aufgaben<br />
ist das EDE in das<br />
neue Jahr gestartet.<br />
Quelle: EDE<br />
Personell verstärkt und anders organisiert<br />
Evolutionärer Prozess beim EDE<br />
Die Wuppertaler Verbundgruppe EDE hat sich zum Jahreswechsel mit Peter Jüngst und Thomas<br />
Henkel an ihrer Spitze personell verstärkt und damit Möglichkeiten geschaffen, die Aufgaben der<br />
Geschäftsführung differenzierter wahrzunehmen – auch in Sachen Stahl. Diese Veränderungen<br />
werden von dem Unternehmen als Teil des seit 2016 laufenden Strategie- sowie Organisationsentwicklungsprozesses<br />
und damit evolutionär eingeordnet.<br />
z Dr. Christoph Grote, seit 1995 im<br />
E/D/E, davon acht Jahre in der<br />
Geschäftsführung, verantwortet<br />
seit dem 1.1.19 die Warenbereiche<br />
Werkzeuge, Betriebseinrichtungen,<br />
Schweißtechnik sowie Arbeitsschutz/Technischer<br />
Handel. In den<br />
nächsten Monaten sollen unter seiner<br />
Leitung ein strategisches Einkaufs-Management<br />
sowie ein übergreifendes<br />
Mitglieder-Management<br />
aufgebaut werden.<br />
z Joachim Hiemeyer, seit 2014<br />
Geschäftsführer im EDE, wird sich<br />
künftig verstärkt dem Schwerpunkt<br />
Daten & Services widmen, mit<br />
bedarfsgerechter Entwicklung und<br />
Bereitstellung von digitalen Lösungen<br />
wie E-Commerce, E-Business,<br />
Produktdaten, Informations- und<br />
Datenaustausch im Verbund für<br />
die Partner des EDE. Außerdem ist<br />
er nach weiterhin für das Marketing<br />
und die Akademie zuständig.<br />
z Dr. Ferdinand von Alvensleben ist<br />
seit 2013 Geschäftsführer in der<br />
Wuppertaler Gruppe und wird sich<br />
zukünftig schwerpunktmäßig mit<br />
den Themen des modernen Personalmanagements<br />
beschäftigen, die<br />
auf Grund des demographischen<br />
Wandels und des Fachkräftemangels<br />
insbesondere den Mittelstand<br />
verstärkt herausfordern.<br />
z Peter Jüngst (58), in der Verbundgruppenlandschaft<br />
der Branche<br />
langjährig als Manager tätig, übernimmt<br />
in der Geschäftsführung<br />
den Bereich Bau mit Bau- und<br />
Möbelbeschlägen, Befestigungstechnik,<br />
Bauelementen und Baugeräten<br />
sowie Haustechnik und<br />
Stahl. Darüber hinaus verantwortet<br />
der Neue in der Geschäftsführung<br />
die Logistik, deren Ausbau in<br />
Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen<br />
soll.<br />
z Mit Thomas Henkel (52) konnte<br />
nach Angaben des EDE ein profilierter<br />
Fachmann für die IT gewonnen<br />
werden. Mit dieser Erweiterung<br />
soll der wachsenden Bedeutung dieses<br />
Themas für die Leistungsfähigkeit<br />
der Gruppe Rechnung getragen<br />
und die Landschaft so gestaltet werden,<br />
dass die anstehenden strategiegetriebenen<br />
Change- und Digitalisierungsprozesse<br />
zum Erfolg<br />
geführt werden.<br />
Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung: „Ich freue<br />
mich, dass wir im Rahmen von EVO-<br />
LUTION zu einem Prozess gefunden<br />
haben, welcher uns in die Lage versetzt,<br />
unsere Organisation auf Basis<br />
dieser neuen Aufstellung kontinuierlich<br />
und aus der Strategie abgeleitet<br />
weiterzuentwickeln.“<br />
Die Einkaufsbüro Deutscher<br />
Eisenhändler GmbH (EDE) ist<br />
Europas größter Einkaufs- und Marketingverbund<br />
mit über 960 angeschlossenen<br />
mittelständischen Handelsunternehmen<br />
im Bereich des<br />
Produktionsverbindungshandels<br />
und rund 250 weiteren Einzelhändlern.<br />
2<br />
60 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Wie sich der Produktionsverbindungshandel<br />
auf die Zukunft vorbereitet<br />
Customer Journey<br />
Feuerverzinkte Preisflut<br />
Funktional und gestaltend<br />
Das zentrale Branchenevent 2019<br />
des Produktionsverbindungshandels wirft<br />
seine Schatten voraus: Zum einen wird<br />
zum PVH-Kongress am 8. und 9.3. in Köln<br />
eingeladen, zum anderen gibt es Faktensammlungen<br />
dazu – beispielsweise etwa<br />
die Wahl zum Partner des Jahres. Im Mittelpunkt<br />
steht die Customer Journey.<br />
Die Dynamik der Kunden und die Werkzeuge<br />
des Handels, diese Reise zu begleiten,<br />
stehen im Mittelpunkt der inzwischen<br />
fünften Branchenkonferenz unter<br />
dem Motto „Online + mobile und trotzdem<br />
stationär + regional?“ Im Mittelpunkt<br />
der Tagung stehen die aktuellen Ergebnisse<br />
der neuen PVH-Marktuntersuchung,<br />
die dem Publikum in der Rheinmetropole<br />
exklusiv vorgestellt werden. Aufbauend<br />
auf den vorausgegangenen Analysen sollen<br />
weitergehende Erkenntnisse zu digitalen<br />
Services sowie zu Vertriebswegen<br />
und Informationsquellen, also zu den<br />
wesentlichen Punkten der Customer Journey,<br />
dargestellt werden.<br />
Der Industrieverband Feuerverzinken<br />
hat 2018 zum achten Mal seinen Innovationspreis<br />
vergeben und für 2019 den bereits<br />
16. Verzinkerpreis ausgelobt. Funktional<br />
bzw. gestaltend waren bzw. sind die entscheidenden<br />
Kriterien geprägt.<br />
Das Forschungsprojekt „Feuerwiderstand<br />
feuerverzinkter Konstruktionen“ der TU<br />
München wurde erstplatziert, gefolgt vom<br />
Produkt „Feuerverzinkte Tragekonsole mit<br />
patentierter thermischer Entkopplung“ der<br />
innofixx equipment GmbH. Eine Anerkennung<br />
erhielt die BFtec GmbH für das betonlose<br />
Fundament „Steel-Root“, das von der<br />
Natur abgeleitet ist, den Wurzeln eines Baumes<br />
ähnelt und einen nachhaltigen Charakter<br />
hat.<br />
Architekten, Ingenieure, Stahl- und Metallbauer<br />
sind aufgerufen, sich am Wettbewerb<br />
für 2019 um den Award des Industrieverbands<br />
zu beteiligen. Der mit 15.000 €<br />
dotierte Preis prämiert innovative Bauwerke,<br />
Objekte und Produkte, die in<br />
Das betonlose Fundament „Steel-Root“ erhielt<br />
im Rahmen des Innovationspreises 2018 eine<br />
Anerkennung.<br />
wesentlichem Umfang feuerverzinkt sind<br />
oder interessante Details mit diesem<br />
Charakter enthalten. Einsendeschluss ist<br />
der 1.4.19, Einzelheiten gibt es unter<br />
www.verzinkerpreis.de.<br />
Der Industrieverband Feuerverzinken e.V.<br />
und seine Serviceorganisation, das Institut<br />
Feuerverzinken GmbH, vertreten die heimische<br />
Stückverzinkungsindustrie. 2017<br />
wurde in Deutschland mehr als 1,9 Mio. t<br />
Stahl stückverzinkt.<br />
Foto: Industrieverband Feuerverzinken<br />
Um solche Fakten geht es auch bei der<br />
Aufforderung des Arbeitskreises Werkzeuge<br />
im Zentralverband Hartwarenhandel<br />
e.V. (ZHH), bis zum 15.2.19, wieder<br />
die wichtigsten Lieferanten aus den<br />
Bereichen Handwerkzeuge, Präzisionswerkzeuge,<br />
Betriebseinrichtung, Befestigungstechnik,<br />
Arbeitsschutz, Schleif-/<br />
Trennmittel und Messwerkzeuge zu<br />
bewerten. Erstmals kommt diesmal der<br />
Bereich chemischer Produkte hinzu. Auch<br />
die Beurteilungskriterien sind den veränderten<br />
Anforderungen angepasst und um<br />
Aspekte der Daten- bzw. Digitalisierungsqualität<br />
erweitert worden.<br />
Der Kölner Kongress wird vom ZHH organisiert<br />
– mit Unterstützung des Fachverbandes<br />
des Deutschen Maschinen- und<br />
Werkzeug-Großhandels e.V., des Fachverbandes<br />
Werkzeugindustrie sowie der<br />
Elektrowerkzeuge-Fachgruppe des Zentralverbandes<br />
Elektrotechnik und Elektronikindustrie<br />
e.V.<br />
[ Info ]<br />
Der Wahlbogen steht auf der Internetseite<br />
des ZHH unter www.zhh.de zur Verfügung,<br />
Informationen zum Kongress gibt es unter<br />
www.pvh-kongress.de.<br />
China macht dicht<br />
BDSV erwartet Veränderung der Schrottmärkte<br />
China hat die Absicht, Importbeschränkungen<br />
für feste Abfälle ab 1.7.19 auf Sekundärrohstoffe<br />
wie Eisen-, Kupfer- und Aluminiumschrotte<br />
auszudehnen. Ergänzend hat der<br />
BDSV darauf hingewiesen, dass es dadurch<br />
zu Verwerfungen auf den internationalen Märkten<br />
kommen wird.<br />
Nach Angaben der Bundesvereinigung<br />
Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen<br />
e.V. (BDSV) werden derzeit<br />
15 % der deutschen Stahlschrottexporte<br />
(Gesamtvolumen ca. 8,5 Mio.t p.a.) direkt in<br />
Länder außerhalb der EU-28 geliefert, wobei<br />
der Anteil der deutschen Stahlschrottexporte<br />
nach China mit 33.000 t im Jahr 2017<br />
lediglich ca. 0,4 % beträgt. Dennoch geht<br />
die BDSV davon aus, dass es zu Verwerfungen<br />
auf den internationalen Märkten kommen<br />
wird, die auch in Deutschland zu spüren<br />
sein werden. Für die Mengen an<br />
Stahlschrott, die China bisher weltweit<br />
importiert (2017: ca. 2,3 Mio. t) müssten<br />
nämlich neue Absatzmärkte erschlossen<br />
werden. Dies erzeuge zwangsläufig Preisdruck.<br />
BGA: Kostenlose Ausbildungswerbung<br />
Der BGA hat darauf hingewiesen, dass Mitgliedunternehmen ihre Ausbildungsstellen auf<br />
der verbandlichen Internetseite www.gross-handeln.de kostenlos inserieren können. Unter<br />
dieser Kampagnenadresse werden zudem Informationen über die Branche, die wichtigsten<br />
Ausbildungsberufe sowie über Karrierewege des Groß- und Außenhandels dargestellt.<br />
Diese Stellenbörse ist bei den digitalen Nutzern der BGA-Angebote eine der beliebtesten<br />
Seiten, teilte der Bundesverband Großhandel Außenhandel Dienstleistungen (BGA) in diesem<br />
Zusammenhang mit.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
61
Foto: WZV / NORD/LB<br />
Lifesteel<br />
Bericht<br />
Hannover: Jeff Koons<br />
Tulips erhalten durch<br />
viele Arbeitsstunden<br />
Schleifen, Polieren und<br />
Lackieren des farbigen<br />
Edelstahls ihre unverwechselbare<br />
Optik.<br />
Städte schmücken sich mit Skulpturen aus Edelstahl<br />
Material schafft viele Möglichkeiten<br />
Im Wettbewerb um Attraktivität setzen immer mehr Städte auf Leitbilder, um die Lebens- und Wohnqualität zu steigern.<br />
Kunst und Kultur gelten dabei als unverzichtbare weiche Standortfaktoren. In diesem Zusammenhang übernehmen<br />
Skulpturen aus Edelstahl Rostfrei Schlüsselfunktionen. Eine entscheidende Rolle bei der Materialwahl spielt das<br />
Eigenschaftsspektrum dieses Werkstoffs, der die Möglichkeit zur freien Formgebung und unbegrenzter Ausdruckskraft<br />
mit dauerhafter Korrosionsbeständigkeit paart.<br />
In den 1950er-Jahren wurde<br />
der Werkstoff für skulpturale Gestaltung<br />
entdeckt und gewann ab 1960<br />
rasch an Bedeutung – insbesondere<br />
für Plastiken im öffentlichen Raum.<br />
Dazu gibt es weltweit viele Beispiele,<br />
vier davon werden nachfolgend im<br />
Auftrag des Warenzeichenverbands<br />
Edelstahl Rostfrei vorgestellt:<br />
z Bildhauer Jeff Koons hat sich diese<br />
Materialeigenschaften in seinen farbenfrohen<br />
Plastiken wie kaum ein<br />
anderer Künstler zu eigen gemacht.<br />
Seine überdimensionalen Skulpturen<br />
aus Edelstahl Rostfrei, wie z.B. die<br />
Tulips in Hannover, begeistern die<br />
Welt und erzielen astronomische<br />
Verkaufspreise. Gefertigt werden die<br />
schwerelos wirkenden, aber bis zu<br />
30 t wiegenden Kunstwerke in deutschen<br />
Gießereien. Nach dem Guss<br />
erhalten sie dort auch handgeformte<br />
Verzierungen und das charakteristische<br />
Finish.<br />
z Auf ähnliche Effekte setzt auch der<br />
deutsche Künstler Horst Gläsker bei<br />
seiner Skulpturengruppe für den<br />
neuen Justizpalast in Luxemburg.<br />
Vier 1,80 m hohe Vasen in den Farben<br />
Rot, Türkis, Gold und Blau symbolisieren<br />
die Elemente Feuer,<br />
Wasser, Erde und Luft. Ihre spiegelpolierte<br />
Oberfläche reflektiert Licht<br />
und Umgebung, sodass ein permanenter<br />
Dialog entsteht.<br />
z Eine optisch nahtlose Spiegeloberfläche<br />
kennzeichnet auch eine der<br />
bekanntesten und zugleich größten<br />
Edelstahlskulpturen der Welt: Anish<br />
Kapoors Cloud Gate in Chicago, vom<br />
Volksmund The Bean genannt. Inspiriert<br />
von flüssigem Quecksilber ließ<br />
er die über zehn Meter hohe, 13 m<br />
breite und 20 m lange Plastik aus<br />
168 großen Edelstahlplatten schweißen.<br />
Sie formen einen voluminösen<br />
Bogen, der sich an zwei Seiten wie<br />
ein Tor auf 3,60 Meter Höhe hebt<br />
und zum Betreten des Innenraums<br />
der Skulptur einlädt.<br />
z Durch den fortwährenden Austausch<br />
spiegelpolierter Edelstahlflächen mit<br />
der Umgebung wirken Kunstwerke<br />
aus nichtrostendem Stahl mit diesem<br />
Finish ungewöhnlich lebendig. Beispielhaft<br />
hierfür steht auch die Plastik<br />
I’m Alive von Tony Cragg am<br />
Opernhaus in Wuppertal. Wie ein<br />
schlangenähnliches Fabelwesen, das<br />
gerade untertauchen möchte, windet<br />
sich ihr mächtiger Körper, der sich<br />
vom Kopf bis zur Schwanzspitze kontinuierlich<br />
verjüngt. Ihre geradezu<br />
lebendige Wirkung bezieht sie aus<br />
der fließenden Formgebung, der die<br />
Spiegelungen der vorbeifahrenden<br />
62 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Foto: WZV/Edelstahlwerke Schmees GmbH<br />
Foto: WZV/Thomas Emden-Weinert<br />
Luxemburg: Die vier bunten Vasen vor<br />
dem dortigen Justizpalast reflektieren<br />
durch ihre polierte Edelstahloberfläche<br />
Licht und Umgebung.<br />
Autos zusätzliche Dynamik verleihen.<br />
Entscheidende Eigenschaften<br />
Ob dünnwandige, zugleich höchst stabile<br />
Konstruktionen oder massive, aus<br />
dem Vollen gefräste oder geschnittene<br />
Arbeiten: Neben der außergewöhnlichen<br />
Ästhetik prädestinieren die<br />
mechanischen Eigenschaften Edelstahl<br />
Rostfrei als Werkstoff für künstlerische<br />
Gestaltung. Er lässt sich hervorragend<br />
umformen, trennen oder<br />
fügen. Dank der spezifischen Festigkeit<br />
und Bruchdehnung im Zusammenspiel<br />
mit der hohen Kaltverfestigungsneigung<br />
können sehr komplexe<br />
und nahtlose dreidimensionale Formen<br />
gefertigt werden. Dennoch bleiben<br />
die für öffentliche Objekte unverzichtbare<br />
mechanische Belastbarkeit<br />
und dauerhafte Korrosionsbeständigkeit<br />
erhalten.<br />
Unabhängig von der Wahl der<br />
Oberflächengestaltung – geschliffen,<br />
gebürstet, hochglanzpoliert oder matt<br />
gestrahlt – behalten die Kunstwerke<br />
ihre Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse<br />
jeder Art. In Küstenregionen<br />
mit aggressiver Meeresatmosphäre<br />
bewahren zudem entsprechend<br />
höher legierter Werkstoff und metallisch<br />
blanke, vollständig passivierte<br />
Oberflächen die Schönheit der Skulpturen<br />
für Jahrzehnte. Die werkstoffbedingte<br />
Robustheit gegen Abnutzung<br />
und Graffiti sowie ein minimaler Pflegeund<br />
Instandhaltungsaufwand tragen<br />
zudem wirtschaftlichen Überlegungen<br />
der Städte Rechnung.<br />
Erste Adresse für einen sachgemäßen<br />
Werkstoffeinsatz und fachgerechte<br />
Verarbeitung dieses Materials<br />
sind Fachbetriebe, die das Qualitätssiegel<br />
Edelstahl Rostfrei tragen. Sie<br />
gewährleisten so, dass die Kunstwerke<br />
mit ihrer edlen Gestalt die Menschen<br />
auf Jahrzehnte berühren. 2<br />
Chicago: Bei dem Entwurf<br />
seines Cloud Gate<br />
wurde Anish Kapoors<br />
von flüssigem Queck -<br />
silber inspiriert und ließ<br />
sie aus 168 großen<br />
Edelstahlplatten fertigen.<br />
Wuppertal: Die Edelstahlplastik I’m Alive bezieht ihre lebendige Wirkung<br />
aus der fließenden Formgebung und spiegelpolierten Oberfläche.<br />
Foto: WZV<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
63
Lifesteel<br />
Berichte<br />
SOP Architekten gestalteten<br />
einen Kubus, der<br />
durch seine vollverglasten<br />
Kopffassanden wie<br />
ein gigantisches Tor<br />
zum Campus wirkt. An<br />
der Seite ist die Edelstahlhülle<br />
zu erkennen.<br />
Foto: GKD<br />
Metallgewebe für Aachener Universitätsgebäude<br />
Tor zur Zukunft<br />
Weithin sichtbares Erkennungszeichen des Clusters Biomedizintechnik der RWTH Aachen ist das neue<br />
Lehr- und Weiterbildungsgebäude der Medizinischen Fakultät. SOP Architekten aus Düsseldorf<br />
konzipierten den Bau als lichtdurchfluteten Solitär, der durch seine Form und exponierte Lage zum Tor<br />
zur Zukunft wird. Zwei der Fassaden sind mit Metallgewebe der GKD – Gebr. Kufferath ausgestattet.<br />
Neben der besonderen Ästhetik<br />
der Metallmembran vom Typ OMEGA<br />
1520 der GKD – Gebr. Kufferath AG<br />
waren für ihren Einsatz vor allem<br />
funktionale Eigenschaften ausschlaggebend.<br />
So dient die Edelstahlhülle<br />
als effizienter Sonnenschutz, der die<br />
Oberflächentemperatur der Fassade<br />
reduziert und den Sonneneintrag in<br />
die dahinterliegenden Labor-, Büround<br />
Seminarräume vermindert. Dennoch<br />
gewährleistet die offene Gewebestruktur<br />
ungehinderten Tageslichteinfall<br />
und freie Aussicht. So trägt sie<br />
nicht nur zur Verbesserung der Energiebilanz<br />
des Gebäudes bei, sondern<br />
steigert auch den Aufenthaltskomfort<br />
und damit die Leistungsfähigkeit der<br />
Mitarbeiter. Da Edelstahl am Ende der<br />
Nutzung vollständig recycelt werden<br />
kann, unterstützt die Membran auch<br />
das anspruchsvolle Nachhaltigkeitskonzept<br />
des Neubaus.<br />
Die bereits von außen sichtbare<br />
Offenheit und Interaktion wird durch<br />
das ausgeschnittene, lichtdurchflutete<br />
Atrium im Inneren des Gebäudes konsequent<br />
fortgeführt. Zahlreiche Brü-<br />
cken und breite Galerien erlauben<br />
vielfältige Blickbeziehungen mit allen<br />
Geschossen. Das Leitmotiv der Kommunikation<br />
und interdisziplinären<br />
Zusammenarbeit wird so im ganzen<br />
Gebäude erlebbar. Weitere Highlights<br />
sind ein 400 Personen fassender Multifunktionssaal<br />
sowie ein mit modernster<br />
Technologie ausgestatteter<br />
Demonstrations-Operationssaal. Bei<br />
Bedarf können beide Funktionsräume<br />
mit dem Foyer im Untergeschoss zu<br />
einem durchgängigen Veranstaltungsbereich<br />
verbunden und beispielsweise<br />
für Symposien genutzt werden. Bei<br />
voller Betriebsauslastung fasst das<br />
Gebäude bis zu 1.200 Personen. Sein<br />
schimmerndes Kleid aus Edelstahlgewebe<br />
weist schon von weitem den<br />
Weg zum Tor in die Zukunft.<br />
Vorzeigeobjekt<br />
Die Rheinisch-Westfälische Technische<br />
Hochschule (RWTH) Aachen ist<br />
als Eliteuniversität eine der Vorzeigehochschulen<br />
des Landes. Rund<br />
44.500 Studierende, 550 Professoren<br />
und fast zehnmal so viele wissen-<br />
schaftliche Mitarbeiter festigen den<br />
Ruf der RWTH als eine der – vor allem<br />
in technischen und medizinischen<br />
Studiengängen – international renommierten<br />
akademischen Bildungseinrichtungen.<br />
In einem europaweiten Investorenauswahlverfahren<br />
hatten sich die<br />
A. Frauenrath BauConcept GmbH und<br />
SOP mit ihrem markanten Entwurf<br />
durchgesetzt. Sie gestalteten auf dem<br />
leicht abschüssigen Gelände einen<br />
Kubus, der durch seine vollverglasten<br />
Kopffassaden wie ein umgedrehtes U<br />
aussieht und damit wie ein gigantisches<br />
Tor zum dahinterliegenden<br />
Campus wirkt. Unterstrichen wird<br />
dieser Eindruck durch den auskragenden<br />
Sichtbeton der Seitenwände,<br />
der die Stirnfassade umrahmt. Die<br />
von Fensterbändern durchzogenen<br />
seitlichen Fassaden werden von einer<br />
schimmernden Haut aus Metallgewebe<br />
überspannt, die eine optisch<br />
nahtlose Flächigkeit erzeugt. Gleichzeitig<br />
bleiben durch die Gewebetransparenz<br />
die dahinterliegenden Räume<br />
erkennbar. 2<br />
64 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Fotos, 3: Janosch Gruschczyk<br />
Zeppelin mit Zukunft<br />
Stahlkunst in Würzburg<br />
Die Ära der Luftschiffe war nur von kurzer Dauer, und auch die Landesgartenschau 2018 in<br />
Würzburg ist Geschichte. Der dort im vergangenen Jahr zum zweiten Mal gelandete<br />
Zeppelin hat in der unterfränkischen Metropole jedoch nachvollziehbar Zukunft – auch,<br />
weil The Coating Company für dauerhaften Korrosionsschutz gesorgt hat.<br />
Im April war die letztjährige<br />
Landesgartenschau (LGS) in Würzburg<br />
gestartet. Im Rahmen eines Wettbewerbs<br />
hatte Michael Ehlers die<br />
Kunst- und Medieninstallation „Das<br />
letzte Luftschiff“ konzipiert. Der Hintergrund:<br />
Am 6. August 1939 war die<br />
LZ 130 Graf Zeppelin II am Hubland<br />
in Würzburg angekommen– das letzte<br />
Luftschiff seiner Art. Ehlers erkannte<br />
den geschichtlich-künstlerischen<br />
Mehrwert und gewann mit seinem<br />
Konzept den Künstlerwettbewerb der<br />
LGS 2018. Mit Metz Stahl- und Metallbau<br />
wurde der Entwurf Wirklichkeit.<br />
Die geometrische Konstruktion<br />
ist 20 m lang und 7 m hoch. Zusätzlich<br />
wurde es am Bug auf etwa 7,58 m in<br />
die Höhe gezogen – so entstand eine<br />
dynamische Gesamtwirkung. Die prozessorientierte<br />
Installation soll so auf<br />
die Halbwertszeit technischer Utopien<br />
verweisen, die trotz ihrer Gewaltigkeit<br />
wieder zerfallen und von der Natur<br />
zurückerobert werden.<br />
Um eine lange Lebensdauer des<br />
Werks sicherzustellen, übernahm<br />
Coatinc Würzburg (CWÜ) den Korrosionsschutz<br />
des Bauwerks. „Mit Fachwissen<br />
und viel Liebe zum Detail<br />
wurde jedes einzelne Tragwerksele-<br />
ment mittels der Feuerverzinkung<br />
von uns perfekt vor Korrosion<br />
geschützt“, erläutert Susanne Kolb,<br />
Geschäftsbereichsleiterin der CWÜ.<br />
Sie veredelte insgesamt 5,5 t Stahl für<br />
Michael Ehlers Kunstprojekt. Diese<br />
Leistung schuf die Basis für den letzten<br />
Kunstgriff: Das fertige Objekt aus Stahl<br />
wurde mit schnell wachsenden Kletterpflanzen<br />
wie etwa Hopfen und<br />
Kapuzinerkresse bepflanzt. Industrie,<br />
Natur und Kunst werden damit in<br />
einem einzigen Projekt vereint.<br />
Für stets aktuelle Informationen<br />
zum „Letzten Luftschiff” wurde eine<br />
entsprechende Internet-Seite online<br />
Gut geschützt: CWÜ-Geschäftsbereichsleiterin<br />
Susanne Kolb …<br />
geschaltet. Hier kann die gesamte Entstehung<br />
– vom Gerüst bis zum bewachsenen<br />
Kunstwerk – per installierter<br />
Webcam unter www.dasletzteluftschiff.de<br />
beobachtet werden. Die Installation<br />
konnte im Rahmen der Landesgartenschau<br />
2018 vom 12. April bis<br />
zum 7. Oktober besucht werden,<br />
Sie bleibt noch für Jahrzehnte dauerhaft<br />
als Kunst im öffentlichen Raum<br />
im Park des neuen Stadtteils Würzburg-Hubland<br />
ausgestellt und kann –<br />
auch und gerade im Wechsel der Jahreszeiten<br />
– per installierter Webcam<br />
unter www.dasletzteluftschiff.de beobachtet<br />
werden. 2<br />
… und die Installation „Das letzte Luftschiff“ in Würzburg-Hubland.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 1/2|19<br />
65
Lifesteel<br />
XXXXX Bericht A XXXXX<br />
Impressum<br />
STAHLREPORT<br />
Das BDS-Magazin für die Stahldistribution<br />
Stahlhandel | Stahlproduktion |<br />
Stahlverarbeitung<br />
Offizielles Organ des BDS-Fernstudiums<br />
Fotos, 2: Ancofer<br />
„IN ALLER RUHE GENIESSEN“ beim Brennvorgang im Hause Ancofer in Mülheim …<br />
… und als hinterleuchtete Botschaft an der Wand des Hotels Klosterpforte in Harsewinkel.<br />
Das Hotel Klosterpforte in Harsewinkel „in aller Ruhe genießen“<br />
Ancofer in Mülheim schuf Visitenkarte aus Stahl<br />
Eine besondere Visitenkarte aus Stahl hat Ancofer in Mülheim für das Hotel<br />
Klosterpforte in Harsewinkel gebrannt – mit hoher Kunst und bei 30.000 °C. Die<br />
inzwischen an einer Wand des Hotels Klosterpforte angebrachte Stahlplatte rät<br />
den Gästen in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt „in aller Ruhe“ zu genießen<br />
und vermittelt zugleich etwas von der Geschichte dieses Ortes<br />
Der Mönch und der Putto weisen auf den Ursprung des Hotels Klosterpforte<br />
hin, der Fußball steht für zahlreiche dort beherbergte Mannschaften. So wohnte<br />
in dem Hotel während der Weltmeisterschaft 2006 das portugiesische Nationalteam<br />
und nutzte Trainingsplätze mit Rasen, der internationalen Ansprüchen<br />
genügt.<br />
Den Ansprüchen des Gütersloher Künstlers Radomir, 1951 in Belgrad geboren,<br />
entsprach das Equipment, das die Ancofer Stahllhandel GmbH in Mülheim an<br />
der Ruhr zum Brennen der Platte aufbieten konnte. „So wie die Maschine<br />
brennt, das ist Kunst“, formulierte er anerkennend während des Brennvorgangs.<br />
Der war u.a. deshalb kompliziert, weil der Brenner wegen der starken<br />
Hitzentwicklung immer wieder die Position wechseln musste. So konnte der<br />
Schriftzug „IN ALLER RUHE GENIESSEN“ nicht in einem kontinuierlichen Prozess<br />
gebrannt werden.<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Wiesenstraße 21<br />
40549 Düsseldorf<br />
Redaktion:<br />
Dr. Ludger Wolfgart (Chefredakteur)<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-11<br />
E-Mail: Wolfgart-BDS@stahlhandel.com<br />
Markus Huneke<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-24<br />
E-Mail: Huneke-BDS@stahlhandel.com<br />
Anzeigen:<br />
Ksenija Sandek<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-21<br />
E-Mail: Sandek-BDS@stahlhandel.com<br />
Verlag:<br />
BDS AG<br />
Max-Planck-Straße 1<br />
40237 Düsseldorf<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-0<br />
Telefax (02 11) 8 64 97-22<br />
Layout:<br />
auhage|schwarz, Leichlingen<br />
Druck:<br />
Hellendoorn, Bad Bentheim<br />
Erscheinungsweise:<br />
monatlich (10 Hefte/Jahr)<br />
Bezugspreis:<br />
Jährlich 65 € im Inland und 70 € im Ausland<br />
zuzüglich Versandspesen und Mehrwertsteuer.<br />
Abbestellungen sind lediglich unter Einhaltung<br />
einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Jahres -<br />
ende möglich. Für die Mitglieder des BDS und die<br />
Teilnehmer im BDS-Fernstudium ist der Bezug<br />
eines Exemplars der Fachzeitschrift „<strong>Stahlreport</strong>“<br />
im Mitgliedsbeitrag bzw. in der Studien gebühr<br />
enthalten. Ein Nachdruck ist nur mit ausdrücklicher<br />
Genehmigung der Redaktion gestattet.<br />
Anzeigenpreis:<br />
Zur Zeit gilt die Preisliste Nr. 36.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte oder<br />
Fotos übernehmen Herausgeber, Redaktion und<br />
Verlag keine Gewähr. Namentlich oder mit Initialen<br />
gekennzeichnete Beiträge vertreten eine vom<br />
Herausgeber unabhängige Meinung der Autoren.<br />
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird mitunter<br />
auf die gleichzeitige Verwendung mänlicher<br />
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche<br />
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl<br />
für beiderlei Geschlechter.<br />
Außerdem bittet die Redaktion um Verständnis,<br />
dass insbesondere Firmennamen je Artikel in der<br />
Regel nur einmal in ihrer werbeorientierten Form<br />
verwendet und entsprechende Begriffe häufig<br />
eingedeutscht werden.<br />
International Standard Serial Number:<br />
ISSN 0942-9336<br />
Diese Zeitschrift wurde aus umwelt schonendem<br />
Papier hergestellt.<br />
Beilagenhinweis:<br />
Dieser Ausgabe liegen zwei Beilagen der BDS AG<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel bei.<br />
66 <strong>Stahlreport</strong> 1/2|19
Bereit für größere Aufgaben?<br />
Fernstudium – in drei Jahren berufsbegleitend zum „Betriebswirt Stahlhandel (BDS)“<br />
Argumente<br />
z Staatlich zugelassener Studiengang<br />
z Markenrechtlich geschützter Abschluss<br />
z Orientiert am Europäischen und<br />
Deutschen Qualifikationsrahmen<br />
z Zertifizierter Anbieter<br />
Inhalte<br />
z Technik (Werkstoffe, Produkte,<br />
Anarbeitung)<br />
z Wirtschaft (Kaufmännische Kompetenz,<br />
Führungskompetenz)<br />
z Methoden (Selbst- und Sozialkompetenz)<br />
Formen<br />
z 60 Module<br />
z 6 Präsenzphasen<br />
z 3 Prüfungen<br />
z 1 Studienarbeit<br />
Für Auskünfte und Anmeldungen:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel (BDS AG)<br />
Wiesenstraße 21 · 40549 Düsseldorf<br />
Telefon: 0211 86497-0 · Telefax: 0211 86497-22<br />
www.stahlhandel.com<br />
fernstudium<br />
Betriebswirt<br />
Stahlhandel (BDS)
BDS-Berufsbildung<br />
Seminare und sonstige (BDS-)Veranstaltungen<br />
2019<br />
Seminarthema Termin Tagungsort<br />
Stahlkunde (Seminar) 06.-08.03. Dortmund<br />
Rohre und Rohrzubehör (Seminar) 11.-13.03. Paderborn<br />
Blankstahl (Seminar) 28.-29.03. Ludwigsburg<br />
Stahleinkauf ( Seminar/Kooperation) 07.-08.05. Duisburg<br />
Flacherzeugnisse (Seminar) 14.-15.05. Duisburg<br />
Qualitäts- und Edelstahl (Seminar) 04.-05.06. Baunatal<br />
Stahlkunde (Seminar) 20.-22.08. Gröditz<br />
Stahleinkauf (Seminar/Kooperation) 10.-11.09. Duisburg<br />
Nichtrostende Stähle und ihre Produktformen (Seminar) 28.-30.10.<br />
Lüdenscheid<br />
Stahlkunde (Seminar) 03.-05.12. Gengenbach<br />
Stahleinkauf (Seminar/Kooperation) 10.-11.12. Duisburg<br />
Diese Übersicht gibt den Stand der Planungen für Lernteam- und Seminarveranstaltungen<br />
und zum Fernstudium sowie zu entsprechenden Kooperationen wieder.<br />
Änderungen jeder Art sind vorbehalten, vor allem Ergänzungen. Über weitere Details sowie zu<br />
den Anmeldemöglichkeiten informieren Sie sich bitte im Internet (www.stahlhandel.com) oder<br />
wenden sich telefonisch bzw. elektronisch an den<br />
BUNDESVERBAND DEUTSCHER STAHLHANDEL (BDS)<br />
Wiesenstraße 21 · 40549 Düsseldorf<br />
Telefon: 0211/86497-19 · Telefax: 0211/86497-22<br />
E-MAIL: WYNANDS-BDS@STAHLHANDEL.COM