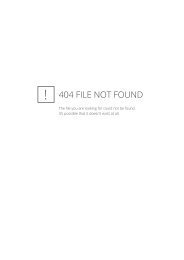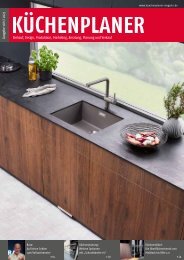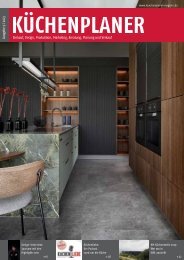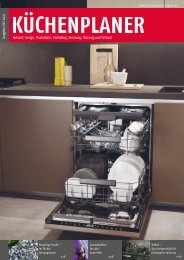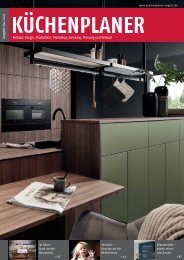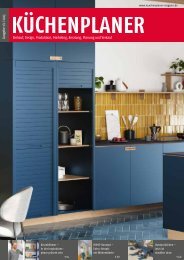IKZplus-KLIMA 1_2020
IKZ-KLIMA informiert nicht nur über die zentralen und dezentralen kälte- und raumlufttechnischen Lösungen, es werden auch alternative Raumkonditionierungskonzepte aufgezeigt. MSR, Anlagen-Monitoring sowie Möglichkeiten der Anlagenoptimierung runden die Themenbereiche inhaltlich ab.
IKZ-KLIMA informiert nicht nur über die zentralen und dezentralen kälte- und raumlufttechnischen Lösungen, es werden auch alternative Raumkonditionierungskonzepte aufgezeigt. MSR, Anlagen-Monitoring sowie Möglichkeiten der Anlagenoptimierung runden die Themenbereiche inhaltlich ab.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>IKZplus</strong> 1 | Jan. / Feb. <strong>2020</strong><br />
www.ikz.de<br />
Bild: Rockwool<br />
Simultan kühlen und heizen Seite 8<br />
CO 2<br />
aus der Luft filtern Seite 12<br />
RLT-Systeme für Rechenzentren Seite 16
Gemeinsam<br />
stark!<br />
Jetzt registrieren auf www.ikz-select.de<br />
Die exklusive SHK-Community<br />
Erleben Sie die neue<br />
SHK-Community:<br />
▶ Dossiers und Fachwissen<br />
▶ Arbeitshilfen<br />
▶ Weiterbildungsangebote<br />
▶ Vorteilswelt<br />
▶ Reisen und Erleben<br />
▶ Buchtipps<br />
▶ Mediathek<br />
www.ikz-select.de
INHALT/INTRO<br />
4 Firmen & Fakten<br />
32 Tipps & Trends<br />
35 Termine & Impressum<br />
Klima<br />
8 Simultan kühlen und heizen spart Kosten<br />
Klimakomfort im Gewerbeobjekt mit getrennter<br />
Verbrauchserfassung.<br />
12 CO 2 -Filterung gegen den Klimawandel<br />
„Direct Air Capture“-Technologie gewinnt CO 2 aus der<br />
Umgebungsluft und macht es für Prozesse nutzbar.<br />
Kälte<br />
16 Optimierte Lüftungs- und<br />
Klimatisierungssysteme für Rechenzentren<br />
Rahmenbedingungen für Planung, Bau und Betrieb von<br />
Rechenzentren nach VDI-Richtlinie 2054.<br />
20 Kaltwassersysteme bieten flexible Einsatzmöglichkeiten<br />
Situation zur F-Gas-Verordnung, Einsatzkriterien für<br />
Kaltwassersysteme.<br />
22 Kühlen mit Verdunstungskälte<br />
Die adiabate Kühlung kann eine Alternative zu<br />
Kompressionskälteanlagen sein. Ökologische und<br />
ökonomische Gründe sprechen dafür.<br />
Reportage<br />
26 Gute Luft in Kölner Gesamtschule<br />
Frische Lernatmosphäre dank 28 dezentraler Lüftungsgeräte<br />
im Gebäudekomplex „Snake“.<br />
30 Qualitätssicherung leicht gemacht<br />
Steinwolle überzeugt in der Kältedämmung.<br />
Klimaschutz mit Klimatisierung<br />
CO 2 aus der Luft filtern und<br />
dann als Rohstoff etwa – als<br />
Dünger für Gewächshäuser –<br />
verkaufen oder dauerhaft im<br />
Untergrund speichern. Das<br />
klingt nach Zukunftsmusik.<br />
Ist es aber nicht. Die „Direct<br />
Air Capture“-Technologie<br />
macht’s möglich. Natürlich ist<br />
das System nicht die Lösung,<br />
um den globalen CO 2 -Emissionen<br />
Einhalt zu gebieten.<br />
Aber es zeigt doch auf, dass<br />
technische Lösungen durchaus<br />
ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten können (Bericht<br />
ab Seite 12).<br />
Energieeffizienz und Klimaschutz stehen bei der Klimatisierung<br />
von Rechenzentren im Fokus. Und das nicht nur, weil<br />
die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft mit einer<br />
Zunahme von Rechenzentrumsleistung einhergeht. Sondern<br />
auch, weil die Anforderungen an die Infrastrukturtechnik in<br />
den vergangenen Jahren gestiegen sind. Für Klimafachleute<br />
ist es deshalb unumgänglich, sich mit den Inhalten der VDI<br />
2054 „Raumlufttechnische Anlagen für Datenverarbeitung“<br />
vertraut zu machen, um optimierte RLT-Systeme für Rechenzentren<br />
zu konzipieren (Bericht ab Seite 16).<br />
Diese und weitere Beispiele in dieser Ausgabe belegen, dass<br />
das Thema Energieeffizienz (und damit auch der Klimaschutz)<br />
in der TGA-Branche allgegenwärtig ist. Sie zeigen, was bereits<br />
heute durch Ideenreichtum und dem nötigen technischen<br />
Wissen möglich ist.<br />
Markus Sironi<br />
Chefredakteur<br />
m.sironi@strobelmediagroup.de<br />
Bilder: Mitsubishi Electric<br />
Bild: Climeworks/Julia Dunlop<br />
8<br />
12<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 3
FIRMEN & FAKTEN<br />
Kurz notiert<br />
Forum Wohnraumlüftung <strong>2020</strong><br />
erstmals auf der SHK Essen<br />
Essen. Das richtige<br />
Lüften ist neben<br />
dem Heizen immer<br />
stärker in den Blick<br />
der Technischen Gebäudeausstattung<br />
gerückt. Denn einerseits<br />
muss bei<br />
sehr gut abgedichteten,<br />
energieeffizienten<br />
Gebäuden ein<br />
ausreichender Luftaustausch<br />
gewährleistet<br />
sein, andererseits<br />
sollte dadurch<br />
aber nur so wenig<br />
Energie wie möglich<br />
verlorengehen. Zudem<br />
bedeutet kontrollierte<br />
Lüftung<br />
auch Wohnkomfort. Erstmals rückt die SHK ESSEN dieses wichtige<br />
Thema vom 10. bis zum 13. März <strong>2020</strong> mit dem neuen „Forum<br />
für Wohnungslüftung“ in den Fokus. Veranstaltet wird es gemeinsam<br />
vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindus trie<br />
(BDH), dem Fachverband Gebäude-Klima (FGK) und dem Fachverband<br />
SHK NRW.<br />
Das Forum in Halle 2 bietet insbesondere Besuchern, die auf<br />
der Suche nach neuen, lukrativen Marktfeldern sind, die Möglichkeit,<br />
sich eine Übersicht über Technologien und Lösungen zu verschaffen.<br />
Ein tägliches Vortragsprogramm der Branchenverbände<br />
informiert über Anwendungstechniken, Regelwerke und Produktvarianten.<br />
„Das sollten sich vor allem Planer, Bauträger und<br />
Fachunternehmen<br />
nicht entgehen lassen“,<br />
sagt Hans-Peter<br />
Sproten, Hauptgeschäftsführer<br />
des<br />
Fachverbands SHK<br />
NRW. „Das Forum<br />
trägt der Tatsache<br />
Rechnung, dass neben<br />
der Heiztechnik<br />
auch die Lüftung<br />
zur Energieeinsparung<br />
und CO 2 -Reduktion<br />
beiträgt. Zudem<br />
steigert sie den<br />
Wohnkomfort“, ergänzt<br />
Andreas Lücke,<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
des BDH. „Die<br />
SHK Essen ist als<br />
Fachmesse für Heizung und Klima die ideale Plattform, um das<br />
Forum für Wohnungslüftung auszurichten“, sagt Günther Mertz,<br />
FGK-Geschäftsführer.<br />
Das „Forum für Wohnungslüftung“ ist für eine breit gefächerte<br />
Zielgruppe interessant. Sie beginnt bei Planern und Architekten,<br />
reicht über Energieberater und Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften<br />
bis zu Installateuren des SHK-Handwerks. Praxisnahe<br />
Lösungen stehen dabei im Fokus. Täglich werden von 10:30<br />
Uhr bis 12:30 Uhr je 20-minütige Vorträge angeboten. Im Anschluss<br />
stehen die Experten für Fragen zur Verfügung.<br />
www.shkessen.de<br />
Bild: Messe Essen<br />
Christian Raschka ist<br />
Deutschland manager von<br />
A-Gas Rapid Recovery.<br />
Bild: A-Gas<br />
A-Gas führt die Kampagne<br />
gegen illegale Importe an<br />
Seevetal. A-Gas ist Teil einer europaweiten Initiative zur Überzeugung der Europäischen Kommission,<br />
mehr gegen den Import illegaler Kältemittel zu tun. Branchenführer aus allen Teilen des europäischen<br />
Kältemittelmarkts haben sich zusammengetan und ein White-Paper veröffentlicht: „The<br />
F-Gas Regulation and the Issue of Illegal Import“ (Die F-Gas-Verordnung und das Problem des illegalen<br />
Imports).<br />
Aus diesem Papier geht hervor, dass der illegale Import von HFC-Gasen die Vorgaben der F-Gas-<br />
Verordnung gefährdet, die darauf ausgelegt sind, die Emissionen von HFC-Kältemitteln durch die<br />
Senkung des Verbrauchs zu reduzieren. A-Gas und andere Branchenführer wollen, dass die Europäische<br />
Kommission der Verfolgung des Handels mit illegalen Kältemitteln Priorität verleiht. Außerdem<br />
wird die Kommission aufgefordert, „alle rechtlichen und praktischen Maßnahmen zu berücksichtigen,<br />
die in naher Zukunft zu einer effektiven Förderung der Reduzierung von F-Gas-Emissionen<br />
führen könnten“.<br />
A-Gas unterstützt die F-Gas-Verordnung, ebenso wie das „Kigali-Amendment“ des Montreal-Protokolls.<br />
Unternehmen, die sich an der Kampagne beteiligen möchten, schicken eine E-Mail an den Commercial Business Development<br />
Director von A-Gas, Ken Logan: marketing@agas.com<br />
www.agasrapidrecovery.eu<br />
4 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
FIRMEN & FAKTEN<br />
Kurz notiert<br />
Bild: Bitzer<br />
Der Kältemittelschieber<br />
von Bitzer enthält Daten und<br />
Informationen zu mehr als<br />
100 Kältemitteln.<br />
Bitzer veröffentlicht<br />
aktualisierten Kältemittelschieber<br />
Sindelfingen. Der Spezialist für Kälte- und Klimatechnik Bitzer hat sein kostenloses<br />
Kältemittelnachschlagewerk für Smartphones überarbeitet: den Kältemittelschieber.<br />
2016 waren Design und Bedienung der 2010 eingeführten App modernisiert<br />
worden. Das Tool wurde speziell für Smartphones und Tablets mit iOS- oder<br />
Android-Betriebssystem entwickelt und umfasst alle gängigen Kältemittel einschließlich<br />
wichtiger Stoffdaten, Angaben zur Sicherheitsgruppe, zum Erderwärmungspotenzial<br />
(GWP) und Ozonabbaupotenzial (ODP) sowie Informationen zur<br />
Auswahl der Ölsorte für den Verdichter. Die Benutzeroberfläche ermöglicht nicht<br />
nur präzise Temperatur-Druck-Umrechnungen, sondern auch die Vorauswahl<br />
und Verwendung unterschiedlicher metrischer (SI) und imperialer (IP) Einheiten.<br />
Zu den Hauptfunktionen gehören mehrere parallele Schieberregler zur Einstellung<br />
von Druck- und Temperaturwerten, Suchfilter und die Favoritenspeicherung<br />
ebenso wie die Möglichkeit zur Anpassung aller relevanten Parameter<br />
im Einstellungsmenü. Darüber hinaus sind ergänzende Informationsschriften<br />
zu Kältemitteln und Links zu relevanten Online-Dokumenten hinterlegt. Die<br />
App enthält Daten und Informationen zu mehr als 100 natürlichen und synthetischen<br />
Kältemitteln. Im Einstellungsmenü können alle wichtigen Parameter für<br />
die Bestimmung der Meereshöhe sowie für Temperatur- und Druckwerte eingestellt<br />
werden. Die App ist auf Deutsch und Englisch erhältlich.<br />
www.bitzer.de<br />
SmartTouch<br />
Die neue<br />
Generation<br />
der Klimamesstechnik.<br />
Neuer Generalmanager<br />
bei Johnson Controls<br />
Essen. Johnson Controls ist führender Komplettanbieter<br />
für Gebäudeautomation, Klima-/Kältetechnik,<br />
Brandschutz und Sicherheit.<br />
Jetzt hat Johnson Controls Rainer Schild<br />
zum General Manager Industrial Refrigeration<br />
für Deutschland und die Schweiz ernannt.<br />
Zum 20. Januar übernimmt er die gesamte<br />
Verantwortung für den Geschäftsbereich Industrielle<br />
Kältetechnik. Schild hat Vertriebsund<br />
Managementerfahrung sowie mehr als<br />
30 Jahre technisches Fachwissen. Nach seinem<br />
Maschinenbaustudium in Bochum hatte<br />
er bei der Vaillant Gruppe angeheuert.<br />
Rainer Schild<br />
Bild: Johnson Controls<br />
Smarter. Schneller. Besser.<br />
Das Klimamessgerät<br />
testo 400.<br />
• Smarter: Mit Touch-Display<br />
so intuitiv zu bedienen wie Ihr<br />
Smartphone.<br />
• Schneller: Zeit sparen durch<br />
einfache Dokumentation & Berichterstellung<br />
vor Ort.<br />
• Besser: Fehlerfrei & routiniert<br />
durch jede Messung mit dem<br />
Mess-Assistenten.<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de<br />
www.testo.com/400
FIRMEN & FAKTEN<br />
Kurz notiert<br />
„Status-Report 8 - Fragen und Antworten zur Raumluftfeuchte“<br />
Bietigheim-Bissingen. Der Fachverband<br />
Gebäude-Klima (FGK) hat Ende 2019 den<br />
Status-Report 8 mit Fragen und Antworten<br />
zur Raumluftfeuchte aktualisiert.<br />
Der Status-Report bietet allgemeine Informationen<br />
zur Bedeutung der Raumluftfeuchte<br />
für den Menschen in Bezug<br />
auf dessen Gesundheit und dessen Behaglichkeit.<br />
Ebenfalls gibt er Aufschluss,<br />
welche Befeuchterarten angeboten und<br />
verbaut werden. Darüber hinaus befasst<br />
sich der Report mit der Nutzung der Befeuchtungsgeräte<br />
und veranschaulicht<br />
die technischen Lösungen mit Best-Practice-Beispielen<br />
in namhaften Objekten.<br />
Mit der Aktualisierung des Reports liefert<br />
der FGK Antworten auf Fragen rund<br />
um die Raumluftfeuchte.<br />
www.fgk.de<br />
Kurzlink und QR-Code<br />
führen direkt zur Richtlinie:<br />
bit.ly/status-report-8<br />
Bild: Alfred Kaut<br />
Rockwool: Brandschutz für Lüftungsleitungen<br />
Gladbeck. Mit dem „Montagehelfer für Lüftungsleitungen“ bietet<br />
Weltmarktführer Rockwool Verarbeitern kompakte Informationen,<br />
die auf der Baustelle gute Dienste tun. Zahlreiche Illustrationen<br />
mit präzisen Maßangaben<br />
vermitteln wertvolle Tipps zu<br />
allen wichtigen Anwendungen und<br />
Details zur brandschutztechnischen<br />
Ertüchtigung eckiger Lüftungsleitungen<br />
mit dem System „Conlit Duct<br />
Board 90“.<br />
Auf einigen Seiten fasst der Montagehelfer<br />
Wissenswertes zur fachgerechten<br />
Ausführung von horizontalen,<br />
geneigten und vertikalen<br />
Kanälen zusammen. Dabei wird aufgezeigt,<br />
welche Voraussetzungen<br />
von den Gewerken Lüftungsbau und<br />
Trockenbau geschaffen werden müssen,<br />
bevor die Montage durch den<br />
WKSB-Isolierer beginnen kann. Es gibt eine Checkliste, die hilft,<br />
alle Voraussetzungen für die Montage des „Conlit“-Systems zu<br />
ermitteln. In einer Materialliste wird zusammengefasst, was für<br />
den Einbau der Kanalbekleidung außerdem<br />
im Bereich von Wand- und<br />
Deckendurchführungen sowie zum<br />
Verschluss von Revisionsöffnungen<br />
benötigt wird.<br />
Fragen zum Brandschutz haustechnischer<br />
Anlagen beantwortet<br />
der Technische Service von Rockwool<br />
werktags von 8 bis 17:30 Uhr<br />
bzw. Freitags bis 16:30 Uhr. Der<br />
„Montagehelfer für Lüftungsleitungen“<br />
steht wie alle Rockwool-<br />
Kompendien kostenfrei zum Download<br />
bereit.<br />
ww.rockwool.de<br />
Neuauflage des<br />
Planungshandbuches für<br />
VRF-Systeme von Panasonic<br />
Wuppertal. Die Alfred Kaut GmbH aus Wuppertal hat ergänzend<br />
zum Produktportfolio die aktuelle Auflage des VRF-Planungshandbuches<br />
für Panasonic Heiz- und Kühlsysteme veröffentlicht.<br />
Die Dokumentation enthält auf 276 Seiten detaillierte<br />
und praxisnahe Informationen für eine individuelle und<br />
reibungslose Planung. Unter anderem werden ausführliche<br />
technische Daten der Innen- und Außengeräte, Abmessungen<br />
und Installationsabstände, Verdrahtungs- und Fließschemata<br />
sowie Hinweise zur Rohrleitungsdimensionierung bereitgestellt.<br />
Neben den Beschreibungen gerätespezifischer Eigenschaften<br />
und Sonderfunktionen werden die vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten<br />
von Kaut und Panasonic erläutert. Ebenso erhält der Planer Informationen über Zubehör für die sichere Aufstellung<br />
sowie Möglichkeiten zur Reduzierung der Schallemissionen von Panasonic-Außengeräten.<br />
www.kaut.de<br />
Blickpunkt Brandschutz für Lüftungsleitungen: Der<br />
„Montagehelfer für Lüftungsleitungen“ liefert kompakte<br />
Informationen.<br />
Bild: Rockwool<br />
6 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
–<br />
Neue<br />
Standards<br />
setzen<br />
Mit der Kampagne „Mindestfeuchte 40 %“ will der FGK u. a.<br />
Bauherren und Planer erreichen, die in ihren Gebäuden eine<br />
optimale und gesundheitsfördernde Raumluftqualität anstreben.<br />
Trockene Luft erhöht<br />
Übertragungseffizienz<br />
von Viren<br />
Hamburg/Bietigheim-Bissingen. Der Fachverband Gebäude-Klima<br />
(FGK) hat die Kampagne „Mindestfeuchte 40 %“<br />
gestartet. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Luftbefeuchtung<br />
als integralem Bestandteil der Indoor Air Quality<br />
(IAQ) zu schärfen. In einer Veranstaltung zum Kampagnenauftakt<br />
am 16. Januar <strong>2020</strong> in der Hamburger Elbphilharmonie<br />
wurde in Fachvorträgen dargestellt, welchen<br />
Einfluss die Raumluftfeuchtigkeit auf Behaglichkeit,<br />
Arbeitsproduktivität und Gesundheit hat. So erklärte Dr.<br />
med. Walter J. Hugentobler, Facharzt für Allgemeine Innere<br />
Medizin und Experte für Raumluftfeuchte, dass sich trockene<br />
Luft unter 40 % Raumluftfeuchte nicht nur auf die<br />
Haut, Augen und Schleimhäute auswirkt, sondern auch<br />
die Übertragungseffizienz von Grippeviren erhöht. Speziell<br />
in öffentlichen Gebäuden mit einem hohen Besucheraufkommen,<br />
wie der Hamburger Elbphilharmonie, sei eine<br />
ausreichende Luftfeuchtigkeit elementar wichtig. „Eine<br />
Mindestfeuchtigkeit von 40 % trägt somit dazu bei, die<br />
Ansteckungsgefahr deutlich zu verringern und das gesundheitliche<br />
Wohlbefinden zu steigern“, sagte Hugentobler.<br />
Mit der Kampagne „Mindestfeuchte 40 %“ will der FGK<br />
in Zukunft Bauherren, Planer, gewerbliche Nutzer und Arbeitnehmervertreter<br />
erreichen, die in ihren Gebäuden eine<br />
optimale und gesundheitsfördernde Raumluftqualität anstreben.<br />
Dazu erläuterte Claus Händel, Technischer Referent<br />
des FGK: „Der Grenzwert von 40 % soll sich langfristig<br />
als Mindestmaß für die Raumluftfeuchtigkeit in Gebäuden<br />
etablieren.“<br />
www.mindestfeuchte40.de<br />
Link und QR-Code führen direkt zum Video-<br />
Beitrag der IKZ-Redaktion zur Auftaktveranstaltung<br />
in Hamburg:<br />
bit.ly/Mindestfeuchte<br />
Bild: FGK<br />
Starke Leistung für Ihre Projekte<br />
Set Free Sigma<br />
VRF-Außeneinheiten<br />
zum modularen Aufbau<br />
• Standard und High COP<br />
in den Ausführungen als 2- oder 3-Leiter<br />
• Neue kompakte Bauformen<br />
mit bis zu 42 % kleineren Standflächen<br />
• Smooth Drive Control<br />
mit neuen Inverter-Verdichtern<br />
• Modularbetrieb<br />
9 Einzelmodule, bis zu 36 Kombinationen<br />
• Max. Kühlleistung 268,0 kW<br />
• Max. Heizleistung 305,0 kW<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de Klimatechnik, Wärmepumpen & Kaltwassersätze<br />
Tel. 02 02 - 69 88 45 0 • www.kaut-hitachi.de
<strong>KLIMA</strong><br />
Anlagenmonitoring<br />
Simultan kühlen und heizen spart Kosten<br />
Klimakomfort im Gewerbeobjekt mit getrennter Verbrauchserfassung<br />
Für das Kühlen und Heizen in Gewerbeobjekten bietet sich oft die Klimatisierung mit Wärmerückgewinnung als ideale Lösung an.<br />
So lässt sich meist die klassische Heizungsanlage einsparen und der Energieverbrauch sowie die Kosten signifikant reduzieren. Bei<br />
mehreren Mieteinheiten in einem Objekt kann dazu die separate Verbrauchserfassung durch eine zentrale Bediensoftware ermöglicht<br />
werden, um den exakten Energieverbrauch zu berechnen und zu optimieren. In Ingolstadt hat ein Fachhandwerksunternehmen dies<br />
in Kooperation mit einem Kälte-Klima-Fachgroßhandel realisiert.<br />
Das Gewerbegebiet IngoPark bietet Unternehmen<br />
einen attraktiven Standort in<br />
der Wirtschaftsregion Ingolstadt. Zahlreiche<br />
Betriebe aus Gewerbe, Handel und<br />
der Technologiebranche haben sich hier<br />
angesiedelt oder werden dies in Zukunft<br />
tun. So wie ein heimischer Unternehmer,<br />
der die stadtrandnahe Lage für ein<br />
neu errichtetes Gewerbeobjekt nutzt. Das<br />
dreistöckige Gebäude ist im schlichten,<br />
funktionalen Stil erbaut und orientiert<br />
sich an den aktuellen Energiestandards.<br />
Als Zweckbau spielte bei dem Entwurf das<br />
Verhältnis von optimaler Kos ten-Nutzen-<br />
Rechnung eine wichtige Rolle. Gleichzeitig<br />
wurden durch den Bauherrn auf<br />
Langlebigkeit der Materialien und eine<br />
zukunftssichere technische Ausstattung<br />
geachtet.<br />
Unterstützung durch<br />
Klima-Fachgroßhandel<br />
Vor diesem Hintergrund standen bei der<br />
Wahl des geeigneten Klimasystems neben<br />
dem Klimakomfort auch die Investitions-<br />
und Betriebskosten im Fokus. Ausführung<br />
und Betreuung wurden durch<br />
das Fachhandwerksunternehmen Graf<br />
aus Ingolstadt durchgeführt. Unterstützt<br />
wurde der Fachhandwerksbetrieb von<br />
Marco Daffner, Kälteanlagenbauermeister<br />
und Key-Account-Manager bei der<br />
Robert Schiessl GmbH, einem Kälte-Klima-Fachgroßhandel.<br />
Er hat die Anlagenplanung<br />
unterstützt und die Inbetriebnahme<br />
begleitet. „Unser gemeinsames<br />
Ziel war eine komfortable, energieeffiziente<br />
Klimatisierung, die individuell<br />
gesteuert und nach dem tatsächlichen<br />
Verbrauch abgerechnet werden kann“,<br />
erklärt dazu Marco Daffner. In enger<br />
Abstimmung mit dem Bauherrn fiel die<br />
Wahl bei den Klimaanlagen für die Büroetagen<br />
deshalb auf VRF-Wärmepumpensysteme<br />
von Mitsubishi Electric. Zum<br />
Einsatz kommen zwei unterschiedliche<br />
Systeme mit zahlreichen Funktionalitäten,<br />
die den jeweiligen Anforderungen<br />
Rechnung tragen sollen.<br />
In den Werkstätten im Erdgeschoss<br />
sind so z. B. VRF-Klimasysteme der „Y“-<br />
Serie zum wahlweisen Heizen oder Kühlen<br />
installiert. Diese Serie bietet sich an,<br />
wenn im Umschaltbetrieb geheizt oder<br />
gekühlt werden soll und die Voraussetzungen<br />
für die Nutzung einer Wärmerückgewinnungsfunktion<br />
nicht zweckmäßig<br />
gegeben sind. Für die beiden Büroetagen<br />
stehen „VRF-R2“-Wärmepumpensysteme<br />
zur Verfügung, die nach Angabe des Herstellers<br />
speziell zum Aufbau energiesparender<br />
und umweltfreundlicher Anlagen<br />
in komplexen Gebäuden entwickelt wurden.<br />
Büro- und Werkstattgebäude im Gewerbegebiet IngoPark in Ingolstadt. Hier wird über die<br />
Klimatisierung mit Wärmerückgewinnung gekühlt und geheizt.<br />
Niedrige Energiekosten durch<br />
Wärmerückgewinnung<br />
Das „VRF-R2“-Wärmepumpensystem von<br />
Mitsubishi Electric ist ein Wärmerückgewinnungssystem,<br />
das Heizen und Kühlen<br />
im Simultanbetrieb mit nur zwei<br />
Rohrleitungen ermöglicht. Hierbei wird<br />
den zu kühlenden Räumen Wärme entzogen<br />
und über sogenannte BC-Controller<br />
(Kältemittelverteiler) in Bereiche des<br />
Gebäudes verschoben, die Wärme benötigen.<br />
Die Wärme wird so nicht ungenutzt<br />
über die Außengeräte an die Umwelt abgegeben,<br />
sondern verbleibt im geschlossenen<br />
System.<br />
8 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
<strong>KLIMA</strong><br />
Anlagenmonitoring<br />
In den Werkstätten sind Klimasysteme der<br />
Y-Serie zum wahlweisen Heizen oder Kühlen<br />
installiert.<br />
In dem Büro- und Gewerbeobjekt konnte<br />
durch das System so auf eine klassische<br />
Heizungsanlage verzichtet werden. Die<br />
Versorgung der Büros mit Wärme erfolgt<br />
im reinen Umluftbetrieb über die Klimageräte.<br />
Dazu befinden sich die Außenanlagen<br />
auf dem Flachdach des Gebäudes<br />
und bedienen jeweils ein Stockwerk. Im<br />
Erdgeschoss sind zwei Werkstätten beheimatet,<br />
eine davon ist ein Fachbetrieb<br />
für Fahrzeugaufbereitung. Beide Gewerbeeinheiten<br />
verfügen über je ein eigenes<br />
VRF-Klimasystem aus der „Y“-Serie zum<br />
wahlweisen Heizen oder Kühlen. Die linke<br />
Gebäudeseite im Erdgeschoss wird durch<br />
ein Außengerät mit 40 kW Kälteleistung<br />
und die Aufbereitungswerkstatt durch ein<br />
Außengerät mit 50 kW Kälteleistung versorgt.<br />
BC-Controller<br />
Im ersten Obergeschoss befinden sich<br />
zwei Mietgewerbeeinheiten für Büroräume.<br />
Die Klimaanlage für dieses Stockwerk<br />
besteht aus zwei Außengeräten des<br />
VRF-R2-Systems der „City Multi“-Serie mit<br />
einer Gesamtkälteleistung von 61,5 kW<br />
und einer Gesamtheizleistung von rund<br />
69 kW. Die Außengeräte verfügen über sogenannte<br />
Wind-Shields, damit die Geräte<br />
bei starken Windlasten oder im Winter bei<br />
Schneefall im Heizbetrieb reibungslos abtauen<br />
können. Zwei Kältemittelverteiler<br />
(BC-Controller) übernehmen die Verteilung<br />
des Kältemittels an die einzelnen Innengeräte.<br />
Die beiden Verteilereinheiten<br />
sind als eine Master- und eine Slave-Einheit<br />
in zwei Schächten auf der Etage untergebracht.<br />
Das zweite Obergeschoss ist sowohl<br />
von der Raumaufteilung als auch vom<br />
Nutzungsprofil und den eingesetzten Geräten<br />
nahezu identisch mit dem ersten<br />
Obergeschoss. Auch hier befinden sich<br />
die BC-Controller in den Schachtanlagen<br />
des betreffenden Stockwerks. Sie bilden<br />
mit den Außengeräten eine kälte- und regelungstechnische<br />
Einheit und leiten das<br />
Kältemittel je nach Wärme- oder Kältebedarf<br />
als Heißgas oder Flüssigkeit an die<br />
unterschiedlichen Klimakreise in den Büros.<br />
Sensor-Technologie<br />
passt Leistung bedarfsgerecht an<br />
Als Innengeräte kommen in dem Gebäude<br />
insgesamt 63 4-Wege-Deckenkassetten<br />
in unterschiedlichen Leistungsgrößen als<br />
große Kassetten oder im Eurorastermaß<br />
zum Einsatz. Für die Bedienung der Innengeräte<br />
stehen in jedem Raum Kabelfernbedienungen<br />
zur Verfügung. Alle Innengeräte<br />
sind mit der sogenannten „3Di-see“-Sensor-Technologie<br />
des Herstellers<br />
für eine nachhaltige Klimatisierung ausgestattet.<br />
Diese Sensor-Technologie verfügt<br />
über einen intelligenten Algorithmus,<br />
der die Anzahl und Position von Personen<br />
im Raum erkennt.<br />
Durch die regelungstechnische Verknüpfung<br />
von Außen- und Innengeräten<br />
mit der Sensor-Technologie schalten die<br />
Geräte in einen erweiterten Energiesparmodus,<br />
in dem die Kompressorleistung<br />
entsprechend reduziert wird. Dies ermöglicht<br />
einen automatischen Energiesparbetrieb<br />
an Orten, an denen sich die Anzahl<br />
der Personen häufig ändert und deshalb<br />
geringere Wärmelasten abzuführen sind.<br />
Erhöht sich die Anzahl der Personen im<br />
Raum wieder, fährt der Kompressor mit<br />
seiner Leistung hoch. Zudem kann der<br />
Sensor auch feststellen, welche Bereiche<br />
häufig genutzt werden und passt so die<br />
Anlagenbetriebsweise an.<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 9
<strong>KLIMA</strong><br />
Anlagenmonitoring<br />
Als Innengeräte kommen in dem Gebäude insgesamt 63 4-Wege-<br />
Deckenkassetten in unterschiedlichen Leistungsgrößen als große<br />
Kassetten oder im Eurorastermaß zum Einsatz.<br />
In einem kleinen Technikraum ist ein PC aufgestellt, auf dem eine<br />
multifunktionale Bediensoftware den genauen Energieverbrauch pro<br />
Mieteinheit ermittelt.<br />
Getrennte Verbrauchserfassung<br />
durch zentrale Bediensoftware<br />
Besonderen Wert legte der Bauherr auf<br />
eine getrennte Verbrauchserfassung für<br />
die einzelnen vermieteten Einheiten.<br />
Dafür wurde in einem kleinen Technikraum<br />
ein PC aufgestellt, auf dem eine<br />
multifunktionale Bediensoftware („TG-<br />
2000A“) installiert ist. Das zentrale Steuerungssystem<br />
ermöglicht es dem Vermieter<br />
bzw. dem Wartungsbetrieb, die<br />
einzelnen Klimageräte oder Gerätegruppen<br />
zentral zu überprüfen und alle Klimageräte<br />
vom PC aus zu steuern. Zur<br />
genauen Verbrauchserfassung berechnet<br />
die Regelung in Abhängigkeit der<br />
Leistungsaufnahme der Innengeräte,<br />
der momentanen Heiz- und Kühlleistung<br />
sowie der Raumtemperatur den<br />
tatsächlichen Stromverbrauch pro Mieteinheit.<br />
„Das macht die Arbeit für den Betreiber<br />
einfacher und effizienter. Zudem zeigt die<br />
Erfahrung, dass sich durch das zentrale<br />
Klimamanagement Einsparungen beim<br />
Energieverbrauch realisieren lassen, die<br />
letztlich den Mietern zugutekommen“, so<br />
Daffner. Die Funktionalitäten und damit<br />
verbundenen Vorteile der Software reichen<br />
aber noch weiter. So können Betriebsparameter<br />
und eventuelle Fehlermeldungen<br />
angezeigt, Zeitprogramme eingestellt<br />
und Trenddaten analysiert werden.<br />
Zudem bietet das Programm die Möglichkeit,<br />
den Betriebszustand und Temperaturverlauf<br />
jedes einzelnen Klimageräts<br />
anzuzeigen und gegebenenfalls anzupassen.<br />
Bilder: Mitsubishi Electric<br />
www.mitsubishi-les.com<br />
Alle Innengeräte sind mit „3D-i-see“-Sensor-Technologie<br />
für eine intelligente Klimatisierung ausgestattet.<br />
Die Technologie verfügt über einen Algorithmus, der die<br />
Anzahl und Position von Personen im Raum erkennt und<br />
die Anlagenbetriebsweise entsprechend anpasst.<br />
10 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
RadiPac.<br />
Der Spezialist für<br />
hohen statischen Druck.<br />
Leistungsstarke EC-Radialventilatoren für große<br />
Gebäude: Es gibt nichts, was ein RadiPac nicht kann.<br />
ebmpapst.com/highpressure
<strong>KLIMA</strong><br />
Kohlendioxid<br />
CO 2 -Filterung gegen den Klimawandel<br />
„Direct Air Capture“-Technologie gewinnt CO 2 aus der Umgebungsluft und macht es für Prozesse nutzbar<br />
Bild: Climeworks/Julia Dunlop<br />
„Was wäre, wenn wir verhindern könnten, dass der Klimawandel noch dramatischere Auswirkungen hat als bislang?“ Eine Frage, mit<br />
der sich die Gründer von Climeworks in der Schweiz intensiv auseinandergesetzt haben und die als Basis für ihr Unternehmenskonzept<br />
dient: CO 2 aus der Luft zu filtern. Ermöglicht wird dies durch die „Direct Air Capture“-Technologie.<br />
Abschmelzende Polkappen, Hitzerekorde,<br />
ein steigender Meeresspiegel – hauptsächlich<br />
verursacht durch den Klimawandel<br />
ist dessen bedrohliche Bedeutung für uns<br />
und unseren Planeten mittlerweile in praktisch<br />
jedes Wohnzimmer vorgedrungen.<br />
Ein Hauptverursacher dieser bedrohlichen<br />
Entwicklung: zu hohe CO 2 -Emissionen. Das<br />
Pariser Übereinkommen, welches 2015 im<br />
Zuge der Klimarahmenkonvention der Vereinten<br />
Nationen verabschiedet wurde, zielt<br />
darauf ab, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur<br />
auf „deutlich unter<br />
2 °C“ über dem vorindustriellen Niveau zu<br />
halten, um die Risiken und Auswirkungen<br />
der Klimakrise auf den Planeten erheblich<br />
zu verringern. Aber wie kann dieses Abkommen<br />
auch Wirklichkeit werden? Lösungsansätze<br />
und Strategien, die zum Erreichen<br />
dieser Ziele beitragen möchten,<br />
gibt es einige. Eines dieser Konzepte liefert<br />
das schweizer Unternehmen Climeworks:<br />
die modulare „Direct Air Capture“-<br />
Technologie, die CO 2 aus der Luft filtert und<br />
den gewonnenen Rohstoff in unterschiedliche<br />
Industriezweige weiter verkauft z. B.<br />
als Dünger für Gewächshäuser – so wie am<br />
Hauptstandort von Climeworks in Hinwil,<br />
in der Schweiz.<br />
Die „Direct Air Capture“-Technologie<br />
Bereits im Jahr 2008 besuchten Christoph<br />
Gebald und sein Kommilitone Jan Wurzbacher<br />
– die zwei Gründer und Vorstandsmitglieder<br />
von Climeworks – den Familienbetrieb<br />
der Gebrüder Meier. Die beiden<br />
damaligen ETH-Studenten hatten<br />
die Idee, CO 2 direkt aus der Umgebungsluft<br />
zu filtern und als Rohstoff zu verkaufen.<br />
„Wir stellten unser Konzept vor und<br />
schlossen eine Absichtserklärung über<br />
den möglichen Kauf, wenn es uns gelingt,<br />
eine entsprechende Anlage zu bauen“, erinnert<br />
sich Christoph Gebald. Anschließend<br />
entstand im Rahmen des „Venture<br />
Challenge“-Kurses an der ETH Zürich ein<br />
erster Businessplan.<br />
Neun Jahre später thront die weltweit<br />
erste kommerzielle Anlage ihrer Art auf<br />
dem Dach der nur 400 m entfernt liegenden<br />
Müllverwertungsanlage des Zweck-<br />
12 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
<strong>KLIMA</strong><br />
Kohlendioxid<br />
verbands Kehrichtverwertung Zürcher<br />
Oberland (KEZO). „Seit unserem ersten Besuch<br />
hier haben wir den Sprung von einigen<br />
Millilitern pro Tag im Labor auf 900<br />
Tonnen pro Jahr im industriellen Maßstab<br />
geschafft“, sagt Climeworks-Geschäftsführer<br />
Christoph Gebald stolz.<br />
„Direct Air Capture“ – kurz DAC – heißt<br />
das Verfahren, das Christoph Gebald und<br />
Jan Wurzbacher inzwischen mit einem<br />
Team von aktuell 65 Experten zur kommerziellen<br />
Verfügbarkeit weiterentwickelt<br />
haben. Für die Umsetzung der Anlage<br />
in Hinwil wird Climeworks vom Bundesamt<br />
für Energie BFE mit einem Beitrag<br />
an den nicht amortisierbaren Kosten unterstützt.<br />
Fakten zur „Direct Air Capture“-Anlage in Hinwil<br />
Art der Anlage:<br />
Climeworks DAC-18<br />
Zahl der CO 2 -Kollektoren:<br />
18<br />
CO 2 -Kapazität pro Tag:<br />
2460 kg (abhängig u. a.<br />
von Wetterfaktoren)<br />
CO 2 -Nutzung:<br />
CO 2 -Anreicherung eines<br />
Gewächshauses<br />
Größe der CO 2 -Filteranlage: ca. 90 m²<br />
Größe des Gewächshauses: 37 632 m²<br />
Effekt im Gewächshaus: Steigerung des Ernteertrags um bis zu 20 %<br />
18 Kollektoren filtern 900 t CO 2<br />
Die 18 CO 2 -Kollektoren sind in drei Schiffscontainern<br />
übereinander auf dem Dach<br />
der Müllverwertungsanlage und in Sichtweite<br />
zu den Gewächshäusern installiert.<br />
„Die Ventilatoren außen dienen dazu,<br />
die Umgebungsluft anzusaugen“, erklärt<br />
Christoph Gebald. Im Inneren jedes Kollektors<br />
findet dann der eigentliche Adsorptions-Desorptions-Prozess<br />
statt. Die<br />
CO 2 -reduzierte Luft wird wieder herausgeblasen.<br />
„Unsere Filter werden innerhalb<br />
weniger Stunden mit CO 2 gesättigt“,<br />
beschreibt Gebald. Um den Desorptions-<br />
Prozess zu starten, wird das gesättigte Filtermaterial<br />
auf ca. 100 °C erhitzt. „Hierzu<br />
nutzen wir die Abwärme der KEZO und<br />
sind damit besonders ressourcenschonend“,<br />
so Gebald. Dabei wird das hochreine<br />
CO 2 freigesetzt und der Leitung zugeführt,<br />
die die Gewächshäuser der Gebrüder<br />
Meier mit dem Gas versorgt. Pro<br />
Jahr kauft der landwirtschaftliche Betrieb<br />
Climeworks 900 t des Gases zu marktüblichen<br />
Preisen ab. „Die Nutzung von CO 2<br />
aus der lokalen Umgebungsluft passt zu<br />
unseren nachhaltigen Produktionsgrundsätzen<br />
und unterstützt die Vermarktung<br />
unserer Produkte“, sagt Meier. Das Wachstum<br />
von Gurken oder Tomaten, die das<br />
Unternehmen für den schweizerischen<br />
Bild: Climeworks<br />
Großhandel anbaut, wird deutlich gesteigert.<br />
Bislang musste dafür eigens ein<br />
Lkw aus größerer Entfernung den CO 2 -<br />
Tank auffüllen.<br />
CO 2 aus Umgebungsluft kurbelt<br />
Pflanzenwachstum an<br />
CO 2 ist in der Landwirtschaft ein wertvoller<br />
Dünger: In der richtigen Dosis eingesetzt,<br />
sorgt das Gas dafür, dass Tomaten,<br />
Gurken oder Salat bis zu 20 % schneller<br />
wachsen. „Die Pflanzen werden kräftiger<br />
und größer“, sagt Fritz Meier, der bei der<br />
Gebrüder Meier AG im schweizerischen<br />
Hinwil für die Gewächshausproduktion<br />
zuständig ist. Seither erhält der landwirt-<br />
Bild: Climeworks/Julia Dunlop<br />
Die DAC-Anlage auf dem Dach der Müllverwertungsanlage<br />
des KEZO mit Blick<br />
auf die Gewächshäuser der Gebrüder<br />
Maier.<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 13
Die<br />
Gründer<br />
von Climeworks:<br />
Christoph Gebald (links) und Jan<br />
Wurzbacher (rechts).<br />
schaftliche Betrieb das CO 2 nicht mehr aus<br />
industriellen Quellen per Lkw angeliefert,<br />
sondern weltweit einmalig von einer<br />
Anlage, die den wertvollen Rohstoff direkt<br />
aus der Umgebungsluft filtert. Aufgrund<br />
des zyklischen Prozesses sind die 18 Kollektoren<br />
stets in unterschiedlichen Phasen<br />
– dies ermöglicht die kontinuierliche<br />
Belieferung der Gewächshäuser über eine<br />
unterirdische Rohrleitung.<br />
Bild: Climeworks/Julia Dunlop<br />
Rohstoff für Getränke,<br />
Kraftstoff und Materialien<br />
Aufgrund der Vor-Ort-Herstellung muss<br />
kein industrielles, fossiles CO 2 mehr per<br />
Lkw zum Verbraucher antransportiert<br />
und in Tanks zwischengespeichert werden.<br />
Die Kunden reduzieren damit ihre<br />
Emissionen sowie die Abhängigkeit von<br />
fossilen Energien. Darüber hinaus kann<br />
das von Climeworks gesammelte CO 2 verwendet<br />
werden, um z. B. Getränke anzureichern<br />
oder klimaneutrale Kraftstoffe<br />
und Materialien herzustellen.<br />
Mit der Installation der ersten kommerziellen<br />
DAC-Anlage hat das Unternehmen<br />
nicht nur Produktionskapazitäten<br />
am Firmenstandort geschaffen, sondern<br />
auch sein Expertenteam Schritt für<br />
Schritt erweitert. „Mit den energetischen<br />
und wirtschaftlichen Daten können wir<br />
nun auch andere, größere Projekte zuverlässig<br />
kalkulieren und dabei auf die Erfahrungswerte<br />
aus der Praxis zurückgreifen“,<br />
so Jan Wurzbacher.<br />
Beispiel: Das<br />
CarbFix2-Projekt<br />
in Island arbeitet<br />
seit 2017 mit<br />
einer DAC-Anlage<br />
in Kombination<br />
mit einer unterirdischen<br />
Mineralisierung<br />
des CO 2 .<br />
Projekt in Island<br />
Climeworks hat sich hierfür<br />
mit dem isländischen Ener -<br />
gieversorger Reykjavik Energy<br />
verbündet, um weltweit einmalig<br />
die DAC-Technologie mit dauerhafter geologischer<br />
Speicherung zu kombinieren.<br />
Gemanagt wird das im Rahmen von Horizon<br />
<strong>2020</strong> von der EU geförderte Vorhaben<br />
an einem der größten Geothermie-Kraftwerke<br />
der Welt von Reykjavik Energy. In<br />
Hellisheidi wird bereits CO 2 aus anderen<br />
Quellen mineralisiert.<br />
Mit der Pilotanlage in Island wird CO 2<br />
direkt aus der Umgebungsluft gefiltert<br />
und – in Wasser gebunden – über 700 m<br />
in den Untergrund geleitet. In diesem Basaltreichen<br />
Boden kann das sprudelnde<br />
Gemisch aufgrund des hohen Drucks und<br />
der hohen Temperaturen nicht mehr entweichen.<br />
Stattdessen verbindet es sich mit<br />
dem Basalt – ein natürlicher Prozess, bei<br />
dem CO 2 mit dem basischen Gestein reagiert<br />
und innerhalb weniger Jahre zu<br />
Calciumcarbonat umgesetzt wird. Der<br />
Vorteil? Calciumcarbonat – auch Calzit<br />
genannt – kann weder durch äußere Wettereinflüsse<br />
oder etwa auftretende Brände<br />
geschädigt werden, sodass kein CO 2 mehr<br />
austreten kann. Dadurch lässt sich CO 2 –<br />
als Calzit gebunden – dauerhaft und sicher<br />
aus der Atmosphäre entfernen.<br />
Während der Testphase wird vor allem<br />
untersucht, wie DAC auf die spezifischen<br />
Wetterverhältnisse im Südwesten Islands<br />
reagiert. Die Bedingungen in bestehenden<br />
Geothermiekraftwerken in Island machen<br />
es zu einem der besten Orte, um mit der<br />
Endlagerung von CO 2 zu beginnen. Es gibt<br />
jedoch noch mehr Orte, an denen ideale<br />
Voraussetzungen vorherrschen. Z. B.<br />
bietet das „Icelandic Rift“-System Kapazitäten,<br />
um pro Jahr bis zu 50 Mio. t CO 2<br />
zu speichern. Studien zufolge bieten sich<br />
auf globaler Ebene sogar Kapazitäten, um<br />
über 30 Bio. t CO 2 einspeichern zu können.<br />
Geeignet sind dafür z. B. vor allem Standorte<br />
in Nordamerika, im Mittleren Osten<br />
oder auch in China.<br />
Gurkenpflanzen in einem der Gewächshäuser der Gebrüder Maier.<br />
Bild: Climeworks/Julia Dunlop<br />
14 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
<strong>KLIMA</strong><br />
Kohlendioxid<br />
Bild links: Prozesskette des Carb-<br />
Fix2-Projekts in Island zur Filterung<br />
und Mineralisierung von CO 2 . Bild<br />
rechts: Basaltkern mit Carbonaten.<br />
Negative Emissionen<br />
zur Erreichung des 2-°C-Ziels<br />
„Hoch skalierbare negative Emissionstechnologien<br />
sind zum Erreichen des<br />
2-Grad-Ziels der Weltgemeinschaft unerlässlich“,<br />
sagt Christoph Gebald. „Die<br />
DAC-Technologie bietet hierfür unzählige<br />
Vorteile und ist in Kombination mit unterirdischer<br />
Speicherung bestens geeignet.<br />
Daher arbeiten wir jeden Tag daran,<br />
unsere Mission, bis 2025 ein Prozent der<br />
globalen CO 2 -Emissionen aus der Luft zu<br />
filtern, zu erreichen.“ Um dieses Ziel umzusetzen,<br />
sind laut Climeworks 250 000<br />
DAC-Anlagen wie in Hinwil notwendig.<br />
Parallel hierzu biete das Unternehmen<br />
auch für „Einzelkämpfer“ ein passendes<br />
Angebot: Seit Kurzem ist es für jede Person<br />
möglich, Reise-Emissionen permanent<br />
aus der Atmosphäre zu entfernen. Als Mitglied<br />
der „Climeworks Pioneers“ lässt man<br />
CO 2 im eigenen Namen zu Stein umwandeln<br />
– und setzt somit ein Zeichen gegen<br />
die Klimakrise.<br />
www.climeworks.com<br />
www.climeworks.shop<br />
Bild: Climeworks/Julia Dunlop<br />
Bild: Climeworks<br />
Bild: Climeworks/Sandra O Snaebjornsdottir<br />
Am Geothermie-<br />
Kraftwerk<br />
Hellisheidi auf<br />
Island wird<br />
erstmals CO 2 aus<br />
der Luft in Stein<br />
verwandelt.
KÄLTE<br />
Datenverarbeitung<br />
Optimierte Lüftungs- und<br />
Klimatisierungssysteme für Rechenzentren<br />
Rahmenbedingungen für Planung, Bau und Betrieb von Rechenzentren nach VDI-Richtlinie 2054<br />
Obwohl der Energieverbrauch einzelner Computer stetig sinkt, führt die fortschreitende Digitalisierung in Gesellschaft und Industrie<br />
zu einer Zunahme von Rechenzentrumsleistungen. Die rasante Entwicklung der IT-Systeme stellt neue und höhere Anforderung an die<br />
Infrastrukturtechnik. Aus diesem Grunde musste die aus dem Jahr 1994 stammende VDI-Richtlinie 2054 „Raumlufttechnische Anlagen<br />
für Datenverarbeitung“ zwingend aktualisiert werden. Nachfolgend einige Kernpunkte der aktuellen Richtlinie.<br />
Die Zeiten, in denen bloß um die Machbarkeit<br />
hoher Rechenleistungen gerungen<br />
wurde, sind vorbei. Die Standards<br />
sind gesetzt und nach oben verschoben.<br />
In der Folge rückten andere Aspekte von<br />
Rechenzentren in den Fokus: Ein möglichst<br />
niedriger Energieverbrauch, Effizienz<br />
und damit auch Klimaschutz gewinnen<br />
zunehmend an Bedeutung. Die aktuelle<br />
VDI-Richtlinie 2054 „Raumlufttechnik<br />
– Datenverarbeitung (VDI-Lüftungsregeln)“,<br />
von August 2019, setzt an diesem<br />
Punkt an und stellt die Anforderungen an<br />
Planung, Bau und Betrieb von energieeffizienten<br />
Rechenzentren dar. Ein wichtiger<br />
– wenn nicht der wichtigste – Faktor in diesem<br />
Zusammenhang ist die Wärmefreisetzung<br />
von Systemen der Datenverarbeitung.<br />
Die Wärmeentwicklung liegt bei solchen<br />
Systemen um ein Vielfaches höher als bei<br />
herkömmlichen Wärmelasten wie Lampen,<br />
Sonnenlicht oder der Umgebungstemperatur.<br />
Entsprechend ist es Aufgabe der<br />
Belüftungssys teme, die hohen Wärmelasten<br />
sicher und effizient abzuführen.<br />
Alternative Auslegungsgrundlagen<br />
Die klimatechnischen Rahmenbedingungen,<br />
die innerhalb eines Rechenzentrums<br />
eingehalten werden sollen, sind<br />
im Wesentlichen die Temperatur und die<br />
Luftfeuchte. Dabei handelt es sich um die<br />
Lufteintrittszustände in das IT-Equipment.<br />
Als Auslegungsgrundlagen stehen<br />
dazu neben der VDI-Richtlinie 2054 alternativ<br />
weitere Regelwerke zur Verfügung:<br />
• DIN EN 50600-2-3:2019-08 „Informationstechnik<br />
– Einrichtungen und Infrastrukturen<br />
von Rechenzentren, Teil<br />
Bilder: dc-ce RZ-Beratung<br />
KALTGANG<br />
Bild 1: Modernes Rechenzentrum mit Kaltgangeinhausung.<br />
2-3: Regelung von Umgebungsbedingungen“,<br />
• ASHRAE Thermal Guidelines for Data<br />
Processing Environments 2012; ASH-<br />
RAE (American Society of Heating, Refrigeration,<br />
Air-Conditioning Engineers),<br />
• DIN EN 60721-3-3:1995-09 „Klassifizierung<br />
von Umweltbedingungen (für<br />
Telekommunikationsräume) – Teil 3:<br />
Klassen von Umwelteinflussgrößen<br />
und deren Grenzwerte“.<br />
Die VDI 2054 enthält Empfehlungen, die<br />
bei Planung, Errichtung und Betrieb von<br />
technischen Anlagen zur Klimatisierung<br />
von Einrichtungen für die Datenverarbeitung<br />
zu beachten sind. Dabei werden folgende<br />
Systeme allerdings nicht berücksichtigt:<br />
WARMGANG<br />
• Systeme zur Abführung von hohen Prozessorleistungen<br />
direkt am Rechenkern<br />
mittels flüssiger Kälteträger und<br />
• Anlagen für Maschinenräume mit Arbeitsplätzen<br />
(für Anforderungen bezüglich<br />
dauerhafter Arbeitsplätze<br />
wird auf die technischen Regeln wie<br />
ASR A 3.5, ASR A 3.6, DIN EN 16798,<br />
DIN EN 15251, VDI 6022 und VDI 3804<br />
verwiesen). Im Gegensatz zur Fassung<br />
der Norm von 1994 [1] – in der noch Vorgaben<br />
für periphere Räume und Operatorräume<br />
mit ständigen Arbeitsplätzen<br />
enthalten waren – wurde der Inhalt<br />
der Neufassung bewusst auf reine<br />
Rechnerräume beschränkt.<br />
Im Folgenden werden einige Aspekte zum<br />
Inhalt und zu Schnittstellen der VDI 2054<br />
dargelegt.<br />
16 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
Bild: Beuth Verlag/VDI 2054<br />
Systemauswahl<br />
Bild 2 zeigt eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten,<br />
die sich bei der Kombination<br />
der Anlagen bzw. Komponenten<br />
für wasser-, luft- und kältemittelbasierte<br />
Wärmeträgersysteme mit den Installationsorten<br />
(Rack, DV-Raum, Gebäude) ergeben,<br />
um die im Server anfallende Wärmeleistung<br />
abzuführen. I. d. R. muss das<br />
System:<br />
• die Kriterien des Anforderungskatalogs,<br />
• die jeweiligen Anwendungsbedingungen<br />
und örtlichen Gegebenheiten<br />
sowie<br />
• die Anforderungen hinsichtlich der<br />
Ener gie- und Kosteneffizienz erfüllen.<br />
Für den Nachweis der Effizienz ist meist<br />
eine Berechnung des Jahresenergieverbrauchs<br />
und der jährlichen Energiekosten<br />
– auf der Grundlage der statistischen Jahresstunden<br />
für die Außentemperatur und<br />
unter Berücksichtigung der Abhängigkeit<br />
des Energie- sowie des Wasserverbrauchs<br />
von der Außentemperatur – zu erstellen.<br />
Die Kälteträgersysteme (Kaltwasser,<br />
Kühlwasser, indirekte freie Kühlung, direkte<br />
freie Kühlung, Kältemittel) werden<br />
in dem Kapitel Systemauswahl erläutert.<br />
Die Zielstellung der Norm bestand jedoch<br />
nicht darin, detaillierte Planungshinweise<br />
für das gewählte System zu erstellen.<br />
Hierfür wird auf separate Regelwerke verwiesen,<br />
z. B. auf die VDI-Richtlinie 6018<br />
für die Auswahl und die Dimensionierung<br />
der Kälteerzeugung sowie die Auswahl<br />
des Kältemittels, oder auf die VDI-<br />
Richtlinie 2047 Blatt 2, für die Auslegung<br />
von Verdunstungs- und Hybridkühleinrichtung.<br />
Luftführungssysteme<br />
im Rechenzentrum<br />
Die Luftführung im Rechenzentrum beeinflusst<br />
entscheidend die mögliche Wärmeabführung<br />
aus den Racks sowie die<br />
ener getische Effektivität der Anlage. Eine<br />
Übersicht über mögliche Luftführungssysteme<br />
wird in Tabelle 1 dargestellt. Diese<br />
angeführten Varianten werden jeweils<br />
auch auf Basis einer Prinzip-Darstellung<br />
(wie in Bild 3), in der Richtlinie mit Vorund<br />
Nachteilen beschrieben.<br />
Bild 2: Übersicht der typischen Systemkonstellationen nach [2].<br />
Im Kapitel „Luftführungssysteme“<br />
zeigt sich besonders der Fortschritt bezüglich<br />
effektiver Abführung von Wärmelasten<br />
aus Rechenzentren. In der Fassung<br />
von 1994 [1] wurde nur die Variante<br />
„Freie Strömung durch Doppelboden“ beschrieben.<br />
Dies spiegelt die damalige Praxis<br />
der unstrukturierten Aufstellung und<br />
Anordnung der Server/Racks wider. Die<br />
konsequente Ausrichtung der Server mit<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 17
Tabelle 1: Übersicht der Lüftungssysteme nach [2].<br />
Maximal<br />
erreichbare Kühllast<br />
Energetische<br />
Bewertung<br />
Ungeführte<br />
Lufteinbringung<br />
≤ 500 W/m 2<br />
≤ 2 kW/Rack<br />
Freie Strömung<br />
durch Doppelboden<br />
≤ 1000 W/m 2<br />
≤ 4 kW/Rack<br />
Offene Kalt-/<br />
Warmgangklimatisierung<br />
≤ 1500 W/m 2<br />
≤ 6 kW/Rack<br />
Kalt-/ Warmgangklimatisierung<br />
mit<br />
Einhausung<br />
< 4000 W/m 2<br />
< 12 kW/Rack<br />
Klimatisierung über<br />
wassergekühlte<br />
Racks<br />
(8…25) kW/Rack<br />
Schlecht Schlecht Gut Sehr gut Sehr gut<br />
Investition Gering Mittel Mittel Hoch Hoch<br />
Einsatzbereich (5…10) m 2<br />
Etagenpatchraum<br />
Mobilfunkbasisstation<br />
dezentraler Serverraum<br />
Bis 400 m 2<br />
Bestandsrechenzentrum<br />
dezentraler Serverraum<br />
Rechenzentrum<br />
dezentraler Serverraum<br />
Rechenzentrum<br />
Rechenzentrum<br />
dezentraler Serverraum<br />
Etagenpatchraum<br />
Zulufttemperatur Ca. (12…20) °C Ca. 16 °C Ca. 20 °C Ca. 24 °C Daten systemabhängig<br />
Ablufttemperatur 22 °C 22 °C 30 °C > 35 °C<br />
Temperaturdifferenz<br />
zwischen Abluft- und<br />
Zulufttemperatur<br />
(2…10) K Max. 6 K Max. 10 K > 10 K<br />
Bild: Beuth Verlag/VDI 2054<br />
Bild 3: Kalt-/Warmgangklimatisierung mit Doppelboden.<br />
der Lufteintrittsseite in einem Gang und<br />
der Luftaustrittsseite im anderen Gang<br />
(„Kalt-/Warmgangprinzip“) war noch<br />
nicht üblich.<br />
Doppelbodenausführung/-auslegung<br />
Aus energetischen und funktionellen<br />
Gründen wird der Doppelbodenauslegung<br />
ein separates Kapitel in der Richtlinie<br />
gewidmet. Die Praxis zeigt, dass<br />
bei der Luftverteilung über den Doppelboden<br />
häufig Probleme infolge falscher<br />
Dimensionierung auftreten. Die Zielstellung<br />
besteht darin, eine möglichst<br />
gleichmäßige Beaufschlagung der Lüftungsplatten,<br />
die im Kaltgang angeordnet<br />
sind und die Kaltluft für die Server<br />
einströmen lassen, zu erreichen. Dies<br />
wird erreicht, indem im Doppelboden ein<br />
entsprechend hoher Vordruck durch den<br />
Strömungswiderstand der Lüftungsplatten<br />
aufgebaut wird. In der VDI 2054 sind<br />
Auslegungsrichtwerte für die Geschwindigkeit<br />
und den Druckverlust im Doppelboden<br />
entsprechend Tabelle 2 empfohlen.<br />
Des Weiteren sind in der Norm Auslegungshilfen<br />
für die Berechnung des<br />
Druckverlustes sowie zur Berechnung<br />
der Geschwindigkeit im Doppelboden in<br />
Abhängigkeit von der Kühlleistung angeführt.<br />
Betriebssicherheit – Verfügbarkeitsklassen<br />
für Klima und Kälte<br />
Rechenzentren werden in der Regel durchgehend<br />
betrieben und stellen somit hohe<br />
Anforderungen an die Betriebssicherheit,<br />
die durch redundante Ausführung der Anlagen<br />
bzw. Komponenten erreicht wird.<br />
Bei der Planung von Rechenzentren hat<br />
insbesondere die geforderte Verfügbarkeit<br />
einen großen Einfluss auf Anlagenkonzeption,<br />
späteren Energie- und Medienverbrauch<br />
sowie Investitionskosten. In<br />
der Richtlinie werden, in Anlehnung an<br />
international verbreitete Definitionen,<br />
vier Verfügbarkeitsklassen (Klassen A,<br />
niedrigste Verfügbarkeit, bis D, höchste<br />
Verfügbarkeit) für Anlagen zur Klimatisierung<br />
von IT-Equipment festgelegt und<br />
die Merkmale sowie Anforderungen an<br />
die Anlagen der einzelnen Verfügbarkeitsklassen<br />
beschrieben. Die Klassifizierung<br />
basiert darauf, dass sich technische Komponenten<br />
hinsichtlich ihres Einflusses auf<br />
die Verfügbarkeit wie folgt unterscheiden<br />
lassen:<br />
• ausfallkritische Komponenten (z. B.<br />
Kälteerzeuger, Rückkühler, Umluftklimageräte,<br />
Pumpen, Antriebe, regelmäßig<br />
instandsetzungsbedürftige Armaturen)<br />
und<br />
Tabelle 2: Auslegungsrichtwerte für den Druckverlust von Doppelbodenplatten in Abhängigkeit<br />
der maximalen Luftgeschwindigkeit nach [2].<br />
Geschwindigkeit im Doppelboden<br />
mit maximalem<br />
Luftvolumenstrom in m/s<br />
Auslegungsdruckverlust<br />
der Lüftungsplatten in Pa<br />
Anmerkung<br />
1,0 6 Bevorzugter Auslegungsbereich<br />
2,0 8<br />
3,0 15<br />
4,0 25 Überschreitung der Geschwindigkeit<br />
von 3 m/s ist im Einzelfall zu<br />
5,0 37<br />
prüfen.<br />
6,0 51<br />
18 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
KÄLTE<br />
Datenverarbeitung<br />
• weniger ausfallkritische Komponenten<br />
(z.B. Rohrleitungen einschließlich<br />
Dämmungen, manuelle Absperrklappen).<br />
Ausgehend von der Systemausstattung<br />
führen die Verfügbarkeitsklassen in Verbindung<br />
mit der Komponenteneinteilung<br />
zur Betriebsweise (nicht redundant, redundant,<br />
parallel Betrieb etc.). So lassen<br />
sich die einzelnen Anlagenbetriebsweisen<br />
leichter ermitteln.<br />
In VDI 2054 werden darüber hinaus<br />
auch die Auswirkungen von Störungen<br />
sowie Wartung und Instandsetzung der<br />
technischen Komponenten auf die Klimatisierung<br />
des IT-Equipments detailliert beschrieben.<br />
Bild 4: Beispiel einer Kaltgangeinhausung mit Lufteinbringung über einen Doppelboden.<br />
Bild: Beuth Verlag/VDI 2054<br />
Planungsgrundlagen/<br />
Auslegungsparameter<br />
Ausgehend von der Definition der für das<br />
Rechenzentrum relevanten Temperaturen,<br />
wie Zulufttemperatur, DV-Eintrittsund<br />
DV-Austrittstemperatur und Ablufttemperatur,<br />
sind nachfolgende Grundlagen<br />
u.a. zu beachten:<br />
Die Lufteintrittstemperatur sollte aus<br />
energetischen Gründen möglichst hoch<br />
sein. Bei den heutigen Rechnertechnologien<br />
sind Eintrittstemperaturen im Bereich<br />
von 25 °C bis 30 °C möglich (Bild 4).<br />
Die Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit<br />
ergeben sich aus den Einsatzbedingungen<br />
für das IT-Equipment. Üblicherweise<br />
liegen die Grenzwerte für die<br />
minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit<br />
bei 20 % r. F. und 80 % r. F. Damit<br />
ist der Toleranzbereich wesentlich größer,<br />
als in der ersten Fassung der Richtlinie<br />
(mit Grenzwerten von 30 % r. F. sowie 68 %<br />
r. F.). Es ergeben sich somit höhere Einsparmöglichkeiten,<br />
wenn die Luftfeuchtigkeit<br />
variabel nach den Kriterien eines wirtschaftlichen<br />
Betriebs geregelt wird.<br />
Konkrete Anforderungen an den<br />
Schalldruckpegel im Rechnerraum sind<br />
im Gegensatz zur Vorgänger-Richtlinie<br />
nicht mehr angeführt. Dies hat u. a. zum<br />
Hintergrund, das in modernen Rechenzentren<br />
mit hoher Leistungsdichte die<br />
Schallemission der Rechentechnik in der<br />
Regel wesentlich größer als die Schallemission<br />
der Klimageräte ist.<br />
Neben verschiedenen Möglichkeiten<br />
zur Berechnung der IT-Wärmebelastung<br />
bietet die VDI 2054 auch Berechnungsgrundlagen<br />
zur Bestimmung der Gesamtkühllast<br />
und des Kühlluftvolumenstroms.<br />
Regelkonzepte<br />
Beispiele für Regelkonzepte von Klimageräten<br />
sind in der Anlage C der Richtlinie<br />
aufgeführt. Es wird dabei prinzipiell unterschieden<br />
zwischen den Ausführungsvarianten<br />
„mit“ und „ohne“ Kaltgang-Einhausung.<br />
Dazu ein Beispiel der Variante A2 – „Regelkonzept<br />
zur Leistungsregulierung der<br />
Umluftklimageräte, ohne Kaltgang-Einhausung,<br />
Regelgröße Lufttemperaturdifferenz:<br />
Zusätzlich zur Ablufttemperatur wird<br />
die Zulufttemperatur auf einen vorgegebenen<br />
Sollwert geregelt. (Dieses Konzept<br />
entspricht einer ∆T = konst.-Regelung).<br />
Die Einhaltung der Zulufttemperatur geschieht<br />
durch Stellen des Kaltwasserregelventils,<br />
während zur Einhaltung der Ablufttemperatur<br />
die Drehzahl des Ventilators<br />
angepasst wird (Bild 5).<br />
Literatur:<br />
[1] VDI 2054:1994-09 „Raumlufttechnische Anlagen<br />
für Datenverarbeitung“ (mit Überprüfung<br />
vom Januar 2000), Beuth Verlag<br />
[2] VDI 2054:2019-08 „Raumlufttechnik – Datenverarbeitung<br />
(VDI-Lüftungsregeln)“, Beuth<br />
Verlag<br />
Autor: Dr.-Ing. Jürgen Zschernig, Projektleiter<br />
bei dc-ce RZ-Beratung in Frankfurt am Main und<br />
Mitglied des VDI-Richtlinienausschusses VDI 2054<br />
Bild 5: Beispiel „Regelkonzept zur Leistungsregulierung der Umluftklimageräte, ohne<br />
Kaltgang-Einhausung, Regelgröße Lufttemperaturdifferenz.<br />
Bild: Beuth Verlag/VDI 2054<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 19
KÄLTE<br />
Kältemittel<br />
Kaltwassersysteme bieten flexible<br />
Einsatzmöglichkeiten<br />
Situation zur F-Gas-Verordnung, Einsatzkriterien für Kaltwassersysteme<br />
Die fortschreitende Verschärfung der F-Gas-Verordnung stellt die Klimabranche vor einige Herausforderungen. So zwingt das Phase-<br />
Down-Szenario beispielsweise die Hersteller von Kälte- und Klimaanlagen neue Kältemittel einzusetzen. Ebenso sind Fachplanungsund<br />
Handwerksunternehmen betroffen, die sich z. B. mit der Frage beschäftigen müssen, ob die heute installierten Anlagen sich auch<br />
in einigen Jahren noch problemlos betreiben lassen. Somit ist das Interesse aller Beteiligten an zukunftssicheren Technologien groß.<br />
Unter diesem Aspekt bieten z. B. Kaltwassersysteme verschiedene Vorteile, die nachfolgend neben der Situation zur F-Gas-Verordnung<br />
aufgezeigt werden.<br />
Um die Erderwärmung durch fluorhaltige<br />
Kältemittel (sogenannte F-Gase) zu<br />
reduzieren, hat die Europäische Union<br />
die Verordnung 517/2014, besser bekannt<br />
als F-Gas-Verordnung, erlassen.<br />
Durch die Verordnung sollen die Emissionen<br />
des Industriesektors bis zum Jahr<br />
2030 um 70 % gegenüber 1990 reduziert<br />
werden. Dies soll durch drei Ansätze geschehen.<br />
Eine zentrale Rolle spielt dabei<br />
die schrittweise Beschränkung (Phase-<br />
Down) der am Markt verfügbaren Mengen<br />
an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen<br />
(HFKW) bis zum Jahr 2030 auf ein Fünftel<br />
der heutigen Verkaufsmengen. Die beiden<br />
anderen Maßnahmen sind zum einen<br />
der Erlass von Verwendungs- und Inverkehrbringungsverboten,<br />
wenn technisch<br />
machbare, klimafreundlichere Alternativen<br />
vorhanden sind, sowie zum anderen<br />
die Beibehaltung und Ergänzung der Regelungen<br />
zu Dichtheitsprüfungen, Zertifizierung,<br />
Entsorgung und Kennzeichnung.<br />
Ausschlaggebender Maßstab für die<br />
Einordnung eines F-Gases ist dessen relatives<br />
Treibhauspotenzial, das mit dem<br />
englischsprachigen Ausdruck „global warming<br />
potential“ (GWP) bezeichnet wird. Der<br />
GWP-Wert gibt die Auswirkungen auf den<br />
Treibhauseffekt einer bestimmten, in die<br />
Atmosphäre emittierten Menge des jeweiligen<br />
Gases im Vergleich zur gleichen Menge<br />
CO 2 an. Kohlendioxid hat dabei laut Definition<br />
bei 100 Jahren Zeithorizont das<br />
relative Treibhauspotenzial 1. Für beispielsweise<br />
Methan beträgt der GWP-Wert 23, das<br />
bedeutet, dass 1 kg Methan in 100 Jahren<br />
23-mal stärker zum Treibhauseffekt beiträgt,<br />
als 1 kg CO 2 . Deutlich höher liegen die<br />
Werte bei nicht natürlichen Kältemitteln.<br />
So hat das früher gebräuchliche R404A einen<br />
GWP-Wert von 3922 und das heute vielfach<br />
in Wärmepumpen und Kaltwassererzeugern<br />
verwendete R410A den Wert 2088.<br />
Die verschärften Vorschriften führen<br />
dazu, dass – wie von der EU beabsich tigt<br />
– etablierte Kältemittel mit vergleichsweise<br />
hohem GWP nach und nach vom<br />
Markt verdrängt werden. Als erstes von<br />
den Neuerungen betroffen war die Kältebranche.<br />
R404A, das z. B. zur Produktkühlung<br />
in Supermärkten eingesetzt wurde,<br />
war nach Einführung der Verschärfung<br />
relativ schnell zum Teil nur noch schwer<br />
verfügbar. Danach folgten weitere Stufen,<br />
die nun weitere Kältemittel betreffen,<br />
z. B. R410A, das u. a. in der Klimaindustrie<br />
in Einsatz ist. Auch in diesem Bereich<br />
hat sich das Phase-Down-Szenario<br />
direkt in einer deutlichen Preissteigerung<br />
für das Kältemittel bemerkbar gemacht,<br />
hier zum Teil von über 400 %, im Vergleich<br />
zur Zeit vor der F-Gas-Verordnung. „Si -<br />
Mit dem Phase-Down-<br />
Szenario beabsichtigt<br />
die EU die schrittweise<br />
Verdrängung<br />
und Reduzierung<br />
von Kältemitteln mit<br />
hohem GWP.<br />
20 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
KÄLTE<br />
Kältemittel<br />
In Kaltwassererzeugern befindet sich das Kältemittel nur in einem kleinen Kreislauf im Gerät.<br />
cherlich wird hier die Verfügbarkeit noch<br />
über die nächsten Jahre gegeben sein, weil<br />
es in der Branche sehr gebräuchlich ist.<br />
Aber die Preise werden weiter drastisch<br />
steigen. Deswegen müssen die Hersteller<br />
reagieren und nach alternativen Kältemitteln<br />
mit einem niedrigeren GWP suchen“,<br />
erläutert Dennis Peters, Leiter Produktmanagement<br />
bei der Kampmann GmbH.<br />
Auswirkungen der F-Gas-Verordnung<br />
beschäftigen alle Beteiligten<br />
Die Umstellung der Anlagen auf neue Kältemittel<br />
mit niedrigerem relativen Treibhauspotenzial<br />
wird jedoch durch die Tatsache<br />
erschwert, dass Kältemittel mit<br />
einem GWP unter 1000 fast immer auch<br />
mit Nachteilen verbunden sind, z. B. wenn<br />
sie brennbar, giftig oder toxisch sind. Weil<br />
Kältemittel mit letzteren Eigenschaften<br />
aufgrund höherer Gefahr für Personen<br />
nicht für Klimageräte infrage kommen,<br />
werden Substanzen eingesetzt, die als<br />
schwer entflammbar gelten, wie R32. Mit<br />
einem GWP von 675 entspricht das relative<br />
Treibhauspotenzial dieses Kältemittels<br />
nur etwa einem Drittel im Vergleich<br />
zu R410a. Hinzu kommen weitere Vorteile<br />
wie die rund 20 % höhere volumetrische<br />
Kälteleistung gegenüber R410A sowie ein<br />
etwa 4,4 % höherer theoretischer COP<br />
(Coeffizient of Performance), sodass R32<br />
derzeit zunehmend zum Einsatz kommt.<br />
„Auch in Kaltwassererzeugern ist R32<br />
eine gute Alternative, da bei diesen Systemen<br />
kein Kältemittel im Gebäudeinneren<br />
nötig ist und daher die Brennbarkeit nur<br />
eine untergeordnete Rolle spielt. Anders<br />
sieht es bei Direktverdampfungssystemen<br />
aus. Für den Einsatz brennbarer Kältemittel<br />
im Personenaufenthaltsbereich gibt es<br />
besondere Auflagen, die beachtet werden<br />
müssen, damit es in geschlossenen Räumen<br />
nicht zu einer Atmosphäre kommen<br />
könnte, in der sich das Kältemittel entzündet.<br />
Mit Kaltwassersystemen ist man hingegen<br />
immer auf der sicheren Seite“, betont<br />
Peters.<br />
Während für die Hersteller also die Suche<br />
nach alternativen Kältemitteln im Fokus<br />
steht, beschäftigt das Thema F-Gas-<br />
Verordnung Fachplaner und -handwerker<br />
u. a. im Hinblick auf die Aspekte Reparatur<br />
und Gewährleistung. Sorge bereitet ihnen<br />
vor allem das mögliche Szenario, dass sie<br />
haften müssen, wenn einige Jahre nach der<br />
Installation eine Anlage stillgelegt werden<br />
muss, aufgrund eines eventuellen Verbots<br />
oder mangelnder Verfügbarkeit des eingesetzten<br />
Kältemittels. „Dazu gibt es bislang<br />
zwar noch keine klare Rechtslage, jedoch<br />
besteht nach Aussage verschiedener Experten<br />
tatsächlich die Möglichkeit, dass Richter<br />
die Haftung bei Kältefachbetrieben oder<br />
Planungsbüros sehen und diese somit für<br />
den Schaden aufkommen müssten“, so Peters<br />
und weiter: „Dieses Risiko gilt es durch<br />
eine vorausschauende Planung zu vermeiden,<br />
da dem finanziellen Schaden für die<br />
Betriebe auch der Image- bzw. Vertrauensverlust<br />
hinzukäme.“<br />
Kaltwassersysteme<br />
Neben dem bereits erwähnten Aspekt,<br />
dass bei Kaltwassersystemen sich i. d. R.<br />
kein Kältemittel in gefährdeten Bereichen<br />
befindet, bieten die Systeme weitere Vorteile.<br />
So sind die Auswirkungen möglicher<br />
Szenarien wie eine weitere Verschärfung<br />
der F-Gas-Verordnung oder Verbote bzw.<br />
die mangelnde Verfügbarkeit von Kältemitteln<br />
geringer. Sollte aus diesen Gründen<br />
das Ersetzen des Kältemittels erforderlich<br />
sein, so ist dies bei Kaltwassererzeugern<br />
auf den kleinen Kreislauf im<br />
Gerät begrenzt. Bei Anlagen, bei denen<br />
sich das Kältemittel auch im gesamten<br />
Rohrleitungssystem sowie in den Innengeräten<br />
befindet, ist eine Umrüstung dagegen<br />
nur schwerer realisierbar. „Bereits<br />
in der Vergangenheit kam es bei gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Umstellungen von Kältemitteln<br />
in Klimaanlagen häufig zu der<br />
Situation, dass das gesamte Rohrleitungssystem<br />
und die Innen- sowie Außeneinheiten<br />
komplett getauscht werden mussten“,<br />
schildert Peters.<br />
„Tatsächlich haben wir festgestellt, dass<br />
Kaltwassersysteme wieder stärker in den<br />
Fokus der Kunden rücken, nachdem in den<br />
vergangenen Jahren der Markt für VRF-Anlagen<br />
stetig gewachsen ist“, so Peters weiter.<br />
Einen weiteren Grund für das Interesse<br />
sieht der Produktmanager auch in der Anlagenfunktion:<br />
„Kaltwassererzeuger wie die<br />
‚KaClima‘-Geräte von Kampmann können<br />
sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen<br />
eingesetzt werden. Zusätzlich zeichnet sich<br />
die Lösung durch ihre einfache und damit<br />
schnelle Montage aus. Alle grundsätzlichen<br />
Einstellungen sind werksseitig programmiert,<br />
weitere individuelle Anpassungen<br />
sind vor Ort möglich“, ergänzt Peters.<br />
Bei Einsatz eines Kaltwassererzeugers bietet<br />
sich der Vorteil, dass sich in gefährdeten<br />
Bereichen kein Kältemittel befindet, da im<br />
Gebäudeinneren die Energie mittels Wasser<br />
übertragen wird.<br />
Das Unternehmen aus Lingen unterstützt<br />
Betriebe dabei sowohl durch einen<br />
Inbetriebnahme-Service als auch durch<br />
passendes Zubehör wie eine „Hydraulikbox“,<br />
die Komponenten für eine Trennung<br />
des primären vom sekundären Kreislauf<br />
beinhaltet.<br />
Bilder: Kampmann<br />
www.kampmann.de<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 21
KÄLTE<br />
Erzeugung<br />
Kühlen mit Verdunstungskälte<br />
Die adiabate Kühlung kann eine Alternative zu Kompressionskälteanlagen sein.<br />
Ökologische und ökonomische Gründe sprechen dafür<br />
Zur Bereitstellung von Kälte für die Raumklimatisierung dienen überwiegend elektrisch betriebene Kompressionskälteanlagen. Deren<br />
Einsatz ist aber mit hohen Energiekosten und CO 2 -Emissionen verbunden. Eine Alternative sind adiabate Kühlsysteme. Wir stellen die<br />
Technik, ihre Einsatzfelder und -grenzen vor.<br />
Bild: SEW Systemtechnik für Energierecycling und Wärmeflussbegrenzung GmbH<br />
Vor allem im Nichtwohnbereich, etwa in<br />
Bürogebäuden, Krankenhäusern oder Produktionshallen,<br />
können mittels adiabater<br />
Kühlung Energie und damit CO 2 -Emissionen<br />
eingespart werden. Das Prinzip ist<br />
simpel: Wasser wird verdunstet, dabei<br />
entsteht „Verdunstungskälte“. In der Klimatechnik<br />
wird die adiabate Kühlung so<br />
eingesetzt, dass der Luftstrom in einem<br />
raumlufttechnischen Gerät befeuchtet<br />
und damit abgekühlt wird. Nicht mit Wasser<br />
gesättigte Luft wird mit jedem Gramm<br />
Wasser, mit dem die Luft befeuchtet wird,<br />
um ca. 2,5 °C abgekühlt.<br />
Es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten<br />
der Anwendung in raumlufttechnischen(RLT)-Anlagen:<br />
1. Zuluftbefeuchtung<br />
Bei der Zuluftbefeuchtung wird Außenluft<br />
über einen Befeuchter geleitet und dabei<br />
abgekühlt. Dabei muss beachtet werden,<br />
dass die Luft nicht beliebig stark befeuchtet<br />
werden kann, sondern vielmehr<br />
innerhalb des Behaglichkeitsbereiches liegen<br />
sollte. Dieser liegt für normale Raumtemperaturen<br />
zwischen 20 und 22 °C bei<br />
30 bis 65 % relativer Feuchte. Steigt die<br />
Raumtemperatur bis 26 °C, sollte die relative<br />
Feuchte 55 % nicht übersteigen. Die Erzeugung<br />
von Luftzuständen, die innerhalb<br />
des Behaglichkeitsbereiches liegen, ist nur<br />
bei sehr trockenen, in Mitteleuropa eher<br />
selten anzutreffenden Außenluftzuständen<br />
möglich. Aus diesem Grund ist die direkte<br />
Zuluftbefeuchtung für die praktische<br />
Anwendung der adiabaten Kühlung in der<br />
Klimatechnik nur bedingt geeignet.<br />
2. Abluftbefeuchtung mit<br />
Wärmerückgewinnung<br />
Bei der Abluftbefeuchtung mit Wärmerückgewinnung<br />
(WRG) wird die Abluft zunächst<br />
befeuchtet und dadurch abgekühlt.<br />
Je nach Befeuchtertyp sind relative Feuchten<br />
bis zu 100 % möglich. Die abgekühlte<br />
Bild 1: Prinzip der<br />
adiabaten Kühlung<br />
in einem Kreislauf-<br />
Verbund-System mit<br />
integrierter Nacherwärmung<br />
und<br />
Nachkühlung.<br />
Abluft wird über ein WRG-System geleitet,<br />
der Zuluftstrom dadurch abgekühlt.<br />
Bei den verwendeten WRG-Systemen<br />
sollte beachtet werden, dass nur stoffdichte<br />
Systeme, in der Regel Plattenwärmeübertrager<br />
oder Kreislauf-Verbund-Systeme<br />
(KVS), zum Einsatz kommen, da sonst die<br />
Zuluftfeuchte durch die Übertragung der<br />
Feuchte aus der Abluft zu stark erhöht wird.<br />
KVS haben den Vorteil, dass sie bei der<br />
räumlichen Trennung der Zu- und Abluftwege<br />
sowie auch für die Nachrüstung in<br />
bestehenden Klima- und Lüftungsanlagen<br />
eingesetzt werden können (Bild 1). Beim<br />
Einsatz von Hochleistungswärmeübertragern<br />
und -befeuchtern, die zu einer Übersättigung<br />
der Abluft führen, sind Abkühlungen<br />
der Außenluft zwischen 10 und<br />
12 K (Kelvin) möglich.<br />
Die adiabate Kühlung in Kombination<br />
mit Plattenwärmeübertragern setzt<br />
eine räumliche Nähe der Zu- und Abluft<br />
voraus. Hier gibt es die einfache Variante<br />
in der Kombination von Kreuzstromwärmeübertrager<br />
mit vorheriger Befeuchtung<br />
der Abluft. Bei diesem System wird eine<br />
Abkühlung der Zuluft bis zu 6 K erreicht.<br />
Eine effizientere Variante ist der Einsatz<br />
von Doppelplatten- bzw. Gegenstromwärmeübertragern<br />
mit integrierter Befeuchtung<br />
der Abluft (Bild 2). Bei diesem System<br />
erfolgen die Kühlung und Wärmeübertragung<br />
gleichzeitig in einem Bauteil.<br />
Das Wasser für die Verdunstungskühlung<br />
wird direkt in den Wärmeübertrager<br />
eingespritzt. Die Abluft wird hierdurch<br />
übersättigt, was zu einer Leistungssteigerung<br />
gegenüber dem getrennten Prozess<br />
von ca. 40 % führt und es werden Abkühlungen<br />
der Zuluft bis zu 12 K erreicht. Dieses<br />
Prinzip wird im h-x-Diagramm (Bild 3)<br />
verdeutlicht.<br />
22 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
KÄLTE<br />
Erzeugung<br />
Bild: Menerga GmbH<br />
Bild 2: Adiabater Kühlprozess mit direkter<br />
Wassereinspritzung und Gegenstrom-<br />
Wärmeübertrager.<br />
Bild: EnergieAgentur.NRW<br />
Bild 3: Adiabater Kühlprozess über WRG-System, Darstellung im h-x-Diagramm: Prozess 1 (blau): adiabate Befeuchtung und Abkühlung der Abluft;<br />
Prozess 2 (rot): Erwärmung der Abluft durch das WRG-System zur Fortluft; Prozess 2 (grün): Abkühlung der Außenluft durch das WRG-System zur<br />
Zuluft.<br />
3. Zuluftbefeuchtung mit<br />
vorgeschalteter Lufttrocknung<br />
Bei der Zuluftbefeuchtung hat man mit<br />
dem Problem der zu hohen Zuluftfeuchte<br />
zu tun, umgekehrt ist zudem die Wasseraufnahmefähigkeit<br />
der Außenluft<br />
bzw. der Abluft oft begrenzt, was den gewünschten<br />
Kühleffekt nur unzureichend<br />
gewährleistet. Dieses Problem wird umgangen,<br />
indem die Luft vor dem Eintritt<br />
in den Befeuchter aktiv getrocknet wird.<br />
Diese Art der Luftführung, d. h. die Trocknung<br />
und anschließende Befeuchtung des<br />
Luftstromes, wird unter dem Begriff DEC<br />
(desiccand evaporative cooling) beschrieben.<br />
Die Luftentfeuchtung erfolgt über<br />
hygroskopische Medien, z. B. Zeolithe,<br />
Salze und Silikate, die auf einer Matrixstruktur<br />
aufgebracht werden (Sorptionskörper).<br />
Diese Medien entziehen den in<br />
der Luft enthaltenen Wasserdampf (Adsorption)<br />
und speichern ihn. Lufttrocknung<br />
ist thermodynamisch die Umkehrung<br />
des Befeuchtungsprozesses, d. h. es<br />
kommt bei der Entfeuchtung zur Erwärmung<br />
der Luft. Diese Temperaturerhöhung<br />
muss wieder rückgekühlt werden.<br />
Das kann aufgrund der hohen Temperaturen<br />
in den meisten Fällen sehr leicht mit<br />
Außen- oder Fortluft erfolgen. Nach der<br />
Rückkühlung wird der Zuluftstrom, wie<br />
bereits zuvor beschrieben, so lange adia-<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 23
KÄLTE<br />
Erzeugung<br />
Bild: Klingenburg GmbH, Zahlen von EnergieAgentur.NRW eingefügt<br />
Bild: Klingenburg GmbH, Zahlen von EnergieAgentur.NRW eingefügt<br />
Bild 4: Beispiel einer Systemlösung.<br />
bat befeuchtet, bis der gewünschte Luftzustand<br />
bezüglich relativer Feuchte und<br />
Temperatur erreicht ist.<br />
Die Trocknungsmedien müssen auch<br />
wieder regeneriert (d. h. desorbiert) werden.<br />
Die Desorption erfolgt durch Aufheizen<br />
der Sorptionskörper, sodass das gespeicherte<br />
Wasser ausgetrieben wird. Die<br />
Desorptionstemperatur hängt stark vom<br />
verwendeten Sorptionsmittel ab und bewegt<br />
sich zwischen ca. 50 und mehreren<br />
100 °C. Für die Klimatechnik bieten sich<br />
primär Sorptionsmedien mit geringen Regenerationstemperaturen<br />
an. Es kann z.B.<br />
mit Abwärme aus Blockheizkraftwerken,<br />
solarthermisch erzeugter Wärme oder<br />
Fernwärme, die in den Sommermonaten<br />
oft preisgünstig ist, regeneriert werden.<br />
In den Bildern 4 und 5 wird dieser Prozess<br />
verdeutlicht: Die Außenluft mit 32 °C<br />
und 40 % relativer Feuchte (1) wird über<br />
den Sorptionsregenerator entfeuchtet, dabei<br />
allerdings auch erwärmt (2). Die Wärme<br />
wird der Luft im Wärmeregenerator<br />
Bild 5: Auslegungszustand<br />
Sommer,<br />
Darstellung in h-x-<br />
Diagramm.<br />
wieder entzogen (3) und im Verdunstungskühler<br />
(Befeuchter) wird die gewünschte<br />
Zuluftkondition eingestellt (4). Damit<br />
dieser ganze Prozess auch funktioniert,<br />
muss die Abluft mit in den Prozess eingebunden<br />
werden. Dieser Prozess kann<br />
in den Bildern 6 und 7 ebenfalls verfolgt<br />
werden, deshalb soll darauf nicht näher<br />
eingegangen werden.<br />
4. Zuluftrückführung und<br />
Befeuchtung im Gegenstromprinzip<br />
Bei diesem Prinzip wird ein Teil der bereits<br />
im Wärmeübertrager gekühlten Luft<br />
wieder zurückgeführt. Dieser Luftstrom<br />
wird im Wärmeübertrager befeuchtet, sodass<br />
er sich abkühlt. Dabei kühlt sich die<br />
warme Außenluft ab. Nach einer Startphase<br />
stellt sich ein stabiles System ein und<br />
es sind Abkühlungen der Außen-/Zuluft<br />
bis zu 10 K möglich. Im Folgenden wird<br />
der Prozess erläutert und in den Bildern<br />
6 und 7 verdeutlicht:<br />
Die Außenluft (1) wird auf der Primärseite<br />
des Wärmeübertragers von 32 °C,<br />
40 % relativer Feuchte auf 23 °C, 70 % relativer<br />
Feuchte gekühlt (2) und 2/3 der<br />
Außenluft wird als Zuluft in den Raum<br />
gebracht (3). 1/3 der Zuluft wird als Prozessluft<br />
(4) über die Sekundärseite des<br />
Wärmeübertragers geführt und befeuchtet.<br />
Da der Luftstrom auf der Sekundärseite<br />
nur 1/3 des Luftstroms auf der Primärseite<br />
beträgt, ist die Enthalpiedifferenz<br />
hier drei Mal so groß. Die Prozessluft hat<br />
28 °C, 90 % relative Feuchte bei Austritt aus<br />
dem Wärmeübertrager (5). Die Abluft wird<br />
über einen Bypass geführt und vermischt<br />
sich mit der Prozessluft (6). Die Abluft hat<br />
die zweifache Menge der Prozessluft, sodass<br />
sich ein Mischpunkt von 27 °C, 64 %<br />
relativer Feuchte ergibt. Die vermisch ten<br />
Luftströme werden dann Fortluft.<br />
Betriebskosten im Vergleich –<br />
ein Rechenbeispiel<br />
Die adiabate Kühlung ist allerdings sehr<br />
von den Feuchtezuständen der Außenund<br />
damit auch indirekt der Abluft abhängig.<br />
An sehr schwül-warmen Sommertagen<br />
kann die gewünschte Kälteleistung<br />
von der adiabaten Kühlung oft nicht erbracht<br />
werden. Diese Wetterzustände sind<br />
allerdings im mitteleuropäischen Raum<br />
24 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
KÄLTE<br />
Erzeugung<br />
selten anzutreffen. Daher kann die Systemtechnik<br />
hierzulande durchaus als Alternative<br />
zur elektrisch betriebenen Kompressionskälteanlage<br />
angesehen werden.<br />
Nicht zuletzt sprechen auch die bereits erwähnten<br />
Energieeinsparungen dafür. Ein<br />
Rechenbeispiel soll das verdeutlichen:<br />
Es soll ein Luftvolumenstrom von 10 000<br />
m³/h mit 32 °C und 40 % relativer Feuchte<br />
um 10 °C abgekühlt werden. Bei der konventionellen<br />
Kühlung mittels Kompressionskälteanlage<br />
wird hierfür eine Kälteleistung<br />
von ca. 35 kW benötigt. Wenn die Kälteanlage<br />
eine COP von 5 ausweist, werden<br />
ca. 7 kW elektrischer Leistung benötigt. Bei<br />
einem Strompreis von 0,25 Euro/kWh ergibt<br />
das Kosten von 1,75 Euro pro Stunde.<br />
Bei der adiabaten Kühlung werden für<br />
die gleiche Kälteleistung ca. 50 l Wasser<br />
benötigt und ca. 1 kW elektrische Pumpenleistung.<br />
Die kWh Strom kostet 0,25<br />
Euro pro Stunde und das Wasser 0,1 Euro<br />
pro Stunde, bei Wasserkosten von 2 Euro<br />
pro m³. (Da das Wasser verdunstet, braucht<br />
hierfür keine Abwassergebühr entrichtet<br />
werden.) Das ergibt zusammen Kosten in<br />
Höhe von 0,35 Euro pro Stunde, was einer<br />
Einsparung von 80 % entspricht.<br />
Bild 6: Adiabater Kühlprozess bei der Zuluftrückführung mit Befeuchtung im Gegenstromprinzip.<br />
Bild: Kampmann GmbH, Zahlen von EnergieAgentur.NRW eingefügt<br />
Bild: Kampmann GmbH<br />
Schlussbetrachtung<br />
Der große Vorteil der adiabaten Kühlung<br />
liegt in der Reduzierung der Betriebskosten.<br />
Betrachtet man die Gesamtkosten<br />
(Investition + Betriebs- und Wartungskosten),<br />
so können durch eine adiabate Kühlung<br />
die Kosten für die Klimatisierung bis<br />
auf ein Drittel der Kosten durch Kompressionskältemaschinen<br />
gesenkt werden.<br />
Die Abkühlung der Außenluft beträgt bis<br />
zu 12 °C. Damit können zwar bei hohen<br />
Außentemperaturen die Raumtemperaturen<br />
nicht immer auf den idealen Werten<br />
gehalten werden, aber der empfohlene<br />
Temperaturunterschied zwischen Außentemperatur<br />
und Raumtemperatur von<br />
6 °C ist in der Regel realisierbar. Werden<br />
feste Raumkonditionen verlangt, kann zusätzlich<br />
noch eine Kompressionskälteanlage<br />
mit integriert werden, die dann bei<br />
sehr hohen Außentemperaturen die adiabate<br />
Kühlung unterstützt.<br />
Autor: Dipl.-Ing./MBA Matthias Kabus,<br />
Senior-Berater bei der EnergieAgentur.NRW<br />
Bild 7: Adiabater Kühlprozess bei der Zuluftrückführung mit<br />
Befeuchtung im Gegenstromprinzip, Darstellung im h-x-Diagramm.<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 25
REPORTAGE<br />
Dezentrale Lüftungsgeräte<br />
Der 6800 m 2 große „Snake“-Komplex in Köln<br />
musste an die besonderen Anforderungen für<br />
Schulräume angepasst werden.<br />
Gute Luft<br />
in Kölner Gesamtschule<br />
Frische Lernatmosphäre dank 28 dezentraler Lüftungsgeräte im Gebäudekomplex „Snake“<br />
Schluss mit Lernen im Container. Schüler und Lehrkräfte der städtischen Gesamtschule am Wasseramselweg in Köln sind zum Schuljahr<br />
2019/<strong>2020</strong> endlich in neue Räumlichkeiten im Gebäudekomplex Snake eingezogen. Das Gebäude beherbergt seit Ende August die<br />
Klassen fünf bis zehn der neuen sechszügigen Gesamtschule. Eine freie Fensterlüftung war aufgrund der nahen Bahntrasse und des<br />
damit verbundenen Verkehrslärms nicht möglich. Außerdem entspricht diese Art der Lüftung durch eine immer luftdichter werdende<br />
Gebäudehülle nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Um den erforderlichen Mindestluftwechsel sicherzustellen, sollte ein<br />
ausgeklügeltes Belüftungssystem eingebaut werden. Dieses wurde mit insgesamt 28 dezentralen Lüftungsgeräten des Lüftungsspezialisten<br />
Airflow Lufttechnik realisiert. Mit dem Ziel, Lernende und Lehrende jederzeit mit ausreichender frischer Luft zu versorgen.<br />
Zudem ist diese Art der Belüftung wesentlich energie- und damit kostensparender, weil Wärmeverluste vermieden werden.<br />
Der geschwungene Gebäudekörper mit<br />
markanter Klinkerfassade legt schon<br />
bei ersten Assoziationen den Namen des<br />
Gebäudes nahe: „Snake“. Die Architektur<br />
des dreigeschossigen Gebäudes stammt<br />
vom Kölner Architekten Bernhard Trübenbach<br />
in Kooperation mit Claudia Kister.<br />
Das 6800 m 2 große Neubauprojekt im<br />
Kölner Stadtteil Vogelsang ist ein moderner<br />
Gebäudekomplex, der vor allem<br />
für Büroräume ausgelegt ist. Ab 2024 soll<br />
„Snake“ auch als Bürogebäude genutzt<br />
werden. In der Zwischenzeit nutzt die<br />
Stadt Köln das Gebäude ab dem Schuljahr<br />
2019/<strong>2020</strong> für fünf Jahre als Inte<br />
26 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
REPORTAGE<br />
Dezentrale Lüftungsgeräte<br />
rimsgebäude für die neue Gesamtschule<br />
am Wasseramselweg.<br />
Eine Interimsnutzung von „Snake“ als<br />
Schule ist möglich, weil das Gebäude von<br />
Anfang an für eine multifunktionale Nutzung<br />
konzipiert war. „Flächen für Unternehmen<br />
müssen heute immer flexibler gestaltet<br />
werden und Raum für die unterschiedlichsten<br />
Nutzungen und Arbeitsformen bieten.<br />
Deshalb haben wir ,Snake‘ multifunktional<br />
konzipiert. Dass wir ,Snake‘ in Nachbarschaft<br />
des von der Stadt Köln geplanten<br />
endgültigen Neubaus einer Gesamtschule<br />
in Vorbereitung hatten, ist ein glücklicher<br />
Zufall“, sagt Bauherr Anton Bausinger, Geschäftsführender<br />
Gesellschafter der Bauunternehmung<br />
Friedrich Wassermann.<br />
Der als Bürogebäude geplante Komplex<br />
musste im Vorfeld an die Anforderungen<br />
der Schule angepasst werden. Neben Planung<br />
und Neuaufteilung der Räumlichkeiten<br />
war ein neues, ausgefeiltes Belüftungssystem<br />
gefordert, das die Luftzufuhr<br />
für 1000 Schüler gewährleistet. Für die Realisierung<br />
blieben eineinhalb Jahre. Zum<br />
Einsatz kamen Lüftungsgeräte der Airflow<br />
Lufttechnik GmbH.<br />
Gutes Klima für gute Leistungen<br />
Bei der Planung waren einige Herausforderungen<br />
zu meistern. So sollte ein perfektes<br />
Umfeld für Schüler und Lehrer<br />
Die Airflow-Lüftungsgeräte der „DUPLEX Vent<br />
Serie“ wurden an den Decken der jeweiligen<br />
Räumlichkeiten angebracht.<br />
geschaffen werden. Frische Luft ist ein<br />
Faktor für konzentriertes Arbeiten und<br />
damit auch Erfolg in der Schule. Studien<br />
belegen, dass ein zu hoher CO 2 Gehalt bei<br />
Schülern und Lehrern zu Konzentrationsschwächen,<br />
verminderter Leistungsfähigkeit,<br />
Müdigkeit, Kopfschmerzen und weiteren<br />
Symptomen führen kann. In einem<br />
Klassenraum ist kurz nach Unterrichtsbeginn<br />
die Luft verbraucht, der CO 2 Wert<br />
erreicht kritische Werte. Stoßlüften reicht<br />
nicht aus, um die Luftqualität zu verbessern<br />
und wird darüber hinaus ohnehin<br />
oft vergessen. Eine kontrollierte Lüftung<br />
mit Wärmerückgewinnung aber ist Vorsorge<br />
in die Gesundheit, schont den Geldbeutel<br />
und auch die Umwelt.<br />
Fensterbänder ermöglichen zwar ein<br />
Arbeiten und Lernen in lichtdurchfluteten<br />
Räumen, die dadurch im Sommer<br />
aber auch sehr warm werden. „Neben<br />
den Klassenräumen mussten zudem<br />
Küche, Mensa und Foyer eingeplant und<br />
ebenfalls mit Lüftungsgeräten ausgestattet<br />
werden“, sagt Anne Tangermann,<br />
Dipl.Ingenieurin für Versorgungstechnik<br />
und Projektleiterin für „Snake“ bei<br />
Peter Zeiler und Partner Ingenieurgesellschaft.<br />
Ein weiterer Aspekt: Aufgrund der<br />
knapp bemessenen Zeitspanne zur Planung<br />
und Realisierung wurde ein Anbieter<br />
für Lüftungsgeräte gesucht, der die gewünschten<br />
Geräte auch termingerecht liefern<br />
konnte. Im Beratungsgespräch zeigte<br />
Udo Rausch, zuständiger Außendienstmitarbeiter<br />
bei Airflow, die Vorteile der ver<br />
Inbetriebnahme eines Lüftungsgerätes durch<br />
einen Airflow-Servicetechniker.<br />
Durch die dezentrale Einbauweise wird jeder Raum individuell mit frischer Luft versorgt.<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 27
REPORTAGE<br />
Dezentrale Lüftungsgeräte<br />
Nachgefragt<br />
Ralf Nitschke ist Vertriebsleiter Lüftungsgeräte<br />
und Ventilatoren bei Airflow Lufttechnik.<br />
IKZ-<strong>KLIMA</strong>: Welche generellen Anforderungen<br />
im Bereich der dezentralen Lüftung<br />
sind speziell in Schulen, Kindergärten<br />
oder anderen öffentlichen Einrichtungen<br />
zu beachten?<br />
Ralf Nitschke: Besonders in Schulen kommen<br />
viele Menschen auf relativ kleinem<br />
Raum zusammen und müssen über längere<br />
Zeit effizient arbeiten und lernen.<br />
Um frische Luft in den Raum zu bringen,<br />
wird meist ganz klassisch stoßgelüftet.<br />
Dies reicht aber nicht aus, um ein Klassenzimmer<br />
konstant und ausreichend<br />
mit frischer Luft zu versorgen. Hinzu<br />
kommt noch der Wärmeverlust, dem Lüftungsgeräte<br />
mit Wärmerückgewinnung<br />
bis zu 95 % entgegenwirken. Der CO 2 Gehalt<br />
in einem Klassenraum kann bereits<br />
nach kurzer Zeit auf 2000 ppm oder höher<br />
steigen. Die Folgen: Kopfschmerzen,<br />
Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit.<br />
Bei der Planung einer Lüftungsanlage<br />
muss daher genau berücksichtigt werden,<br />
wie groß der Raum ist und wie viele<br />
Menschen sich dort zu Stoßzeiten aufhalten.<br />
Das Lüftungsgerät muss individuell<br />
regelbar sein und flüsterleise im Betrieb,<br />
sodass der Unterricht nicht gestört wird.<br />
Oft werden dezentrale Geräte im Falle einer<br />
raumweisen Sanierung eingesetzt,<br />
damit das Gebäude weiter genutzt werden<br />
kann. D. h. die Lüftungsgeräte müssen<br />
auch schnell und leicht montiert werden<br />
können.<br />
IKZ-<strong>KLIMA</strong>: Inwieweit müssen bei dezentralen<br />
Geräten in öffentlichen Einrichtungen<br />
wie Schulen Aspekte des Brandoder<br />
Schallschutzes und insbesondere der<br />
Schutz vor Vandalismus beachtet werden?<br />
Ralf Nitschke: Um Lärmbelästigung<br />
zu vermeiden, müssen die Lüftungsgeräte<br />
geräuscharm laufen. Über Rauchschalter<br />
werden<br />
die Lüftungsgeräte<br />
im Auslösefall<br />
abgeschaltet<br />
und Außen sowie<br />
Fortluftklappe werden umgehend geschlossen.<br />
Um Vandalismus vorzubeugen,<br />
können dezentrale Lüftungsgeräte<br />
bis zu zwei Drittel oder ganz in die Decke<br />
integriert werden. Über unser integriertes<br />
Netzwerk können alle Geräte ohne<br />
Raumbedieneinheit über einen handelsüblichen<br />
InternetBrowser von jedem<br />
Ort und ohne zusätzliche Software bedient,<br />
eingestellt und geloggt werden. Kabel<br />
werden im oberen Teil der Geräte herausgeführt,<br />
sodass diese ebenfalls geschützt<br />
sind.<br />
Das klassische Stoßlüften<br />
reicht nicht aus.<br />
IKZKlima: Wie sollten Geräte in öffentlichen<br />
oder halböffentlichen Bereichen<br />
angesteuert werden – zentral über eine<br />
übergeordnete Leitstelle oder dezentral<br />
über ein Regelgerät in den einzelnen<br />
Räumen?<br />
Ralf Nitschke: Gesteuert wird die gesamte<br />
Lüftungsanlage entweder durch<br />
das integrierte Netzwerk oder mit optionalen<br />
Schnittstellen (KNX, BACNET,<br />
LON, MODBUS) über eine bauseitige<br />
Gebäudeleittechnik. Ebenfalls besteht<br />
die Möglichkeit über eine Raumbedieneinheit<br />
direkt am Gerät. Die Versorgung<br />
der Klassenräume mit Frischluft wird<br />
bedarfsgeführt über CO 2 Sensoren gesteuert.<br />
Zudem steuert die Gebäudeleittechnik<br />
oder die Geräteregelung übergeordnete<br />
Zeitprogramme wie Ferien,<br />
Wochenende und Feiertage und übernimmt<br />
die Funktionskontrolle sowie<br />
Hinweis auf Filterwechsel.<br />
Ob<br />
eine dezentrale<br />
oder zentrale Ansteuerung<br />
sinnvoll<br />
ist, entscheidet der individuelle<br />
Fall vor Ort.<br />
IKZ-<strong>KLIMA</strong>: Mit welchen Leistungen unterstützt<br />
Airflow Planer und Verarbeiter<br />
bei der Konzepterstellung und in der anschließenden<br />
Umsetzungsphase?<br />
Ralf Nitschke: Unser ExpertenTeam begleitet<br />
Fachplaner und Verarbeiter von<br />
der Entwurfsplanung über die Ausführung<br />
bis hin zur Inbetriebnahme.<br />
schiedenen Lüftungsgeräte auf. Am Ende<br />
fiel die Wahl auf die dezentralen Lüftungsgeräte<br />
der „DUPLEX Vent Serie“. Aus<br />
drei Gründen:<br />
• Die verschiedenen Räume des Schulgebäudes<br />
lassen sich individueller steuern,<br />
• der Einbau ist weitaus schneller und<br />
unkomplizierter und<br />
• damit auch kostengünstiger als bei zentralen<br />
Geräten.<br />
Unkomplizierter Einbau<br />
der Lüftungsgeräte<br />
Den Einbau der Lüftungsgeräte übernahmen<br />
die Spezialisten für Luft und Klimatechnik,<br />
Kältetechnik und Gebäudeautomation<br />
Otto in Köln. Dabei kamen Geräte mit<br />
zwei unterschiedlichen Volumenströmen<br />
zum Einsatz. So wird sichergestellt, dass die<br />
unterschiedlich großen Räume genau die<br />
Luftzufuhr erhalten, die sie auch benötigen.<br />
Jetzt sorgen 3 „DUPLEX Vent 300“ sowie 25<br />
„DUPLEX Vent 800“ für gute Luft und warten<br />
dabei mit mehreren Besonderheiten auf.<br />
„Der Einbau erfolgte nahe der Außenwand,<br />
sodass nur ein kurzer Kanal nach außen<br />
28 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
gelegt werden musste. Durch ein Wetterschutzgitter<br />
kann somit die Innenluft nach<br />
außen geführt und neue, frische Luft angesogen<br />
werden“, sagt Volker Höhne, Technischer<br />
Leiter bei der in Bad Berleburg im<br />
Kreis SiegenWittgenstein ansässigen Firma<br />
Otto mit Niederlassung in Köln.<br />
Ein flüsterleiser Betrieb sorgt dafür,<br />
dass der Unterricht nicht gestört wird. Dabei<br />
kommt eine besondere Technik zum<br />
Einsatz: Der Schall wird dank integrierter<br />
Richtmikrofone mit Gegenschall gedämpft.<br />
Es gibt einen weiteren Pluspunkt<br />
der AirflowLüftungsgeräte: Dank der integrierten,<br />
leistungsstarken und effizienten<br />
KreuzgegenstromWärmetauscher<br />
können die Geräte auch im Winter die<br />
Raumluft auf ein angenehmes Klima temperieren<br />
und unterstützen damit die Heizungsanlage.<br />
Der Wärmebereitstellungsgrad<br />
beträgt bis zu 95 %. Dabei sind die Geräte<br />
kompakt und platzsparend.<br />
Nach zwei Monaten waren die 28 Lüftungsgeräte<br />
eingebaut, inklusive der Kanalsysteme.<br />
Anschließend stand die ebenfalls<br />
problemlos verlaufende Inbetriebnahme<br />
der Lüftungsgeräte an. „Wir waren<br />
sehr zufrieden mit dem Service, der technischen<br />
Abwicklung und den Lüftungsgeräten<br />
selbst. Es ist nicht das erste Mal, dass wir<br />
AirflowGeräte verbaut haben und es wird<br />
auch ganz sicher nicht das letzte Mal gewesen<br />
sein“, sagt der 54jährige Höhne rückblickend.<br />
Auch Planerin Anne Tangermann<br />
lobt: „Die Beratung war ausgezeichnet und<br />
die Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt.“<br />
Bis zum Start des Schuljahrs 2024/25<br />
will die Stadt Köln am Wasseramselweg<br />
einen endgültigen Neubaukomplex für die<br />
Gesamtschule mit einer Einfach und DreifachSporthalle<br />
errichten. Nach fünf Jahren<br />
Nutzung durch die Schule können die<br />
Räume 2024 dann einfach zurückgebaut<br />
werden. Und „Snake“ kann dann wieder als<br />
reines Bürogebäude fungieren. Volker Höhne<br />
sagt vorausschauend: „Wenn es dann soweit<br />
ist, müssen die Lüftungsgeräte und die<br />
Aufteilungen natürlich neu besprochen, geplant<br />
und montiert werden.“<br />
8. – 13. 3. <strong>2020</strong><br />
Frankfurt am Main<br />
Technik, die<br />
verbindet.<br />
20<br />
JAHRE<br />
Smart Urban, Konnektivität und<br />
einfache Prozesse. Machen Sie Gebäude<br />
fit mit intelligenten Infrastrukturen und<br />
zukunftsweisendem Energiemanagement.<br />
Die Hersteller auf der Light + Building<br />
bringen Sie auf den aktuellen Stand.<br />
Connecting. Pioneering. Fascinating.<br />
Autor: Udo Rausch, technischer Vertrieb<br />
Lüftungsgeräte bei Airflow<br />
Bilder: Airflow<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de
Der Neubau des<br />
Centrums für Integrierte<br />
Onkologie<br />
(CIO) im Uniklinikum<br />
Köln mit seinen rund<br />
36 000 m 2 Bruttogeschossfläche<br />
wurde<br />
als rechteckiger,<br />
siebengeschossiger<br />
Baukörper in Stahlbetonbauweise<br />
mit<br />
einer Ausdehnung<br />
von ca. 60 m x 80 m<br />
errichtet.<br />
Qualitätssicherung<br />
leicht gemacht<br />
Steinwolle überzeugt in der Kältedämmung<br />
Als die Röckinghausen GmbH den Zuschlag für einen Auftrag auf dem Gelände der Uniklinik Köln erhielt, fühlte sich Isoliermeister<br />
Wolfram Opitz einmal mehr in seiner Überzeugung für das „Teclit“-Dämmsystem von Rockwool bestärkt. „Wir haben dieses System<br />
nach sehr guten Erfahrungen auf anderen Baustellen mit angeboten und durch die Kombination von Rockwool-Systemen für Wärmedämmung,<br />
Kältedämmung und Brandschutz überzeugt“, berichtet der verantwortliche Projektleiter.<br />
„Das „Teclit“ System ist abgestimmt auf die<br />
„Conlit“-Brandabschottungen und wird im<br />
Grunde genauso verarbeitet wie die Rockwool<br />
Rohrschalen für den Wärmeschutz.<br />
Die Verarbeitung geht deshalb zügig voran,“<br />
begründet Opitz seine Vorliebe. Rund<br />
20 000 m Rohrleitungen haben seine Mitarbeiter<br />
in den sieben Geschossen des<br />
Centrums für Integrierte Onkologie (CIO)<br />
der Uniklinik Köln verlegt und den überwiegenden<br />
Teil auch isoliert, davon etwa<br />
2800 m Kälteleitungen. „Teclit PS Cold“-<br />
Rohrschalen sind nichtbrennbar nach DIN<br />
13501, mit A2L-s1, d0 klassifiziert und UVbeständig.<br />
Ausgestattet mit einer stabilen<br />
glasfasernetzverstärkten Alukaschierung<br />
und selbstklebender Überlappung an der<br />
Längsfuge sind sie schnell zu verarbeiten.<br />
Es entsteht eine robuste und hochwertige<br />
Dämmung von Kaltleitungen in kurzer<br />
Zeit.“ Die Mitarbeiter könnten mit der im<br />
Grunde immer gleichen Arbeitsweise die<br />
klassische Wärmedämmung der warmgehenden<br />
Leitungen, die Kältedämmung<br />
und die Brandabschottung mit „Conlit“ im<br />
Bereich der Durchdringungen ausführen.<br />
Das spare Zeit und Nerven.<br />
Dauerhaft gut geschützt<br />
In den zwei Tiefgaragenebenen des Kölner<br />
CIO wurden die unter den Decken montierten<br />
Kaltleitungen zusätzlich mit Blech<br />
Eine auf den Transportkarton<br />
aufgedruckte<br />
Schablone<br />
erleichtert den Zuschnitt<br />
der Rohrschale<br />
zur Isolierung von<br />
Bögen im benötigten<br />
Winkelmaß.<br />
ummantelt. „Das war ein Wunsch des Bauherrn,<br />
dem wir gerne gefolgt sind. Denn<br />
überall dort, wo Leitungen durch öffentlich<br />
zugängliche Räume wie eben in diesem Fall<br />
durch eine Garage geführt werden, kann<br />
eine Beschädigung der Isolierung durch unachtsame<br />
Dritte auf Dauer nicht völlig ausgeschlossen<br />
werden. Und leider gibt es bis-<br />
30 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
REPORTAGE<br />
Rohrleitungsdämmung<br />
Das „Teclit“-System<br />
Das System für die Dämmung von<br />
Kälteleitungen an haustechnischen<br />
Anlagen ist sowohl für den Einsatz<br />
auf Trinkwasser- und Kühlwasserleitungen<br />
als auch für Wechseltemperaturanlagen<br />
aus Stahl, Edelstahl,<br />
Kupfer und Kunststoff geeignet.<br />
Das System kann aber auch<br />
für Rohrleitungen mit warmen Medien<br />
bis 250 °C eingesetzt werden.<br />
Der nichtbrennbare Dämmstoff<br />
Steinwolle – A2L-s1, d0 nach<br />
DIN EN 13501 – gewährleistet darüber<br />
hinaus einen optimalen Brandschutz.<br />
Damit ist eine offene Verlegung<br />
wie in notwendigen Fluren ohne<br />
zusätzliche Maßnahmen wie z. B. Unterdecken<br />
oder I-Kanäle möglich. Darüber<br />
hinaus können mit den „Teclit“<br />
Dämmsystem brennbare Rohrleitungen<br />
in Rettungswegen gekapselt<br />
werden. Alle Hinweise zur brandschutztechnischen<br />
Ummantelung<br />
sind in der gutachterlichen Stellungnahme<br />
Nr. 3335/1111-Mer oder im<br />
Rockwool „Planungs- und Montagehelfer<br />
für Rohrleitungsanlagen“ enthalten.<br />
Rund 2800 m Kälteleitungen haben die Mitarbeiter der Röckinghausen GmbH in den sieben<br />
Geschossen des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) der Uniklinik Köln verlegt und isoliert.<br />
Projektleiter Wolfram Opitz ist ein überzeugter Verarbeiter der nichtbrennbaren Dämmung für<br />
Kälteleitungen an haustechnischen Anlagen.<br />
her kein Dämmsystem im Markt, das quasi<br />
‚unkaputtbar’ wäre“, erklärt Opitz. „Gerade<br />
bei der Isolierung von Kälteleitungen müssen<br />
Beschädigungen aber unter allen Umständen<br />
vermieden werden, damit keine<br />
Feuchtigkeit eindringen und Korrosion an<br />
den Leitungen verursachen kann.“ Beschädigungen<br />
vor der Ausführung der Blechummantelung<br />
zu erkennen, sei deshalb eine<br />
wichtige Aufgabe der Bauleiter.<br />
„Die neu entwickelte Aluminiumkaschierung<br />
des „Teclit“-Systems ist extrem<br />
belastbar. In der Bauphase sind Rohrschalen<br />
und Dämmmatten deshalb wenig anfällig<br />
für Beschädigungen von außen.<br />
Wird die Kaschierung dennoch verletzt,<br />
so ist das sofort zu sehen, weil die grüne<br />
Steinwolle sichtbar wird.“ Mit einem speziellen<br />
Alu-Tape sei das Problem schnell gelöst.<br />
„So können wir nahezu garantieren,<br />
dass jede noch so kleine Beschädigung von<br />
uns erkannt und verschlossen wird.“ Auch<br />
Mit dem hochreißfesten, ebenfalls glasfasernetzverstärkten Aluminiumklebeband „Teclit-<br />
Alutape“ sind alle Fugen und Verbindungen im Dämmsystem sicher abzudichten. Es ist<br />
optimiert für die Verklebung von Dämmstoff-Stoßstellen, die hohen Temperaturbelastungen<br />
standhalten müssen.<br />
die mit der Abnahme befassten Bauleiter<br />
hätten diese Stärke des Systems auf allen<br />
Baustellen gelobt. „Beschädigungen an<br />
z. B. schwarzen Schaumglasisolierungen<br />
sind deutlich schwerer auszumachen.“<br />
Nachfrage wächst<br />
Seit Februar 2017 ist die Röckinghausen<br />
GmbH ein für die Verarbeitung des „Teclit“-<br />
Systems zertifizierter Fachbetrieb. Deshalb<br />
finden sich die Kontaktdaten des Unternehmens<br />
auch auf der Rockwool-Website. „Seither<br />
haben wir bereits einige Anfragen für<br />
sehr attraktive Aufträge erhalten“, freut sich<br />
Opitz. „Da die öffentliche Hand im Moment<br />
sehr viel in neue Bildungseinrichtungen,<br />
Krankenhäuser und andere Gebäude mit erhöhten<br />
Anforderungen an den Brandschutz<br />
steckt, gibt es für Isolierer im Bereich nichtbrennbarer<br />
Dämmungen viel zu tun.“<br />
Bilder: Rockwool<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 31
TIPPS & TRENDS<br />
Produkte<br />
Exhausto by Aldes GmbH<br />
Gute Luft in Klassenräumen<br />
Kinder verbringen etwa acht Stunden pro Tag in Klassenräumen.<br />
Angesichts dessen und im Interesse gesünderer<br />
Atemluft hat Exhausto die Lösung „VEX308“ entwickelt.<br />
Dabei handelt es sich um ein Lüftungsgerät, das<br />
die Luft in den einzelnen Klassen permanent filtert und<br />
erneuert, ohne die Fenster öffnen zu müssen. Mit der<br />
integrierten Wärmerückgewinnung<br />
wird<br />
die Zuluft temperiert.<br />
Im Sommer kann das<br />
Gerät nachts zur freien<br />
Kühlung genutzt<br />
werden.<br />
„Die kompakte<br />
Bauweise ermöglicht<br />
eine schnelle und einfache Installation des Gerätes in weniger als zwei Stunden“, beschreibt<br />
der Hersteller. Brandschutzklappen könnten üblicherweise entfallen. Durch die integrierte<br />
Regelung sei das Gerät sofort betriebsbereit. Es schaltet sich über Präsens ein und passt<br />
den notwenigen Volumenstrom über einen integrierten<br />
CO 2 -Sensor automatisch an. Die Außenluft<br />
wird gefiltert (Filterklasse<br />
F7), verbrauchte Raumluft<br />
abgeführt. Der maximale Volumenstrom<br />
beträgt 800 m 3 /h.<br />
Exhausto by Aldes GmbH,<br />
Mainzer Str. 43,<br />
55411 Bingen am Rhein,<br />
Tel. : 06721 9178 - 111, Fax: - 99,<br />
info@exhausto.de, www.exhausto.de<br />
Anschlussvarianten des<br />
Schullüftungsgeräts<br />
„VEX308“.<br />
Einbaubeispiel in einem Klassenraum.<br />
Auch ein teilintegrierter Einbau<br />
in die Decke ist möglich.<br />
Bilder: Exhausto<br />
Bilder: Exhausto<br />
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH<br />
Lüftungslösung für mehrgeschossige Gebäude<br />
Der neue „ER EC“ hat Maico speziell zur Entlüftung von<br />
Badezimmern und Toilettenräumen mehrgeschossiger<br />
Wohngebäude, Hotels oder Bürokomplexe konzipiert.<br />
Feuchte Luft sowie Gerüche werden abtransportiert und<br />
ins Freie befördert. Das Lüftungsgerät ist in vier Steuerungsvarianten<br />
erhältlich: Standard, Komfort,<br />
mit Feuchtesteuerung sowie mit Bewegungssensor.<br />
Alle vier laufen<br />
im Grundlastbetrieb<br />
mit 30 m³/h.<br />
Über einen Lichtschalter<br />
bzw. separaten<br />
Schalter<br />
kann in den Volllastbetrieb<br />
mit 60<br />
m³/h gewechselt<br />
werden. Die Komfortausführung<br />
bzw. die Ausführungen mit Bewegungs- und Feuchtesensor verfügen<br />
über weitere Lüftungsstufen. Das Ein- und Ausschalten der Grundlast ist<br />
ebenfalls über einen Schalter möglich.<br />
Bei den drei Ausführungen Komfort, Feuchte- und Bewegungssensor<br />
sind die Steuerung sowie das Touch-Bedienelement in<br />
den Designabdeckungen integriert. Durch den Austausch der<br />
Abdeckung kann später eine andere Steuerung realisiert<br />
werden. Eine Filterwechselanzeige mit Reset-Funktion<br />
bildet die Grundlage für einen hygienischen<br />
Betrieb und erinnert den Anwender an<br />
den ohne Werkzeug durchführbaren Filtertausch.<br />
Bild: Maico<br />
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH,<br />
Steinbeisstr. 20, 78056 Villingen-Schwenningen,<br />
Tel.: 07720 694 - 0, Fax: - 263,<br />
info@maico.de, www.maico-ventilatoren.com<br />
Der „ER EC“ ist mit einem EC-Motor ausgestattet. Die Ausblasrichtung ist durch<br />
Drehung des Gehäuses um 90° nach links oder rechts veränderbar.<br />
32 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
Daikin Airconditioning Germany GmbH<br />
Produktreihe „Sky Air“<br />
Mit zwei neuen Geräteserien der Produktreihe „Sky Air“ (für Klimalösungen in<br />
kleineren, gewerblichen Anwendungen) reagiert Daikin auf die Anforderungen<br />
in eng bebauten Gebieten. Es sind die Modelle „RZA-D“ der Advanced-Serie<br />
und die „RZAG-N“ der Alpha-Serie. Wie das Unternehmen hervorhebt,<br />
seien die beiden Geräteserien deutlich kompakter und<br />
kleiner als<br />
ihr jewei-<br />
Mit den Abmessungen und Gewichten seien beide<br />
Außen geräte leichter zu transportieren. Mit vier<br />
Haltegriffen lässt sich ein Außengerät von zwei<br />
Personen tragen.<br />
Bild: Daikin<br />
liges Vorgängermodell.<br />
Die Außen maße der<br />
neuen „RZA-D“ seien um fast 50 %<br />
reduziert. Statt bisher nach oben ausblasend<br />
ist das Modell jetzt mit frontausblasenden Ventilatoren<br />
ausgestattet. „Diese ermöglichen eine größere Flexibilität<br />
bei der Wahl des Aufstellungsortes“, heißt es bei<br />
Daikin. Die neue „RZAG-N“ hat nur noch einen Lüftermotor<br />
„und entsprechend kompaktere Maße.“<br />
Beide neuen „Sky Air“-Serien sind mit allen gängigen Innengeräten der gleichen<br />
Serie kombinierbar. Das Portfolio an Innengeräten wird durch das neue<br />
Kanalgerät „FDA-A“ (R-32) ergänzt, das mit neuem Gehäuse im Stil der anderen<br />
Kanalgeräte designt ist „und mit neuen Motoren effizient arbeitet“.<br />
Daikin Airconditioning Germany GmbH, Inselkammerstr. 2, 82008 Unterhaching,<br />
Tel.: 089 74427 - 0, Fax: - 299, info@daikin.de, www.daikin.de<br />
Größenvergleich<br />
zwischen dem<br />
Vorgängermodell und<br />
dem neuen „RZA-D“.<br />
Bild: Daikin<br />
Kampmann GmbH<br />
Fan Coils mit erweitertem Leistungsbereich<br />
Der<br />
Fan Coil<br />
„Venkon“.<br />
Die Kampmann GmbH aus Lingen (Ems) hat neue Fan Coils der Reihe „ Venkon“ auf<br />
den Markt gebracht. Aufgrund einer veränderten luft- und wasserseitigen Durchströmung<br />
soll der Leistungsbereich im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich erweitert<br />
worden sein. Die eingesetzten EC-Ventilatoren könnten auch bei geringen Luftleistungen<br />
in einem niedrigen Drehzahlbereich bedarfsgerecht betrieben werden. Das<br />
ermögliche<br />
eine Verringerung<br />
der Schallemissionen.<br />
Komplettiert wird die Überarbeitung durch ein Design,<br />
das Techniker und Architekten in Zusammenarbeit gestaltet<br />
haben. Die Fan Coils sind „hygienekonform nach<br />
VDI 6022“ und sollen sich durch eine einfache Montage<br />
sowie kurze Lieferzeiten auszeichnen.<br />
Die neuen Modelle ersetzen sukzessive die bisherigen<br />
Venkons, deren Verkauf mittelfristig ausläuft. Erhältlich<br />
sind vier Baugrößen, die Kühlleistungen zwischen 0,79<br />
und 11,26 kW und Heizleistungen zwischen 1,54 und<br />
26,20 kW abdecken.<br />
Bild: Kampmann<br />
Bild: Kampmann<br />
Kampmann GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 128 - 130,<br />
49811 Lingen (Ems), Tel.: 0591 7108 - 0, Fax: - 300,<br />
info@kampmann.de; www.kampmann.de<br />
Es gibt eine optimierte luft- und wasserseitige Durchströmung.<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 33
TIPPS & TRENDS<br />
Produkte<br />
Tecalor GmbH<br />
Dezentrales Lüftungssystem<br />
Bild: Tecalor<br />
Die „Thermo-Lüfter“ sind für Wohnräume im Neubau und<br />
im Gebäudebestand ausgelegt.<br />
Für die Frischluftversorgung in bewohnten wie nicht bewohnten<br />
Räumen können dezentrale Lüftungsgeräte dienen, beispielsweise<br />
die Gerätereihe „LTM dezent“, mit der Tecalor sein Portfolio<br />
erweitert hat. Ursprünglich wurde dieses Gerät unter der Marke<br />
LTM vertrieben, die im Frühjahr 2019 mit Tecalor verschmolzen<br />
wurde und jetzt in der Holzmindener Haustechnikmarke aufgeht.<br />
„LTM dezent“ ist lieferbar in der Ausführung „GIT“ als frei-blasendes<br />
Gerät zum dezentralen Lüften und als Modell „KZA“, das<br />
kanalgeführt arbeitet und als zentrales Lüftungsgerät eingesetzt<br />
werden kann. Beide Versionen gibt es in drei Ausführungen mit<br />
Luftvolumenströmen zwischen 100 und 870 m³/h. Eine Systemlösung<br />
für Wohnräume in Neubau und Bestand stellen die beiden<br />
„LTM-Thermo-Lüfter“ dar: Im System arbeiten sie paarweise<br />
im Gegentakt. Mit dem „1230“ lassen sich Abluft-Volumenströme<br />
mit 18 – 65 m³/h je Gerät realisieren, beim „200-50“ sind<br />
es bis zu 50 m³/h. Beide „LTM-Thermo-Lüfter“ lassen sich individuell<br />
konfigurieren.<br />
Bild: Tecalor<br />
Tecalor GmbH, Lüchtringer Weg 3, 37603 Holzminden,<br />
Tel.: 05531 99068-95082, Fax: -95712, info@tecalor.de, www.tecalor.de<br />
Das „LTM dezent“ eignet sich für Gebäude mit hoher Personenbelegung.<br />
Systemair GmbH<br />
System regelt Lüftung, Heizung, Kühlung<br />
Nach Auffassung von Systemair sollten in Gebäuden die Gewerke<br />
Lüftung, Heizung und Kühlung übergreifend geregelt werden.<br />
Dazu hat das Unternehmen auf der Messe ISH im Frühjahr dieses<br />
Jahres das neue System „Efficient Ventilation Control (EVC)“<br />
vorgestellt. Bis zu 25 Zonen oder Räume mit Sensoren und Aktoren<br />
sowie bis zu vier Lüftungsgeräte lassen sich mit einem zentralen<br />
Schaltschrank verbinden. „Im Vergleich zu druckkonstant<br />
geregelten Lüftungsanlagen reduziert das beispielsweise die<br />
Stromaufnahme von Lüftungsventilatoren um bis zu 60 %“, hat<br />
Systemair errechnet. Zudem kann die „EVC“-Regelung die Fußbodenheizung<br />
und Systeme zur aktiven Kühlung mit einbinden.<br />
Für jede Zone ist ein „Zonen-Set“ zu installieren. Es besteht aus<br />
einem zentralen Zonen-Hub, an den eine Raumbedieneinheit sowie<br />
verschiedene Sensoren und Aktoren, beispielsweise die Volumenstromregler<br />
für die Zu- und Abluft, angeschlossen werden. Mit<br />
der Sensorik können der CO 2 -Gehalt, die Konzentration von VOCs<br />
(flüchtige organische Verbindungen), die Luftfeuchtigkeit und die<br />
Raumlufttemperatur erfasst werden. Zusätzliche Regeloptionen ergeben<br />
sich durch den Anschluss von Präsenzmeldern, Kondensationswächtern<br />
und Chance-over-Sensoren oder Fensterkontakten.<br />
Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, 97944 Boxberg-Windischbuch,<br />
Tel.: 07930 9272 - 0, Fax: - 92, info@systemair.de, www.systemair.de<br />
Das neue System „Efficient Ventilation Control (EVC)“ von Systemair<br />
erfasst mehrere Raumdaten und regelt die Volumenstromklappen<br />
und die Drehzahl der Lüftungsventilatoren. Fußbodenheizungen und<br />
Kühldecken lassen sich einbinden.<br />
Bild: Systemair<br />
34 <strong>IKZplus</strong> • IKZ-<strong>KLIMA</strong> 1/<strong>2020</strong>
TERMINE<br />
Veranstaltung, Inhalt<br />
Datum Ort Kosten Veranstalter<br />
Studiengang TGA-Manager<br />
Der BTGA (Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung)<br />
und die Frankfurt School of Finance & Management haben<br />
diesen einjährigen Zertifi-katslehrgang entwickelt. Er umfasst<br />
acht Module, z. B. Projektmanagement, Trends & Digitalisierung,<br />
Unternehmensführung, die in Präsenzveranstaltungen<br />
und per E-Learning vermittelt werden. Das Weiterbildungsangebot<br />
richtet sich an angehende Führungskräfte.<br />
Energetische Inspektion von Klimaanlagen nach § 12 EnEV<br />
Das Seminar vermittelt die notwendigen Kenntnisse zur Durchführung<br />
der energetischen Inspektion von Lüftungs- und Klimaanlagen<br />
sowie von Anlagen zur Klimakälteerzeugung. Aus dem<br />
Inhalt der zweitägigen Schulung: EnEG, EnEV, GEG, Referenzanlage,<br />
Systemkennwert, Quick-Check Lüftung, Quick-Check Kälte,<br />
Bewertung der Anlagenauslegung, Interpretation und Auswertung<br />
der Messwerte, Klimakälteerzeugung, Hydraulik.<br />
Trainingsprogramm für Klima- und Lüftungstechnik<br />
Mitsubishi Electric hat für das Jahr <strong>2020</strong> ein breites Trainingsprogramm<br />
ausgearbeitet. Die Technikseminare strukturieren sich<br />
in Grundlagen-, Aufbau-, Experten- und Planungsveranstaltungen.<br />
Im Segment der Betriebsführung geht es z. B. um professionelles<br />
Auftreten beim Kunden oder um juristische und vertragliche<br />
Themen. Ergänzt wird das Angebot um Trendthemen<br />
wie F-Gas-Verordnung oder alternative Kältemitte.<br />
Honeywell Home: Seminare<br />
Das Schulungsangebot von Honeywell Home umfasst 59 Kurse –<br />
rund um Trinkwasserinstallation und Wärmetechnik sowie Recht.<br />
Vermittelt werden u. a. ein Überblick über bestehende und neue<br />
Regelungen und praktische Tipps für den Arbeitsalltag.<br />
17.3. Frankfurt 14500,-<br />
Euro<br />
10. –<br />
11.6.<br />
Berlin<br />
1370,- Euro<br />
Detaillierte Informationen finden sich<br />
unter www.mitsubishi-les.com im<br />
Internet.<br />
Termine, Orte und alle weiteren<br />
Infos finden sich hier: fachseminare.<br />
honeywellhome.de<br />
BTGA (Bundesindustrieverband<br />
Technische Gebäudeausrüstung)<br />
Bonn<br />
Tel.: 0228 94917-0, Fax: -17<br />
info@btga.de<br />
www.btga.de<br />
Mitsubishi Electric Europe B.V.<br />
Ratingen<br />
Tel.: 02102 486-0, Fax: -1120<br />
les-training@meg.mee.com<br />
www.mitsubishi-les.com<br />
Ansel & Möllers GmbH<br />
Stuttgart<br />
Tel.: 0711 92545-0, Fax: -19<br />
honeywellhome-fachseminare@<br />
anselmoellers.de<br />
fachseminare.honeywellhome.de<br />
Impressum<br />
Fachmagazin des Mehrwert-Konzeptes <strong>IKZplus</strong><br />
www.ikz.de · www.strobelmediagroup.de<br />
Verlag<br />
STROBEL VERLAG GmbH & Co. KG<br />
Postanschrift: Postfach 5654, 59806 Arnsberg<br />
Hausanschrift: Zur Feldmühle 9-11, 59821 Arnsberg,<br />
Telefon: 02931 8900-0, Telefax: 02931 8900-38<br />
Herausgeber<br />
Dipl.-Kfm. Christopher Strobel, Verleger<br />
Redaktion<br />
Markus Sironi<br />
Chefredakteur IKZ-Medien<br />
Gas- und Wasserinstallateurmeister, Zentralheizungsund<br />
Lüftungsbauermeister, gepr. Energieberater<br />
Telefon: +49 2931 8900-46<br />
E-Mail: m.sironi@strobelmediagroup.de<br />
Stv. Chefredakteur: Detlev Knecht<br />
Staatl. gepr. Techniker (Heizung Lüftung Sanitär),<br />
Techn. Betriebswirt, Journalist (FJS)<br />
Telefon: +49 2931 8900-40<br />
E-Mail: d.knecht@strobelmediagroup.de<br />
Redakteur: Markus Münzfeld<br />
Staatl. gepr. Techniker (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik),<br />
Gebäudeenergieberater (HWK)<br />
Telefon: +49 2931 8900-43<br />
E-Mail: m.muenzfeld@strobelmediagroup.de<br />
Redaktions-Sekretariat: Birgit Brosowski<br />
Telefon: 02931 8900-41,<br />
E-Mail: redaktion@strobelmediagroup.de<br />
Anzeigen<br />
Anzeigenleiter: Stefan Hoffmann<br />
E-Mail: s.hoffmann@strobelmediagroup.de<br />
Mediaservice: Anke Ziegler und Sabine Trost<br />
Telefon: 02931 8900-21 oder 02931 8900-24<br />
E-Mail: anzeigen@strobelmediagroup.de<br />
Vertrieb / Leserservice<br />
Reinhard Heite<br />
E-Mail: r.heite@strobelmediagroup.de<br />
Druckvorstufenproduktion<br />
STROBEL PrePress & Media, Postfach 5654, 59806 Arnsberg<br />
E-Mail: datenannahme@strobelmediagroup.de<br />
Layout und Herstellung<br />
Daniela Vetter<br />
Druck (Lieferadresse für Beihefter und Beilagen)<br />
Dierichs Druck + Media GmbH & Co KG,<br />
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel<br />
Veröffentlichungen<br />
Zum Abdruck angenommene Beiträge, Manuskripte und Bilder<br />
gehen mit Ablieferung in das Eigentum des Verlages über. Damit<br />
erhält er gleichzeitig im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen<br />
das Veröffentlichungs- und Verarbeitungsrecht. Der Autor räumt<br />
dem Verlag das unbeschränkte Nutzungsrecht ein, seine Beiträge<br />
im In- und Ausland und in allen Sprachen, insbesondere in Print-<br />
medien, Film, Rundfunk, Datenbanken, Telekommunikations- und<br />
Datennetzen (z. B. Online-Dienste) sowie auf Datenträgern (z. B.<br />
CD-ROM) usw. ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken<br />
sowie öffentlich wiederzugeben. Für unaufgefordert<br />
eingesandte Manuskripte übernehmen Verlag und Redaktion keine<br />
Gewähr.<br />
Mit Namen gezeichnete Beiträge geben die Meinung der Verfasser<br />
wieder und müssen nicht mit der des Verlages übereinstimmen.<br />
Für Werbeaussagen von Herstellern und Inserenten in abgedruckten<br />
Anzeigen haftet der Verlag nicht. Die Wiedergabe von<br />
Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und<br />
dergleichen in dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu der Annahme,<br />
dass solche Namen ohne Weiteres von jedermann benutzt werden<br />
dürfen; oft handelt es sich um gesetzlich geschützte eingetragene<br />
Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.<br />
Nachdruck, Reproduktion und das Übersetzen in fremde Sprachen<br />
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet. Dieses<br />
gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und<br />
Vervielfältigungen auf Datenträgern jeder Art. Sofern Sie Artikel<br />
aus IKZ-DIGITAL in Ihren internen elektronischen Pressespiegel<br />
übernehmen wollen, erhalten Sie die erforderlichen Rechte unter<br />
www.pressemonitor.de oder unter Telefon 030 284930, PMG<br />
Presse-Monitor GmbH. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen<br />
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.<br />
1/<strong>2020</strong> www.ikz.de 35
Die Königsklasse<br />
der Ventilatoren<br />
Zukunft spüren<br />
ZA plus – Umweltfreundliches, energiesparendes Hightech-Ventilatorensystem<br />
Verbraucht bis zu 30% weniger Strom, spart jährlich bis zu 1400 Euro* pro ZAplus-Ventilator, sorgt für<br />
deutlich höhere Volumenströme, ist flexibel in 3 Höhen einbaubar. Optional mit Highend-Diffusor<br />
für gleichbleibende Leistung bei niedrigen Volumenströmen. www.ziehl-abegg.de<br />
Besuchen Sie uns: EuroShop, Düsseldorf, 16.02.-20.02.<strong>2020</strong>, Halle 17 – Stand D56<br />
ZAbluegalaxy<br />
Cloudbasierte IoT-Plattform für<br />
Produktverwaltung der Zukunft<br />
Clever modernisieren und Energie sparen<br />
ZAplus mit flexiblem Adapterring (optional),<br />
passend für alle Verflüssigermodelle<br />
Flattop<br />
Semi Flattop<br />
On Top<br />
*Pro Jahr/Ventilator, abhängig von<br />
Betriebspunkt, Anwendung und Größe<br />
Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik<br />
Bewegung durch Perfektion<br />
RetRofitblue<br />
Modernisieren und sofort Energie sparen