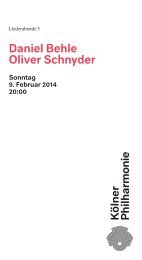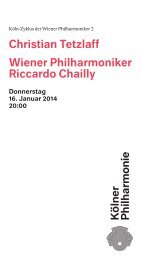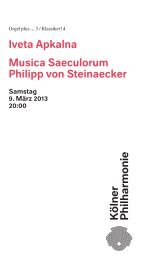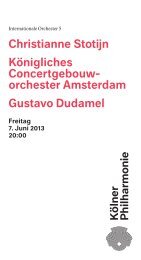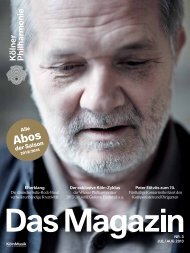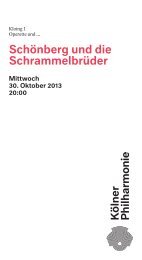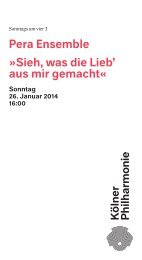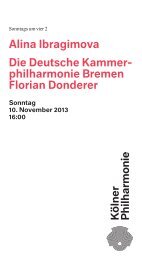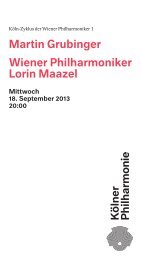24 - Kölner Philharmonie
24 - Kölner Philharmonie
24 - Kölner Philharmonie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hanslick in dem ganzen Strauss’schen Unternehmen nur einen<br />
Etikettenschwindel sehen.<br />
Den selbstbewussten Richard Strauss dürfte diese Kritik wenig<br />
berührt haben. Von seinem Rückgriff auf das hymnische Buch<br />
über den unmoralischen Übermenschen versprach er sich nicht<br />
nur Zustimmung, sondern antizipierte die Kritik schon im Januar<br />
1896 in einem Brief: »Jetzt nagle ich eine Orchesterdichtung: ›Also<br />
sprach Zarathustra‹ zusammen; wenn sie gelingt, so kenn’ ich<br />
viele, die sich darüber ärgern werden – dass sie’s so gar nicht<br />
verstehen!« Doch die Entstehungsgeschichte dieses Werkes reicht<br />
weiter zurück. Um eine Lungenentzündung auszukurieren, spendierte<br />
ein Onkel 1892/93 dem jungen Komponisten eine Reise nach<br />
Griechenland und Ägypten. Als Reiselektüre führte der Nietzsche<br />
mit sich und berichtet darüber später in seiner Autobiographie:<br />
»Als ich in Ägypten mit Nietzsches Werken bekannt geworden,<br />
dessen Polemik gegen die christliche Religion mir besonders aus<br />
dem Herzen gesprochen war, wurde meine seit meinem fünfzehnten<br />
Jahr mir unbewusste Antipathie gegen diese Religion,<br />
die den Gläubigen vor der eigenen Verantwortung für sein Tun<br />
und Lassen (durch die Beichte) befreit, bestärkt und begründet.«<br />
Im Sommerurlaub 1895 dann, mitten in den Dolomiten, arbeitete<br />
Strauss erste Ideen, die er sich im Jahr zuvor notiert hatte, zu einer<br />
Komposition über den »Zarathustra« aus, und schloss im Juli 1896<br />
die Klavierskizze ab. Es folgte die Instrumentierung, und am <strong>24</strong>.<br />
August 1896 war die Partitur fertig. Die Uraufführung folgte am<br />
27. November in Frankfurt.<br />
In das einsätzige Werk »frei nach Nietzsche«, wie es ausdrücklich<br />
heißt, fügte Strauss Zwischenüberschriften ein, die sich – mit<br />
Ausnahme des Nachtwandlerliedes – an den Kapiteln des Buches<br />
orientierten, wenn auch in anderer Reihenfolge. »Die Sonne geht<br />
auf. Das Individuum tritt in die Welt oder die Welt ins Individuum«,<br />
notierte Strauss zu den Eingangstakten. Für die beiden Pole wählte<br />
Strauss die Tonarten C und H und führte sie zu einer raffinierten<br />
Symbiose, auf die er am Ende der Komposition wieder zurückkommt,<br />
ohne jedoch die Spannung aufzuheben. »Der Mensch<br />
(H-Dur) fragte: Wann? – Wann? – und die Natur antwortete tief<br />
unten in ihrem C-Dur: Nie – nie – wird’s schönes Wetter!« schrieb<br />
Strauss dazu an Max von Schillings – ein Beleg dafür, wie wenig<br />
7