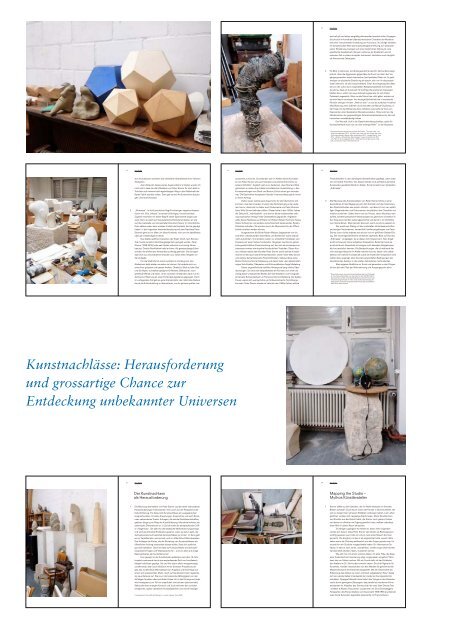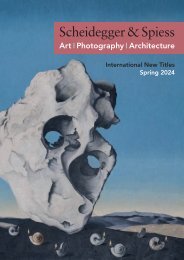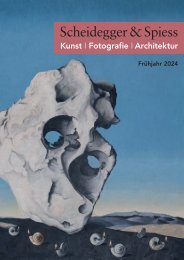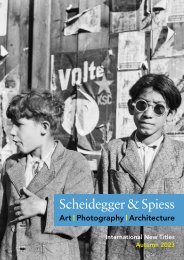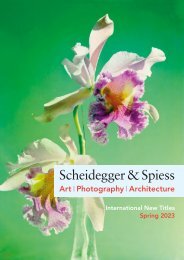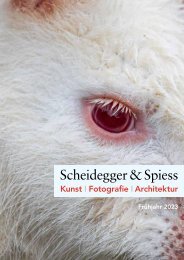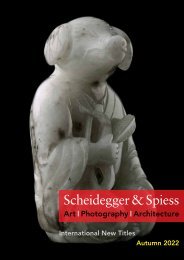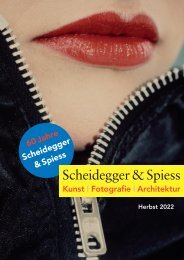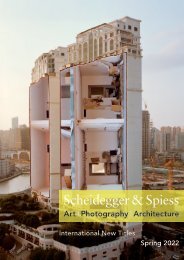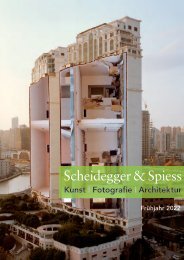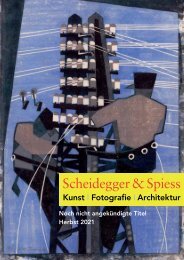Vorschau Scheidegger & Spiess Herbst 2023
NFT-Kunst von Wolfgang Beltracchi, der Jubiläumsband des Schweizer Fotografen Ernst Scheidegger und vieles mehr - entdecken Sie die Neuerscheinungen im Herbstprogramm!
NFT-Kunst von Wolfgang Beltracchi, der Jubiläumsband des Schweizer Fotografen Ernst Scheidegger und vieles mehr - entdecken Sie die Neuerscheinungen im Herbstprogramm!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9 Exemplarische Auskünfte hierzu bietet die Studie „The new artist“ von<br />
31 Was Bleibt<br />
wertvoll gilt und daher sorgfältig dokumentiert werden sollte. Hingegen<br />
drückt sich im konträren bilderstürmerischen Charakter der Moderne<br />
eine eher instrumentelle Vorstellung von Kunst aus. Ihr zufolge entfaltet<br />
ein künstlerisches Werk seine grösstmögliche Wirkung zum Zeitpunkt<br />
seiner Entstehung, bezogen auf einen bestimmten Gebrauch, eine<br />
spezifische Gesellschaft. Danach verliert es an Strahlkraft, wird im<br />
extremen Fall zu einem stumpfen Instrument, höchstens noch tauglich<br />
als historisches Zeitzeugnis.<br />
4 Ein Blick in die Kunst- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts zeigt<br />
jedoch, dass die Aggression gegenüber der Kunst vor allem der Vorgängergeneration<br />
meist rhetorischer (und partieller) Natur ist. Es geht<br />
weniger um physische Zerstörung als darum, sich von ihr abzusetzen<br />
(oder alternativ, sie sich einzuverleiben). Einen Konvergenzpunkt bildet<br />
die von der schon kurz vorgestellten Rezeptionsästhetik formulierte<br />
Annahme, dass ein Kunstwerk für künftige Generationen interessant<br />
bleiben kann, sofern sie neue Anknüpfungspunkte für sich findet.<br />
Polemisch zugespitzt: Wenn es die Mona Lisa nicht gäbe, würden wir<br />
sie wohl kaum vermissen. Ihre heutige Berühmtheit hat in mancherlei<br />
Hinsicht weniger mit dem „Werk an sich“ zu tun als zunächst mit seiner<br />
Mystifizierung unter anderem durch Künstler wie Marcel Duchamp, in<br />
der Folge mit der Stilisierung ihres Urhebers Leonardo da Vinci zum<br />
Exponenten einer idealisierten Renaissancekultur. Hinzu kommen die<br />
Mechanismen der gegenwärtigen Aufmerksamkeitsökonomie, die sich<br />
inzwischen verselbständigt haben.<br />
Der Wunsch, sich in die Geschichte einzuschreiben, spielt für<br />
Kunstschaffende nach wie vor eine wichtige Rolle 11 . In der Nachlass-<br />
Johannes Hedinger (2017). Auf die Frage, was von ihrer Kunst über ihren<br />
Tod hinaus Bestand haben solle, antworteten 65%: „einige Werke“ und<br />
45%: „Werke in öffentlichen Sammlungen“ sowie immerhin fast 30%<br />
„Ein Platz in der Kunstgeschichte“. (Mehrfachnennungen waren möglich).<br />
Download: https://thenewartist.net<br />
13 Was Bleibt<br />
14 Was Bleibt 15 Was Bleibt<br />
sich hinzuträumen schienen wie rätselhafte Überbleibsel einer früheren<br />
Zivilisation.<br />
Zum Zeitpunkt dieses ersten Augenscheins im Atelier wusste ich<br />
noch nicht, dass die drei Obelisken von Peter Storrer für mich bald zu<br />
Torhütern auf meinem bald regelmässigen Weg in den Ateliertrakt der<br />
Roten Fabrik werden sollten. Dort galt es eine Art Endmoräne abzutragen:<br />
Storrers Erbmasse.<br />
2 „Erbmasse“: Im kühl juristischen Begriff schwingen negative Assoziationen<br />
mit. Eine „Masse“ ist etwas Unförmiges, Unstrukturiertes.<br />
Zugleich erscheint mir dieser Begriff seiner Spannweite wegen passend.<br />
Denn er spielt auf das genetische Erbmaterial ebenso an wie<br />
auf das materielle und immaterielle Erbe einer Person, ihr Vermächtnis.<br />
Dazu zählen neben dem sozialen Umfeld die Kontexte, die sie geprägt<br />
haben. In der folgenden Auseinandersetzung mit dem Nachlass Peter<br />
Storrers geht es vor allem um diese Kontexte, nicht um ein detailliertes<br />
oder gar vollständiges Inventar.<br />
Das Atelier gehörte inzwischen der Stadt. Doch nach Storrers<br />
Tod musste zunächst die Erbangelegenheit geregelt werden. Peter<br />
Storrer (1928-2016) hatte sein Atelier während rund vierzig Jahren<br />
benutzt. Direkte Nachfahren hatte er keine. Als gesetzmässige Erben<br />
wurden vier entferntere Verwandte ausfindig gemacht. Sie schlugen<br />
das Erbe aus verschiedenen Gründen aus: hohes Alter, Respekt vor<br />
der Aufgabe.<br />
Für die Stadt Zürich stand zunächst im Vordergrund, den<br />
Atelierraum bald wieder vermieten zu können. Es handelte sich um<br />
eines ihrer grössten und besten Ateliers. Oberlicht, Blick auf den See<br />
und die Alpen, wunderbar geeignet für Malerei, Bildhauerei, raumgreifende<br />
Werke und Ideen. Unter normalen Umständen wäre nun ein<br />
Auftrag zur Räumung an einen Entrümpelungsdienst gegangen. Doch<br />
im vorliegenden Fall gab es gute Gründe dafür, den Inhalt des Ateliers<br />
durch die Kulturabteilung zu übernehmen, um ihn genauer prüfen und<br />
auswerten zu können. So befanden sich im Atelier etliche Kunstwerke<br />
von Peter Storrer wie auch teilweise vorsortierte Dokumente zu<br />
seinem Schaffen 2 . Zugleich galt es zu bedenken, dass Storrers Werk,<br />
gemessen an seiner eher lokalen künstlerischen Ausstrahlung, in den<br />
Kunstsammlungen von Stadt und Kanton Zürich schon gut vertreten<br />
war. Die Übernahme kompletter Künstler*innennachlässe gehört nicht<br />
zu ihrem Auftrag.<br />
Daher waren weitere gute Argumente für die Übernahme willkommen.<br />
Aus dem knappen Inventar des Notariats ging unter anderem<br />
hervor, dass sich im Atelier auch Dokumente von Peter Storrers<br />
Vater Willy Storrer befinden sollten. Dieser hatte in den 1920er Jahren<br />
die Zeitschrift „Individualität“ und den bis heute existierenden anthroposophischen<br />
Verlag Freies Geistesleben gegründet. Angeblich<br />
sollte dieser Nachlass auch Briefe von Robert Walser, Hermann Hesse,<br />
Oskar Schlemmer und anderen kulturhistorisch bedeutenden Persönlichkeiten<br />
enthalten. Sie würden durch die Übernahme für die Öffentlichkeit<br />
erhalten werden können.<br />
Ausgerechnet die Briefe Robert Walsers (abgesehen von ein,<br />
zwei eher unbedeutenden Schreiben) und Schlemmer waren jedoch<br />
nicht aufzufinden. Von letzteren waren nur schlechte Fotokopien und<br />
Hinweise auf einen Verkauf vorhanden. Hingegen tauchte ein ganzer<br />
kulturgeschichtlicher Zusammenhang auf, der sich als mindestens so<br />
interessant erwies wie einzelne Handschriften-Trophäen. Dieser Konnex<br />
umfasst neben dem Künstler Peter Storrer sowie seinem künstlerischen<br />
Umfeld auch seine Herkunftsfamilie: seinen Vater Willy Storrer<br />
und weitere bemerkenswerte Persönlichkeiten, insbesondere seine<br />
Mutter Florianna Storrer-Madelung und deren Vater, den dänischstämmigen<br />
Schriftsteller, Übersetzer und Kulturpublizisten Aage Madelung.<br />
Dieser ungewöhnliche familiäre Hintergrund barg etliche Überraschungen.<br />
So fand sich beispielsweise ein Konvolut von mehr als<br />
vierzig bisher unbekannten Briefen der Schriftstellerin und Fotografin<br />
Annemarie Schwarzenbach an Florianna Storrer-Madelung. Die beiden<br />
Frauen waren sich wenige Jahre vor Schwarzenbachs Tod nähergekommen.<br />
Peter Storrer wiederum hatte ab den 1950er Jahren etliche<br />
Freundschaften in den damaligen Künstlerkreisen gepflegt, unter anderem<br />
mit André Thomkins. Von diesem fanden sich zahlreiche als kleine<br />
Kunstwerke gestaltete Briefe im Atelier. Soviel zunächst zur materiellen<br />
„Erbmasse“.<br />
3 Die Räumung des Künstlerateliers von Peter Storrer führte zu einer<br />
besonderen Art der Begegnung mit dem Künstler und den faszinierenden<br />
Persönlichkeiten aus seinem Umfeld – und dies in Form von unzähligen<br />
Gegenständen und Dokumenten, die plötzlich den Charakter von<br />
Indizien annahmen. Selbst wenn man zur Person, deren Nachlass man<br />
auflöst, keinerlei persönliche Verbindungen hat, gerät man unmerklich in<br />
den Sog einer fremden Lebensgeschichte und damit in ein Verhältnis<br />
zum Verstorbenen. Man bemerkt dies erst, wenn es schon passiert ist.<br />
Der posthume Dialog mit den materiellen Hinterlassenschaften<br />
und einigen Verstorbenen, namentlich Familienangehörigen von Peter<br />
Storrer, kann nichts anderes sein als ein von mir geführter Geister-Dialog.<br />
Der nachfolgende Bericht will keinen objektiven Blick auf Storrers<br />
„Erbmasse“ vorspiegeln, da er diesen nicht bieten kann. Sein Angelpunkt<br />
ist bewusst meine subjektive Perspektive. Bereichert wird sie<br />
punktuell durch Gespräche mit einigen noch lebenden Zeitgenossen,<br />
die ihn persönlich kannten. Die Beobachtungen, die ich während der<br />
nicht wenigen Besuche im Atelier machen konnte, haben mich dabei<br />
ebenso wie manche Fundstücke sowie die erwähnten Gespräche nicht<br />
zuletzt dazu angeregt, über die stark gewandelten Bedingungen der<br />
künstlerischen Existenz in den letzten Jahrzehnten nachzudenken.<br />
Mein eigenes Verhältnis zur Kunst und genereller zu den Dingen<br />
ist hier also der Filter der Wahrnehmung und Ausgangspunkt einer<br />
2 Diese Dokumente, darunter Künstlerbriefwechsel und Fotografien,<br />
konnten grösstenteils vom Kunstarchiv des SIK-ISEA Zürich<br />
übernommen werden. Einzelne Bestände (namentlich Konvolute<br />
mit Zeichnungen) haben in erster Linie die Kunstsammlung der<br />
Stadt Zürich sowie die Graphische Sammlung der Zentralbibliothek<br />
Zürich übernommen.<br />
Kunstnachlässe: Herausforderung<br />
und grossartige Chance zur<br />
Entdeckung unbekannter Universen<br />
21 Was Bleibt<br />
35 Was Bleibt<br />
Der Kunstnachlass<br />
als Herausforderung<br />
Mapping the Studio –<br />
Mythos Künstleratelier<br />
1 Die Räumung des Ateliers von Peter Storrer und die damit verbundenen<br />
Herausforderungen interessierten mich auch aus der Perspektive der<br />
Kulturförderung. Für diese sind Kunstnachlässe ein ausgesprochen<br />
anspruchsvolles, mit vielen Erwartungen, Ansprüchen und auch Emotionen<br />
verbundenes Thema. Anfragen, die solche Nachlässe betreffen,<br />
gehören längst zum Alltag der Kunstförderung. Manchmal nehmen sie<br />
polemische Dimensionen an. In Zürich lautet die entsprechende Chiffre<br />
«Hagenholz». Sie steht für die städtische Müllverbrennungsanlage<br />
und wird als drohende Endstation genannt, wenn es darum geht, die<br />
Aufmerksamkeit auf bedrohte Kunstnachlässe zu richten. Im Kern geht<br />
es um Verteilkämpfe, wie sie sich rund um öffentliche Mittel abspielen.<br />
Das Anliegen der Kreise, die die Sicherung von Kunstnachlässen als<br />
öffentlichen Auftrag verstanden wissen wollen, lässt sich zunächst<br />
gut nachvollziehen. Denn es weist auf kulturpolitische und kulturphilosophische<br />
Fragen und Widersprüche hin – und vor allem auf einige<br />
Besonderheiten der Kunstökonomie 5 .<br />
Kurz gesagt, ist der Kunstbetrieb spätestens seit dem 19. Jahrhundert<br />
zunehmend durch eine explodierende Zahl von künstlerisch<br />
tätigen Individuen geprägt. Sie und ihre schon allein mengenmässig<br />
zunehmende, aber auch stilistisch immer diversere Produktion prägen<br />
das zunehmende Wechselspiel von Angebot und Nachfrage auf<br />
einem sich erweiternden Markt. Auch auf Käuferseite treten regelmässig<br />
neue Akteure auf. Die zuvor dominierende Abhängigkeit von den<br />
Aufträgen feudaler oder kirchlicher Kreise tritt in den Hintergrund (oder<br />
wird wenigstens zum Teil von staatlichen Institutionen übernommen).<br />
Selbst die einst strengen Kontroll- und Juryfunktionen der zunächst<br />
königlichen, später staatlichen Kunstakademien wird immer häufiger<br />
1 Storrer zählte zu den Künstlern, die ihr Atelier bewusst vor fremden<br />
Blicken schützen. Doch kaum waren die Fenster in Storrers Atelier, die<br />
sich so lange hinter schweren Rollläden verborgen hatten, zum Lüften<br />
geöffnet, reckten sich neugierige Köpfe hinein. Ältere Künstlerinnen<br />
und Künstler aus der Roten Fabrik, die Storrer noch gekannt hatten<br />
und denen er offenbar nie Zugang gewährt hatte, wollten unbedingt<br />
einen Blick in seinen Raum erhaschen.<br />
Je weniger zugänglich ein Atelier ist, desto mehr Legenden<br />
ranken sich darum. Dass Peter Storrer sein Atelier als Rückzugsraum<br />
wichtig gewesen war, hatte mir schon mein erster Besuch dort klar<br />
gemacht. Die Sorgfalt, mit der er es eingerichtet hatte, sprach dafür,<br />
selbst wenn die Ordnung schliesslich aus den Fugen geraten war. Es<br />
musste ihm ein Studiolo vorgeschwebt haben. Ein Hieronymus-Gehäuse,<br />
in dem er auch ruhen, nachdenken, notfalls sogar übernachten,<br />
handwerklich arbeiten, lesen, musizieren konnte.<br />
Wie soll man mit einem solchen Atelier, mit einer Fülle, die Züge<br />
einer theatralischen Inszenierung trägt, angemessen umgehen? Man<br />
kann hier nur Fehler machen. Mit ein Grund dafür ist der Kultstatus,<br />
den Ateliers im 20. Jahrhundert erreicht haben. Sie sind Pilgerorte für<br />
Kunstfans, werden insbesondere von den Medien als geheimnisvolle<br />
Maschinenräume der Kreativität dargestellt. Mit der Geschichte der<br />
Stilisierung des Ateliers zu einem mythisch aufgeladenen Raum liesse<br />
sich ein substantielles Unterkapitel der modernen Kunstgeschichte<br />
schreiben. Üppiges Material hierzu liefert das Textgenre des Atelierbesuchs<br />
durch gewogene Zeitzeugen, das parallel zur modernen Kunst<br />
entstanden ist. Klassiker des Genres sind hier etwa Jean Genets Text<br />
«L’Atelier d’Alberto Giacometti» (zusammen mit Ernst <strong>Scheidegger</strong>s<br />
Fotografien des Pariser Ateliers von Giacometti 1958/1963 erschienen)<br />
5 Exemplarisch: Pierre-Michel Menger, Le travail créateur, Paris 2009.<br />
oder David Sylvesters legendäre Gespräche mit Francis Bacon.