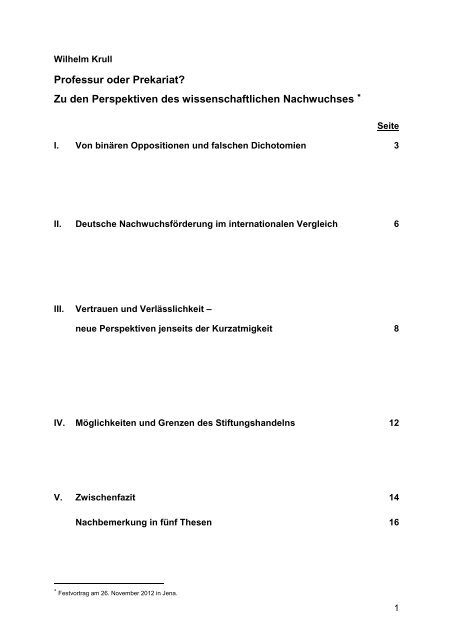Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Zu den Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wilhelm Krull<br />
Professur oder Prekariat?<br />
<strong>Zu</strong> <strong>den</strong> <strong>Perspektiven</strong> <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong> <strong>Nachwuchses</strong> ∗<br />
Seite<br />
I. Von binären Oppositionen und falschen Dichotomien 3<br />
II. Deutsche Nachwuchsförderung im internationalen Vergleich 6<br />
III. Vertrauen und Verlässlichkeit –<br />
neue <strong>Perspektiven</strong> jenseits der Kurzatmigkeit 8<br />
IV. Möglichkeiten und Grenzen <strong>des</strong> Stiftungshandelns 12<br />
V. Zwischenfazit 14<br />
Nachbemerkung in fünf Thesen 16<br />
∗ Festvortrag am 26. November 2012 in Jena.<br />
1
Lieber Herr Dicke,<br />
liebe Frau Mummendey,<br />
verehrte Frau Professor Kothe,<br />
verehrte Frau Dickhaut,<br />
liebe Tagungsteilnehmer(innen),<br />
meine sehr verehrten Damen und Herren,<br />
Sie alle hier im Saal stimmen vermutlich mit dem ersten Teil <strong>des</strong> folgen<strong>den</strong> Zitats von<br />
Albert Einstein überein, der dereinst feststellte: „Die Wissenschaft ist eine wunderbare<br />
Sache, wenn man nicht seinen Lebensunterhalt damit verdienen muss.“ – Das<br />
Problem, diesem Satz insgesamt zustimmen zu können, liegt vermutlich für viele von<br />
Ihnen in dem Relativsatz. Denn damit wird zugleich das Spannungsverhältnis zwischen<br />
der faszinieren<strong>den</strong> Suche nach neuen Erkenntnissen einerseits und der Not-<br />
wendigkeit, soziale Existenzsicherung zu betreiben, andererseits, auf <strong>den</strong> Punkt gebracht.<br />
In der Tat streben in Deutschland immer mehr junge Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftler an, nicht nur für die Wissenschaft leben zu wollen, sondern<br />
auch von ihr leben zu können. Und es wer<strong>den</strong> von Jahr zu Jahr mehr!<br />
Etwa zeitgleich mit Albert Einstein hat der Soziologe Max Weber in seinem Aufsatz<br />
„Wissenschaft als Beruf“ (1919) das gleiche Spannungsfeld als ein typisch deutsches<br />
Phänomen diagnostiziert. Dabei stellte Weber <strong>den</strong> Status <strong>des</strong> habilitierten Privatgelehrten,<br />
der letztlich seiner <strong>wissenschaftlichen</strong> Lei<strong>den</strong>schaft nur nachgehen kann,<br />
weil er durch ein entsprechen<strong>des</strong> Einkommen aus anderen Quellen abgesichert ist,<br />
dem amerikanischen Modell der auf jeder Qualifikationsstufe finanziell ausreichend<br />
dotierten hauptberuflichen Tätigkeit gegenüber. „Bei uns – das weiß jeder – beginnt<br />
normalerweise die Laufbahn eines jungen Mannes, der sich der Wissenschaft als<br />
Beruf hingibt, als Privatdozent. Er habilitiert sich nach Rücksprache und mit <strong>Zu</strong>stimmung<br />
<strong>des</strong> betreffen<strong>den</strong> Fachvertreters, auf Grund eines Buches und eines meist<br />
mehr formellen Examens vor der Fakultät, an einer Universität und hält nun, unbesoldet,<br />
entgolten nur durch das Kolleggeld der Stu<strong>den</strong>ten, Vorlesungen, deren Gegenstand<br />
er innerhalb seiner venia legendi selbst bestimmt. In Amerika beginnt die<br />
2
Laufbahn normalerweise ganz anders, nämlich durch Anstellung als assistant. In<br />
ähnlicher Art etwa, wie das bei uns an <strong>den</strong> großen Instituten der naturwissenschaftli-<br />
chen und medizinischen Fakultäten vor sich zu gehen pflegt, wo die förmliche Habili-<br />
tation als Privatdozent nur von einem Bruchteil der Assistenten und oft erst spät erstrebt<br />
wird. Der Gegensatz bedeutet praktisch: dass bei uns die Laufbahn eines<br />
Mannes der Wissenschaft im Ganzen auf plutokratischen Voraussetzungen aufgebaut<br />
ist. Denn es ist außeror<strong>den</strong>tlich gewagt für einen jungen Gelehrten, der keinerlei<br />
Vermögen hat, überhaupt <strong>den</strong> Bedingungen der akademischen Laufbahn sich auszusetzen.<br />
Er muss es min<strong>des</strong>tens eine Anzahl Jahre aushalten können, ohne irgendwie<br />
zu wissen, ob er nachher die Chancen hat, einzurücken in eine Stellung, die<br />
für <strong>den</strong> Unterhalt ausreicht.“ Weber sagte zugleich voraus, dass das amerikanische<br />
Modell sich im weiteren Verlauf <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts überall durchsetzen werde.<br />
Seit Max Webers Analyse hat sich in Deutschland – nicht zuletzt aufgrund der gro-<br />
ßen Expansionswelle in <strong>den</strong> 1960er- und 1970er-Jahren – überaus viel getan. Mittlerweile<br />
ist die Zahl der Professuren auf über 40.000 angestiegen und auch die wis-<br />
senschaftlichen Mitarbeiterstellen belaufen sich auf rund 150.000 (im Jahre 2000 waren<br />
es noch 100.000)<br />
. Aber zwei andere Zahlen zeigen uns, dass das Problem der privat finanzierten <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Betätigung in Deutschland noch längst nicht von der Bildfläche ver-<br />
schwun<strong>den</strong> ist: Laut Aussagen <strong>des</strong> HRK-Präsidiums befin<strong>den</strong> sich derzeit mehr als<br />
200.000 Doktorand(innen) in der Phase <strong>des</strong> Promovierens und außerdem ist die Zahl<br />
der Lehrbeauftragten (von <strong>den</strong>en viele gänzlich unbezahlt bleiben) seit 2005 von<br />
11.349 auf 16.828 (2010) gestiegen. Darüber hinaus zeigt ein Blick auf die Förder-<br />
angebote und vor allem die Förderzeiträume sehr rasch, dass große Diskrepanzen<br />
zwischen <strong>den</strong> prognostizierten Zielen und <strong>den</strong> harten Realitäten bestehen. So liegt<br />
zum Beispiel die durchschnittliche Förderdauer für Promoven<strong>den</strong> bei 2 – 3 Jahren,<br />
die durchschnittliche Promotionsdauer hingegen bei 4,6 Jahren. Wem dies bei Weitem<br />
zu lang erscheint, der werfe einen Blick in die USA: Dort beträgt die durchschnittliche<br />
Promotionszeit 7,7 Jahre (vgl. NSF 2008 Survey of Earned Doctorates).<br />
3
I. Von binären Oppositionen und falschen Dichotomien<br />
Der Begründer der Strukturalen Anthropologie, Claude Lévi-Strauss, hat in seinen<br />
Studien herausgearbeitet, dass ein Charakteristikum <strong>des</strong> mythischen Denkens vor<br />
allem die Verwendung binärer Oppositionen ist. Ausgehend von der konstitutiven<br />
Erfahrung je<strong>des</strong> Einzelnen, dass zu dem Selbst das Andere hinzutritt, erweisen sich<br />
im mythischen Denken zahlreiche Dualismen und Gegensatzformen als konstant, so<br />
z. B. hell versus dunkel, krank versus gesund, aber auch „Hälftensysteme“ wie Ost<br />
und West, Sonne und Mond, Tag und Nacht sowie Feuer und Wasser (vgl. Claude<br />
Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie. Frankfurt am Main 1967. S. 165).<br />
Hat man ein solches Oppositionspaar erst einmal etabliert und mit gleichen dualen<br />
Achsen verknüpft, so ergeben sich – zumin<strong>des</strong>t für <strong>den</strong> jeweiligen Kulturkreis – daraus<br />
Beziehungslogiken. Für uns in Europa bedeutet dies etwa, dass wir <strong>den</strong> Gegen-<br />
satz von Freud und Leid zugleich mit <strong>den</strong> Farben weiß und schwarz verbin<strong>den</strong>.<br />
Durch die Korrelativierung wer<strong>den</strong> der Farbcode und der Gefühlscode aufs Engste<br />
miteinander verknüpft. So sinnfällig dies jeweils auch erscheinen mag, so wichtig ist<br />
es doch, sich der jeweiligen Beziehungskonstruktion bewusst zu wer<strong>den</strong>. Michael<br />
Opitz hat bereits in seinem Buch „Notwendige Beziehungen“ auf die letztlich willkürlichen<br />
Verknüpfungen hingewiesen: „Man kann mit Trauer ebenso weiß verbin<strong>den</strong> wie<br />
schwarz, was die Fakten beweisen. Die schwarze Kleidung einer europäischen Wit-<br />
we, auch wenn sie lacht, bedeutet: Sie ist in Trauer. Und das weiße Kleid der Braut,<br />
mag ihr auch noch so wenig danach zu Mute sein, bezeichnet Freude. In Süd-<br />
ostasien oder in China demgegenüber ist die Farbe der Trauer weiß. Hier wird also<br />
wieder einmal sinnfällig, was de Saussure l’arbitraire du signe nannte. Das aber gilt<br />
nicht mehr für <strong>den</strong> zweiten Begriff. Steht der erste einmal in seiner Bezeichnungsfunktion<br />
fest, ist der zweite nicht mehr frei. Er kann nur noch das Gegenteil bezeich-<br />
nen.“ (Michael Opitz: Notwendige Beziehungen. Abriss der strukturalen Anthropologie.<br />
Frankfurt am Main 1975. S. 293.)<br />
In unserem Alltagsleben neigen wir dazu, die oftmals komplexen Beziehungen dualistisch<br />
zu betrachten und – gewissermaßen aus Gewohnheit – uns so zu orientieren.<br />
Mir scheint, dass bisweilen auch im wissenschaftspolitischen Denken dieselbe Logik<br />
wie in dem soeben charakterisierten mythischen Denken am Werke ist und wir die<br />
komplexen <strong>Zu</strong>sammenhänge am liebsten in Form von Gegensätzen, Widersprüchen<br />
4
und Dilemmata betrachten. Mir scheint ferner, dass wir uns beispielsweise mit Blick<br />
auf die Promotionsphase noch immer im Spannungsfeld solcher, zumeist falscher<br />
Dichotomien, bewegen. Lassen Sie mich nur drei davon kurz beleuchten: Transparenz<br />
versus Autonomie; Individualität versus Teamarbeit; dritte Phase der Ausbildung<br />
oder eigenständige Forschung. Im ersten Fall steht auf der einen Seite die Forderung<br />
nach mehr Transparenz, d. h. nach offenen, klar strukturierten Aufnahmeverfahren,<br />
Promotionsvereinbarungen und „Thesis Advisory Committees“, auf der anderen Seite<br />
steht die Erwartung der Professorinnen und Professoren, bei der Auswahl und Betreuung<br />
ihrer Doktorandinnen und Doktoran<strong>den</strong> freie Hand zu haben. Die Erwartung,<br />
dass die Doktorandin und Doktoran<strong>den</strong> mit ihrer Dissertation eine eigenständige wissenschaftliche<br />
Arbeit vorlegen sollen, wird von manchen in dem Sinne falsch verstan<strong>den</strong>,<br />
dass diese Arbeit in der Abgeschie<strong>den</strong>heit einer Studierstube ohne regelmäßigen<br />
Austausch mit der Betreuerin oder dem Betreuer entstehen muss, von an-<br />
deren wird die Forderung nach mehr Teamarbeit gar so interpretiert, dass die Leistung<br />
der Doktorandinnen oder <strong>des</strong> Doktoran<strong>den</strong> in der Teamleistung aufgeht und<br />
somit nicht individuell erkennbar gewürdigt wer<strong>den</strong> kann. Vor dem Hintergrund der<br />
Bologna-Reformen ist zudem ein wissenschaftspolitischer Streit darüber entbrannt,<br />
ob es sich bei der Promotion in erster Linie um eine Fortsetzung <strong>des</strong> Studiums in der<br />
sogenannten „Dritten Phase“ oder um selbstbestimmte Forschung handelt. Diese<br />
falsch verstan<strong>den</strong>en Dichotomien gilt es so schnell wie möglich aufzulösen; <strong>den</strong>n die<br />
Promotionsphase bildet in jedem Fall die Grundlage für späteres wissenschaftliches<br />
und berufliches Wirken. Hier wer<strong>den</strong> schließlich die Weichen gestellt, die in die Wissenschaft<br />
oder aus ihr heraus führen. Ausschlaggebend für die Entscheidung für o-<br />
der gegen eine Karriere in der Wissenschaft sind natürlich auch die <strong>Perspektiven</strong>, die<br />
sich für Promovierende nach Abschluss ihrer Dissertation ergeben.<br />
Um aus diesen Dichotomien und Dilemmata herauszukommen, brauchen wir dringend<br />
eine veränderte Farb- und Gefühlsskala. Um diese zu entwickeln, könnte es<br />
nützlich sein, sich die konzeptionellen Vorarbeiten der Carnegie Foundation for the<br />
Advancement of Teaching anzuschauen, die in zwei Bän<strong>den</strong> mit <strong>den</strong> jeweiligen Titeln<br />
„Envisioning the Future of Doctoral Education: Preparing Stewards of the Discipline –<br />
Carnegie Essays on the Doctorate“ (2006) und „Information of Scholars: Rethinking<br />
Doctoral Education for the Twenty-First Century“ (2008) publiziert wur<strong>den</strong>.<br />
5
Über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren hat die Carnegie Foundation for the<br />
Advancement of Teaching die Herausforderungen analysiert, vor <strong>den</strong>en man auch in<br />
<strong>den</strong> Vereinigten Staaten im Hinblick auf die Ausbildung der Studieren<strong>den</strong> sowie die<br />
Förderung von Promovieren<strong>den</strong> und Postdocs steht: Die sich verändernde demografische<br />
<strong>Zu</strong>sammensetzung der Studieren<strong>den</strong>schaft, neue Formen <strong>des</strong> Wettbewerbs,<br />
rückläufige öffentliche Finanzierung und nicht zuletzt hohe Abbrecherquoten, zu <strong>den</strong>en<br />
der Projektleiter George E. Walker bemerkte: „ One half of today’s doctoral stu-<br />
<strong>den</strong>ts drop out and many who do persist find that they are ill-prepared for the work<br />
they choose, it’s time that all doctoral programs face fundamental questions about<br />
purpose, vision and quality.“<br />
Als Bildungsziel für die Ausbildung von Doktoran<strong>den</strong> entwickelte die Projektgruppe<br />
der Carnegie Foundation das Leitbild <strong>des</strong> „Steward of the Discipline“. Ein „Steward“<br />
sollte mit Abschluss der Promotion in der Lage sein, sowohl die Entwicklung seines<br />
Faches umfassend zu überblicken als auch kreativ neues Wissen hervorzubringen,<br />
neue Ideen anderer Forscherteams kritisch zu validieren und vor allem auf verantwortungsvolle<br />
Weise unser Verständnis <strong>des</strong> jeweiligen Forschungsfel<strong>des</strong> durch Pub-<br />
lizieren, Unterrichten und Anwen<strong>den</strong> bereichern. „Steward of the Discipline“ bedeutet<br />
also mehr als das bloße Ansammeln nützlicher Metho<strong>den</strong> und Kenntnisse. Mit ande-<br />
ren Worten: Ein Steward sollte mit hohem Engagement, unbestrittener Qualität und<br />
mit großer Integrität sein Forschungsfeld vertreten können und zugleich für inter- und<br />
transdisziplinäre Problemstellungen offen sein. Für Lee Shulman, <strong>den</strong> damaligen<br />
Präsi<strong>den</strong>ten der Carnegie Foundation, lief die gesamte Initiative auf folgen<strong>den</strong><br />
Schluss hinaus: „The doctoral programs attempt to discover the ‚sweet spot‘ between<br />
conservation and change by teaching skepticism and respect for earlier traditions and<br />
courses while encouraging strikingly new ideas and courageous leaps forward.”<br />
II. Deutsche Nachwuchsförderung im internationalen Vergleich<br />
Angesichts der eingangs zitierten, rasant angestiegenen Zahlen von Doktoran<strong>den</strong>,<br />
Postdocs und <strong>wissenschaftlichen</strong> Mitarbeiter(innen) und der sich damit zugleich verengen<strong>den</strong><br />
Aussichten auf eine permanente Beschäftigung im deutschen Wissen-<br />
schaftssystem erscheint vielen nach wie vor ein Blick in Richtung USA wie der in<br />
“Das gelobte Land”. Bei näherem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass sich auch die<br />
6
weltweit bewunderten amerikanischen Universitäten zunehmend in einer Krise befin-<br />
<strong>den</strong>. Die Präsi<strong>den</strong>tin der in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise stark gebeutelten<br />
Harvard University hat im September 2009 in der New York Times festgestellt:<br />
„American Universities have long struggled to meet almost irreconcilable demands: to<br />
be practical as well as transcen<strong>den</strong>t; to assist immediate national needs and to pur-<br />
sue knowledge for its own sake to both add value and question values.“ (Drew Gilpin<br />
Faust: The University’s Crisis of Purpose. In “The New York Times”, 6.9.2009.)<br />
Rund ein Jahr später stellte ein Autor <strong>des</strong> Wirtschaftsmagazins „The Economist“ die<br />
Frage „Will America’s universities go the way of its car companies?“ und verwies auf<br />
folgende Entwicklungen, wie sie mittlerweile übrigens auch in Großbritannien festzu-<br />
stellen sind: Die Studiengebühren und Verwaltungskosten sind in dramatische Höhen<br />
angestiegen. Die Studienabbrecherzahlen schnellen ebenfalls in die Höhe. Die universitäre<br />
Lehre wird auf Kosten der Forschung vernachlässigt. Der Wettbewerb zwischen<br />
<strong>den</strong> Hochschulen konzentriert sich auf <strong>den</strong> Einkauf von Star-Professorinnen<br />
und -Professoren sowie <strong>den</strong> Ausbau der Universitätsgebäude und Parkanlagen.<br />
Rund 4.000 Corporate Universities weltweit stellten vor allem im Bereich der Weiter-<br />
bildung eine zusätzliche Herausforderung dar. Das Fazit <strong>des</strong> Artikels lautet: „America’s<br />
universities lost their way badly in the era of easy money. If they do not find it<br />
again, they may go the way of GM.” (Declining by degree. Will America’s universities<br />
go the way of its car companies?, in: “The Economist”, 2.9.2010.)<br />
Mögen die angelsächsischen Universitäten auch in vielerlei Hinsicht große Schwie-<br />
rigkeiten haben, etwa ihre Doktorandinnen und Doktoran<strong>den</strong> zum Abschluss zu bringen,<br />
so können wir uns jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass sie – vor allem<br />
in der Postdocphase – immer noch in der Spitze die kreativen Potenziale besser zu<br />
nutzen wissen als andere Einrichtungen in der Welt. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist<br />
dabei die Kombination von hervorragen<strong>den</strong> Infrastrukturen in <strong>den</strong> einzelnen Hochschulen<br />
mit privatem Mäzenatentum und der Förderung durch auf Spitzenforschung<br />
fokussierte, private Stiftungen. Für die USA ist hier etwa das Howard Hughes Medical<br />
Institute zu nennen, <strong>des</strong>sen erfolgreiche „Investigatorprogramme“ durch individuelle<br />
Förderung herausragender Forscherpersönlichkeiten und die Bereitschaft, besonders<br />
risikoreiche Projekte zu unterstützen, als eine Art Benchmark für moderne<br />
biomedizinische Forschung gelten kann. Das Vorgehen von Howard Hughes Medical<br />
Institute beruht auf der Überzeugung „that scientists of exceptional talent and imagi-<br />
7
nation will make fundamental contributions of lasting scientific value and benefit to<br />
mankind when given the resources, time and freedom to pursue challenging questions.”<br />
(vgl. URL: http://www.hhmi.org/about.faq.html; Stand: 1.9.2011.)<br />
Der britische Wellcome Trust, der jährlich mehr als 500 Millionen £ in biomedizinische<br />
Forschung investiert, hat sich im November 2009 mit der Einrichtung der „Investigatorawards“<br />
ebenfalls ganz bewusst dafür entschie<strong>den</strong>, in <strong>Zu</strong>kunft verstärkt auf<br />
langfristige Personenförderung zu setzen. In der Pressemitteilung zur Einrichtung<br />
dieses Awards hieß es: „Wellcome Trust Investigator Awards will provide researchers<br />
and their teams with a support to pursue individual bold visions without constraints.<br />
Awards will give researchers the maximum amount of freedom to be creative and<br />
innovative in their approach.” (Wellcome Trust - press release: Wellcome Trust seeks<br />
world class researchers to tackle most ambitious biomedical research questions; vom<br />
12.11.2009.) Dieses Förderangebot <strong>des</strong> Wellcome Trusts richtet sich sowohl an exzellente<br />
Nachwuchswissenschaftlerinnen/-wissenschaftler (new investigator awards)<br />
als auch an auf ihrem Gebiet international bereits führende Forscherpersönlichkeiten<br />
(‘Senior investigator awards’). Der Wellcome Trust geht damit einen ähnlichen Weg,<br />
wie er seit 2007 auch durch <strong>den</strong> European Research Council forciert wird, nämlich<br />
die Fokussierung der Fördertätigkeit auf herausragende Forscherpersönlichkeiten<br />
statt auf Projekte!<br />
III. Vertrauen und Verlässlichkeit – neue <strong>Perspektiven</strong> jenseits der Kurzatmigkeit<br />
Mittel für innovative und risikoreiche Forschungsvorhaben von Postdocs stellt vereinzelt<br />
auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, etwa im Rahmen ihrer Emmy<br />
Noether-, Heisenberg- und Reinhart Koselleck-Programme sowie teilweise auch in<br />
<strong>den</strong> Forschungsclustern der Exzellenzinitiative, zur Verfügung. Die Förderzeiträume<br />
erstrecken sich jedoch dabei auf maximal fünf Jahre. In <strong>den</strong> meisten Fällen ist auch<br />
noch kein tenure track bei Projekterfolg gewährleistet. So bleibt das Problem der fehlen<strong>den</strong><br />
langfristigen <strong>Perspektiven</strong> im deutschen Wissenschaftssystem weitestgehend<br />
bestehen und damit auch das Problem eines größer wer<strong>den</strong><strong>den</strong> „brain drain“, insbe-<br />
sondere in Richtung USA, aber auch in einige unserer europäischen Nachbarländer.<br />
8
Wenn wir im Sinne <strong>des</strong> vorhin angesprochenen neuen Farb- und Gefühlsco<strong>des</strong> –<br />
gerade auch für Postdocs – vorankommen wollen, dann erscheint es wichtig, die bi-<br />
nären Oppositionen und verqueren Beziehungslogiken der folgen<strong>den</strong> sieben Prob-<br />
lemkreise produktiv aufzulösen. Es sind dies die Begriffspaare: Universität und Interdisziplinarität;<br />
Wissenschaft und Wettbewerb; Begutachtung und Innovation; Spezia-<br />
lisierung und Überblickskompetenz; Betreuung und Selbständigkeit; <strong>Zu</strong>gehörigkeit<br />
und Mobilität; Hochschulkarriere und Geschlecht.<br />
<strong>Zu</strong>nächst zu dem Begriffs-, manchmal auch Gegensatzpaar „Universität und Interdis-<br />
ziplinarität“. In nahezu allen Forschungssystemen nehmen die Universitäten einen<br />
zentralen Platz ein; <strong>den</strong>n sie sind es, die in erster Linie <strong>den</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Nachwuchs ausbil<strong>den</strong>. Für <strong>den</strong> Wissenschaftsrat sind sie gar seit langem "die wichtigsten<br />
Stätten der Forschung". Die deutschen Hochschulen verfügen über ein geradezu<br />
beängstigend breites Spektrum an Fachgebieten und Spezialdisziplinen. Der<br />
Fächerkatalog <strong>des</strong> Hochschulverban<strong>des</strong> registriert mittlerweile mehr als 4.000 Fach-<br />
gebiete. <strong>Zu</strong>gleich kommt der Austausch zwischen <strong>den</strong> verschie<strong>den</strong>en Gebieten häufig<br />
immer noch zu kurz, dabei bewegt sich besonders innovative Forschung meist an<br />
<strong>den</strong> Rändern der herkömmlichen Fächer und Disziplinen. Der wissenschaftliche<br />
Nachwuchs steht vor der Herausforderung, sowohl <strong>den</strong> Ansprüchen seines jeweiligen<br />
Faches gerecht zu wer<strong>den</strong> als auch über <strong>den</strong> Tellerrand <strong>des</strong> eigenen Fachgebietes<br />
hinauszublicken. Bei weit ausgreifender Interdisziplinarität besteht in Deutschland<br />
nach wie vor die Gefahr, dass eine Hochschulkarriere dadurch stark beeinträchtigt<br />
wer<strong>den</strong> könnte. Interdisziplinäre Neugier von Nachwuchswissenschaftler/inne/n sollte<br />
jedoch weder von Forschungsförderern noch bei universitären Berufungsverfahren<br />
bestraft, sondern vielmehr von allen beteiligten Akteuren gefördert wer<strong>den</strong>. Ent-<br />
schlossenheit und Mut zu Grenzüberschreitungen sollten nachhaltig belohnt wer<strong>den</strong>.<br />
Was das Begriffspaar Wissenschaft und Wettbewerb betrifft, so kann Wissenschaftsförderung<br />
– je<strong>den</strong>falls auf mittlere Sicht – nicht ohne Wettbewerb auskommen. Der<br />
immer wieder zu erneuernde Zwang zur Auswahl <strong>des</strong> Besten ist geradezu eine<br />
Grundbedingung für <strong>den</strong> Erfolg. Dies gilt für einzelne Projekte ebenso wie für ganze<br />
Programme, erst recht aber für Personen. Diesem Wettbewerb müssen sich Nachwuchswissenschaftler/innen<br />
stellen. Dabei kommt es entschei<strong>den</strong>d darauf an, dass<br />
dies in für alle Beteiligten transparenten und nachvollziehbaren Verfahren, nach anerkannten<br />
Kriterien und nicht zuletzt in einem institutionellen Rahmen geschieht, der<br />
9
das volle Vertrauen der Antragsteller wie der Gutachter genießt. Gerade mit Blick auf<br />
die originellsten Köpfe und deren Förderung kann ein Forschungssystem nicht darauf<br />
verzichten, ein möglichst breites und vielfältiges Förderangebot zu haben und auch<br />
immer wieder Korrekturmöglichkeiten einzubauen, die eine Durchlässigkeit insbesondere<br />
für diejenigen gewährleisten, die nicht <strong>den</strong> üblichen Karriereweg einge-<br />
schlagen haben.<br />
Das Begriffspaar „Begutachtung und Innovation“ sollte nach Möglichkeit nicht zu einem<br />
Gegensatzpaar wer<strong>den</strong>. Für die Begutachtung der Tragfähigkeit von Projektideen<br />
und der <strong>wissenschaftlichen</strong> Leistungsfähigkeit von Antragstellern hat sich in<br />
der Scientific Community das so genannte Peer Review-Verfahren durchgesetzt, d.h.<br />
die Beurteilung durch ausgewiesene Fachkollegen. Durch kein anderes Verfahren<br />
scheint in gleicher Weise sichergestellt wer<strong>den</strong> zu können, dass die Auswahl von<br />
Bewerbern für leitende Wissenschaftlerstellen, von förderungswürdigen Stipendiaten<br />
oder Projektanträgen, von Zeitschriftenmanuskripten etc. nach <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Qualitätsstandards vorgenommen wird. Kritiker werfen der Selbststeuerung der Wis-<br />
senschaft durch peer review jedoch vor, diese sei unzuverlässig, nicht valide, unfair<br />
und schade vor allem der besonders originellen, innovativen Forschung. Tatsächlich<br />
ist das Peer Review-Verfahren primär ein Instrument der Qualitätssicherung und weniger<br />
eines der risikofreudigen Förderung von ganz neuen Ideen. Dies gilt insbeson-<br />
dere mit Blick auf inter- und transdisziplinäre Vorhaben, für die sich ein schriftliches<br />
Begutachtungsverfahren mit entsprechen<strong>den</strong> Stellungnahmen mehrerer Spezialisten<br />
aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen Disziplinen nicht bewährt hat. In der VolkswagenStiftung<br />
arbeiten wir daher immer mehr mit Gutachterkreisen, die wir in die Stif-<br />
tung einla<strong>den</strong> und mit <strong>den</strong>en wir gemeinsam die Chancen und Risiken; also die Förderungswürdigkeit<br />
der einzelnen Anträge erörtern. Wissenschaftsförderern bleibt<br />
letztlich nichts anderes übrig, als immer wieder zu versuchen, die Begutachtungsprozesse<br />
so fair wie möglich zu gestalten und sie in ihren einzelnen Verfahrensschritten<br />
zu optimieren. Fairness gegenüber dem <strong>wissenschaftlichen</strong> Nachwuchs impliziert<br />
hier u.a. auch eine möglichst zügige und transparente Abwicklung <strong>des</strong> Verfahrens.<br />
Was das augenscheinliche Gegensatzpaar „Spezialisierung und Überblickskompetenz“<br />
betrifft, so kann auch der schärfste Kritiker disziplinärer Spezialisierung oder<br />
gar Überspezialisierung nicht umhin, <strong>den</strong> gerade dadurch möglich gewor<strong>den</strong>en<br />
enormen Wissenszuwachs über die letzten Jahrzehnte hinweg anzuerkennen. Mittels<br />
10
immer stärker fokussierter Forschung ist es gelungen, eine Fülle von Detailwissen<br />
über unsere natürlichen und gesellschaftlichen Umweltbedingungen anzuhäufen. Die<br />
arbeitsteilige Erzeugung neuen Wissens hat aber nicht nur zur Klärung von Einzelfragen<br />
geführt, sondern zugleich – etwa in Medizin und Technik – zu einer enormen<br />
Verbesserung unserer Lebensqualität beigetragen. Der Preis einer solchen arbeitsteiligen<br />
Spezialisierung für <strong>den</strong> Einzelnen ist freilich hoch: Er weiß am Ende immer<br />
mehr über immer weniger. Während seine Fachkompetenz weiter wächst, besteht<br />
zugleich die Gefahr, dass er an Überblickskompetenz und Urteilsfähigkeit verliert.<br />
Insbesondere bei der Ausbildung und Förderung <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong> <strong>Nachwuchses</strong><br />
gilt es jedoch, darauf zu achten, dass eben diese Überblickskompetenz gewonnen<br />
wird, da sie der Schlüssel zum Stellen und Beantworten großer Forschungsfra-<br />
gen ist.<br />
Mit Blick auf <strong>den</strong> Problemkreis „Betreuung und Selbstständigkeit“ ist in <strong>den</strong> vergan-<br />
genen zehn Jahren viel geschehen. Die frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit<br />
von Nachwuchswissenschaftler(innen) wird zumin<strong>des</strong>t von <strong>den</strong> Wissenschaftsförder-<br />
organisationen zunehmend unterstützt, um das kreative Potenzial und die Motivation<br />
der Nachwuchsforscher/innen optimal nutzen zu können. Die Hochschulen und ins-<br />
besondere die Professorenschaft durchlaufen in diesem Punkt zwar z. T. immer noch<br />
einen Lernprozess, doch die so notwendige Entwicklung hin zu mehr Eigenständig-<br />
keit von Nachwuchswissenschaftler(innen) scheint unumkehrbar.<br />
„<strong>Zu</strong>gehörigkeit“ auf der einen und „Mobilität“ auf der anderen Seite sind zwei nicht<br />
zuletzt mit Blick auf die Bindung und Ausbildung <strong>des</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong> <strong>Nachwuchses</strong><br />
wichtige Faktoren, die in <strong>den</strong> letzten Jahren zunehmend in <strong>den</strong> Fokus der Hoch-<br />
schulleitungen gerückt sind. Noch vor wenigen Jahren galt es an deutschen Hochschulen<br />
als verpönt, über ein gemeinsames Leitbild für die eigene Institution, über<br />
gemeinsame Ziele oder auch nur über die Notwendigkeit einer Kontaktpflege zu <strong>den</strong><br />
ehemaligen Stu<strong>den</strong>tinnen und Stu<strong>den</strong>ten zu re<strong>den</strong>. Die "weichen Faktoren", mit <strong>den</strong>en<br />
man so etwas wie ein Wir-Gefühl erzeugen möchte, wer<strong>den</strong> von <strong>den</strong> heutigen<br />
Hochschulleitungen jedoch zunehmend als wichtig erkannt und kaum noch belächelt.<br />
Dieser Prozess wird begleitet von einem grundlegen<strong>den</strong> Über<strong>den</strong>ken der bisherigen,<br />
vorwiegend auf Partnerschaftsabkommen beruhen<strong>den</strong> Internationalisierungsstrategien.<br />
Um im internationalen Hochschulwettbewerb bestehen zu können, sind nämlich<br />
regelrechte "strategische Allianzen" erforderlich. So könnten sich z.B. durch "Interna-<br />
11
tional Graduate Schools" gemeinsam mit international führen<strong>den</strong> Universitäten ande-<br />
rer Länder für die deutschen Hochschulen ganz neue Möglichkeiten auftun, ihre Leis-<br />
tungsfähigkeit zu demonstrieren und ein Stück Reputation zurückzugewinnen. <strong>Zu</strong>-<br />
gleich könnten sie damit ihren Stu<strong>den</strong>ten und Nachwuchswissenschaftlern ganz<br />
neue Chancen im Rahmen einer international vernetzten Ausbildung eröffnen. <strong>Zu</strong><br />
einer guten Nachwuchspflege gehört eben auch, dass man diesen rechtzeitig flügge<br />
wer<strong>den</strong> lässt. Davon profitieren letztlich sowohl die beteiligten Institutionen als auch<br />
insbesondere die jeweiligen Personen. Letztere können nicht nur neues Wissen erwerben,<br />
Erfahrungen in ausländischen Lebens- und Forschungszusammenhängen<br />
machen, Verantwortung für die Durchführung international vernetzter Forschungsprojekte<br />
übernehmen, sondern auch ihre persönlichen Chancen für eine erfolgreiche<br />
Forscherkarriere deutlich erhöhen.<br />
Noch immer haben überwiegend Männer die Spitzen- und Führungspositionen im<br />
deutschen Wissenschaftssystem inne. Zwar ist der Anteil der Lehrstuhlinhaberinnen<br />
seit 1995 von acht auf rund 18 Prozent angestiegen, doch in Sachen Chancen-<br />
gleichheit von Männern und Frauen in der Wissenschaft hinkt Deutschland international<br />
gesehen immer noch weit hinterher. Ein wesentlicher Grund dürfte auch darin zu<br />
sehen sein, dass in der mit vielen Ungewiss- und Unsicherheiten versehenen Postdocphase<br />
überproportional viele Frauen der Wissenschaft <strong>den</strong> Rücken kehren. Wer<br />
sich in der deutschen Förderlandschaft umsieht, der wird zwar allenthalben auf Förderangebote<br />
speziell für <strong>den</strong> weiblichen <strong>wissenschaftlichen</strong> Nachwuchs stoßen, doch<br />
diese Angebote nützen wenig, wenn nicht gleichzeitig ein Um<strong>den</strong>ken bei Hochschulleitungen<br />
und Berufungskommissionen stattfindet. Die Exzellenzinitiative hat hier<br />
wiederum wichtige Entwicklungen angestoßen, die jedoch auch jenseits von Graduiertenschulen,<br />
Exzellenzclustern und <strong>Zu</strong>kunftskonzepten – vor allem mit Blick auf<br />
verlässliche Tenure Track-Optionen – konsequent vorangetrieben wer<strong>den</strong> müssen.<br />
IV. Möglichkeiten und Grenzen <strong>des</strong> Stiftungshandelns<br />
Angesichts der Milliar<strong>den</strong>summen, die von der öffentlichen Hand und von Wirtschaftsunternehmen<br />
für Forschung und Entwicklung ausgegeben wer<strong>den</strong>, ist die<br />
Frage berechtigt, welche Wirkung vergleichsweise kleine Stiftungen auf diesem Feld<br />
überhaupt erzielen können. Es ist jedoch nicht die Größe <strong>des</strong> Fördervolumens von<br />
12
Stiftungen, sondern ihre Vorgehensweise, die <strong>den</strong> Unterschied macht. Ihre Unab-<br />
hängigkeit und ihre Flexibilität ermöglichen es Stiftungen, rasch zu reagieren und<br />
wirkungsvoll zu handeln. Durch ihre Förderung von sorgfältig ausgewählten Perso-<br />
nen und Vorhaben können sie „Inseln <strong>des</strong> Gelingens“ schaffen und somit indirekt<br />
einen erheblichen Einfluss auf die Wissenschaftspolitik und die Entscheidungsträger<br />
in <strong>den</strong> einzelnen Institutionen ausüben. Stiftungen sollten dabei stets danach streben,<br />
frühzeitig neue Forschungstrends und im Entstehen begriffene Durchbrüche,<br />
insbesondere in inter- und transdisziplinären Forschungsfeldern, zu ermöglichen.<br />
Gleichzeitig müssen sie sich rasch auf die Bedürfnisse der <strong>wissenschaftlichen</strong> Community<br />
einstellen und neue, vielversprechende Entwicklungen aufgreifen. Sie haben<br />
in erster Linie die Aufgabe, <strong>den</strong> Wandel zu ermöglichen und somit Vorbilder zu schaf-<br />
fen. Kleine Impulse können auf diese Weise große Wirkung erzielen – auch auf europäischer<br />
Ebene. Dazu müssen wir freilich eine Forschungsumgebung schaffen, die<br />
Risikobereitschaft fördert und Innovation inspiriert. Das heißt, wir müssen unsere Unterstützung<br />
auf diejenigen Personen und Projekte konzentrieren, die das Potenzial<br />
haben, die herrschende Meinung in Frage zu stellen oder gar ganz zu revidieren.<br />
Wir sollten vorrangig diejenigen Forscherinnen und Forscher aufspüren und unterstützen,<br />
die bereit sind, ein Risiko einzugehen und unkonventionelle Ansätze zu ver-<br />
folgen. Forscher(innen) und Forschungsförderer müssen gemeinsam Mut zeigen, so<br />
wie es etwa die VolkswagenStiftung künftig mit <strong>den</strong> neu etablierten Freigeist-Fellows<br />
versuchen will. Nach dem Ankündigungstext versteht die Stiftung unter einem Freigeist-Fellow:<br />
„Ein Freigeist-Fellow – das ist für die VolkswagenStiftung eine junge<br />
Forscherpersönlichkeit, die neue Wege geht, Freiräume nutzen und Widerstände<br />
überwin<strong>den</strong> kann. Sie schwimmt – wenn nötig – gegen <strong>den</strong> Strom und hat Spaß am<br />
kreativen Umgang mit Unerwartetem, auch mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten.<br />
Ein Freigeist-Fellow erschließt neue Horizonte und verbindet kritisches Analysevermögen<br />
mit außergewöhnlichen <strong>Perspektiven</strong> und Lösungsansätzen. Durch vorausschauen<strong>des</strong><br />
Agieren wird der Freigeist-Fellow zum Katalysator für die Überwindung<br />
fachlicher, institutioneller und nationaler Grenzen.“<br />
Nur wenn Forscher(innen) und Forschungsförderer bereit sind, Risiken einzugehen<br />
und zu teilen, können wir Wissenschaftler(innen) ermutigen, ausgetretene Pfade zu<br />
verlassen und nach neuen Wegen zu suchen. Wir müssen dabei <strong>den</strong> entsprechen-<br />
13
<strong>den</strong> Personen langfristige Unterstützung anbieten. Vertrauen ist essenziell, um exzellente<br />
Fördermöglichkeiten zu bieten, und so wiederum bahnbrechende Forschungsergebnisse<br />
zu ermöglichen. Sich auf unbekanntes Terrain vorzuwagen, erfordert viel<br />
mehr Zeit – und Mut! – als die üblichen zwei oder drei Jahre Projektförderung erlauben.<br />
Wissenschaftsförderer müssen also auch bereit sein, Fehler zu tolerieren und<br />
zu akzeptieren, dass in einem Projekt ein anderer Weg eingeschlagen wird als ursprünglich<br />
geplant. Dieser Punkt ist dereinst von Albert Einstein bereits sehr pointiert<br />
formuliert wor<strong>den</strong>: „Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer<br />
und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder weg-<br />
zuwerfen.“<br />
V. Zwischenfazit<br />
Idealismus und Durchhaltevermögen sind auch von Max Weber als wichtige Erfolgsvoraussetzungen<br />
markiert wor<strong>den</strong>. Er verwies seinerzeit – vor gut 90 Jahren – freilich<br />
auch darauf, dass von Karriereplanung an deutschen Universitäten keine Rede sein<br />
könne. Es sei vielmehr „ein wilder Hazard. Wenn junge Gelehrte um Rat fragen<br />
kommen wegen Habilitation, so ist die Verantwortung <strong>des</strong> <strong>Zu</strong>re<strong>den</strong>s fast nicht zu tragen.<br />
Ist er ein Jude, so sagt man ihm natürlich: lasciate ogni speranza. Aber auch<br />
je<strong>den</strong> anderen muss man auf das Gewissen fragen: Glauben Sie, dass Sie es aus-<br />
halten, dass Jahr um Jahr Mittelmäßigkeit nach Mittelmäßigkeit über Sie hinaussteigt,<br />
ohne innerlich zu verbittern und zu verderben? Dann bekommt man selbstver-<br />
ständlich je<strong>des</strong> Mal die Antwort: Natürlich, ich lebe nur meinem ‚Beruf‘; aber ich wenigstens<br />
habe es nur von sehr wenigen erlebt, dass sie das ohne inneren Scha<strong>den</strong><br />
für sich aushielten.“ (a. a. O., S. 481)<br />
Trotz aller Klagen über die schlechten Karriereaussichten und Probleme, die die Um-<br />
stellung der Studiengangsstrukturen, die steigen<strong>den</strong> Studienanfängerzahlen und die<br />
sinkende Grundfinanzierung mit sich bringen: An <strong>den</strong> deutschen Hochschulen<br />
herrscht eine Aufbruchstimmung, von der auch der wissenschaftliche Nachwuchs<br />
profitiert. Durch die Governance-Reformen und die damit einhergehen<strong>den</strong> neuen Leitungs-<br />
und Entscheidungsstrukturen gelingt es vielerorts, die Hochschulen aus ihrer<br />
14
Erstarrung zu lösen, Freiräume für transformative Forschung zu schaffen und damit<br />
zugleich neue Chancen für Nachwuchswissenschaftler(innen) zu eröffnen.<br />
Für viele der Probleme, mit <strong>den</strong>en sich Nachwuchswissenschaftler/innen im deutschen<br />
Wissenschaftssystem konfrontiert sehen, sind – mit Ausnahme <strong>des</strong> Berufungsund<br />
Karrieresystems der TU München – noch keine überzeugen<strong>den</strong> Lösungen gefun<strong>den</strong><br />
wor<strong>den</strong>. Dennoch wer<strong>den</strong> auch sie von der zunehmen<strong>den</strong> Diversifizierung<br />
der Institutionen und der Karrierewege profitieren. Professor oder Prekariat lautet<br />
also keineswegs die Alternative. Es gibt vielmehr vielfältige Möglichkeiten, gewissermaßen<br />
ein bunter, farbenfroher Strauß von höchst unterschiedlichen Blumen (wie<br />
sich dies für einen Festvortrag gehört); aber Rosen haben nun mal auch Dornen! Der<br />
Wettbewerb um Ressourcen und Reputation wird in <strong>den</strong> kommen<strong>den</strong> Jahren weiter<br />
zunehmen. Nicht jede Hochschule wird sich als Ort der Spitzenforschung behaupten<br />
können. Umso wichtiger wird es für Nachwuchswissenschaftler/innen, sich in ihrem<br />
jeweiligen Umfeld zu positionieren und zugleich international zu kooperieren.<br />
Eine Erfolgsgarantie gibt es weder für Forschung noch für Forscherkarrieren. Es gibt<br />
jedoch Erfolgsfaktoren, die herausragende Forschung begünstigen. <strong>Zu</strong>m einen sind<br />
dies sehr gute Lehr- und Forschungsbedingungen, d. h. eine exzellente technische<br />
Ausstattung, eine gute Infrastruktur und geringe Belastung durch Verwaltungsaufgaben.<br />
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Arbeit in relativ kleinen Forschergruppen von<br />
vier bis fünf Wissenschaftler(inne)n, bei <strong>den</strong>en auch die Leitungspersönlichkeit selbst<br />
aktiv in die Forschungsarbeit involviert ist. Wichtig für <strong>den</strong> Erfolg sind ferner eine<br />
langfristige, institutionell abgesicherte Finanzierung sowie realistische Karriereoptionen<br />
für <strong>den</strong> <strong>wissenschaftlichen</strong> Nachwuchs. Entschei<strong>den</strong>d ist jedoch eine inspirie-<br />
rende, auf das jeweilige Potenzial vertrauende, Originalität und Kreativität fördernde,<br />
von Kollegialität geprägte „Kultur“, in der auch ungewöhnliche Forschungsideen entstehen<br />
und weitergesponnen wer<strong>den</strong> können.<br />
Die moderne Wissensgesellschaft braucht transformative Forschung. Diese wiederum<br />
benötigt herausragende Talente, gute institutionelle Rahmenbedingungen, ausreichende<br />
institutionelle Grundfinanzierung, Förderung von hervorragen<strong>den</strong> Forscherpersönlichkeiten<br />
mit vielversprechen<strong>den</strong> Projekten, kurzfristige Bereitstellung<br />
von Mitteln zur Realisierung origineller Ideen, langfristige Förderung innovativer Projekte<br />
und nicht zuletzt mehr Mut zu risikoreichen Vorhaben bei allen Beteiligten. Das<br />
Verhältnis zwischen fördern<strong>den</strong> und Forschung treiben<strong>den</strong> Organisationen und dem<br />
15
<strong>wissenschaftlichen</strong> Nachwuchs sollte geprägt sein von Verantwortung, Vertrauen und<br />
Verlässlichkeit. Exzellente Nachwuchswissenschaftler(innen) sollen sich beherzt<br />
aufmachen können in das Grenzland transformativer Forschung, und dort nicht nur<br />
<strong>den</strong> Weg zu neuen Erkenntnissen, sondern auch zu einer erfolgreichen <strong>wissenschaftlichen</strong><br />
Karriere fin<strong>den</strong>. Dieser Weg ist nicht immer einfach, doch wie schon Albert<br />
Einstein feststellte: „Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit.“<br />
Soweit mein Festvortrag, in dem ich die Karriereperspektiven von Postdocs ganz<br />
bewusst in einen weiteren Kontext anstehender Herausforderungen gestellt habe.<br />
Erlauben Sie mir bitte mit Blick auf das Thema der morgigen Tagung doch noch eine<br />
auf fünf Thesen fokussierte politisch-praktische Nachbemerkung, die wir gerne schon<br />
beim Empfang, aber ebenso auch morgen diskutieren können.<br />
Nachbemerkung in fünf Thesen<br />
1. Wer von Postdocs redet, der darf über die vorausliegen<strong>den</strong> Ausbildungsphasen<br />
und die Promotion nicht schweigen. Curricula und Bildungsziele müssen im Zeit-<br />
alter der digitalen Reproduzierbarkeit neu reflektiert und konfiguriert wer<strong>den</strong>. Angesichts<br />
zahlreicher Plagiats- und Fälschungsfälle gilt es, auch ein Privileg <strong>des</strong><br />
deutschen Professors zu hinterfragen, das bislang unbestritten schien, nämlich<br />
die Prüfung und Notenvorgabe durch <strong>den</strong> Betreuer (der zugleich häufig Ko-Autor<br />
der Publikationen ist). Nicht die Nähe zur Person, sondern die Nähe zum Gegenstand<br />
der Arbeit muss handlungsleitend sein für die Auswahl der Gutach-<br />
ter(innen).<br />
2. Der Status eines Postdocs und die Strukturierung der Postdocphase bedürfen<br />
dringend der Klärung. Die Unsicherheit und Intransparenz der Karrierewege sind<br />
nirgendwo so groß wie in Deutschland. Die zumeist drittmittelfinanzierte, zweibis<br />
dreijährige Laufzeit der jeweiligen Verträge wird zugleich mit extrem hohen<br />
Erwartungen überfrachtet: Aufenthalt in einer der weltweit auf dem jeweiligen<br />
Gebiet als führend angesehenen Einrichtungen, Durchführung eines besonders<br />
originellen Vorhabens und in hochrangigen Zeitschriften publizierte Veröffentli-<br />
16
chungen. In dieser Phase bedarf es zugleich vielfältiger Ausgänge aus der Wis-<br />
senschaft. Es ist und bleibt die Hauptaufgabe der Universitäten, Führungskräfte<br />
für alle Bereiche der Gesellschaft auszubil<strong>den</strong>!<br />
3. Jenseits einer ersten, häufig im Ausland verbrachten Postdocphase bedarf es<br />
zwingend einer sozialen Absicherung und <strong>des</strong> Schritts in die Selbstständigkeit<br />
der Forschungsarbeit. Die Selbstausbeutung in Form einer 60-Stun<strong>den</strong>woche auf<br />
Stipendienbasis muss – nicht zuletzt angesichts der demographischen Entwicklung<br />
– ein Ende haben. Die bereits in einigen Ländern eingeführte Min<strong>des</strong>tbezah-<br />
lung auf Stellenbasis ist der richtige Weg. Ihn gilt es mit dem Recht auf Eigenständigkeit<br />
und Autorschaft spätestens ab der zweiten Postdocphase zu koppeln.<br />
4. W1- und W2-Professuren auf Zeit sind wichtige Instrumente, um herausragende<br />
Talente gewinnen zu können; sie müssen aber mit einer verlässlichen Tenure<br />
Track-Option gekoppelt wer<strong>den</strong>. Mit Blick auf die bisherige Umsetzung der Juni-<br />
or-Professur gilt es, die vielfach zu geringe Bezahlung, die häufig nur unzureichend<br />
gewährten Sachmittel- und Personalausstattung sowie die nach knapp<br />
drei Jahren in der Regel zu früh einsetzende Zwischenevaluation zu über<strong>den</strong>ken<br />
(vor allem bei langwierigem Laboraufbau etc.). Es bedarf dringend einer kohären-<br />
ten Konzeption für die Stufung verschie<strong>den</strong>er Karrierewege und aufeinander aufbauender<br />
Schritte von der Junior- über die Associate- bis zur Vollprofessur (vgl.<br />
etwa das Konzept der TU München).<br />
5. Als eigentlicher „Flaschenhals“ für die Karriereaussichten der heutigen Postdocgeneration<br />
im Hochschulbereich erweist sich die an deutschen Universitä-<br />
ten ‒ nicht zuletzt aufgrund <strong>des</strong> traditionellen Lehrstuhlprinzips – eigenartig verschobene<br />
Personalstruktur. Im Vergleich zu international führen<strong>den</strong> Forschungsuniversitäten<br />
kommt in Deutschland auf eine vergleichsweise geringe Zahl von<br />
Professuren eine ungewöhnlich große Menge von <strong>wissenschaftlichen</strong> Mitarbeiter(inne)n,<br />
Hilfs- und Sekretariatskräften. Diese Stellen- und Aufgabenverteilung<br />
(mit ihrer Konzentration der Prüfungs- und Verwaltungsaufgaben auf wenige Professuren)<br />
wird zu über<strong>den</strong>ken sein, wenn wir die Leistungskraft der deutschen<br />
Universitäten weiter erhöhen wollen. Nicht zuletzt mit Blick auf mehr Forschungszeit<br />
für hochkarätige Wissenschaftler (derzeit vor allem über Drittmittel<br />
17
wie etwa Opus Magnum gewährleistet) gilt es, eine neue Stellenstruktur mit niedrigeren<br />
Lehrdeputaten etc. zu schaffen. Ob wir uns damit bereits ins Reich der<br />
Utopien oder Dystopien begeben, überlasse ich gerne Ihrem persönlichen Urteil.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
18