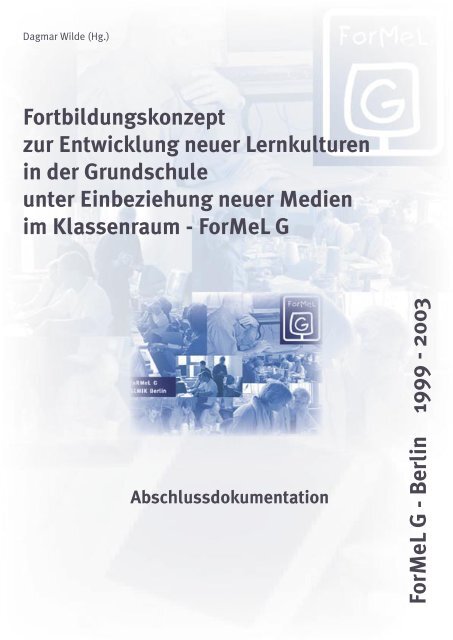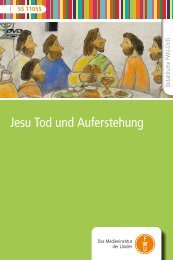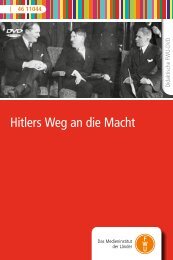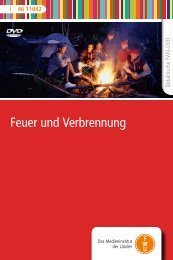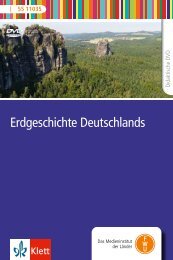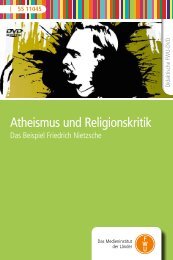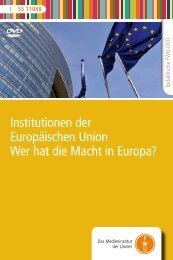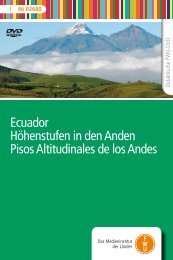Fortbildungskonzept zur Entwicklung neuer Lernkulturen in ... - FWU
Fortbildungskonzept zur Entwicklung neuer Lernkulturen in ... - FWU
Fortbildungskonzept zur Entwicklung neuer Lernkulturen in ... - FWU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dagmar Wilde (Hg.)<br />
<strong>Fortbildungskonzept</strong><br />
<strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong><br />
<strong>in</strong> der Grundschule<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien<br />
im Klassenraum - ForMeL G<br />
Abschlussdokumentation<br />
ForMeL G - Berl<strong>in</strong> 1999 - 2003
Dagmar Wilde (Hg.)<br />
<strong>Fortbildungskonzept</strong><br />
<strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong> <strong>in</strong> der Grundschule<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien<br />
im Klassenraum - ForMeL G<br />
Abschlussdokumentation<br />
Prozesschritte und Erfahrungen<br />
1999 bis 2003<br />
Modellvorhaben des Landes Berl<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung<br />
und Forschungsförderung (BLK) <strong>in</strong> Bonn<br />
im Rahmen des Programms<br />
»Systematische E<strong>in</strong>beziehung von Medien,<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
<strong>in</strong> Lehr– und Lernprozesse«<br />
(SEMIK)
Impressum<br />
Herausgeber: BLK-Modellvorhaben<br />
<strong>Fortbildungskonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong><br />
<strong>in</strong> der Grundschule unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im<br />
Klassenraum - ForMeL G<br />
Redaktion und Layout: Dagmar Wilde<br />
Berl<strong>in</strong>er Landes<strong>in</strong>stitut für Schule und Medien (LISUM)<br />
Storkower Str. 133<br />
10407 Berl<strong>in</strong><br />
CD-Redaktion: Thomas Kahlki, Frieder Klapp<br />
© 06/2003 LISUM / Berl<strong>in</strong><br />
1. Auflage Mai 2003<br />
Das der Dokumentation zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des BMBF unter dem Förderkennzeichen A 667800 BE 08<br />
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.<br />
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder ist nur mit schriftlicher Zustimmung gestattet. Dies gilt auch für die<br />
Verwendung <strong>in</strong> Kursunterlagen und elektronischen Systemen. Dem Band ist e<strong>in</strong>e CD-Rom beigefügt. Diese darf nur für Fortbildung-<br />
und Unterrichtszwecke e<strong>in</strong>gesetzt werden.
Inhalt<br />
E<strong>in</strong>leitung.................................................................................................................................................................. 7<br />
1 Lehren und Lernen mit neuen Medien fordert uns heraus... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
Lehren und Lernen mit neuen Medien erfordert Kompetenzen und Konzepte... .........................................................11<br />
Neue Medien fordern Lehrer/<strong>in</strong>nen heraus... .............................................................................................................11<br />
Neue Medien erfordern e<strong>in</strong>e neue Lernkultur.............................................................................................................12<br />
Neue Medien erfordern neue <strong>Fortbildungskonzept</strong>e ..................................................................................................12<br />
2 Das BLK-Programm „SEMIK“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
3 Das Berl<strong>in</strong>er SEMIK-Projekt „ForMeL G“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
Schulen im Projekt ForMeL G......................................................................................................................................18<br />
4 Prozess–Schritte im Projekt ForMeL G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
5 Schlussfolgerungen zum Ende der Projektlaufzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
Neue Medien im Schulalltag... .................................................................................................................................. 28<br />
6 ForMeL G <strong>in</strong> den Regionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
Berichte der Projektmitarbeiter im Mai 2002 .............................................................................................................29<br />
Drei Jahre ForMeL G an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule.................................................................................................29<br />
Drei Jahre ForMeL G <strong>in</strong> der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule........................................................................................... 33<br />
Zwischenbilanz der Schwielowsee-Grundschule ....................................................................................................... 39<br />
Die Arbeit mit neuen Medien an der Möwensee-Grundschule................................................................................... 44<br />
Zwischenbilanz der Otto-Wels-Grundschule.............................................................................................................. 49<br />
Grundschule im Grünen - Projektbericht 1999 – 2002 ............................................................................................... 51<br />
Prozesse, Ergebnisse und Perspektiven der Region Neukölln, Treptow-Köpenick ..................................................... 54<br />
7 Medienkonzepte der Projektschulen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />
Das Medienkonzept der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule .................................................................................................... 57<br />
Arbeit mit dem Computer an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule ....................................................................................... 57<br />
Computer als Werkzeug - Das schul<strong>in</strong>terne Curriculum der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule............................................... 59<br />
Der Weg zum Medienkonzept der 5. Grundschule Mitte............................................................................................ 60<br />
Medienkonzept der Lisa-Tetzner-Grundschule ...........................................................................................................62<br />
Medienkonzept der Schwielowsee-Grundschule........................................................................................................62<br />
5
8 <strong>Fortbildungskonzept</strong>e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
Netzwerkstatt Re<strong>in</strong>ickendorf - das regionale Forum für neue Medien <strong>in</strong> Re<strong>in</strong>ickendorfer Grundschulen ................... 66<br />
Fachforum „Neue Medien im Deutschunterricht“ - e<strong>in</strong> regionales <strong>Fortbildungskonzept</strong> ........................................... 67<br />
Von MoMo zu momodo.de - Rückblicke, Stolperste<strong>in</strong>e und Perspektiven im Oktober 2002 ...................................... 71<br />
Co-Teach<strong>in</strong>g - Unterrichtsbegleitung als Angebot im Rahmen der Lehrerfortbildung ............................................... 74<br />
Die NetzWerkstatt oder wie Kollegen überregional mite<strong>in</strong>ander vernetzt werden ..................................................... 78<br />
9 Fortbildungsdokumentationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
9.1 Kurse ................................................................................................................................................................... 83<br />
Fortbildungskurs „Computer <strong>in</strong> der Schule - was nun?“ ............................................................................................83<br />
Fortbildungskurs „Suchen im Netz“ ...........................................................................................................................86<br />
9.2 Workshops .......................................................................................................................................................... 89<br />
Workshop „Benutzung der Digitalkamera“ ............................................................................................................... 89<br />
Workshop „Schulhomepage mit Freeway“ ................................................................................................................91<br />
9.3 Co-teach<strong>in</strong>g / Unterrichtsbegleitung ................................................................................................................... 96<br />
Unterrichtsbegleitung „Internetrecherche, 3. Klasse“................................................................................................96<br />
Co-teach<strong>in</strong>g Klasse 1 „Briefe verfassen“.....................................................................................................................100<br />
9.4 Fachforen ............................................................................................................................................................ 103<br />
Fachforum „Neue <strong>in</strong>s Boot“ - Dezember 2002............................................................................................................103<br />
Fachforum „Erstellen e<strong>in</strong>er Internetrallye“ ................................................................................................................ 106<br />
Fachforum „Lesen am und mit dem Computer“..........................................................................................................110<br />
9.5 Tutor<strong>in</strong>g............................................................................................................................................................... 114<br />
Tutor<strong>in</strong>g „Phantastische Flug<strong>in</strong>sekten“ - von der Pr<strong>in</strong>tversion <strong>zur</strong> Webversion.......................................................... 114<br />
9.6 Sonstige Fortbildungen....................................................................................................................................... 115<br />
Workshop für Multiplikatoren <strong>in</strong> Dill<strong>in</strong>gen im Januar 2003 ........................................................................................ 115<br />
9.7 Onl<strong>in</strong>e-Angebote ................................................................................................................................................. 121<br />
MoMo - die Internet-Mitmach-Seite ...........................................................................................................................121<br />
Virtueller Fortbildungskontakt ...................................................................................................................................124<br />
10 Darstellungen zum Projekt ForMeL G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />
11 Neue Medien und neue Lernkultur <strong>in</strong> der Grundschule - e<strong>in</strong> ABC-Darium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130<br />
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144<br />
Autor<strong>in</strong>nen und Autoren der Beiträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />
6
E<strong>in</strong>leitung<br />
Lehren und Lernen bef<strong>in</strong>den sich im Wandel. Nicht nur <strong>in</strong>haltliche und strukturelle Anforde-<br />
rungen an die Grundschule und an die Qualität des Unterrichts ändern sich - die neuen Medien<br />
bieten neue Möglichkeiten des Lehrens und Lernens. Diese Möglichkeiten zu beurteilen und aus-<br />
zuschöpfen stellt neue Anforderungen an Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer.<br />
Das Land Berl<strong>in</strong> hat vom August 1999 bis zum Juli 2003 am BLK-Programm „Systematische<br />
E<strong>in</strong>beziehung von Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien <strong>in</strong> Lehr- und Lern-<br />
prozesse (SEMIK)“ mit dem Projekt „<strong>Fortbildungskonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong><br />
<strong>in</strong> der Grundschule unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im Klassenraum – ForMeL G“ teilgenom-<br />
men.<br />
Im Projekt ForMeL G lagen die Schwerpunkte der fünfjährigen Arbeit unter dem Fokus e<strong>in</strong>er<br />
Veränderung der Lernkultur <strong>in</strong> der Grundschule unter E<strong>in</strong>beziehung der neuen Medien <strong>in</strong> den<br />
Unterricht im Bereich der Lehreraus- und –fortbildung und der Schulentwicklung. Sechs Lehre-<br />
r<strong>in</strong>nen und Lehrer aus sechs Grundschulen <strong>in</strong> Spandau, Re<strong>in</strong>ickendorf, Tempelhof-Schöneberg,<br />
Neukölln, Hohenschönhausen und Friedrichsha<strong>in</strong>-Kreuzberg übernahmen im Schuljahr 1999/<br />
2000 die Aufgaben e<strong>in</strong>es „Computer-Multiplikators (CoMu)“. Im Laufe der Projektjahre traten<br />
weitere Lehrer und Schulen <strong>in</strong> das Projekt e<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>zelne zogen sich aus der Arbeit <strong>zur</strong>ück. Seit<br />
Mitte der Projektlaufzeit arbeiteten neun Multiplikatoren – zum Teil <strong>in</strong> regionalen Tandems – an<br />
der schul<strong>in</strong>ternen und regionalen Umsetzung des Projektziels, dem Aufbau e<strong>in</strong>es Fortbildungs-<br />
netzwerks<br />
• das grundschuldidaktisch ausgerichtete Fortbildungen <strong>zur</strong> E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den<br />
Unterricht anbietet,<br />
• das Orientierung und Unterstützung im H<strong>in</strong>blick auf die Implementierung veränderter Lehr-<br />
Lern-Konzepte, die die E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht erfordern, bietet,<br />
• das den kollegialen Austausch über die E<strong>in</strong>zelschule h<strong>in</strong>aus, dabei aber schulstandortnah beför-<br />
dert und<br />
an der <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es die didaktisch-methodischen Besonderheiten der Grundschule akzentu-<br />
ierenden Qualifizierungsprogramms für Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer.<br />
Diese Ziele wurden – so lässt sich heute erkennen – umgesetzt. Die Schwerpunkte des Projekts<br />
ForMeL G, die dar<strong>in</strong> bestanden,<br />
• Akzeptanz und Kompetenz der Lehrkräfte <strong>in</strong> Bezug auf den E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> der<br />
Grundschule zu stärken,<br />
• ihre didaktische Kompetenz h<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht zu<br />
erweitern,<br />
• Lernformen weiter zu entwickeln und zu etablieren, die selbstgesteuertes und situiertes Lernen<br />
sowie kooperative Arbeitsverfahren bei der E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht un-<br />
terstützen,<br />
• Lernumgebungen zu konzipieren, die e<strong>in</strong>e Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Klassenraum unter-<br />
stützen,<br />
• auf e<strong>in</strong>e Veränderung der Rolle von Lehrenden und Lernenden bei der Nutzung <strong>neuer</strong> Medien<br />
<strong>in</strong> Lehr-/Lernprozessen h<strong>in</strong>zuwirken,<br />
7
8<br />
• veränderte Formen des Lehrens und Lernens zu implementieren, die - unter anderem durch<br />
die E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Grundschulunterricht - <strong>in</strong> der heutigen Schule unver-<br />
zichtbar s<strong>in</strong>d,<br />
haben <strong>in</strong> den vergangenen Jahren zu nachhaltigen <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> den Schulen und Regio-<br />
nen geführt. Die Netzwerkarbeit, die schul<strong>in</strong>ternen und regionalen bedarfsorientierten Fort-<br />
bildungsangebote von „vor Ort aktiven“ Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrern haben sich sukzessive eta-<br />
bliert. Die Netzwerke kollegialer Lern- und Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften und die praxisverankerten<br />
Fortbildungsformen werden <strong>in</strong> den Projektschulen sowie <strong>in</strong> den im Netzwerk mitarbeitenden<br />
Grundschulen nach Projektende weiter wirksam se<strong>in</strong>, denn es ist Anliegen aller Beteiligten Be-<br />
währtes fortzusetzen und weiter zu entwickeln.<br />
Das Anliegen dieser Abschlussdokumentation besteht nicht dar<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>en weiteren Beitrag<br />
zu den wissenschaftlichen und theoretischen Erkenntnissen zum E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> der<br />
Grundschule zu leisten. Die <strong>in</strong> den vergangenen Jahren publizierten Erkenntnisse, die den<br />
neuen Medien e<strong>in</strong>en zentralen didaktischen Ort im Grundschulunterricht zuweisen, bilden<br />
aber den Reflexionsh<strong>in</strong>tergrund, vor dem die am Projekt beteiligten Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer<br />
<strong>in</strong> ihrer fünfjährigen Arbeit <strong>Fortbildungskonzept</strong>e <strong>zur</strong> Implementierung <strong>neuer</strong> Lernkultur und<br />
<strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> der Grundschule entwickelt, erprobt und evaluiert haben.<br />
Der Band besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil (Kapitel 1 – 6) wird der konzeptionel-<br />
le H<strong>in</strong>tergrund des BLK-Projekts ForMeL G beleuchtet. Hier wird das Projektanliegen im<br />
Kontext der Ziele des Gesamtvorhabens SEMIK näher betrachtet. Im zweiten Teil (Kapitel<br />
7 – 10) steht die praktische Arbeit der Projektmitarbeiter im Vordergrund. Die Pr<strong>in</strong>tfassung<br />
wird durch e<strong>in</strong>e digitale Version der Abschlussdokumentation ergänzt. Auf der beiliegenden<br />
CD-Rom f<strong>in</strong>den sich weitere Materialien, die den Rahmen der Druckversion gesprengt hätten,<br />
sowie etliche multimediale Präsentationen und Dokumentation verschiedener Fortbildungs-<br />
szenarien.<br />
Bei der Zusammenstellung der Beiträge g<strong>in</strong>g es nicht darum e<strong>in</strong>e Auswahl von „best-<br />
practice-Modellen“ zu präsentieren, sondern vor allem darum, die Highlights, Scharnierstel-<br />
len und Stolperste<strong>in</strong>e der schul<strong>in</strong>ternen und regionalen <strong>Entwicklung</strong>sprozesse wärend der Pro-<br />
jektlaufzeit aufzuzeigen. Es braucht Kraft, Durchhaltevermögen und durchaus auch e<strong>in</strong>iges an<br />
Frustrationstoleranz, <strong>Entwicklung</strong>en zu befördern, längere (Um)Wege zu gehen und trotzdem<br />
<strong>in</strong> Prozessschritte zu vertrauen. Die Schwierigkeiten, die andere durchlaufen haben, sollten<br />
Mut machen, sich auf den Weg zu wagen und <strong>in</strong> die <strong>Entwicklung</strong>spotenziale aller an Schule<br />
Beteiligten zu vertrauen. Zum Ende des Projekts zeigt sich, dass sich das Engagement für alle<br />
Beteiligten gelohnt hat.<br />
Mit den Beispielen aus der Projektarbeit soll „Fortbildungslust“ geweckt werden. Die Be-<br />
richte sollen helfen, die Offenheit zu befördern, die Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer brauchen, um das<br />
Lehren und Lernen immer wieder neu zu denken, auch ihren „bewährten“ Unterricht immer<br />
wieder e<strong>in</strong>er selbstkritischen Reflexion zu unterziehen und damit die Evaluationskultur <strong>in</strong> der<br />
Schule als e<strong>in</strong>er lernenden Organisation weiter zu entwickeln.
Wir hoffen die konkrete Arbeit mit neuen Medien mit den hier dargelegten Erfahrungen an-<br />
<strong>zur</strong>egen. Wir hoffen Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen zu motivieren, sich geme<strong>in</strong>sam auf den Weg zu<br />
e<strong>in</strong>er veränderten Lernkultur mit neuen Medien zu begeben. Wir hoffen Schulleitungen und<br />
Schulaufsicht zu sensibilisieren, damit diese <strong>Entwicklung</strong>en e<strong>in</strong>e breite Unterstützung f<strong>in</strong>den.<br />
Den Grundste<strong>in</strong> für die Implementierung regionaler Fortbildungsnetzwerke, welche e<strong>in</strong><br />
kooperatives, selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen von Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrern ebenso<br />
unterstützen wie Schulentwicklungsprozesse befördern helfen, hat ForMeL G gelegt. Die Wei-<br />
terentwicklung dieser schul<strong>in</strong>ternen und regionalen Netzwerke wird nun dem Engagement der<br />
Beteiligten und Interessierten obliegen. Um dazu e<strong>in</strong>en Beitrag zu leisten, bietet die hier vor-<br />
liegende Abschlussdokumentation E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> Prozesse und Ergebnisse der Projektarbeit und<br />
trägt die Erfahrungen damit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e breitere Öffentlichkeit weiter. Alle am Projekt Beteiligten<br />
hoffen, dass ihre Arbeit, die sich <strong>in</strong> den Modellen dieses Bandes widerspiegelt, übertragbare<br />
Beispiele und Impulse für das Lehren und Lernen mit neuen Medien <strong>in</strong> der Grundschule eröff-<br />
nen wird.<br />
Dagmar Wilde<br />
Berl<strong>in</strong>, Mai 2003<br />
9
1 Lehren und Lernen mit neuen Medien fordert uns<br />
heraus...<br />
Dagmar Wilde<br />
Lehren und Lernen mit neuen Medien erfordert Kompetenzen und Konzepte...<br />
E<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> den Alltag der Grundschulen offenbart: Vernetzte Computer und/oder e<strong>in</strong> Zu-<br />
gang zum Internet <strong>in</strong> allen Klassenräumen sichern oder verbessern noch ke<strong>in</strong>eswegs die Qua-<br />
lität von Unterricht. Medien – neue wie alte – s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Variable im Lehr–Lern–Prozess. Mehr<br />
als herkömmliche Medien dienen die neuen Medien jedoch nicht alle<strong>in</strong> der Unterstützung von<br />
Wissenserwerb, sondern sie stellen e<strong>in</strong>e Lernumgebung dar, die es den Lernenden ermöglicht<br />
selbstständig und handlungsorientiert zu lernen und dabei <strong>in</strong>dividuelle Wege zu gehen. Auch<br />
die neuen Medien s<strong>in</strong>d per se noch nicht geeignet die Effizienz von Lernprozessen zu unter-<br />
stützen oder gar den Lernertrag zu sichern. Sie stellen e<strong>in</strong>e wichtige pädagogische Ergänzung<br />
dar, aber sie entheben Lehrende nicht von der Frage nach Inhalten, Lernvoraussetzungen und<br />
Zielen – und somit nach der Qualität – geme<strong>in</strong>samer wie <strong>in</strong>dividueller Lehr–Lernprozesse:<br />
„Im Computer selbst stecken ke<strong>in</strong>e didaktischen Qualitäten. Didaktische Qualität hat nur der<br />
Unterricht, <strong>in</strong> dessen Rahmen er e<strong>in</strong>gesetzt wird. Der Computer kann lediglich <strong>zur</strong> Unterstüt-<br />
zung e<strong>in</strong>er didaktischen Konzeption herangezogen werden.“ (1) Es s<strong>in</strong>d somit die Kompeten-<br />
zen der Lehrenden, die wesentlich über die Qualtität des Lernens und die Innovationskraft<br />
der neuen Medien für schulische Lernprozesse entscheiden.<br />
Neue Medien fordern Lehrer/<strong>in</strong>nen heraus...<br />
Ausstattungs– und Fortbildungsoffensiven der vergangenen Jahre waren nicht nur öffentlich-<br />
keitswirksam, sie waren auch dr<strong>in</strong>gend notwendig. Jedoch haben sie ganz offensichtlich bis<br />
heute noch nicht dazu geführt, dass Unterricht mit neuen Medien <strong>in</strong> den Grundschulklassen<br />
bereits <strong>zur</strong> Normalität geworden ist. (2) Fortbildungen zum Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g basaler Fertigkeiten im<br />
Umgang mit Hard– und Software waren und s<strong>in</strong>d für Lehrer überaus wichtig. Diese Angebote<br />
reichen offensichtlich alle<strong>in</strong> aber nicht aus, um Lehrer (3) vom didaktischen und pädagogi-<br />
schen Mehrwert der neuen Medien zu überzeugen und sie zu befähigen z. B. Computer und<br />
Internet als Werkzeug und Gegenstand des Lernens im alltäglichen Unterricht zielgerichtet<br />
zu nutzen. E<strong>in</strong> Grund dürfte dar<strong>in</strong> liegen, dass Unterricht mit neuen Medien – sofern er sich<br />
nicht auf Angebote für Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften, Projektwochen oder vere<strong>in</strong>zelte Stunden im<br />
Computerraum mit dem Demolux (als „Ergänzung“ zum „normalen“ Unterricht) beschränkt<br />
– e<strong>in</strong>e Veränderung der gewohnten Lehr–Lern–Szenarien erfordert. Die neuen Medien verm<strong>in</strong>-<br />
dern die Chancen der Lehrer, entlang vorgeplanter Lehr- und Lernstrategien und e<strong>in</strong>heitlicher<br />
Zielstellungen zu unterrichten. (2) Damit wird die Veränderung der Lernkultur unumgäng-<br />
lich. Auch wenn dreißig Schüler an dreißig Computern arbeiten könnten: Beim Navigieren <strong>in</strong><br />
Hypertexten erweist sich der (Irr)Glaube an e<strong>in</strong> gleichschrittiges Voranschreiten im Lernpro-<br />
zess als Illusion. Wenn K<strong>in</strong>der Recherchen im Internet durchführen, irritieren ihre Ergebnisse<br />
über kurz oder lang das Wissensmonopol des Lehrers. Wenn sich Gruppen spontan beratend<br />
und Rat suchend um e<strong>in</strong>e Schüler<strong>in</strong> versammeln, die e<strong>in</strong> Foto digital umgestalten will, erweist<br />
sich das Anliegen um E<strong>in</strong>zelarbeit und E<strong>in</strong>zelleistungen als nicht e<strong>in</strong>lösbar.<br />
11
12<br />
Neue Medien erfordern e<strong>in</strong>e neue Lernkultur<br />
Neue Medien transportieren somit entscheidende Impulse <strong>zur</strong> Implementierung e<strong>in</strong>er neuen<br />
Lernkultur und <strong>in</strong>novativer Unterrichtsmethoden. Diese Impulse s<strong>in</strong>d nicht neu – man den-<br />
ke an die Forderungen der Reformpädagogen zu Beg<strong>in</strong>n des Jahrhunderts, an die Plädoyers<br />
gegen die Monokultur des Frontalunterrichts <strong>in</strong> den 70er/80er Jahren. Was Erkenntnisse u.<br />
a. der Lernbiologie und Systemtheorie seit langem und <strong>in</strong>ternationale Untersuchungen <strong>zur</strong><br />
Schulqualität nun ganz aktuell nahe legen, zwölf vernetzte Rechner im Computerraum, zwei<br />
bis drei vernetzte Rechner und e<strong>in</strong> Internetzugang im Klassenraum machen es unumgänglich:<br />
tradierte Lehr–Lern–Konzepte müssen überdacht, verändert, wenn nicht ganz aufgegeben<br />
werden.<br />
Die E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht fordert das Wissen und Können der Leh-<br />
renden heraus. Gewohnte, lange Zeit praktikable Problemlösungen, vertraute Orientierungen,<br />
die konventionelle didaktisch-methodische Handlungsmuster des Unterrichtens bislang boten,<br />
müssen überdacht werden, denn sie erweisen sich nun als nicht mehr anschlussfähig. Mit dem<br />
E<strong>in</strong>zug <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> jede Grundschule und <strong>in</strong> den alltäglichen Unterricht verstärkt sich<br />
die Notwendigkeit zum (Um–)Lernen. Wo bereits Bereitschaft <strong>zur</strong> Veränderung tradierter<br />
<strong>Lernkulturen</strong> existierte, wird sie durch die E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht noch<br />
verstärkt. Mit der Bereitschaft zum (Um–)Lernen wächst auch das Interesse an Fortbildungen,<br />
die nicht nur Unterstützung bei der Arbeit mit neuen Medien, sondern auch bei der Verände-<br />
rung von Unterricht versprechen.<br />
Neue Medien erfordern neue <strong>Fortbildungskonzept</strong>e<br />
Um die Vielfalt der Phänomene, die sich beim E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien im Unterricht ergeben, zu<br />
bedenken und um darauf reagieren zu können, bedarf es weiter reichender Kompetenzen als<br />
herkömmliche Hard– und Softwareschulungen vermitteln können. Handlungskompetenz lässt<br />
sich nicht auf Handhabungskompetenz reduzieren – Medienhandhabungskompetenz ist nur<br />
e<strong>in</strong> Aspekt von Medienkompetenz. Aber auch Medienkompetenz alle<strong>in</strong> reicht für Lehrer nicht<br />
aus. Neben persönlicher Medienkompetenz benötigen sie – allgeme<strong>in</strong>e, fach– und schulstu-<br />
fenspezifische – medienpädagogische und mediendidaktische Kompetenz. Um habitualisierte<br />
Vorstellungen von Lehren und Lernen zu verändern bedarf es – neben technischer Kompetenz<br />
und neben Kenntnissen über lerntheoretische und fachdidaktische Pr<strong>in</strong>zipien – nicht zuletzt<br />
auch der Impulse <strong>zur</strong> Ause<strong>in</strong>andersetzung mit dem Lernen im Allgeme<strong>in</strong>en und dem Lernen<br />
der K<strong>in</strong>der im Besonderen. Die neuen Medien br<strong>in</strong>gen es aktuell mit sich, dass Lehrerende mit<br />
langjähriger Berufserfahrung sich – oft seit langer Zeit wieder e<strong>in</strong>mal – selbst <strong>in</strong> der Situation<br />
der Lernenden f<strong>in</strong>den. Dies zu erleben, setzt oft e<strong>in</strong> Nachdenken über das Lernen <strong>in</strong> Gang.
Anmerkungen:<br />
(1) Ses<strong>in</strong>k, Werner, <strong>in</strong>: Bildung ans Netz. Hrsg.: Hessisches M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent<br />
wicklung, Geschäftsstelle Hessen–media, Redaktion Werner Ses<strong>in</strong>k. Wiesbaden 2000. S. 84.<br />
(2) E<strong>in</strong>e Befragung des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund ergab Ende 1999,<br />
dass nicht e<strong>in</strong>mal jede zweite Lehrer<strong>in</strong> im Unterricht den Computer e<strong>in</strong>setzt, obwohl mehr als 80% e<strong>in</strong>en<br />
Rechner zu Hause haben. Regelmäßig <strong>in</strong>s Internet gehen nach Erkenntnissen der Bertelsmann-Stiftung nur<br />
7,5% der Lehrer. Dpa-Meldung v. 20.04.00: http://www.sat1nachrichten.de/anzeigen.htm/id=55464.<br />
(3) An Grundschulen unterrichten sehr viel mehr Lehrer<strong>in</strong>nen als Lehrer die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler. Um<br />
jedoch stilistische Stolperste<strong>in</strong>e zu vermeiden und den Lesefluss nicht zu beh<strong>in</strong>dern, wird hier nur die maskul-<br />
<strong>in</strong>e Form verwendet. Ausdrücklich mitgedacht ist immer die fem<strong>in</strong><strong>in</strong>e Form.<br />
(4) Dichanz, Horst, Vortrag anlässlich der Delphi-Tagung, Bielefeld 15.2.2002.<br />
Bestimmte organisatorisch–technische Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
ersche<strong>in</strong>en für e<strong>in</strong>en alltäglichen E<strong>in</strong>satz der neuen Medien <strong>in</strong><br />
Grundschulen unverzichtbar:<br />
• 2–3 Computer <strong>in</strong> den Klassenräumen<br />
• m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> zentraler Computerraum (als „Medien–Werkstatt“<br />
nicht als „IT–Raum“ e<strong>in</strong>gerichtet) – alternativ: mobile Medienzentren<br />
(Laptop–Lösungen sche<strong>in</strong>en besonders praktikabel)<br />
• Vernetzung möglichst vieler Klassenräume (auch hier gilt: mobile<br />
Laptop–Lösungen – mit Funkvernetzung – haben sich sehr bewährt)<br />
• mehrere Computer mit Internetzugang <strong>in</strong> Lehrerarbeitsräumen<br />
• standortnah – d. h. sowohl im Computerraum als auch <strong>in</strong> den Klassenräumen<br />
– verfügbare Peripherie (zum<strong>in</strong>dest Drucker, darüber h<strong>in</strong>aus<br />
Scanner, Digitalkamera, Videokamera).<br />
13
14<br />
2 Das BLK-Programm „SEMIK“<br />
Dagmar Wilde<br />
„Systematische E<strong>in</strong>beziehung von Medien, Informations– und Kommunikationstechnologien<br />
<strong>in</strong> Lehr– und Lernprozesse – SEMIK“<br />
Das Ziel des BLK–Modellversuchsprogramms „Systematische E<strong>in</strong>beziehung von Medien, In-<br />
formations– und Kommunikationstechnologien <strong>in</strong> Lehr– und Lernprozesse – SEMIK“ bestand<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er nachhaltigen (d. h. flächendeckenden und überdauernden) und pädagogisch begrün-<br />
deten (d. h. lernpsychologische und (fach)didaktische Pr<strong>in</strong>zipien berücksichtigenden) Integra-<br />
tion <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterrichtsalltag aller Schularten und –stufen. „SEMIK“ startete im<br />
Oktober 1998 und hatte e<strong>in</strong>e Gesamtlaufzeit von fünf Jahren. Im Programm waren alle Bun-<br />
desländer mit 25 E<strong>in</strong>zelprojekten (1) engagiert. Das Land Berl<strong>in</strong> beteiligte sich mit den beiden<br />
Projekten „<strong>Fortbildungskonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong> <strong>in</strong> der Grundschule un-<br />
ter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im Klassenraum - ForMeL G“ und „<strong>Entwicklung</strong>, Erstellung<br />
und Erprobung von digitalen Lehr- und Lernmaterialien“.<br />
Mit „SEMIK“ sollte das zentrale bildungspolitische und schulpädagogische Ziel unterstützt<br />
werden, den Umgang mit neuen Medien als neue Kulturtechnik an Schulen zu vermitteln.<br />
E<strong>in</strong> übergeordnetes Ziel des schulischen Unterrichts besteht im Erwerb anwendbaren und<br />
anschlussfähigen Wissens. Dazu wurden <strong>in</strong> allen E<strong>in</strong>zelprojekten Konzepte zum Lehren und<br />
Lernen mit neuen Medien entwickelt, erprobt und evaluiert.<br />
Medien, Kommunikations– und Informationstechnologien werden - darüber besteht heute<br />
allgeme<strong>in</strong> Konsens - sowohl als Werkzeuge (Lehr–Lern–Tools), als Anlass <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
und Anwendung <strong>neuer</strong> Lehr–Lernformen, als Gestaltungsmittel als auch als eigenständiger<br />
Lehr–Lern<strong>in</strong>halt betrachtet. Dieses Verständnis der neuen Medien als „kognitive Werkzeuge“<br />
war SEMIK leitend. Das didaktische Leitkonzept aller E<strong>in</strong>zelprojekte war problemorientiertes<br />
Lernen – als Balance zwischen Instruktion und Konstruktion – <strong>in</strong> Anlehnung an gemäßigt<br />
konstruktivistische Ansätze der Lernforschung. Dem Programm „SEMIK“ lag die Überzeu-<br />
gung zugrunde, dass es e<strong>in</strong>er veränderten Lernkultur an Schulen bedarf, um diese Ziele zu<br />
realisieren (2).<br />
Programmträger für „SEMIK“ war das <strong>FWU</strong> Institut für Film und Bild <strong>in</strong> Wissenschaft<br />
und Unterricht. Mit der wissenschaftlichen Begleitung war der Lehrstuhl für Empirische Päd-<br />
agogik und Pädagogische Psychologie der Ludwig–Maximilians–Universität München beauf-<br />
tragt (3).<br />
(1) Informationen zum Programm und den E<strong>in</strong>zelvorhaben: http://www.fwu.de/semik. Siehe auch: Hölzer, Valeska:<br />
Lehren und Lernen mit neuen Medien. Das BLK-Programm SEMIK. In: SchulVerwaltung MO Nr. 4/2002.<br />
(2) Vgl. SEMIK-Basis<strong>in</strong>fo - Kurzdarstellung der Programmziele, der Evaluation und der E<strong>in</strong>zelprojekte. <strong>FWU</strong><br />
Institut für Film und Bild <strong>in</strong> Wissenschaft und Unterricht geme<strong>in</strong>nützige GmbH. Januar 2001.<br />
(3) Mandl / Re<strong>in</strong>mann-Rothmeier / Gräsel: Gutachten <strong>zur</strong> Vorbereitung des Programms „Systematische E<strong>in</strong>be<br />
ziehung von Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien <strong>in</strong> Lehr- und Lernprozesse“. Bund-<br />
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK). Bonn 1998.
3 Das Berl<strong>in</strong>er SEMIK-Projekt „ForMeL G“<br />
Dagmar Wilde<br />
„<strong>Fortbildungskonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong> <strong>in</strong> der Grundschule<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im Klassenraum – ForMeL G“<br />
„ForMeL G – <strong>Fortbildungskonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong> <strong>in</strong> der Grundschule<br />
unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im Klassenraum“ – war e<strong>in</strong>es von zwei Modellvorhaben<br />
des Landes Berl<strong>in</strong> <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der Bund–Länder–Kommission für Bildungspla-<br />
nung und Forschungsförderung (BLK) <strong>in</strong> Bonn im Rahmen des Programms „Systematische<br />
E<strong>in</strong>beziehung von Medien, Informations– und Kommunikationstechnologien <strong>in</strong> Lehr– und<br />
Lernprozesse – SEMIK“ (1). „ForMeL G“ startete im August 1999 und endete mit dem Juli<br />
2003. Das Projekt wurde unter dem Dach des Berl<strong>in</strong>er Landes<strong>in</strong>stituts für Schule und Medien<br />
(LISUM) durchgeführt.<br />
Anliegen<br />
Anliegen des Vorhabens war es, Selbstorganisationspotenziale zu wecken, zu bündeln und <strong>in</strong><br />
Netzwerke kollegialer Kooperation zu überführen. Ausgehend von der Annahme, dass Ver-<br />
trauen und Offenheit im Kollegium e<strong>in</strong>er Schule bzw. im Kollegenkreis e<strong>in</strong>er Region Lernbe-<br />
reitschaft und Lernoffenheit – und damit Lernchancen – befördern, sollten <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> regionale<br />
Fortbildungsnetzwerke implementiert werden, <strong>in</strong> denen Lehrer geme<strong>in</strong>sam daran arbeiten ihre<br />
Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien zu erweitern, die Lernkultur <strong>in</strong> der Grundschule<br />
weiter zu entwickeln und Konzepte e<strong>in</strong>er didaktisch s<strong>in</strong>nvollen E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong><br />
Lehr–Lern–Prozesse auszuarbeiten und auszutauschen. E<strong>in</strong> Ziel bestand daher dar<strong>in</strong> koopera-<br />
tives, selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen von Lehrern ebenso zu unterstützen wie Schulent-<br />
wicklungsprozesse zu befördern.<br />
Leitende Pr<strong>in</strong>zipien<br />
Für Lehr–Lernprozesse mit neuen Medien s<strong>in</strong>d – <strong>in</strong> Lehrerfortbildungen wie im Unterricht der<br />
Grundschule – identische didaktische Pr<strong>in</strong>zipien leitend:<br />
• Problemorientiertes Lernen, Balance zwischen Instruktion und Konstruktion<br />
• situiertes Lernen (Lernen anhand authentischer Probleme)<br />
• selbstgesteuertes Lernen und kooperatives Lernen.<br />
Diese didaktischen Pr<strong>in</strong>zipien stehen im engen Zusammenhang mit den das Gesamtprogramm<br />
SEMIK leitenden Grundannahmen (2).<br />
Im Projekt „ForMeL G“ wurden <strong>in</strong>nerhalb der fünfjährigen Projektlaufzeit Konzepte für<br />
e<strong>in</strong>e grundschuldidaktisch ausgerichtete Qualifizierung von Lehrern <strong>zur</strong> sach– und zielgerich-<br />
teten E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht erarbeitet. Angestrebt war die Implemen-<br />
tierung e<strong>in</strong>es schulübergreifenden Austauschs über technische und didaktisch–methodische<br />
<strong>Entwicklung</strong>en durch Kooperation von Lehrern <strong>in</strong> regionalen Fortbildungsnetzwerken. Damit<br />
verbunden war die Qualifizierung von Multiplikatoren, die (schul<strong>in</strong>tern und standortnah–re-<br />
gional) ihre Kollegen im technischen Gebrauch und didaktisch–methodischen E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong><br />
Medien beraten und sie im H<strong>in</strong>blick auf veränderte Lehr–Lern–Konzepte, die die E<strong>in</strong>bezie-<br />
15
16<br />
hung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den<br />
Unterricht erfordern, un-<br />
terstützen.<br />
Organisatorischer Rahmen<br />
An sechs Fortbildungs-<br />
schulen hatte mit dem<br />
Projektstart e<strong>in</strong> Lehrer<br />
Multiplikatorenaufga-<br />
ben übernommen. Diese<br />
Computer-Multiplikatoren<br />
(CoMus) führten ca. seit<br />
Beg<strong>in</strong>n des Jahres 2000<br />
– anfangs schul<strong>in</strong>tern, im<br />
Laufe der Jahre zuneh-<br />
mend regional – Fortbil-<br />
dungen durch und s<strong>in</strong>d<br />
seitdem Ansprechpartner<br />
für das Kollegium der<br />
eigenen Schule sowie für<br />
die Kollegen der Schulen<br />
Leitende Grundannahmen im Modellvorhaben ForMeL G<br />
• Medienkompetenz ist mehr als Mediennutzungskompetenz, <strong>in</strong>sofern greifen<br />
Lehrgänge <strong>zur</strong> Vermittlung technischer Grundfertigkeiten zu kurz.<br />
• Neue Medien s<strong>in</strong>d Werkzeuge („Tools“), die im Lehr–Lernprozess als Lernmedium<br />
oder Lerngegenstand ihren didaktischen Ort haben können.<br />
• Bei der Nutzung <strong>neuer</strong> Medien für <strong>in</strong>haltliche Ziele lernen Schüler wie Lehrer<br />
nachhaltiger.<br />
• Für Schüler wie Lehrer gilt es e<strong>in</strong> Grundverständnis medialer Ressourcen und<br />
Anwendungsfelder zu entwickeln – mit dem Anliegen um selbstständiges<br />
und kooperierendes Lernen im Zuge dieses Erwerbsprozesses.<br />
• Neue Medien, <strong>neuer</strong>e Erkenntnisse der Lernbiologie, erfordern e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung<br />
tradierter Formen der Wissensvermittlung und Unterrichtsgestaltung,<br />
erfordern e<strong>in</strong>e neue Lernkultur und e<strong>in</strong>e Veränderung der Lehrer–<br />
wie Lernerrolle.<br />
der Region. In e<strong>in</strong>em weiteren Schritt bildeten sich schul<strong>in</strong>tern bzw. regional Multiplikatoren-<br />
Tandems, wodurch pro Projektschule/Region ab Mitte 2001 zwei CoMus <strong>in</strong> ihrer Fortbil-<br />
dungsarbeit kooperierten und den Kollegen als Ansprechpartner <strong>zur</strong> Verfügung standen. Zum<br />
Schuljahr 2000/01 traten acht, zum Schuljahr 2001/02 vier weitere Grundschulen als Koope-<br />
rationspartner <strong>in</strong> das Fortbildungsnetzwerk e<strong>in</strong>. An diesen Schulen qualifizierte sich e<strong>in</strong> Kol-<br />
lege <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit dem Projektmitarbeiter der Region als Ansprechpartner für die<br />
Schwerpunkte des Projekts, sodass e<strong>in</strong> zunehmend dichteres „Netz“ von Ansprechpartnern,<br />
e<strong>in</strong> zunehmend breiterer Austausch vorhandener Kompetenzen und Erfahrungen entstehen<br />
konnte. Mit Projektmitteln (3) wurden die technischen Voraussetzungen an den Fortbildungs-<br />
schulen von Jahr zu Jahr qualitativ und quantitativ erweitert (leistungsstarke Präsentations-<br />
rechner, Scanner, CD–Brenner, Festplattenkapazität, Laptops, Beamer, DV–Videokameras,<br />
Digitalkameras, Grafiktabletts etc.). <strong>Entwicklung</strong>sprozesse im Projektteam haben <strong>in</strong>sbeson-<br />
dere <strong>in</strong> den letzten beiden Projektjahren zu Kooperationen von Multiplikatoren und <strong>zur</strong> Er-<br />
weiterung des Kreises der beteiligten Schulen geführt, was Entlastungen bzw. Stärkungen für<br />
die Multiplikatoren beförderte. E<strong>in</strong> im SEMIK–Gesamtvorhaben sowie im Berl<strong>in</strong>er Projekt<br />
„ForMeL G“ übergeordnetes <strong>Entwicklung</strong>sziel – Kooperation und Vernetzung – spiegelte sich<br />
somit auch im projekt<strong>in</strong>ternen <strong>Entwicklung</strong>sprozess sehr deutlich wider.<br />
<strong>Fortbildungskonzept</strong>e<br />
Die im Projekt „ForMeL G“ erarbeiteten und erprobten <strong>Fortbildungskonzept</strong>e zielten <strong>in</strong> zwei<br />
Richtungen:
Die Fortbildungen sollten<br />
• Lehrer zum technisch souveränen und didaktisch s<strong>in</strong>nvollen E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien im Un-<br />
terricht befähigen,<br />
• Lernarrangements und Lernmethoden transportieren, die <strong>in</strong> die Unterrichtspraxis der Teil-<br />
nehmer <strong>zur</strong>ückfließen und dazu beitragen können, e<strong>in</strong>e Veränderung der Lernkultur zu be-<br />
fördern.<br />
Die Fortbildungsangebote der Multiplikatoren im Projekt „ForMeL G“ hoben daher – neben<br />
der Vermittlung medientechnischer Kompetenzen – vor allem darauf ab<br />
• veränderte Formen des Lehrens und Lernens – und damit verbundener Veränderungen <strong>in</strong><br />
Bezug auf die Rollen der Lehrenden und Lernenden – zu implementieren, die – u. a. durch<br />
die E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Grundschulunterricht – <strong>in</strong> der heutigen Schule un-<br />
verzichtbar s<strong>in</strong>d,<br />
• Lehr–Lernformen zu etablieren, die selbstgesteuertes und situiertes Lernen sowie kooperati-<br />
ve Arbeitsverfahren bei der E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht unterstützen,<br />
• Lernumgebungen erfahrbar zu machen, die e<strong>in</strong>e Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Klassen-<br />
raum unterstützen,<br />
• auf die spezifischen Bed<strong>in</strong>gungen der Teilnehmer abgestimmte Angebote zu machen.<br />
Prozessbegleitung und Evaluation<br />
Bei der <strong>in</strong>ternen Evaluation erfuhr das Projekt „ForMeL G“ Unterstützung und Begleitung<br />
durch e<strong>in</strong>en Mitarbeiter der LMU München. Jährlich fanden bis Ende 2002 zwei Workshops<br />
zum Selbstevaluationsvorhaben statt. Darüber h<strong>in</strong>aus erfolgte e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche projekt<strong>in</strong>-<br />
terne Selbstevaluation, die durch Fortbildungen ergänzt wurde, um<br />
die prozessbegleitende Professionalisierung der im Projekt mitarbei-<br />
tenden Lehrer <strong>in</strong> ihrer Rolle als Fortbildner zu unterstützen. Vier<br />
SEMIK–Projekte (Berl<strong>in</strong> 1 und Berl<strong>in</strong> 2, Saarland, Sachsen) hatten<br />
sich zu e<strong>in</strong>em Selbstevaluationsverbund zusammengeschlossen, um<br />
über die Kooperation der Projektleiter und den Austausch über<br />
projektspezifische Zielsetzungen und jeweiliger Prozessschritte wei-<br />
tere Unterstützung der E<strong>in</strong>zelprojekte im Evaluationsvorhaben zu<br />
erzielen.<br />
17
Schulen im Projekt ForMeL G<br />
E<strong>in</strong> oder zwei Lehrer s<strong>in</strong>d seit dem Schuljahr 1999/2000 an sechs Projektschulen mit<br />
Multiplikatorenaufgaben betraut. Sie führen Fortbildungsveranstaltungen durch und<br />
dienen dem Kollegium der eigenen Schule sowie den Kollegen der Schulen der Region als<br />
Ansprechpartner.<br />
Re<strong>in</strong>ickendorf / Pankow–Weißensee–Prenzlauer Berg<br />
Mark–Twa<strong>in</strong>–Grundschule<br />
Auguste–Viktoria–Allee 95, 13403 Berl<strong>in</strong> (Re<strong>in</strong>ickendorf),<br />
Tel.: 41 92 4824<br />
http://www.twa<strong>in</strong>web.de/<br />
Projektlehrer: Frieder Klapp frieder@klappweb.de<br />
Spandau / Charlottenburg–Wilmersdorf<br />
Astrid–L<strong>in</strong>dgren–Grundschule<br />
Südekumzeile 5, 13591 Berl<strong>in</strong> (Spandau),<br />
Tel.: 375 862 0<br />
http://www.b.shuttle.de/b/l<strong>in</strong>dgrengs/<strong>in</strong>dex.html<br />
Projektlehrer: Thomas Kahlki thoka@l<strong>in</strong>dgrenschule.de<br />
Schöneberg–Tempelhof / Zehlendorf–Steglitz<br />
Schwielowsee–Grundschule<br />
Monumentenstr. 13a, 10829 Berl<strong>in</strong> (Schöneberg), Tel.:7560 7154<br />
http://www.schwielowsee-grundschule.de<br />
Projektlehrer<strong>in</strong>nen: Brigitte Meier brigitte.meier@berl<strong>in</strong>.de<br />
Doris Lerner doris.lerner@freenet.de<br />
Neukölln / Treptow–Köpenick<br />
Rose–Oehmichen–Grundschule (seit dem Schuljahr 2001/02)<br />
Lieselotte–Berger–Str. 65, 12355 Berl<strong>in</strong> (Neukölln), Tel.: 669 88 10<br />
Projektlehrer: Helmut Nitschke helmut.nitschke@t–onl<strong>in</strong>e.de<br />
Axel Schmidt axelp.schmidt@t–onl<strong>in</strong>e.de<br />
Projektleitung<br />
Dagmar Wilde<br />
Berl<strong>in</strong>er Landes<strong>in</strong>stitut für Schule und Medien (LISUM)<br />
Storkower Str. 133 / 10407 Berl<strong>in</strong><br />
SEMIK@dagmarwilde.de<br />
http://www.dagmarwilde.de/semik/<strong>in</strong>troformelg.html<br />
18<br />
Hohenschönhausen–Lichtenberg / Marzahn–Hellersdorf<br />
Grundschule im Grünen<br />
Malchower Chaussee 2, 13051 Berl<strong>in</strong> (Hohenschönhausen),<br />
Tel.: 925 39 65<br />
http://www.grundschule–im–gruenen.de/<br />
Projektlehrer: Ulrich Negraszus ulrich.negraszus@cityweb.de<br />
Friedrichsha<strong>in</strong>–Kreuzberg / Wedd<strong>in</strong>g–Tiergarten–Mitte<br />
Otto–Wels–Grundschule<br />
Alexandr<strong>in</strong>enstraße 12, 10969 Berl<strong>in</strong> (Kreuzberg), Tel.: 2588 7611<br />
http://home.snafu.de/ottowels/<br />
Projektlehrer: Bernward Weber bewe@snafu.de<br />
Ulrich Ahrens uahrens@t–onl<strong>in</strong>e.de<br />
Sigrid Seidel sigrid.seidel@arcor.de<br />
Schulen im Netzwerk „FormeL G“<br />
Grundschule an der Weberwiese (Friedrichsha<strong>in</strong>)<br />
5. Grundschule (Mitte)<br />
Erika-Mann-Grundschule (Wedd<strong>in</strong>g)<br />
Rudolf-Wissell-Grundschule (Wedd<strong>in</strong>g)<br />
Grundschule am Planetarium (Prenzlauer Berg)<br />
Grundschule am Saturnr<strong>in</strong>g (Treptow)<br />
Hauptmann-von-Köpenick-Grundschule (Köpenick)<br />
Ikarus-Grundschule (Tempelhof)<br />
Ernst-Habermann-Grundschule (Wilmersdorf)<br />
Katar<strong>in</strong>a-He<strong>in</strong>roth-Grundschule (Wilmersdorf)<br />
Lisa-Tetzner-Grundschule (Neukölln)<br />
Grundschule am Schäfersee (Re<strong>in</strong>ickendorf)<br />
Möwensee-Grundschule (Wedd<strong>in</strong>g)
4 Prozess–Schritte im Projekt ForMeL G<br />
Dagmar Wilde<br />
Anfang 1999 gab es <strong>in</strong> den Berl<strong>in</strong>er Grundschulen noch wenig IT–Ressourcen und entspre-<br />
chend wenig Erfahrungen zum Unterricht mit neuen Medien im Allgeme<strong>in</strong>en und im Erpro-<br />
ben veränderter Lernformen unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im Besonderen. Alle Mitar-<br />
beiter traten somit gleichermaßen als Lehrende wie als Lernende <strong>in</strong> das Projekt e<strong>in</strong>. Daraus<br />
erwuchsen Potenziale, e<strong>in</strong>e Veränderung der Lehrerrolle auch als Fortbildner zu „leben“.<br />
Die Mitarbeiter im Projekt zeichneten sich durch technische Kompetenz und Bereitschaft <strong>zur</strong><br />
E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> ihren eigenen Unterricht aus. Qualifikationen als Fortbildner,<br />
Kenntnisse über <strong>neuer</strong>e Lerntheorien und darauf bezogene didaktisch–methodische Unter-<br />
richtskonzepte galt es dagegen erst e<strong>in</strong>mal geme<strong>in</strong>sam zu erarbeiten bzw. zu vertiefen. Dar-<br />
aus erwuchsen Anforderungen an das „learn<strong>in</strong>g on job“, die phasenweise hier und da auch<br />
Gefühle der Überforderung entstehen ließen. Mit dem Anliegen, Lehrer für die Integration<br />
Neuer Medien <strong>in</strong> ihren Unterricht durch konkrete, praxiserprobte Angebote von Unterrichts-<br />
beispielen und damit verbundenen didaktisch–methodischen Konzepten zu überzeugen und zu<br />
ermutigen, verband sich die Aufgabe, selbst Unterrichtsmodelle für den E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien<br />
<strong>in</strong> verschiedenen Lernbereichen/Fächern zu entwickeln, zu erproben und zu dokumentieren<br />
(4). In diesem Bereich standen 1999 für die Fächer der Grundschule noch wenig Modelle <strong>zur</strong><br />
Verfügung. Darüber h<strong>in</strong>aus galt es an den Projektschulen Lernumgebungen vorzubereiten,<br />
<strong>in</strong> denen Fortbildungsteilnehmer selbstgesteuert lernen können, neue Medien zu nutzen und<br />
Unterricht mit neuen Medien zu planen und zu realisieren. Die Etablierung der räumlich-<br />
technischen Voraussetzungen forderte im ersten Projektjahr allen Projektmitarbeitern Energie<br />
und Improvisationstalent ab. Daraus erwuchsen Anforderungen an die Improvisations- und<br />
Frustrationstoleranz.<br />
E<strong>in</strong>ige Multiplikatoren g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> ihren Fortbildungsaktivitäten von Anfang an bereits <strong>in</strong> die<br />
Breite (Fortbildung, Austausch und Beratung von Nachbarschulen oder Schulen der Region).<br />
E<strong>in</strong>ige setzen auch 2002 weiterh<strong>in</strong> bei der <strong>in</strong>tensiven Unterstützung des eigenen Kollegiums<br />
an. Spezifische Bed<strong>in</strong>gungen der Schule bzw. der Region hatten spezifische Nachfrage <strong>zur</strong><br />
Folge, sodass sich die Multiplikatoren auf z. T. unterschiedliche Inhaltsschwerpunkte konzen-<br />
trierten. Dies führte mit der Zeit zu entsprechenden Spezialisierungen der Projektmitarbeiter<br />
(Websitegestaltung, Digitalfotografie, Digitalvideo, Scannen und Bildbearbeitung, Vernet-<br />
zungsfragen, Textverarbeitung, Basiskurse zu ausgewählten - <strong>in</strong>tegrierten - Programmen,<br />
Internet und E–Mail, Zeugnisse schreiben mit Textverarbeitung und Datenbank, Umgang mit<br />
dem Betriebssystem). Dom<strong>in</strong>ierten noch im Jahr 2000 vor allem Schulungen zu technischen<br />
Basisfertigkeiten (Betriebssystem, Vernetzung, spezifische Programme) das Fortbildungsange-<br />
bot, wurden ab Mitte 2001 von den meisten Multiplikatoren vor allem Fortbildungen durch-<br />
geführt, die didaktisch–methodische Aspekte des E<strong>in</strong>satzes <strong>neuer</strong> Medien im Unterricht der<br />
Grundschule mit technisch–medialen Aspekten des Vertrautwerdens mit Soft– oder Hardware<br />
verbanden. Dies war neben der zwischenzeitlich fortgeschrittenen Qualifizierung der Multip-<br />
likatoren auch auf die positive Resonanz und entsprechende Nachfrage <strong>in</strong> Schule und Region<br />
<strong>zur</strong>ückzuführen. Seit 2001 etablierten sich <strong>in</strong> allen Projektregionen sukzessive mehr <strong>in</strong>for-<br />
melle, bedarfsorientiert ausgerichtete Fortbildungsformen (Tutor<strong>in</strong>g on demand, Unterrichts-<br />
19
20<br />
begleitung, offene und/oder themenbezogene Workshops). Sie lösten <strong>in</strong> fast allen Regionen<br />
traditionelle Fortbildungsformen (mehrwöchige Kurse) mehr und mehr ab.<br />
Mitte 2001 waren fast alle Multiplikatoren nicht nur im eigenen Kollegium, sondern<br />
auch <strong>in</strong> der gesamten Region als kompetente Ansprechpartner bekannt geworden. Sie boten<br />
schul<strong>in</strong>tern und regional Fortbildungen an und qualifizierten hier und da bereits auch wei-<br />
tere Co–Multiplikatoren an der eigenen Schule oder <strong>in</strong> der Region (kooperatives Arbeiten,<br />
Modell–Lernen, Erfahrungsaustausch, theoriegeleitete Praxisreflexion, Konzeptentwicklung).<br />
Nach wie vor erprobten die Multiplikatoren selbst didaktisch–methodische Konzepte für<br />
e<strong>in</strong>en – sach– und fachgerechten – Mediene<strong>in</strong>satz im Grundschulunterricht, sie tauschten<br />
Unterrichtsmodelle <strong>in</strong> schul<strong>in</strong>ternen und regionalen Konferenzen aus und sie dokumentierten<br />
diese Beispiele z. T. auch auf der schuleigenen Website (5) . Deutlich wurde <strong>in</strong> allen Projekts-<br />
schulen, dass Kollegen als Fortbildnern e<strong>in</strong>e hohe Akzeptanz entgegengebracht wird, dass<br />
konkrete Unterrichtsbeispiele und –ergebnisse Lehrer ermutigen Unterricht mit neuen Medien<br />
zu erproben. Unübersehbar ist jedoch auch am Ende der Projektlaufzeit, dass die Ause<strong>in</strong>an-<br />
dersetzung mit neuen Medien e<strong>in</strong>e Ause<strong>in</strong>andersetzung mit dem Lernen erst dann <strong>in</strong> Gang<br />
setzt, wenn Lehrer auch explizit angeregt werden, sich <strong>in</strong> der Situation der Lernenden zu erle-<br />
ben und Lernsituationen mit neuen Medien gezielt zu reflektieren.<br />
Die meisten Projektmitarbeiter erarbeiteten, erprobten und evaluierten <strong>in</strong>zwischen verschie-<br />
dene Sett<strong>in</strong>gs von Fortbildungen (Veranstaltungsreihen, Workshops, Co-Teach<strong>in</strong>g, Tutor<strong>in</strong>g,<br />
Fachforen) und dokumentierten im Zuge ihrer Projektarbeit e<strong>in</strong> Reihe übertragbarer Fort-<br />
bildungsmodelle. Die <strong>in</strong>haltlichen Schwerpunkte variierten mit Bezug auf das <strong>in</strong> der Region<br />
Nachgefragte und die persönliche Qualifizierung und Spezialisierung (Websitegestaltung,<br />
Digitalfotografie, Videobearbeitung, Schreibprojekte, <strong>in</strong>tegrierte Programme). Etliche Multip-<br />
likatoren bezogen <strong>in</strong> ihren Fortbildungen zunehmend modellhaft Teilaspekte <strong>neuer</strong> Lernkultur<br />
e<strong>in</strong> und motivierten die Teilnehmer, die selbst erfahrenen Elemente auf ihren Unterricht zu<br />
übertragen (reflektierte Praxis etablierte sich vor allem über die Co-Teach<strong>in</strong>g-Konzepte <strong>in</strong> ei-<br />
nigen Schulen).<br />
Erfahrungen mit alternativen Fortbildungsformen<br />
Seit dem Jahr 2001 entwickelte sich die Nachfrage nach Kursen – <strong>in</strong>sbesondere Basisschulun-<br />
gen zum Umgang mit Computer, Internet und Textverarbeitungsprogrammen – <strong>in</strong> fast allen<br />
Regionen deutlich rückläufig. Das bestärkt die Erkenntnis, dass – <strong>in</strong> Bezug auf die Projektzie-<br />
le – didaktisch–methodische Fragen des Unterrichts mit neuen Medien mit der Vermittlung<br />
technischer Fertigkeiten zu koppeln s<strong>in</strong>d. Seit Mitte 2001 erproben etliche Multiplikatoren<br />
alternative Fortbildungsangebote, zu denen zahlreiche Dokumentationen vorliegen: Tuto-<br />
r<strong>in</strong>g on demand, Workshops, Unterrichtsbegleitung (Co-Teach<strong>in</strong>g), Regionalkonferenzen/<br />
Arbeitskreise, Fachforen. Es zeichnet sich ab, dass die eher <strong>in</strong>formell ausgerichteten Veranstal-<br />
tungen, bei denen Lehrer sich zum Beispiel mit <strong>in</strong>dividuellen Fragestellungen an e<strong>in</strong>em festen<br />
monatlichen Term<strong>in</strong> an den Multiplikator wenden oder sich mit Kollegen über <strong>in</strong>dividuelle<br />
Fortbildungsbedürfnisse, Erfahrungen und aktuelle Probleme austauschen können, hohe<br />
Akzeptanz <strong>in</strong> den Kollegien und Regionen erfahren. Diese <strong>in</strong> der Praxis verankerten, stand-<br />
ortnahen, bedarfs- und teilnehmerorientierten Fortbildungsformen konnten den angestrebten<br />
E<strong>in</strong>fluss auf die Unterrichtspraxis der Fortbildungsteilnehmer erzielen. E<strong>in</strong>e ganz wesentli-<br />
che Erkenntnis leiten wir aus der Fortbildungsarbeit im Projekt ab: Fortbildungen, die von
Kollegen angeboten werden, motivieren <strong>zur</strong> Teilnahme und wecken Fortbildungsmotivation.<br />
Kollegen aus der eigenen Schule oder aus der Region wirken auf die Teilnehmer authentisch.<br />
Das baut Hemmungen und Lernbarrieren ab. Die daraus entstehende Offenheit im Kreis der<br />
Teilnehmer setzt Potenziale frei. Die im Projekt ForMeL G entwickelten <strong>Fortbildungskonzept</strong>e<br />
s<strong>in</strong>d - das zeigt die <strong>Entwicklung</strong> der letzten beiden Projektjahre - geeignet, die Etablierung von<br />
Lerngeme<strong>in</strong>schaften <strong>in</strong> Kollegien und unter Kollegen benachbarter Schulen zu befördern.<br />
Tutor<strong>in</strong>g on demand<br />
Dieses bedarfsorientierte, <strong>in</strong>dividuelle Betreuungs–/Beratungsangebot wird schul<strong>in</strong>tern und/<br />
oder regional praktiziert. An bestimmten Tagen stehen die Multiplikatoren zu bestimmten<br />
Zeiten für Beratung <strong>zur</strong> Verfügung. Themen werden vorher verabredet oder auch spontan<br />
bearbeitet. Tutor<strong>in</strong>g sche<strong>in</strong>t dem Umstand besonders gerecht zu werden, dass sich situativ e<strong>in</strong>-<br />
gebettete, e<strong>in</strong>fache E<strong>in</strong>weisungen und wiederholte Unterstützungen <strong>in</strong> der konkreten Arbeits-<br />
situation vor Ort (<strong>in</strong> der Klasse, im Computerraum der Schule) besonders deutlich auf die<br />
Bereitschaft von Lehrern auswirken, Ängste abzubauen, Experimentier– und Innovationsfreu-<br />
de und vor allem Kooperationsbereitschaft und Offenheit im Austauschen von Erfahrungen,<br />
Problemen und Praxismodellen zu entwickeln. Alle Projektmitarbeiter, die dieses Angebot<br />
schul<strong>in</strong>tern – <strong>in</strong> Ansätzen auch regional – etabliert haben, konnten neben breiter Resonanz<br />
vor allem auch e<strong>in</strong>e deutliche Steigerung der Bereitschaft der Kollegen beobachten, neue Me-<br />
dien plan– und regelmäßig <strong>in</strong> den alltäglichen Unterricht zu <strong>in</strong>tegrieren und veränderte Unter-<br />
richtsformen zu erproben.<br />
Workshops<br />
Etabliert haben sich sowohl regelmäßige „themenoffene“ als auch zeitlich befristete, thema-<br />
tisch ausgerichtete Workshops („E–Mail–Projekte mit K<strong>in</strong>dern...“, „Websitegestaltung mit<br />
dem Programm XY“). Der eher <strong>in</strong>formelle Charakter und das handlungsorientierte, <strong>in</strong>divi-<br />
duell betreute Sett<strong>in</strong>g der Workshops eröffnet <strong>in</strong> besonderem Maße Chancen für e<strong>in</strong> Lernen<br />
von– und mite<strong>in</strong>ander, denn auch Teilnehmer fungieren untere<strong>in</strong>ander als Berater, die Mul-<br />
tiplikatoren treten als Mit–Lernende auf. Diese Form der Fortbildung f<strong>in</strong>det schul<strong>in</strong>tern und<br />
regional hohe Akzeptanz und setzt breites Interesse wie auch Bereitschaft <strong>in</strong> Gang, das im<br />
Workshop Erarbeitete <strong>in</strong> den eigenen Unterricht fließen zu lassen. Allerd<strong>in</strong>gs stellen Work-<br />
shops (und z. T. auch Tutor<strong>in</strong>g) besondere Anforderungen an die Lernumgebung (Hard– und<br />
Softwareausstattung, vorbereitete und doch „offene“ Angebote für Teilnehmer) und auch an<br />
die Flexibilität und Kompetenz der Multiplikatoren (situativ zu lösende Fragen, Souveränität<br />
auch e<strong>in</strong>mal Kenntnislücken zu offenbaren etc.). Im Projektzeitraum hat sich das Workshop–<br />
Konzept an drei Projektschulen fest etabliert (6). Darüber h<strong>in</strong>aus wurde von zwei Projektmit-<br />
arbeitern Mitte 2001 e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>e–Präsenz konzipiert (7), die das Workshopangebot begleiten<br />
und unterstützen soll.<br />
Regionalkonferenzen<br />
In vier Regionen wurden <strong>in</strong> der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit Foren zum <strong>in</strong>formellen,<br />
schulübergreifenden Austausch für <strong>in</strong>teressierte Kollegen implementiert (8). Thematische<br />
Schwerpunkte waren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Region anfangs vorwiegend technisch-organisatorische Fragen<br />
<strong>zur</strong> Hard– und Softwarebeschaffung und –e<strong>in</strong>richtung, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er anderen Region fachspezifi-<br />
21
22<br />
sche, den Deutschunterricht der Grundschule betreffende Aspekte des unterrichtlichen Me-<br />
diene<strong>in</strong>satzes. Regionalkonferenzen - so zeigte es sich <strong>in</strong> allen vier Regionen Berl<strong>in</strong>s - eröffnen<br />
e<strong>in</strong>e Plattform, die den schulübergreifenden Austausch anstößt, Kooperationen befördert und<br />
Impulse aus verschiedenen Schulen zu bündeln vermag. Als unverzichtbar erwies es sich, diese<br />
Foren thematisch zu strukturieren und methodenkompetent zu moderieren. E<strong>in</strong> ausschließlich<br />
themenoffener, <strong>in</strong>formeller Austausch – so zeigte es sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er anderen Region – erschöpft<br />
sich im Verlauf e<strong>in</strong>iger Treffen. Vom Multiplikator erfordert dieses Fortbildungsangebot – ne-<br />
ben fachlicher Souveränität – Kompetenzen im Bereich der Moderation von Arbeitsprozessen<br />
größerer Gruppen. Günstig erwies es sich, wenn Multiplikatoren bereits über schulübergrei-<br />
fende Kontakte und/oder regionale Akzeptanz verfügten.<br />
Unterrichtsbegleitung - Co-Teach<strong>in</strong>g<br />
Unterrichtsbegleitung sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e viel versprechende Form der Fortbildung im Team, bei der<br />
sich neben technischen Kompetenzen auch Vertrauen <strong>in</strong> die eigenen Fähigkeiten vermitteln<br />
lässt. Gleichfalls bietet das Unterrichten im Team Chancen, die Perspektive zu wechseln,<br />
Lehrerhandeln e<strong>in</strong>mal als Beobachter wahrzunehmen (bl<strong>in</strong>de Flecken aufzudecken) und Un-<br />
terricht geme<strong>in</strong>sam zu planen und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Prozessen und Ergebnissen zu reflektieren. Aus<br />
organisatorischen Gründen wird das Angebot ausschließlich schul<strong>in</strong>tern praktiziert. Mehrere<br />
Projektschulen haben die dafür erforderlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen ermöglicht. (9)<br />
Weiter zu verfolgen bleibt <strong>in</strong> diesem Konzept, <strong>in</strong>wiefern die Begleitung auch e<strong>in</strong>e Verantwor-<br />
tung beider Kollegen für den Lehr–Lern–Prozess (Planung, Durchführung und Rückbes<strong>in</strong>-<br />
nung) be<strong>in</strong>haltet. E<strong>in</strong>e re<strong>in</strong> technische Assistenz ist zwar entlastend, auf die Dauer jedoch der<br />
pädagogisch–didaktischen Qualitätsentwicklung kaum förderlich. Co-Teach<strong>in</strong>g unter dem<br />
Fokus fachlicher Ziele und didaktisch–methodischer Konzepte des Unterrichts mit neuen<br />
Medien könnte als e<strong>in</strong> wichtiger Impuls für Unterrichtsentwicklung dazu beitragen, kollegial<br />
getragene Schulentwicklungsprozesse <strong>in</strong> Gang zu setzen bzw. zu unterstützen.
5 Schlussfolgerungen zum Ende der Projektlaufzeit<br />
Dagmar Wilde<br />
Fortbildungen<br />
In Fortbildungen erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten im Gebrauch <strong>neuer</strong> Medien ga-<br />
rantieren noch ke<strong>in</strong>eswegs, dass diese E<strong>in</strong>gang im Unterrichtsalltag f<strong>in</strong>den, hierzu bedarf es<br />
kont<strong>in</strong>uierlicher, konsequenter Begleitung. Standortnahe Angebote <strong>in</strong> Form regelmäßiger – of-<br />
fener ebenso wie themengebundener – Workshops und Regionalkonferenzen sowie eher <strong>in</strong>for-<br />
melle Formen des Tutor<strong>in</strong>g erweisen sich hier als überaus wirksam. Zutrauen, neue Medien <strong>in</strong><br />
den Unterrichtsalltag zu <strong>in</strong>tegrieren, und didaktisch–methodische Kompetenz werden durch<br />
e<strong>in</strong>e begleitete Unterrichtspraxis und regelmäßigen (vor allem auch kritischen) Austausch mit<br />
Kolleg<strong>in</strong>nen deutlich befördert. Unterrichtsbezogene Beispiele und <strong>in</strong>dividuelle Ergebnisse,<br />
die sich die Teilnehmer <strong>in</strong> Fortbildungen selbst erarbeiten konnten, der Austausch von Ideen<br />
und Erfahrungen, das Abgleichen der Probleme, die Offenheit im Umgang mit Experimenten,<br />
Irrtümern und auch „Fehlern“ wirken sich stärkend auf das Selbstvertrauen im Umgang mit<br />
neuen Medien und das Interesse selbst Unterricht mit neuen Medien zu realisieren aus. Der<br />
Austausch mit Kollegen kann sich als e<strong>in</strong> fruchtbarer Fortbildungsimpuls mit hohem alltag-<br />
spraktischen Zugew<strong>in</strong>n erweisen: Eigene Ansätze und gewohnte Vorgehensweisen werden bei<br />
der Begegnung mit anderen Sichtweisen und Problemlösungen bestärkt und ergänzt oder <strong>in</strong><br />
Frage gestellt und modifiziert. Dies birgt Reflexions– und Veränderungsimpulse, die sich aus<br />
der alltäglichen Praxis oft nicht ergeben. Vernetzung, Partizipation und Austausch tragen <strong>zur</strong><br />
Professionalisierung aller Beteiligten bei. Wo sich schul<strong>in</strong>terne und –übergreifende Koopera-<br />
tionen, wo sich Netzwerke etabliert haben bzw. zu etablieren beg<strong>in</strong>nen, dort zeichnet sich ab:<br />
Innovationsbereitschaft und Bereitschaft zum Offenlegen und Geben, <strong>zur</strong> Übernahme von<br />
Verantwortung wachsen. Alle Beteiligten erleben e<strong>in</strong>e Stärkung der eigenen Kompetenz.<br />
Unterricht mit neuen Medien kann e<strong>in</strong>e Veränderung der Lehr–/Lernorganisation und der<br />
Lernkultur sowie auch e<strong>in</strong>e erhebliche Motivationssteigerung bei den Lernenden befördern<br />
– dies spiegeln sowohl Lernsituationen mit K<strong>in</strong>dern als auch Fortbildungssituationen mit Leh-<br />
rern wider. Zu betonen ist jedoch, dass es nicht die neuen Medien alle<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d, die diese Verän-<br />
derung bewirken können. Wenn ihr E<strong>in</strong>satz im Unterricht zu e<strong>in</strong>er Veränderung der Lernkul-<br />
tur beitragen soll, müssen Fortbildungen Pr<strong>in</strong>zipien dieser Lernkultur ebenfalls widerspiegeln.<br />
Fortbildungsszenarien müssen e<strong>in</strong>e Lernumgebung eröffnen, <strong>in</strong> der selbstverantwortliches,<br />
selbstorganisiertes, eigenaktives Lernen <strong>in</strong> kooperativen Arbeitsformen – bei kommunikati-<br />
vem Austausch – <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ausgewogenen Verhältnis von Instruktion und Konstruktion er-<br />
möglicht und bewusst erfahren werden können. Die aktive Rolle des Lernenden, Interaktivität<br />
<strong>in</strong> der Kommunikation mit dem Medium, Kooperation und Kommunikation mit Partnern,<br />
die veränderte Rolle des Lehrenden, die Entdeckung des Fehlers als Lernchance, die Individu-<br />
alität und Heterogenität der Lernwege und –ergebnisse – all dies s<strong>in</strong>d Beobachtungen, die <strong>in</strong><br />
Fortbildungs– ebenso wie Unterrichtssituationen deutlich werden. Die Nachhaltigkeit des Ler-<br />
nens <strong>in</strong> problembezogenen Lernsituationen spiegelt sich <strong>in</strong> den bisherigen Beobachtungen der<br />
Multiplikatoren wider. Diese Prozesse Fortbildungsteilnehmern explizit bewusst zu machen,<br />
ist e<strong>in</strong> wesentliches Anliegen der Projektmitarbeiter. Der Transfer vom eigenen Lernen zum<br />
23
24<br />
Lernen der K<strong>in</strong>der erschließt sich gerade Lehrenden mit langjähriger Berufserfahrung oft ganz<br />
und gar nicht „automatisch“.<br />
Fortbildner, so zeigt es sich, müssen e<strong>in</strong>e veränderte Rolle e<strong>in</strong>nehmen, die der veränderten<br />
Rolle der Lehrer im Unterricht mit neuen Medien gleich kommt. Lehrende fungieren nicht<br />
mehr als Experten, die im Besitz aller Lösungen s<strong>in</strong>d und diese häppchenweise an die Ler-<br />
nenden weiterreichen. Auch Teilnehmer tragen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei,<br />
br<strong>in</strong>gen durch Fragen, Ideen, Ergebnisse neue Lernimpulse <strong>in</strong> die Gruppe. Die Transformation<br />
von Vermittlungsprozessen <strong>in</strong> Aneignungsprozesse erfordert didaktische und lernpsychologi-<br />
sche Kompetenzen, die sich alle Lehrenden – auch die Multiplikatoren – erst sukzessive erar-<br />
beiten und derer sie sich stetig vergewissern müssen.<br />
Schulentwicklung<br />
Der Projektprozess ist sehr eng an Schulentwicklungsprozesse <strong>in</strong> Projektschulen und assozi-<br />
ierten Schulen gekoppelt gewesen – gleichzeitig war das Projekt „FormeL G“ e<strong>in</strong> wichtiges<br />
Element dieser Schulentwicklungsprozesse. Die Professionalisierung von Lehrern und die Im-<br />
plementierung <strong>neuer</strong> Lernkultur im Unterricht der Grundschule tragen <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> nicht<br />
nur des Unterrichts, sondern auch der Lehrenden und der Schule als Lernort bei. Diese Ent-<br />
wicklung bedarf entsprechender Unterstützung durch alle an Schule Beteiligten. Zentral s<strong>in</strong>d<br />
Akzeptanz der Schulleitung und Bereitschaft e<strong>in</strong>es größeren Teils des Kollegiums das Anliegen<br />
um Integration <strong>neuer</strong> Medien und Implementierung <strong>neuer</strong> Lernkultur mitzutragen bzw. aktiv<br />
zu unterstützen. Neue Konzepte müssen nicht unbed<strong>in</strong>gt von Anfang an von allen Beteiligten<br />
umgesetzt, sollten aber mit Interesse und Akzeptanz begleitet werden (11). E<strong>in</strong>e zentrale Auf-<br />
gabe der Schulleitung besteht dar<strong>in</strong>, <strong>Entwicklung</strong>en und Ergebnisse <strong>in</strong>s Gesamtkollegium zu<br />
transportieren und für Beteiligung (und auch kritische Rückmeldung) zu werben. Unterstüt-<br />
zung <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne me<strong>in</strong>t auch immer kritische Begleitung – Vergewisserung über die Ziele<br />
und Schritte dorth<strong>in</strong>, Überprüfung der Ergebnisse, ggf. Modifizierung der Konzepte. Hier<br />
haben sich Gesprächsrunden mit Projektleitung, Schulleitung und Multiplikator sowie regel-<br />
mäßige Arbeitstreffen des Projektteams an allen Projektschulen als prozessfördernd erwiesen.<br />
E<strong>in</strong> wichtiges Forum ist darüber h<strong>in</strong>aus die „Fach–Runde“, die zweimal im Jahr Vertretern<br />
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, des Landesschulamtes, des LISUM, den<br />
Schulleitungen, Multiplikatoren, beteiligten Lehrern Gelegenheit zum Austausch eigener und<br />
Kennen lernen fremder Sichtweisen, <strong>Entwicklung</strong>sschritte, Probleme und Lösungen eröffnet.<br />
Der Informationsfluss zum Stand der Arbeit, zu Problemen und <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> den Schu-<br />
len und Regionen sowie im Gesamtvorhaben weitet und schärft den auf den eigenen Arbeits-<br />
bereich beschränkten Blickw<strong>in</strong>kel.<br />
Die Implementierung <strong>neuer</strong> Lernkultur und <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> Schule und Unterricht ist e<strong>in</strong><br />
Prozess, den E<strong>in</strong>zelne nicht <strong>in</strong>itiieren und realisieren können. Sowohl <strong>in</strong> systemadm<strong>in</strong>istra-<br />
tiven als auch <strong>in</strong> <strong>in</strong>haltlichen Belangen bedarf es der aktiven Unterstützung durch mehrere<br />
Kollegen. Müsste der Multiplikator als E<strong>in</strong>zelkämpfer agieren, wäre er (trotz Entlastungsstun-<br />
den) auf Dauer überfordert. Wichtig ersche<strong>in</strong>t es, dass das Kollegium sich auf e<strong>in</strong> Konzept<br />
zum Mediene<strong>in</strong>satz – als Teil des Schulprogramms – verständigt und Lehren und Lernen mit<br />
neuen Medien als e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Aufgabe begreift. Solche <strong>Entwicklung</strong>en zeichnen sich <strong>in</strong><br />
den Projektschulen ab (Entstehen schul<strong>in</strong>terner Computer–Teams, Erarbeitung schulischer<br />
Medienkonzepte).
Bestätigt hat sich an den Fortbildungsschulen, dass für e<strong>in</strong>e erfolgreiche Schulentwicklung<br />
neben der E<strong>in</strong>beziehung des gesamten Kollegiums und der Unterstützung durch die Schul-<br />
aufsicht vor allem auch die E<strong>in</strong>beziehung der Eltern von Bedeutung ist. An etlichen Schulen<br />
werden Eltern <strong>in</strong>zwischen regelmäßig über medienpädagogische Themen sowie über neue<br />
bzw. veränderte didaktische Konzepte (z.B. das Schreiben am Computer) <strong>in</strong>formiert, an e<strong>in</strong>i-<br />
gen Projektschulen werden Fortbildungen für Eltern angeboten, gleichfalls werden Eltern aber<br />
auch als Experten <strong>in</strong> die schulische Medienarbeit e<strong>in</strong>bezogen.<br />
Perspektiven<br />
Die Arbeit mit neuen Medien, das haben alle am Projekt „FormeL G“ unmittelbar und mit-<br />
telbar Beteiligten vor Ort <strong>in</strong>zwischen erfahren dürfen, erfordert e<strong>in</strong> hohes Engagement der<br />
Lehrer, Schüler und Eltern. Unterstützung bedarf es nicht zuletzt <strong>in</strong> technisch–adm<strong>in</strong>istrativer<br />
H<strong>in</strong>sicht. Die Betreuung und Aktualisierung der schulischen Ausstattung ist zu gewährleisten.<br />
Die E<strong>in</strong>richtung und Wartung der Computer, des Internet, der Peripherie, die Betreuung ver-<br />
netzter Systeme erfordert neben Kompetenz vor allem Zeit. Lehrer s<strong>in</strong>d damit – neben ihrer<br />
Unterrichts– und Fortbildungstätigkeit – faktisch überfordert. Wo auf Elternhilfe oder externe<br />
Partner als Sponsoren <strong>zur</strong>ückgegriffen werden kann, bleibt dies e<strong>in</strong> Kompromiss, der meist<br />
ke<strong>in</strong>e Kont<strong>in</strong>uität bietet. Dies wirkt sich auf das Engagement für die Implementation <strong>neuer</strong><br />
Medien negativ aus. (16)<br />
Die Öffnung der Grundschulen für den Unterricht mit neuen Medien erfordert nicht al-<br />
le<strong>in</strong> personelle Ressourcen (d. h. kompetente, fortbildungsaufgeschlossene Lehrer), sondern<br />
vor allem auch beträchtliche f<strong>in</strong>anzielle Ressourcen. Wenn Lernen mit neuen Medien <strong>in</strong> der<br />
Grundschule selbstverständlicher Bestandteil des alltäglichen Unterrichts werden soll, müs-<br />
sen K<strong>in</strong>der und Lehrer ebenso selbstverständlichen Zugang zu Computer, Internet, Drucker,<br />
Scanner und Digitalkamera wie zu Tafel und Kreide, Schulbuch und Heft haben. (17) Mit<br />
e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>maligen Ausstattungsoffensive – auch wenn sie den Bedarf aller Klassen e<strong>in</strong>er Schule<br />
optimal decken würde (was wohl ke<strong>in</strong>eswegs der Fall ist) – ist es nicht getan. Nach spätestens<br />
zwei bis drei Jahren zeigen Hardware und Peripherie Reparatur–, Ergänzungs– und vor allem<br />
Er<strong>neuer</strong>ungsbedarf, aktuelle und aktualisierte Software präsentiert sich am Markt, Lizenzen<br />
für die Klassenräume s<strong>in</strong>d zu f<strong>in</strong>anzieren. Für e<strong>in</strong>e tragfähige Motivation und Lernbereit-<br />
schaft jüngerer K<strong>in</strong>der, vor allem aber für e<strong>in</strong>e sachgerechte, zielorientierte Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Lernbereich/Fach erweist es sich als kontraproduktiv, wenn Lernende und Lehrende – bed<strong>in</strong>gt<br />
durch ger<strong>in</strong>ge Anzahl von Geräten, begrenzte Möglichkeiten veralteter Hardware, m<strong>in</strong>imale<br />
Softwareausstattung – Arbeitsvorhaben nur zeitlich verzögert durchführen können. Durch die<br />
Erfahrungen des Projekts wird die Forderung bestärkt, dass e<strong>in</strong>e Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong><br />
den (Alltags)Unterricht es notwendig macht, dass neben e<strong>in</strong>er Ausstattung der Klassenräume<br />
mit nach Möglichkeit ca. drei vernetzten Geräten, auch – m<strong>in</strong>destens – e<strong>in</strong>e zentrale „Com-<br />
puterwerkstatt“ existieren sollte, <strong>in</strong> der gleichzeitig mehrere K<strong>in</strong>der und Lehrer an und mit<br />
den Geräten arbeiten können. In zahlreichen Grundschulen hat sich das Konzept e<strong>in</strong>er Me-<br />
dien–Werkstatt seit langem bewährt, die neben neuen Medien, Schreibecken mit vielfältigen<br />
Schreibwerkzeugen und -materialien sowie e<strong>in</strong>e Bibliothek und Mediothek <strong>in</strong>tegriert. Auch<br />
dezentrale Medienecken oder mobile Medienzentren (z. B. mit drahtlos vernetzten Laptops)<br />
erweisen sich – so auch an den ForMeLG-Schulen – als besonders praktikabel (18).<br />
25
26<br />
Was folgt?<br />
Das Fortbildungs<strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> Bezug auf neue Medien ist bei Lehrern hoch, wenn – schul<strong>in</strong>tern<br />
bzw. standortnah – Angebote existieren, die auf die spezifischen Bed<strong>in</strong>gungen an der Schule<br />
und auf die Unterrichtspraxis zugeschnitten s<strong>in</strong>d. Zweifellos braucht es aber Zeit und quali-<br />
fizierte Angebote, Lehrende nicht nur zu motivieren Computer und Internet im Unterricht zu<br />
benutzen, sondern sie darüber h<strong>in</strong>aus auch zu befähigen Unterricht unter e<strong>in</strong>em konstruktivis-<br />
tischen Verständnis von Lernen zu konzipieren. Neue Medien s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> wichtiger Bestandteil<br />
<strong>zur</strong> Implementierung <strong>neuer</strong> Lernkultur und <strong>in</strong>novativer Unterrichtsmethoden – e<strong>in</strong> fundiertes<br />
Verständnis um Lehr–/Lernprozesse, Diagnose– und Sachkompetenz seitens der Lehrenden<br />
bilden jedoch das Fundament. E<strong>in</strong>e umfassende Medienausstattung, vernetzte Computer oder<br />
der Zugang zum Internet <strong>in</strong> allen Klassenräumen br<strong>in</strong>gen ebensowenig von selbst bereits<br />
e<strong>in</strong>e neue Qualität von Lehren und Lernen mit sich wie Lehrer mit Kompetenzen im Vide-<br />
oschnitt und Webdesign. Es bleibt daher wesentlich die Frage nach der Qualität von Lehr–/<br />
Lernprozessen mit neuen Medien zu stellen. Es bleibt die Frage nach dem „Mehrwert“, den<br />
neue Medien bei der Arbeit an e<strong>in</strong>em Lern<strong>in</strong>halt bieten, zu stellen. Damit s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Fortbildun-<br />
gen Fragen der Qualität von Unterricht mit und ohne neue Medien berührt, die zu bearbeiten<br />
das Vorhandense<strong>in</strong> von Kriterien erfordert.<br />
Unterricht mit neuen Medien sollte - nach PISA - weit mehr se<strong>in</strong> als Nachmittagsunterricht<br />
im Rahmen e<strong>in</strong>er Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft, „Highlight“ der Projekttage oder Spezialität e<strong>in</strong>zelner<br />
Lehrer, die ihrer Begeisterung für technische Innovationen frönen. Neue Medien müssen im<br />
Deutschunterricht, Mathematikunterricht, Sachunterricht, Kunstunterricht, Musikunterricht,<br />
Sportunterricht der Klassenstufe 1 - 4 und <strong>in</strong> den Sachfächern der Klassenstufe 5/6 (fachspe-<br />
zifisch und fachübergreifend) jenen didaktischen Ort erhalten, der ihnen im Kontext der In-<br />
halte, Ziele und Voraussetzungen der Lernenden für e<strong>in</strong>en nachhaltigen Lernertrag zukommt<br />
- wenn sie das Lernen unterstützen und Werkzeug wie Inhalt des Lernens im Kontext <strong>in</strong>halt-<br />
licher und methodischer Ziele se<strong>in</strong> können. Um die Lernkompetenz von Schülern zu fördern<br />
und um die dafür erforderliche Medienauswahl vorzunehmen und den dafür erforderlichen<br />
Mediene<strong>in</strong>satz zu realisieren, benötigen alle Lehrer Medienkompetenz.<br />
Die bisherigen Erfahrungen im Projekt verdeutlichen: Erkenntnisse bilden sich im Prozess<br />
der Erfahrungsgew<strong>in</strong>nung erst sukzessive heraus und die Erkenntnisse verändern gleichzeitig<br />
wieder die Konzepte. Die Verarbeitung von Wissen und die Veränderung von Handeln setzt<br />
Geduld und Vertrauen <strong>in</strong> langfristige Lernprozesse bei Lehrern voraus. Auch im Projektteam<br />
musste sich e<strong>in</strong>e lernoffene Haltung, e<strong>in</strong>e Atmosphäre, <strong>in</strong> der Fehler erlaubt s<strong>in</strong>d, und <strong>in</strong> der<br />
man sich über Erfolge und Misserfolge austauschen kann, erst sukzessive etablieren. Den<br />
Arbeitsprozess konsequent als Forschungsprozess zu verstehen („Was lässt sich vone<strong>in</strong>ander<br />
lernen?“), das hat alle Beteiligten <strong>in</strong> den fünf Projektjahren gleichermaßen herausgefordert<br />
wie motiviert.
(1) Vgl. S. 10.<br />
(2) Mandl / Re<strong>in</strong>mann-Rothmeier / Gräsel: Gutachten <strong>zur</strong> Vorbereitung des Programms „Systematische E<strong>in</strong>bezie<br />
hung von Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien <strong>in</strong> Lehr- und Lernprozesse“. Bund-Länder-<br />
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK). Bonn 1998.<br />
(3) Das BLK-Projekt wird vom Land Berl<strong>in</strong> mit Personalmitteln, vom BMBF mit Sachmitteln f<strong>in</strong>anziert.<br />
(4) Vgl. www.momodo.de. Siehe auch: Kahlki, Thomas / Klapp, Frieder: MoMo - die Internet-Mitmach-Seite. In:<br />
Grundschulunterricht Heft 2/2002. S. 33.<br />
(5) http://www.b.shuttle.de/b/l<strong>in</strong>dgrengs/ - www.twa<strong>in</strong>web.de - http://www.snafu.de/~ottowels.<br />
(6) Hierzu z. B. : www.schulvision.de.<br />
(7) www.schulvision.de (Erfahrungen werden im Laufe des Projektjahres 2002 gesammelt und dokumentiert).<br />
(8) Z. B. <strong>in</strong> der Region Neukölln-Treptow-Köpenick und <strong>in</strong> der Region Tempelhof-Schöneberg.<br />
(9) Z. B. Otto-Wels-Grundschule, Schwielowsee-Grundschule, Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule, Astrid-L<strong>in</strong>dgren-<br />
Grundschule.<br />
(11) Vgl. hierzu Aufenanger, Stefan: Medienkompetenz als Aufgabe von Schulentwicklung. In: SchulVerwaltung spez<br />
ial Heft 1/2001.<br />
(12) Siehe hierzu: Gerhard Tulodziecki, 1997.<br />
(13) Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule.<br />
(14) Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule.<br />
(15) Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule, Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule, Schwielowsee-Grundschule.<br />
(16) Erste Schritte dieses Problem zu lösen erfolgen <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> seit dem Schuljahr 2001/02, <strong>in</strong>dem zum<strong>in</strong>dest erst e<strong>in</strong><br />
mal für jeden Bezirk Systemadm<strong>in</strong>istratorenstunden auch für Grundschulen <strong>zur</strong> Verfügung gestellt werden.<br />
(17) Von entscheidender Bedeutung ist hier nicht zuletzt die didaktische Qualität der e<strong>in</strong>gesetzten Lernsoftware.<br />
(18) Otto-Wels-Grundschule, Schwielowsee-Grundschule, Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule, Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule.<br />
27
28<br />
Neue Medien im Schulalltag...<br />
Gedankensplitter<br />
Neue Medien verändern Wissensmonopole - und<br />
damit die Rollen von Lehrenden und Lernenden...<br />
Lernen mit neuen Medien muss „neues“ Lernen mit Medien<br />
se<strong>in</strong>... Ist die Forderung nach eigenaktivem, situiertem,<br />
<strong>in</strong>dividualisiertem Lernen im sozialen Kontext der Gruppe<br />
eigentlich „neu“?<br />
Lehren bedeutet anregende Lernumgebungen zu gestalten<br />
und unterschiedliche Zugänge zum Wissen zu ermöglichen...<br />
Medien s<strong>in</strong>d Teil dieser Lernumgebung und Tools für den<br />
Wissenserwerb...<br />
Neue Medien und neue Lernkultur erfordern: Unterrichts-,<br />
Organisations- und Personalentwicklung...<br />
Welchen „Mehrwert“ bergen neue Medien<br />
für das Lernen und Lehren <strong>in</strong> der<br />
Grundschule?<br />
Lehren und Lernen mit neuen Medien verändert<br />
auch das Lehren und Lernen ohne neue Medien -<br />
hier e<strong>in</strong>mal Unterricht mit dem Computer, da e<strong>in</strong>mal<br />
„normaler“ Unterricht: Das ist nicht mehr möglich...<br />
Es gibt ke<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong> gültigen Rezepte,<br />
aber Impulse, Beispiele und Orientierungen<br />
für <strong>Entwicklung</strong>sschritte...<br />
Leitend sollte die Frage se<strong>in</strong>: „Wie können diese Lernziele<br />
durch den E<strong>in</strong>satz von Computer und Internet unterstützt<br />
werden?“ Leiten sollte uns nicht die Frage: „Was könnten die<br />
K<strong>in</strong>der mit Computer und Internet machen?“<br />
Neue Medien verändern die Lernkultur <strong>in</strong> Unterricht<br />
und Schule nicht per se...
6 ForMeL G <strong>in</strong> den Regionen<br />
Berichte der Projektmitarbeiter im Mai 2002<br />
Drei Jahre ForMeL G an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
Frieder Klapp<br />
Zur Ausgangslage an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
Nach <strong>in</strong>tensiven Vorarbeiten und mehreren von mir e<strong>in</strong>gereichten Projektvorschlägen erhielt<br />
die Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule schließlich im September 1998 von „Schulen ans Netz“ zehn<br />
Computer mit neuester Technologie, die vernetzt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em (für Fortbildungen vorgesehen)<br />
Computerraum standen. Durch diese Voraussetzungen entstand bei e<strong>in</strong>er Reihe von Kollegen<br />
der Wunsch, mit ihren Schülern am Computer zu arbeiten bzw. selbst erste Erfahrungen mit<br />
diesem Medium zu sammeln. Insofern hatten die <strong>in</strong> der Schule zum damaligen Zeitpunkt vor-<br />
handenen Möglichkeiten wesentlichen Anteil am Aufbau e<strong>in</strong>er Motivation <strong>zur</strong> Beschäftigung<br />
mit dem Computer. Bereits im Schuljahr 1998/99 (also im Vorfeld des BLK-Modellversuchs)<br />
nahmen bereits 23 Kollegen an m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>er von mir angebotenen schul<strong>in</strong>ternen Compu-<br />
ter-Fortbildung teil. Außerdem organisierte ich im Dezember 1998 e<strong>in</strong>en Studientag mit den<br />
Themen: „Computer im Anfangsunterricht als Unterstützung im Lese-Schreib-Lernprozess“<br />
und „E<strong>in</strong>satz von Lernsoftware <strong>in</strong> allen Fächern“.<br />
Die wesentlichen Aufgaben des 1. Projektjahres 1999/2000: Schaffung der Netzwerk-Infrastruktur<br />
und Fortsetzung von Basis-Fortbildungskursen<br />
Im ersten Projektjahr 1999/2000 musste ich extrem viel Zeit aufbr<strong>in</strong>gen, um nach dem Um-<br />
zug <strong>in</strong> den Altbau die Computer und das Computernetzwerk im Fortbildungsraum e<strong>in</strong><strong>zur</strong>ich-<br />
ten und für die Arbeit mit den Schülern und für die Fortbildungen zu adm<strong>in</strong>istrieren. H<strong>in</strong>zu<br />
kam im März 2000 die Erweiterung des Computernetzes auf acht Klassenräume mit je zwei<br />
Computern, e<strong>in</strong>em Drucker und teilweise e<strong>in</strong>em Scanner pro Klasse. Viele Kollegen, die <strong>in</strong><br />
den so ausgestatteten Klassen unterrichteten, nahmen regelmäßig an der kollegiums<strong>in</strong>ternen<br />
Fortbildung teil. Die schul<strong>in</strong>ternen Basiskurse beschäftigten sich mit den Möglichkeiten des<br />
Office-Programms „AppleWorks“, mit Internet und E-Mail, mit der digitalen Bildbearbeitung<br />
und mit Unterrichtsprojekten mit Computer und Internet. H<strong>in</strong>zu kam e<strong>in</strong> Basiskurs zum The-<br />
ma Internet, den ich für alle Re<strong>in</strong>ickendorfer Kollegen anbot.<br />
Insgesamt besuchten im ersten Projektjahr 18 Kollegen der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule und<br />
12 Kollegen anderer Re<strong>in</strong>ickendorfer Grundschulen m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>en der oben angegebenen<br />
Fortbildungskurse (7-13 Teilnehmer pro Kurs). Die vorherrschende Arbeitsform war die Part-<br />
nerarbeit. Außerdem unterstützte ich die Kollegen regelmäßig 2-3 Stunden pro Woche durch<br />
Unterrichtsbegleitungen (Co-Teach<strong>in</strong>g) <strong>in</strong> drei 3. Klassen und e<strong>in</strong>er 4. Klasse (Schüler schrei-<br />
ben ihre Texte/Aufsätze und illustrieren sie). Zusätzlich gab es e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Beratung<br />
(Tutor<strong>in</strong>g) von Kollegen (ca. 1-2 Stunden pro Woche). Im Bezirk Re<strong>in</strong>ickendorf machte ich<br />
das SEMIK-Projekt und die Rolle der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule als Projektschule im Fort-<br />
bildungsnetzwerk Grundschule im Frühjahr 2000 durch e<strong>in</strong>e Präsentation auf e<strong>in</strong>er Schullei-<br />
29
30<br />
tersitzung bekannt. E<strong>in</strong>e weitere Präsentation mit e<strong>in</strong>em Lernsoftware-Workshop erfolgte im<br />
Rahmen e<strong>in</strong>er Sitzung der Bezirksfachkonferenz Deutsch.<br />
Fortbildungen im 2. Projektjahr (2000/2001): Statt Kursen nun Workshops<br />
Der Fortbildungskurs am Beg<strong>in</strong>n des zweiten Projektjahres im September 2000 signalisierte<br />
den Übergang zu Workshops. Das Fortbildungsthema „Im Netz präsent - nicht schwer!“ (Pla-<br />
nung, Struktur und Design e<strong>in</strong>er Grundschul-Homepage für Re<strong>in</strong>ickendorfer Grundschulen)<br />
war zwar noch als 12-stündiger Kurs angekündigt, trug aber dann weitgehend Workshop-<br />
Charakter, das heißt die Eigenaktivität der Teilnehmer überwog. So konnten sie ihre eigenen<br />
Ideen selbständig umsetzen und zudem mit me<strong>in</strong>er Unterstützung rechnen, wenn sie Hilfe<br />
benötigten. Während des zweiten Projektjahres bot ich wöchentliche, schul<strong>in</strong>terne und exter-<br />
ne Workshops zum übergeordneten Thema „Computer und Internet im Unterricht“ an. Der<br />
zeitliche Umfang betrug je nach Inhalt zwischen 2-6 Stunden. (Die genauen Inhalte und Orte<br />
f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> der Workshop-Übersicht 2001.) Mit dem Wechsel von Kursen zu Workshops<br />
rückten nun auch spezifische Ziele des SEMIK-Modellvorhabens stärker <strong>in</strong> den Vordergrund.<br />
Das didaktische Arrangement der <strong>zur</strong> Verfügung gestellten Lernumgebung ermöglichte es den<br />
Teilnehmern nun, ihre Sach-, Methoden- und Sozialkompetenz weiter zu entwickeln.<br />
Neue <strong>Lernkulturen</strong> wurden <strong>in</strong> allen Workshops folgendermaßen umgesetzt:<br />
• Den Kursteilnehmern wurde durch die Entscheidung über den Inhalt (z.B. Internet-Recher-<br />
che oder Schul-Homepage-Gestaltung) <strong>in</strong>teressengebundenes Lernen ermöglicht.<br />
• Die gerade erlernten Fähigkeiten und das neu erworbene Wissen wurden auf verschiedene<br />
Frage- und Problemstellungen übertragen.<br />
• Kooperatives und selbständiges Arbeiten bildete e<strong>in</strong>en wichtigen Bestandteil der<br />
Arbeitsphasen.<br />
• Es gab e<strong>in</strong>en regen Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern.<br />
• Die Instruktion beschränkte sich auf kurze, gezielte Inputphasen.<br />
• Der Lehrende agierte vor allem <strong>in</strong> der Rolle e<strong>in</strong>es Beraters.<br />
21 Kollegen der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule und 19 Kollegen anderer Re<strong>in</strong>ickendorfer oder<br />
Berl<strong>in</strong>er Grundschulen nahmen an m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em der Workshops teil (je 2-14 Perso-<br />
nen). Weiterh<strong>in</strong> waren Co-Teach<strong>in</strong>g (unterrichtsbegleitende Fortbildungen) und Tutor<strong>in</strong>g<br />
(E<strong>in</strong>zelberatung/Support) wichtige Bestandteile me<strong>in</strong>es <strong>Fortbildungskonzept</strong>s. Als Beispiel soll<br />
hier exemplarisch die Unterrichtse<strong>in</strong>heit <strong>zur</strong> Lektüre des Buches „Emil und die Detektive“<br />
von Erich Kästner genannt werden. Dazu fanden im Co-Teach<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensive Arbeit im<br />
Internet, das Erstellen e<strong>in</strong>er Wandzeitung und e<strong>in</strong>e Exkursion als „Hör-Spaziergang“ begleitet<br />
mit der Video-Kamera statt.<br />
Die Akzeptanz des Mediums Computer wuchs im Kollegium, wobei jedoch <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
die Kollegen, die auch über Computer <strong>in</strong> den Klassen verfügten, diese mehr oder weniger<br />
<strong>in</strong>tensiv <strong>in</strong> ihren Unterricht <strong>in</strong>tegrierten. Jene Kollegen waren es anderseits aber auch, die<br />
verstärkt mit ihrer Klasse oder Teilgruppe den Computerraum aufsuchten. Nur durch diese<br />
zusätzliche Möglichkeit kam es wirklich zu e<strong>in</strong>er effektiven Nutzung der neuen Medien. Al-<br />
le<strong>in</strong> mit den Computern <strong>in</strong> den Klassen wäre die <strong>in</strong>tensive E<strong>in</strong>beziehung des Computers als<br />
Werkzeug <strong>in</strong> vielen Unterrichtsfächern nicht möglich gewesen. Für die e<strong>in</strong>zelnen Klassenstufen<br />
wurde auf der Gesamtkonferenz jeweils e<strong>in</strong> Kollege zum Computerexperten/-ansprechpartner<br />
ausgewählt, der verstärkt an den schul<strong>in</strong>ternen Fortbildungen teilnahm. Außerdem wurden
im Schuljahr 2000/2001 <strong>in</strong> jeder der sieben Klassen mit neuen Computern zwei Schüler (e<strong>in</strong><br />
Mädchen und e<strong>in</strong> Junge) ausgewählt, die im Januar und Februar 2001 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em 12-stündi-<br />
gen Workshop (drei Vormittage à vier Stunden) zum „MacHelper“ ausgebildet. Die Schüler<br />
waren somit <strong>in</strong> der Lage, kle<strong>in</strong>ere Probleme mit dem Computer und Drucker <strong>in</strong> der Klasse<br />
selbständig zu beheben sowie ihren Mitschülern zu helfen und ihre Lehrer bei der Compu-<br />
terarbeit <strong>in</strong> der Klasse zu unterstützen. Neben der Möglichkeit des kreativen Umgangs mit<br />
dem Medium konnten die Kollegen durch umfangreichere Anschaffungen von Lernsoftware<br />
für verschiedene Fächer auch erste Erfahrungen mit dem Computer als Instrument <strong>zur</strong> In-<br />
formationsvermittlung und zum Üben sammeln. Dabei wurde auch deutlich, dass der Anteil<br />
von Lernsoftware, die sich für den Unterricht und besonders für die Verwendung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Netzwerk eignet, noch recht ger<strong>in</strong>g ist. E<strong>in</strong> Grund dafür ist sicher dar<strong>in</strong> zu sehen, dass diese<br />
Software weitgehend für den Heimbereich konzipiert wird, also für e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d an e<strong>in</strong>em Rech-<br />
ner. Dies erschwerte den E<strong>in</strong>satz im Unterricht und machte zusätzliche Fortbildungen zum<br />
Lernsoftware-E<strong>in</strong>satz notwendig.<br />
In den letzten Monaten des zweiten Projektjahres begann auf der Projektebene e<strong>in</strong>e neue<br />
<strong>Entwicklung</strong>. Die langjährige Zusammenarbeit mit Thomas Kahlki - dem Projektmitarbeiter<br />
der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule <strong>in</strong> Spandau - führte <strong>zur</strong> Bildung e<strong>in</strong>es Fortbildner-Teams. So<br />
fand im Juni 2001 der erste Fortbildungsworkshop im Team statt. Die Teilnehmer aus Mitte,<br />
Neukölln und Schöneberg trafen sich <strong>zur</strong> „Schulhomepage-Gestaltung mit Freeway“ an der<br />
Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule. Außerdem war dies auch der erste Workshop, der im Internet<br />
auf der Seite „www.schulvision.de“ begleitet wurde. Die Fortbildungsteilnehmer nahmen die-<br />
ses Angebot wahr und beteiligten sich mit E-Mails an der Diskussion im Netz.<br />
Neue Formen der Fortbildungen im dritten Projektjahr (2001/2002): Fortbildung im Team und<br />
im Netz<br />
Die wesentlichen <strong>Entwicklung</strong>sschritte im dritten Projektjahr bestanden <strong>in</strong> der Teambildung<br />
und der geme<strong>in</strong>samen Arbeit im Netz. Die von uns gestalteten Internetpräsenzen „SchulVision<br />
- die Internet-Portalseite für LehrerInnen“ (www.schulvision.de) und „MoMo - die Internet-<br />
Mitmachseite für SchülerInnen“ (www.momodo.de) waren wichtige Bestandteile unserer<br />
Fortbildungsarbeit. E<strong>in</strong> wesentlicher Schwerpunkt unseres Konzepts ist die Verb<strong>in</strong>dung von<br />
„traditioneller“ Fortbildung und Onl<strong>in</strong>e-Hilfe und Onl<strong>in</strong>e-Kontakt. Der Ansatz, Fortbildun-<br />
gen onl<strong>in</strong>e durch „SchulVision“ zu unterstützen, geht von folgenden Annahmen aus:<br />
• e<strong>in</strong>e aktive Ause<strong>in</strong>andersetzung der Fortbildungsteilnehmer mit den neuen Medien wird an-<br />
geregt und kann mit fortgeschrittener Projektdauer vorausgesetzt werden,<br />
• durch die Interaktivität s<strong>in</strong>d die Betreuung der Teilnehmer und der Dialog (auch der Teil-<br />
nehmer untere<strong>in</strong>ander) auch über die Fortbildung h<strong>in</strong>aus möglich (so erhalten Teilnehmer<br />
zum Beispiel Chancen zu Rückfragen, die sich erst bei der späteren Arbeit und der Umset-<br />
zung der Fortbildungs<strong>in</strong>halte im Unterricht ergeben),<br />
• durch Ankündigung, Begleitung, Auswertung und Diskussion im Netz ergibt sich für die<br />
Teilnehmer e<strong>in</strong> hohes Maß an Transparenz und Unterstützung.<br />
Unser kreativer Schwerpunkt im visuellen Bereich (Illustration von Texten, Bearbeiten<br />
von Bildern, digitale Fotografie und digitales Video) wurde nun auch <strong>in</strong> drei überregionalen<br />
Workshops deutlich (Homepage mit Freeway II, Hollywood für E<strong>in</strong>steiger, Toy-Story selbstge-<br />
macht), die im Netz begleitet wurden (siehe www.schulvision.de). Hierzu muss kritisch ange-<br />
31
32<br />
merkt werden, dass sich die Umsetzung im Unterricht durch Fortbildungsteilnehmer und auch<br />
durch uns selbst schwieriger gestaltete als erwartet. Speziell Videoprojekte s<strong>in</strong>d nur außerhalb<br />
des regulären Unterrichts und mit e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>eren Schülergruppe zu realisieren.<br />
Auch bei den wöchentlichen schul<strong>in</strong>ternen Workshops gab es e<strong>in</strong>e wichtige Veränderung:<br />
die Nachfrageorientierung. Das bedeutete, dass nun Themen und Fragen der Kollegen aufge-<br />
griffen wurden, die sich aus ihrem aktuellen Unterricht bzw. aus ihrer Unterrichtsvorbereitung<br />
ergeben hatten. Der themenoffene Workshop diente dazu Lösungen für alle kle<strong>in</strong>en und gro-<br />
ßen Probleme zu f<strong>in</strong>den, die im Alltag des Lehrers beim Umgang mit Computern und Internet<br />
nun e<strong>in</strong>mal auftauchen. Dies waren unter anderem:<br />
• Lösungen für technische Probleme und Beseitigung von Fragezeichen bei der Computerbe-<br />
dienung (z.B. Umgang mit Scannern, Digitalkameras, Druckern).<br />
• Austausch von Erfahrungen zum Computere<strong>in</strong>satz und geme<strong>in</strong>sames Ausprobieren von<br />
Ideen.<br />
• Entwickeln und Verabreden von geme<strong>in</strong>samen Unterrichtsvorhaben mit Computer und<br />
Internet.<br />
Über das Anbieten von Problemlösungsstrategien h<strong>in</strong>aus wurden Erfahrungen ausge-<br />
tauscht, Anregungen und Ideen gegeben und geme<strong>in</strong>sam ausprobiert. Wesentlich war also die<br />
Übertragbarkeit der Fortbildungs<strong>in</strong>halte auf den Unterricht. Über das Gel<strong>in</strong>gen dieser Umset-<br />
zung lassen sich Qualität und Nachhaltigkeit der Fortbildung evaluieren.<br />
Im dritten Projektjahr konnten nun auch e<strong>in</strong>e erste Zwischenbilanz gezogen und Ergebnisse<br />
des Projekts ForMeL G präsentiert werden. So fand <strong>in</strong> Gött<strong>in</strong>gen das offizielle Projekt-Review<br />
vor dem SEMIK-Lenkungsausschuss zusammen mit der Projektleiter<strong>in</strong> Dagmar Wilde und<br />
dem Kollegen Thomas Kahlki statt. Es folgten weitere Projekt-Präsentationen auf e<strong>in</strong>em Fo-<br />
rum <strong>zur</strong> Medienkompetenz im Offenen Kanal Berl<strong>in</strong>, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sem<strong>in</strong>ar zum E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong><br />
Medien <strong>in</strong> der Grundschule an der FU Berl<strong>in</strong>, auf dem Abschlusskongress des Forums Bildung<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>, auf der Bildungsmesse <strong>in</strong> Köln und auf der Benutzertagung <strong>in</strong> Ma<strong>in</strong>z.<br />
E<strong>in</strong> <strong>neuer</strong> Projektbestandteil ist seit Januar 2002 die NetzWerkstatt. Hierbei handelt es<br />
sich um regelmäßige Treffen der Projektmitarbeiter mit Kollegen der assoziierten Schulen und<br />
weiteren an der Zusammenarbeit <strong>in</strong>teressierten Schulen, die jeweils unter e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>haltlichen<br />
Schwerpunkt stehen. Es fanden bis Mitte 2002 vier NetzWerkstatt-Treffen statt, die auch auf<br />
SchulVision dokumentiert s<strong>in</strong>d.<br />
Perspektiven für das letzte Projektjahr (2002/03): Lernen <strong>in</strong> der vernetzten Lernumgebung<br />
Um das Medienkonzept der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule weiter zu profilieren, soll <strong>in</strong> diesem<br />
Schuljahr e<strong>in</strong> im Kollegenteam erarbeitetes schul<strong>in</strong>ternes Curriculum „Computer als Werk-<br />
zeug“ auf se<strong>in</strong>e Tauglichkeit geprüft werden. Für die Dauer der Probezeit des Curriculums ha-<br />
be ich begleitende Evaluationsmaßnahmen geplant, so dass am Ende des Schuljahres konkrete<br />
Aussagen über Realisierbarkeit im Unterricht e<strong>in</strong>es Schuljahres, Akzeptanz im Kollegium bzw.<br />
konkrete Änderungsvorschläge vorliegen werden. Auf Basis der Onl<strong>in</strong>e-Plattform „lo-net“<br />
soll versucht werden, noch stärker netzbasiert zu arbeiten. Dies soll sowohl auf der Fortbil-<br />
dungsebene, wie auch <strong>in</strong> der NetzWerkstatt Berl<strong>in</strong>, der NetzWerkstatt Re<strong>in</strong>ickendorf (Onl<strong>in</strong>e<br />
Plattform der Bezirksfachkonferenz „Neue Medien <strong>in</strong> der Grundschule“) und im Unterricht<br />
mit Schülern <strong>in</strong> virtuellen Klassenräumen den Kommunikationsaustausch der Teilnehmer un-<br />
tere<strong>in</strong>ander <strong>in</strong>tensivieren.
Drei Jahre ForMeL G <strong>in</strong> der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule<br />
Thomas Kahlki<br />
Rückblicke und Perspektiven im Mai 2002<br />
„Neues Lernen? Was ist das denn?“ Oder: Zielsetzungen und didaktisch-methodische Pr<strong>in</strong>zipien<br />
Es muss etwa 1977 gewesen se<strong>in</strong>, als ich an me<strong>in</strong>er damaligen Schule als 15-Jähriger an e<strong>in</strong>er<br />
Computer-AG teilnahm. E<strong>in</strong>en Computer der Marke „Wang“ mit Strichkartenleser, Kas-<br />
settenspeicherlaufwerk, 16 Kilobyte Arbeitsspeicher und Monochrom-Monitor zu besitzen,<br />
galt damals def<strong>in</strong>itiv als höchst ungewöhnliche High-Tech-Ausstattung für e<strong>in</strong>e Schule, und<br />
so war es ke<strong>in</strong> Wunder, dass unsere Schule als hochmoderne Modellschule galt, die sich im<br />
übrigen gleichzeitig bemühte, Pr<strong>in</strong>zipien der Reformpädagogik zu verwirklichen. In dieser<br />
AG beschäftigten wir uns im Team mit e<strong>in</strong>em Lehrer damit, e<strong>in</strong>e Mondlandungssimulation<br />
zu programmieren. Nicht, dass es wirklich e<strong>in</strong> authentisches Problem für uns gewesen wäre,<br />
e<strong>in</strong> Mondlandungsfahrzeug zu steuern, aber sehr schnell machten wir diese knifflige Aufgabe,<br />
als deren Ergebnis uns e<strong>in</strong> selbst erstelltes spannendes Computerspiel lockte, zu unserer ganz<br />
persönlichen Herausforderung, über der wir brüteten, bis die Köpfe rauchten. Wir zerbrachen<br />
uns dabei ke<strong>in</strong>eswegs nur die Köpfe über Fragen der Programmierung <strong>in</strong> „Basic“ oder die Tü-<br />
cken des E<strong>in</strong>lesens von Strichkarten. Viel größeren Raum nahm der notwendige physikalische<br />
und mathematische H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>, von dem wir Schüler aus dem Unterricht eigentlich kei-<br />
nen blassen Schimmer hatten. Anfangs hofften wir die nötigen Informationen (zum Beispiel<br />
die Berechnung der Fallgeschw<strong>in</strong>digkeit, die Frage, welche Auswirkung welcher Schub aus<br />
den Bremsraketen hat, die Überlegung wie man den Treibstoffvorrat berechnet usw.) durch<br />
geschicktes Fragen oder schlichte Faulheit aus unserem Lehrer ohne eigene Mühe herauszu-<br />
quetschen und uns schnellstens dem Spiel außerhalb der Schule h<strong>in</strong>geben zu können. Bald<br />
stellte sich aber heraus, dass er nicht gewillt war, mehr als Berater, Antreiber und Tippgeber<br />
zu se<strong>in</strong> und häufig auch genauso wie wir herumknobelte (oder zum<strong>in</strong>dest den Ansche<strong>in</strong> er-<br />
weckte), wie die Berechnungen und die Programmierung se<strong>in</strong> müssten und wie die Variablen<br />
sich gegenseitig bee<strong>in</strong>flussten, um am Ende e<strong>in</strong> funktionierendes Computerspiel zu haben. So<br />
blieb uns nichts anderes übrig, als unsere kargen Kenntnisse und etliche Schulbücher zusam-<br />
menzunehmen und uns alles Fehlende anzueignen, bis wir es - vermutlich unter Produktion<br />
tausender virtueller <strong>neuer</strong> Krater auf der Mondoberfläche - tatsächlich geme<strong>in</strong>sam geschafft<br />
hatten: Das Spiel war fertig!<br />
Heute - nach 25 Jahren - b<strong>in</strong> ich erstaunt, dass viele Grundgedanken unseres Projektes<br />
Formel G sich <strong>in</strong> dieser Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft im Jahr 1977 bereits angelegt fanden:<br />
• Authentizität und Problemorientierung durch Herstellung e<strong>in</strong>es Produktes, dass projektartig<br />
und fächerübergreifend hergestellt wird.<br />
• Lernen im sozialen Kontext, Förderung von Teamfähigkeit, Kooperation und Erfahrungs-<br />
austausch.<br />
• Förderung der Medienkompetenz der Schüler.<br />
33
34<br />
• Beschränkung der notwendigen Instruktion auf kurze, gezielte Phasen zugunsten von selbst-<br />
gesteuertem, kooperativem Lernen mit e<strong>in</strong>em hohen Anteil von Eigentätigkeit und eigener<br />
gedanklicher Konstruktion der Lernenden.<br />
• Wandel der Lehrer- und Schülerrolle; die Lehrenden strukturieren die Lernumgebung, agie-<br />
ren überwiegend als Berater und Tippgeber, Schüler werden zunehmend zu Gestaltern ihres<br />
eigenen Lernprozesses.<br />
„Das waren also me<strong>in</strong>e Herbstferien...“ Oder: Schaffung der notwendigen technischen Infrastruktur<br />
Endlich war es soweit: Lange Zeit hatten wir neben unserem e<strong>in</strong>zigen neuwertigen „Schulen-<br />
ans-Netz“-Rechner mit Internetanschluss nur mit veralteten, gebrauchten, über verschiedene<br />
Spenden von Firmen und Privatpersonen zusammengeklaubten Computern arbeiten können.<br />
Obwohl es an allem fehlte, waren uns damit trotzdem beachtliche und erfolgreiche Unter-<br />
richtsprojekte gelungen. Nun, am vorletzten Tag vor den Herbstferien 1998, stand der lang<br />
ersehnte Lastwagen mit neun von Schulen ans Netz gesponserten iMacs vor der Tür. Geme<strong>in</strong>-<br />
sam mit me<strong>in</strong>em Schulleiter und mehreren Vätern machte ich mich die Herbstferien über<br />
daran, die Geräte auszupacken, aufzustellen, Netzwerkkabel zu verlegen, Software zu <strong>in</strong>stal-<br />
lieren, geeignete Tische und Stühle durch die Schule zu transportieren, das Netzwerk, den In-<br />
ternetzugang und e<strong>in</strong>en Router e<strong>in</strong><strong>zur</strong>ichten und alle Geräte <strong>in</strong>ternetfähig zu machen. Schließ-<br />
lich sollte direkt nach den Herbstferien der erste Internet-Basiskurs für Kolleg<strong>in</strong>nen unserer<br />
Schule starten. Und auf ke<strong>in</strong>en Fall wollten wir, dass es uns so ergehen würde wie manch an-<br />
deren Schulen, die - alle<strong>in</strong>gelassen mit den gelieferten Kartons - viele Monate brauchten, um<br />
die neuen Geräte <strong>in</strong> Betrieb nehmen zu können.<br />
In diesem Er<strong>in</strong>nerungssplitter bildet sich e<strong>in</strong>e Situation ab, die sich wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> allen<br />
Formel-G-Projektschulen ähnlich zeigte: In der Projektvorbereitungsphase 1998 und im ersten<br />
Projektjahr 1999/2000 musste extrem viel Zeit aufgebracht werden, um Fortbildungsräume<br />
und die ersten Medienecken <strong>in</strong> den Klassenräumen aufzubauen, e<strong>in</strong><strong>zur</strong>ichten und <strong>in</strong> der Folge<br />
zu warten und zu verwalten. Dies alles, ohne dass wir Projektmitarbeiter dafür ausgebildet<br />
oder besonders qualifiziert gewesen wären, ohne Entlastung durch externe Fachkräfte und oh-<br />
ne, dass im Projektdesign dafür Ressourcen vorgesehen waren. Trotzdem war die Schaffung<br />
der technischen Infrastruktur für Fortbildungen unter E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien e<strong>in</strong>e unabd<strong>in</strong>gba-<br />
re Voraussetzung, um die Projektarbeit überhaupt aufnehmen zu können. Andere Aufgaben<br />
mussten sich diesem Umstand zeitweise unterordnen.<br />
„Unterricht auf Flur und Schulhof? Klar!“- Oder: Raumkonzept und Schulentwicklung<br />
Ursprünglich aus unserer Raumnot geboren, war schnell klar, dass <strong>in</strong> unserer Schule ke<strong>in</strong>e<br />
Möglichkeit bestand, mit separaten Computerfachräumen zu arbeiten. Mit unseren ersten<br />
neuen Computern richteten wir <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en Gruppenraum unseren Fortbildungsraum<br />
e<strong>in</strong>, der von den angrenzenden Klassen rege mitbenutzt wurde. Darüber h<strong>in</strong>aus setzten wir<br />
von vornhere<strong>in</strong> (ohne, dass dies zu diesem Zeitpunkt schon das allgeme<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Praxis an-<br />
erkannte und angewandte Konzept gewesen wäre) auf Computer- und Medienecken <strong>in</strong> den<br />
Klassenräumen.<br />
Im Juni 2002 besteht die Computerausstattung der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule mittler-<br />
weile aus 50 Mac<strong>in</strong>tosh-Computern und 25 W<strong>in</strong>dows-PCs. Alle Computer bef<strong>in</strong>den sich im
stationären oder drahtlosen Netzwerk der Schule und haben Zugang zum Schulserver und<br />
zum Internet. Bei uns gibt es drei Computergruppenräume mit jeweils ca. acht Computern.<br />
In diesen Räumen können maximal 16 K<strong>in</strong>der gleichzeitig arbeiten. Fast alle Klassenräume<br />
<strong>in</strong> der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule haben e<strong>in</strong>e Medienecke mit 2-3 Computern (iMacs oder<br />
PCs), e<strong>in</strong>em Scanner und e<strong>in</strong>em Drucker. In den Medienecken können Projekte von kle<strong>in</strong>eren<br />
Schülergruppen bearbeitet werden, während die übrigen K<strong>in</strong>der ihre sonstigen Aufgaben er-<br />
ledigen. Falls weitere Computer benötigt werden, können die umliegenden Klassen, die Com-<br />
puterräume und die mobilen iBooks mitbenutzt werden. Unsere Schule verfügt über <strong>in</strong>sgesamt<br />
25 tragbare iBooks, die über das drahtlose Netzwerk von jedem Ort im Gebäude aus Zugang<br />
zum Server und zum Internet haben. So kann der Unterricht durchaus auch mal auf dem Flur<br />
oder auf dem Schulhof stattf<strong>in</strong>den... Die mobilen Geräte können jederzeit <strong>in</strong> der für das ge-<br />
plante Unterrichtsvorhaben benötigten Anzahl <strong>in</strong> den Computerräumen abgeholt werden.<br />
Diese auf den ersten Blick re<strong>in</strong> technischen Entscheidungen unterstützen pädagogische Ziel-<br />
setzungen:<br />
• Die Klassenraumgrenzen werden aufgehoben, e<strong>in</strong>e Kultur der „offenen Tür“ entwickelt<br />
sich.<br />
• Die Kooperation zwischen Schülern verschiedener Klassen und zwischen den Lehrern wird<br />
gefördert.<br />
• Projektorientierte und fächerübergreifende Unterrichtsformen werden durch die flexible<br />
Raumorganisation und die jederzeitige Verfügbarkeit <strong>neuer</strong> Medien unterstützt.<br />
• Erste Schritte zu jahrgangsübergreifenden Unterrichtsformen werden möglich.<br />
„Wie viele Zehen hat das Meerschwe<strong>in</strong>chen?“ Oder: Unterrichtskonzepte entwickeln und<br />
erproben<br />
„Computer und Internet s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule nicht Zweck des Unter-<br />
richts, sondern kreative und vielseitige Werkzeuge im Lernprozess. Sie werden von den K<strong>in</strong>-<br />
dern (ebenso wie Bücher, Buntstifte oder Papier) ganz selbstverständlich <strong>zur</strong> Herstellung eige-<br />
ner Produkte - z. B. liebevoll gestalteter „Meerschwe<strong>in</strong>stories“ - benutzt. Gerne präsentieren<br />
die K<strong>in</strong>der ihre Ergebnisse <strong>in</strong> der Klasse oder auf den Internet-Seiten der Schule.“ (Zitat aus<br />
e<strong>in</strong>er Informationsschrift der Schule.)<br />
In der Vorbereitungsphase und auch während des ersten Projektjahres nahm die Entwick-<br />
lung und Erprobung von Unterrichtskonzepten unter E<strong>in</strong>beziehung der neuen Medien für<br />
mich e<strong>in</strong>en großen Raum e<strong>in</strong>. Nur auf der Grundlage eigener umfangreicher Unterrichtser-<br />
fahrungen konnte ich praxisnahe Fortbildungen mit dem Anspruch, Kompetenzen für den<br />
E<strong>in</strong>satz der neuen Medien im Unterricht und Elemente e<strong>in</strong>er neuen Lernkultur zu vermitteln,<br />
s<strong>in</strong>nvoll planen und durchführen. So entstanden <strong>in</strong> dieser Zeit zahlreiche Beispiele für Unter-<br />
richtsprojekte und -aktivitäten. Als Beispiel seien hier unter vielen Projekten die „M<strong>in</strong>i-Mu-<br />
wies”, (kle<strong>in</strong>e Multimedia-Projekte wie „Berl<strong>in</strong>filme“, „Die Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> auf der Erbse“, „Ge-<br />
müsefilm“, „Ich“-Filme ) genannt. Unterrichtsprojekte s<strong>in</strong>d zum Teil auf der Schulhomepage<br />
(www.b.shuttle.de/b/l<strong>in</strong>dgrengs) und den Schulvision-Seiten (www.schulvision.de) dokumen-<br />
tiert. Auch <strong>in</strong> den folgenden Projektjahren blieb die <strong>Entwicklung</strong> von unterrichtspraktischen<br />
Umsetzungen „<strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong> <strong>in</strong> der Grundschule unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im<br />
Klassenraum“ e<strong>in</strong>e unabd<strong>in</strong>gbare Voraussetzung für die Fortbildungsaktivitäten.<br />
35
36<br />
„E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Mausbedienung (Teil 3)?“ Oder: Fortbildungsformen ändern sich<br />
In der Vorbereitungsphase und im ersten Projektjahr nahmen schul<strong>in</strong>terne Basiskurse <strong>zur</strong><br />
grundlegenden Bedienung von Textverarbeitungssoftware wie „AppleWorks“, zum Umgang<br />
mit Internet und E-Mail und <strong>zur</strong> e<strong>in</strong>fachen digitalen Bildbearbeitung <strong>in</strong> der Fortbildungsar-<br />
beit noch e<strong>in</strong>en breiten Raum e<strong>in</strong>. Inhaltlich standen hier die Möglichkeiten <strong>zur</strong> Verwendung<br />
für die eigene Unterrichtsvorbereitung im Vordergrund. Der E<strong>in</strong>satz im eigenen Klassenraum<br />
stellte für die meisten Teilnehmer jedoch - obgleich für die Zukunft viel Interesse daran be-<br />
stand - noch e<strong>in</strong>e Überforderung dar. Obwohl SEMIK-Projektziele auch hier bereits teilweise<br />
verwirklicht wurden (so zum Beispiel durch e<strong>in</strong>en hohen Anteil an Eigentätigkeit, die häufige<br />
Zurücknahme des Fortbildenden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e beratende und helfende Funktion, kooperative Ar-<br />
beitsformen wie zum Beispiel Partnerarbeit und die Erstellung eigener Produkte), handelte es<br />
sich bei diesen Kursen noch um eher lehrgangsähnlich konzipierte Lernangebote. Sehr schnell<br />
bestätigte sich jedoch der - mit e<strong>in</strong>er Fragebogenumfrage im Kollegium untermauerte - E<strong>in</strong>-<br />
druck, dass Basiskurse zwar gerade für Anfänger im Umgang mit neuen Medien s<strong>in</strong>nvolle<br />
Hilfen und Unterstützung bieten können, auf Dauer jedoch eher andere Bedürfnisse als die<br />
vorwiegend technische Basisschulung <strong>in</strong> den Vordergrund treten, nämlich:<br />
• die praktische Unterstützung beim E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien im Klassenraum,<br />
• Fortbildungsangebote auf der Ebene didaktischer und methodischer Fragen,<br />
• kurzfristige Hilfestellung bei aktuellen (meist eher technischen oder methodischen) Proble-<br />
men<br />
Dieser Erkenntnis wollte ich im zweiten Projektjahr ab September 2000 durch e<strong>in</strong>e verstärkte<br />
Ausrichtung me<strong>in</strong>er Fortbildungen auf Formen wie Tutor<strong>in</strong>g, Co-Teach<strong>in</strong>g und Workshops<br />
gerecht werden.<br />
Co-Teach<strong>in</strong>g<br />
Co-Teach<strong>in</strong>g bedeutet, dass ich geme<strong>in</strong>sam mit e<strong>in</strong> bis zwei im Umgang mit den neuen Me-<br />
dien weniger erfahrenen Kollegen Unterrichtsprojekte plane, diese <strong>in</strong> ihren Klassen im Team<br />
durchführe und anschließend geme<strong>in</strong>sam Ergebnisse und aufgetretene Probleme mit ihnen<br />
reflektiere.<br />
Workshop<br />
Dies ist e<strong>in</strong>e nachfrageorientierte und themenoffene Fortbildungsform für kle<strong>in</strong>ere Gruppen<br />
aus den Kollegien der Projektschulen. Hier können sich die Teilnehmer für aktuelle Fragen<br />
und Probleme aus ihrer Unterrichtspraxis (zum Beispiel „Wie kann ich die Digitalkamera für<br />
me<strong>in</strong>en Biologieunterricht e<strong>in</strong>setzen?“ oder „Ich möchte für e<strong>in</strong>e E-Mail-Partnerschaft ‚Steck-<br />
briefe‘ mit verfremdeten Porträtfotos herstellen...“ gezielt Unterstützung e<strong>in</strong>holen, um diese<br />
Anregungen anschließend <strong>in</strong> ihrem Unterricht (selbständig oder im Co-Teach<strong>in</strong>g) umzusetzen.<br />
Tutor<strong>in</strong>g<br />
Hier handelt es sich um e<strong>in</strong>e oft kurzfristig verabredete Fortbildungsform, <strong>in</strong> der kle<strong>in</strong>e Pro-<br />
bleme meist technischer oder methodischer Natur - wie beispielsweise Drucker- oder Scan-<br />
nerprobleme - beim E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong>nerhalb von 10 - 30 M<strong>in</strong>uten bearbeitet werden.
Das von mir angestrebte Ziel ist die Hilfe <strong>zur</strong> Selbsthilfe, das heißt die Teilnehmer sollen<br />
beispielsweise anschließend selbständig Druckerprobleme und andere kle<strong>in</strong>e technische Fehler<br />
beseitigen oder Fragen <strong>zur</strong> Internetnutzung oder <strong>zur</strong> Arbeit mit AppleWorks klären können.<br />
Diese Veränderungen <strong>in</strong> der Art und Gewichtung der Fortbildungsangebote trafen offenbar<br />
passgenau die Bedürfnisse der Zielgruppe. Viele Fortbildungsteilnehmer nahmen seit Septem-<br />
ber 2000 regelmäßig und mehrfach solche Fortbildungen <strong>in</strong> Anspruch. Der E<strong>in</strong>satz von Com-<br />
putern und Internet <strong>in</strong> der Unterrichtsvorbereitung und <strong>in</strong> Unterrichtsprojekten nahm bei den<br />
Teilnehmern anschließend deutlich zu und schlug sich beispielsweise <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er großen Zahl von<br />
im Co-Teach<strong>in</strong>g durchgeführten Unterrichtsprojekten nieder.<br />
„E<strong>in</strong> Moderator für 70 Grundschulen????“ Oder: Schwerpunktsetzung und Teambildung<br />
Von der ursprünglichen Vorstellung, die ich zu Beg<strong>in</strong>n des Projektzeitraumes verfolgt hatte,<br />
nämlich mit Fortbildungsangeboten <strong>in</strong>nerhalb der Regionen sehr schnell sehr viele Schulen<br />
und e<strong>in</strong>e große Zahl von Kollegen zu erreichen und nachhaltige Effekte zu erzielen, habe ich<br />
mich für „me<strong>in</strong>e“ Region bald getrennt. Dafür waren verschiedenen Gründe und Überlegun-<br />
gen ausschlaggebend:<br />
• Prozesse und <strong>Entwicklung</strong>sschritte erforderten wesentlich mehr Zeit als <strong>in</strong> der Projektgrup-<br />
pe ursprünglich angenommen worden war, - zum Beispiel die Schaffung der notwendigen<br />
technischen Infrastruktur (dies schon alle<strong>in</strong>e an der Fortbildungsschule, von allen anderen<br />
Grundschulen ganz zu schweigen).<br />
• Zeitraubende Basisschulungen <strong>in</strong> der grundlegenden Bedienung von Computern und Pro-<br />
grammen waren zu Beg<strong>in</strong>n des Projektzeitraums noch unvermeidlich.<br />
• Nachhaltigkeit entsteht me<strong>in</strong>er Erfahrung nach nur dort, wo Fortbildungsteilnehmer die<br />
gewonnenen Erkenntnisse auch sofort im eigenen Unterricht umsetzen können und dafür<br />
möglichst auch im weiteren Verlauf Rat und Hilfe e<strong>in</strong>holen können.<br />
• Die me<strong>in</strong>es Erachtens für das nachhaltige Erreichen der SEMIK-Ziele günstigeren Fortbil-<br />
dungsformen (Workshop, Co-Teach<strong>in</strong>g, Tutor<strong>in</strong>g) erfordern kle<strong>in</strong>ere Fortbildungsgruppen<br />
als dies <strong>in</strong> kursartigen Veranstaltungen der Fall se<strong>in</strong> kann.<br />
• Nachhaltigkeit kann nicht bedeuten, dass viele Schulen und Kollegen auf mich angewiesen<br />
s<strong>in</strong>d, sondern ist erst überall dort zu erzielen, wo es mir gel<strong>in</strong>gt, mich wieder „überflüssig zu<br />
machen“.<br />
Diese Beobachtungen und Erfahrungen veranlassten mich dazu, vorerst möglichst nach-<br />
haltige Umsetzungen vor Ort - also <strong>in</strong> den bisherigen Projektschulen - anzustreben, um diese<br />
Erfahrungen dann auf e<strong>in</strong>e - zunächst kle<strong>in</strong>e - Anzahl von kooperierenden Schulen <strong>in</strong> der<br />
Region zu übertragen. Insbesondere legte ich e<strong>in</strong>en Schwerpunkt me<strong>in</strong>er Tätigkeit auf die<br />
Fortbildung e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>eren Gruppe von besonders <strong>in</strong>teressierten Kollegen me<strong>in</strong>er eigenen<br />
Schule, von denen ich hoffte, dass sie im Anschluss an die erfolgreiche Bildung e<strong>in</strong>es solchen<br />
„Computerteams“ ihrerseits Fortbildungsaufgaben <strong>in</strong>nerhalb und außerhalb der Schule über-<br />
nehmen könnten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass diese Fokussierung<br />
auf die Fortbildung e<strong>in</strong>es Computerteams von ca. zwölf Kollegen und Kolleg<strong>in</strong>nen positive<br />
und nachhaltige Ergebnisse mit sich brachte. So werden häufig kle<strong>in</strong>ere Fortbildungsaktivi-<br />
täten (Tutor<strong>in</strong>g/Co-Teach<strong>in</strong>g) <strong>in</strong>nerhalb der Schule von Teammitgliedern durchgeführt. Vier<br />
Mitglieder des Teams konnten mit Beg<strong>in</strong>n des Schuljahres 2001/2002 schul<strong>in</strong>tern mit Ent-<br />
lastungsstunden versehen werden, damit sie ihre Kenntnisse und Erfahrungen <strong>in</strong> besonderem<br />
37
38<br />
Maße <strong>in</strong> kollegiums<strong>in</strong>terne Fortbildungen (<strong>in</strong>sbesondere Tutor<strong>in</strong>g und Co-Teach<strong>in</strong>g) und Un-<br />
terstützung bei der technischen und adm<strong>in</strong>istrativen Betreuung des Computernetzwerkes e<strong>in</strong>-<br />
br<strong>in</strong>gen. Me<strong>in</strong>em Ziel, „mich überflüssig zu machen“ sche<strong>in</strong>e ich damit zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er<br />
eigenen Schule e<strong>in</strong> Stück näher gekommen zu se<strong>in</strong>.<br />
„Regional, überregional, <strong>in</strong>ternational…“ Kooperationen und Teambildung off- und onl<strong>in</strong>e<br />
Mit Frieder Klapp, dem Projektmitarbeiter an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-<br />
Re<strong>in</strong>ickendorf hatte ich schon lange vor dem Projektstart und auch während der ersten bei-<br />
den Projektjahre Ideen ausgetauscht und Konzepte entwickelt. So lag es nahe, dass diese lang-<br />
jährige Zusammenarbeit gegen Ende des 2. Projektjahres dann auch „offiziell“ <strong>zur</strong> Bildung<br />
e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen Fortbildungs-Teams führte. Seitdem f<strong>in</strong>den viele unserer Workshops mit<br />
Teilnehmern aus verschiedenen Schulen im Team statt. E<strong>in</strong> wichtiges Ergebnis dieser Koope-<br />
ration (neben unseren geme<strong>in</strong>samen „Auftritten“ bei mittlerweile zahlreichen Präsentationen<br />
unseres Projektes bei verschiedenen Anlässen) s<strong>in</strong>d die von uns gestalteten Internet-Seiten<br />
„SchulVision - die Internet-Portalseite für LehrerInnen“ (www.schulvision.de) und „MoMo<br />
- die Internet-Mitmachseite für SchülerInnen“ (www.momodo.de).<br />
Grundgedanke beider Projekte ist die Verb<strong>in</strong>dung von ortsgebundenem Lernen mit den<br />
<strong>in</strong>teraktiven Möglichkeiten und Chancen <strong>neuer</strong> Medien. Während MoMo sich vorwiegend an<br />
Schüler wendet (bzw. Lehrern e<strong>in</strong>e im Unterricht nutzbare Internet-Seite <strong>zur</strong> Verfügung stellt,<br />
zum Beispiel zum Thema „Rund um‘s Rad“) ist es der Ansatz von SchulVision, unsere Fort-<br />
bildungsaktivitäten im Internet zu unterstützen. Man kann sich auf den Seiten von SchulVi-<br />
sion nicht nur onl<strong>in</strong>e über geplante Fortbildungen <strong>in</strong>formieren und dafür anmelden, sondern<br />
dort auch unterstützende Materialien e<strong>in</strong>sehen und im Anschluss an die Veranstaltung Hilfe<br />
e<strong>in</strong>holen, Nachfragen stellen oder Rückmeldungen geben. Auch Fortbildungsnachfragen s<strong>in</strong>d<br />
dort sehr willkommen.<br />
E<strong>in</strong> <strong>neuer</strong> Projektschwerpunkt ist seit Januar 2002 die „NetzWerkstatt“. Hierbei handelt<br />
es sich um regelmäßige Treffen der Projektmitarbeiter mit <strong>in</strong>teressierten Kollegen zu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>-<br />
haltlichen Schwerpunkt, die dem Erfahrungsaustausch und der Förderung von Kooperationen<br />
dienen sollen. Bisher fanden vier NetzWerkstatt-Treffen <strong>in</strong> verschiedenen Schulen statt, die er-<br />
freulicherweise auch von Kollegen besucht wurden, die nicht aus dem engeren Kreise der dem<br />
Projekt verbundenen Schulen stammten. Auch diese überbezirkliche Kooperation wollen wir<br />
versuchen, mit Hilfe der Onl<strong>in</strong>e-Plattform „lo-net“ durch <strong>in</strong>ternetbasierte, „virtuelle“ Kom-<br />
munikations- und Arbeitsmöglichkeiten zu ergänzen.
Zwischenbilanz der Schwielowsee-Grundschule<br />
Brigitte Meier<br />
Vorbemerkung<br />
Im Grundschulbereich hat <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong> grundlegender Wandel <strong>in</strong> der Beurteilung<br />
des Computere<strong>in</strong>satzes stattgefunden. Sowohl von Seiten der Politiker als auch der Lehrkräfte<br />
wird der didaktisch überlegte E<strong>in</strong>satz des Computers begrüßt.<br />
Für die Kollegien besteht e<strong>in</strong> erheblicher Qualifizierungsbedarf. Es wird daher <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> e<strong>in</strong><br />
Programm für die Fortbildung entwickelt, das auf schulnahen Multiplikatoren beruht. In den<br />
sechs ausgewählten Schwerpunktgrundschulen besteht die Aufgabe des Multiplikators zum ei-<br />
nen dar<strong>in</strong>, das Kollegium bei der Nutzung der neuen Medien zu beraten und zu unterstützen,<br />
zum anderen dar<strong>in</strong>, für <strong>in</strong>teressierte Lehrer der Region als Ansprechpartner zu fungieren.<br />
In der Schwielowsee-Grundschule, die heute e<strong>in</strong>e der Schwerpunktschulen ist, nahm die<br />
Idee des „Fortbildungsnetzwerkes Grundschulen“ ihren Anfang. Bärbel Nicolas begründete<br />
bereits 1993 e<strong>in</strong>e Schreibwerkstatt mit Computern neben anderen Schreibgeräten wie Frei-<br />
net-Druckereien, Stempelkästen, kalligraphischen Werkzeugen und natürlich Stiften. Ihrem<br />
Engagement ist es zu verdanken, dass der Projektantrag bei „Schulen ans Netz“ mit dem Titel<br />
„Schul<strong>in</strong>terne und schulortnahe Computerfortbildung – Pädagogen, Eltern und K<strong>in</strong>der lernen<br />
mite<strong>in</strong>ander und vone<strong>in</strong>ander“ bewilligt wurde. Erste Erfahrungen mit Fortbildungsangebo-<br />
ten lagen bereits vor, als 1998 die Bewerbung für das BLK-Programm SEMIK erfolgte.<br />
Didaktische Leitpr<strong>in</strong>zipien für die Fortbildungen waren und s<strong>in</strong>d:<br />
• Problemorientiertes Lernen durch ausgewogenen Wechsel von Instruktion und Konstruktion<br />
• Lernen anhand authentischer Probleme, die spezifischen Bed<strong>in</strong>gungen der Teilnehmer be-<br />
rücksichtigend<br />
• Selbstgesteuertes, kooperatives Lernen<br />
• Implementierung e<strong>in</strong>er Feedbackkultur<br />
• Transfer auf die konkrete Arbeit <strong>in</strong> den Klassen<br />
Inwiefern diesen Leitideen an der Schwielowsee-Grundschule Rechnung getragen wird, wel-<br />
che situativen Bed<strong>in</strong>gungen herrschen und welche Perspektiven es gibt, versuche ich im Fol-<br />
genden darzustellen.<br />
Die Schulsituation<br />
Die Schwielowsee-Grundschule ist e<strong>in</strong>e Schule mit Ganztagsbetreuung und bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> ei-<br />
nem sozialen Brennpunktgebiet Berl<strong>in</strong>s. Der Anteil der Schüler nichtdeutscher Herkunftsspra-<br />
che liegt bei 54%. Zum Kollegium gehören 49 Lehrer und 15 Erzieher. (Das Durchschnitts-<br />
alter beträgt 51 Jahre - wie an fast allen im ehemaligen Westteil der Stadt liegenden Schulen.)<br />
Die Schule ist dreizügig. Als e<strong>in</strong> besonderes pädagogisches Modell wird im Anfangsunterricht<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zug die E<strong>in</strong>gangsstufe (0. und 1. Klasse mit e<strong>in</strong>er Frequenz von maximal 15 Schü-<br />
lern) praktiziert. Ab der 3. Klasse gibt es die Frühbegegnungssprache Englisch oder Fran-<br />
zösisch, außerdem gehören Angebote wie Psychomotorik, Sportarbeitsgeme<strong>in</strong>schaften, e<strong>in</strong><br />
Schulgarten, Musik- und Tanzgruppen, e<strong>in</strong>e Töpferwerkstatt zum schulischen Leben. Mehrere<br />
Kolleg<strong>in</strong>nen haben sich <strong>in</strong> Kursen zu Montessori-Pädagogen ausbilden lassen und besonders<br />
39
40<br />
im E<strong>in</strong>gangsstufen- und Primarbereich wird e<strong>in</strong> besonderes Augenmerk auf die Arbeit mit al-<br />
len S<strong>in</strong>nen gelegt. Manche Neuerungen wie DaZ (Deutsch als Zweitsprache), WUV (Wahlun-<br />
terricht verpflichtend) oder – im Schuljahr 2001/02202 - äußere Differenzierung <strong>in</strong> Klasse 5/6<br />
werden mit viel Engagement umgesetzt.<br />
Und nun sollten sich die Kollegen auch noch mit dem Computere<strong>in</strong>satz beschäftigen?<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>er „E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> die alltägliche<br />
Unterrichtspraxis“<br />
Am Anfang gab es die Schreibwerkstatt – und e<strong>in</strong> paar „e<strong>in</strong>geweihte“ Kolleg<strong>in</strong>nen, die teils <strong>in</strong><br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften am Nachmittag, teils mit Kle<strong>in</strong>gruppen während des Unterrichtsvor-<br />
mittags diesen Raum benutzten. Der Andrang war groß, die Begeisterung der Schüler für die<br />
Computer enorm, die als Werkzeuge für die kreative Umsetzung eigener Ideen, ob mit Mal-<br />
oder Textverarbeitungsprogrammen, verwendet wurden. Es fand hier explizit ke<strong>in</strong>e Software-<br />
schulung statt. Die <strong>in</strong>haltliche Arbeit und der entdeckende Umgang standen im Vordergrund,<br />
nicht das Kennenlernen aller Raff<strong>in</strong>essen e<strong>in</strong>es Programms.<br />
In e<strong>in</strong>igen Klassen wurden die Schreibmasch<strong>in</strong>en nach und nach durch privat ausrangierte<br />
Rechner ersetzt, bald kam noch e<strong>in</strong>e Spende e<strong>in</strong>er Firma h<strong>in</strong>zu, sodass <strong>in</strong> 16 Klassen Com-<br />
puter (meist e<strong>in</strong>fachsten Standards) standen. Diese Rechner wurden je nach Vorliebe der<br />
Kollegen „nur“ als Schreibmasch<strong>in</strong>enersatz benutzt oder mit arbeitsspeicherfreundlichen,<br />
diskettenfähigen Lernprogrammen bestückt. Gedruckt werden konnte meist nur privat, da die<br />
Klassen nicht über e<strong>in</strong>en Drucker verfügten. E<strong>in</strong>e erhebliche Anzahl von Kolleg<strong>in</strong>nen besuchte<br />
zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten Computerkurse, die von dem bankeigenen Vere<strong>in</strong> „Ju-<br />
gend und Computer“ angeboten wurden.<br />
E<strong>in</strong> großer Schub erfolgte im Schuljahr 1998/1999 <strong>in</strong> dem Moment, als die Schwielowsee-<br />
Grundschule dann selbst über e<strong>in</strong>en gut ausgestatteten Fortbildungsraum verfügte, der durch<br />
Projektmittel von „Schulen ans Netz“, Spenden der Firma Apple und schuleigene Ressourcen<br />
ausgestattet werden konnte. Bärbel Nicolas leitete die ersten E<strong>in</strong>führungskurse. Von Anfang<br />
an war klar, dass es hier nicht nur darum gehen sollte, Lehrer im Umgang mit Hard- und<br />
Software zu schulen, sondern sie zu befähigen, den Computer als Werkzeug im täglichen<br />
Unterricht zu nutzen. Die Kursteilnehmer erhielten Denkanstöße und Anregungen über die<br />
vielfältigen Möglichkeiten, die der Computer für e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle Förderung der Schüler, für<br />
selbstgesteuertes, schülerzentriertes Lernen, für fächerübergreifenden Unterricht bietet.<br />
Der Wunsch vieler Kollegen war es nun, leistungsfähigere Computer <strong>in</strong> die vorhandenen Me-<br />
dienecken der Klassenräume zu bekommen. Mit wachsender Hardwareausstattung erhöhte<br />
sich der Bedarf an Beratung und Unterstützung des Kollegiums. Mit Beg<strong>in</strong>n des Schuljahres<br />
1999/2000 stieg die Schwielowsee-Grundschule <strong>in</strong> das SEMIK-Projekt ForMeL G e<strong>in</strong>. Zu<br />
diesem Zeitpunkt begann ich, die ich bisher <strong>in</strong> manchen Kursen als Teilnehmer<strong>in</strong> me<strong>in</strong> Com-<br />
puterwissen vertieft hatte und schon über mehrere Jahre e<strong>in</strong>en alten Rechner während der<br />
Frei- und Wochenplanarbeit (hauptsächlich zum Geschichtenverfassen) e<strong>in</strong>setzte, zunächst <strong>in</strong><br />
Kooperation mit B. Nicolas, später alle<strong>in</strong>, Fortbildungsveranstaltungen zu planen und durch-<br />
zuführen - ich wurde Multiplikator<strong>in</strong>.<br />
Wenn ich an unsere ersten Teamsitzungen <strong>zur</strong>ückdenke, er<strong>in</strong>nere ich mich gut, wie s<strong>in</strong>nleer<br />
die Schlagworte „Medienkompetenz“, „neue Lernkultur“ und „Schulentwicklung“ damals<br />
für mich waren. Mit e<strong>in</strong>em unserer selbst gewählten Evaluationsschwerpunkte „Akzeptanz
und Motivation“ konnte ich jedoch gleich etwas anfangen. Schließlich hatte ich vor, die Kol-<br />
legen <strong>in</strong> Schule und Region für den E<strong>in</strong>satz des Computers im Unterricht zu begeistern.<br />
Dann g<strong>in</strong>g‘s richtig los! Um die Fortbildungsangebote auf die spezifischen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
der Teilnehmer abzustimmen, e<strong>in</strong>e Teilnehmerorientierung zu praktizieren, wurden Fragebö-<br />
gen entwickelt, um den Fortbildungsbedarf und die Wünsche zu ermitteln. Diese Fragebögen<br />
erhielten neben den Lehrerkollegen selbstverständlich auch die an der Schule arbeitenden<br />
Erzieher<strong>in</strong>nen. Darüber h<strong>in</strong>aus befragten wir Eltern und Schüler. Es waren Kurse vorgesehen,<br />
<strong>in</strong> denen Pädagogen, Eltern und K<strong>in</strong>der geme<strong>in</strong>sam lernen sollten - mite<strong>in</strong>ander und vone<strong>in</strong>-<br />
ander. Die zunächst durchgeführten Kurse beschäftigten sich dem Bedarf entsprechend mit<br />
der Vermittlung technischer Basisfertigkeiten. An diesen Kursen nahmen annähernd 50%<br />
des Kollegiums teil und etwa 30 Eltern-Schüler-Paare. Nachdem der Bedarf an so genannten<br />
„E<strong>in</strong>führungskursen“ <strong>in</strong> der eigenen Schule erst e<strong>in</strong>mal gedeckt war, nahmen an vier folgen-<br />
den Fortbildungen 40 Lehrer aus der Region teil. In Richtung auf e<strong>in</strong>es der Ziele des Projekts,<br />
nämlich die Erweiterung der Medienkompetenz, waren wir schon nach Ablauf des ersten<br />
Projektjahres deutlich vorangekommen. Das Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g basaler Grundfertigkeiten im Umgang<br />
mit dem Computer erfolgte stets an praxisnahen Beispielen. Den Zugang zum notwendigen<br />
technischen Know-how versuchten wir über die Arbeit an pädagogisch bedeutsamen Inhalten<br />
zu erleichtern, an Inhalten, die e<strong>in</strong>en direkten Bezug <strong>zur</strong> Lebenswirklichkeit der Teilnehmer<br />
hatten. So wurden neben Elternbriefen, Klassenlisten auch e<strong>in</strong>fache Spielpläne für Lernspiele<br />
mit Grafikelementen aus dem Programm AppleWorks erstellt. In Phasen der Instruktion beka-<br />
men die Kursteilnehmer E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> die „Geheimnisse“ e<strong>in</strong>es Programms, und sie hatten stets<br />
Gelegenheit, <strong>in</strong> Phasen der Konstruktion eigenständig und kooperativ mit dem Programm zu<br />
experimentieren.<br />
Möglichst oft erhielten die Teilnehmer Anleitungsskripte, nach denen sie sich im <strong>in</strong>divi-<br />
duellen Tempo voranarbeiten konnten. Regelmäßig fand e<strong>in</strong>e Feedbackrunde statt. Die Teil-<br />
nehmer äußerten ihre Me<strong>in</strong>ung <strong>zur</strong> Sitzung als „Blitzlicht“, beantworteten Kurzfragebögen,<br />
mitunter kamen auch Moderationselemente wie Kartenabfrage oder Punkteliste zum Tragen.<br />
So wurde jede der Fortbildungsreihen möglichst <strong>in</strong>dividuell auf die jeweilige Lerngruppe zu-<br />
geschnitten. Die Lehrer <strong>in</strong> den Fortbildungen erlebten sich selbst <strong>in</strong> der Situation der Lernen-<br />
den. Ihnen dies bewusst zu machen, ihr eigenes Lernen, die Irrwege, mögliche Strategien <strong>in</strong>s<br />
Bewusstse<strong>in</strong> zu rücken, ist e<strong>in</strong>e wichtige Erfahrung auf der Metaebene. Mit der Vermittlung<br />
von Medienhandhabungskompetenz, die die Facetten „Gestalten und Verbreiten eigener Me-<br />
dienprodukte“ umfasst, ist es jedoch nicht getan. Die medienpädagogische und -didaktische<br />
Kompetenz muss <strong>in</strong> den Blickpunkt gerückt werden. Diese Arbeit an den <strong>in</strong>haltlichen und<br />
didaktisch-methodischen Möglichkeiten der neuen Medien wurde zum Schwerpunkt me<strong>in</strong>er<br />
Arbeit ab Mitte des zweiten Projektjahres.<br />
Neue Formen der Fortbildung<br />
Akzeptanz und Motivation im Kollegium und auch bei vielen Lehrern der Region waren vor-<br />
handen. Aber: Die <strong>in</strong> der Fortbildung erworbenen Fertigkeiten <strong>in</strong> der Nutzung des Computers<br />
s<strong>in</strong>d noch ke<strong>in</strong>e Garantie dafür, dass die Ängste, den Computer im Unterricht e<strong>in</strong>zusetzen, ab-<br />
gebaut s<strong>in</strong>d. An die Stelle der Kurse im bisherigen Stil trat nun auf Wunsch der Kollegen e<strong>in</strong>e<br />
mehr <strong>in</strong>formelle, bedarfsorientierte Fortbildung <strong>in</strong> Form von Workshops, Tutor<strong>in</strong>g, Support<br />
on demand und Unterrichtsbegleitung (Co-Teach<strong>in</strong>g).<br />
41
42<br />
In e<strong>in</strong>igen Workshops entwickelte ich geme<strong>in</strong>sam mit den Teilnehmern Unterrichtsvorhaben,<br />
<strong>in</strong> denen der Computer oder die Digitalkamera e<strong>in</strong>e unterstützende Rolle spielen könnten.<br />
Der Austausch von Ideen, die verschiedenen Ansätze der Problemlösung führten zu e<strong>in</strong>er<br />
fruchtbaren Zusammenarbeit und zu e<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong> als befriedigend empfundenen Arbeitsat-<br />
mosphäre. Über die Herstellung von Materialien für den E<strong>in</strong>satz im Unterricht h<strong>in</strong>aus spiel-<br />
ten wir Szenarien durch, die die E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten der neuen Medien simulierten und bei<br />
denen didaktisch-methodische Überlegungen im Vordergrund standen. E<strong>in</strong> Beispiel dafür war<br />
der Workshop „Sonne, Mond und Sterne – Unterrichtsideen für die Vorweihnachtszeit“. Es<br />
wurden Fragen diskutiert wie: „Welche Vorerfahrungen müssen Schüler haben, um gew<strong>in</strong>n-<br />
br<strong>in</strong>gend mit dem Lückentext XY zu arbeiten?“ oder: „Wie viel Zeit muss man <strong>in</strong> etwa e<strong>in</strong>-<br />
planen, damit Schüler Informationen zu bestimmten Fragestellungen im Internet f<strong>in</strong>den – wie<br />
grenzt man die Suchseiten e<strong>in</strong>?“ Die Teilnehmer berieten sich untere<strong>in</strong>ander, tauschten Ergeb-<br />
nisse und Erfahrungen aus. Besonders erfreulich war, dass über Klassenstufengrenzen h<strong>in</strong>aus,<br />
e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit stattfand und auch Kolleg<strong>in</strong>nen mite<strong>in</strong>ander <strong>in</strong> Dialog traten, die sonst<br />
eher nichts mite<strong>in</strong>ander zu tun gehabt hatten. Der handlungsorientierte Charakter der Work-<br />
shops, die überschaubaren unterrichtsbezogenen Inhalte und e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle Vorgehensweise<br />
erhöhten die Bereitschaft e<strong>in</strong>iger Teilnehmer, den Transfer zu wagen und das Gelernte im eige-<br />
nen Unterricht anzuwenden.<br />
Beim Tutor<strong>in</strong>g unterstützte ich Kollegen bei konkreten Problemen im Computerraum, so<br />
zum Beispiel beim Umgang mit Outlook Express, beim „Anhängen“ von Dateien.<br />
E<strong>in</strong>en breiten Raum nahm auf Wunsch e<strong>in</strong>iger Kolleg<strong>in</strong>nen die Unterrichtsbegleitung (Co-<br />
Teach<strong>in</strong>g) e<strong>in</strong>. Hierbei handelte es sich weniger um e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong> technische Unterstützung als<br />
vielmehr um e<strong>in</strong>e begleitende Anleitung, nachdem zum Beispiel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Workshop zu e<strong>in</strong>em<br />
Thema e<strong>in</strong>e Sequenz geplant worden war. E<strong>in</strong>mal g<strong>in</strong>g es darum, zum Thema „Tiere am und<br />
im Wasser“ e<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong> mit ihrer Klasse bei der Erstellung e<strong>in</strong>es Bilderbuches zu unterstüt-<br />
zen. Es war dies e<strong>in</strong> Unterfangen, das sich über mehrere Wochen h<strong>in</strong>zog – zunächst schrieben<br />
die Schüler alle<strong>in</strong> oder <strong>in</strong> Partnerarbeit nache<strong>in</strong>ander e<strong>in</strong>e Sequenz der Fortsetzungsgeschichte<br />
„Abenteuer des kle<strong>in</strong>en Delph<strong>in</strong>s“ am Klassencomputer. Die Beiträge waren sowohl <strong>in</strong>halt-<br />
lich, vom Ausdruck als auch von der Textlänge her natürlich sehr unterschiedlich. Im Laufe<br />
der dritten Woche wünschte die Kolleg<strong>in</strong> me<strong>in</strong>e Unterstützung. Sie hatte vor Schreibkonfe-<br />
renzen <strong>zur</strong> Textredigierung am Computer durchführen zu lassen und bat mich, das Vorgehen<br />
der Schüler zu protokollieren und gegebenenfalls helfend e<strong>in</strong>zugreifen. In e<strong>in</strong>em anderen Fall<br />
führte e<strong>in</strong> Jahrgangsteam e<strong>in</strong> Projekt durch, zu dem zwei Kolleg<strong>in</strong>nen Beiträge am Computer<br />
verfassen lassen wollten. Dank me<strong>in</strong>er Anwesenheit im Klassenraum und der Möglichkeit,<br />
den Schülern bei ihrer selbstgewählten Arbeit als Ansprechpartner <strong>zur</strong> Verfügung zu stehen,<br />
konnte die Kolleg<strong>in</strong> sich den am Computer arbeitenden Schülern besser widmen. Sie hatte<br />
aber das beruhigende Gefühl, sich bei eventuell auftretenden Problemen an mich wenden zu<br />
können. Gleichzeitig beobachtete ich die Schüler bei ihrer Projektarbeit und machte mir zu<br />
vorher festgelegten Fragestellungen Notizen (zum Beispiel: Wie lange hält das ADS-K<strong>in</strong>d Y<br />
die Arbeit am Computer aus, ohne durch die Klasse zu toben? oder: Gibt es Stolperste<strong>in</strong>e, die<br />
immer wiederkehren und auf die noch e<strong>in</strong>mal gesondert e<strong>in</strong>gegangen werden müsste? ). In<br />
den folgenden Feedback-Gesprächen konnten so Probleme, die sich durch Materialbereitstel-<br />
lung bzw. ungünstige Gruppenkonstellationen ergeben hatten, diskutiert und für die weitere<br />
Planung verändert werden.
E<strong>in</strong>e sehr erfreuliche <strong>Entwicklung</strong> hat die E<strong>in</strong>beziehung des Computers <strong>in</strong> den Freizeitbereich<br />
der Schule genommen. E<strong>in</strong>ige Erzieher<strong>in</strong>nen haben sich so weit qualifiziert, dass sie eigenstän-<br />
dige kle<strong>in</strong>e Projekte durchführen oder <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern Schüler bei<br />
der Computerarbeit unterstützen.<br />
Es existiert seit Kurzem e<strong>in</strong> Team, die sich mit der Außendarstellung der Schule <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Web-<br />
präsenz beschäftigt. Freudig wurde die „Wir s<strong>in</strong>d dr<strong>in</strong>!“- Botschaft im Kollegenkreis verkün-<br />
det. Auch wenn wegen immer wieder e<strong>in</strong>mal auftretender technischer Probleme oder wegen<br />
nur sehr schleppend e<strong>in</strong>gereichter Beiträge <strong>zur</strong> Veröffentlichung die Arbeit mitunter stagniert,<br />
bleibt doch der Wille, die Seite voran zu treiben.<br />
Neue Lernkultur, Teambildung und Schulentwicklung...<br />
Dies s<strong>in</strong>d Fernziele, um deren Erreichen wir uns im letzten Projektjahr bemühen wollen.<br />
Erste Schritte dorth<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d bereits vollzogen. Die Arbeit mit den neuen Medien ist prädes-<br />
t<strong>in</strong>iert dafür, dass sich Lehrer<strong>in</strong>nen und Schüler Lern<strong>in</strong>halte selbsttätig und aktiv aneignen.<br />
Der Lehrer als Berater und Unterstützer <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er lernenden Geme<strong>in</strong>schaft sieht sich mitunter<br />
<strong>in</strong> der Situation, dass Schüler über gewisse D<strong>in</strong>ge besser Bescheid wissen als er. Die Schüler<br />
dann selbstverständlicher als „Helfer“ e<strong>in</strong>zusetzen und dies nicht als E<strong>in</strong>geständnis e<strong>in</strong>er<br />
eigenen Schwäche zu empf<strong>in</strong>den, das ist auch Folge e<strong>in</strong>es Lern- und Umdenkprozesses. E<strong>in</strong><br />
eher partnerschaftliches Mite<strong>in</strong>anderumgehen, die <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es Teamgefühls könnte so<br />
entstehen. Auch das sich gegenseitig „In die Karten blicken lassen“, geöffnete Klassentüren,<br />
Angebote <strong>zur</strong> Hospitation s<strong>in</strong>d Zeichen <strong>neuer</strong> Lernkultur.<br />
In der Schwielowsee-Grundschule hat sich aus e<strong>in</strong>er Computer-Fachkonferenz heraus e<strong>in</strong>e<br />
Arbeitsgruppe gebildet, die sich gezielt Gedanken über den didaktisch s<strong>in</strong>nvollen Mediene<strong>in</strong>-<br />
satz macht, auftretende Probleme diskutiert und sich darum bemüht, Ansätze e<strong>in</strong>es Medien-<br />
konzepts für die Schule zu entwickeln. Diesem Team gehören Lehrer<strong>in</strong>nen und Erzieher<strong>in</strong>nen<br />
gleichermaßen an. Wichtig ersche<strong>in</strong>t uns vor allem auch den Kollegen Mut zu machen, die<br />
noch immer ängstlich oder ablehnend der Arbeit mit neuen Medien gegenüber stehen.<br />
In den künftig stattf<strong>in</strong>denden Workshops sehe ich me<strong>in</strong>e Aufgabe dar<strong>in</strong>, das Augenmerk der<br />
Teilnehmer von der Frage: „Welche Inhalte können mit dem Computer <strong>in</strong> der Klasse vermit-<br />
telt werden?“ <strong>in</strong> Richtung auf: „Wie kann sich die Qualität me<strong>in</strong>es Unterrichts durch den<br />
E<strong>in</strong>satz des Computers verbessern?“ zu lenken. Ich b<strong>in</strong> recht zuversichtlich, dass sich durch<br />
das Erleben von Kompetenzzuwachs e<strong>in</strong>e steigende Motivation der Kollegen entwickeln wird.<br />
Auch die Bereitschaft <strong>zur</strong> Reflexion bzw. zu e<strong>in</strong>em regelmäßigen kollegialen Feedback kann<br />
maßgeblich <strong>zur</strong> Qualitätsverbesserung des Unterrichts beitragen. Wir sollten durchaus würdi-<br />
gen, dass wir auch mit kle<strong>in</strong>en Schritten <strong>zur</strong> Unterrichtsentwicklung e<strong>in</strong>en Beitrag <strong>in</strong> Richtung<br />
Schulentwicklung leisten.<br />
43
44<br />
Die Arbeit mit neuen Medien an der Möwensee-Grundschule<br />
Marianne Kircher<br />
Rückblick auf e<strong>in</strong> Projektjahr im Mai 2002<br />
Die Möwensee-Grundschule hat seit 1997 Computer durch Spenden zusammengetragen.<br />
Seit e<strong>in</strong>em Projektgew<strong>in</strong>n (T.I.M.E.) 1998 verfügt sie über zehn Pentium1-Rechner, die <strong>in</strong> der<br />
Computerstation „MöwiCom“ zusammengefasst, vernetzt und mit Internetzugang versehen<br />
s<strong>in</strong>d. Es gibt diverse E<strong>in</strong>zelrechner <strong>in</strong> den Klassen, fünf im K<strong>in</strong>der-Computer-Büro im Frei-<br />
zeitbereich und zwei <strong>in</strong> der Bücherei. Die Computerstation – e<strong>in</strong> Raum von 15 m² - wird für<br />
vielfältige schulische Aktivitäten genutzt. Die E<strong>in</strong>zelrechner <strong>in</strong> den Klassen (386/486 zum Teil<br />
ohne CD-Rom-Laufwerk) werden sehr unterschiedlich e<strong>in</strong>gesetzt. Die Rechner im K<strong>in</strong>der-<br />
Computer-Büro im Freizeitbereich werden stark frequentiert. Die Bücherei-Rechner werden<br />
<strong>in</strong>tensiv genutzt.<br />
Medienkompetenz<br />
1998 verfügten die Kollegen überwiegend über e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Medienkompetenz. Haus<strong>in</strong>tern<br />
wurden <strong>in</strong>sgesamt 35 Lehrer und Erzieher <strong>in</strong> PC-Grundlagen und im Umgang mit Word und<br />
Pa<strong>in</strong>t fortgebildet. Es fanden überwiegend Kurse statt – Fortbildungsformen wie das Team-<br />
Teach<strong>in</strong>g, Coach<strong>in</strong>g oder Tutor<strong>in</strong>g waren uns zu dem Zeitpunkt unbekannt. Der von den Kol-<br />
legen geäußerte Wunsch, Computer <strong>in</strong> die Unterricht zu <strong>in</strong>tegrieren, wurde <strong>in</strong> der Praxis nur<br />
wenig realisiert. Von den Lehrern wurden die Möglichkeiten und Chancen computergestützter<br />
Unterrichtsformen noch nicht ausreichend erkannt bzw. fehlte es ihnen an konkreten Unter-<br />
richtsbeispielen. Insgesamt setzten die Erzieher die <strong>in</strong> den Fortbildungen erlangten Fähigkeiten<br />
deutlich aktiver und schneller <strong>in</strong> die Arbeit mit K<strong>in</strong>dern um als die Lehrer. Das liegt teilweise<br />
an der Altersstruktur, teilweise aber auch am Rollenverständnis der Lehrer, die den festen<br />
Rahmenplan des Unterrichtsbereiches als hemmend gegenüber der größeren <strong>in</strong>haltlichen Ge-<br />
staltungsfreiheit im Freizeitbereich sehen. Zum Schuljahr 2000/2001 wurden wir vom LISUM<br />
e<strong>in</strong>geladen, als assoziierte Schule am CFN-G teilzunehmen. Durch Informationen, Anregun-<br />
gen und Ermäßigungsstunden wurde es möglich, die Kollegen differenzierter zu beraten. In<br />
diesem Schuljahr fanden viele Fortbildungsaktivitäten statt, die teilweise <strong>in</strong> konkrete unter-<br />
richtliche Umsetzung mündeten (Erstellung kle<strong>in</strong>er Textprojekte, E<strong>in</strong>satz von Lernsoftware <strong>in</strong><br />
Englisch / Deutsch / Mathematik).<br />
Projektteilnehmer im SEMIK-Modellvorhaben ForMeLG s<strong>in</strong>d wir seit September 2001.<br />
Mit der Teilnahme erhofften wir uns, e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> den Ist-Zustand und die Entwick-<br />
lungsprozesse an der Möwensee-Schule geben zu können. Andererseits versprachen wir<br />
uns von der Teilnahme e<strong>in</strong>e Qualitätsverbesserung unserer Fortbildungsarbeit. Aber die im<br />
Projekt <strong>in</strong> mehrjähriger Vorarbeit entwickelten Ziele, Konzepte, Kriterien und Ansprüche<br />
überforderten uns deutlich. Ich geriet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Art „Spagat“ zwischen ForMelG-Anspruch und<br />
Möwensee-Wirklichkeit, der <strong>in</strong> diesem Bericht auch sehr deutlich wird. Und so blieben Stich-<br />
wörter wie „Neue Lernkultur“, „Medienkonzept“, „<strong>Fortbildungskonzept</strong>“ und „Schulent-<br />
wicklungskonzept“ noch reichlich ungefüllt.
Was ist im letzten Jahr passiert? Prozesse...<br />
Kollegen – Akzeptanz, Motivation, Kompetenz<br />
Wir versuchten kle<strong>in</strong>e Ansätze <strong>neuer</strong> Lernformen mit e<strong>in</strong>zelnen Kollegen zu erarbeiten. Dabei<br />
war <strong>in</strong>teressant, dass auch Kollegen, deren Arbeits- und Unterrichtsformen e<strong>in</strong>en Compu-<br />
tere<strong>in</strong>satz stark erleichtern würden (B<strong>in</strong>nendifferenzierung, Tages- und Wochenplanarbeit,<br />
Freiarbeit, explizite Betonung von Lern- und Arbeitstechniken) sich genauso schwer taten wie<br />
andere, die noch immer stark frontal orientiert und lehrerzentriert arbeiten. Das ist unver-<br />
ständlich und kann eigentlich nur mit Unsicherheit h<strong>in</strong>sichtlich der technischen Handhabung<br />
der Computer erklärt werden oder mit der verbreiteten Angst, dass die Schüler ihnen überle-<br />
gen se<strong>in</strong> könnten.<br />
Der Lehrer als Lernarrangeur, der Unterrichts<strong>in</strong>halte mit neuen Lerntechniken, Medien<br />
und Methoden neu verknüpft, ist noch weitgehend Zukunftsmusik. E<strong>in</strong>e große Chance liegt<br />
me<strong>in</strong>es Erachtens <strong>in</strong> neuen Fortbildungsformen, die bisher bei uns allerd<strong>in</strong>gs noch zu wenig<br />
Anwendung gefunden haben. Viele Kollegen s<strong>in</strong>d nicht bereit oder <strong>in</strong> der Lage, theoretische<br />
Entwürfe von alle<strong>in</strong> und eigenständig <strong>in</strong> die Praxis umzusetzen. Oft br<strong>in</strong>gen die Kollegen<br />
Artikel pädagogischer Zeitschriften und Literaturh<strong>in</strong>weise mit, aber sie lesen und verarbeiten<br />
sie nicht. Hier wäre zum Beispiel Co-Teach<strong>in</strong>g bestimmt e<strong>in</strong> Ansatz, der jedoch nicht davon<br />
entb<strong>in</strong>det, neue Unterrichtsformen auch selbst zu durchdr<strong>in</strong>gen und sich durch eigenes Tun<br />
anzueignen. Es gibt jedoch auch positive Beispiele: E<strong>in</strong>e Vorklassenleiter<strong>in</strong> <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>gangsstu-<br />
fe 1/1 (K<strong>in</strong>der mit ger<strong>in</strong>gen Schriftkenntnissen) und 1/2 (K<strong>in</strong>der, die mit dem Schreiben anfan-<br />
gen) geht ganz selbstverständlich mit kle<strong>in</strong>en Gruppen an die Rechner und br<strong>in</strong>gt den K<strong>in</strong>dern<br />
erste Grundkenntnisse bei, lässt im Zeichenprogramm u. a. zusätzliche Schwungübungen ma-<br />
chen und fertigt mit den K<strong>in</strong>dern sachkundliche Bilder an.<br />
Konzept<br />
Es gab erste Diskussionen, was K<strong>in</strong>der am Ende von Lerne<strong>in</strong>heiten, neben dem <strong>in</strong>haltlichen<br />
Lernzuwachs, <strong>in</strong> der Handhabung der Computer und der Anwendungen können sollten.<br />
Entgegen den Ausführungen der 5. Grundschule Mitte (Frau Sonnick-Ritter), die durch ihren<br />
wirklichkeitsnahen Anspruch überzeugen, haben wir es jedoch zu theoretisch und komplex<br />
angefangen und mussten unsere Entwürfe der Realität anpassen.<br />
Fortbildungen<br />
Fortbildungsaktivitäten im Bereich von Software-Anwendungen wie Microsoft Word wurden<br />
nur noch <strong>in</strong> ganz ger<strong>in</strong>gem Umfang durchgeführt, stattdessen erarbeiteten wir schriftliche<br />
Anleitungen zum Selbstlernen, die auf unserer Homepage abgerufen und abgearbeitet werden<br />
können.<br />
Lernsoftware<br />
Wir haben Grundlagen-Lernsoftware für die Klassenstufen 1 bis 4 <strong>in</strong> Deutsch und Mathema-<br />
tik angeschafft. In Zusammenarbeit mit zwei Mitarbeiter<strong>in</strong>nen von „Goldnetz“ wurden Teile<br />
der Lernsoftware für den Unterrichtse<strong>in</strong>satz weiter bearbeitet. Wir erstellten Übersichten zu<br />
den Inhalten der Programmübungsteile (Arbeitsmappen). Sie geben den Lehrern die Möglich-<br />
keit K<strong>in</strong>der gezielt zu den Übungen h<strong>in</strong>zuführen, die korrelativ zum Unterrichtsstoff s<strong>in</strong>d.<br />
45
46<br />
Computerstation<br />
Parallel planten und <strong>in</strong>itiierten wir die Vergrößerung der Computerstation. Dies war e<strong>in</strong><br />
weiterer wichtiger Schritt, um die Vorbehalte e<strong>in</strong>iger Kollegen zu entkräften. In den kle<strong>in</strong>en<br />
Raum mit zehn Arbeitsplätzen passte bei Computer-E<strong>in</strong>zelnutzung nicht e<strong>in</strong>mal die Tei-<br />
lungsgruppe e<strong>in</strong>er Klasse. Bei der zudem ger<strong>in</strong>gen Anzahl von Teilungsstunden schien vielen<br />
Kollegen die Nutzung der „MöwiCom“ nicht realisierbar. Im neuen Raum werden 18 Ar-<br />
beitsplätze (die Erweiterung wurde durch e<strong>in</strong>e Firmenspende möglich) <strong>zur</strong> Verfügung stehen<br />
und es ist ausreichend Platz vorhanden. Die Raumgestaltung der neuen „MöwiCom“ erlaubt<br />
verschiedene Unterrichtsformen von Frontalunterricht bis <strong>zur</strong> Gruppenarbeit auch im schnel-<br />
len Wechsel.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus gibt es e<strong>in</strong>e direkte Anb<strong>in</strong>dung an die im Haus vorhandene Bücherei (Fili-<br />
ale der Stadtbücherei) mit zwei weiteren PCs, e<strong>in</strong>em großen Bücherbestand und zusätzlichen<br />
Schülerarbeitsplätzen. Der zweite wichtige Grundgedanke bei der Erweiterung der Compu-<br />
terstation war der Aufbau e<strong>in</strong>es Medienzentrums durch Verknüpfung der Computerstation<br />
„MöwiCom“ mit der Bücherei, um den Stellenwert des Computers als Arbeitsmittel zu ver-<br />
deutlichen. Durch die Verb<strong>in</strong>dungstür <strong>zur</strong> Bücherei kann die dortige ABM-Kraft e<strong>in</strong>e Aufsicht<br />
gewährleisten (die Praxis wird zeigen, ob das reicht, sonst könnten Erzieher verstärkend<br />
h<strong>in</strong>zugezogen werden) und die Computer s<strong>in</strong>d für die K<strong>in</strong>der öfter und auch <strong>in</strong> ihrer Schul-<br />
Freizeit nutzbar.<br />
Schulleitung<br />
Aus dem ForMelG-Evaluations-Workshop mit Jan Hense (Welche Möglichkeiten gibt es, die<br />
eigenen Ziele konkret zu befördern? Welche Schritte s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> 2002 dazu nötig?) und dem Ta-<br />
gungsworkshop mit Gerhard Tulodziecki (Medienkonzepte für die Schule) hatten sich me<strong>in</strong>es<br />
Erachtens gute und konkrete Anregungen für e<strong>in</strong>en Konzeptentwurf ergeben, die wir schrift-<br />
lich als Diskussionsgrundlage vorbereiteten. Der Schulleiterwechsel Mitte Februar 2002 hat<br />
die <strong>Entwicklung</strong> des Schulkonzepts allerd<strong>in</strong>gs deutlich verzögert.<br />
Schul-Homepage<br />
Die Homepage der Möwensee-Schule ist seit Oktober 2001 onl<strong>in</strong>e. Es führt hier zu weit, auf<br />
Inhalt, Gestaltung und Absichten näher e<strong>in</strong>zugehen. E<strong>in</strong> H<strong>in</strong>weis sollte jedoch nicht fehlen:<br />
Ebenso wie die schriftlichen, bebilderten Lernanleitungen soll der gesamte „MöwiCom“-<br />
Bereich (erreichbar über den L<strong>in</strong>k „Unterricht“) zu mehr Aufmerksamkeit für die mögliche<br />
Computernutzung und zu größerer Nachhaltigkeit im Bewusstse<strong>in</strong> von Schulleitung, Kolle-<br />
gen, K<strong>in</strong>dern und Eltern führen.<br />
Kle<strong>in</strong>es Netzwerk: Schul-Verbund im Wedd<strong>in</strong>g<br />
Nachdem wir, wie im Projekt ForMeLG abgesprochen, die Tandem-Zusammenarbeit zwi-<br />
schen Hohenschönhausen und Wedd<strong>in</strong>g beendet hatten, haben wir stattdessen zu direkten<br />
Nachbarschulen <strong>in</strong> der Region Kontakt aufgenommen. So ist <strong>in</strong> der Region Wedd<strong>in</strong>g e<strong>in</strong><br />
kle<strong>in</strong>er Schul-Verbund <strong>in</strong>itiiert worden, <strong>in</strong> dem sich die Gottfried-Röhl-Grundschule, die<br />
Rudolf-Wissell-Grundschule, die Goethepark-Grundschule und die Möwensee-Grundschule
zusammengeschlossen haben. Unsere Ziele s<strong>in</strong>d regelmäßige Treffen mit Austausch von Infor-<br />
mationen, gegenseitiger Unterstützung, geme<strong>in</strong>samen Fortbildungsangeboten für die Kollegien<br />
der vier beteiligten Schulen und die Erarbeitung von Grundsätzen für Modelle von Schulkon-<br />
zepten.<br />
Was hat sich verändert? Ergebnisse...<br />
Lernsoftware<br />
Im Bereich der Lernsoftware hat es deutliche Fortschritte <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>es umfangreicheren,<br />
selbstverständlicheren und regelmäßigeren E<strong>in</strong>satzes gegeben. Hier ist die Akzeptanz gut ge-<br />
wachsen. Es gibt pädagogische Ansätze für die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der ausgewählten Software-Pro-<br />
dukte (Lernsoftware – Goldnetz).<br />
Medienkompetenz<br />
Die medialen Kompetenzen bei den Kollegen s<strong>in</strong>d vergrößert worden – allerd<strong>in</strong>gs werden sie<br />
nach wie vor nur <strong>in</strong> sehr ger<strong>in</strong>gem Umfang auch genutzt.<br />
Fachkonferenzen<br />
Auf e<strong>in</strong>er Gesamtkonferenz wurden die Fachkonferenzen beauftragt, sich mit Lernsoftware<br />
ause<strong>in</strong>ander zu setzen, Demos zu besorgen, die <strong>in</strong>nerhalb der Fachkonferenz ausprobiert und<br />
begutachtet werden.<br />
Fachkonferenz IT<br />
Obwohl ich begründete Bedenken über den S<strong>in</strong>n und Zweck e<strong>in</strong>er losgelösten Fachkonferenz<br />
IT hatte, haben wir dennoch e<strong>in</strong>e solche <strong>in</strong>s Leben gerufen. Sie ist den anderen Fachkonferen-<br />
zen gleich geordnet. Vordr<strong>in</strong>glicher Gedanke war e<strong>in</strong>e Teambildung im Kollegium <strong>zur</strong> Bewäl-<br />
tigung der Aufgaben, die sich mittlerweile rund um den Computere<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> großem Arbeits-<br />
umfang ergeben. Neben der Arbeitsaufteilung auf mehrere Schultern bietet e<strong>in</strong>e solche Runde<br />
aber auch die Chance, geme<strong>in</strong>sam zu dem Ergebnis zu kommen, dass e<strong>in</strong> Computerkonzept<br />
dr<strong>in</strong>gend erforderlich ist. Nun ist e<strong>in</strong>e breitere Basis für e<strong>in</strong>en Grundkonsens <strong>zur</strong> Computer-<br />
arbeit geschaffen worden. Es bleibt zu hoffen, dass mehrere Menschen diesem Bedürfnis auch<br />
mehr Nachdruck verleihen können. E<strong>in</strong>em Teil der oben genannten Bedenken wurde auch<br />
durch die Idee vorgebeugt, je Fachkonferenz e<strong>in</strong>en Computer-Beauftragten festzulegen. Die<br />
„Fachkonferenz IT“ wird diese bei Diskussionsbedarf e<strong>in</strong>laden und so ihren Kreis erweitern.<br />
Auf diese Weise ist e<strong>in</strong> Kommunikationsfluss zwischen den Fächern gewährleistet. Grundsätz-<br />
liche pädagogisch-didaktische Überlegungen werden <strong>in</strong>itiiert und auf e<strong>in</strong>e tragfähigere Basis<br />
gestellt.<br />
Was haben wir für das letzte Projektjahr vor? Perspektiven...<br />
Wir werden den Ist-Stand <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Übersicht feststellen und bewerten, hier soll auch noch<br />
Ger<strong>in</strong>ges nicht unterschätzt werden: Was wird schon gemacht? Wie wird es gemacht? Kann<br />
ich es mir angucken? (Hospitationen) Kann ich etwas übernehmen? (Teamteach<strong>in</strong>g) Neben<br />
der Steigerung der Quantität, ist <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>e größere Qualität des computergestützten<br />
47
48<br />
Unterrichts e<strong>in</strong> wichtiges Ziel. Aber hier werden wir uns nicht durch zu hohe Zielsetzungen<br />
überfordern, da <strong>in</strong> der Fachkonferenz IT nur e<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong> ist, die die Fortbildungsaktivitäten<br />
mittragen wird. Dieser Komplex liegt noch fast ausschließlich <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Verantwortung.<br />
Das Angebot an Fortbildungsmaterial auf der Schul-Homepage kann durch Material aus den-<br />
haus<strong>in</strong>ternen Fortbildungen erweitert werden, die bereits stattgefunden haben. Unser Bestand<br />
an Lernsoftware wird <strong>in</strong> den Bereichen Deutsch und Mathematik auf die Klassenstufen 5 und<br />
6 ausgedehnt und durch Lexika <strong>zur</strong> Offl<strong>in</strong>e-Recherche erweitert.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es Schul-Konzeptes wird weiter verfolgt. Wir werden versuchen, das<br />
„Selbstverständnis e<strong>in</strong>er lernenden Schule (zu) entwickeln“ [Kle<strong>in</strong>schmidt-Bräutigam], <strong>in</strong>dem<br />
wir das, was der Schulleitung bisher an Grundlagen-Papieren zugearbeitet wurde, jetzt <strong>in</strong> der<br />
Fachkonferenz IT <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit den PC-Beauftragten der anderen Fachkonferenzen<br />
diskutieren, weiterdenken und ausarbeiten. Das Beispiel der 5. Grundschule Mitte hat uns er-<br />
mutigt, auch kle<strong>in</strong>e Schritte deutlicher zu würdigen. Auch e<strong>in</strong> Weg von 1000 Meilen beg<strong>in</strong>nt<br />
mit dem ersten Schritt.<br />
Innerhalb unseres kle<strong>in</strong>en Schul-Verbundes im Wedd<strong>in</strong>g werden wir e<strong>in</strong> schulübergeifendes,<br />
standortnahes kle<strong>in</strong>es <strong>Fortbildungskonzept</strong> entwickeln. E<strong>in</strong> weiterer Schwerpunkt soll die<br />
Unterrichtsarbeit mit dem Internet werden. E<strong>in</strong> Internet-Portal mit H<strong>in</strong>weisen und URLs zu<br />
Lernangeboten für die e<strong>in</strong>zelnen Fächer und L<strong>in</strong>ks zu anderen Schulseiten, die selbst Portale<br />
oder eigenes Material bereits anbieten, ist geplant.<br />
Die neue Computerstation wird voraussichtlich vier Wochen nach Beg<strong>in</strong>n des Schuljahres<br />
2002/2003 <strong>in</strong> der oben beschriebenen Form <strong>zur</strong> Verfügung stehen. Wenn sich die Organisati-<br />
on e<strong>in</strong>gespielt hat und die Zeiten der Nutzung durch Unterricht und Freizeit feststehen, wird<br />
das Internet-Café „emm@“ eröffnet. Neben der faktischen Nutzung erhoffen wir uns da-<br />
durch auch e<strong>in</strong>e stärkere E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der K<strong>in</strong>der und Eltern <strong>in</strong> die Schule und vor allem e<strong>in</strong>en<br />
Schwellenabbau für unsere Pädagogen. Fast schon erfolgreich hat sich Folgendes entwickelt:<br />
Wir haben endlich e<strong>in</strong> Support-Konzept, um uns vom technisch-adm<strong>in</strong>istrativen Bereich zu<br />
entlasten und ihn an schulfremde Partner delegieren zu können.
Zwischenbilanz der Otto-Wels-Grundschule<br />
Bernward Weber<br />
Zentrale Gesichtspunkte dieses Berichts s<strong>in</strong>d Akzeptanz und Motivation des Kollegiums,<br />
neue Medien im Unterricht e<strong>in</strong>zusetzen. Der damit verbundene Schulentwicklungsprozess soll<br />
aufgezeigt, neue Formen des Unterrichts sollen mit Hilfe veränderter Fortbildungsgestaltung<br />
etabliert werden.<br />
Ziel der Projektteilnahme ist die nachhaltige Implementierung <strong>neuer</strong> Medien an unserer<br />
Schule. Unterstützt und gefördert wird dieses Anliegen durch die Schulleitung und die Ge-<br />
samtelternvertretung. Zu Beg<strong>in</strong>n des Projekts wurden an der Otto-Wels-Grundschule mehrere<br />
fächerübergreifende Projekte durchgeführt (zum Beispiel http://home.snafu.de/ottowels/<br />
Projekte/Afrika/afristart.htm). Mit dem „Africa@Life-Projekt“ sollte Akzeptanz für das<br />
SEMIK-Projekt gefördert werden. Alle Kollegen lieferten mit ihren Klassen Beiträge für die<br />
Internetpräsenz und die Projektzeitung. Die Schülerergebnisse, die <strong>in</strong>s Netz gestellt wurden,<br />
dienten als Grundlage für Fortbildungsmaßnahmen.<br />
Innovative Unterrichtskonzepte s<strong>in</strong>d teilweise verwirklicht worden. Die Ansätze e<strong>in</strong>er ver-<br />
änderten Lernkultur zeigten sich <strong>in</strong> projektbezogenem, arbeitsteiligem und problemorientier-<br />
tem Unterricht, der als Präsentationsgrundlage für Fortbildungen diente. Diese Veränderun-<br />
gen bezogen sich hauptsächlich auf WUV und die Projektwoche, da hier lehrplanunabhängig<br />
Unterricht verwirklicht werden konnte. Das e<strong>in</strong>jährige Projekt „Afric@Life“ ermöglichte e<strong>in</strong>e<br />
vielfältige Untersuchung von Methoden, zeitlichen Abläufen bzw. Motivationen bei den Schü-<br />
lern. Die Präsentation der Ergebnisse weckte bei den Kollegen Interesse, auch im Regelunter-<br />
richt Computer e<strong>in</strong>zusetzen. Im Rahmen e<strong>in</strong>es SAM-Projekts (Strukturanpassungsmaßnahme)<br />
gelang es der Schulleitung, <strong>in</strong> Software geschulte Mitarbeiter<strong>in</strong>nen an die Schule zu holen. Für<br />
24 Wochen standen uns zwei Arbeitskräfte <strong>zur</strong> Verfügung, die an vier Tagen <strong>in</strong> der Woche für<br />
sechs Stunden <strong>in</strong> unterrichtsbegleitenden Maßnahmen <strong>in</strong>tegriert werden konnten. Sie wurden<br />
Coach<strong>in</strong>g-Pr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>gesetzt. Sie waren im „Regelunterricht“ zusätzlich im Klassenraum an-<br />
wesend und standen den Lehrern <strong>in</strong> fünf Klassen für die Medienecke <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
An unserer Schule setzten Anfang 2001 zwölf Kollegen Computer kont<strong>in</strong>uierlich <strong>in</strong> den<br />
unterschiedlichsten Formen im Unterricht e<strong>in</strong>. Durch die wiederholte Präsentation von Unter-<br />
richtsergebnissen, die mit Hilfe des Computers entstanden, wurden immer auch weitere Kol-<br />
legen animiert, den Computer im Unterricht e<strong>in</strong>zusetzen. Die Ausstattung der Klassenräume<br />
war und ist jedoch sehr unterschiedlich. Unter W<strong>in</strong>dows 3.1. lässt sich ke<strong>in</strong>e aktuelle Multi-<br />
media CD-ROM abspielen; dafür ist das Betriebssystem jedoch für e<strong>in</strong>e Textverarbeitungs-<br />
software noch geeignet.<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n des Jahres 2001 war ich als CoMu alle<strong>in</strong>e für die Fortbildungsaktivitäten ver-<br />
antwortlich. In dieser Zeit stellte sich heraus, dass die geplanten und vorgestellten Angebote<br />
<strong>zur</strong> Fortbildung im Bezirk nicht die gewünschte Resonanz fanden. Auch Bemühungen Me-<br />
dien wie die BLZ (Berl<strong>in</strong>er Lehrerzeitung, Auflage 20.000) zu nutzen, um auf unser Angebot<br />
aufmerksam zu machen, führten nicht zum Erfolg. Es wurde e<strong>in</strong> Kurs <strong>zur</strong> Fotobearbeitung<br />
angeboten, zu dem sich vier Teilnehmer meldeten. Ich fasste daraufh<strong>in</strong> den Entschluss, me<strong>in</strong>e<br />
zehn Projekt-Abordnungsstunden aufzuteilen und e<strong>in</strong>en Kollegen me<strong>in</strong>er Schule zu beteiligen.<br />
Die Gesamtkonferenz stimmte dem zu und so konzentrierten wir uns auf die breite Festigung<br />
49
50<br />
des E<strong>in</strong>satzes <strong>neuer</strong> Medien an unserer Schule. Schwerpunktmäßig wurden unterrichtsbeglei-<br />
tende Maßnahmen durchgeführt, das heißt e<strong>in</strong> Kollege wurde bei der Unterrichtsvorbereitung<br />
und im Unterricht beim E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien unterstützt. Der E<strong>in</strong>satz der Computer <strong>in</strong> der<br />
Medienecke erfuhr e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Konsolidierung. Da die benutzen Rechner jedoch weder<br />
vernetzt s<strong>in</strong>d noch e<strong>in</strong>en Zugang zum Internet haben, lassen sich nicht alle Unterrichtsideen<br />
realisieren. E<strong>in</strong>en Internetzugang haben bisher nur die zehn Rechner im Computerraum. Hier<br />
f<strong>in</strong>den neben Fachunterricht, Projekten und WUV auch die Fortbildungen statt.<br />
E<strong>in</strong> Angebot von CidS, 14 Rechner <strong>zur</strong> Verfügung zu stellen, wurde von den Kollegen be-<br />
grüßt. Man g<strong>in</strong>g davon aus, dass für die technische Installation, die Softwarenutzung und die<br />
<strong>Entwicklung</strong> von neuen Lernformen im Jahre 2002 e<strong>in</strong>en hohen Fortbildungsbedarf br<strong>in</strong>gen<br />
würden. Die Schulleitung fasste daraufh<strong>in</strong> den Plan allen Kollegen Schulungen zu ermöglichen<br />
und beschloss im Rahmen der <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es Schulprogramms die Schulung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Form<br />
des Solidaritätspr<strong>in</strong>zips: Die Kollegen wurden <strong>in</strong> der Unterrichtszeit von mir klassenstufen-<br />
weise fortgebildet und <strong>in</strong> der Zeit von den anderen Kollegen im Unterricht vertreten. Diese<br />
Fortbildungen (5 x 6 Unterrichtsstunden im April/Mai 2002 mit jeweils zehn Kollegen) wurde<br />
bezüglich der SEMIK-spezifischen Ziele durchgeführt: Zu Beg<strong>in</strong>n der Fortbildung artikulier-<br />
ten die Teilnehmer Wünsche bezüglich der Lern<strong>in</strong>halte, die Ziele der Fortbildung wurden<br />
geme<strong>in</strong>sam festgelegt. Man kam übere<strong>in</strong>, dass Kollegen mit Erfahrungen im Umgang mit dem<br />
Computer Eckpfeiler der Fortbildung se<strong>in</strong> sollten und Teilnehmern mit wenig Erfahrungen<br />
hilfreich <strong>zur</strong> Seite stehen sollten. Dies geschah <strong>in</strong> Form von Partnerarbeit am Rechner. Vom<br />
Fortbildner wurde artikuliert, dass Phasen der Instruktion mit Phasen des selbstständigen,<br />
konstruktiven Erforschens abwechseln würden. Die Teilnehmer sollten nach e<strong>in</strong>er Phase der<br />
E<strong>in</strong>weisung selbstständig mit den Suchmasch<strong>in</strong>en „google.de“, „zum.de“ und „bl<strong>in</strong>dekuh.de“<br />
umgehen. Sie sollten Bilder für ihr Unterrichtsthema f<strong>in</strong>den und durch Vergleich der Ergebnis-<br />
se bewerten, ob diese für ihren Zweck geeignet waren. Ursprünglich war geplant diese Schu-<br />
lungen mit dem Erhalt von 14 Rechnern zu koppeln, die uns zum Ende Jahres 2001 zugesagt<br />
wurden, dann aber nicht von CidS geliefert wurden. Die Schulungen g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> die zeitgleiche<br />
<strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es Schulprogramms e<strong>in</strong> und fanden an den vorhandenen Rechnern statt.<br />
Der Studientag zum Thema „Neue Lernkultur an der Otto-Wels-Grundschule“ der mit<br />
e<strong>in</strong>em Vortrag von Frau Kle<strong>in</strong>schmidt-Bräutigam e<strong>in</strong>geleitet wurde, begünstigte die schul<strong>in</strong>-<br />
terne Fortbildung, da deren Wichtigkeit erkannt wurde. E<strong>in</strong>e Projektgruppe des Studientages<br />
befasste sich mit der weiteren Planung und dem E<strong>in</strong>satz der PCs im Unterricht. Man kam<br />
übere<strong>in</strong>, dass weitere Rechner nötig s<strong>in</strong>d, um ganze Klassen zu unterrichten. Vielfältige Er-<br />
gebnisse bezüglich <strong>neuer</strong> Lernkultur lassen sich erst f<strong>in</strong>den, wenn auch <strong>in</strong> den meisten Klas-<br />
sen e<strong>in</strong>e Medienecke <strong>zur</strong> Verfügung steht. Bis dah<strong>in</strong> wird man den Computerraum neben<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften, WUV und Projektwochen für Teilungsgruppen, DaZ-Unterricht oder<br />
für Profilkurse nutzen und diesen Aspekt bei der Stundenplangestaltung berücksichtigen.<br />
An E<strong>in</strong>zelbeispielen lässt sich an unserer Schule jedoch durchaus e<strong>in</strong>e veränderte Lernkultur<br />
nachweisen. Durch die <strong>in</strong>tensive Betreuung von Kollegen im Coach<strong>in</strong>g-Pr<strong>in</strong>zip (unter anderem<br />
auch <strong>in</strong> Klasse 1 und 2), liegen dem Kollegium Ergebnisse der Unterrichtsarbeit von Kolleg<strong>in</strong>-<br />
nen vor, die anschaulich verdeutlichen, wie die neuen Medien e<strong>in</strong>gesetzt werden können und<br />
was Lern<strong>in</strong>halte von Fortbildungen se<strong>in</strong> können.
Grundschule im Grünen - Projektbericht 1999 – 2002<br />
Ulrich Negraszus<br />
Unsere Schule<br />
Die Grundschule im Grünen ist e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Schule mit zehn Klassen (<strong>in</strong>klusive Vorklasse) und<br />
rund 270 Schülern, die sich im Nordosten Berl<strong>in</strong>s <strong>in</strong> idyllischer Lage ganz <strong>in</strong> der Nähe des<br />
Malchower Sees bef<strong>in</strong>det. Seit 1991 wird hier durch e<strong>in</strong> junges Kollegium das Schulkonzept<br />
„Grundschule im Grünen“ mit Leben erfüllt und ständig weiterentwickelt. Neben der ökolo-<br />
gischen Erziehung im Rahmen des Umweltlehreunterrichtes, bei der die durch unseren Vere<strong>in</strong><br />
unterhaltene Tierstation „Knirpsenfarm“ e<strong>in</strong>e wichtige Rolle spielt, und dem Offenen Ganz-<br />
tagsbetrieb als wichtigem Element des Schulbetriebes bildet die Öffnung des Unterrichts und<br />
die damit verbundene <strong>Entwicklung</strong> und Erprobung <strong>neuer</strong> Lernformen e<strong>in</strong>e der Säulen unseres<br />
Konzeptes. Warum also „Neue Lernkultur“ nicht auch mit Hilfe der neuen Medien entwi-<br />
ckeln? Mit Beg<strong>in</strong>n des Schuljahres 2002/03 wird sich unsere Grundschule aufgrund e<strong>in</strong>er<br />
Schulzusammenlegung personell und räumlich vergrößern. Im etwa zwei Kilometer entfernten<br />
„Fontane-Gebäude“ werden dann zusätzlich sechs Klassen unterrichtet.<br />
Unsere Ausstattung<br />
Computer gab es an unserer Schule seit Mitte der 90-er Jahre. Sie wurden vor allem im Nach-<br />
mittagsbereich durch den Hort und durch Schülerclubs genutzt. Die neuen Medien auch aktiv<br />
<strong>in</strong> den Unterricht e<strong>in</strong>zubeziehen – auf diesen Gedanken kamen wir damals noch nicht. Wie<br />
sollte das denn auch gehen?<br />
Es waren <strong>in</strong>teressierte Eltern und unser Vere<strong>in</strong>, der Malchower Grashüpfer e.V., die 1998/<br />
99 e<strong>in</strong>e bessere technische Ausstattung über „Schulen ans Netz“ und durch Firmenspenden<br />
auf den Weg brachten. So bekamen wir unseren ersten <strong>in</strong>ternetfähigen Computer. Gleichzeitig<br />
versuchten wir, e<strong>in</strong> Intranet aufzubauen. Dies wurde durch die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung unserer Schule <strong>in</strong><br />
das SEMIK-Projekt weiter vorangetrieben. Über „CidS“ erhielten wir 1999 die Ausstattung<br />
für unseren kle<strong>in</strong>en Computerraum – e<strong>in</strong>en Server mit fünf E<strong>in</strong>zelarbeitsplätzen sowie e<strong>in</strong>en<br />
sogenannten Demolux, e<strong>in</strong>en PC mit OHP-Funktion. - Und wieder halfen Eltern bei der Ver-<br />
netzung, sodass wir Ende 1999 unser „Computerlab“ feierlich e<strong>in</strong>weihen konnten. Mittler-<br />
weile haben wir acht E<strong>in</strong>zelarbeitsplätze im Computerraum, <strong>in</strong> acht von zehn Klassenräumen<br />
gibt es Medienecken, wiederum fünf davon verfügen über e<strong>in</strong>en Internetzugang. Dank der<br />
Initiative unserer Schulleitung wurde zum Jahreswechsel 2001/02 unser gesamtes Gebäude<br />
durch das Bezirksamt vernetzt, <strong>in</strong> jedem Klassenraum existieren nun zwei Anschlussbuchsen.<br />
Da unser Rektor dem Computerprojekt höchste Priorität zumisst und die Akzeptanz im Kol-<br />
legium und im F<strong>in</strong>anzausschuss sehr groß ist, wird die weitere Hardwarebeschaffung bis <strong>zur</strong><br />
vollständigen Ausstattung mit Medienecken auch über Schulmittel f<strong>in</strong>anziert werden können.<br />
Der Malchower Grashüpfer e.V. wird ebenfalls das Computerprojekt weiterh<strong>in</strong> unterstützen,<br />
<strong>in</strong>sbesondere bei kurzfristigen Anschaffungen.<br />
Wie unschwer zu erkennen ist, sieht unser Medienkonzept, wenn man es so nennen darf, vor,<br />
dass wir neben unserem Computerraum, der für die Arbeit mit Kle<strong>in</strong>gruppen gut geeignet ist,<br />
jede Klasse mit e<strong>in</strong>er Medienecke bestehend aus je zwei PC ausrüsten werden. Und das ist<br />
51
52<br />
ke<strong>in</strong>e vom SEMIK-Projekt ausgehende Orientierung oder Vorgabe, sondern der ausdrückliche<br />
Wunsch des Großteils unseres Kollegiums. Diese E<strong>in</strong>stellung kommt natürlich unseren im<br />
Rahmen von ForMeL G entwickelten Grundannahmen sehr entgegen.<br />
Im „Fontane-Gebäude“ gibt es bereits e<strong>in</strong>en mit 15 größtenteils älteren PCs ausgestatteten<br />
vernetzten Computerraum. Drei der Computer dort s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>ternetfähig. Auch hier gab es na-<br />
türlich schon e<strong>in</strong> Medienkonzept. Aber dazu später.<br />
Unser Start<br />
Natürlich hatte ich 1998 schon e<strong>in</strong>en PC, mit dem ich Schreibkram erledigen konnte. Ab und<br />
zu entwarf ich auch Arbeitsblätter oder Klassenarbeiten. Aber die neuen Medien regelmäßig<br />
<strong>in</strong> den ganz normalen Unterricht der Grundschule e<strong>in</strong>zubeziehen, war für mich noch nicht<br />
so recht vorstellbar. In jenem Jahr besuchte ich geme<strong>in</strong>sam mit e<strong>in</strong>er Kolleg<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Kurs für<br />
Multiplikatoren an der FU Berl<strong>in</strong>. Obwohl das e<strong>in</strong>e oder andere für uns unverständlich blieb<br />
und das „Fachch<strong>in</strong>esisch“ manchmal nervtötend war, bekamen wir e<strong>in</strong>e Idee davon, dass die<br />
Grundschule und der Computer durchaus e<strong>in</strong> Paar werden könnten. Und als dann 1999 die<br />
Anfrage kam, ob unsere Schule nicht an e<strong>in</strong>em Projekt <strong>in</strong> dieser Richtung mitarbeiten möchte,<br />
konnte ich nicht ne<strong>in</strong> sagen. Was SEMIK und ForMeL G <strong>in</strong> ihrer Gesamtheit bedeuten, hatte<br />
ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfasst.<br />
Unser Kollegium<br />
„Warum laden wir uns das auch noch auf?“, „Wir haben doch unser ökologisches Profil!“<br />
und „Unser Schulkonzept und der verstärkte E<strong>in</strong>satz von Computern im Unterricht – das<br />
verträgt sich nicht!“ – solche ablehnenden Me<strong>in</strong>ungen und Haltungen bis h<strong>in</strong> zu Gleichgül-<br />
tigkeit gab es durchaus unter unseren Lehrern und Erziehern. Die Mehrzahl jedoch war sehr<br />
aufgeschlossen. Schon kurz darauf formierte sich e<strong>in</strong>e Fachkonferenz bzw. Arbeitsgruppe, der<br />
sowohl Lehrer und Erzieher als auch Eltern angehörten. Anfangs standen bei den Sitzungen<br />
natürlich technische und Ausstattungsfragen im Vordergrund. Doch schon bald wandten wir<br />
uns der Fortbildung der Kollegen <strong>in</strong> Sachen Computer zu. Geme<strong>in</strong>sam mit e<strong>in</strong>em Software-<br />
spezialisten aus der Elternschaft führte ich E<strong>in</strong>führungskurse <strong>in</strong> unserem Computerraum<br />
durch. Schnell wurde klar, dass diese Kurse alle<strong>in</strong> noch nicht die neuen Medien <strong>in</strong> den Un-<br />
terricht der Grundschule e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen können. Unterrichtskonzepte bzw. Ideen für e<strong>in</strong>zelne<br />
Sequenzen waren gefragt. „Wie kann ich das mit Schülern machen?“ war e<strong>in</strong>e häufig gestell-<br />
te Frage. So entstand beispielsweise die Idee, die Vorbereitung auf unser Mittelalterliches<br />
Dorfschulfest 2000 mit e<strong>in</strong>em Internet-E<strong>in</strong>führungskurs zu verb<strong>in</strong>den: „Das Mittelalter im<br />
Internet“. Weitere ähnliche Kurse folgten, später standen Unterrichtsbegleitung, Beratung und<br />
technische Hilfestellung im Vordergrund.<br />
Unser Stand<br />
Zur Zeit gibt es e<strong>in</strong>e ganze Reihe von Kolleg<strong>in</strong>nen, die regelmäßig Unterrichtsprojekte mit<br />
dem Computer planen und oftmals mit Unterstützung von Teilungslehrern bzw. der Hor-<br />
terzieher<strong>in</strong> umsetzen. So wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er dritten Klasse e<strong>in</strong>e eigene Klassen-Homepage über<br />
das Internetangebot www.primolo.de erstellt. E<strong>in</strong>e vierte Klasse bekam von ihrer Lehrer<strong>in</strong><br />
„Internet-Wanderkarten“ für die Bearbeitung des Themas Wasser im Sachkundeunterricht.<br />
In den Klassen 5 und 6 wurden regelmäßig selbständig Internetrecherchen zu den verschie-
densten Fachgebieten durchgeführt. Im „Fontane-Gebäude“ wurde der Sachkunde-Unterricht<br />
<strong>in</strong> Klasse 3 und 4 als Teilungsunterricht organisiert, um e<strong>in</strong>en Computerkurs für alle K<strong>in</strong>der<br />
durchführen zu können. Ich selbst b<strong>in</strong> vorwiegend als Helfer, Berater oder bei Bedarf als Tei-<br />
lungslehrer tätig.<br />
Unser Ziel<br />
Wir haben mit der Medienecken-Installation <strong>in</strong> den unteren Klassen begonnen und wollen<br />
dies nun Jahr für Jahr hochwachsen lassen, sowohl von der technischen Ausstattung her als<br />
auch von dem E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen der neuen Medien <strong>in</strong> den Unterricht und dem Vertrautse<strong>in</strong> der<br />
Schüler mit dem Arbeitsmittel Computer.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es entsprechenden Medienkonzeptes, das Teil unseres Schulkonzeptes<br />
werden muss, ist e<strong>in</strong> weiteres wichtiges Ziel. Es sollte unter anderem auch e<strong>in</strong>e Art Rahmen-<br />
plan bzw. e<strong>in</strong>en Katalog von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer<br />
enthalten. Schon die <strong>Entwicklung</strong> dieses Medienkonzeptes schließt e<strong>in</strong>, dass der Austausch<br />
über den E<strong>in</strong>satz der neuen Medien im Unterricht, über Unterrichtskonzepte und Projektideen<br />
<strong>in</strong>tensiviert werden muss. Dazu müssen verstärkt Fachkonferenzen und Gesamtkonferenzen<br />
genutzt werden.<br />
Und nicht zuletzt steht die Vernetzung und Ausstattung mit Medienecken im „Fontane-Ge-<br />
bäude“ auf der Tagesordnung, damit auch hier die E<strong>in</strong>beziehung der neuen Medien im Klas-<br />
senraum möglich wird.<br />
53
54<br />
Prozesse, Ergebnisse und Perspektiven der Region Neukölln, Treptow-<br />
Köpenick<br />
Helmut Nitschke, Axel Schmidt<br />
Intentionen<br />
Zielsetzung von Fortbildung muss es se<strong>in</strong>, die Teilnehmer dah<strong>in</strong>gehend zu befähigen, mit<br />
den neuen Medien unter E<strong>in</strong>beziehung ihrer Komplexität, Vernetzungen und Dynamiken<br />
umzugehen und dieses <strong>in</strong> der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse zu berücksichtigen. Die<br />
Teilnehmer erweitern ihre <strong>in</strong>dividuelle Medienkompetenz und werten die dabei gewonnenen<br />
Erfahrungen h<strong>in</strong>sichtlich der Gestaltung der von ihnen <strong>in</strong>itiierten Lehr- und Lernprozesse aus.<br />
Zielsetzung<br />
Die Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sollen:<br />
• Ihre persönliche Medienkompetenz zielgerichtet erweitern und dabei <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Selbst-<br />
reflexion die persönliche Medienkompetenz e<strong>in</strong>schätzen,<br />
• Möglichkeiten erfahren, welche didaktisch- methodische Verfahren die Medienkompetenz<br />
bei Schülern und Kollegen erweitern helfen und Kriterien für Medienkompetenz formulie-<br />
ren.<br />
Innerhalb der Fort- und Weiterbildung erweitern die Teilnehmer ihre Kompetenzen im Um-<br />
gang mit Hard- und Software (technische Tools) und der didaktisch-methodischen Gestaltung<br />
von Lehr- und Lernprozessen im Unterricht unter E<strong>in</strong>beziehung der neuen Medien (methodi-<br />
sche Tools).<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Konzeption<br />
Zielsetzung: Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen mit neuen Medien<br />
Inhalte:<br />
• Unterrichts<strong>in</strong>halte; Was?<br />
• Lehr- und Lernmethoden: Wie?<br />
• Organisation Wann, womit?<br />
Beispiele aus der Arbeit <strong>in</strong> der Region<br />
Unterrichts<strong>in</strong>halte: Zentrale Inhalte wie Desktopoberfläche, Scannen; Inhalte für e<strong>in</strong>zelne<br />
Lernbereiche <strong>in</strong> Form von Lernsoftware, Internetseiten; exemplarische Projekte für e<strong>in</strong> lernbe-<br />
reichsübergreifendes Lernen.<br />
Lehr und Lernmethoden - speziell: Unterrichtsformen und Unterrichtsphasen, Internetrecher-<br />
che, Präsentationsformen, Komb<strong>in</strong>ation verschiedener Medien.<br />
Lehr und Lernmethoden - allgeme<strong>in</strong> didaktisch: Differenzierung, Phasengliederung; Möglich-<br />
keiten der Lernkontrolle, M<strong>in</strong>dmapp<strong>in</strong>g, Strukturdiagramme; Projektmethode, Motivation,<br />
Arbeit mit Wochenplan, Lernen mit allen S<strong>in</strong>nen; Möglichkeiten der Reflexion über Lernpro-<br />
zesse.<br />
Organisation: Raumgestaltung, wann technische Steps?, IT Ausstattung, allgeme<strong>in</strong>e Unter-<br />
richtsorganisation wie Größe der Lerngruppe, wann Reflexionsphasen.
Ergebnisse der Region<br />
Computer dienen der Informationsbeschaffung, Ergebnissicherung und Präsentation (Infor-<br />
mationsaufbereitung und Informationsverarbeitung). Medienkompetenz kann nicht losgelöst<br />
von Inhalten erworben werden. Medienkompetenz be<strong>in</strong>haltet das Vermögen, für e<strong>in</strong>en dar-<br />
zustellenden Sachverhalt das geeignete Medium auszuwählen. Medienkompetenz kann nicht<br />
vermittelt werden, sondern wird durch Eigenaktivität erworben.<br />
E<strong>in</strong>e Reflexion erfolgte im Rahmen der Auswahl von Medien bezogen auf den Unterrichts-<br />
<strong>in</strong>halt. Die Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltungen äußerten zu Beg<strong>in</strong>n auch im Rahmen<br />
der Jour Fixe Vorstellungen h<strong>in</strong>sichtlich der zu bearbeitenden Inhalte. Die Schwerpunkte<br />
sollten konkret <strong>in</strong> den Lernbereichen der Grundschule verankert se<strong>in</strong>. Entsprechend wurden<br />
folgende Inhalte abgesprochen: Der E<strong>in</strong>satz von Software <strong>zur</strong> Produktion von Musik im Mu-<br />
sikunterricht und die damit verbundenen didaktisch methodischen Möglichkeiten und Anfor-<br />
derungen. Der E<strong>in</strong>satz von digitaler Fotografie, <strong>in</strong> fachübergreifenden Unterrichtsprojekten.<br />
E<strong>in</strong>e Reflexion erfolgte im Rahmen des Umgangs mit Medien (Bedienung/Handhabung.<br />
Ebenso erfolgte gemäß der Erwartung der Teilnehmer <strong>in</strong> den Fortbildungsveranstaltungen)<br />
und im Jour Fixe e<strong>in</strong>e Behandlung technischer Aspekte im Umgang mit den Medien. So wur-<br />
den die E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten des Beamers erläutert, auch als Videoprojektionsgerät, und<br />
Beispiele sowie Problemlösungen im Aufbau und <strong>in</strong> der Gestaltung von Computernetzwerken<br />
aufgezeigt.<br />
E<strong>in</strong>e Reflexion erfolgte im Rahmen des Beurteilens von Medien, des Hervorhebens der<br />
Vor- und Nachteile der Medien und e<strong>in</strong>er Bündelung <strong>in</strong> gültige Kriterien. Die Teilnehmer er-<br />
kannten <strong>in</strong> den Diskussionen, dass bei der Auswahl der Medien die Effizienz h<strong>in</strong>sichtlich des<br />
zeitlichen und technischen Aufwandes neben den vielfältigen Möglichkeiten der Veranschau-<br />
lichung von Lern<strong>in</strong>halten nachhaltig berücksichtigt werden muss. Ohne e<strong>in</strong>e Rhythmisierung<br />
und Reproduzierbarkeit der Arbeitsabläufe und der damit verbundenen Nutzung erstellter<br />
Vorlagen wie Präsentationen ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e effektive Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten<br />
der neuen Medien nur e<strong>in</strong>geschränkt möglich.<br />
Perspektiven ergeben sich im H<strong>in</strong>blick auf:<br />
• die Reflexion des Lernprozesses durch die Erfahrungen des eigenen Lernens (Wird rezepti-<br />
ves Lernen bei den Präsentierenden gefördert oder die Eigenaktivität? Wird beim Betrachter<br />
eher rezeptives oder eigenaktives Lernen gefördert?)<br />
• und bei dem Transfer der eigenen Lernprozesse auf die Gestaltung der Lehr- und Lernpro-<br />
zesse mit Schülern.<br />
Aus den Prozessen der Fortbildungsveranstaltungen<br />
Teilnehmerorientierung be<strong>in</strong>haltet den Ausbau <strong>in</strong>dividueller Stärken und die zielgerichtete<br />
Förderung von weniger ausgeprägten Kompetenzbereichen. Das impliziert die stetige Be-<br />
rücksichtigung entsprechender differenzierender Maßnahmen bei der Gestaltung e<strong>in</strong>zelnen<br />
Veranstaltungen. Die Reflexion über erlebte veränderte wie auch traditionelle Lehr- und<br />
Lernformen bildet die Grundlage für die eigene Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen.<br />
Die Erarbeitung und kritische Ause<strong>in</strong>andersetzung mit den Kriterien für die Beschreibung der<br />
Ausprägung der Medienkompetenz der Lehrenden und Lernenden bildet die Grundlage für<br />
die am Lernzuwachs orientierte Gestaltung der Stunden-/Lernziele und der Lernphasen.<br />
55
56<br />
Erfahrungen und Ergebnisse h<strong>in</strong>sichtlich der Projektziele<br />
• Problembewältigung durch Informationsaustausch<br />
• Vone<strong>in</strong>ander lernen durch gegenseitiges Vorstellen von Unterrichtssequenzen<br />
• Bezirkliche Regionalkonferenzen wurden <strong>in</strong> die Netzwerkstatt <strong>in</strong>tegriert<br />
Mögliche fächerübergreifende Inhalte und Zielsetzungen<br />
• Verständnis vom Aufbau von Internetseiten<br />
• Struktur von Hypertext<br />
• Kriterien für Auswahl, Gestaltung, Beurteilung e<strong>in</strong>er Bildschirmansicht, Druckseite, Folien-<br />
folge u.ä.<br />
• Kriterien für Präsentationsformen und - beispiele.
7 Medienkonzepte der Projektschulen<br />
Das Medienkonzept der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
Alfred Schaefer<br />
Vorüberlegungen zum Curriculum „Computer als Werkzeug“<br />
Da das Wissen der Menschheit sich <strong>zur</strong> Zeit alle zehn Jahre verdoppelt (<strong>in</strong>sbesondere im<br />
naturwissenschaftlichen Bereich), da unser Leben e<strong>in</strong>em ständigen Wandel unterworfen ist,<br />
sche<strong>in</strong>t es schier unmöglich zu se<strong>in</strong>, K<strong>in</strong>dern e<strong>in</strong> gesichertes Wissen mit auf ihren Lebensweg<br />
zu geben. Wir können davon ausgehen, dass die K<strong>in</strong>der Berufe ausüben werden, deren Na-<br />
men wir heute nicht kennen, geschweige denn, dass wir wissen was ihre genaue Tätigkeit se<strong>in</strong><br />
wird. Dass wir heute <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong> könnten, unsere K<strong>in</strong>der auf ihre zukünftigen Tätigkeit<br />
<strong>in</strong>haltlich vorzubereiten, ist e<strong>in</strong>e Illusion. Die Lehrperson als Wissenstransporteur tritt <strong>in</strong> den<br />
H<strong>in</strong>tergrund, die Vermittlung von Lernkompetenzen bekommt immer mehr Gewicht. Es er-<br />
sche<strong>in</strong>t aber sehr s<strong>in</strong>nvoll zu se<strong>in</strong> den K<strong>in</strong>dern Fähigkeiten mitzugeben, die übertragbar s<strong>in</strong>d<br />
und die sich an den Möglichkeiten orientieren, die heute schon wichtig und möglich s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />
Teil dieser Fähigkeiten ist der Umgang mit den neuen Medien. Die Schule muss den K<strong>in</strong>dern<br />
<strong>in</strong> unserer Gesellschaft diese Möglichkeit bieten, um ihnen reelle Startchancen zu verschaffen.<br />
Insbesondere ist es wichtig für K<strong>in</strong>der, die <strong>in</strong> ihrem Elternhaus nicht diese Möglichkeit haben.<br />
Der Computer ist heute e<strong>in</strong> Werkzeug, dessen Gebrauch <strong>in</strong> fast allen Bereichen unseres Lebens<br />
e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit geworden ist. Genau deshalb sollte er auch <strong>in</strong> der Schule selbstver-<br />
ständlich se<strong>in</strong>. Dies s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige der Gründe, die uns bewegen, das Curriculum „Computer als<br />
Werkzeug“ an unserer Schule umzusetzen.<br />
Arbeit mit dem Computer an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
Ausstattung, organisatorische Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und <strong>in</strong>haltlich, didaktische<br />
H<strong>in</strong>weise<br />
Frieder Klapp<br />
Im Oktober 2003 verfügten wir an unserer Schule über folgende Voraussetzungen:<br />
Neun Macs für Klasse 1-3 <strong>in</strong> Teilungsräumen und <strong>in</strong> den Klassen (im gelben Haus), sechs<br />
Macs im Teilungsraum der 5. Klassen und acht Pentium- PCs im Sprachlabor, e<strong>in</strong> iMac <strong>in</strong> der<br />
Vorklasse (im blauen Haus), <strong>in</strong> jeder 4. und 6. Klasse zwei iMacs mit Drucker (und teilweise<br />
Scanner) und Internetanschluss, Multimedia-Werkstatt mit zwölf iMacs, e<strong>in</strong>em G4-Mac, ei-<br />
nem Server, zwei Scanner, Beamer, zwei iBooks (im roten Haus).<br />
Bei der Arbeit mit neuen Medien haben sich <strong>in</strong> den vergangenen Jahren folgende Inhaltsbe-<br />
reiche etabliert:<br />
Vorklasse: Die K<strong>in</strong>der werden spielerisch an den Computer herangeführt. Es wird e<strong>in</strong>fache<br />
Lernsoftware zum logischen Denken (Th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g Th<strong>in</strong>gs, Denkspiele 2 usw.) und <strong>zur</strong> Wort-<br />
schatzerweiterung speziell für die ausländischen Schüler (Me<strong>in</strong> erstes Lexikon) e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
57
58<br />
1. Klasse: In dieser Klassenstufe arbeiten die K<strong>in</strong>der b<strong>in</strong>nendifferenziert <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zel- und Part-<br />
nerarbeit (teils mit Unterstützung durch Eltern) am Computer. Benutzt wird AppleWorks als<br />
e<strong>in</strong>faches Schreib- und Malprogramm und Lernsoftware im Bereich Mathematik (z.B. Me<strong>in</strong><br />
erstes Lexikon, Blitzrechnen). Ziel ist, die K<strong>in</strong>der an den Umgang mit der Maus und der Tas-<br />
tatur zu gewöhnen, um eventuelle ungleiche Voraussetzungen anzugleichen.<br />
2. Klasse: Der Umgang mit den Computern wird erweitert, es wird b<strong>in</strong>nendifferenziert,<br />
partnerschaftlich gearbeitet. Lernsoftware wird <strong>in</strong> Mathematik, Deutsch (Lernkartei auf Basis<br />
des Grundwortschatzes - GUT1) e<strong>in</strong>gesetzt Bildnerisches Gestalten (Erstellung kle<strong>in</strong>er Comics<br />
und Bilder), Schreib-und Malprogramm, Übung des Umgangs mit Maus und Tastatur. Im We-<br />
sentlichen wird bedarfsorientiert im Gruppenraum oder <strong>in</strong> den Klassen gearbeitet.<br />
3. Klasse: E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft, zwei zusätzliche Unterrichtsstunden auf<br />
freiwilliger Basis. Schreiben von längeren Texten, Zusammenführen von Text und Bild, selbs-<br />
terstellt oder aus der ClipArt-Bibliothek. Herstellung e<strong>in</strong>es kle<strong>in</strong>en Gedichtbuches. Organisa-<br />
tionsform: Die zweistündige AG wird von jeweils 12 - 18 K<strong>in</strong>dern der 3. Klassen im Compu-<br />
terraum durchgeführt. Die AG wird alternierend vierteljährlich für alle 3. Klassen angeboten.<br />
Der Andrang hat etwas nachgelassen, da die AG <strong>in</strong> der 7./8. Stunde stattf<strong>in</strong>det und die häusli-<br />
che Ausstattung teilweise recht gut ist. E<strong>in</strong>satz des Beamers, b<strong>in</strong>nendifferenzierte Arbeit nach<br />
Teilnahme an der AG mit den Computern im Teilungsraum. Alle K<strong>in</strong>der der Schule haben<br />
spätestens ab Klasse 3 Grunderfahrungen mit dem Computer.<br />
4. Klasse: Die Computer im Klassenraum werden b<strong>in</strong>nendifferenziert e<strong>in</strong>gesetzt. Grundla-<br />
gen des Schreibens, Sicherns usw. s<strong>in</strong>d für das selbständige Arbeiten vorhanden. E<strong>in</strong>satz von<br />
Lernsoftware <strong>in</strong> der Klasse und im Computerraum. Anlegen eigener Ordner, Verwaltung der<br />
eigenen Dateien, Mathematik- und Rechtschreibübungen mit der Software. Neu h<strong>in</strong>zu kommt<br />
die E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> den virtuellen Klassenraum (lo-net) mit E-Mail, Chat, Forum, Dateiablage<br />
und Aufgabenliste. Jedes der K<strong>in</strong>d der 4. Klasse erhält e<strong>in</strong>e E-Mail-Adresse. Ausbildung von<br />
je zwei geeigneten K<strong>in</strong>dern (Junge/Mädchen) pro Klasse zu MAC-Helpern <strong>zur</strong> Förderung der<br />
selbständigen Arbeit <strong>in</strong> den Klassen (Unterstützung der Mitschüler und Lehrer). Angebot der<br />
Computer-AG als Fortsetzung und für die nicht erreichten K<strong>in</strong>der der 3. Klassen, bzw. Vertie-<br />
fung des bereits Gelernten.<br />
5. Klasse: Internetführersche<strong>in</strong> im WUV Kurs, Dauer 1/4 Jahr, damit alle <strong>in</strong>teressierten K<strong>in</strong>-<br />
der erreicht werden. Selbständige Recherche <strong>in</strong> k<strong>in</strong>dgerechten Suchmasch<strong>in</strong>en, Internetspiele,<br />
Anlegen e<strong>in</strong>er persönlichen Bildersammlung aus dem Internet, Erstellung von Arbeitsblättern<br />
für die Klassengeme<strong>in</strong>schaft. MoMo wird regelmäßig im Unterricht e<strong>in</strong>gesetzt und gibt Impul-<br />
se für den aktuellen Unterricht. Die MOMO-Themen erwachsen teilweise aus dem Unterricht.<br />
6. Klasse: Auffrischungskurs für die MAC- Helper (Anleitung und Hilfe für die Macs, Dru-<br />
cker und Scanner <strong>in</strong> den Klassen). Halbjähriger WUV-Kurs mit folgenden Arbeitsergebnissen:<br />
Wandzeitungen, Präsentation der Schule auf dem Kiezfest, Fotogeschichten, Bücher: Me<strong>in</strong>e<br />
Grundschulzeit. Fertigkeiten der K<strong>in</strong>der: Scannen, Digitales Fotografieren und Filmen, Inter-<br />
netrecherche, Layouten. Der diesjährige WUV-Kurs (Lego-Projekt) verb<strong>in</strong>det neben digitalem<br />
Fotografieren und Filmen haptisches Lernen mit zielgerichteter Internetnutzung (Beteiligung<br />
an Onl<strong>in</strong>e-Auktionen).
Computer als Werkzeug<br />
- Das schul<strong>in</strong>terne Curriculum der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
Frieder Klapp<br />
Das Kollegium der Mark-Twa<strong>in</strong>-grundschule hat im November 2002 folgendes schul<strong>in</strong>terne<br />
Mediencurriculum für e<strong>in</strong>e Erprobungsphase verabschiedet.<br />
Die K<strong>in</strong>der üben im Unterricht den Umgang mit der Maus, der Tastatur, der Benutzerober-<br />
fläche (Schreibtisch / Desktop), dem schul<strong>in</strong>ternen Netz, CD-Roms / Lernprogrammen, dem<br />
Programm AppleWorks, dem Internet, den Kommunikations<strong>in</strong>strumenten <strong>in</strong> lo-net (E-Mails,<br />
Dateiaustausch usw.) oder bei L<strong>in</strong>omail, (E-Mail, virtuelle Festplatte), den Computer-Fachbe-<br />
griffen. Folgende Fachbegriffe sollten e<strong>in</strong>geführt werden: Apple-Menü, Arbeitsgruppe, Com-<br />
puter, Cursor, Dokumente, Dokumentenordner, F<strong>in</strong>der, Kontrollleiste, Mac<strong>in</strong>tosh HD, Menü,<br />
Menüleiste, Monitor, Objekte, Programmauswahl, Schreibtisch (Desktop), Server Mailbox<br />
Vorklasse:<br />
Erste Erfahrungen mit dem Computer, Malumgebung erproben, anklicken, Doppelklick,<br />
Mausbenutzung, Lernspiele nutzen.<br />
1. Klasse:<br />
H<strong>in</strong>führung zu AppleWorks Textverarbeitung: Buchstaben, Ziffern, Leerstellen; Programm<br />
starten und beenden, CD-Roms starten und entnehmen.<br />
2. Klasse:<br />
Textverarbeitung und Zeichenprogramm (Markieren, E<strong>in</strong>fügen von Grafiken, Schriften, Sym-<br />
bolen, Größe, Farbe ( „ohne Markieren kann nichts passieren“), E<strong>in</strong>gabe (Enter-), Umschalt-<br />
(groß), Leer- und Löschtaste, Dokumente sichern, Programme starten und beenden.<br />
3. Klasse:<br />
An- und Abmelden am Computer (Benutzername und Passwort), AppleWorks Zeichenpro-<br />
gramm: Objekte/Bilder aus der Bibliothek vergrößern, verdoppeln, spiegeln, Bilder <strong>in</strong> Text<br />
e<strong>in</strong>fügen, Dokumente sichern, benennen und sichern als, drucken.<br />
4. Klasse:<br />
AppleWorks Dokumentansicht, Papierformat, Menübefehle (rückgängig, kopieren, e<strong>in</strong>fügen),<br />
Ordner anlegen, geme<strong>in</strong>same Dokumente <strong>in</strong> die Server Mailbox verschieben und dort nutzen,<br />
Internet: Informationen entnehmen, K<strong>in</strong>derseiten nutzen, Suchmasch<strong>in</strong>e: Bl<strong>in</strong>de Kuh, E-Mails<br />
schreiben (lo-net oder L<strong>in</strong>omail), Drucker auswählen und drucken.<br />
5. Klasse:<br />
AppleWorks: Absätze, Spalten, Ausrichtung, Tabellen im Textmodul anlegen, Programm <strong>zur</strong><br />
Bildbearbeitung, Umgang mit der digitalen Kamera, Internet: kopieren und speichern von<br />
Seiten, Text und Bild, Nutzung der Kommunikationsmöglichkeiten bei lo-net (im virtuellen<br />
Klassenraum) oder bei L<strong>in</strong>omail (virtuelle Festplatte)<br />
6. Klasse:<br />
AppleWorks: Tabellenkalkulation und Diagramme, Wechseln der Menüleisten / Programme /<br />
Werkzeugleisten, Scannen, Internet, Suchmasch<strong>in</strong>e: Google.<br />
59
60<br />
Der Weg zum Medienkonzept der 5. Grundschule Mitte<br />
Eva-Maria Sonnick-Ritter<br />
„Der Wandel ist e<strong>in</strong>e Reise und ke<strong>in</strong> festgelegter Plan“<br />
Als ich dieses Zitat zum ersten Mal las, fand ich dar<strong>in</strong> sehr treffend die eigene Erfahrung be-<br />
schrieben.<br />
Projektbeg<strong>in</strong>n<br />
Im Schuljahr 1998/99 beteiligte ich mich an e<strong>in</strong>em Projekt, das unspektakulär „Computer<br />
an der 5. Grundschule Berl<strong>in</strong>-Mitte“ hieß. Es war der Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es Wandels, für den es ke<strong>in</strong>e<br />
Planung und nur e<strong>in</strong>e vage Richtung gab. Es sollte e<strong>in</strong>e Reise zu „neuen Medien“ werden. Als<br />
Lehrer<strong>in</strong> aus Neukölln hatte ich nach e<strong>in</strong>em Schulwechsel zeitgleich mit 25 nagelneuen G3<br />
Apple Mac<strong>in</strong>tosh Computern die Arbeit an der 5. Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Mitte aufgenommen.<br />
Me<strong>in</strong>e Vorerfahrungen im Umgang mit Computern waren ger<strong>in</strong>g. Damit stand ich nicht al-<br />
le<strong>in</strong>. Ich befand mich <strong>in</strong>mitten e<strong>in</strong>es Kollegiums, das ebenso ger<strong>in</strong>ge oder überwiegend ke<strong>in</strong>e<br />
Kenntnisse hatte. Es handelte sich zum damaligen Zeitpunkt um 25 ausschließlich weibliche<br />
Lehrer<strong>in</strong>nen und Erzieher<strong>in</strong>nen. Initiator<strong>in</strong> des Projektes war <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Schulleiter<strong>in</strong>.<br />
Sie hatte mit e<strong>in</strong>zelnen Eltern und Kolleg<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>en Antrag bei „Schulen ans Netz“ gestellt,<br />
als Ergebnis davon 25 Computer erhalten und damit Veränderung <strong>in</strong> Gang gesetzt.<br />
Die neuen Computer wirkten sehr motivierend. Moderne Kommunikationsmittel <strong>in</strong> den Un-<br />
terricht e<strong>in</strong>zubeziehen, Schritt zu halten mit aktuellen Anforderungen an Schule und Bildung<br />
war für viele durchaus verlockend. Die meisten Kolleg<strong>in</strong>nen blickten stolz auf das moderne<br />
Equipment, wenngleich sie der Technologie respektvoll distanziert gegenüber standen.<br />
Offene Fragen<br />
Fast zeitgleich hatte e<strong>in</strong> Jahr zuvor die E<strong>in</strong>richtung der Staatlichen Europaschule Berl<strong>in</strong> (SESB)<br />
begonnen. Die im Vorjahr bil<strong>in</strong>gual <strong>in</strong> der Vorklasse betreuten K<strong>in</strong>der wurden <strong>in</strong> die erste<br />
Klasse aufgenommen und damit startete der deutsch-portugiesische Zweig der Europaschule.<br />
Parallel dazu sollten wir Apple-Modellschule werden. Welche zusätzliche Belastung würde<br />
das se<strong>in</strong>? Ist es e<strong>in</strong>e Bereicherung, sogar Notwendigkeit im H<strong>in</strong>blick auf die SESB? Bieten die<br />
Computer neue, andere Möglichkeiten kulturellen und sprachlichen Austauschs? Wie lernen<br />
wir das Medium kennen und damit umzugehen? Welche Ziele sollen wir verfolgen? Welche<br />
Unterstützung im Blick auf Technik haben wir? Woher kommen <strong>in</strong>haltliche Anregungen? Wer<br />
übernimmt verantwortlich die Begleitung und <strong>Entwicklung</strong> des Prozesses? Wie viel Arbeit<br />
kostet uns unsere Mühe? Welche Veränderungen br<strong>in</strong>gen die Computer <strong>in</strong> unserer Schule mit<br />
sich?<br />
Voraussetzungen<br />
Die Fragen blieben offen, nur die gegebenen Voraussetzungen standen fest: Es mangelte an<br />
Vorkenntnissen und es existierte noch ke<strong>in</strong> Arbeitsplan. Es gab lediglich die Bereitschaft, Ver-<br />
änderungen zuzulassen. H<strong>in</strong>tergrund war mehr der Wunsch, e<strong>in</strong>er drohenden Schulschließung<br />
durch Profilierung entgegen zu wirken als der Wille nach Innovation. Erwartungen und Wün-<br />
sche musste man selbst formulieren. Dies betraf <strong>in</strong>sbesondere Fortbildung und begleitende
Betreuung. Die Suche nach geeigneten Fortbildungsformen war schwierig. Aus mangelnder<br />
Kenntnis der Kapazitäten des neuen Mediums konnte kaum strukturierter Bedarf benannt<br />
werden. Irgendwie musste <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Schritten ausprobiert und herausgefunden werden,<br />
was machbar ist.<br />
Prozessentwicklung<br />
Aus heutiger Sicht erstaunt die Naivität, mit der man dennoch „E<strong>in</strong>schalten und Loslegen“<br />
wollte. Vielleicht spielte dabei die bis dato fehlende Erfahrung, eben auch die fehlende Nega-<br />
tiverfahrung h<strong>in</strong>sichtlich technischer Probleme e<strong>in</strong>e Rolle. Das geme<strong>in</strong>schaftliche Nichtkön-<br />
nen verband die Kolleg<strong>in</strong>nen. Erste kle<strong>in</strong>e Fortschritte wurden stolz ausgetauscht. E<strong>in</strong> Prozess<br />
geme<strong>in</strong>samen Lernens war <strong>in</strong> Gang gekommen. E<strong>in</strong>en Spielraum zwischen vorhandenen<br />
Grundfertigkeiten und der Anwendung <strong>in</strong> Unterrichtszielen gab es nicht. Man musste sich um<br />
die eigene Qualifikation bemühen und war gleichzeitig Lehrende. Alle befanden sich <strong>in</strong> der<br />
Rolle der Lernenden, auch gegenüber den Schülern.<br />
Die Computer waren als neue Geräte <strong>in</strong> den Klassen präsent, sie wurden auch zum Thema<br />
an zwei Studientagen. Interner Erfahrungsaustausch und Hospitationen an anderen Schulen<br />
wurden organisiert. Nach und nach kristallisierten sich Vorstellungen für die Weiterarbeit<br />
heraus. Aus der anfänglichen Zufallskonzeption entwickelte sich e<strong>in</strong> Weg kle<strong>in</strong>er und kle<strong>in</strong>s-<br />
ter Schritte. Gespräche am und über Computer führten <strong>zur</strong> Bildung e<strong>in</strong>er Interessentengruppe.<br />
Sie bildete den Ausgangspunkt für gegenseitige Beratung und schul<strong>in</strong>terne Fortbildung. Die<br />
daraus entstandenen Angebote nennen sich heute „Support on Demand“ und „Co-teach<strong>in</strong>g“.<br />
Die Arbeitsgruppe traf sich später <strong>in</strong> Fachkonferenzen, um e<strong>in</strong>zelne Schritte zu besprechen<br />
und Ergebnisse festzuhalten. Die Fachkonferenz entwickelte auch das vorliegende Curricu-<br />
lum. Es wurde im Schuljahr 2001/02 dem gesamten Kollegium vorgestellt und abgestimmt.<br />
Im Schuljahr 2002/03 wird verstärkt das E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen der erarbeiteten „Basics“ <strong>in</strong> die Team-<br />
sitzungen der Jahrgänge betrieben. Die Fachkonferenz diskutiert auftretende Probleme und<br />
sucht nach s<strong>in</strong>nvollen Lösungen. Sie ist besonders darum bemüht, die mittlerweile personell<br />
veränderte Besetzung des Kollegiums zu berücksichtigen und den Mediene<strong>in</strong>satz mit der Ent-<br />
wicklung als Europaschule zu verb<strong>in</strong>den.<br />
Zusammenfassung<br />
Es ließ sich <strong>in</strong> den letzten Jahren allmählich e<strong>in</strong>e Prozessstruktur erkennen, e<strong>in</strong> Wandel wurde<br />
sichtbar. Die Mühen der Bewältigung technischer Probleme, die von Anfang an und bis heu-<br />
te e<strong>in</strong>en immensen Energieaufwand fordern, bleiben dabei unerwähnt. Letztendlich wurde<br />
im Zusammenspiel von Qualifizierung und Zieldef<strong>in</strong>ition e<strong>in</strong> schul<strong>in</strong>ternes Medienkonzept<br />
erstellt. Es sieht vor, den Computer <strong>in</strong> allen Klassen und allen Fächern als Medium und Werk-<br />
zeug <strong>in</strong> den Unterricht e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den. Es beg<strong>in</strong>nt mit der Vorklasse, berücksichtigt die Beson-<br />
derheiten der Europaschule und setzt fächerübergreifend an. Es wird seit dem Schuljahr 2002/<br />
03 verb<strong>in</strong>dlich erprobt und <strong>in</strong> der Schule e<strong>in</strong>er Selbstevaluation unterzogen.<br />
Die PowerPo<strong>in</strong>t-Präsentation f<strong>in</strong>det als als PPT- und HTML-Datei auf der CD-<br />
Rom.<br />
61
62<br />
Medienkonzept der Lisa-Tetzner-Grundschule<br />
Axel Schmidt<br />
Vom Rahmenplan zum Lernziel – Zum E<strong>in</strong>satz der Neuen Medien im Fachunterricht<br />
und <strong>in</strong> den Lernbereichen<br />
Die Fertigkeiten im Umgang mit den neuen Medien werden zunehmend <strong>zur</strong> Schlüsselqualifi-<br />
kation neben dem Schreiben, Lesen, Rechnen und dem Sprechen e<strong>in</strong>er Fremdsprache. Damit<br />
ist die Grundschule gefordert entsprechende Bildungsangebote zu unterbreiten. In den Rah-<br />
menplänen s<strong>in</strong>d bislang sehr allgeme<strong>in</strong>e Aussagen <strong>zur</strong> Mediennutzung und Medienkompetenz<br />
formuliert. Die Präsentation „Vom Rahmenplan zum Lernziel“ formuliert zentrale Fragestel-<br />
lungen und beabsichtigt damit, zu methodisch-didaktischen Grundüberlegungen an<strong>zur</strong>egen,<br />
die bei e<strong>in</strong>em s<strong>in</strong>nvollen E<strong>in</strong>satz der neuen Medien unverzichtbar s<strong>in</strong>d.<br />
Das Skript und die PowerPo<strong>in</strong>t-Präsentation f<strong>in</strong>den sich als PDF-Dateien auf<br />
der CD-Rom.<br />
Medienkonzept der Schwielowsee-Grundschule<br />
Brigitte Meier<br />
Ausgangslage<br />
Das Kollegium der Schwielowsee-Grundschule blickt auf e<strong>in</strong>e über 10-jährige Erfahrung mit<br />
den neuen Medien <strong>zur</strong>ück. Bereits Anfang der 90-er Jahre wurde die Schreibwerkstatt gegrün-<br />
det, die neben anderen Schreibwerkzeugen, Druckereien usw. mit Apple Mac<strong>in</strong>tosh-Rechnern<br />
ausgestattet war. Im Laufe der Jahre kamen aus privaten Spenden PC (meist 386er und 486er)<br />
für die Medienecken <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Klassen h<strong>in</strong>zu. E<strong>in</strong> großer Schritt <strong>in</strong> Richtung Multimedia<br />
gelang uns durch die E<strong>in</strong>richtung des vernetzten Computerraumes mit acht iMacs der ersten<br />
Generation und e<strong>in</strong>em Mac G3-Rechner im Jahr 1997. Es folgten noch weitere acht iMacs<br />
für Medienecken <strong>in</strong> den Klassen sowie dank e<strong>in</strong>es Sponsors e<strong>in</strong>ige T<strong>in</strong>tenstrahldrucker. Vom<br />
Schuljahr 1999/2000 bis 2002/2003 nahm die Schwielowsee-Grundschule am SEMIK-Projekt<br />
ForMeL G (<strong>Fortbildungskonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong> <strong>in</strong> der Grundschule un-<br />
ter E<strong>in</strong>beziehung Neuer Medien im Klassenraum) teil. Während der Projektlaufzeit haben sich<br />
die Kollegen <strong>in</strong> verschiedenen Bereichen fortgebildet:<br />
• <strong>in</strong> der Erweiterung ihrer persönlichen Medienkompetenz
• <strong>in</strong> Bezug auf methodisch-didaktische Aspekte des Mediene<strong>in</strong>satzes<br />
• <strong>in</strong> Richtung der Umsetzung von Elementen e<strong>in</strong>er neuen Lernkultur.<br />
Auf Grund ihrer Erfahrungen und angeregt durch Kommunikation <strong>in</strong> den Fortbildungen ver-<br />
b<strong>in</strong>den die Kollegen mit dem Mediene<strong>in</strong>satz bestimmte Prämissen und daraus folgernd Ziel-<br />
vorstellungen.<br />
Grundannahmen<br />
Da das Wissen <strong>in</strong>sbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich e<strong>in</strong>e immer kürzere Halb-<br />
wertzeit besitzt und unser Leben e<strong>in</strong>em ständigen Wandel unterworfen ist, müssen wir uns<br />
fragen, mit welchen Grundqualifikationen wir Schüler ausstatten wollen, um sie für künftige<br />
Lebenssituationen vorzubereiten. Es ist s<strong>in</strong>nvoll, den K<strong>in</strong>dern Kompetenzen zu vermitteln,<br />
die übertragbar s<strong>in</strong>d. Dazu gehört neben Sozial- und Methoden- auch Medienkompetenz.<br />
Bereits die Grundschule muss K<strong>in</strong>dern Angebote <strong>in</strong> dieser Richtung machen, um ihnen reelle<br />
Startchancen zu verschaffen. Der Computer ist heute e<strong>in</strong> Werkzeug, dessen Gebrauch <strong>in</strong> fast<br />
allen Bereichen unseres Lebens e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit ist. Deshalb sollten auch Grund-<br />
schüler die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten für dessen Nutzung vermittelt bekom-<br />
men. Genau wie Lesen, Schreiben und Rechnen wird Medienkompetenz als Kulturtechnik<br />
nicht losgelöst von <strong>in</strong>haltlichen Zielen vermittelt.<br />
Neben der Beherrschung der Kulturtechniken gilt es vor allem die Bereitschaft und Fähigkeit<br />
zu Flexibilität, zu Mobilität zu fördern. In Verb<strong>in</strong>dung mit offenen Unterrichtskonzepten<br />
erlauben die neuen Medien das selbstständige und konstruktive Lernen, ermöglichen unter-<br />
schiedliche Zugänge und <strong>in</strong>dividuelle Zugriffe. Durch die Möglichkeiten der neuen Medien<br />
wird die Heterogenität der Lerngruppen <strong>in</strong> besonderem Maße berücksichtigt. Der Computer<br />
wird nicht nur als Schreib-, Übungs- oder Informationsmedium betrachtet, sondern als Werk-<br />
zeug des <strong>in</strong>terkulturellen Lernens.<br />
Computer <strong>in</strong> der Schwielowsee-Grundschule wird gesehen als Chance<br />
• <strong>zur</strong> Information<br />
• <strong>zur</strong> Kommunikation<br />
• <strong>zur</strong> Schulentwicklung.<br />
Das Medienkonzept ist veränderbar und wird im Dialog aller an Schule Beteiligten weiterent-<br />
wickelt.<br />
Ziele des E<strong>in</strong>satzes Neuer Medien<br />
a) Allgeme<strong>in</strong>e Ziele<br />
Durch den E<strong>in</strong>satz der neuen Medien verbessert sich die Unterrichtsqualität. Der Computer<br />
wird verstanden als Werkzeug <strong>zur</strong> besseren Erreichung bestimmter Lernziele<br />
• im Unterrichts- und im Nachmittagsbereich<br />
• <strong>in</strong> allen Fächern<br />
• <strong>in</strong> allen Altersstufen<br />
• im Klassenraum und im Fachraum<br />
• mit allen Lehrern/Erziehern.<br />
Die neuen Medien sollen Schüler bei selbst gesteuertem Lernen unterstützen. Vorrangig sollen<br />
die Schüler lernen, wie man sich eigenständig Wissen aneignet und erschließt. Die kompetente<br />
63
64<br />
Nutzung der passenden Werkzeuge ist unser Ziel. Die Schüler sollen Fertigkeiten erwerben im<br />
Umgang mit: Maus, Tastatur, Benutzeroberfläche, Arbeit im Netzwerk, CD-Roms, Textverar-<br />
beitung, Internet, E-Mail. Die Kollegen nehmen die neuen Medien zum Anlass, um sich über<br />
veränderte Lehrmethoden und Elemente e<strong>in</strong>er neuen Lernkultur auszutauschen.<br />
b) Ziele der jeweiligen Klassenstufen<br />
Schule<strong>in</strong>gangsphase (1./2. Klasse)<br />
Die K<strong>in</strong>der werden spielerisch an den Computer herangeführt. Es wird e<strong>in</strong>fache Lernsoftware<br />
zum logischen Denken, <strong>zur</strong> Wahrnehmungsförderung und <strong>zur</strong> Wortschatzerweiterung speziell<br />
für die ausländischen Schüler (Me<strong>in</strong> erstes Lexikon) e<strong>in</strong>gesetzt. Erstellen von Namenkärtchen,<br />
Arbeit mit Anlauttabellen, erste Malversuche mit der Maus. Die K<strong>in</strong>der nutzen den Computer<br />
b<strong>in</strong>nendifferenziert <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zel- und Partnerarbeit. An den Mac<strong>in</strong>tosh-Rechnern wird Apple-<br />
Works als e<strong>in</strong>faches Schreib- und Malprogramm, an den PC WordPad oder Star Office e<strong>in</strong>ge-<br />
setzt. Die K<strong>in</strong>der gewöhnen sich an den Umgang mit der Maus und der Tastatur. Im Laufe des<br />
zweiten Jahres erweitern die Schüler ihre Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer. Freies<br />
Schreiben hat e<strong>in</strong>en hohen Stellenwert. E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>ige Details des Mal- und Zeichen-<br />
programms. Lernsoftware <strong>in</strong> den Bereichen Mathematik, Deutsch (z. B. GUT 1) und Sach-<br />
kunde (z. B. Löwenzahn) wird e<strong>in</strong>gesetzt. Die Schüler lernen das E<strong>in</strong>legen und Auswerfen von<br />
CD-Roms. Der Drucker wird über die Symbolleiste ausgewählt. Im Wesentlichen arbeiten die<br />
Schüler bedarfsorientiert im Computerraum, im Gruppenraum oder <strong>in</strong> den Klassen.<br />
3. Klasse<br />
Die Arbeit mit Textverarbeitung und Zeichenprogramm wird erweitert. Die Schüler üben:<br />
Markieren, E<strong>in</strong>fügen von Grafiken, sie verändern selbständig Schriften, Größe, Farbe. Sie<br />
benutzen sicher die E<strong>in</strong>gabe-, Umschalt-, Leer- und Löschtaste. Sie kennen das Symbol „letz-<br />
ten Arbeitsschritt rückgängig machen“ und wenden es an. Die Begriffe Desktop/Schreibtisch,<br />
Ordner, Datei werden gelernt. Die Schüler können selbständig Dokumente benennen und si-<br />
chern. Im Zeichenprogramm: Objekte vergrößern, verdoppeln, spiegeln, Bilder aus der<br />
Bibliothek e<strong>in</strong>fügen (AppleWorks). Eigene Texte werden mithilfe der Rechtschreibprüfung<br />
überarbeitet. Kommunikation der Schüler <strong>in</strong> Schreibkonferenzen f<strong>in</strong>det statt, E<strong>in</strong>fügen, Aus-<br />
schneiden, Umstellen, Verändern von Textpassagen wird geübt. Alle K<strong>in</strong>der der Schule haben<br />
spätestens ab Klasse 3 Grunderfahrungen mit dem Computer.<br />
4. Klasse<br />
Die Computer im Klassenraum werden b<strong>in</strong>nendifferenziert <strong>in</strong> allen Lernbereichen e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Grundlagen des Schreibens, Sicherns usw. s<strong>in</strong>d für das selbständige Arbeiten vorhanden.<br />
Die Schüler lernen das E<strong>in</strong>richten und Verändern e<strong>in</strong>facher Tabellen, Grundlagen des Layouts,<br />
Schreiben <strong>in</strong> Spalten, E<strong>in</strong>satz von Lernsoftware <strong>in</strong> der Klasse und im Computerraum (z. B.<br />
Software für Fremdsprachenfrühbeg<strong>in</strong>n). Anlegen eigener Ordner, Verwaltung der eigenen<br />
Dateien. Freie Texte werden <strong>in</strong> Schreibkonferenzen überarbeitet, dies fördert das kooperative<br />
Handeln, die Kritikfähigkeit, den sprachlichen Ausdruck und erweitert den Grundwortschatz<br />
mit der zugehörigen Rechtschreibung. Jede Klasse erhält die Möglichkeit, sich bei antol<strong>in</strong>.de<br />
anzumelden, um onl<strong>in</strong>e die Fragen der angebotenen Lesetagebücher zu beantworten. Erarbei-
tung m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>es Themenbereiches des Sachkunde-Rahmenplanes mit Unterstützung der<br />
neuen Medien.<br />
5. Klasse<br />
Internetführersche<strong>in</strong> im WUV Kurs. Jedes K<strong>in</strong>d der 5. Klasse erhält e<strong>in</strong>e E-Mail-Adresse.<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> den virtuellen Klassenraum (lo-net) mit E-Mail, Chat, Forum, Dateiablage und<br />
Aufgabenliste. Selbständige Recherche <strong>in</strong> k<strong>in</strong>dgerechten Suchmasch<strong>in</strong>en, Internetspiele, An-<br />
legen e<strong>in</strong>er Bildersammlung aus dem Internet. E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die digitale Fotografie. Erstellen<br />
e<strong>in</strong>es persönlichen „Steckbriefes“ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fremdsprache. Wenn möglich Austausch mit e<strong>in</strong>er<br />
fremdsprachigen Partnerklasse. Arbeit an m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em fachübergreifenden Projekt mit<br />
Unterstützung der neuen Medien.<br />
6. Klasse<br />
Fotogeschichten, Buch erstellen: Me<strong>in</strong>e Grundschulzeit. Fertigkeiten der Schüler: Scannen,<br />
digitales Fotografieren, E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> das Programm Photoshop Elements, Bildgrößen verän-<br />
dern, Layout von Texten. In den Klassen werden die Rechner weiterh<strong>in</strong> b<strong>in</strong>nendifferenziert,<br />
für die Textbearbeitung, <strong>zur</strong> Internetrecherche (Erdkunde, Geschichte, Biologie) e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Notwendige Voraussetzungen<br />
Lehrer und Erzieher bilden sich <strong>in</strong> regelmäßigen Abständen fort. Es f<strong>in</strong>det m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal<br />
jährlich e<strong>in</strong>e Selbstevaluation der Kollegen und ihrer Lerngruppen statt, deren Ergebnisse <strong>in</strong><br />
die Weiterentwicklung des medienpädagogischen Curriculums e<strong>in</strong>fließen. Für die Systemad-<br />
m<strong>in</strong>istration stehen ausreichende Mittel <strong>zur</strong> Verfügung. E<strong>in</strong>e enge Zusammenarbeit zwischen<br />
Systemadm<strong>in</strong>istrator und Pädagogen f<strong>in</strong>det statt. Es s<strong>in</strong>d sowohl e<strong>in</strong> Computerraum mit<br />
m<strong>in</strong>destens 16 Arbeitsplätzen als auch m<strong>in</strong>destens zwei Computer mit Internetanschluss <strong>in</strong><br />
allen Klassen- und Gruppenräumen vorhanden. Die Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em zentralen Raum muss<br />
auf Grund unserer Erfahrungen ergänzt werden durch Medienecken im Klassen- bzw. Grup-<br />
penraum. Im Unterricht und im Freizeitbereich muss Gelegenheit bestehen, jederzeit und<br />
situationsbezogen Computer für Lernprozesse zu nutzen, sie als Werkzeuge neben bewährten<br />
anderen e<strong>in</strong>zusetzen. Für Präsentationen <strong>in</strong> den Klassen-, Fach- oder Gruppenräumen stehen<br />
zwei mobile E<strong>in</strong>heiten (Laptops) mit Beamer <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
65
66<br />
8 <strong>Fortbildungskonzept</strong>e<br />
Netzwerkstatt Re<strong>in</strong>ickendorf - das regionale Forum für neue Medien <strong>in</strong><br />
Re<strong>in</strong>ickendorfer Grundschulen<br />
Frieder Klapp<br />
Die NetzWerkstatt Re<strong>in</strong>ickendorf ist e<strong>in</strong>e Arbeits- und Kommunikationsplattform für Kol-<br />
legen, die an den Re<strong>in</strong>ickendorfer Grundschulen mit der technischen und pädagogischen Be-<br />
treuung des E<strong>in</strong>satzes von Computern und Internet im Unterricht beauftragt s<strong>in</strong>d. Es handelt<br />
sich dabei um e<strong>in</strong>en geschlossenen Gruppenraum - nur e<strong>in</strong>geladene Mitglieder haben dort Zu-<br />
griff. Zweck dieses Arbeitsbereiches ist es den Mitgliedern e<strong>in</strong>en möglichst unkomplizierten<br />
und aktuellen Informationsaustausch zu ermöglichen. Jede denkbare Frage, die zum Thema<br />
Computer und Internet im Unterricht gestellt wird (gewissermaßen von Computer-Technik<br />
bis Internet-Didaktik…), soll hier ihren Platz f<strong>in</strong>den können. Um sich <strong>in</strong> dem Arbeitsbereich<br />
NetzWerkstatt Re<strong>in</strong>ickendorf anzumelden, muss man sich zunächst bei lo-net, e<strong>in</strong>em Internet-<br />
Angebot von Schulen ans Netz, e<strong>in</strong>tragen. Das geht unter der Internet-Adresse http://www.lo-<br />
net.de und auf der dort ersche<strong>in</strong>enden Seite unter dem Unterpunkt Anmeldung unter Angabe<br />
e<strong>in</strong>iger weniger persönlicher Daten (Name, Adresse, gewünschter Username, gewünschtes<br />
Passwort). E<strong>in</strong> Tipp: Wählen Sie als Usernamen nicht irgende<strong>in</strong>en Fantasienamen oder e<strong>in</strong>e<br />
komplizierte Abkürzung, da dieser Name Bestandteil e<strong>in</strong>er E-Mail-Adresse für Ihre Schüler<br />
wird, falls Sie e<strong>in</strong>en virtuellen Klassenraum e<strong>in</strong>richten wollen! Also e<strong>in</strong>en kurzen Namen wäh-<br />
len, am besten den eigenen Nachnamen... Anschließend kann man sich sofort <strong>in</strong> der Netz-<br />
Werkstatt Re<strong>in</strong>ickendorf anmelden (auf Gruppenraum klicken und den Namen und das Pass-<br />
wort e<strong>in</strong>geben). Auf der dann ersche<strong>in</strong>enden Gruppenraum-Startseite klickt man unten auf<br />
Anmeldung bei e<strong>in</strong>er geschlossenen Gruppe und trägt <strong>in</strong> dem sich öffnenden Anmeldefenster<br />
den Gruppenkurznamen Re<strong>in</strong>ickenNet und das Passwort bezirk e<strong>in</strong>. Auf der l<strong>in</strong>ken Fenster-<br />
seite sollte dann <strong>in</strong> der (bisher noch leeren) Gruppenliste die NetzWerkstatt Re<strong>in</strong>ickendorf<br />
ersche<strong>in</strong>en mit den Bereichen Chat, Forum, Mitgliederliste, Term<strong>in</strong>kalender, Dateiaustausch<br />
und Webspace. Nach e<strong>in</strong>er richtig durchgeführten Anmeldung verfügen Sie außerdem über<br />
e<strong>in</strong>en eigenen E-Mail-Zugang (unter Privatraum) und die Berechtigung eigene virtuelle Klas-<br />
senräume (unter Klassenraum) e<strong>in</strong><strong>zur</strong>ichten. Diese Möglichkeit ist <strong>in</strong>sbesondere sehr empfeh-<br />
lenswert für Schulen, die ihre Schüler mit E-mail arbeiten lassen wollen.<br />
Im lo-net f<strong>in</strong>den Sie übrigens unter Hilfe und Support e<strong>in</strong> komplettes bebildertes Handbuch<br />
<strong>zur</strong> lo-net-Nutzung zum Herunterladen (ca. 4,5 MB).
Fachforum „Neue Medien im Deutschunterricht“ -<br />
e<strong>in</strong> regionales <strong>Fortbildungskonzept</strong><br />
Doris Lerner<br />
Hier erfahren Sie mehr über e<strong>in</strong> <strong>Fortbildungskonzept</strong>, das sich nicht nur bewährt hat, sondern<br />
sich mit e<strong>in</strong>igen Modifizierungen auf andere Bereiche/Fächer übertragen lassen könnte.<br />
Ausgangspunkt und Anlass<br />
Der Impuls dafür, das Fachforum im Rahmen der Zielsetzungen des SEMIK-Projekts „For-<br />
MeL G“ <strong>in</strong>s Leben zu rufen, war die Frage, wie die Möglichkeiten und Chancen der neuen<br />
Medien gezielt für den Fachunterricht genutzt werden können. Was kann bzw. muss man tun,<br />
um selbstgesteuertes, problembezogenes Lernen sowie kooperative Arbeitsformen unter E<strong>in</strong>-<br />
beziehung <strong>neuer</strong> Medien zu realisieren und damit veränderte Lehr- und Lernformen <strong>in</strong> Schule<br />
und Unterricht e<strong>in</strong>zuführen? Im Fachforum <strong>zur</strong> Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Deutsch-<br />
unterricht haben sich Grundschullehrer<strong>in</strong>nen als Ziel gesetzt, praktikable Unterrichtsideen<br />
und -konzepte, die die neuen Medien im Deutschunterricht berücksichtigen, auszutauschen<br />
und weiter zu entwickeln. Die Kolleg<strong>in</strong>nen verstehen sich dabei als gleichberechtigt Lernende<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Lerngeme<strong>in</strong>schaft. Sie bieten ihre Erfahrungen an, profitieren gegenseitig von dem<br />
vorhandenen Erfahrungsschatz, holen sich Anregungen für die Weiterarbeit, entwickeln ge-<br />
me<strong>in</strong>sam neue Ideen für ihren Unterricht und erweitern quasi nebenbei - im geme<strong>in</strong>samen Tun<br />
– situativ anhand authentischer, d.h. praxisnaher Probleme ihre eigene Medienhandhabungs-<br />
kompetenz.<br />
Die Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen des Fachforums sehen sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie als Unterrichten-<br />
de im Lernbereich oder Fach Deutsch und weniger als technisch versierte oder ambitionierte<br />
Bastler an den Computern. Sie suchen Möglichkeiten, die neuen Medien s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> ihren<br />
Unterricht zu <strong>in</strong>tegrieren. Dies geschieht im Rahmen ihrer persönlichen Medienkompetenz<br />
und <strong>in</strong> Ause<strong>in</strong>andersetzung mit fachdidaktischen Prämissen der e<strong>in</strong>zelnen Teilbereiche des<br />
Deutschunterrichts. Vier Leitfragen stehen - analog zu den Projektzielen - bei allen Veranstal-<br />
tungen des Fachforums - mit unterschiedlichen Akzentuierungen - im Zentrum der Ause<strong>in</strong>an-<br />
dersetzung mit den aus dem Teilnehmerkreis gewählten Inhalten:<br />
1. Wie können neue Medien <strong>in</strong> den Deutschunterricht <strong>in</strong>tegriert werden, um die Lernenden<br />
zum aktiven und kompetenten Umgang mit ihnen zu befähigen?<br />
2. Können die Inhalte des Deutschunterrichts mithilfe der neuen Medien nachhaltiger erarbei-<br />
tet werden? Wenn ja wie?<br />
3. Welche Voraussetzungen brauchen die Unterrichtenden, welche die Schüler<strong>in</strong>nen und Schü-<br />
ler?<br />
4. Welche Konsequenzen hat der E<strong>in</strong>satz neue Medien <strong>in</strong> den Unterricht für die Lehr- und<br />
Lernkultur?<br />
Das Fachforum hat dann e<strong>in</strong>e Chance, von den Teilnehmern als bereichernd für die eigene<br />
Qualifizierung empfunden zu werden, wenn es teilnehmerorientiert, bedarfsgerecht, ortsnah<br />
und regelmäßig stattf<strong>in</strong>det. Teilnehmerorientiert und bedarfsgerecht bedeutet dabei, dass die<br />
Teilnehmer ihre eigenen Interessen bzw. ihre Unterrichtspraxis berücksichtigt sehen, dass den<br />
Ansprüchen nach e<strong>in</strong>er s<strong>in</strong>nvollen Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Deutschunterricht Rech-<br />
67
68<br />
nung getragen wird - und nicht zum Beispiel Debatten über die Wartung der Computer oder<br />
Anschaffungsfragen <strong>in</strong> den Schulen die Diskussionen bestimmen.<br />
Unter den Teilnehmern besteht vorrangig der Wunsch nach praktikablen Unterrichtsideen,<br />
die möglichst am nächsten Tag umgesetzt und ausprobiert werden können. Ortsnah sollten<br />
die Treffen stattf<strong>in</strong>den, damit e<strong>in</strong> zu langer Fahrweg nicht abschreckt und als Grund für e<strong>in</strong>e<br />
Nicht-Teilnahme angeführt wird. Interessierte sollen mit e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>gen zeitlichen Aufwand<br />
möglichst großen Nutzen für ihre eigene Unterrichtsgestaltung erzielen. Regelmäßige Treffen<br />
erleichtern den kont<strong>in</strong>uierlichen Austausch <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Region, festigen persönliche B<strong>in</strong>-<br />
dungen, befördern e<strong>in</strong>e regelmäßige <strong>in</strong>haltliche Arbeit, lassen das Fachforum zu e<strong>in</strong>er Selbst-<br />
verständlichkeit werden und wecken Fortbildungslust.<br />
Ich habe im Zeitraum seit Januar 2001 festgestellt: Wenn man bei der ersten Veranstaltung<br />
e<strong>in</strong>ige Grundsätze beachtet, mit denen es gel<strong>in</strong>gt, die Interessierten <strong>in</strong>s Boot zu holen, lassen<br />
regelmäßige Treffen die ‚lernende Geme<strong>in</strong>schaft‘ auch wirklich praktizierend tätig werden,<br />
leistet das Fachforum mittel- und langfristig e<strong>in</strong>en Beitrag, den Umgang mit neuen Medien im<br />
Deutschunterricht zu e<strong>in</strong>er Selbstverständlichkeit werden zu lassen.<br />
Das erste Treffen ...<br />
Dem ersten Treffen sollte man besondere Beachtung schenken, geht es hier doch darum, Inter-<br />
essierte für e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Mitarbeit zu motivieren und ihnen Mut zu machen, die neuen<br />
Medien <strong>in</strong> ihren Unterricht zu <strong>in</strong>tegrieren. Das gel<strong>in</strong>gt vor allem dann, wenn die Teilnehmer<br />
sich angenommen fühlen, ihr Fragehorizont geklärt, ihre Erfahrungen aufgenommen und die<br />
Erwartungen an e<strong>in</strong>e solche Veranstaltung geklärt und berücksichtigt werden. Bewährt hat es<br />
sich, sich zunächst viel Zeit für dieses erste Kennen lernen und die Formulierung des Frage-<br />
und Erwartungshorizonts zu nehmen. Auch sollte man Zeit für e<strong>in</strong>en ersten Ideenaustausch<br />
e<strong>in</strong>planen, bei dem Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen ihre Erfahrungen mitteilen können. S<strong>in</strong>nvoll ist<br />
es außerdem, wenn die Moderator<strong>in</strong> zu diesem ersten Treffen zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong> konkretes Mut-<br />
mach-Praxisbeispiel bereithält, damit <strong>in</strong> jedem Fall alle mit e<strong>in</strong>em Praxistipp die erste Veran-<br />
staltung verlassen.<br />
Um die Beteiligten <strong>in</strong>s Boot zu holen, ist es s<strong>in</strong>nvoll, bei diesem ersten Treffen Problemfel-<br />
der für die <strong>in</strong>haltliche Arbeit bei Folgetreffen festzulegen, damit sich alle Beteiligten darauf<br />
e<strong>in</strong>stellen können und eventuell eigenes Material oder Ideen und Erfahrungen beisteuern kön-<br />
nen. Auch ist es hilfreich, am Ende e<strong>in</strong>er jeden Veranstaltung e<strong>in</strong>en neuen Term<strong>in</strong> auszuma-<br />
chen - die Moderator<strong>in</strong> sollte zwei bis drei Alternativen anbieten -, weil sich die Teilnehme-<br />
r<strong>in</strong>nen und Teilnehmer dann noch e<strong>in</strong> Stück mehr an der Planung der Veranstaltung beteiligt<br />
fühlen.<br />
Inhaltliche Bauste<strong>in</strong>e ...<br />
Es lassen sich vor allem zwei große Fragenkomplexe feststellen, die Teilnehmern unter den<br />
Nägeln brennen:<br />
1. Was mache ich und wie kann ich es organisieren, wenn ich mit e<strong>in</strong>er ganzen Klasse <strong>in</strong> den<br />
Computerraum muss?<br />
2. Was mache ich und wie kann ich es organisieren, wenn ich nur e<strong>in</strong> oder zwei Rechner <strong>in</strong><br />
der Klasse habe?
Es s<strong>in</strong>d vor allem die kle<strong>in</strong>en Tipps, die hilfreich s<strong>in</strong>d und das organisatorische Chaos ent-<br />
schärfen. „Geben Sie doch e<strong>in</strong>fach jedem Schüler e<strong>in</strong>e eigene Diskette, auf der jeder se<strong>in</strong>e Tex-<br />
te speichern kann.“<br />
Ist das Fundament erst e<strong>in</strong>mal gelegt, s<strong>in</strong>d die thematischen Bauste<strong>in</strong>e, die auf das Funda-<br />
ment aufgesetzt werden können, beliebig und lassen sich entsprechend der Teilnehmer<strong>in</strong>teres-<br />
sen organisieren. Bei allen thematischen Schwerpunkten sollten diese beiden Fragenkomplexe<br />
mitgedacht werden. Fast alle Unterrichtsideen und Unterrichtsbeispiele lassen sich modifi-<br />
zieren und für die Realisierung im Computer- bzw. Klassenraum verändern. Inhaltlich liegen<br />
vor allem zwei Bereiche im Interessenbereich der Teilnehmer. Zum E<strong>in</strong>en wird immer wieder<br />
die Ause<strong>in</strong>andersetzung mit Lernsoftware gewünscht, zum Anderen verlangen die Teilnehmer<br />
Ideen zum Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen (Textproduktion, Textgestaltung) und<br />
<strong>zur</strong> Informationsrecherche im Internet. Bedenken sollte man bei allen Themen, dass es immer<br />
darum geht, möglichst überschaubare Vorhaben zu entwickeln, die sich <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Dop-<br />
pelstunde realisieren lassen oder nur wenig mehr Zeit <strong>in</strong> Anspruch nehmen. E<strong>in</strong>erseits lässt<br />
die Motivation bei den Schülern schneller nach, als man es zunächst annimmt. Schreiben am<br />
Computer ist anstrengend, auch wenn die Motivation, am Computer schreiben zu können bei<br />
den Schülern zunächst sehr groß ist. Andererseits lassen sich umfangreiche Schreibvorhaben<br />
nur mühsam realisieren, wenn man bei der Nutzung des Computerraumes auf Absprachen<br />
mit Kollegen angewiesen ist.<br />
Beschäftigt man sich <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Fachforums mit Lernsoftware, so kann dies sicher nur<br />
exemplarisch geschehen. Organisatorisch vere<strong>in</strong>fachen lässt sich das Vorhaben, wenn die an<br />
e<strong>in</strong>igen Schulen bereits <strong>in</strong>stallierte Software unter die Lupe genommen und allen Teilnehmern<br />
e<strong>in</strong>ige Zeit des Ausprobierens e<strong>in</strong>geräumt wird. Da die Kollegen unterschiedliche Erfahrungen<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich vorweisen können, e<strong>in</strong>ige nur vage Kriterien für ihre Beurteilung im Kopf<br />
haben, ist es hilfreich, ihnen e<strong>in</strong>en offenen Beurteilungskatalog an die Hand zu geben, der<br />
Orientierungshilfen gibt, andererseits ergänzt werden kann, der ihnen e<strong>in</strong>e erste zielgerichtete<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung mit der Software ermöglicht. Nachdem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Treffen Lernsoftware,<br />
Schreibprojekte und Internet Ausgangspunkt unserer Arbeit waren und wir Lernchancen und<br />
Lernziele der e<strong>in</strong>zelnen Teilbereiche jeweils (eher oberflächlich) transparent gemacht hatten,<br />
haben wir im letzten halben Jahr unseren Blickw<strong>in</strong>kel etwas geändert. Wir s<strong>in</strong>d von e<strong>in</strong>zelnen<br />
Teilbereichen ausgegangen (zum Beispiel „Lesen am und mit dem Computer“), haben bereits<br />
<strong>in</strong> der Gruppe entstandene Unterrichtsszenarien wieder aufgegriffen, sie durch die „Lesebril-<br />
le“ betrachtet, damit den komplexen Lesevorgang (zum Beispiel bei e<strong>in</strong>er Internetrecherche)<br />
<strong>in</strong> den Blick bekommen, ihn zergliedert und für e<strong>in</strong>zelne Lesefähigkeiten (Texte unter be-<br />
stimmten Gesichtspunkten lesen, Informationen entnehmen...) Übungen zusammengestellt.<br />
Mit dieser Änderung des Blickw<strong>in</strong>kels ist es im Rahmen des Fachforums gelungen, Anre-<br />
gungen für e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>nvollen E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>tegrativen Deutschunterricht<br />
zu geben, der - ausgehend von e<strong>in</strong>em Inhalt - e<strong>in</strong>zelne Teilbereiche abdeckt, <strong>in</strong> dem aber auch<br />
- ausgehend von e<strong>in</strong>em Teilbereich - Inhalte fachspezifisch erschlossen werden.<br />
So fühlen sich Quere<strong>in</strong>steiger angesprochen...<br />
Nach etwas mehr als e<strong>in</strong>em Jahr Erfahrungen mit der Organisation und Durchführung des<br />
<strong>in</strong>haltsbezogenen Fachforums lassen sich organisatorische Kniffe feststellen, die sich als nütz-<br />
lich erwiesen haben. Wichtig ist <strong>in</strong> jeder E<strong>in</strong>ladung der Zusatz, dass ausdrücklich auch Neu-<br />
69
70<br />
l<strong>in</strong>ge willkommen s<strong>in</strong>d. Zwar kristallisiert sich nach e<strong>in</strong>igen Veranstaltungen e<strong>in</strong> harter Kern<br />
heraus, aber e<strong>in</strong> Kennzeichen des <strong>Fortbildungskonzept</strong>es ist auch, dass es sich nicht um e<strong>in</strong>e<br />
geschlossene Gruppe handelt. Austausch und Anregungen s<strong>in</strong>d s<strong>in</strong>nvoll und nützlich.<br />
Das Fachforum möchte ja gerade e<strong>in</strong> Forum bieten für all diejenigen, die sich ausgehend vom<br />
Fach Deutsch mit der Integration <strong>neuer</strong> Medien ause<strong>in</strong>ander setzen möchten. Und das Inter-<br />
esse wurde und wird eben nicht gleichzeitig geweckt. Spät- bzw. Quere<strong>in</strong>steiger s<strong>in</strong>d also aus-<br />
drücklich erwünscht!<br />
F<strong>in</strong>den die Veranstaltungen an wechselnden Orten statt, so hat das den Vorteil, dass man<br />
verschiedene Schulen und deren Medienecken und Computerräume kennen lernt. Außerdem<br />
nehmen meist noch e<strong>in</strong> oder zwei Kolleg<strong>in</strong>nen der jeweiligen Schule spontan an dem Fachfo-<br />
rum teil, die zwar grundsätzlich Interesse haben, aber bisher den Weg noch nicht gefunden<br />
hatten. E<strong>in</strong>e Veranstaltung <strong>in</strong> der eigenen Schule hilft offensichtlich Türen zu öffnen und<br />
Hemmungen zu überw<strong>in</strong>den.<br />
Fazit ...<br />
Positiv auf die Teilnehmerzahlen und motivierend auf die <strong>in</strong>haltliche Arbeit wirkt es sich aus,<br />
wenn die Inhalte für e<strong>in</strong>e Veranstaltung aus dem Teilnehmerkreis kommen oder Vorschläge<br />
von außen hohe Akzeptanz f<strong>in</strong>den. Selbstbestimmte Fachforen, <strong>in</strong> denen sich die Teilnehmer<br />
für wechselnde Orte und Inhalte verantwortlich fühlen, zu denen sie etwas beitragen können,<br />
schaffen Fortbildungslust. Geme<strong>in</strong>sam entwickelte Unterrichtsideen, die <strong>in</strong> der Umsetzung<br />
praktikabel s<strong>in</strong>d, fördern e<strong>in</strong> angenehmes Klima <strong>in</strong> der Gruppe und <strong>in</strong>tensivieren den Aus-<br />
tausch. Nutznießer s<strong>in</strong>d die Kollegen, die angeregt und mit neuem Schwung ihren Unter-<br />
richtsalltag meistern. Nutznießer im Schulalltag s<strong>in</strong>d aber vor allem natürlich die Schüler, für<br />
die der funktionale Umgang mit neuen Medien im Unterricht durch diese nach und nach zu<br />
e<strong>in</strong>er Selbstverständlichkeit wird.
Von MoMo zu momodo.de<br />
- Rückblicke, Stolperste<strong>in</strong>e und Perspektiven<br />
im Oktober 2002<br />
Thomas Kahlki, Frieder Klapp<br />
Erfahrungen ausmit MoMo - Was/Wie MoMo se<strong>in</strong> sollte<br />
und was daraus wurde<br />
MoMo sollte jeden Monat e<strong>in</strong> neues Monatsthema (mit Montagsrätseln) br<strong>in</strong>gen. Dies war<br />
zeitlich und personell e<strong>in</strong>fach nicht realisierbar und vielleicht nicht e<strong>in</strong>mal unbed<strong>in</strong>gt wün-<br />
schenswert.<br />
MoMo sollte sowohl <strong>in</strong> der Schule wie <strong>in</strong> der Freizeit e<strong>in</strong>setzbar se<strong>in</strong>. Da MoMo e<strong>in</strong> unab-<br />
hängig vom Unterricht e<strong>in</strong>setzbares Lernangebot se<strong>in</strong> sollte, haben wir uns bei der Auswahl<br />
der Monatsthemen nicht immer an typischen Inhalten des Unterrichts <strong>in</strong> der Grundschule<br />
orientiert. Tatsächlich beschränkte sich der E<strong>in</strong>satz jedoch weitgehend auf Unterricht und Ar-<br />
beitsgeme<strong>in</strong>schaften <strong>in</strong> der Schule. Von zu Hause aus wurde MoMo nur wenig genutzt.<br />
MoMo-Angebote wie „Zeit“ und „Filmwelten“ waren aber, da sie ke<strong>in</strong>e klassischen Unter-<br />
richtsthemen s<strong>in</strong>d, nur schwer direkt im Unterricht e<strong>in</strong>setzbar (Ausnahme: Projekte)<br />
MoMo sollte <strong>in</strong>teraktiv se<strong>in</strong> und <strong>zur</strong> Mitarbeit anregen. Die angestrebte Interaktivität, der<br />
kommunikative Aspekt und die Beteiligung von außen wurden unseren Zielsetzungen nicht<br />
gerecht, das heißt die erwarteten Rückmeldungen blieben aus. Die Beteiligung an Wettbe-<br />
werben und Rätseln, deren Lösung <strong>zur</strong>ückgemailt werden sollte, war nicht hoch. Unser Ziel<br />
war, dass neben uns „Machern“ zunehmend Ideen, Themen und Aufgaben von Schülern und<br />
anderen Lehrern <strong>in</strong>tegriert werden sollten und unsere Besucher aktive Mitgestalter von Momo<br />
werden sollten. Dass dieses Konzept offenbar falsch war (zum<strong>in</strong>dest zum jetzigen Zeitpunkt),<br />
wurde besonders beim letzten MoMo-Thema dem „MoMo-Club“ deutlich, bei dem e<strong>in</strong> be-<br />
sonders hohes Maß an Initiative und Mitarbeit gefordert wurde. Hier fand praktisch ke<strong>in</strong>e<br />
Beteiligung statt.<br />
Für die mangelnde Beteiligung hat es sicher verschiedene Gründe gegeben:<br />
• In vielen Grundschulen ist die Möglichkeit <strong>zur</strong> regelmäßigen Arbeit mit dem Internet noch<br />
gar nicht gegeben - <strong>in</strong> den Klassen gibt es oft ke<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternetfähigen Computer und e<strong>in</strong><br />
möglicherweise vorhandener Computerraum mit Internetanschluss wird nur von wenigen<br />
Kollegen/Kolleg<strong>in</strong>nen regelmäßig genutzt. Bei höchstens 45 M<strong>in</strong>uten Internetbesuch pro<br />
Woche bleibt ke<strong>in</strong>e Zeit für Knobelseiten und Rückmeldungen durch die Schüler.<br />
• Selbst bei der Zielgruppe „erfahrene Internetnutzer“ s<strong>in</strong>d Konsumentenhaltung und wenig<br />
ausgeprägte Rückmeldekultur wohl eher die Regel (jeder möge sich selber fragen, ob er da<br />
tatsächlich e<strong>in</strong>e Ausnahme darstellt...).<br />
• Unsere Themenseiten trafen nicht die Interessen der Zielgruppe (K<strong>in</strong>der fanden es zu leicht,<br />
zu schwer, langweilig, wollten nur spielen und nicht knobeln; Lehrer fanden die Themen-<br />
seiten möglicherweise nicht ausreichend passgenau für ihren Unterricht, konnten nicht die<br />
benötigte Zeit <strong>zur</strong> Verfügung stellen).<br />
• Werbewirksame „Highlights“ wie das monatliche Preisrätsel mussten wir bald e<strong>in</strong>stellen,<br />
weil sie ohne Sponsoren nicht auf Dauer zu realisieren waren.<br />
71
72<br />
• Die Zugriffszahlen entwickelten sich nicht <strong>in</strong> dem von uns erhofften Tempo - je weniger Be-<br />
sucher, desto weniger Rückmeldungen.<br />
• Aktualisierungen unserer Seiten wurden immer seltener, weil sie neben unseren eigentlichen<br />
Aufgaben und Verpflichtungen nicht mehr <strong>in</strong> der ursprünglich geplanten Häufigkeit zu<br />
schaffen waren.<br />
Bei MoMo sollte viel Wert auf die Gestaltung gelegt werden. Dieser bisherige Qualitäts-<br />
anspruch an die MoMo-Webpräsenz erforderte e<strong>in</strong>en hohen zeitlichen Aufwand, der mit<br />
den personellen Ressourcen nicht fortgeführt werden kann. Die MoMo-Seiten waren häufig<br />
- nicht zuletzt wegen der <strong>in</strong>teraktiven und spielerischen Elemente- recht aufwändig gestaltet<br />
und layoutet, was auch den entsprechend hohen Aufwand bei der Produktion erforderte. Im<br />
Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> ersche<strong>in</strong>t zweifelhaft, ob dieser Aufwand tatsächlich wesentlich für die Akzep-<br />
tanz der Seite war und e<strong>in</strong>e schlichtere und e<strong>in</strong>fachere Webseitengestaltung dem Zweck nicht<br />
genauso gut dienen würde. Auch wären wir vermutlich gar nicht <strong>in</strong> der Lage gewesen, die<br />
erhoffte Flut an E<strong>in</strong>sendungen und Beiträgen zu sichten, beantworten, <strong>in</strong> die Seiten e<strong>in</strong>zufü-<br />
gen. Für den von uns aufgestellten Anspruch (wöchentliche bzw. monatliche Aktualisierung,<br />
aufwändige Gestaltung, professionell ersche<strong>in</strong>ender Auftritt, prompte Rückmeldung auf E<strong>in</strong>-<br />
sendungen) wäre wohl eher e<strong>in</strong> Vollzeit-Redaktionsteam erforderlich gewesen.<br />
MoMo sollte eng mit Schulvision, unserer Internet-Seite für Lehrer verknüpft se<strong>in</strong>. Auf<br />
SchulVision sollten zusätzliche Infos, Tipps und Materialien für Lehrer zum jeweils aktuellen<br />
MoMo-Thema präsentiert werden. Inwiefern dieses Angebot genutzt wurde und ob diese<br />
Aufteilung s<strong>in</strong>nvoll war, konnte von uns nicht direkt festgestellt werden, da Rückmeldungen<br />
hierzu fehlen.<br />
Die neue konzeptionelle Ausrichtung von momodo.de<br />
MoMo erhält den Namen und das Logo momodo.de. Da es ke<strong>in</strong>e Monatsthemen mit Mon-<br />
tagsfragen mehr geben wird und e<strong>in</strong>e Neuausrichtung des Angebots auf den ersten Blick deut-<br />
lich werden soll, werden der Name und das Logo MoMo <strong>in</strong> momodo.de geändert.<br />
momodo.de wird sich stärker an Unterrichtsthemen orientieren.<br />
Unsere Zielgruppe und Zielsetzung verlagert sich. Die jeweiligen Seiten s<strong>in</strong>d für den E<strong>in</strong>-<br />
satz im Unterricht konzipiert und orientieren sich stärker als bisher an den Bedürfnissen der<br />
Unterrichtenden, weniger am Freizeitbereich. Bei der Auswahl und Gestaltung der Inhalte<br />
werden wir uns stärker auf die Altersgruppe der 10 -13-Jährigen (also ungefähr Klassenstufe<br />
4-6) konzentrieren, weil dort auch unsere eigenen Unterrichtsschwerpunkte liegen. Bei ent-<br />
sprechender Mitarbeit weiterer Kollegen ließe sich das allerd<strong>in</strong>gs auch wieder erweitern.<br />
momodo.de wird also <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Unterrichtsthemen der 4.-6. Klasse aufgreifen (z.B. Ber-<br />
l<strong>in</strong>, öffentliche Verkehrsmittel, Klassenfahrt, Ägypten, Griechenland, Römer, etc.). Die Orien-<br />
tierung erfolgt am Berl<strong>in</strong>er Rahmenplan, wobei jedoch durchaus weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e fächerüber-<br />
greifende Sicht Vorrang haben soll<br />
Bei momodo.de wird der Service-Gedanke im Vordergrund stehen. Die Inhalte <strong>in</strong><br />
momodo.de werden weniger von uns redaktionell aufgearbeitet und <strong>in</strong>teraktiv angelegt se<strong>in</strong>.<br />
In Anlehnung an die Schulvision-Idee wird es vor allem ausgewählte L<strong>in</strong>ks auf bereits vorhan-<br />
dene Internet-Angebote, konkrete Unterrichtsmaterialien (z.B. Arbeitsbögen) zum Download,<br />
Literatursammlungen, Museumsadressen etc. geben.
momodo.de wird e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fachere und schlich-<br />
tere, aber offenere Webseitengestaltung erhalten.<br />
Was auf den ersten Blick als Nachteil ersche<strong>in</strong>t,<br />
eröffnet andererseits neue Möglichkeiten und<br />
Chancen h<strong>in</strong>sichtlich des Inhalts. Waren bisher<br />
die Monatsthemen von Inhalt und Layout <strong>in</strong> sich<br />
abgeschlossen, so wird zukünftig für momodo.de<br />
e<strong>in</strong> offeneres Modell präferiert. Damit sollen die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Themen besser erweiterbar werden und<br />
die offenere Struktur mehr Assoziationen zulassen.<br />
Dies bedeutet auch, dass es (bis auf Ausnahmen)<br />
ke<strong>in</strong> aktuelles Hauptthema geben wird, sondern<br />
alle angebotenen Themen <strong>in</strong> durchaus sehr unterschiedlicher Art <strong>in</strong> Bezug auf Form, Inhalt<br />
und Umfang nebene<strong>in</strong>ander <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em sich ständig wandelnden Prozess stehen.<br />
momodo.de wird um die Zielgruppe Lehrer erweitert.<br />
Die bisher auf SchulVision ausgelagerten Infos, Tipps und Materialien für Lehrer zu den Mo-<br />
Mo-Themen sollen nun <strong>in</strong> die Webpräsenz momodo.de <strong>in</strong>tegriert werden. Dies befördert den<br />
bereits erläuterten Service-Gedanken und gibt andererseits Lehrern wie Schülern die Möglich-<br />
keit e<strong>in</strong>es offeneren Umgangs mit dem angebotenen Material, das heißt, dass sich Chancen<br />
für selbstgesteuertes Lernen eröffnen.<br />
73
74<br />
Co-Teach<strong>in</strong>g - Unterrichtsbegleitung als Angebot im Rahmen der<br />
Lehrerfortbildung<br />
Brigitte Meier<br />
Vorbemerkung<br />
Im Laufe des zweiten Projektjahres ForMelG hatten sich mehrere Kollegen <strong>in</strong> Bezug auf die<br />
Handhabung der neuen Medien fortgebildet, Workshops zu unterrichtsrelevanten Themen<br />
lagen h<strong>in</strong>ter uns, nun brauchte „nur“ noch die Umsetzung <strong>in</strong> die Praxis zu erfolgen. Es tat<br />
sich aber wenig, der Computerraum blieb weitgehend ungenutzt, bis auf e<strong>in</strong>ige Ausnahmen<br />
gab es auch <strong>in</strong> den Medienecken der Klassenräume kaum Anzeichen e<strong>in</strong>er verstärkten E<strong>in</strong>be-<br />
ziehung des Computers <strong>in</strong> die tägliche Arbeit. Wie kam das? Auch wenn sich viele Kollegen<br />
<strong>in</strong>zwischen recht fit fühlten und Unterrichtsvorbereitungen, Recherche etc. mit dem Computer<br />
durchführen konnten, der Schritt, das neu Erlernte auch mit Schülern auszuprobieren, er-<br />
schien den meisten zu gewagt.<br />
Auf Nachfrage wurden folgende Ängste und Vorbehalte immer wieder genannt:<br />
• dass irgendwelche technischen Pannen mit den Geräten auftreten könnten,<br />
• dass die Programme, die ja bekanntlich e<strong>in</strong> undurchsichtiges Eigenleben haben, nicht das<br />
tun, was man von ihnen erwartete,<br />
• dass Schüler Fragen zum Programm stellten, die man nicht beantworten könnte,<br />
• dass bei e<strong>in</strong>er Klassenstärke von durchschnittlich 25 Schülern und ke<strong>in</strong>er Teilungsstunde die<br />
Arbeit im Computerraum (zehn Rechner) schlichtweg nicht organisierbar wäre.<br />
Die Möglichkeit, dass sich Kollegen Hilfe bei aktuellen Problemen holen konnten (sup-<br />
port on demand - e<strong>in</strong> bis zwei Stunden mittags zu festgelegten Term<strong>in</strong>en), existierte bereits,<br />
diese Unterstützung wurde nun angesichts der oben genannten Vorbehalte e<strong>in</strong>iger Kollegen<br />
ausgeweitet auf e<strong>in</strong>e Begleitung im computergestützten Unterricht. Unterrichtsbegleitung /Co-<br />
Teach<strong>in</strong>g ist die Form der Fortbildung, die am besten auf die <strong>in</strong>dividuellen Gegebenheiten der<br />
begleiteten Kollegen e<strong>in</strong>gehen kann. Durch die Anwesenheit des „Experten“ vor Ort können<br />
nicht nur Kompetenzen erweitert werden, sondern es kann auch Vertrauen <strong>in</strong> die eigenen Fä-<br />
higkeiten vermittelt werden.<br />
Organisation / Planung<br />
Die Kollegen haben e<strong>in</strong> Unterrichtsvorhaben im Auge, bereits geplant, schon begonnen. Für<br />
e<strong>in</strong>e konkrete Situation wird der E<strong>in</strong>satz des Computers erwogen. Abhängig von stunden-<br />
plantechnischen Gegebenheiten kann die Unterrichtsbegleitung angefragt werden. In e<strong>in</strong>em<br />
Vorgespräch wird das Thema kurz skizziert und die Unterrichtssituation benannt, <strong>in</strong> der e<strong>in</strong>e<br />
Unterstützung wünschenswert wäre. S<strong>in</strong>d Zeit und Dauer festgelegt (es gab Unterrichtsbeglei-<br />
tungen von nur e<strong>in</strong>er Stunde bis h<strong>in</strong> zu regelmäßiger Kooperation von bis zu zehn Stunden<br />
bei Projekten), wird detailliert geplant. Der Schwerpunkt der Begleitung wird verabredet, dies<br />
könnte z. B. se<strong>in</strong>:<br />
Planungshilfe:<br />
• was ist <strong>in</strong> der <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Zeit realisierbar?<br />
• welche Voraussetzungen müssen die Schüler erfüllen?
• wie können arbeitsteilige Aufgaben gestellt werden, dass möglichst viele Schüler effektiv am<br />
Computer arbeiten können?<br />
organisatorische Hilfe:<br />
• zum Beispiel beim Anmelden der Gruppe am Server), bei der Bereitstellung des Arbeitsmate-<br />
rials,<br />
•Ad-hoc-E<strong>in</strong>greifen bei Hardware oder Softwareproblemen, sonst nur als „Versicherung“ im<br />
H<strong>in</strong>tergrund,<br />
• E<strong>in</strong>weisung der Schüler <strong>in</strong> bestimmte Programmdetails bei Unsicherheiten der verantwortli-<br />
chen Lehrkraft,<br />
• als gleichberechtigter Ansprechpartner für die Schüler neben dem verantwortlichen Lehrer<br />
<strong>zur</strong> Verfügung stehen<br />
• Unterstützung bei bisher ungewohnten Methoden <strong>neuer</strong> Lehr-/Lernformen,<br />
• konkrete Beobachtungsaufgaben und Dokumentation <strong>in</strong> Bezug auf das Lernverhalten der<br />
Schüler,<br />
• Beobachtung und Dokumentation zu vorher festgelegten Fragen <strong>in</strong> Bezug auf Lehrerverhal-<br />
ten /Lehreräußerungen.<br />
Durchführung<br />
Die Unterrichtsbegleitung sieht je nach verabredetem Schwerpunkt unterschiedlich aus. Der<br />
Schwerpunkt wiederum ist abhängig von<br />
• der Medienhandhabungskompetenz des Lehrers<br />
• dem methodischen Sett<strong>in</strong>g<br />
• den Unterrichtszielen des jeweiligen Vorhabens<br />
• den situativen Gegebenheiten.<br />
Bei Begleitungen über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum konnte ich beobachten, dass Kollegen bei<br />
der Unterrichtsarbeit mit den neuen Medien verschiedene Phasen durchlaufen, vom Rezipie-<br />
ren und Mitlernen, über e<strong>in</strong> Assistieren h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em selbstverständlichen und selbstbewussten<br />
Arrangieren der Lernsituation.<br />
Wichtig und für die Begleitung fruchtbar erweist sich e<strong>in</strong> gegenseitiges Vertrauensverhält-<br />
nis. Der begleitete Kollege soll e<strong>in</strong>e Unterstützung bekommen, es handelt sich nicht um e<strong>in</strong>e<br />
Kontrolle oder Beurteilung se<strong>in</strong>es Unterrichts. Das erklärte Ziel der Begleitung ist es, Unsi-<br />
cherheiten abbauen zu helfen und die Kollegen zu bestärken, den begonnenen Weg <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en<br />
Schritten weiter zu gehen. E<strong>in</strong> Protokoll der begleiteten Stunde ist auf jeden Fall s<strong>in</strong>nvoll. Das<br />
Unterrichten im Team bietet Chancen, die Perspektive zu wechseln, Lehrerhandeln als Beob-<br />
achter wahrzunehmen. Die Prozesse und Ergebnisse des Unterrichts werden geme<strong>in</strong>sam reflek-<br />
tiert. Nach der Begleitung sollte e<strong>in</strong>e ausführliche Besprechung möglichst zeitnah stattf<strong>in</strong>den.<br />
Dies ist wahrsche<strong>in</strong>lich der wichtigste Teil der Begleitung, weil hier nicht nur auf die Probleme<br />
oder Highlights der Computernutzung e<strong>in</strong>gegangen wird, sondern im Dialog auch grundle-<br />
gende didaktische Fragen diskutiert werden können. Dieses Feedbackgespräch be<strong>in</strong>haltet e<strong>in</strong><br />
Nachdenken über den eigenen Unterricht, die Lehrerrolle und das Lernverhalten der Schüler.<br />
Es ist nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Klima des Vertrauens möglich und kann langfristig zu e<strong>in</strong>er Qualitätsver-<br />
besserung des Unterrichts führen.<br />
75
76<br />
Fazit<br />
In H<strong>in</strong>blick auf die SEMIK-Projektziele<br />
• Neue Lernkultur<br />
• Medienkompetenz<br />
• Problemorientierung<br />
• Schulentwicklung<br />
• Nachhaltigkeit<br />
ist Co-Teach<strong>in</strong>g als die ideale Fortbildungsform anzusehen.<br />
Die Erkenntnisse <strong>neuer</strong>er Lerntheorien werden explizit bewusst gemacht. Co-Teachimg<br />
anbieten, das heißt Lernen begleiten und Lernen bewusst erfahrbar machen. Der Fortbildner<br />
agiert als Anbieter von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, nicht als Übermittler von Wis-<br />
sen, das sich die Teilnehmer vielmehr selbstständig aneignen. Die Kollegen erfahren, dass ge-<br />
rade beim E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien e<strong>in</strong>heitliche Lernzielvorstellungen und konventionelle didak-<br />
tisch-methodische Handlungsmuster nicht möglich s<strong>in</strong>d, dass veränderte Methoden, offenere<br />
Unterrichtsformen - wie Lernen an Stationen, Werkstattunterricht, projektartiges Arbeiten im<br />
fächerübergreifenden Zusammenhang - die Gebote der Stunde s<strong>in</strong>d. Hier entwickelt sich neue<br />
Lernkultur ebenso wie <strong>in</strong> dem sozialen Mite<strong>in</strong>ander Schüler-Schüler und Lehrer-Schüler. Wie<br />
gern geben medienkompetente Schüler ihr Wissen an ihre Mitschüler aber auch an den Lehrer<br />
weiter.<br />
Gerade weil Medienkompetenz nicht isoliert als Medienhandhabungskompetenz betrach-<br />
tet wird, sondern im breiteren Spektrum der Medienbewertung, Medienpädagogik und<br />
Mediendidaktik angesiedelt wird, entfaltet Co-Teach<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e so unmittelbare Wirkung auf<br />
die tägliche Unterrichtspraxis. Die Kollegen erhalten dar<strong>in</strong> Unterstützung, Medienangebote<br />
auszuwählen und zu nutzen sowie Medienprodukte selbst zu gestalten und zu verbreiten. Die<br />
Präsentation der Arbeitsergebnisse <strong>in</strong> den Schulfluren oder an anderer Stelle wirkt sich moti-<br />
vationsfördernd aus.<br />
Die durch Co-Teach<strong>in</strong>g begleiteten Kollegen lernen s<strong>in</strong>nhaft <strong>in</strong> der Ause<strong>in</strong>andersetzung mit<br />
authentischen Problemen und bedeutsamen Inhalten, nämlich an dem für sie aktuellen Unter-<br />
richt ihrer jeweiligen Lerngruppe. Das Wissen wird somit kontextbezogen erworben und kann<br />
sofort <strong>in</strong> der realen Situation angewendet werden.<br />
Die beim Co-Teach<strong>in</strong>g entstehende Dialogbereitschaft, die Kooperationswilligkeit der<br />
Lehrer s<strong>in</strong>d bereits Indikatoren für e<strong>in</strong>e Veränderung gewohnter Bahnen. Die für die Weiter-<br />
entwicklung notwendige Reflexion der Unterrichtsarbeit f<strong>in</strong>det statt. Kollegen überdenken<br />
ihre Lehrerolle, Grenzen zwischen Lehrenden und Lernenden werden fließend. Die Angst<br />
vor „E<strong>in</strong>mischung“ <strong>in</strong> den Unterricht verschw<strong>in</strong>det. Ganz e<strong>in</strong>deutig f<strong>in</strong>det Schulentwicklung<br />
statt, <strong>in</strong>dem sich immer mehr Kollegen, ermutigt durch die Unterstützung „vor Ort“ und die<br />
damit verbundene tiefere E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gung <strong>in</strong> den Themenkomplex „Neues Lernen mit Medien“<br />
Gedanken über e<strong>in</strong> Medienkonzept der Schule machen, das letztlich im Schulprogramm e<strong>in</strong>e<br />
Verankerung f<strong>in</strong>den wird.<br />
Von entscheidender Bedeutung für den Aspekt der Schulentwicklung ist die Rolle der<br />
Schulleitung. Auch unter der Maßgabe s<strong>in</strong>kender personeller und f<strong>in</strong>anzieller Mittel sollte die<br />
Bereitschaft vorhanden se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>en Stundenpool für das Teamteach<strong>in</strong>g im Computerbereich<br />
aufecht zu erhalten. Das Problem der F<strong>in</strong>anzierbarkeit e<strong>in</strong>er solchen „Fortbildung de luxe“<br />
(siehe die Bertelsmann-Studie) wird gesehen, kann an dieser Stelle aber nicht gelöst werden.
Kollegen, die durch Co-Teach<strong>in</strong>g ermutigt werden, ihre eigenen Stärken feststellen und weiter<br />
ausbauen, die die neuen Medien als Werkzeuge selbstverständlicher e<strong>in</strong>setzen und <strong>in</strong> ihren<br />
Klassen neue Lernmethoden sukzessive praktizieren, werden dies nicht nur während der<br />
Projektlaufzeit tun, sondern darüber h<strong>in</strong>aus. Sie gew<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>e langfristige Stärkung ihres<br />
Selbstvertrauens im Umgang mit den neuen Medien. Insofern ist e<strong>in</strong>e Nachhaltigkeit der Fort-<br />
bildungsarbeit gewährleistet.<br />
Ausblick<br />
Nach e<strong>in</strong>em guten Jahr Co-Teach<strong>in</strong>g zeigt sich: Die bereits begleiteten Kollegen fühlen sich<br />
zunehmend sicherer und kompetenter. Viele gehen mittlerweile mit Gruppen alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> den<br />
Computerraum, andere setzen selbstverständlicher den Klassencomputer für die tägliche<br />
Arbeit e<strong>in</strong>. Innerhalb der letzten Monate hat e<strong>in</strong> regelrechter „Run“ auf den Computerraum<br />
e<strong>in</strong>gesetzt, kaum hängt der Plan für die folgende Woche aus, tragen sich Kollegen e<strong>in</strong>, um sich<br />
ihre Wunschstunden zu sichern.<br />
Auf der CD-Rom: PowerPo<strong>in</strong>t-Präsentation <strong>Fortbildungskonzept</strong>e im Projekt<br />
ForMeL G: Co-Teach<strong>in</strong>g - Brigitte Meier<br />
77
78<br />
Die NetzWerkstatt oder wie Kollegen überregional mite<strong>in</strong>ander vernetzt<br />
werden<br />
Doris Lerner<br />
Idee<br />
Geboren wurde die Idee der NetzWerkstatt im Gespräch mit den Kollegen des NetzWerkstatt-<br />
Teams während der Präsentation des SEMIK-Projekts ForMeL G beim Forum-Bildung.<br />
Wir stellten Überlegungen an, wie es gel<strong>in</strong>gen könne, ForMeL G und die damit verbundenen<br />
Ziele <strong>in</strong> die Breite und Weite der Berl<strong>in</strong>er Schullandschaft zu tragen. Wir wollen Kollegen mit-<br />
e<strong>in</strong>ander vernetzen, die Interesse an e<strong>in</strong>em regelmäßigen Austausch darüber haben, wie neue<br />
Medien s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> den Unterrichtsalltag <strong>in</strong>tegriert werden können.<br />
Grundgedanken<br />
• Welche Voraussetzungen müssen <strong>in</strong> Schule und Klassenraum geschaffen werden, damit neue<br />
Medien s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> den Schulalltag <strong>in</strong>tegriert werden können?<br />
• Welche Auswirkungen und Konsequenzen hat die Integration der neuen Medien auf den<br />
Unterricht?<br />
• Wie verändert sich das Verhältnis zwischen Lehrer<strong>in</strong>nen und Schüler<strong>in</strong>nen?<br />
• Wie verändert sich Lernen durch neue Medien – verändert es sich überhaupt?<br />
Diese wesentlichen Überlegungen werden - unabhängig vom gewählten Inhaltsschwerpunkt<br />
der e<strong>in</strong>zelnen NetzWerkstatt - stets mitgedacht und thematisiert.<br />
Grundlegender Kerngedanke der NetzWerkstatt ist e<strong>in</strong> gegenseitiges Geben und Nehmen. Das<br />
bedeutet, dass die NetzWerkstatt zwar von e<strong>in</strong>em Team organisiert und moderiert wird, dass<br />
sich aber alle Teilnehmer für e<strong>in</strong>e erfolgreiche <strong>in</strong>haltliche Arbeit mit verantwortlich fühlen<br />
und ihre Erfahrungen <strong>zur</strong> Verfügung stellen.<br />
Während der e<strong>in</strong>zelnen Treffen wird möglichst so praxisnah diskutiert und praktisch ge-<br />
arbeitet, dass die Teilnehmer konkrete Ideen und Anregungen mitnehmen, die sie <strong>in</strong> ihren<br />
Unterricht <strong>in</strong>tegrieren können. In jeder NetzWerkstatt werden ca. 20 bis 30 M<strong>in</strong>uten e<strong>in</strong>ge-<br />
plant, <strong>in</strong> denen unabhängig vom thematischen Schwerpunkt des Nachmittags Highlights und<br />
Stolperste<strong>in</strong>e aus der Unterrichtsarbeit mit neuen Medien ausgetauscht werden. In dieser Zeit<br />
können die Teilnehmer aktuelle Fragen und Probleme loswerden und Gelungenes verbreiten.<br />
Voraussetzungen<br />
Das bereits am Landes<strong>in</strong>stitut für Schule und Medien (LISUM) angesiedelte CFN-G (Compu-<br />
terfortbildungsnetzwerk Grundschule) wollten wir nutzen, um die Leitziele unseres Projekts<br />
<strong>in</strong> die Breite zu tragen. Mit Bezug auf die Ziele des BLK–Projekts sollte die personelle Verzah-<br />
nung e<strong>in</strong>e nachhaltige Kooperation der Projektschulen und der assoziierten Schulen befördern<br />
helfen. Die Möglichkeit bestehende Strukturen zu nutzen bot sich, weil die Kolleg<strong>in</strong>, die bis<br />
zu diesem Zeitpunkt die Organisation des CFN-G <strong>in</strong>nehatte, ihre Arbeit wegen anderer Auf-<br />
gaben nicht fortsetzen konnte.
Vorüberlegungen<br />
Wir wollten die sich bietende Chance ergreifen, um unsere Projektziele <strong>in</strong> die Breite zu tragen<br />
und andererseits den Kollegen, die an den Treffens des CFN-G bis zu diesem Zeitpunkt teil-<br />
genommen hatten – sich also bereits für die Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Schulalltag <strong>in</strong>-<br />
teressieren - , e<strong>in</strong> Angebot machen, sich weiter zu professionalisieren. Um unsere Projektziele<br />
bereits mit dem ‚Fortbildungsdesign’ zu transportieren, sollten die Veranstaltungen ke<strong>in</strong>en Sit-<br />
zungscharakter haben. Bereits mit dem Titel NetzWerkstatt wollten wir unsere Fortbildungs-<br />
bzw. Veranstaltungsphilosophie nach außen transportieren - auch wenn der Titel bei Compu-<br />
terfreaks, die sich eher mit der Systemadm<strong>in</strong>istration befassen, andere Assoziationen wecken<br />
könnte. Im Vorfeld waren e<strong>in</strong>ige Fragen zu klären, um den Wechsel des Moderatoren-Teams<br />
zum Anlass zu nehmen, unsere Grundideen <strong>in</strong> der ersten Veranstaltung zu transportieren und<br />
e<strong>in</strong>en soliden Grundste<strong>in</strong> für Folgetreffen zu legen:<br />
• Wie holt man Fortbildungs<strong>in</strong>teressierte <strong>in</strong>s Boot?<br />
• Wie kann man die Treffen der Netz-Werkstatt so effektiv gestalten, dass die Teilnehmer, die<br />
aus allen Bezirken Berl<strong>in</strong>s kommen und teilweise weite Wege zum Veranstaltungsort <strong>in</strong> Kauf<br />
nehmen, diesen Aufwand als gerechtfertigt ansehen und für sich als nutzbr<strong>in</strong>gend empf<strong>in</strong>-<br />
den?<br />
• Welche Möglichkeiten der Information können <strong>zur</strong> Verfügung gestellt werden, damit Inter-<br />
essierte nicht ausschließlich auf die Treffen der NetzWerkstatt angewiesen s<strong>in</strong>d?<br />
Ziel ist die Implementierung e<strong>in</strong>es personalen Netzwerks, das allen Interessierten e<strong>in</strong>en an-<br />
regenden Erfahrungsaustausch ermöglicht und e<strong>in</strong> Lernen von– und mite<strong>in</strong>ander unterstützt.<br />
Voraussetzung dafür s<strong>in</strong>d regelmäßige NetzWerkstatt-Treffen (ca. sechs pro Schuljahr), die<br />
<strong>in</strong>haltlich durch bedürfnisorientierte Angebote geprägt s<strong>in</strong>d.<br />
Kommunikations–Plattform<br />
Alls Kommunikations-Plattform dient – neben der Info–Theke des Projekts ForMeL G <strong>in</strong><br />
BSCW – die NetzWerkstatt–Seite auf Schulvision (www.schulvision.de). Dort s<strong>in</strong>d aktuelle<br />
Term<strong>in</strong>e abrufbar, f<strong>in</strong>den sich Materialien der Werkstatt-Treffen, können Ideen und Anregun-<br />
gen formuliert, NetzWerkstatt-Treffen nachbereitet werden. Parallel dazu wurde e<strong>in</strong> Gruppen-<br />
raum bei lo-net eröffnet, der mit e<strong>in</strong>em Forum den Austausch der Beteiligten untere<strong>in</strong>ander<br />
Gang setzen und vertiefen könnte. Auch auf der Webseite des Projekts FormeL G gibt es e<strong>in</strong><br />
Informationsangebote für die NetzWerkstatt.<br />
E<strong>in</strong>ladungen<br />
E<strong>in</strong>ladungen zu den NetzWerkstatt-Treffen werden parallel zu den Term<strong>in</strong>planungen, die on-<br />
l<strong>in</strong>e abrufbar s<strong>in</strong>d, auch per E–Mail versandt. E<strong>in</strong>geladen s<strong>in</strong>d alle Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen<br />
der Berl<strong>in</strong>er Grundschulen, die an der aktiven Teilhabe <strong>in</strong>teressiert s<strong>in</strong>d (Stichwort: mentale<br />
Netzwerke...). Teilnahme bzw. Nicht–Teilnahme sollen aber vorab per E-Mail rückgemeldet<br />
werden, damit bekannt ist, für wie viele Teilnehmer die jeweilige NetzWerkstatt geplant wird.<br />
E<strong>in</strong>e erste Kontaktaufnahme zum NetzWerk-Team ist über Schulvision oder die Webseite des<br />
Projekts ForMeL G möglich. Die Term<strong>in</strong>e der NetzWerkstatt-Treffen werden langfristig ge-<br />
plant, thematische Schwerpunkte e<strong>in</strong>zelner Treffen werden möglichst früh vere<strong>in</strong>bart, damit<br />
79
80<br />
jeder – se<strong>in</strong>en Interessen entsprechend – Term<strong>in</strong>e planen, wahrnehmen oder auch bewusst auf<br />
e<strong>in</strong>e Teilnahme verzichten kann, wenn das Thema nicht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Fokus liegt.<br />
Die 1. NetzWerkstatt Anfang 2002<br />
Bei der ersten Veranstaltung wollten wir den Kollegen zum e<strong>in</strong>en Ausschnitte unserer Pro-<br />
jektarbeit näher br<strong>in</strong>gen und ihnen gleichzeitig Anregungen für ihren Unterricht geben. Des-<br />
halb stellten wir ihnen mit „Schulvision“ (www.schulvision.de - für Lehrer) und „Momodo“<br />
(www.momodo.de - für Schüler) Internetangebote vor, die von Thomas Kahlki und Frieder<br />
Klapp entwickelt wurden und betreut werden. Auf der anderen Seite wollten wir uns e<strong>in</strong>en<br />
Überblick über die Teilnehmer und deren Interessen verschaffen, um zukünftige NetzWerk-<br />
stätten teilnehmer- und bedarfsorientiert planen zu können. Deshalb war die erste Veranstal-<br />
tung dreigeteilt. Die Teilnehmer stellten sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Kennenlernrunde kurz vor und bekamen<br />
dann mit der Vorstellung von Momodo und Schulvision erste Unterrichtsanregungen.<br />
In sich daran anschließenden <strong>in</strong>tensiven Gruppengesprächen klärten die Anwesenden ihre<br />
<strong>zur</strong> Erwartungen und Bedürfnissen an zukünftige NetzWerkstatt-Treffen. Dabei wurde e<strong>in</strong><br />
sehr breites Interessensspektrum deutlich. Anregungen für die <strong>Entwicklung</strong> von schulischen<br />
Medienkonzepten standen ebenso auf der Wunschliste wie ganz konkrete Anregungen für den<br />
Unterricht <strong>in</strong> verschiedenen Lernbereichen und Fächern unter Berücksichtigung der Integrati-<br />
on <strong>neuer</strong> Medien.<br />
Themen der bisherigen NetzWerkstatt-Treffen<br />
• www.schulvision.de und www.momodo.de - Erwartungen an die NetzWerkstatt<br />
• Tipps und Tricks für Schreibvorhaben am und mit dem Computer<br />
• Die 5.G Mitte präsentiert ihr Medienkonzept<br />
• Unterrichtsideen rund um die Digitalfotografie<br />
• Chancen e<strong>in</strong>es mobilen Klassenzimmers / virtuelle Gruppen- und Klassenräume bei lo-net<br />
Geplante Themen<br />
• Videobearbeitung mit iMovie;<br />
• Schüler und Lehrer präsentieren ihre Arbeitsergebnisse;<br />
• Lernsoftware<br />
• Unterrichtsmaterialien im Internet<br />
Zwischenbilanz nach e<strong>in</strong>em Jahr NetzWerkstatt<br />
Anmeldekultur<br />
Die Erfahrung nach e<strong>in</strong>em Jahr NetzWerkstatt hat gezeigt, dass es e<strong>in</strong>en langen Atem erfor-<br />
dert, e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>e-Form der Anmelde- und Rückmeldekultur zu etablieren. Will man aber den<br />
selbstverständlichen Umgang mit neuen Medien nicht nur bei Schülern etablieren, lohnt sich<br />
die Mühe. Wenn die onl<strong>in</strong>e-Anmeldung erst e<strong>in</strong>mal funktioniert, erleichtert sie langfristig Pla-<br />
nungs- und Organisationsprozesse. Deshalb macht es S<strong>in</strong>n, die Beteiligten immer wieder an<br />
die Onl<strong>in</strong>e-Anmeldung zu er<strong>in</strong>nern.<br />
Onl<strong>in</strong>e-Angebote
Websites müssen regelmäßig gepflegt, Foren kont<strong>in</strong>uierlich moderiert werden, damit sie von<br />
den Teilnehmern als nutzbr<strong>in</strong>gend empfunden werden und sie regelmäßig nachsehen, ob sich<br />
etwas getan hat. Wer Onl<strong>in</strong>e-Angebote nutzt und merkt, dass sich bei mehreren Besuchen der<br />
jeweiligen Plattform nichts getan hat, gibt über kurz oder lang auf und widmet se<strong>in</strong> Interesse<br />
anderen Seiten.<br />
Teilnehmer<br />
Die Beteiligung an den e<strong>in</strong>zelnen Treffen war unterschiedlich. Im Durchschnitt kamen etwa<br />
15 Kollegen zusammen. Nach e<strong>in</strong>igen Veranstaltungen kristallisierte sich e<strong>in</strong>e Kerngruppe von<br />
acht Kollegen heraus, die regelmäßig an der NetzWerkstatt teilnehmen, die anderen Teilneh-<br />
mer wechseln, suchen sich die Veranstaltungen nach ihren Interessen heraus.<br />
Aktive Teilhabe aller Interessierten<br />
Es ist s<strong>in</strong>nvoll die Interessierten an den Inhalten, aber auch an der Organisation bewusst zu<br />
beteiligen. Man hat dadurch die Chance, unterschiedliche Schulen mit ihren Computerräu-<br />
men, Medienecken und -konzepten kennen zu lernen. Inhaltlich haben viele Kollegen bei ihrer<br />
Arbeit mit neuen Medien im Unterricht auf verschiedenen Gebieten vielfältige und <strong>in</strong>teressan-<br />
te Erfahrungen gemacht, von denen die anderen profitieren können.<br />
Instruktion – Konstruktion<br />
Wichtig ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong> ausgewogenes Verhältnis von fachdidaktischen Impulsen - um Gedan-<br />
ken über verändertes Lernen mit (und ohne) neue Medien zu transportieren - und Phasen des<br />
praktischen Tuns, <strong>in</strong> denen die Teilnehmer ihre eigene Medienhandhabungskompetenz erwei-<br />
tern können. Ehrlicherweise muss zugegeben werden, dass pädagogische und fachdidaktische<br />
Fragestellungen häufig zu kurz kamen, da die Teilnehmer oft erst technische und organisatori-<br />
sche Fragestellungen geklärt haben wollten.<br />
Regelmäßigkeit<br />
Regelmäßige Treffen s<strong>in</strong>d Voraussetzung für e<strong>in</strong>en kont<strong>in</strong>uierlichen Austausch und helfen,<br />
mentale Netze zwischen den Kollegen – auch über die NetzWerkstatt h<strong>in</strong>aus – zu knüpfen.<br />
Stets ist zu beobachten, dass e<strong>in</strong>zelne Kollegen sich zu e<strong>in</strong>em weiterführenden Austausch ver-<br />
abreden.<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
Mehr als e<strong>in</strong> <strong>in</strong>haltlicher Schwerpunkt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er NetzWerkstatt ist ungünstig, weil dann e<strong>in</strong>fach<br />
nicht genug Zeit bleibt, sich zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong>tensiv mit dem Inhalt ause<strong>in</strong>ander zu setzen. E<strong>in</strong> zu<br />
oberflächliches Anreißen e<strong>in</strong>es möglichen Unterrichts<strong>in</strong>halts br<strong>in</strong>gt kaum Impulse für verän-<br />
derten Unterricht, da sich die Fragen meist auf technische Aspekte beschränken und die trans-<br />
portierten <strong>in</strong>haltlichen Fragestellungen zu kurz kommen.<br />
Es geht nicht darum, was man mit neuen Medien im Unterricht alles machen könnte. Es<br />
geht darum zu klären:<br />
• welche Ziele mit dem Vorhaben verbunden s<strong>in</strong>d,<br />
• welchen Lernertrag das Vorhaben br<strong>in</strong>gt,<br />
81
82<br />
• was mehr oder anders durch den E<strong>in</strong>satz der neuen Medien <strong>in</strong> diesem Vorhaben gelernt<br />
wird,<br />
• <strong>in</strong> welchen Bereichen die Lernkompetenz der Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler gefördert wird.<br />
Dafür braucht man e<strong>in</strong>fach Zeit für Ause<strong>in</strong>andersetzung und Diskussion.
9 Fortbildungsdokumentationen<br />
9.1 Kurse<br />
Fortbildungskurs „Computer <strong>in</strong> der Schule - was nun?“<br />
Thomas Kahlki<br />
1. Allgeme<strong>in</strong>e Angaben<br />
Fortbildungsthema Computer <strong>in</strong> der Schule – was nun?<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> Möglichkeiten des E<strong>in</strong>satzes von Computern und Internet als Werkzeug im<br />
Unterricht<br />
Kursniveau Anfänger Datum 10.5.2000 – 7.6.2000<br />
Teilnehmerzahl 10 Zeitansatz 10 Unterrichtsstunden<br />
(verteilt auf 5 Term<strong>in</strong>e)<br />
Fortbildner Thomas Kahlki E-Mail Thomas.kahlki@l<strong>in</strong>dgrengs<br />
chule.de<br />
Schule/E<strong>in</strong>richtung Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule URL http://www.b.shuttle.de/b/<br />
l<strong>in</strong>dgrengs<br />
E<strong>in</strong>gesetzte Medien Computer mit Internet-Anschluss, verschiedene Arbeitspapiere, Bildschirmpräsentation/<br />
Computer, Lernsoftware-CD-Roms<br />
Techn. Ausstattung Computerraum mit stationären und mobilen Geräten für jeden Teilnehmer<br />
2. Lernziele<br />
Fachlich/Didaktisch • Die Teilnehmer kennen drei mögliche Bereiche des Computere<strong>in</strong>satzes <strong>in</strong> der<br />
Schule (Computerarbeit mit Lernsoftware, Computer/Internet als Werkzeug <strong>zur</strong><br />
Materialerstellung/Unterrichtsvorbereitung, Computer/Internet als Werkzeug für<br />
Lehrer und Schüler im Unterricht) und ausgewählte Beispiele dafür.<br />
• Die Teilnehmer erlernen die benötigten Basisfähigkeiten im Umgang mit Computern<br />
und WWW, um die vorbereiteten Beispiele für den Unterrichtse<strong>in</strong>satz oder<br />
<strong>zur</strong> Unterrichtsvorbereitung weitgehend selbständig erkunden und bearbeiten zu<br />
können.<br />
• Die TN entwickeln erste eigene Ideen, wie sie <strong>in</strong> ihrem eigenen Unterricht Lernsoftware<br />
e<strong>in</strong>setzen können, Computer und Internet <strong>zur</strong> Vorbereitung nutzen und<br />
Computer und Internet als Schülerwerkzeug im Unterricht e<strong>in</strong>setzen können.<br />
Methodisch • methodisch: Die Teilnehmer kennen Möglichkeiten Unterrichts<strong>in</strong>halte so vorzubereiten,<br />
dass Schüler diese mit Computern und Internet selbständig bearbeiten<br />
können.<br />
• medienpädagogisch: Die Teilnehmer begreifen Computer und Internet nicht als<br />
Unterrichtsgegenstand, sondern als Werkzeug (also gewissermaßen eben nicht<br />
medienpädagogisch).<br />
Sozialkompetenz • Die Teilnehmer kennen Möglichkeiten <strong>zur</strong> kooperativen Gestaltung der Arbeit<br />
am Computer (auch: methodisch)<br />
• Die Teilnehmer können mit eigenen Ängsten und Unsicherheiten im Umgang mit<br />
Computern und Internet produktiv umgehen.<br />
3. Ablauf<br />
3.1 E<strong>in</strong>bettung der Fortbildungssitzung <strong>in</strong> die Gesamtplanung<br />
Zeit Inhalte Anwendungsbereich<br />
1. Block:<br />
(ca. 2 Unterrichtsstunden)<br />
Drei mögliche Bereiche des E<strong>in</strong>satzes von Computern und Internet<br />
werden erläutert:<br />
- Lernsoftware<br />
- Materialerstellung/Unterrichtsvorbereitung durch Lehrer und Schüler<br />
- Computer als Werkzeug im Unterricht<br />
Der Schwerpunkt des ersten Blocks liegt auf dem Kennenlernen,<br />
Erkunden, Ausprobieren von verschiedener Lernsoftware (Beispiele:<br />
Blitzrechnen, Mit Alex auf Reisen: Deutschland, Löwenzahn, Kuck mal,<br />
Kunst)<br />
Unterricht oder Unterrichtsvorbereitung<br />
83
84<br />
2. Block:<br />
ca. 2 U-Std.<br />
Materialerstellung/Unterrichtsvorbereitung:<br />
Herstellen und Gestalten von Wortsuchrätseln für verschiedene Unterrichtszwecke<br />
mit den Programmen WordF<strong>in</strong>d und AppleWorks<br />
3. Block: ca. 2 U-Std. Von der Unterrichtsvorbereitung zum Werkzeug im Unterricht:<br />
Möglichkeiten zum E<strong>in</strong>satz des Computers im Rechtschreibunterricht<br />
und <strong>zur</strong> Diktatvorbereitung werden anhand der Programme Diktattra<strong>in</strong>er,<br />
Diktafon, und AppleWorks (hier <strong>in</strong>sbesondere die Rechtschreibkontrolle)<br />
vorgestellt und durch das Erstellen eigener Übungsbeispiele<br />
kennengelernt.<br />
4. Block: ca. 2 U-Std. Computer als Werkzeug im Unterricht:<br />
Die Teilnehmer lernen ausgewählte Unterrichtsprojekte, bei denen<br />
Computer und Internet als Werkzeug e<strong>in</strong>gesetzt wurden (u.a. die Projekte<br />
„Meerschwe<strong>in</strong>stories“ und „Planetentexte“) kennen, <strong>in</strong>dem sie<br />
diese mit dem vorbereiteten Material weitgehend selbständig durcharbeiten.<br />
5. Block:<br />
ca. 2 U-Std.<br />
3.2 Ablauf e<strong>in</strong>er Fortbildungssitzung<br />
Computer <strong>in</strong> der Klasse –was nun?<br />
Die Teilnehmer wiederholen und vertiefen nach eigener Wahl Beispiele<br />
zu den drei aufgezeigten Anwendungsbereichen (Software, Unterrichtsvorbereitung,<br />
Unterrichtswerkzeug) und versuchen –mit Unterstützung<br />
des Kursleiters- alle<strong>in</strong>e oder <strong>in</strong> Partnerarbeit eigene Ideen für den<br />
Computere<strong>in</strong>satz zu entwickeln.<br />
Zeit Inhalt Medien (z.B. Pro-<br />
10 M<strong>in</strong> Rückblick auf den vorangegangenen Block, „Warm-Up“<br />
gramme)<br />
Kopierte Wortsuchrät-<br />
Das Vorhaben für diese Sitzung (Erstellen von Unterrichtsselbögen zu verschiematerialien<br />
am Beispiel „Wortsuchrätsel“) wird anhand von denenUnterrichts- konkreten Beispielen für Gestaltung und Anwendungsbethemen und <strong>in</strong> verschiereiche<br />
besprochen.<br />
Teilnehmer entscheiden sich für e<strong>in</strong> Sachgebiet (z.B. Tiere,<br />
Namen, Diktatwörter, Vokabeln o.ä.) für ihr(e) Wortsuchrätsel,<br />
wechseln <strong>in</strong> den Computerraum und starten den<br />
Computer und das Programm WordF<strong>in</strong>d.<br />
denen Gestaltungen<br />
20 m<strong>in</strong> Die Teilnehmer werden – z. T. <strong>in</strong> der Gruppe, z. T. <strong>in</strong>dividuell<br />
– mündlich angeleitet die nötigen Arbeitsschritte zu tun:<br />
Erstellen e<strong>in</strong>er Wortliste zum gewählten Thema<br />
Bearbeiten der Programmoptionen (welche Buchstaben/<br />
Zeichen s<strong>in</strong>d erlaubt, welche Größe soll das Rätselfeld<br />
haben, soll das Rätselfeld e<strong>in</strong>en Rahmen haben, welche<br />
Schriftart soll verwendet werden, <strong>in</strong> welchen Richtungen<br />
dürfen Wörter versteckt se<strong>in</strong>, soll das Rätselblatt e<strong>in</strong>e Titel-<br />
und Namenszeile haben, wie wird e<strong>in</strong> Lösungsbogen erstellt,<br />
wie sichere ich me<strong>in</strong> Rätsel, wie drucke ich me<strong>in</strong> Rätsel)<br />
Rätsel und Lösungsbögen werden ausgedruckt.<br />
Ca. 10<br />
m<strong>in</strong><br />
WordF<strong>in</strong>d<br />
Erstellen von Unterrichtsmaterial<br />
durch<br />
Lehrer und Schüler<br />
(Arbeitsbögen, Rätsel,<br />
Spiele, etc.)<br />
Deutschunterricht,<br />
Sprachunterricht<br />
Sachkunde-, Deutsch-,<br />
Erdkunde-, Biologieunterricht;<br />
Computer<br />
und Internet als Schülerwerkzeug<br />
Sachkunde-, Deutsch-,<br />
Erdkunde-, Biologieunterricht;<br />
Computer<br />
und Internet als Schülerwerkzeug<br />
Arbeits-/Sozialform<br />
Kreisgespräch an der<br />
„Kaffeetafel“<br />
E<strong>in</strong>zel-/Partnerarbeit<br />
WordF<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>zel-/Partnerarbeit<br />
Da es sich um e<strong>in</strong><br />
relativ e<strong>in</strong>faches und<br />
weitgehend <strong>in</strong>tuitiv<br />
und „entdeckend“<br />
erlernbares Programm<br />
handelt, kann nach dem<br />
E<strong>in</strong>gangsimpuls (Programm<br />
starten –Wortliste<br />
erstellen) die ggf.<br />
notwendige m<strong>in</strong>imale<br />
Instruktion <strong>in</strong>dividuell<br />
erfolgen<br />
Pause Kaffeetafel (Kreisgespräch)
40 m<strong>in</strong> Erläuterung des Vorhabens für den zweiten Teil anhand von<br />
Beispielen:<br />
Herstellung von grafisch gestalteten Rätselbögen.<br />
Die Teilnehmer werden – z. T. <strong>in</strong> der Gruppe, z. T. <strong>in</strong>dividuell<br />
– mündlich angeleitet die nötigen Arbeitsschritte zu tun:<br />
Kopieren des erstellten Rätsels aus WordF<strong>in</strong>d <strong>in</strong> die Zwischenablage,<br />
Öffnen e<strong>in</strong>er AppleWorks-Seite und E<strong>in</strong>kleben des erstellten<br />
Rätsels aus der Zwischenablage,<br />
Kennenlernen von wichtigen Gestaltungsoptionen <strong>in</strong> Apple-<br />
Works:<br />
Rahmen, Rahmenstärke, Rahmenfarbe e<strong>in</strong>stellen, Objekte<br />
e<strong>in</strong>färben, E<strong>in</strong>fügen von zusätzlichen Grafikobjekten (z.B.<br />
zum Rätsel passende Clip-Arts), vergrößern/verkle<strong>in</strong>ern/<br />
verschieben von Grafikobjekten, Textelemente h<strong>in</strong>zufügen<br />
und formatieren (Lösungswörter, Titel, Namensfeld etc.)<br />
Gestaltetes Rätsel sichern und Ausdrucken.<br />
Kopierte Wortsuchrätselbögen<br />
zu verschiedenenUnterrichtsthemen<br />
und <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Gestaltungen<br />
AppleWorks, WordF<strong>in</strong>d,<br />
Wahlweise E<strong>in</strong>zelarbeit,<br />
Partnerarbeit; Instruktion<br />
kann aufgrund der<br />
kle<strong>in</strong>en Gruppe und des<br />
überschaubaren Raumes<br />
überwiegend <strong>in</strong>dividuell<br />
oder für Teilgruppen<br />
entsprechend dem<br />
jeweiligen Arbeitsstand<br />
erfolgen (Methode:<br />
mündliches Schildern<br />
der jeweiligen Arbeitsschritte,<br />
der Kursleiter<br />
vermeidet möglichst<br />
das Zeigen auf dem<br />
Bildschirm oder gar das<br />
Übernehmen der Maus).<br />
10 m<strong>in</strong> Ausklang, geme<strong>in</strong>sames Aufräumen, Verabschiedung -- Gelegenheit zum Feedback<br />
im Rahmen des<br />
Gesprächs<br />
4. Umsetzung spezieller Projektziele <strong>in</strong> der Sitzung<br />
Wie erfolgte die Umsetzung? Kommentar, Urteil, Beobachtung, Warum hat es<br />
gut/schlecht funktioniert?<br />
Neue Lernkultur Großer Anteil an Eigentätigkeit und selbstän- Modulhafter Kursaufbau mit variabel e<strong>in</strong>diger<br />
Problemlösung der TN, <strong>in</strong>struktionale setzbaren Abschnitten ermöglicht flexibles<br />
Phasen kurz und kompakt, Orientierung an E<strong>in</strong>gehen auf die aktuelle Situation und die<br />
Problemen des Schulalltags, flexible Planungsan- Bedürfnisse der Lerngruppe – mehr Angebote<br />
passung an Teilnehmerwünsche und –fragen. als nötig vorbereitet zu haben beruhigt den<br />
Kursleiter und ermöglicht Planungsvariabilität.<br />
Vermittlung von MK Vermittlung von Medienkompetenz durch ausgiebige<br />
Eigentätigkeit, nicht als ausdrücklicher<br />
eigener Programmpunkt<br />
Schulentwicklung -- --<br />
Akzeptanz &<br />
Motivation<br />
A&M brachten die Teilnehmer bereits mit, weiteres<br />
siehe „Neue Lernkultur“<br />
5. Beurteilung der Fortbildungssitzung<br />
Urteil der Teilnehmer Siehe Fragebögen<br />
funktioniert gut, bewusste Unterbetonung hilft<br />
<strong>in</strong>sbesondere unsicheren Teilnehmern<br />
Urteil des Fortbildners Konzept und Durchführung können für den vorgesehenen Zweck (E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> Möglichkeiten<br />
des Computere<strong>in</strong>satzes für Anfänger) im Wesentlichen so bleiben, Zeitplanung<br />
und Schwierigkeitsgrad der e<strong>in</strong>zelnen Module müssen von Fall zu Fall (entsprechend<br />
der jeweiligen Gruppe) angepasst werden.<br />
Konsequenzen für weitere s.o.<br />
Durchführung<br />
Empfehlungen --<br />
6. Anhang:<br />
Beispiele für verschieden gestaltete Rätselbögen aus verschiedenen Anwen-<br />
dungsbereichen, Fragebogen-Auswertung<br />
--<br />
85
86<br />
Fortbildungskurs „Suchen im Netz“<br />
Frieder Klapp<br />
1. Allgeme<strong>in</strong>e Angaben<br />
Fortbildungsthema Internet – Führersche<strong>in</strong> für LehrerInnen<br />
Kursniveau Anfänger Datum 22.5.2000 – 26.6.2000<br />
Teilnehmerzahl 12 Zeitansatz 10 Zeit-Stunden (5 Term<strong>in</strong>e)<br />
Fortbildner Frieder Klapp eMail klapp@mac.com<br />
Schule / E<strong>in</strong>richtung Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule URL www.twa<strong>in</strong>web.de<br />
E<strong>in</strong>gesetzte Medien Beamer, Whiteboard, Computer mit Netzanb<strong>in</strong>dung, ABs, Zettel,<br />
CD mit allen Materialien am Schluss des Kurses für jeden Teilnehmer<br />
Techn. Ausstattung Netzwerk mit 12 iMacs, PowerMac G3-Server<br />
2. Lernziele<br />
Fachlich/Didaktisch • Die KursteilnehmerInnen lernen verschiedene Suchmasch<strong>in</strong>en kennen.<br />
• Sie gew<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>en Überblick über Möglichkeiten und Grenzen von Suchmasch<strong>in</strong>en.<br />
• Sie erproben Möglichkeiten für eigenverantwortliches, selbstgesteuertes Lernen.<br />
Methodisch • Die KursteilnehmerInnen können e<strong>in</strong>e Recherche im Internet durchführen.<br />
• Sie können alternative Wege beschreiten, wenn die Recherche nicht gleich zum<br />
gewünschten Ziel führt.<br />
• Sie können die Ergebnisse ihrer Recherche als Bookmark oder Webarchiv abspeichern.<br />
Sozialkompetenz • Die KursteilnehmerInnen entwickeln durch die Partnerarbeit geme<strong>in</strong>same Problemlösungsstrategien<br />
und Teamfähigkeit..<br />
Den Kursteilnehmern soll durch die Entscheidung über den Inhalt der Internet-Recherche <strong>in</strong>teressengebundenes Lernen<br />
ermöglicht werden.<br />
3. Ablauf<br />
3.1 E<strong>in</strong>bettung der Fortbildungssitzung <strong>in</strong> die Gesamtplanung<br />
Zeitansatz Inhalte Anwendungsbereich<br />
2 h Grundlagen zum Internet<br />
Diskussionsrunde zum Vorwissen und <strong>zur</strong> Vermittlung erster Grundlagen (Anlage<br />
1.2.1 : Was ist das WWW?)<br />
Historische Dimension (Kurz-Präsentation) - (Anlage 6.1)<br />
Annährung an die Fachterm<strong>in</strong>ologie des Internets und E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Browser-<br />
Bedienung durch Lösen e<strong>in</strong>es vorbereiteten, <strong>in</strong> HTML erstellten „Internet-Quiz“<br />
(Partnerarbeit am Computer – offl<strong>in</strong>e oder onl<strong>in</strong>e) - (Anlage 1.6)<br />
Geme<strong>in</strong>same Klärung und Erläuterung der neuen Begriffe, z.B. Aufbau von Internet-<br />
Adressen,<br />
(Anlagen 1.2.2 + 1.7.2)<br />
Erstes Surfen im Netz durch Vorgabe e<strong>in</strong>iger URLs Bookmarks / Favoriten abspeichern<br />
2 h Wie f<strong>in</strong>de ich was im Web - Überblick und Funktionsweise von Suchmasch<strong>in</strong>en<br />
(s.u. -> ausführlichen Ablauf)<br />
Erste Nutzung des<br />
Internets <strong>in</strong> der Schule<br />
und zu Hause<br />
Internetrecherche<br />
allgeme<strong>in</strong>
2 h Informationsrecherche –<br />
Materialien für die Schule<br />
Kennen lernen wichtiger Adressen (nicht nur Bildungsserver) für Lehrer und<br />
Schüler -> Unterrichtsmaterial und Sach<strong>in</strong>formationen<br />
Erstellung e<strong>in</strong>er Sammlung und Bewertung relevanter Internet-Adressen für die<br />
verschiedenen Unterrichtsbereiche des vorfachlichen Unterrichts und der Fächer <strong>in</strong><br />
Klasse 5 und 6 der Berl<strong>in</strong>er Grundschule (onl<strong>in</strong>e, Partnerarbeit)<br />
(Anlagen 3)<br />
2 h elektronische Post - E-mail<br />
Grundlagen zu e-mail-Adressen und Mail-Programmen:<br />
Impuls: Woher kommt der Schreibboom bei Jugendlichen? (Anlage 4.1 : Schreibboom<br />
- ARD Videotextnachricht vom 1.3.99)<br />
- Exkurs: Was ist und was kann e-mail ? (Anlage 4.3)<br />
- Erläuterung der Unterschiede bei providerabhängiger oder -unabhängiger e-mail<br />
Adresse<br />
- Unterschiede zum Mailserver der Schule<br />
Anlegen e<strong>in</strong>er kostenlosen e-mail Adresse bei GMX oder excite-mail (onl<strong>in</strong>e,<br />
Partner- oder E<strong>in</strong>zelarbeit)<br />
Kommunikation der Sem<strong>in</strong>arteilnehmer per eMail.<br />
Anlegen e<strong>in</strong>es eMail-Adressbuches<br />
Verschicken von E-Mails mit Anhang<br />
2 h<br />
Internet <strong>in</strong> der Schule / Unterrichtsprojekte<br />
Möglichkeiten des Internete<strong>in</strong>satzes <strong>in</strong> der Schule, Vorschläge, Anregungen,<br />
Erfahrungsaustausch / Präsentation durchgeführter Projekte (siehe Beispiele auf<br />
www.twa<strong>in</strong>web.de)<br />
Abschlussdiskussion:<br />
Chancen und Probleme der Nutzung des Internets durch Schüler im Unterricht und<br />
<strong>in</strong> Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften (Anlage 5.1)<br />
4. Ablauf der Fortbildungssitzung:<br />
Wie f<strong>in</strong>de ich was im Web ? - Überblick und Funktionsweise von Suchmasch<strong>in</strong>en / Sichern von Ergebnissen<br />
Informationsrecherche<br />
nach unterrichtsrelevanten<br />
Inhalten<br />
Umgang / Nutzung<br />
elektronischer Post<br />
Internet im Unterricht<br />
Zeit Inhalt Medien<br />
Arbeits-, Sozial- und<br />
10 m<strong>in</strong> Rückblick auf erste Sitzung / Geme<strong>in</strong>same<br />
(z.B. Programme)<br />
Diagramm der Erwartungen - Beamer-<br />
Organisationsform<br />
Kreisgespräch<br />
Bewertung der Erwartungen der Teilnehmer<br />
(Anlage 7.1)<br />
projektion<br />
5 m<strong>in</strong> Sammeln von Themen und Fragestellungen,<br />
nach denen gesucht werden soll<br />
(z.B. verschw<strong>in</strong>det der Tropische Regenwald?)<br />
Whiteboard E<strong>in</strong>zelarbeit<br />
10 m<strong>in</strong> Grundsätzliches zu Suchmasch<strong>in</strong>en /<br />
Erklärung an e<strong>in</strong>em Such-Beispiel<br />
40 m<strong>in</strong> Problemlösung – Antworten auf die Fragestellungen<br />
im Netz f<strong>in</strong>den<br />
10 m<strong>in</strong> Auswertung der Ergebnisse und Bewertung<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Suchmasch<strong>in</strong>en /<br />
geme<strong>in</strong>sames Klären von Fragen<br />
10 m<strong>in</strong> Möglichkeiten (Vor- und Nachteile) des<br />
Sicherns von Ergebnissen e<strong>in</strong>er WWW-<br />
Recherche (Anlage 2.4):<br />
• Favoriten / Bookmarks anlegen,<br />
• Seiten als Web-Archive abspeichern<br />
30 m<strong>in</strong> Internet-Recherche zu Unterrichtsthemen<br />
auf Basis des bisher Gelernten mit Sichern<br />
der Ergebnisse (Anlagen 2.1 + 2.2)<br />
5 m<strong>in</strong> Blitzlicht (Kurz-Evaluation) und<br />
Ausblick auf nächste Sitzung<br />
Beamer Vortrag / Präsentation<br />
Suchmasch<strong>in</strong>en-Logos (vergrößert auf<br />
Zettel ausgedruckt – Anlagen 6.2.1<br />
– 6.3),<br />
Computer / Internet-Explorer,<br />
Whiteboard mit Matrix <strong>zur</strong> Ergebnis-<br />
sicherung<br />
Whiteboard mit den Suchmasch<strong>in</strong>en-<br />
Logos <strong>in</strong> der Matrix<br />
Beamer Vortrag<br />
Partnerarbeit ( 2<br />
FortbildungteilnehmerInnen<br />
pro Rechner),<br />
jeder Teilnehmer<br />
erhält 2 Suchmasch<strong>in</strong>en-Logos<br />
Gespräch / Diskussion<br />
Computer / Internet-Explorer Partner- und E<strong>in</strong>zelarbeit<br />
mit Kooperation<br />
Gespräch<br />
87
88<br />
5. Umsetzung spezieller Projektziele <strong>in</strong> der Sitzung<br />
Wie erfolgte die Umsetzung? Kommentar, Urteil, Beobachtung,<br />
Warum hat es gut/schlecht funktioniert?<br />
Neue Lernkultur Den KursteilnehmerInnen wurde durch die<br />
Ent≠scheidung über den Inhalt der Internet-Recherche<br />
<strong>in</strong>teressengebundenes Lernen ermögli≠cht.<br />
Vermittlung von Medienkompetenz<br />
Das neu erworbenen Wissen wurde auf verschiedene<br />
Frage- und Problemstellungen übertragen.<br />
Kooperatives und selbständiges Arbeiten bildete e<strong>in</strong>en<br />
wichtigen Bestandteil der Arbeitsphasen.<br />
Zwischen den TeilnehmerInnen fand e<strong>in</strong> reger Erfahrungsaustausch<br />
statt.<br />
Die Instruktion beschränkte sich auf kurze, gezielte<br />
Inputphasen.<br />
Der Lehrende agierte vor allem <strong>in</strong> der Rolle e<strong>in</strong>es<br />
Beraters.<br />
Erlangung von Medienkompetenz entsteht hier durch<br />
aktive Medien-Nutzung: Internet-Recherche und Weiterverarbeitung<br />
der Ergebnisse (Speichern als Bookmarks<br />
oder Web-Archive)<br />
Schulentwick≠lung Verdeutlichung am E<strong>in</strong>satz von neuen Medien <strong>in</strong> der<br />
Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
Akzeptanz &<br />
Motivation<br />
6. Beurteilung der Fortbildungssitzung<br />
Die Teilnehmer zeigten großes Interesse am Thema,<br />
extr<strong>in</strong>sische Motivation <strong>in</strong>sofern nicht nötig!<br />
Ursprünglicher Zeitansatz wurde auf Wunsch der<br />
Teilnehmer von e<strong>in</strong>er Doppelstunde auf 2 Zeitstunden<br />
erhöht!<br />
Obwohl als Anfängerkurs deklariert,<br />
hatten doch e<strong>in</strong>ige wenige TeilnehmerInnen<br />
schon Grundfähigkeiten im<br />
Umgang mit dem Internet, was sich<br />
<strong>in</strong>sbesondere positiv auf die Kooperation<br />
und Kommunikation unter den<br />
KursteilnehmerInnen auswirkte.<br />
Instruktion wurde „dankbar“ aufgenommen!<br />
<strong>in</strong> dieser Rolle allerd<strong>in</strong>gs sehr gefragt<br />
Wichtig war, den TeilnehmerInnen viel<br />
Raum <strong>zur</strong> Eigentätigkeit zu geben!<br />
Motivation musste bei e<strong>in</strong>igen der<br />
TeilnehmerInnen am Schluss der<br />
Sitzungen gebremst werden – Zeitvorgabe<br />
wurde teilweise überschritten.<br />
Urteil derTeilnehmer Blitzlicht:<br />
• Überblick über verschiedene Suchmasch<strong>in</strong>en gut<br />
• Arbeitsphase mit Bewertung der Suchmasch<strong>in</strong>en anhand von Logos wurde von mehreren<br />
Teilnehmern positiv beurteilt<br />
• Umgang mit Sichern der Recherche-Ergebnisse sollte müsste noch weiter geübt und<br />
vertieft werden<br />
Fragebogenauswertung am Ende des Kurses (Anlage 7.2)<br />
Urteil des Fortbildners Fortbildungskurs wurde 2x (mit Abweichungen) wie beschrieben mit Erfolg durchgeführt!<br />
Konsequenzen für weitere Siehe Empfehlungen!<br />
Durch≠führung<br />
Empfehlungen Fortbildungen im Team (2 Moderatoren/Multiplikatoren) um auf die Teilnehmer noch<br />
gezielter e<strong>in</strong>gehen zu können (größerer Handlungsspielraum, gegenseitige Ergänzung)<br />
7. Materialien / Anlagen<br />
Die Materialien f<strong>in</strong>den sich im Ordner „Internet-Führersche<strong>in</strong> 2000“ auf der CD-Rom<br />
Weitere Dokumentationen von Fortbildungskursen f<strong>in</strong>den sich auf der CD-Rom<br />
• Internetkurs für Anfänger - Thomas Kahlki<br />
•
9.2 Workshops<br />
Workshop „Benutzung der Digitalkamera“<br />
Brigitte Meier<br />
Thema: „Lust- und Frustecken unserer Schule“ – Versuch e<strong>in</strong>er Fotoevaluation<br />
Teilnehmer: drei Kolleg<strong>in</strong>nen der Schwielowsee-Grundschule; Dauer: 2 x 2 Stunden<br />
Erwartungen und Ziele der Teilnehmer: Die Kolleg<strong>in</strong>nen wollen <strong>in</strong> den Gebrauch der Digital-<br />
kamera e<strong>in</strong>geführt werden, Fotos auf den Computer laden können und sie dann zu verschie-<br />
denen Zwecken weiter bearbeiten lernen, sie zum Beispiel <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Textverarbeitungsprogramm<br />
e<strong>in</strong>fügen können. Es besteht ke<strong>in</strong> Interesse an e<strong>in</strong>em vertiefenden E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> Bildbearbei-<br />
tungsprogramme. Ihr Fernziel ist es, die Kamera auch im Unterricht e<strong>in</strong>zusetzen.<br />
Ziele der Fortbildner<strong>in</strong>: Die Teilnehmer sollen geme<strong>in</strong>sam Unterrichtsideen entwickeln, wie<br />
die Digitalkamera <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en schülerbezogenen, die Eigenaktivität fördernden Unterricht e<strong>in</strong>ge-<br />
bunden werden kann. Als e<strong>in</strong>e Möglichkeit des E<strong>in</strong>satzes soll den Teilnehmern die Fotoevalu-<br />
ation vorgestellt werden. Die Chancen, die diese Fotoevaluation für Qualitätsanalyse, Kom-<br />
munikation, Demokratie und damit letztlich Schulentwicklung bietet, sollen bewusst gemacht<br />
werden. Bei der Frage: „Wo fühle ich mich <strong>in</strong> der Schule wohl, wo unwohl ?“ geht es <strong>in</strong> erster<br />
L<strong>in</strong>ie um e<strong>in</strong> Wahrnehmen und Reflektieren der eigenen Gefühle. Dieser Dimension des Ler-<br />
nens („weg vom Kopf“) sollen die Teilnehmer auf die Spur kommen und ihre Erfahrungen<br />
möglichst mit Schülergruppen umsetzen.<br />
Vorgehen<br />
Nach der Begrüßung werden die Teilnehmer gebeten e<strong>in</strong>ige Unterrichtsvorhaben, bei denen<br />
sie sich den E<strong>in</strong>satz der Digitalkamera vorstellen könnten, auf Metaplankarten zu schreiben.<br />
Es werden folgende Themen notiert: Ich und me<strong>in</strong>e Familie, Besuch im Zoo, Briefkontakt per<br />
E-Mail mit e<strong>in</strong>er Partnerklasse, Verkehrsunterricht, Klassenfahrttagebuch, Pflanzen <strong>in</strong> der<br />
Großstadt. Im Gespräch werden zu e<strong>in</strong>igen Themen Ideen gesammelt. Es ergibt sich z.B. beim<br />
Unterrichtsvorhaben Zootiere die Diskussion, ob es nicht besser sei, vorgefertigte Fotos, zum<br />
Beispiel Postkarten oder andere „fertige“ Bilder zu nehmen, auf denen die Tiere deutlich zu<br />
erkennen s<strong>in</strong>d. Mit der Kamera kämen die Schüler meist nicht dicht genug an die Tiere heran,<br />
außerdem gäbe es Probleme mit den Gitterstäben.<br />
Auch zum Thema Verkehrsunterricht kommen den Teilnehmern nach e<strong>in</strong>igem Nachdenken<br />
Zweifel, ob hierfür die Kamera e<strong>in</strong> geeignetes Hilfsmittel se<strong>in</strong> könnte. Dem E<strong>in</strong>wand, es gäbe<br />
gut benutzbare Magnetverkehrsschilder und Material der Landesverkehrswacht, das anschau-<br />
lich ist, wird zugestimmt.<br />
Als gut und wegen des Dokumentationscharakters optimal e<strong>in</strong>setzbar ersche<strong>in</strong>t den Teil-<br />
nehmern die Kamera auf Klassenfahrten und anschließend <strong>zur</strong> Erstellung e<strong>in</strong>es Tagebuches<br />
mit den am Computer verfassten Texten. „Ja, aber wie kriegt man denn die Fotos <strong>in</strong> den<br />
Text ?“Allmählich ist die Ungeduld spürbar, die Teilnehmer wollen praktisch tätig werden!<br />
Auf me<strong>in</strong>e Frage „Wo möchtet ihr denn fotografieren, damit wir Fotos bekommen, an denen<br />
wir s<strong>in</strong>nvoll weiterarbeiten können?“ kommt als Vorschlag: „Na, am besten gleich hier <strong>in</strong><br />
der Schule oder auf dem Schulhof.“ Das Unterrichtsvorhaben „Pflanzen <strong>in</strong> der Großstadt“<br />
89
90<br />
ersche<strong>in</strong>t den Teilnehmern zunächst geeignet. An dieser Stelle erfolgt me<strong>in</strong> Vorschlag, etwas<br />
zu fotografieren, das weder botanische Vorkenntnisse erfordere noch die Zuhilfenahme von<br />
Bestimmungsbüchern.<br />
Die Aufforderung „Fotografiert etwa drei bis fünf Orte, an denen ihr euch hier an eurem<br />
Arbeitsplatz Schule wohl fühlt und Orte, an denen ihr euch unwohl fühlt “ löst als erste Re-<br />
aktionen Stirnerunzeln, Schmunzeln und leichte Verwirrung aus. Spontanäußerungen wie<br />
„Na, dann muss ich die Klasse XY fotografieren, das ist e<strong>in</strong> Horror, dort zu unterrichten“<br />
führen zu der Diskussion, ob nur Räume oder auch Personen fotografiert werden sollen. Die<br />
Gruppe verständigt sich darauf, dort wo es möglich ist, auch Personen zu fotografieren. Nach<br />
kurzer Zeit e<strong>in</strong>igen sich die drei Teilnehmer<strong>in</strong>nen auf vier Positivorte und drei Negativorte,<br />
die sie fotografieren wollen. (Das Auto e<strong>in</strong>er Kolleg<strong>in</strong>, die sich immer wohl fühlt, wenn sie<br />
nach Hause fahren darf, kommt nicht <strong>in</strong> die engere Wahl.) Die Gruppe begibt sich auf Streif-<br />
zug durch Gebäude und Außenanlagen.<br />
Nach der Rückkehr von der Fotosafari wird den Teilnehmern demonstriert, wie die Fotos<br />
auf die iMacs übertragen werden können. Der Speicherchip wird entnommen und <strong>in</strong> das<br />
Lesegerät gesteckt, das Lesegerät wird an den Computer angeschlossen. Mit dem Drag-and-<br />
Drop-Verfahren werden die Fotos e<strong>in</strong>zeln auf das Symbol des Programms Photoshop elements<br />
gelegt und öffnen sich dann automatisch. Nach der Demonstration üben die Teilnehmer an<br />
jeweils zwei Fotos das Öffnen im Bildbearbeitungsprogramm. Da die Teilnehmer bei e<strong>in</strong>igen<br />
Fotos mit dem Bildausschnitt bzw. der Farbe unzufrieden s<strong>in</strong>d, gebe ich ihnen Hilfestellung,<br />
erkläre und demonstriere e<strong>in</strong>ige Möglichkeiten des Programms zum Beispiel Freistellen oder<br />
Helligkeit/Kontrast verändern. Die Teilnehmer kooperieren beim Bearbeiten der Fotos, ver-<br />
ändern die Größe und speichern diese als JPG-Dateien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em neu angelegten Ordner Fotos<br />
Workshop ab. Obwohl die Zeit schon weit fortgeschritten ist, wollen die Teilnehmer noch<br />
wissen, wie die Fotos <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Textdokument e<strong>in</strong>gebunden werden können. Das Procedere wird<br />
am Programm AppleWorks demonstriert (über den Befehl Importieren, Grafik-Modus / Pfeil<br />
aktivieren, dann ist das Bild im Dokument frei platzierbar).<br />
Am Ende der Sitzung wird folgende Verabredung getroffen:<br />
Die Teilnehmer machen sich bis <strong>zur</strong> nächsten Woche Gedanken<br />
a) wie die Fotos ausgewertet werden könnten,<br />
b) welche Vor- (oder auch Nach)teile e<strong>in</strong>e Fotoevaluation haben kann,<br />
c) <strong>in</strong> welchem Rahmen e<strong>in</strong> solches Vorhaben mit Schülern zu realisieren wäre.<br />
Beim Folgeterm<strong>in</strong> wollen die Teilnehmer zunächst ihre Fotos noch verändern, sie üben<br />
dann das E<strong>in</strong>setzen <strong>in</strong> das Textdokument mehrmals. Sie schreiben Bildunterschriften und<br />
Kurzkommentare zu den Fotos und erstellen damit e<strong>in</strong>e Diashow.<br />
Die anschließende Diskussion zu den drei Leitfragen ist lebhaft. Als Positivmerkmale wer-<br />
den festgehalten:<br />
• Schüler können ihre Empf<strong>in</strong>dungen und Gefühle ausdrücken ohne viel Worte.<br />
• E<strong>in</strong> Gespräch über die Schulwirklichkeit wird <strong>in</strong>itiiert.<br />
• Es entsteht e<strong>in</strong>e offene Lernsituation, die Schüler wählen frei ihre Motive und entscheiden,<br />
welchen Kommentar sie dazu abgeben wollen.<br />
• Manchen an Schule Beteiligten werden „die Augen geöffnet“ - man ist ja selbst oft „be-<br />
triebsbl<strong>in</strong>d“.<br />
• Möglicherweise wird e<strong>in</strong> Veränderungsprozess <strong>in</strong> Gang gesetzt – es darf jedoch nicht mit<br />
Kosten verbunden se<strong>in</strong>!
Workshop „Schulhomepage mit Freeway“<br />
Thomas Kahlki, Frieder Klapp<br />
Teilnehmer: Sechs Kollegen aus Berl<strong>in</strong>er Grundschulen<br />
Vorerfahrung: Grundkenntnisse im Umgang mit dem Internet und dem Programm Apple-<br />
Works<br />
Zeit: Zehn Zeitstunden an zwei Tagen im Juni 2001<br />
Ausgangssituation<br />
S<strong>in</strong>nhaftes Lernen <strong>in</strong> Fortbildungen besteht <strong>in</strong> der Ause<strong>in</strong>andersetzung mit für die Teilnehmer<br />
authentischen Problemen und bedeutsamen Inhalten. Anlass für das Fortbildungsangebot war<br />
deshalb die Absicht der teilnehmenden Kollegen, e<strong>in</strong>e Homepage für ihre Schule zu gestalten<br />
und <strong>in</strong>s Netz zu stellen. Zum Teil hatten sie bereits mit anderen HTML-Editoren Erfahrungen<br />
gesammelt, die aber <strong>in</strong> der Regel nur e<strong>in</strong>e weniger visuell orientierte Arbeitsweise gestatteten<br />
und weniger Möglichkeiten <strong>zur</strong> grafischen Gestaltung der Seiten boten.<br />
Freeway ist e<strong>in</strong> Programm <strong>zur</strong> Erstellung von Internet-Seiten, das sich zwar e<strong>in</strong>fach bedienen<br />
lässt, aber gleichzeitig sehr leistungsfähig ist. Es s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e HTML-Kenntnisse erforderlich<br />
und jeder, der schon e<strong>in</strong>mal mit AppleWorks oder e<strong>in</strong>em Layoutprogramm gearbeitet hat,<br />
wird sich <strong>in</strong> Freeway schnell heimisch fühlen. Freeway ist deshalb e<strong>in</strong> ideales Werkzeug für<br />
alle, die noch nie e<strong>in</strong>e Webseite gestaltet haben. In kurzer Zeit kann man damit Seiten entwer-<br />
fen, die anschließend im Browser auch genauso ersche<strong>in</strong>en.<br />
Da es Freeway bisher nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Mac<strong>in</strong>tosh-Version gibt, haben wir ausdrücklich Kollegen<br />
von Schulen, an denen mit Mac<strong>in</strong>tosh-Computern gearbeitet wird, e<strong>in</strong>geladen. Die Fortbil-<br />
91
92<br />
dungsform Workshop haben wir gewählt, weil sie es uns ermöglicht e<strong>in</strong>e Lernsituation herzu-<br />
stellen, <strong>in</strong> der sich die Teilnehmer aktiv und <strong>in</strong>teragierend verhalten können und <strong>in</strong> denen sie<br />
ihre Erfahrungen, Probleme und Fragen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen können.<br />
Der Zeitrahmen (zehn Stunden kompakt <strong>in</strong>nerhalb von zwei Tagen) ergab sich aus dem Be-<br />
dürfnis der Teilnehmer <strong>in</strong>nerhalb kürzester Zeit zu konkreten Ergebnissen (nämlich e<strong>in</strong>er ei-<br />
genen Homepage) zu gelangen. Dabei war<br />
es uns wichtig, die Teilnehmer nicht Schritt<br />
für Schritt von den HTML-Grundlagen <strong>zur</strong><br />
fertigen Website zu führen, sondern sie als<br />
Berater und Helfer auf ihrem durch ihre <strong>in</strong>-<br />
dividuellen Problemstellungen bestimmten<br />
<strong>in</strong>dividuellen Lösungsweg zu begleiten.<br />
E<strong>in</strong>e solche möglichst offene Lernumge-<br />
bung hängt maßgeblich von der Qualität<br />
der Vorstrukturierung ab (zum Beispiel<br />
<strong>in</strong> Form vorbereiteter Materialien und<br />
gedanklicher Vorwegnahme möglicher Lö-<br />
sungswege). Um diesem Anspruch gerecht<br />
werden zu können, stellten wir für jeden<br />
Teilnehmer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em <strong>in</strong>dividuell vorbereiteten Arbeitsbereich im Computernetzwerk e<strong>in</strong>en<br />
Ordner mit zahlreichen Materialien <strong>zur</strong> Verfügung (zum Beispiel Installationsprogramme,<br />
Clip-Art-Bibliotheken, Beispieldateien, Utilities etc.).<br />
Erläuterung der notwendigen Arbeitsschritte<br />
Der erste Arbeitsschritt der Teilnehmer bestand dar<strong>in</strong>, das für die eigene Homepage benötigte<br />
Ausgangsmaterial (Texte, Fotos, Grafiken, Clip-Art, ggf. Schriften) zu Hause und <strong>in</strong> der Schu-<br />
le vorzubereiten und auf e<strong>in</strong>em geeigneten Speichermedium (Zip, CD) mitzubr<strong>in</strong>gen. Damit<br />
wollten wir die Teilnehmer dazu anregen, sich bereits im Vorfeld mit den Inhalten, der Gestal-<br />
tung und der Struktur ihrer geplanten Seite ause<strong>in</strong>anderzusetzen.<br />
Da bereits im Vorfeld E<strong>in</strong>igkeit über die Inhalte und das erwünschte Ergebnis des Work-<br />
shops hergestellt worden war (E<strong>in</strong>ladung, E-Mails) und alle Teilnehmer sich bereits bekannt<br />
waren, begannen wir mit e<strong>in</strong>er kompakten Instruktionsphase, <strong>in</strong> der den Teilnehmern die fol-<br />
genden, für die Arbeit mit Freeway erforder-<br />
lichen Arbeitsschritte vermittelt wurden:<br />
• E<strong>in</strong>wählen <strong>in</strong>s Computersystem, Kennen-<br />
lernen des Arbeitsbereiches<br />
• Freeway <strong>in</strong>stallieren<br />
• Freeway starten und e<strong>in</strong> neues Dokument<br />
anlegen<br />
• Grunde<strong>in</strong>stellungen der Internetsei- te<br />
festlegen (zum Beispiel Größe, Festlegung<br />
der Speicherorte)<br />
• Auf der erschienenen Internetsei- te<br />
e<strong>in</strong>en Objektrahmen aufziehen
• Text oder Grafik e<strong>in</strong>fügen und bearbeiten bzw. gestalten (Bildgröße, Schriftart, Schriftgröße<br />
und -farbe, Ausrichtung auf der Seite)<br />
• Zwischenspeichern des Ergebnisses („Site erzeugen“)<br />
• Ergebnis durch automatische Voransicht im Browser überprüfen , gegebenenfalls überarbei-<br />
ten.<br />
Nach dieser Instruktionsphase verfügten die Teilnehmer über die nötigen Grundkenntnisse,<br />
um eigene Freeway-Dokumente zu öffnen und das dar<strong>in</strong> Gesehene <strong>in</strong> eigenes entdeckendes<br />
Lernen umzusetzen. Dabei ergaben sich automatisch <strong>in</strong>dividuelle Fragestellungen, die den je-<br />
weiligen weiteren Lernweg bestimmten. In dieser Phase agierten wir vornehmlich als Berater<br />
und Helfer im Lernprozess. Im späteren Verlauf unterstützten sich die Teilnehmer mit ihren<br />
neu gewonnen Kenntnissen und Fähigkeiten gegenseitig, während sie<br />
• eigenes Material e<strong>in</strong>fügten (Bilder),<br />
• Bildergalerien anlegten,<br />
• weitere Seiten und L<strong>in</strong>ks und L<strong>in</strong>ks erstellten,<br />
• bereits vorhandene Internetseiten importierten und überarbeiteten,<br />
• fertigen Seiten auf dem jeweiligen Server ablegten.<br />
Fortbildungsbewertung<br />
Da die Teilnehmer den Wunsch an uns herantrugen, e<strong>in</strong>e Homepage für ihre Schule zu er-<br />
stellen beziehungsweise zu modifizieren, um ihre Schule und Schülerarbeiten präsentieren<br />
zu können, ergab es sich automatisch, dass die Teilnehmer situationsbezogen und anhand<br />
authentischer Probleme lernten. Sie waren deshalb stark motiviert neues Wissen und neue<br />
Fertigkeiten zu erwerben. Zusätzlich zu den von den Teilnehmern aus ihren Schulen mitge-<br />
brachten Dokumenten und Fotos regten die von uns bereitgestellten Materialien (zum Beispiel<br />
Bildersammlungen und Programme <strong>zur</strong> Erstellung von Bildergalerien) zum spielerischem und<br />
kreativen Umgang mit dem Programm Freeway an.<br />
Besonders positiv hat sich unseres Erachtens unser Team-Teach<strong>in</strong>g ausgewirkt. So war es uns<br />
möglich sehr ausführlich und mit mehr Zeit auch auf schwierigere und <strong>in</strong>dividuellere Anfra-<br />
gen der e<strong>in</strong>zelnen Teilnehmer e<strong>in</strong>zugehen.<br />
Gleiches kann auch über die Teamarbeit der Teilnehmer gesagt werden. Die Arbeit war dort<br />
am effektivsten, wo mehrere (drei) Kollegen e<strong>in</strong>er Schule geme<strong>in</strong>sam am Homepage-Projekt<br />
arbeiteten. Insofern bestätigte sich unsere Emp-<br />
fehlung <strong>in</strong> der Kursankündigung, dass möglichst<br />
zwei oder mehr Kollegen e<strong>in</strong>er Schule geme<strong>in</strong>-<br />
sam kommen sollten.<br />
Am Ende der zwei Workshoptage hatten wir den<br />
E<strong>in</strong>druck e<strong>in</strong>er positiven Resonanz der Teilneh-<br />
mer. Wir verzichteten jedoch <strong>in</strong> Anbetracht der<br />
sehr fortgeschrittenen Zeit auf e<strong>in</strong>e direkte Feed-<br />
backrunde, sondern baten die Teilnehmer e<strong>in</strong>e<br />
Woche später um e<strong>in</strong> kurze E<strong>in</strong>schätzung des<br />
Workshops per E-Mail.<br />
Teilnehmer-Feedback<br />
93
94<br />
„Fortbildungen mit e<strong>in</strong>em von euch oder gar<br />
beiden machen immer besonderen Spaß. Und<br />
zwar aus verschiedenen Gründen:<br />
1. s<strong>in</strong>d sie kurzweilig, weil der Wortanteil zu-<br />
gunsten e<strong>in</strong>es Learn<strong>in</strong>g-by-Do<strong>in</strong>g-Anteils <strong>in</strong> den<br />
H<strong>in</strong>tergrund tritt;<br />
2. ihr kompetent seid und gut <strong>in</strong> der Lage euch<br />
auf die Bedürfnisse der Leute e<strong>in</strong>zustellen;<br />
3. ihr sehr großzügig mit eurer Zeit umgeht!<br />
4. ihr Spaß an der Sache habt und den auch<br />
vermittelt.<br />
5. Man trifft bei euch nette Menschen, mit<br />
denen man <strong>in</strong> lockerer Atmosphäre gut <strong>in</strong> Kon-<br />
takt kommt und die so etwa auf der gleichen<br />
Wellenlänge liegen.“<br />
„Die Fortbildung war für mich sehr motivierend und auch erfolgreich, da Freeway wirklich<br />
sehr <strong>in</strong>tuitiv zu bedienen war und ich schnelle Erfolgserlebnisse hatte. Die Gruppengröße war<br />
gerade richtig, da bei <strong>in</strong>dividuellen Fragen ke<strong>in</strong>e langen Wartezeiten entstanden. Die Koope-<br />
ration und Hilfen der Teilnehmer untere<strong>in</strong>ander trugen zu e<strong>in</strong>er guten Atmosphäre bei. Eure<br />
Vorbereitung und Durchführung sowie Eure Geduld und die leicht verständlichen Erklärun-<br />
gen haben ebenfalls me<strong>in</strong> Lernergebnis positiv bee<strong>in</strong>flusst.“<br />
Workshop-Nachbereitung<br />
Teil unseres Workshop-Konzeptes ist es den Teilnehmern auch im Anschluss für Nachfragen,<br />
Tipps und Tricks, weiterführende Anregungen und Support per E-Mail <strong>zur</strong> Verfügung zu ste-<br />
hen. Außerdem bereiten wir unsere Workshops auf „Schulvision“, unserer Internet-Portalseite<br />
für LehrerInnen (www.schulvision.de) nach und bieten dort Support, geeignetes Zusatzmate-<br />
rial, L<strong>in</strong>ks etc. an.
Auf der CD-Rom: weitere Dokumentationen von Fortbildungsworkshops<br />
Umgang mit der Digitalkamera und Photoshop - Frieder Klapp<br />
Fortbildungsergebnis:<br />
E<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong> nimmt die Kamera gleich mit nach Hause, um sich mit weiteren Funktionen<br />
vertraut zu machen und die Bildbearbeitung zu üben. Die zweite erwägt den Kauf e<strong>in</strong>er eige-<br />
nen digitalen Kamera. Der Kollege arbeitet <strong>in</strong>zwischen mit der Kamera im Unterricht.<br />
Weitere Dokumentationen auf der CD-Rom:<br />
Im Web präsent ... nicht schwer - Frieder Klapp<br />
Themenoffener Workshop - Thomas Kahlki<br />
Sonne, Mond und Sterne - Brigitte Meier<br />
Freeway II - Thomas Kahlki, Frieder Klapp<br />
Unterrichtsideen zum Thema „Kartoffel“ - Brigitte Meier<br />
Quicktime-Film zum Workshop „Hollywood für E<strong>in</strong>stei-<br />
ger“ - Thomas Kahlki, Frieder Klapp<br />
95
96<br />
9.3 Co-teach<strong>in</strong>g / Unterrichtsbegleitung<br />
Unterrichtsbegleitung „Internetrecherche, 3. Klasse“<br />
Eva-Maria Sonnick-Ritter<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Angaben<br />
Thema: Internetrecherche im Rahmen e<strong>in</strong>er Unterrichtssequenz zum Thema „Tiere“, Mai<br />
2002, vier Unterrichtsstunden, Klassenlehrer<strong>in</strong> und Erzieherun der Klasse 3a im Fach Deutsch<br />
als Muttersprache. Hilfe <strong>zur</strong> E<strong>in</strong>führung der Schüler <strong>in</strong>s Internet.<br />
Erwartungen und Ziele der Beteiligten<br />
Die Kolleg<strong>in</strong>nen (Lehrer<strong>in</strong> <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der Erzieher<strong>in</strong>) möchten das Medienkon-<br />
zept der Schule umsetzen und planen im Rahmen ihrer Unterrichtse<strong>in</strong>heit den E<strong>in</strong>satz des<br />
Computers <strong>zur</strong> Recherche im Internet. Vorangegangen s<strong>in</strong>d die Beschäftigung mit Tieren <strong>in</strong><br />
ihrem Lebensraum, e<strong>in</strong> Besuch im Zoo, das Erstellen e<strong>in</strong>er Sachkartei... Die geplante Sequenz<br />
schließt die Unterrichtse<strong>in</strong>heit ab. Als Ergebnis sollen die Schüler <strong>in</strong> der Klasse über e<strong>in</strong> Tier<br />
ihrer Wahl berichten. Unterrichtsbegleitung soll es ermöglichen, das Vorhaben zu realisieren,<br />
soll Hilfe und Unterstützung bieten und gleichzeitig die Kolleg<strong>in</strong>nen für selbstständige Weiter-<br />
arbeit qualifizieren.<br />
Vorgehensweise und Vorerfahrungen<br />
In e<strong>in</strong>em ausführlichen Vorgespräch wurden die Erwartungen konkretisiert und die Vorerfah-<br />
rungen abgeklärt. Die Klasse hat bislang eher ger<strong>in</strong>ge Kenntnisse mit der Arbeit im Compu-<br />
terraum (Netzwerk <strong>in</strong> der Schule). Die Medienecke <strong>in</strong> der Klasse wurde bereits für verschiede-<br />
ne Arbeiten e<strong>in</strong>gesetzt und ist den K<strong>in</strong>dern, der Lehrer<strong>in</strong> und der Erzieher<strong>in</strong> mit dem Mac-OS<br />
Betriebssystem bekannt. Über Vorerfahrungen der K<strong>in</strong>der mit dem Internet konnten ke<strong>in</strong>e<br />
Aussagen getroffen werden. Beide Kolleg<strong>in</strong>nen haben zu Beg<strong>in</strong>n des Schuljahres 2001/02 an<br />
die Schule gewechselt und bislang ebenfalls wenig den Computerraum genutzt. Sie haben Vor-<br />
erfahrungen am Computer zu Hause mit der W<strong>in</strong>dowsoberfläche. Sie wollen mit den K<strong>in</strong>dern<br />
ihr und deren Vorwissen aktivieren und mehr über die Arbeitsweise im Computernetzwerk<br />
(am Beispiel der Internetrecherche) lernen. Die Durchführung des Projektes sieht die Beglei-<br />
tung von vier Unterrichtsstunden vor, e<strong>in</strong>geplant s<strong>in</strong>d kurze Zwischenbesprechungen nach<br />
jeder Stunde (zum Verlauf und <strong>zur</strong> weiteren Planung).<br />
Ziele, Problemfelder, Lösungsstrategie<br />
Wichtigste Ziele s<strong>in</strong>d:<br />
• Umgang mit der Benutzeroberfläche im Netzwerk<br />
• Starten des Programms für den Internetzugang<br />
• Kennenlernen der Suchmasch<strong>in</strong>e bl<strong>in</strong>de-kuh.de<br />
• E<strong>in</strong>geben von Suchbegriffen<br />
• F<strong>in</strong>den und Unterscheiden von brauchbaren / weniger brauchbaren Informationen<br />
• Abspeichern von Seiten und e<strong>in</strong>zelnen <strong>in</strong>teressanten Informationen / Bildern<br />
• Zusammenfassen von Informationen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em neuen Dokument
Problemfelder<br />
• Komplexe Zielstellung <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit dem Erlernen der Arbeit als Netzwerkbenutzer<br />
• Offene Aufgabenstellung: die Schüler sollen sich e<strong>in</strong> Tier ihrer Wahl aussuchen<br />
• Damit ist e<strong>in</strong>e themenorientierte Vorarbeit für mich (z.B. Seitenvorauswahl) kaum möglich.<br />
• Ger<strong>in</strong>ger Zeitumfang<br />
Lösungsstrategien<br />
• Anknüpfen an Interesse der Kolleg<strong>in</strong>nen und erwartete Motivation der Schüler<br />
• Aktivieren von Vorkenntnissen, Initiieren von Helferaufgaben<br />
• Aufgreifen von sachlichen Vorkenntnissen aus dem Unterricht<br />
• Ausschöpfen des Potentials der Lehrer<strong>in</strong> und Erzieher<strong>in</strong> als Mitlerner, aktive Begleiter und<br />
Gestalter der gesamten Unterrichtse<strong>in</strong>heit<br />
• Entwickeln e<strong>in</strong>es Konzepts <strong>zur</strong> selbstständigen Weiterarbeit (Anleitungsskript)<br />
• Integration der Basics <strong>zur</strong> Nutzung des schulischen Netzwerks <strong>in</strong> das Unterrichtsvorhaben<br />
• Support durch die Fortbildner<strong>in</strong> als Anschub, Hilfe <strong>zur</strong> Selbsthilfe<br />
• Nachbereitung, Weiterarbeit durch die Kolleg<strong>in</strong>nen<br />
• Austausch von Zwischenergebnissen<br />
Verlauf<br />
1. Stunde<br />
Inhalt: Allgeme<strong>in</strong>es zum Netzwerk, Anmeldemodus, Bedeutung des Benutzerkennworts, Ge-<br />
brauch der Benutzerausweise, Auswahl der Arbeitsgruppe, Programm „Internet Explorer“,<br />
Suchmasch<strong>in</strong>e, Ergebnislisten, L<strong>in</strong>ks anklicken, Blättern, Speichern<br />
Methode: Vortrag – Gespräch – Zeigen – Ausprobieren (E<strong>in</strong>zel- oder Partnerarbeit) - E<strong>in</strong>zel-<br />
betreuung<br />
Ergebnis: Die Schüler waren motiviert und hatten Vorstellungen darüber, was sie <strong>in</strong>teressierte<br />
und sie suchen wollten. Wichtiges <strong>zur</strong> Benutzeroberfläche (Netzwerk) wurde schrittweise er-<br />
klärt und gezeigt. Das Umsetzen war ke<strong>in</strong> Problem, ebenso wenig der Umgang mit der Maus<br />
(Vorerfahrungen). Die meisten Schüler arbeiteten paarweise und mit gegenseitiger Unterstüt-<br />
zung. K<strong>in</strong>der mit Vorkenntnissen wurden gebeten, als Helfer zu fungieren.<br />
In der Anleitung war die Suchmasch<strong>in</strong>e bl<strong>in</strong>de-kuh.de vorgegeben, sie fand aber nicht immer<br />
Ergebnisse zu den teilweise ausgefallenen Wünschen der Schüler. E<strong>in</strong>zelbetreuung half weiter.<br />
Die Rechner arbeiten langsam und verlangen gelegentlich mehr Geduld als Schüler aufbr<strong>in</strong>gen<br />
wollen. Die meisten Schüler konnten im Ergebnis dennoch e<strong>in</strong>zelne Seiten abspeichern.<br />
Rollenverteilung Co-Teacher (Fortbildner<strong>in</strong>) – Teacher (Lehrer<strong>in</strong>, Erzieher<strong>in</strong>):<br />
Ich übernahm die Leitung der Unterrichtsstunde, lenkte das Gespräch, erklärte, zeigte, führte<br />
vor. Die Kolleg<strong>in</strong>nen lernten mit den Schülern. Sie brachten ihre Vorkenntnisse unterstützend<br />
e<strong>in</strong> und begleiteten die Schüler <strong>in</strong> der praktischen Phase.<br />
2.Stunde:<br />
Inhalt: Geme<strong>in</strong>same Vore<strong>in</strong>stellung von bl<strong>in</strong>de-kuh.de als Startseite, Weiterführung der Re-<br />
cherche, <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen Recherche mit google.de, Aussuchen und Kopieren von Bildmaterial,<br />
Lesen von Informationen.<br />
97
98<br />
Methode: Wiederholung - Vortrag – Gespräch – Zeigen – Ausprobieren (E<strong>in</strong>zel- oder Partner-<br />
arbeit beibehalten) - E<strong>in</strong>zelbetreuung<br />
Ergebnis: Die Schüler wollten motiviert die begonnene Arbeit fortführen. Sie halfen sich ge-<br />
genseitig oder erbaten me<strong>in</strong>e Unterstützung beim Auff<strong>in</strong>den ihrer Dokumente. Großes Inter-<br />
esse bestand am Kopieren von Bildmaterial. E<strong>in</strong>ige konnten zusätzliche Seiten f<strong>in</strong>den und ab-<br />
speichern. Die Ordnungsstruktur im Netzwerk hatte marg<strong>in</strong>ale Bedeutung, sie wurde gezeigt<br />
und war dem <strong>in</strong>haltlichen Ziel untergeordnet. Das E<strong>in</strong>stellen der bl<strong>in</strong>de-kuh.de als Startseite<br />
wurde überwiegend <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelbetreuung vorgenommen. Benachbart sitzende Teams schauten<br />
jeweils zu und probierten es dann selbst. Zum genauen Lesen und Auswählen von gezielten<br />
Informationen bot die Unterrichtsstunde allerd<strong>in</strong>gs auch zu wenig Zeit!<br />
Rollenverteilung<br />
Ich übernahm die E<strong>in</strong>leitung der Unterrichtsstunde. Danach standen beide Kolleg<strong>in</strong>nen zu-<br />
sammen mit mir <strong>zur</strong> Unterstützung der Schüler <strong>zur</strong> Verfügung. Sie konnten dabei die gezeig-<br />
ten Arbeitsschritte der vorigen Unterrichtsstunde anwenden. Dies ermöglichte mir die gezielte<br />
Betreuung spezieller Probleme.<br />
3. Stunde<br />
Inhalt: Aufrufen e<strong>in</strong>er abgespeicherten Internetseite, Auswahl von Informationen, Öffnen<br />
e<strong>in</strong>es zweiten Dokuments, Markieren, Kopieren, E<strong>in</strong>setzen und Abspeichern als eigenes<br />
Dokument, Bearbeitung des eigenen Dokuments<br />
Methode: Wiederholen - Zeigen - Ausprobieren (E<strong>in</strong>zel- oder Partnerarbeit beibehalten) - E<strong>in</strong>-<br />
zelbetreuung<br />
Ergebnis: E<strong>in</strong>ige Schüler kopierten mit me<strong>in</strong>er Hilfe Texte und Bilder. Manche wiederholten<br />
die Arbeitsschritte der vorigen Stunden, um nach weiteren Internetseiten zu suchen und diese<br />
zu speichern. Sie wurden von den Kolleg<strong>in</strong>nen unterstützt. Bereits gezeigte Handgriffe zeigten<br />
sich die K<strong>in</strong>der gerne auch gegenseitig. Andere begannen, „ihr“ Dokument durch Verände-<br />
rung von Schriftgröße und Layout zu bearbeiten. Auftauchende Fragen wurden von mir oder<br />
den Kolleg<strong>in</strong>nen beantwortet. Das Lesen und Auswählen geeigneter Informationen erfordert<br />
Qualifikationen, die unabhängig vom Computere<strong>in</strong>satz s<strong>in</strong>d. Hierbei spielte die geleistete <strong>in</strong>-<br />
haltliche Vorarbeit der Kolleg<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>e wesentliche Rolle.<br />
Rollenverteilung<br />
Die Klassenlehrer<strong>in</strong> übernahm die <strong>in</strong>haltliche Umsetzung der Ziele ihres Unterrichtsvorha-<br />
bens. Die Erzieher<strong>in</strong> ergänzte sie durch Betreuung e<strong>in</strong>zelner Schüler. Ich bot Unterstützung <strong>zur</strong><br />
Bewältigung der Technik des gewählten Mediums. Ich war als Begleiter<strong>in</strong> und bei der Lösung<br />
auftauchender Schwierigkeiten gefragt.<br />
4. Stunde<br />
Geplanter Inhalt: Weiterarbeit an Inhalten, Gestalten und Ausdrucken des Dokuments als<br />
Grundlage für den Vortrag <strong>in</strong> der Klasse, Anleitungsskript <strong>zur</strong> Er<strong>in</strong>nerung wichtiger Arbeits-<br />
schritte. Die letzte Stunde des Vorhabens fiel aufgrund der Krankheit der Kolleg<strong>in</strong> aus und<br />
konnte <strong>in</strong> zeitlich angemessenem Abstand leider nicht mehr nachgeholt werden. Es wurde ver-<br />
abredet, dass das Anleitungsskript den Kolleg<strong>in</strong>nen ausgehändigt wird. Ich bot an bei Bedarf
e<strong>in</strong>zelne Schülerergebnisse auszudrucken. Nach Aussage der Kolleg<strong>in</strong>nen wurden im Verlauf<br />
des weiteren Unterrichts die Ergebnisse des Projekts mündlich <strong>in</strong> der Klasse vorgetragen. Die<br />
Rückmeldung <strong>zur</strong> durchgeführten Unterrichtsbegleitung war positiv, auch aus me<strong>in</strong>er Sicht.<br />
In Anbetracht der kurzen Zeit schien mir das Resultat zufrieden stellend, wenngleich im Er-<br />
gebnis nicht ganz abgeschlossen. Wichtig f<strong>in</strong>de ich, dass alle notwendigen Handgriffe zum<br />
Gebrauch des Werkzeugs Computer eng mit dem Thema verknüpft waren. Sie wurden schritt-<br />
weise gezeigt und <strong>in</strong> allen Unterrichtstunden geübt. Nur zu Beg<strong>in</strong>n standen die Werkzeuge im<br />
Mittelpunkt, im weiteren Verlauf blieb der Unterricht <strong>in</strong>haltlichen Zielen verpflichtet. Dies<br />
sche<strong>in</strong>t mir sowohl für die Lehrer<strong>in</strong>nen als auch für die Schüler entscheidend für erfolgreiches<br />
Lernen.<br />
Reflexion der Fortbildung<br />
Entscheidende Merkmale für die gelungene Fortbildung (Co-Teach<strong>in</strong>g) s<strong>in</strong>d aus me<strong>in</strong>er Sicht:<br />
• Absprachen über Erwartungen, Vorerfahrungen und Ziele,<br />
• Austausch über den Verlauf, den Zwischenstand und die weitere Vorgehensweise,<br />
• Interesse, aktive Lernbereitschaft von Schülern und Lehrer<strong>in</strong>nen,<br />
• Wechselnde Rollen- bzw. Aufgabenverteilung im Verlauf der Fortbildung: Lehrer<strong>in</strong> als Mit-<br />
lernende, als Helfer<strong>in</strong>, als Begleiter<strong>in</strong>, als Gestalter<strong>in</strong>; Fortbildner<strong>in</strong> als fachkompetente Mit-<br />
Gestalter<strong>in</strong>, Helfer<strong>in</strong>, Begleiter<strong>in</strong>,<br />
• Integration <strong>in</strong> die Unterrichtsarbeit (Vor- und Nachbereitung durch die Lehrer<strong>in</strong>),<br />
• Hilfe <strong>zur</strong> Selbsthilfe und Zusammenfassung der Arbeitsschritte (Anleitungsskript),<br />
• Technische Handgriffe werden an <strong>in</strong>haltlichen Zielen erlernt.<br />
Zu verbessern: Zeitplanung nicht so knapp bemessen!<br />
Das Anleitungsskript ist auf der CD-Rom zu f<strong>in</strong>den.<br />
Weitere Beispiele zum Co-teach<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>den sich auf der CD-Rom<br />
Co-Teach<strong>in</strong>g im Rahmen e<strong>in</strong>er Unterrichtse<strong>in</strong>heit zum Thema „Sucht“<br />
- Brigitte Meier<br />
Co-Teach<strong>in</strong>g im Rahmen der Unterrichtse<strong>in</strong>heit „Unser Sonnnensystem“<br />
- Brigitte Meier<br />
Co-Teach<strong>in</strong>g „E<strong>in</strong>führung der Schüler der E<strong>in</strong>gangsstufe <strong>in</strong> AppleWorks“<br />
- Sigrid Seidel<br />
99
100<br />
Co-teach<strong>in</strong>g Klasse 1 „Briefe verfassen“<br />
Brigitte Meier<br />
1. Allgeme<strong>in</strong>e Angaben<br />
Thema Unterrichtsbegleitung zum Thema „Briefe verfassen“<br />
Datum 20.Juni 2002 Dauer 2 Stunden<br />
Fortbildner<strong>in</strong> B. Meier Ort Computerraum der<br />
Schwielowsee-GS<br />
Teilnehmer<strong>in</strong> E<strong>in</strong>gangsstufenleiter<strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>gesetzte Medien G3-Server, 8 i-Macs, Beamer<br />
Anlass Die Kolleg<strong>in</strong> nutzte mit ihrer Gruppe (14 Schüler) das erste Mal den Computerraum und<br />
bat mich um Unterstützung.<br />
2. Erwartungen und Ziele der Beteiligten<br />
Erwartungen und Ziele der<br />
Teilnehmer<strong>in</strong><br />
• Die TN möchte die Schüler, die sich am Ende des 1. Schuljahres bef<strong>in</strong>den, mit dem<br />
Computerraum vertraut machen.<br />
• Sie möchte feststellen, ob die S die Arbeitstechniken, die sie am Rechner <strong>in</strong> der Klasse<br />
bereits geübt haben, auch <strong>in</strong> der neuen Umgebung anwenden können.<br />
• Durch me<strong>in</strong>e Anwesenheit hat die TN e<strong>in</strong>e „Rückversicherung“, falls die Anmeldung<br />
am Server nicht auf Anhieb klappen sollte.<br />
• In der Klasse haben bisher höchstens 2-3 Schüler gleichzeitig am Computer gearbeitet<br />
und die TN konnte auf deren Fragen zeitnah e<strong>in</strong>gehen. Im Computerraum gibt es ihr<br />
e<strong>in</strong>e Sicherheit, dass bei der Schülerzahl von 14 zwei Ansprechpartner für auftretende<br />
Probleme da s<strong>in</strong>d.<br />
• Sie möchte ihr Verhalten den Fehlern, Fragen oder Irrtümern von Schülern gegenüber<br />
beobachtet haben.<br />
• Die TN will das technische Problem „E<strong>in</strong>fügen von mehreren Anhängen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Email“<br />
geklärt haben.<br />
Wurden die Erwartungen und Ziele im Vorfeld abgefragt? x ja O ne<strong>in</strong><br />
Ziele der<br />
Fortbildner<strong>in</strong><br />
3. Ablauf bzw. Vorgehen<br />
Die TN soll eigene Unsicherheiten abbauen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Klima des Vertrauens ihren<br />
Unterricht reflektieren.<br />
Die TN wird <strong>in</strong> ihrem Vorhaben unterstützt, der Klasse Lernangebote zu machen, die<br />
e<strong>in</strong>erseits die Individualität der Lernenden berücksichtigen, andererseits die Kooperationsfähigkeit<br />
untere<strong>in</strong>ander fördern.<br />
Die TN gibt ihre eigene Medienkompetenz an die Schüler weiter.<br />
Die TN nutzt den Computer als e<strong>in</strong> Werkzeug <strong>zur</strong> Erreichung des Zieles, die Schreibkompetenz<br />
der Schüler zu erhöhen.<br />
Die TN fungiert als Berater<strong>in</strong> der Schüler, die ihre selbstgewählten Texte nach <strong>in</strong>dividuellem<br />
Tempo verfassen.<br />
Zeit Inhalt Situative Bed<strong>in</strong>gungen<br />
Briefe verfassen ist e<strong>in</strong> beliebter<br />
Schreibanlass <strong>in</strong> der 1. Klasse.<br />
Über wichtige Komponenten e<strong>in</strong>es<br />
Briefes (Anrede, Textteil, Grußformel,<br />
Unterschrift) war bereits<br />
im Unterricht gesprochen worden.<br />
Die meisten Schüler hatten schon<br />
Briefe für den seit e<strong>in</strong>iger Zeit<br />
existierenden Klassenbriefkasten<br />
verfasst.<br />
E<strong>in</strong>e Mitschüler<strong>in</strong>, deren Familie zwei Monate zuvor aus Deutschland<br />
weggezogen war, hatte der Klasse e<strong>in</strong>e Email geschickt. Die Schüler<br />
wollten ihr nun darauf antworten.<br />
E<strong>in</strong>e neue Situation und e<strong>in</strong>e gewisse Aufregung entstand dadurch, dass<br />
zum ersten Mal Briefe wirklich versendet werden sollten. (Wirklichkeitsbezug)
10 m<strong>in</strong> Die Schüler lernen den Computerraum<br />
kennen, schalten die Rechner<br />
e<strong>in</strong> und melden sich am Server an.<br />
Die Lehrer<strong>in</strong> demonstriert ihnen<br />
über den Beamer die nötigen 5<br />
Schritte für die Anmeldung.<br />
30 m<strong>in</strong> Die Schüler arbeiten zu zweit an<br />
e<strong>in</strong>em Computer. Sie öffnen das<br />
Programm Apple Works, stimmen<br />
sich über den Inhalt ihres Briefes<br />
ab, verfassen ihre Texte. Viele<br />
Schüler stellen Fragen zu Problemen<br />
wie Schriftgröße, Schriftstil<br />
verändern, manche wollen auch<br />
die Rechtschreibung bestimmter<br />
Wörter wissen.<br />
Die meisten Rechtschreibfehler<br />
werden jedoch nicht korrigiert.<br />
Durch e<strong>in</strong>e Umstellung der Serversoftware und der Zugangsmodalitäten<br />
hat sich für alle Benutzer des Computerraumes die Anmeldeprozedur<br />
verändert. Die Lehrer<strong>in</strong> hatte vor e<strong>in</strong>igen Monaten an e<strong>in</strong>em<br />
E<strong>in</strong>führungskurs für die Benutzung des Raumes teilgenommen. Hier<br />
gab sie ihr kürzlich erworbenes Wissen an die Schüler weiter.<br />
Diese Phase der Instruktion wird sehr aufmerksam von den Schülern<br />
verfolgt. E<strong>in</strong>e Erleichterung gegenüber der bisherigen Anmeldemethode<br />
ist die Tatsache, dass die Schüler nur noch ihren Klassennamen<br />
(z.B. 1c) und ke<strong>in</strong> Passwort mehr e<strong>in</strong>tippen müssen.<br />
Die Lehrer<strong>in</strong> geht auf Nachfrage zu den Schülern und gibt Hilfestellung.<br />
Ich mache mir Notizen zu folgenden Fragestellungen:<br />
• Wo liegen die Probleme der Schüler, welche Fragen werden gestellt?<br />
• Wie hilft die Lehrer<strong>in</strong> bei Problemen – re<strong>in</strong> verbal, verbal und Zeigen<br />
auf den Bildschirm, durch aktives Vormachen, durch Vorschlag auf Hilfe<br />
e<strong>in</strong>es Mitschülers <strong>zur</strong>ückzugreifen ?<br />
5 m<strong>in</strong> Speichern der Ergebnisse Hier verzichtet die Lehrer<strong>in</strong> bewussst auf e<strong>in</strong>e Instruktion am Beamer,<br />
da die Partner unterschiedlich mit ihren Texten fertig wurden und sie<br />
es wünschte, dass die gesamte Aufmerksamkeit auf die Textproduktion<br />
gelegt wird. E<strong>in</strong>ige Schüler wissen schon aus der Erfahrung mit dem<br />
Klassencomputer an welcher Stelle der Menüleiste geklickt werden<br />
muss, um Sichern zu können. Bei den meisten Schülern geht die Lehrer<strong>in</strong><br />
direkt an den Rechner und übernimmt das Speichern, um sicherzugehen,<br />
die Dokumente im Anschluss daran schnell wiederzuf<strong>in</strong>den,<br />
da sie ja gesammelt versendet werden sollten.<br />
5 m<strong>in</strong> Versenden der Briefe per Email Nachdem die Schüler den Raum verlassen haben, vollzieht die TN die<br />
Schritte zum E<strong>in</strong>fügen von Dokumenten, sie benötigt me<strong>in</strong>e Hilfe nur<br />
beim Auff<strong>in</strong>den des Ordners der Klasse.<br />
25 m<strong>in</strong> Nachbesprechung Anhand me<strong>in</strong>er Notizen werden<br />
a) die Schwierigkeiten der Schüler reflektiert<br />
b) das Lehrerverhalten analysiert<br />
4. Umsetzung spezieller Projektziele<br />
1. Situationsbezogen u. anhand authentischer<br />
Probleme lernen<br />
2. In vielfältigen Sachzusammenhängen lernen<br />
3. In sozialem Kontext lernen<br />
Die konkrete Situation, e<strong>in</strong>er abwesenden Mitschüler<strong>in</strong> über Geschehnisse<br />
<strong>in</strong> der Klasse zu berichten, führt zum Wunsch, Briefe am Computer<br />
zu verfassen.<br />
Die Schüler können die bereits <strong>in</strong> der Klasse geübten Techniken wie<br />
Markieren, Klicken mit der Maus auch im Computerraum anwenden.<br />
Die Schüler stimmen sich über den Inhalt ihrer Briefe ab, sie wechseln<br />
sich beim Tippen ab, entscheiden geme<strong>in</strong>sam über Schriftgröße<br />
und –stil. Sie s<strong>in</strong>d stolz, etwas Geme<strong>in</strong>sames geschafft zu haben. Die<br />
Lehrer<strong>in</strong> legt Wert darauf, dass Schülerexperten ihr Wissen an andere<br />
weitergeben.<br />
Die Kolleg<strong>in</strong> lässt sich bewusst „<strong>in</strong> die Karten gucken“, <strong>in</strong>dem sie<br />
den Wunsch äußerte, ihr Verhalten den Schülern gegenüber zu beobachten.<br />
Die „Deprivatisierung“ der Unterrichtspraxis wird hier<br />
gefördert, e<strong>in</strong> Austausch über Methodik, über das mitunter unbewusste<br />
Reagieren auf Schüleräußerungen, das <strong>in</strong> der Nachbesprechung<br />
anhand der Aufzeichnungen möglich wurde, fördert das kollegiale<br />
Mite<strong>in</strong>ander.<br />
101
102<br />
4. Mit <strong>in</strong>struktionaler Unterstützung lernen<br />
5. Lernumgebung<br />
6. Medienkompetenz<br />
5. Ergebnisse des Fortbildungskontakts<br />
Die Instruktion beschränkt sich auf das unbed<strong>in</strong>gt Nötige. Beim Verfassen<br />
der Texte wird den Schülern freie Hand gelassen.<br />
Beim Erstellen der Email mit den entsprechenden Anhängen braucht<br />
die Lehrer<strong>in</strong> lediglich e<strong>in</strong>e kurze Instruktion.<br />
Für die Schülergruppe ist es die erste Begegnung mit dem Computerraum.<br />
Sie f<strong>in</strong>den sich erstaunlich rasch <strong>zur</strong>echt und fragen beim<br />
H<strong>in</strong>ausgehen, wann sie wieder kommen dürfen.<br />
Für die Kolleg<strong>in</strong>, die bisher als Teilnehmer<strong>in</strong> an Workshops oder <strong>in</strong><br />
Teamsitzungen den Computerraum nutzte, ist es ebenfalls e<strong>in</strong>e Premiere.<br />
E<strong>in</strong>e deutliche Steigerung ist zu beobachten. Das kürzlich <strong>in</strong> Fortbildungen<br />
erworbene Wissen wird an die Schüler sehr souverän weitergegeben.<br />
Rückmeldung der Teilnehmer<strong>in</strong> • Die TN hatte vor dem Term<strong>in</strong> die Befürchtung geäußert, sie würde zu schnell e<strong>in</strong>greifen,<br />
wenn Schüler Probleme hätten, sie nicht lange genug alle<strong>in</strong> probieren lassen,<br />
aus Furcht, die bisherigen Ergebnisse könnten plötzlich „weg“ se<strong>in</strong>. Aufgrund me<strong>in</strong>er<br />
Beobachtung und weil sie sich auf diesen Punkt besonders konzentrierte, war nur<br />
beim Speichern die Situation, dass sie selbst <strong>zur</strong> Maus der Schüler griff und die nötigen<br />
Handgriffe erledigte. In allen anderen Problemsituationen schaffte sie es, erklärend und<br />
zum Probieren auffordernd den Fragen der Schüler zu begegnen. Über das anschließende<br />
Gespräch war die TN sehr froh. Sie wusste nun auch <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Häufigkeit<br />
bestimmter Fragestellungen, an welchen Schwerpunkten sie Übungen für die<br />
Schüler anbieten sollte. ( Benutzung der Zeilenschaltung nicht am Ende jeder Reihe,<br />
Verändern der Schriftart)<br />
Eigene E<strong>in</strong>schätzung • Die pr<strong>in</strong>zipiell sehr offene und zum Austausch bereite Kolleg<strong>in</strong> hat durch das Medium<br />
Computer die Chance ergriffen, über den eigenen Unterrichtsstil nachzudenken. Die<br />
Bereitschaft <strong>zur</strong> Reflexion und zum Verändern e<strong>in</strong>gefahrener Muster ist vorhanden.<br />
Was hat sich bewährt? • Es müssen vor Beg<strong>in</strong>n der Unterrichtsbegleitung Kriterien abgesprochen werden,<br />
nach denen der Unterricht beobachtet werden soll. Es war praktikabel, die beiden<br />
Schwerpunkte „Schülerprobleme und Lehrerreaktion“ zu protokollieren.<br />
• Ich ermuntere immer wieder Kolleg<strong>in</strong>nen, ihr erst kürzlich erworbenes Wissen auch<br />
relativ zeitnah an die Schüler weiterzugeben. In diesem Fall fühlte sich die Kolleg<strong>in</strong><br />
sicherer durch me<strong>in</strong>e Anwesenheit.
9.4 Fachforen<br />
Fachforum „Neue <strong>in</strong>s Boot“ - Dezember 2002<br />
Dokumentation der Veranstaltung des Fachforums <strong>in</strong> der Region Tempelhof-Schöneberg mit<br />
dem Ziel, neue Kolleg<strong>in</strong>nen für das Fachforum zu begeistern und <strong>in</strong> die bestehenden Gruppen<br />
zu <strong>in</strong>tegriere<br />
Doris Lerner<br />
Teilnehmer: 20 Kollegen aus den Grundschulen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, e<strong>in</strong> Mit-<br />
glied der bezirklichen Schulaufsicht<br />
Moderator<strong>in</strong>nen: Brigitte Meier / Doris Lerner<br />
Ort: Schwielowsee-Grundschule<br />
Zeit: 15.00 bis 17.00 Uhr<br />
Vorbemerkungen:<br />
Nachdem das Fachforum seit mehr als e<strong>in</strong>em Jahr Fachforum existierte, entstand der Ge-<br />
danke, neue Kollegen der Grundschulen <strong>in</strong> Tempelhof-Schöneberg, die ausgehend vom Fach<br />
Deutsch neue Medien <strong>in</strong> ihren Unterricht <strong>in</strong>tegrieren möchten, für die Mitarbeit <strong>in</strong> den Fach-<br />
foren zu gew<strong>in</strong>nen. Die Veranstaltung wurde ausgehend von der Annahme konzipiert, dass<br />
seit dem Start des Fachforums im Januar 2001 viele Kollegen h<strong>in</strong>zu gekommen s<strong>in</strong>d, die die<br />
Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht erst jetzt <strong>in</strong> ihrem Fokus haben.<br />
Während der Veranstaltung stellt sich heraus, dass es <strong>in</strong> Tempelhof und auch <strong>in</strong> Schöne-<br />
berg seit kurzem jeweils e<strong>in</strong>e Korbit-Modellschule gibt. An diesen Schulen wurde jeder Klas-<br />
senraum mit zwei Computern und e<strong>in</strong>em Drucker ausgestattet. Die Geräte im Klassenraum<br />
zw<strong>in</strong>gen die Kollegen sich mit ihnen ause<strong>in</strong>ander zu setzen und sie nach und nach <strong>in</strong> den Un-<br />
terricht zu <strong>in</strong>tegrieren. Da sich viele der Kollegen bisher noch nicht mit der Integration <strong>neuer</strong><br />
Medien <strong>in</strong> den Unterricht befasst haben, ist der Bedarf an unterrichtspraktischen Tipps und<br />
Anregungen groß. Es geht nicht darum, die existierenden Gruppen <strong>in</strong> Tempelhof und Schö-<br />
neberg um e<strong>in</strong>e weitere zu ergänzen. Es geht vielmehr darum, die neuen Kollegen <strong>in</strong>s Boot<br />
zu holen und nach e<strong>in</strong>er grundlegenden E<strong>in</strong>führungsveranstaltung <strong>in</strong> die bereits bestehenden<br />
Gruppen zu <strong>in</strong>tegrieren. Angemeldet hatten sich <strong>in</strong>sgesamt 17 Kollegen aus fünf Tempelhofer<br />
und drei Schöneberger Grundschulen sowie e<strong>in</strong> Vertreter der bezirklichen Schulaufsicht. Drei<br />
Kollegen kamen spontan.<br />
Wie bei den anderen konstituierenden Treffen sollte wiederum viel Wert darauf gelegt<br />
werden, den Frage- und Erwartungshorizont der Teilnehmer zu klären und ihnen e<strong>in</strong> erstes<br />
Spektrum konkreter Anregungen für den Unterricht zu geben. Sie sollten das Fachforum als<br />
bereichernd für ihre eigene Professionalisierung empf<strong>in</strong>den, konkrete Ideen und H<strong>in</strong>weise<br />
möglichst am nächsten Tag umsetzen können. Nur wenn das gel<strong>in</strong>gt, haben sie Interesse an<br />
weiteren Treffen.<br />
Ziel der Veranstaltung<br />
Zum e<strong>in</strong>en sollte es darum gehen, die Teilnehmer mit e<strong>in</strong>em bewährten <strong>Fortbildungskonzept</strong><br />
(teilnehmerorientiert, bedarfsgerecht, ortsnah) vertraut zu machen, zum anderen g<strong>in</strong>g es dar-<br />
103
104<br />
um, den Teilnehmern die Vorzüge des kollegialen Austauschs im S<strong>in</strong>ne von Lerngeme<strong>in</strong>schaf-<br />
ten bewusst zu machen, sie von den Erfahrungen anderer Kollegen profitieren zu lassen und<br />
ihnen mit konkreten Anregungen den E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Arbeit mit neuen Medien im Unterricht<br />
- ob nun mit wenigen Computern im Klassenraum oder mit e<strong>in</strong>er Klasse im Computerraum<br />
- zu erleichtern.<br />
Planungsüberlegungen<br />
Diese Veranstaltung des Fachforums f<strong>in</strong>det im Computerraum der Schwielowsee-Grundschule<br />
statt, um die Schule als Projektstandort <strong>in</strong> der Region herauszustellen.<br />
In dem Fachforum geht es immer auch um die Qualifizierung der Lehrenden h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>er<br />
sach- und zielgerichteten E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht. Es geht darum e<strong>in</strong>e<br />
kritische Fragehaltung aufzubauen, die Grenzen der neuen Medien bewusst zu machen. Das<br />
gilt auch und vor allem für die Kollegen, die bisher ke<strong>in</strong>e oder nur ger<strong>in</strong>ge Erfahrungen mit<br />
dem E<strong>in</strong>satz von Computern im Unterricht gemacht haben.<br />
Zunächst stellen die Moderator<strong>in</strong>nen sich, das Projekt „SEMIK – ForMeL G“ und das<br />
Konzept des Fachforums vor, geben e<strong>in</strong>en Ausblick auf die anstehenden Fachforen.<br />
In e<strong>in</strong>er kurzen Vorstellungsrunde wird der Frage- und Erwartungshorizont der Teilnehmer<br />
geklärt.<br />
Erwartet werden Fragen, die sich auf kle<strong>in</strong>e Unterrichtsbeispiele im Klassenraum mit wenigen<br />
Rechnern oder im Computerraum mit e<strong>in</strong>er ganzen Lerngruppe beziehen. Die zu erwartenden<br />
Fragen nach „guter Lernsoftware“ sollten <strong>in</strong> dieser Veranstaltung nicht thematisiert werden.<br />
Die Ause<strong>in</strong>andersetzung mit Lernsoftware wäre für die Kollegen, die sich am Anfang der In-<br />
tegration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht bef<strong>in</strong>den nur <strong>in</strong>teressant, wenn genug Zeit für e<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>tensive Ause<strong>in</strong>andersetzung wäre, sie schon e<strong>in</strong>e konkrete Vorstellung hätten, zu welchem<br />
Zweck sie Software benötigen und ihre Anschaffungswünsche an den Schulen realisiert wer-<br />
den könnten.<br />
Für die Mehrheit der Teilnehmer dürften Unterrichtsanregungen, die mit e<strong>in</strong>em Textverar-<br />
beitungsprogramm und e<strong>in</strong>em Internetanschluss zu realisieren s<strong>in</strong>d - und damit an ihren Vor-<br />
erfahrungen anknüpfen - zu diesem Zeitpunkt effektiver se<strong>in</strong>. Nach den W<strong>in</strong>terferien werden<br />
sich die Teilnehmer des Fachforums mit der Computer-Lernkartei „Individuelles Grundwort-<br />
schatztra<strong>in</strong><strong>in</strong>g“ befassen. Um den Kollegen den E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Arbeit mit dem Computer im<br />
Unterricht (Klassenraum oder Computerraum) zu erleichtern, werden ihnen zunächst e<strong>in</strong>ige<br />
bewährte praktikable Unterrichtsbeispiele präsentiert, die mit e<strong>in</strong>em Textverarbeitungspro-<br />
gramm, das auf jedem Rechner <strong>in</strong>stalliert ist, realisiert werden können.<br />
Die Teilnehmer zeigen großes Interesse an ganz konkreten Tipps (kle<strong>in</strong>e Lerngruppen zum<br />
Angewöhnen - Förderk<strong>in</strong>der, DaZ-Gruppen, Teilungsgruppen -, überschaubare Vorhaben, um<br />
sich selbst und die Schüler nicht zu überfordern, Schüler als Helfer bei technischen Problemen<br />
nutzen...), sie stellen konstruktive Fragen, die sich zunächst vor allem auf technische Überle-<br />
gungen beziehen (Wo speichere ich, damit es wieder gefunden wird? E<strong>in</strong> Ordner pro Schüler?<br />
E<strong>in</strong> Ordner pro Lernbereich?), sie sprechen aber auch unterrichtspraktische Probleme an (Wie<br />
muss Unterricht organisiert se<strong>in</strong>, wenn es zwei Rechner im Raum gibt? Was mache ich, wenn<br />
ich <strong>in</strong> Folgestunden nicht <strong>in</strong> den Computerraum komme?). In der Diskussion wird ihnen sehr<br />
schnell deutlich, dass zwei Computer im Klassenraum nur s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> den Unterricht <strong>in</strong>tegriert<br />
werden können, wenn er <strong>in</strong>sgesamt offener und differenzierter gestaltet wird.
Basierend auf e<strong>in</strong>em konstruktivistischen Lernbegriff und um ihre eigene Medienhandha-<br />
bungskompetenz zu erweitern, sollen die Teilnehmer im Rahmen dieser Veranstaltung die<br />
Gelegenheit erhalten am Computer zu arbeiten, Unterrichtsideen zu entwickeln und zu kon-<br />
kretisieren (L<strong>in</strong>ktipps) bzw. Vorgaben (Internetrallye) zu erproben und für ihre Lerngruppe zu<br />
modifizieren. Ausgewählte L<strong>in</strong>ktipps dienen dazu, den Teilnehmern die vielfältigen Möglich-<br />
keiten, die im Internet für den Unterricht stecken aufzuzeigen, sie neugierig zu machen. Die<br />
Teilnehmer können entsprechend ihrer <strong>in</strong>dividuellen unterrichtlichen Bedürfnisse im Internet<br />
surfen.<br />
Bei der Internetrallye handelt es sich um e<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Fachforum entstandenes Arbeitsergebnis<br />
(Suchaufträge zum Thema „Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg“), das mit kle<strong>in</strong>en Modifikati-<br />
onen auf die eigene Lerngruppe zugeschnitten werden kann.<br />
Eventuell auftretende Probleme während der Arbeitsphase am Computer können <strong>in</strong> der<br />
Gruppe geme<strong>in</strong>sam gelöst werden. Die Teilnehmer erfahren so situiert die Vorzüge e<strong>in</strong>er ler-<br />
nenden Geme<strong>in</strong>schaft, erfahren sich selbst als Lernende und beg<strong>in</strong>nen, über e<strong>in</strong>e veränderte<br />
Lehrerrolle zu reflektieren. Auftretende Fragen <strong>zur</strong> Unterrichtsdurchführung werden vorweg-<br />
genommen, Handlungsstrategien und Reaktionsweisen auf eventuell auftretende Schwierig-<br />
keiten im Unterricht können <strong>in</strong> der Gruppe besprochen werden. Wegen der großen Teilneh-<br />
merzahl müssen die Teilnehmer zu zweit an e<strong>in</strong>em Rechner arbeiten, was sie erfahrungsgemäß<br />
aber auch bei e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>geren Teilnehmerzahl tun würden, da Partnerarbeit stärkt und Un-<br />
sicherheiten auffängt. In e<strong>in</strong>er Schlussrunde im Plenum werden Erkenntnisse im Zusammen-<br />
hang mit der eigenaktiven Phase ausgetauscht.<br />
Es gab durchweg positive Rückmeldungen. Die Kollegen begrüßten das Angebot „Fachfo-<br />
rum“, fühlten sich bestärkt, hatten Ideen und Mut gewonnen, das Erfahrene bald im Unter-<br />
richt umzusetzen.<br />
Fazit<br />
Die hohe Teilnehmerzahl der Veranstaltung hat gezeigt, dass der Bedarf an standortnahen,<br />
bedarfsbezogenen Fortbildungen vorhanden ist, dass Lehrer – entgegen der landläufigen<br />
Me<strong>in</strong>ung – Innovationen gegenüber aufgeschlossen und sehr wohl bereit s<strong>in</strong>d, sich <strong>in</strong> ihrer<br />
Freizeit zu qualifizieren, um <strong>in</strong> ihrem Unterrichtsalltag bestehen zu können. Das Ziel dieser<br />
Veranstaltung, neue Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>s „Fachforum-Boot“ zu holen, kann als gelungen bezeich-<br />
net werden. Die Mischung, zunächst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vorstellungsrunde die Erwartungen der Teilneh-<br />
mer zu klären, ihnen dann konkrete Unterrichtstipps zu geben , sie anschließend selbst an den<br />
Computern tätig werden zu lassen, hat sich erneut bewährt. Die ganze Zeit war e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensive<br />
Lernatmosphäre wahrzunehmen.<br />
Die Teilnehmer haben großes Interesse an weiteren Veranstaltungen, drei haben sich bereits<br />
zum nächsten Fachforum (e<strong>in</strong>e Woche nach der E<strong>in</strong>führungsveranstaltung und mitten <strong>in</strong> der<br />
Adventszeit...) angemeldet, um weitere Anregungen zu bekommen.<br />
105
106<br />
Fachforum „Erstellen e<strong>in</strong>er Internetrallye“<br />
Beispiel für Planung und Ablauf e<strong>in</strong>es Fachforums “Neue Medien im Deutschunterricht der<br />
Grundschule” - Erstellen e<strong>in</strong>er Internetrallye - Lernchancen für die Schüler<br />
Doris Lerner<br />
Auf der Grundlage der projektspezifischen Ziele von „SEMIK- ForMeL G“ und der darauf<br />
basierenden Konzeption des Fachforums, das sich mit der Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den<br />
Deutschunterricht ause<strong>in</strong>ander setzt, soll hier e<strong>in</strong> Treffen der Kollegen ausführlicher darge-<br />
stellt werden.<br />
Bei ForMeL G geht es e<strong>in</strong>erseits um die Qualifizierung der Lehrenden h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>er<br />
sach- und zielgerichteten E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht und damit zusammen<br />
hängend um die Implementierung veränderter Formen des Lehrens und Lernens, die selbst-<br />
gesteuertes und situiertes Lernen und kooperative Arbeitsverfahren unterstützen. Da sich die<br />
Teilnehmer das Thema beim vorigen Treffen selbst gestellt hatten, lag es <strong>in</strong> ihrem Interessen-<br />
fokus. Im H<strong>in</strong>blick auf konstruktivistische Lerntheorien s<strong>in</strong>d Motivation und Interesse e<strong>in</strong>e<br />
wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Lernprozesse.<br />
Während der Veranstaltung war die Eigenaktivität der e<strong>in</strong>zelnen Teilnehmer sehr hoch. Sie<br />
erarbeiteten sich den Inhalt im geme<strong>in</strong>samen Tun, erfuhren <strong>in</strong> der Situation e<strong>in</strong>e veränderte<br />
Lehr- und Lernkultur - e<strong>in</strong>e veränderte Fortbildungskultur - die sie unter Berücksichtigung<br />
e<strong>in</strong>iger Modifizierungen auf ihren eigenen Unterricht übertragen könnten.<br />
Während der gesamten Veranstaltung war e<strong>in</strong>e entspannte, produktive Arbeitsatmosphäre<br />
wahrzunehmen. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich entsprechend ihrer eigenen Inter-
essen und Fähigkeiten dem Inhalt zu nähern, an ihre Vorerfahrungen anzuknüpfen und an der<br />
Thematik zu arbeiten. Sie äußerten offen ihre Ideen und Erfahrungen, unterstützten sich ge-<br />
genseitig, wenn sie zum Beispiel im Rahmen der eigenen Bedienkompetenz an Grenzen stießen<br />
und verstanden sich als Lernende <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaft.<br />
Zwölf Kollegen aus den Tempelhofer Grundschulen trafen sich im Computerraum der Kie-<br />
pert-Grundschule, <strong>in</strong> dem ausreichend Rechner mit Internetzugang <strong>zur</strong> Verfügung standen.<br />
Für mich als Moderator<strong>in</strong> war das Ziel dieser Veranstaltung, die Vere<strong>in</strong>barung aus dem<br />
vorigen Treffen aufzugreifen und e<strong>in</strong>en kollegialen Austausch zu <strong>in</strong>itiieren, <strong>in</strong> dem die Teil-<br />
nehmer für die Lernpotenziale, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Internetrallye stecken, sensibilisiert werden. Es<br />
sollten geme<strong>in</strong>sam Bauste<strong>in</strong>e für e<strong>in</strong>e Internetrallye durch Berl<strong>in</strong>-Tempelhof zusammengestellt<br />
werden. Die Lehrer wollten im Rahmen des Treffens - im geme<strong>in</strong>samen Tun - für das Thema<br />
<strong>in</strong>teressante URLs austauschen und ihre eigene Bedienkompetenz h<strong>in</strong>sichtlich der Nutzung<br />
des Internet erweitern und vervollkommnen (Nutzung von Suchmasch<strong>in</strong>en, Auswählen und<br />
Integrieren von Bildern...).<br />
Bei der Realisierung im Unterricht sollen die Schüler im Rahmen der Internetrallye Interes-<br />
santes und Wissenswertes über ihren Bezirk erfahren, vertrauter mit dem Internet werden und<br />
Kompetenzen erwerben, die für e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>nvollen Umgang mit dem Internet unabd<strong>in</strong>gbar s<strong>in</strong>d<br />
(Suchstrategien, Lesetechniken, korrekte E<strong>in</strong>gabe e<strong>in</strong>er URL, Aufnahme und Bewertung von<br />
Informationen ...).<br />
Planerische Vorüberlegungen<br />
Bereits mit der E<strong>in</strong>ladung wurden die Teilnehmer aufgefordert, Ideen und Vorschläge zum<br />
Thema mitzubr<strong>in</strong>gen. Für den Fall, dass wider Erwarten ke<strong>in</strong>e Ideen aus dem Teilnehmerkreis<br />
kämen bzw. die Vorschläge wenig konkret wären, hatte ich e<strong>in</strong>e offen gehaltene Vorlage mit<br />
möglichen Zielen, Inhalten und e<strong>in</strong>er Auswahl von URLs erstellt, die Anhaltspunkte und<br />
somit e<strong>in</strong>e Struktur für das Vorhaben geben könnte. Die <strong>zur</strong> Verfügung stehende Zeit (ca.<br />
zwei Zeitstunden) sollte möglichst <strong>in</strong>haltsbezogen und themenorientiert genutzt werden. Auf<br />
ke<strong>in</strong>en Fall wollte ich der Gruppe e<strong>in</strong>e bestimmte Form der Internetrallye vorgeben. Mir war<br />
es wichtig, dass jeder se<strong>in</strong>e eigenen Interessen und Vorstellungen während des Fachforums<br />
verwirklichen konnte. Ich wollte lediglich e<strong>in</strong>en Rahmen bereit stellen, <strong>in</strong>nerhalb dessen jeder<br />
Teilnehmer alle<strong>in</strong> oder im Team se<strong>in</strong>e eigenen Schwerpunkte setzen konnte.<br />
Ich stellte mir vor, dass die Teilnehmer nach der bereits <strong>in</strong>stitutionalisierten „Aktuellen Vier-<br />
telstunde“, <strong>in</strong> der Interessantes, Literaturtipps, L<strong>in</strong>ktipps und Ähnliches ausgetauscht werden,<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Phase des Ausprobierens und des Austauschs eventuell <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Gruppen erste Bei-<br />
spiele für e<strong>in</strong>e Internetrallye entwickeln, die dann zusammengetragen und ausgetauscht, wer-<br />
den sollten. Dabei wären verschiedene Formen e<strong>in</strong>er Internetrallye denkbar, wie zum Beispiel<br />
e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>e-Version, bei der die Ergebnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Dokument e<strong>in</strong>getragen werden müssten<br />
oder Suchaufgaben, deren Ergebnisse per Hand auf e<strong>in</strong>em Arbeitsblatt e<strong>in</strong>getragen werden<br />
können, was sicher zunächst die e<strong>in</strong>fachere Variante darstellen würde. Der nächste Schritt wä-<br />
re, die gesammelten Vorschläge <strong>in</strong> der Unterrichtspraxis zu erproben, sie zu modifizieren und<br />
nach e<strong>in</strong>iger Zeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Folgesitzung erneut zu diesem Thema auszutauschen. Während der<br />
Phase des Sammelns und Ausprobierens, sollten <strong>in</strong>teressante URLs auf Moderationskarten<br />
geschrieben und sichtbar aufgehängt werden, um laufend Anregungen zu geben und sie allen<br />
<strong>zur</strong> Verfügung zu stellen.<br />
107
108<br />
Wichtig war auch, dass am Ende der Veranstaltung alle Teilnehmer die Ergebnisse des Nach-<br />
mittags mit nach Hause nehmen konnten (Diskette, E-Mail an die eigene Adresse), oder sie<br />
ihnen zeitnah – <strong>in</strong>nerhalb weniger Tage - per E-Mail zugehen. E<strong>in</strong>e gewisse Sicherheit im Um-<br />
gang mit dem Internet, das geme<strong>in</strong>same Lernerlebnis am Nachmittag und die Lust, das Erfah-<br />
rene mit Schülern umzusetzen, sollten nicht dadurch ausgebremst werden, dass die Ergebnisse<br />
nicht unmittelbar <strong>zur</strong> Verfügung stehen. (D<strong>in</strong>ge, die man sich vornimmt, sollten möglichst<br />
rasch begonnen und realisiert werden - <strong>in</strong>nerhalb von 72 Stunden. Dies ist e<strong>in</strong>e bewährte Ma-<br />
nagerregel. Vergeht mehr Zeit, ist der Elan verpufft, man fühlt sich vielleicht nicht mehr so<br />
sicher und fängt gar nicht erst an.)<br />
Durchführung<br />
Die Kollegen brachten teilweise Ideen und erste Versuche e<strong>in</strong>er Internetrallye mit (die sie<br />
zunächst verschwiegen), teilweise waren sie aus Neugier gekommen. Wir verabredeten, uns<br />
zunächst ca. zwanzig M<strong>in</strong>uten im Internet umzusehen, Seiten auszuprobieren, uns <strong>in</strong> die The-<br />
matik e<strong>in</strong>zudenken und Ideen zu sammeln. Auf Moderationskarten sammelte ich Vorschläge<br />
für L<strong>in</strong>ktipps der Kollegen zum Thema Berl<strong>in</strong> und heftete sie sichtbar an die Fenster. Sie f<strong>in</strong>-<br />
den sich auch <strong>in</strong> dem Arbeitsergebnis, das auf der Grundlage der Vorlage erstellt wurde. Mit<br />
zwanzig M<strong>in</strong>uten war diese Phase allerd<strong>in</strong>gs von vornhere<strong>in</strong> zu knapp angesetzt, die ‚Probier-<br />
phase‘ dauerte fast doppelt so lange.<br />
Gruppenprozesse<br />
Der Forscherdrang e<strong>in</strong>iger Kollegen hatte nach etwa e<strong>in</strong>er halben Stunde nachgelassen und<br />
ich nahm erste Frustrationen wahr. E<strong>in</strong>ige wussten nicht, was man nun mit den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Websites zum Thema Berl<strong>in</strong> anfängt, wie man die Ideen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Form br<strong>in</strong>gt. E<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong>,<br />
die an diesem Nachmittag zum ersten Mal an der Runde teilnahm, von dem großen Anteil<br />
an Eigenaktivität bei e<strong>in</strong>er Fortbildung etwas überrascht war und damit zunächst Probleme<br />
hatte, forderte stärkere Lenkung und e<strong>in</strong>deutigere Arbeitsaufträge. Am Ende äußerte sie je-<br />
doch große Zufriedenheit und wirkte erleichtert. Sie sah die ‚Probierphase’ nun als notwendig<br />
und produktiv, hatte das Gefühl, viel für sich und ihren Unterricht mitzunehmen. Sie hatte<br />
neue Lernerfahrungen gemacht und war sehr motiviert für Folgetreffen. In e<strong>in</strong>em Gespräch<br />
während dieser Phase vertraute mir e<strong>in</strong>e andere Kolleg<strong>in</strong> an, sie habe zu Hause schon mal<br />
angefangen und e<strong>in</strong>ige Fragen aufgeschrieben. Nachdem sie zu Beg<strong>in</strong>n des Treffens noch nicht<br />
den Mut gehabt hatte (sie empfand ihre Arbeit als nicht vorzeigbar), <strong>in</strong> Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
mit Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> der ‚Probierphase‘ aber feststellte, dass sie e<strong>in</strong>en produktiven Beitrag leis-<br />
ten könnte, stellte sie ihre Versuche nun allen Kollegen <strong>zur</strong> Verfügung. Sie erntete großen Zu-<br />
spruch, hatte sie der Gruppe doch e<strong>in</strong> Gerüst für den Fragenkatalog geliefert.<br />
Ich lernte aus dieser Phase, dass es wichtig ist, den Kollegen Irrwege zu ermöglichen, ihnen<br />
damit Zutrauen <strong>in</strong> ihre eigenen Fähigkeiten zu vermitteln, diese Frustphasen auszuhalten und<br />
als wichtigen gruppendynamischen Prozess zu begreifen. Insgesamt war <strong>in</strong> dieser Phase e<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>tensive, entspannte Arbeitsatmosphäre wahrzunehmen, <strong>in</strong> der die Kollegen sich gegenseitig<br />
unterstützten bei der Erweiterung ihrer Bedienkompetenz, <strong>in</strong> der sie sich auf verschiedene<br />
Inhalte h<strong>in</strong>wiesen und geme<strong>in</strong>sam Ideen entwickelten. Das Szenario war beispielhaft für <strong>in</strong>-<br />
tensives geme<strong>in</strong>sames Lernen an e<strong>in</strong>em konkreten Inhalt mit e<strong>in</strong>er konkreten Zielstellung und<br />
stand damit <strong>in</strong> Passung zu den Projektzielen.
Um Prozesse und Stimmungen während dieser Phase <strong>in</strong> der Gruppe aufzugreifen, bat ich die<br />
Kollegen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kreis zusammen, wollte sie an der Planung der Schlussphase beteiligen.<br />
Ergebnissicherung<br />
Wir beschlossen die letzte halbe Stunde dazu zu nutzen, Fragen und Aufgabenstellungen für<br />
e<strong>in</strong>en Fragenkatalog, der je nach Interessenschwerpunkten erweitert und modifiziert werden<br />
könnte. E<strong>in</strong> Kollege übernahm es, diese Fragen gleich aufzuschreiben, um die Ergebnissiche-<br />
rung für alle zu gewährleisten. Die Diskette nahm ich mit und erstellte zu Hause unser Ar-<br />
beitsergebnis, das ich an alle Kollegen mailte.<br />
Nachhaltigkeit - Internet im Unterricht<br />
Anschließend g<strong>in</strong>gen wir geme<strong>in</strong>sam der Frage nach, welche Lernchancen für Schüler <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Internetrallye stecken könnten. Erschöpfend beantwortet werden konnte die Frage nicht, aber<br />
im Rahmen des Gesprächs wurde e<strong>in</strong> breites Spektrum potenzieller Lernchancen aufgedeckt:<br />
• Internet als Inhalt - Internet als Werkzeug<br />
• Selbstständige Erarbeitung fachlicher Inhalte für Lernbereiche/Fächer<br />
• Kritische Ause<strong>in</strong>andersetzung und Bewertung von Informationen; Auswahl und Aufberei-<br />
tung von Informationen<br />
• Erweiterung der Mediennutzungskompetenz h<strong>in</strong>sichtlich Internet, Suchmasch<strong>in</strong>en, E<strong>in</strong>gabe<br />
von URLs...<br />
• Erweiterung der Lesekompetenz, <strong>in</strong>sbesondere der Lesestrategien; Informationssuche, Infor-<br />
mationsverarbeitung<br />
• Vergleich verschiedener Informationsquellen (Internet, Pr<strong>in</strong>tmedien, Filme, Fachleute).<br />
Fazit<br />
Die differenzierte, teilnehmerorientierte, die Gruppe im Blick habende, aber gleichzeitig offene<br />
Planung bewährte sich. Die Teilnehmer empfanden die <strong>in</strong>tensive, konstruktive, geme<strong>in</strong>same<br />
Arbeit als sehr bereichernd und Mut machend für eigene Aktivitäten mit Schülern.<br />
Sie hatten Ideen für ihren Unterricht gesammelt, sich über unterrichtsorganisatorische D<strong>in</strong>ge<br />
ausgetauscht und im geme<strong>in</strong>samen Tun Stärkung für den Umgang mit neuen Medien erfah-<br />
ren. Für das Gel<strong>in</strong>gen der Veranstaltung war es hilfreich, im Vorfeld e<strong>in</strong>e erste Vorlage zu<br />
erstellen, damit sich die Kollegen schneller <strong>in</strong> die Thematik e<strong>in</strong>denken konnten und die Zeit<br />
effektiv genutzt wurde.<br />
Die Materialien der Veranstaltung f<strong>in</strong>den sich auf der CD-Rom.<br />
109
110<br />
Fachforum „Lesen am und mit dem Computer“<br />
Doris Lerner<br />
Dokumentation des 7. Fachforums (27. Mai 2002)<br />
“Neue Medien im Deutschunterricht der Grundschule” - Tempelhof<br />
Teilnehmer: zehn Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen aus den Tempelhofer Grundschulen<br />
Ziel der Veranstaltung war es, sich auf dem H<strong>in</strong>tergrund der PISA-Studie mit dem Teilbereich<br />
Lesen im Zusammenhang mit dem Computer ause<strong>in</strong>ander zu setzen. Die Teilnehmer sollten<br />
für die Vielfalt dieses Themenspektrums geöffnet und sich darüber klar werden, <strong>in</strong>wieweit die<br />
Integration des Computers LESEN verändert, andere Strategien und Techniken, andere Lese-<br />
haltungen erfordert.<br />
Planungsüberlegungen<br />
Wir hatten uns <strong>in</strong> der Grundschule im Taunusviertel verabredet, weil dort e<strong>in</strong> Raum mit aus-<br />
reichend Rechnern mit Internetzugang <strong>zur</strong> Verfügung stand, die wir eventuell nutzen wollten.<br />
Die Teilnehmer wurden mit der E<strong>in</strong>ladung aufgefordert, Ideen und Vorschläge zum Thema<br />
mitzubr<strong>in</strong>gen.<br />
In dem Fachforum geht es immer auch um die Qualifizierung der Lehrenden h<strong>in</strong>sichtlich<br />
e<strong>in</strong>er sach- und zielgerichteten E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Unterricht. E<strong>in</strong>e Ause<strong>in</strong>-<br />
andersetzung mit dem eigenen Lesebegriff und dem eigenen Verständnis von Lesekompetenz<br />
- auf Schule und Unterricht bezogen - erschien mir deshalb e<strong>in</strong> günstiger E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die The-<br />
matik. In der Vorbereitung fiel mir auf, dass konkrete Beispiele, die Lesen am oder mit dem<br />
Computer explizit <strong>in</strong> den Fokus nehmen, kaum zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d. Mir wurde allerd<strong>in</strong>gs schnell<br />
deutlich, dass wir <strong>in</strong> den vergangenen Fachforen zahlreiche unterrichtspraktische Beispiele<br />
ausgetauscht hatten (Schreibvorhaben, Internetrallye), die sich - wenn man den Blick auf<br />
diesen Unterricht etwas ändert - hervorragend eignen, ihre Chancen h<strong>in</strong>sichtlich LESEN und<br />
LESEFÖRDERUNG aufzudecken und für die Schüler nutzbar zu machen. Diese Chancen<br />
wollte ich nutzen. Der Umgang mit den neuen Medien verlangt e<strong>in</strong> anderes Leseverhalten,<br />
Lesekompetenz ist - seit PISA wissen wir es alle - e<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzung <strong>zur</strong> Teilnahme<br />
am gesellschaftlichen Leben. Die Nutzung von Computer und Internet ist für die Kollegen<br />
teilweise noch immer e<strong>in</strong>e Herausforderung und darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e gute Gelegenheit, sich<br />
e<strong>in</strong>mal wieder grundsätzlich mit dem Teilbereich LESEN ause<strong>in</strong>ander zu setzen. Ich <strong>in</strong>itiierte<br />
zunächst e<strong>in</strong>e Ause<strong>in</strong>andersetzung mit dem eigenen Lesebegriff, um den Teilnehmern auf die-<br />
ser Grundlage bewusst zu machen, dass Lesen mehr bedeutet als e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>derbuch zu lesen und<br />
mehr ist, als dass Schüler e<strong>in</strong>en Text gut vorlesen können.<br />
Leseunterricht <strong>in</strong> der Schule ist für mich wie ...<br />
Diesen Impuls sollten die Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelarbeit bildhaft ergänzen, was ihnen nicht<br />
leicht fiel. Es war Widerstand zu spüren, e<strong>in</strong>ige schrieben dann aber doch spontane Gedanken<br />
auf, die zunächst e<strong>in</strong>e sehr e<strong>in</strong>geschränkte Sicht deutlich werden ließen:<br />
... e<strong>in</strong> mühsamer Weg mit vielen Ste<strong>in</strong>en...<br />
üben, üben, üben..
e<strong>in</strong>e Geduldsprobe...<br />
e<strong>in</strong>e große Herausforderung, für die vielfältige Fähigkeiten tra<strong>in</strong>iert werden müssen...<br />
Die Kollegen wurden mit dieser Aufgabe von mir ziemlich überrumpelt, die Äußerungen spie-<br />
geln das wider, was sie spontan mit dem Impuls verbanden. Sie sollten nicht kommentiert,<br />
sondern lediglich als Anregungen von der Gruppe <strong>zur</strong> Kenntnis genommen werden.<br />
Im Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> wäre es s<strong>in</strong>nvoll gewesen, dieses Verfahren am Ende der Veranstaltung zu<br />
wiederholen oder ihnen auch am Anfang schon mehr Zeit zu lassen. Andererseits diente mir<br />
diese Sequenz lediglich als Öffner für die Thematik. Im Austausch stellte sich heraus, dass<br />
eigentlich noch ke<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong> während ihrer Arbeit mit neuen Medien im Unterricht speziell<br />
Lesen oder Leseförderung im Blick gehabt hatte, sondern immer eher von den sich aufdrän-<br />
genden Zielen und vordergründigen Aktivitäten ausgegangen war (Die Schüler sollten Texte<br />
überarbeiten, sie sollten Informationen im Internet suchen, ...). Dass zum Beispiel e<strong>in</strong>e Inter-<br />
netrecherche von den Schülern eher zu bewältigen ist, wenn man se<strong>in</strong>en Unterricht mit der<br />
„Lesebrille“ plant und sich im Vorfeld überlegt, welche Strategien die Schüler beherrschen<br />
müssen, damit sie Informationen f<strong>in</strong>den und wie ich als Lehrer<strong>in</strong> diese Kompetenzen fördern<br />
kann, wurde den Teilnehmer <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>samen Ause<strong>in</strong>andersetzung bewusst.<br />
Um e<strong>in</strong>e Gesprächsbasis zu haben und die Ause<strong>in</strong>andersetzung zu fundieren, verteilte ich<br />
e<strong>in</strong>e Vorlage mit e<strong>in</strong>igen passenden Zitaten. Damit wollte ich das Verständnis von LESEN/<br />
LESEKOMPETENZ <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Vielfalt deutlich werden lassen und es den Kollegen gleichzeitig<br />
ermöglichen, ihre eigene Sichtweise zu überdenken und gegebenenfalls zu modifizieren.<br />
Wir erarbeiteten geme<strong>in</strong>sam wichtige Aspekte und Facetten der Thematik. Während dieser<br />
Phase war deutlich zu spüren, dass vielen erst jetzt die Komplexität des Teilbereichs LESEN,<br />
besonders im Zusammenhang mit neuen Medien, bewusst wurde.<br />
Lesekompetenz (PISA)<br />
„Lesekompetenz ist mehr als e<strong>in</strong>fach nur lesen zu können. Unter Lesekompetenz versteht<br />
PISA die Fähigkeit, geschriebene Texte unterschiedlicher Art <strong>in</strong> ihren Aussagen, ihren Ab-<br />
sichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en größeren Zusammenhang e<strong>in</strong>-<br />
ordnen zu können, sowie <strong>in</strong> der Lage zu se<strong>in</strong>, Texte für verschiedene Zwecke sachgerecht zu<br />
nutzen. Nach diesem Verständnis ist Lesekompetenz nicht nur e<strong>in</strong> wichtiges Hilfsmittel für<br />
das Erreichen persönlicher Ziele, sondern e<strong>in</strong>e Bed<strong>in</strong>gung für die Weiterentwicklung des ei-<br />
genen Wissens und der eigenen Fähigkeiten – also jeder Art selbständigen Lernens – und e<strong>in</strong>e<br />
Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.“<br />
„Das Sachwissen muss höher se<strong>in</strong> als beim Lesen von Texten, da die Lesenden die verstreu-<br />
ten Informationsportionen auff<strong>in</strong>den, reduzierte und auf den Punkt gebrachte Angaben <strong>in</strong><br />
den Hypertexte<strong>in</strong>heiten anreichern und isolierte Informationsportionen eigenständig <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Zusammenhang br<strong>in</strong>gen müssen. Die Lesefähigkeit muss gut ausgebildet se<strong>in</strong>, um die wesent-<br />
lichen und unwesentlichen Informationen auf dem Bildschirm schnell erfassen und strategisch<br />
und zielgeleitet „surfen“ zu können.“ (Schnotz, angeführt von Inge Blatt <strong>in</strong>: Thomé/Thomé<br />
(Hg.): Computer im Deutschunterricht der Sekundarstufe, Braunschweig 2000, S. 29..<br />
„Um beim Lesen Hypothesen bilden zu können, ist vor allem das schnelle Erkennen von<br />
Strukturen erforderlich, da es die Basis für Textverstehen liefert“ (Smith, angeführt von Inge<br />
111
Blatt <strong>in</strong>: Thomé/Thomé (Hg.): Computer im Deutschunterricht der Sekundarstufe. Braun-<br />
schweig 2000, S. 30.)<br />
„Auch setzt Computer-Literacy e<strong>in</strong>e ausgebildete Lesekompetenz voraus. Auf Dauer wird<br />
sich <strong>in</strong> der Informationsgesellschaft nur derjenige <strong>zur</strong>echtf<strong>in</strong>den und behaupten können, der<br />
die verfügbaren Ressourcen für Information, Wissen und Persönlichkeitsbildung selbstbe-<br />
stimmt zu nutzen gelernt hat. Dafür ist Lesen e<strong>in</strong>e unverzichtbare Grundkompetenz. Daher<br />
ist Leseförderung nicht nur e<strong>in</strong>e schulische, sondern e<strong>in</strong>e gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“<br />
(Bett<strong>in</strong>a Hurrelmann, <strong>in</strong>: Heckt/Neumann (Hg.): Deutschunterricht von A bis Z. Braun-<br />
schweig 2001, S. 204.)<br />
„Die Integration <strong>neuer</strong> Medien <strong>in</strong> den Deutschunterricht steht der Förderung von Lese-<br />
kompetenz nicht entgegen, sondern kann e<strong>in</strong>en spezifischen Beitrag zu ihrer <strong>Entwicklung</strong><br />
leisten. ... Denn gleichzeitig eröffnet der fachspezifische E<strong>in</strong>satz von Computer und Internet<br />
im Deutschunterricht neue Chancen für e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>teressanten Umgang mit Sprache und Litera-<br />
tur, der die Lesekompetenz der Schüler(<strong>in</strong>nen) erweitern bzw. vertiefen kann. Im Gegensatz<br />
zu den audiovisuellen Medien s<strong>in</strong>d Computer und Internet nämlich auf Sprache gegründete<br />
Medien. E<strong>in</strong> s<strong>in</strong>nvoller, den spezifischen Mehrwert berücksichtigender E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong> Medien<br />
kann deshalb <strong>zur</strong> Förderung von Lesekompetenz beitragen, <strong>in</strong>sbesondere <strong>zur</strong> Fähigkeit mit<br />
„nichtkont<strong>in</strong>uierlichen Texten“ (PISA) umzugehen. ...“ (Frederk<strong>in</strong>g/ Beisbart/ Abraham, im<br />
Januar 2002 - Quelle: www.uni-bamberg.de/~ba4dd1/pisa2.html.)<br />
E<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong> kam zu der Erkenntnis, dass man ja nun eigentlich zu jedem e<strong>in</strong>zelnen As-<br />
pekt Unterrichtsszenarien entwickeln müsse:<br />
• Was muss ich tun, damit me<strong>in</strong>e Schüler zielgerichtet, strategisch surfen können?<br />
(Konkrete Fragen an den Text bzw. die Rechercheaufgabe formulieren)<br />
• Wie kann ich die sachgerechte Auswahl von Texten für verschiedene Zwecke fördern?<br />
(Texte zu e<strong>in</strong>em Thema bereitstellen, vergleichen und deren Nutzen für bestimmte Zwecke<br />
(zum Beispiel Information, Unterhaltung) e<strong>in</strong>schätzen)<br />
• Wie kann ich das Erkennen von Strukturen fördern?<br />
(Verschiedene Textsorten speziell auf ihre strukturellen Merkmale h<strong>in</strong> untersuchen und ver-<br />
gleichen, Geme<strong>in</strong>samkeiten, Unterschiede klären)<br />
• Wie kann ich verschiedene Lesetechniken vermitteln?<br />
(Anregungen dazu zum Beispiel im Methodentra<strong>in</strong><strong>in</strong>g von Klippert, <strong>in</strong> Praxis Deutsch 164:<br />
Lernmethoden; <strong>in</strong> Seiler/Vögeli: Lesetra<strong>in</strong><strong>in</strong>g – Techniken, Spiele, Tricks. Verlag an der<br />
Ruhr.)<br />
Es war e<strong>in</strong> sehr <strong>in</strong>tensives, forschendes Gespräch, währenddessen die Kollegen sich geme<strong>in</strong>-<br />
sam auf die Suche begaben, sich für die Thematik öffneten, e<strong>in</strong> Problembewusstse<strong>in</strong> für die<br />
Komplexität des Themenfeldes entwickelten, <strong>in</strong> dem viele Aspekte angerissen, angedacht und<br />
aufgedeckt wurden, die <strong>in</strong> Zukunft - auf dem H<strong>in</strong>tergrund der PISA-Studie - stärker <strong>in</strong> den<br />
Blick zu nehmen s<strong>in</strong>d. Um die Überlegungen gedanklich zu strukturieren, kamen wir zu dem<br />
Schluss, Leseförderung am und mit dem Computer grob <strong>in</strong> drei Bereiche zu gliedern:<br />
1. Leseförderung am Computer (Internetrecherche, Lesestrategien wie überfliegendes Lesen,<br />
Umgang mit Hypertexten...)<br />
2. Leseförderung mit Texten, die am Computer entstehen oder entstanden s<strong>in</strong>d (Schreiben<br />
und Überarbeiten von Texten, Lesen von fertigen Schülertexten z.B. unter verschiedenen<br />
Fragestellungen...)
3. Förderung der Literalität durch e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation aus K<strong>in</strong>derbuch und CD ROM oder<br />
Zusatz<strong>in</strong>formationen aus dem Internet<br />
Der dritte Punkt wurde von allen als sehr spannend e<strong>in</strong>geschätzt, konkrete Erfahrungen<br />
mit diesem Themenfeld hatte aber bisher noch niemand. E<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong> hatte allerd<strong>in</strong>gs den<br />
Tipp, dass unter www.stuttgart.de/chilias Informationen zu K<strong>in</strong>derbüchern und Autoren zu<br />
fi nden s<strong>in</strong>d. In E<strong>in</strong>zel- oder Partnerarbeit orientierten sich die Kollegen für etwa zwanzig M<strong>in</strong>uten<br />
auf dieser Plattform und suchten nach Ideen und Vernetzungsmöglichkeiten für ihren<br />
eigenen Literaturunterricht.<br />
Konsens herrschte <strong>in</strong> der Gruppe darüber, das Thema LESEN für die nächste Zeit im<br />
H<strong>in</strong>terkopf zu behalten, es auch bei unserem nächsten Treffen mitzudenken, wenn es um die<br />
Überarbeitung der im Januar erstellten Internetrallye geht, es zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt<br />
aber explizit aufzugreifen und zu refl ektieren. Die Überarbeitung der Internetrallye ist notwendig,<br />
da das Berl<strong>in</strong>portal www.berl<strong>in</strong>.de völlig neu gestaltet wurde.<br />
Materialien auf der CD-Rom<br />
Tischvorlagen und Materialien zum Fachforum Internetrallye<br />
Materialien des Fachforums : „Lesen am und mit dem Computer“<br />
Dokumentationen e<strong>in</strong>er Bezirkfachkonferenz Spandau (mit Anleitungsskripts<br />
für lo-net)<br />
Protokoll der 1. Bezirksfachkonferenz Re<strong>in</strong>ickendorf<br />
Protokoll der 2. Bezirksfachkonferenz Re<strong>in</strong>ickendorf
114<br />
9.5 Tutor<strong>in</strong>g<br />
Tutor<strong>in</strong>g „Phantastische Flug<strong>in</strong>sekten“ - von der Pr<strong>in</strong>tversion <strong>zur</strong><br />
Webversion<br />
Frieder Klapp<br />
Dokumentation des Tutor<strong>in</strong>gs vom 10. und 15. Mai 2001<br />
Anlegen e<strong>in</strong>es Projektordners mit dem Na-<br />
men „flug<strong>in</strong>sekten“ <strong>zur</strong> Speicherung der<br />
HTML-Dateien) und den damit verbundenen<br />
Grafiken.<br />
Kopieren des Textes aus dem Word-Doku-<br />
ment.<br />
Öffnen des Programms „Claris Homepage“<br />
mit neuem HTML-Dokument.<br />
E<strong>in</strong>setzen und Formatieren (Absätze, Schrift-<br />
typ: Arial, Überschriften fett usw.) des Textes<br />
Gliederung des Inhaltsverzeichnisses.<br />
Auswählen der Fotos und Bilder für die<br />
Website.<br />
E<strong>in</strong>scannen von Bildern die nicht <strong>in</strong> digitaler<br />
Form vorliegen.<br />
Verkle<strong>in</strong>ern und Komprimieren der Bilder mit<br />
Photoshop.<br />
Die Dokumentation zum Tutor<strong>in</strong>g bef<strong>in</strong>det sich auf der CD-Rom.
9.6 Sonstige Fortbildungen<br />
Workshop für Multiplikatoren <strong>in</strong> Dill<strong>in</strong>gen im Januar 2003<br />
Brigitte Meier, März 2003<br />
Von Bayern lernen: Erfahrungen während e<strong>in</strong>es Fortbildungslehrgangs <strong>in</strong><br />
Dill<strong>in</strong>gen<br />
Hilferuf aus Bayern: Referenten gesucht !<br />
Kurz vor Weihnachten erreichte uns die Anfrage der Akademie für Lehrerfortbildung und<br />
Personalführung aus Dill<strong>in</strong>gen nach Referenten zum Thema Co-Teach<strong>in</strong>g. Ohne Kenntnis des<br />
genauen Umfanges der von uns erwarteten Tätigkeit sagten Frieder Klapp und ich zu. Wir<br />
konnten zwar auf e<strong>in</strong>e etwa e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halbjährige Erfahrung mit Unterrichtsbegleitung <strong>in</strong> unseren<br />
Schulen im Rahmen unserer Multiplikatorentätigkeit <strong>zur</strong>ückblicken, ahnten aber zu diesem<br />
Zeitpunkt noch nicht, wer unsere Zielgruppe se<strong>in</strong> würde und wie wir unser „Know-how“ ver-<br />
mitteln sollten.<br />
Nach e<strong>in</strong>em Gespräch mit dem bayerischen Lehrgangsleiter erfuhren wir, dass es sich bei den<br />
fortzubildenden Kollegen um Fachberater für Informatik/Datenverarbeitung an Förderschulen<br />
handelte. Erst später (nämlich vor Ort <strong>in</strong> Dill<strong>in</strong>gen) hörten wir, dass die medienpädagogisch-<br />
<strong>in</strong>formationstechnischen Berater (MIB) der Förderschulen Co-Teach<strong>in</strong>g als <strong>in</strong>novatives Kon-<br />
zept der Lehrerfortbildung im Rahmen e<strong>in</strong>er zweijährigen Versuchsphase <strong>in</strong> ihren Regionen<br />
erproben und umsetzen sollten.<br />
Insgesamt hatte der Lehrgang e<strong>in</strong>e Dauer von vier Tagen, wobei unser Workshop sich über<br />
zwei Tage erstrecken sollte. Na dann ran an die Arbeit – zum Glück gab‘s ja die Ferien!<br />
Workshop Co-Teach<strong>in</strong>g – wie aus e<strong>in</strong>em Referat e<strong>in</strong> zweitätiges Sem<strong>in</strong>ar wurde<br />
Nun wussten wir zwar, wer unsere Teilnehmer <strong>in</strong> Dill<strong>in</strong>gen se<strong>in</strong> würden, aber nicht, welche<br />
Erwartungen sie an uns haben würden, welches Vorwissen vorhanden se<strong>in</strong> würde etc. Die Pla-<br />
nung musste also neben e<strong>in</strong>igen festgelegten Eckpunkten wie den allgeme<strong>in</strong>en Informationen<br />
zum Thema Co-Teach<strong>in</strong>g, unseren Unterrichtsbeispielen und den Feedbackrunden möglichst<br />
mehrere Phasen vorsehen, <strong>in</strong> denen die Teilnehmer eigenständig tätig werden konnten. Für<br />
den ersten Tag sahen wir verschiedene Formen von Gruppenaktivitäten vor, dazu Moderati-<br />
onsmethoden, die es den Teilnehmern ermöglichten, aktiv auf den Ablauf der Veranstaltung<br />
E<strong>in</strong>fluss zu nehmen. Den Folgetag planten wir bewusst offen, hatten e<strong>in</strong>ige Texte <strong>in</strong> der „H<strong>in</strong>-<br />
terhand“, die wir jedoch dann nicht e<strong>in</strong>setzten. Im Folgenden die Agenda des ersten Tages,<br />
anschließend dazu e<strong>in</strong>ige Erläuterungen:<br />
Agenda Workshop Co-Teach<strong>in</strong>g<br />
9.00 Begrüßung<br />
9.10 Warm<strong>in</strong>g Up<br />
9.25 Brigitte Meier, Präsentation Co-Teach<strong>in</strong>g (1. Teil)<br />
10.00 Teilnehmeraktivität: Schreibgitter<br />
10.30 Pause<br />
115
116<br />
10.45 Brigitte Meier, Präsentation Co-Teach<strong>in</strong>g (2. Teil)<br />
11.10 Teilnehmeraktivität : Gruppenpuzzle zu Formen geöffneten Unterrichts<br />
11.40 Praxisbeispiele Co-Teach<strong>in</strong>g<br />
12.00 Pause<br />
14.15 Zwischenfeedback der Teilnehmer<br />
14.35 Frieder Klapp, Präsentation Fortbildungsformen<br />
15.10 Teilnehmeraktivität zu Aspekten der Fortbildungsarbeit: Vier-Ecken<br />
15.45 Pause<br />
16.00 Auswertung der Gruppenarbeit und Beispiele der Teilnehmer<br />
16.15 Frieder Klapp, Präsentation: verschiedene Unterrichtsprojekte mit neuen Medien<br />
16.45 Teilnehmeraktivität: Bra<strong>in</strong>storm<strong>in</strong>g, Kartenabfrage zu Problemen der Umsetzbarkeit <strong>in</strong><br />
den Regionen<br />
17.30 Abschluss-Feedback<br />
Warm<strong>in</strong>g Up<br />
Im wahrsten S<strong>in</strong>ne des Wortes „aufwärmen“ sollten sich die Teilnehmer bei diesem bewegten<br />
E<strong>in</strong>stieg. Im großen Veranstaltungsraum befestigten wir an zwei gegenüberliegenden Wänden<br />
e<strong>in</strong> JA- (grün) und e<strong>in</strong> NEIN-Schild (rot). Wir gaben Impulse („In me<strong>in</strong>er Schule s<strong>in</strong>d die<br />
meisten Kollegen fit im Umgang mit den Neuen Medien“) und die Teilnehmer bewegten sich<br />
je nach ihrer <strong>in</strong>dividuellen Antwort <strong>zur</strong> Ja- oder <strong>zur</strong> Ne<strong>in</strong>-Seite. Insgesamt 15 solcher State-<br />
ments lasen wir vor, wobei das Ziel, zum e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>e lockere, heitere Atmosphäre zu schaffen,<br />
zum anderen e<strong>in</strong> Wir-Gefühl zu entwickeln gut erreicht wurden.<br />
Nachdem alle Platz genommen hatten, erhielten die Teilnehmer e<strong>in</strong>en Zettel, auf dem sie den<br />
Satz Co-Teach<strong>in</strong>g <strong>in</strong>teressiert mich, weil ..... ergänzen sollten. Diese Zettel wurden an der<br />
ersten von vier Metaplanwänden gesammelt. Für die Professionalität und Sensibilität der Teil-<br />
nehmer sprechen ihre Statements:<br />
• Weil ich es vom Namen her für e<strong>in</strong>e effektive Fortbildungsform halte, die zwar weniger Per-<br />
sonen erreicht, diese jedoch <strong>in</strong>dividuell und nachhaltig fördern kann.<br />
• Weil ich nach effektiveren Formen der Lehrerfortbildung suche.<br />
• Weil ich über mediengerechtere Unterrichtsformen nachdenke.<br />
• Weil me<strong>in</strong>e Fortbildungen im Klassenzimmer stattf<strong>in</strong>den sollen.<br />
• Weil das die effektivste Form für die Lehrer ist, die ich betreue (glaube ich).<br />
• Weil ich mit anderen Kollegen im Bereich der Fortbildung oft zusammenarbeite.<br />
• Weil ich diese Art der Fortbildung als sehr praxisnah erlebe.<br />
• Weil ich Ideen und Konzepte für Fortbildungen kennen lernen möchte.<br />
• Weil ich geme<strong>in</strong>sames Arbeiten und Unterrichten für effizienter halte als „E<strong>in</strong>zelkämpfer-<br />
tum“.<br />
• Weil es zu me<strong>in</strong>em künftigen Aufgabenbereich gehört.<br />
• Weil ich so e<strong>in</strong> Projekt am Laufen habe und bisher kaum Berührungsängste gespürt habe.<br />
• Weil ich diese Lernform für effektiv halte.
Präsentation - erster Teil<br />
Der eher theoretische erste Teil der Powerpo<strong>in</strong>t-Präsentation hätte für diese Teilnehmer we-<br />
sentlich komprimierter ausfallen können. Was wir vorher nicht wussten: Die medienpädago-<br />
gisch-<strong>in</strong>formationstechnischen Berater nehmen an e<strong>in</strong>em berufsbegleitenden Studiengang teil<br />
und hatten bereits ausführlich an Themen wie Medienkompetenz und Konstruktivismus gear-<br />
beitet. Die Ausführungen zu diesen Punkten hätten also stark gestrafft werden können.<br />
Schreibgitter<br />
Die Teilnehmer erhielten folgende Impulse:<br />
• Bilden Sie bitte Gruppen von vier Personen.<br />
• Benutzen Sie den <strong>in</strong> Ihren Unterlagen vorhandenen Vordruck e<strong>in</strong>es Schreibgitters.<br />
• E<strong>in</strong>zelarbeit: „Welches s<strong>in</strong>d für mich die drei wichtigsten Kriterien für e<strong>in</strong>e gute Fortbil-<br />
dung?“<br />
• Gruppenarbeit: Verständigung auf die drei wichtigsten geme<strong>in</strong>samen Kriterien.<br />
• Notieren Sie jeweils e<strong>in</strong> Kriterium auf die vorbereiteten Metaplankarten<br />
• Plenum, Aussprache über die Kriterien<br />
Ergebnis der drei Gruppen (Aushang an der zweiten Metaplanwand):<br />
Kriterien e<strong>in</strong>er guten Fortbildung s<strong>in</strong>d für uns:<br />
Praxisorientierung, Professionalität, Teamlernen.<br />
Flexibilität, Umsetzbarkeit, Rahmenbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Wir-Gefühl, Anwendbarkeit, abwechslungsreiche Gestaltung.<br />
Präsentation - zweiter Teil<br />
Da sich der zweite Teil me<strong>in</strong>er Präsentation mit den Besonderheiten des Fortbildungsmodells<br />
des Co-Teach<strong>in</strong>g beschäftigte, gab es viele <strong>in</strong>teressierte Zwischenfragen.<br />
Gruppenpuzzle<br />
Die Prämisse von ForMeL G, „nicht Lernen mit Neuen Medien sondern Neues Lernen mit<br />
Medien“ hatte ich im Laufe me<strong>in</strong>er Präsentation mehrfach erwähnt. Da es für me<strong>in</strong> Verständ-<br />
nis von neuen Lernenformen von immenser Bedeutung ist, das methodische Vorgehen zu<br />
überdenken, <strong>in</strong>sbesondere geöffnete Formen des Unterrichts zu praktizieren, war dies Inhalt<br />
des Gruppenpuzzles. Die Teilnehmer erhielten je e<strong>in</strong> farbiges Kärtchen, das den Buchstaben A,<br />
B oder C enthielt. Es lagen zu folgenden Themen Texte bereit:<br />
A Wochenplanarbeit<br />
B Lernen an Stationen<br />
C Werkstattunterricht<br />
D Freie Arbeit (dieser Text wurde nicht benutzt)<br />
Der Impuls lautete:<br />
• Gruppenbildung A – B – C – D.<br />
• Lesen des Gruppenthemas <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelarbeit, Verständigung <strong>in</strong> der Gruppe über wichtige Ge-<br />
sichtspunkte.<br />
• Erneute Gruppenbildung rot – blau – gelb.<br />
• Jeder trägt die wichtigsten Aspekte se<strong>in</strong>es Themas <strong>in</strong> der Gruppe vor.<br />
117
118<br />
H<strong>in</strong>ter dieser Teilnehmeraktivität steht die Annahme, dass man das, was man hört nur zu<br />
20% behält, das, was man hört und liest zu 50%, und das, was man nach dem Lesen e<strong>in</strong>em<br />
anderen erklärt, verstanden hat und sich zu 80% merken kann.<br />
Zwischenfeedback<br />
Nach der Mittagspause erhielten die Teilnehmer drei verschiedenfarbige Karten, auf denen sie<br />
zu den Punkten:<br />
Das war neu für mich...<br />
Das war e<strong>in</strong> „alter Hut“...<br />
Ich hoffe, das kommt noch <strong>zur</strong> Sprache...<br />
Notizen machen sollten. Wichtig war uns diese Phase vor allem <strong>in</strong> Bezug auf das weitere Vor-<br />
• Möglichkeiten des E<strong>in</strong>satzes überlegen und planen<br />
gehen am Nachmittag und am Folgetag. So<br />
kamen als Wünsche zum Impuls „Ich hoffe,<br />
das kommt noch <strong>zur</strong> Sprache“ u. a. zum<br />
Aushang: (3. Metaplanwand)<br />
• Fortbildungsmöglichkeiten für größere<br />
Gruppen<br />
• Beispiele für Inhalte beim Co-Teach<strong>in</strong>g<br />
• Möglichkeit <strong>zur</strong> Aussprache<br />
• Erfahrungsaustausch<br />
• Konkrete Umsetzung <strong>in</strong> Bayern<br />
• Co-Teach<strong>in</strong>g „Flächen“ bezogen – geme<strong>in</strong>t<br />
ist die Umsetzbarkeit im Flächenstaat Bayern<br />
• Wo liegen die Schwierigkeiten beim Co-<br />
Teach<strong>in</strong>g ?<br />
• Co-Teach<strong>in</strong>g über die schul<strong>in</strong>terne Fortbildung h<strong>in</strong>aus<br />
Die Präsentation über verschiedene Fortbildungsformen, die Frieder Klapp anschließend vor-<br />
stellte, erfüllte e<strong>in</strong>ige der Teilnehmerbedürfnisse.<br />
Die Teilnehmeraktivität zu Aspekten des Co-Teach<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Form der Vier-Ecken-Impulse war<br />
äußerst effektiv und führte die Teilnehmer dazu, ihre persönlichen Vorstellungen zu formulie-<br />
ren. So lauteten Denkanstöße auf vier Metaplanwänden:<br />
• Diese Erfahrungen und Inhalte könnte ich im Co-Teach<strong>in</strong>g an <strong>in</strong>teressierte Kollegen weiter-<br />
geben...<br />
• Diese (äußeren) Bed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d für Co-Teach<strong>in</strong>g förderlich...<br />
• Diesen E<strong>in</strong>fluss hat Co-Teach<strong>in</strong>g auf Unterrichts- und Schulentwicklung...<br />
• Diese persönlichen Qualifikationen brauche ich als „Co-Teacher“...<br />
Auswertung und Gedankenaustausch<br />
Nach der Pause nutzten die Teilnehmer die Chance für e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tensiven Austausch ihrer Er-<br />
fahrungen und <strong>zur</strong> Diskussion über die Aussagen auf den Plakaten.<br />
Die Präsentation Frieder Klapps zu verschiedenen Unterrichtsprojekten mit neuen Medien<br />
erfolgte im Dialog mit den Teilnehmern. Konkrete, praxisbezogene Fragen konnten sofort ge-<br />
klärt werden.
Bra<strong>in</strong>storm<strong>in</strong>g, Kartenabfrage : Obwohl der Nachmittag schon weit fortgeschritten war, ka-<br />
men die Teilnehmer mit großer Motivation der Aufforderung nach, die möglichen Probleme<br />
der Umsetzbarkeit von Co-Teach<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ihren Regionen zu notieren. Über das „Clustern“ kris-<br />
tallisierten sich folgende Themenbereiche heraus:<br />
• Probleme mit der Schulaufsicht<br />
• Probleme mit der Zielgruppe<br />
• Probleme, die <strong>in</strong> der eigenen Persönlichkeit verankert s<strong>in</strong>d<br />
• Anlaufprobleme<br />
• Probleme <strong>in</strong> der Ausstattung<br />
Der zweite Tag - So machen sich die MIB auf den Weg<br />
An den am Vorabend gefundenen Problemschwerpunkten wollten wir lösungsbezogen wei-<br />
terarbeiten. In Partnerarbeit schrieben die Teilnehmer zunächst ihre Gedanken zu möglichen<br />
Lösungsansätzen auf.<br />
Konkrete Vere<strong>in</strong>barungen wurden u. a. <strong>in</strong> folgenden Bereichen getroffen:<br />
• e<strong>in</strong>e Bedarfsliste über das als M<strong>in</strong>destvoraussetzung für effektives Arbeiten <strong>zur</strong> Verfügung<br />
stehende Material für die MIB. Diese Liste wird an die e<strong>in</strong>zelnen Regierungsbezirke weiter-<br />
gegeben.<br />
• Die Verpflichtung <strong>zur</strong> Erstellung e<strong>in</strong>es Werbe-Plakats, das an die Schulen versendet wird.<br />
• Materialbereitstellung im Onl<strong>in</strong>e-Forum.<br />
• Erstellung e<strong>in</strong>es Flyers, der bei Informationsveranstaltungen und Gesamtkonferenzen ver-<br />
teilt werden kann.<br />
• Erstellen von Anleitungsskripten u. a. <strong>zur</strong> „Multimedia-Werkstatt“.<br />
Nachahmenswertes<br />
Mich hat das Engagement der bayerischen Kol-<br />
legen, ihre Kreativität und Fachkompetenz sehr<br />
bee<strong>in</strong>druckt. Wie kommt diese Gruppe von aufge-<br />
schlossenen, <strong>in</strong>novativen Ideen zugeneigten Leh-<br />
rern zustande? Für jeden der Regierungsbezirke im<br />
Freistaat gibt es seit Beg<strong>in</strong>n des Schuljahres 2002/<br />
2003 e<strong>in</strong>en sogenannten MIB. Diese wurden nach<br />
Ausschreibung ausgewählt, die Bestellung durch<br />
die Landesregierung erfolgt zunächst für e<strong>in</strong> Jahr,<br />
dann für e<strong>in</strong>en weiteren Zeitraum von vier Jahren.<br />
Die Entscheidung trifft die zuständige Dienststelle<br />
unter Mitwirkung der Akademie für Lehrerbil-<br />
dung. Für die Tätigkeit der medienpädagogisch-<strong>in</strong>-<br />
formationstechnischen Beratung werden Anrechnungsstunden gewährt.<br />
In der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isteriums für Unterricht und Kultus<br />
vom 28.2.2002 heißt es: „1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Gesamtkonzepts der<br />
Medienerziehung <strong>in</strong> Bayern und des Gesamtkonzepts der <strong>in</strong>formationstechnischen Bildung <strong>in</strong><br />
der Schule sowie <strong>zur</strong> Sicherung und Verbesserung der Qualität von Schule wird e<strong>in</strong> Netzwerk<br />
von Medienpädagogisch-<strong>in</strong>formationstechnischen Beratern e<strong>in</strong>gerichtet. 2. Ziel ist es, die Ge-<br />
me<strong>in</strong>schaftsaufgabe Medienerziehung und die <strong>in</strong>formationstechnische Bildung zu fördern und<br />
119
120<br />
den K<strong>in</strong>dern und Jugendlichen im Rahmen e<strong>in</strong>er wertorientierten Persönlichkeitserziehung<br />
Medienbildung zu vermitteln, sie zu e<strong>in</strong>em sicheren, verantwortungsbewussten und kreativen<br />
Umgang mit allen Medien zu befähigen. Dazu gehört <strong>in</strong>sbesondere auch der kompetente Um-<br />
gang mit den Informations- und Kommunikationstechniken. Gleichzeitig sollen die Qualität<br />
des Unterrichts, das selbstverantwortliche lernen<br />
durch die Nutzung von Medien, <strong>in</strong>sbesondere<br />
von Neuen Medien ... weiter verbessert werden.“<br />
Die Medienpädagogisch-<strong>in</strong>formationstechnischen<br />
Berater werden sowohl im schulischen als auch<br />
- schulnah - im außerschulischen Bereich e<strong>in</strong>ge-<br />
setzt. Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> folgenden Feldern tätig:<br />
• regionale, lokale, schul<strong>in</strong>terne Lehrerfortbil-<br />
dung,<br />
• Lehrerausbildung (erste und zweite Phase),<br />
• Expertentätigkeit <strong>in</strong> den Bereichen Medien-<br />
und Informationstechnik, Medienauswahl,<br />
Mediendidaktik, Mediengestaltung und Medie-<br />
nerziehung.<br />
Während der zweijährigen Erprobungsphase ist<br />
vorgesehen, dass die MIB den Schwerpunkt ihrer<br />
Fortbildungen auf Co-Teach<strong>in</strong>g legen.<br />
E<strong>in</strong>ige der Teilnehmer des Lehrgangs <strong>in</strong> Dill<strong>in</strong>gen<br />
haben bereits auf ihrer Webseite oder <strong>in</strong> Flyern auf die Möglichkeit h<strong>in</strong>gewiesen, sich als An-<br />
sprechpartner für Unterrichtsvorhaben mit neuen Medien angeboten und Kollegen dafür zu<br />
<strong>in</strong>teressieren versucht. Ich habe Rückmeldungen erhalten, dass die ersten positiven Erfahrun-<br />
gen mit Co-Teach<strong>in</strong>g vorliegen. Da <strong>in</strong> Bayern dafür vom M<strong>in</strong>isterium Stunden <strong>zur</strong> Verfügung<br />
gestellt werden, kann durch Co-Teach<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e nachhaltige Implementierung der neuen Medi-<br />
en <strong>in</strong> die Unterrichtspraxis erfolgen. Das <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> im Rahmen des SEMIK-Projekts FormeL<br />
G erprobte <strong>Fortbildungskonzept</strong> wird somit flächendeckend <strong>in</strong> bayerischen Förderschulen<br />
umgesetzt. Nicht nur die Kollegen, sondern auch die Vertreter der Schulaufsicht gehen von<br />
der Effektivität des Konzepts aus. Auf die Ergebnisse der zweijährigen Pilotphase kann man<br />
gespannt se<strong>in</strong>.
9.7 Onl<strong>in</strong>e-Angebote<br />
MoMo - die Internet-Mitmach-Seite<br />
Dokumentation e<strong>in</strong>es Fortbildungsbauste<strong>in</strong>s - November 2001<br />
Thomas Kahlki, Frieder Klapp<br />
Wie Internet s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> der Grundschule e<strong>in</strong>gesetzt werden kann<br />
Zielgruppe: Schüler und Lehrer <strong>in</strong> den Klassenstufen 1 - 6, Vorerfahrung: Umgang mit dem<br />
Internet<br />
Die Nutzung dieses Fortbildungsbauste<strong>in</strong>es ist unabhängig von Ort und Zeit möglich.<br />
Was ist MoMo?<br />
Anders als beim traditionellen Präsenzlernen s<strong>in</strong>d die Lernenden und Lehrenden bei virtuellen<br />
Lernumgebungen unabhängig von Zeit und Raum und können ihr Lernen selbst steuern, wo-<br />
durch der Wechsel vom lehrerzentrierten Unterricht <strong>zur</strong> „Learn<strong>in</strong>g Community“ nachhaltig<br />
unterstützt wird.<br />
MoMo (www.momodo.de), das geme<strong>in</strong>same Internet-Mitmach-Projekt der Astrid-L<strong>in</strong>d-<br />
gren-Grundschule und Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule, ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong>teraktives, spielerisches Lernan-<br />
gebot, das sowohl <strong>in</strong> der Unterrichtsstunde als<br />
auch von zu Hause aus genutzt werden kann. Das<br />
Projekt richtet sich an Schüler etwa zwischen acht<br />
und zwölf Jahren und an ihre Lehrer.<br />
MoMo beschäftigt sich für jeweils e<strong>in</strong>en Monat<br />
mit e<strong>in</strong>em bestimmten Thema (Oktober 2001:<br />
Reise <strong>in</strong> die Vergangenheit) und stellt an jedem<br />
Montag neue <strong>in</strong>teraktive Rätselaufgaben, Kno-<br />
beleien und Informationen zu diesem Thema<br />
vor. Außerdem werden ausgewählte andere<br />
Internetseiten zum jeweiligen Momo-Thema prä-<br />
sentiert. Zu jedem Monatsthema gehört außerdem<br />
e<strong>in</strong>e etwas schwierigere Rätselaufgabe, deren<br />
Lösung den Schülern Durchhaltevermögen und F<strong>in</strong>digkeit abverlangt. Unter den per E-Mail-<br />
Formular e<strong>in</strong>geschickten richtigen Lösungen wird am Ende des Monats e<strong>in</strong> passender Preis<br />
verlost - für das Thema „Zeit“ (Mai 2001) zum Beispiel e<strong>in</strong> Exemplar des Buches „Momo“<br />
von Michael Ende.<br />
Warum MoMo?<br />
MoMo versucht e<strong>in</strong>e Antwort auf die Frage vieler Grundschullehrer zu geben: „Was kann ich<br />
denn eigentlich mit me<strong>in</strong>en Schülern im Internet tun?“ Oft wird das Internet „nur“ <strong>zur</strong> Infor-<br />
mationssuche genutzt und viele Internetangebote verleiten zu e<strong>in</strong>er eher passiven Konsumen-<br />
121
122<br />
tenhaltung. Wir f<strong>in</strong>den, dass das Potenzial des Internet als Lernumgebung damit bei weitem<br />
nicht ausgeschöpft ist. Mit Momo haben wir den Versuch unternommen, uns mit den <strong>in</strong>terak-<br />
tiven Möglichkeiten des Mediums für K<strong>in</strong>der im Grundschulalter ause<strong>in</strong>anderzusetzen.<br />
Was macht die Interaktivität von MoMo aus?<br />
Die Eigentätigkeit der K<strong>in</strong>der wird angeregt, <strong>in</strong>dem sie aufgefordert werden, Lösungen e<strong>in</strong>zu-<br />
geben und teilweise per E-Mail e<strong>in</strong>zusenden (e<strong>in</strong> eigener E-Mail-Zugang wird <strong>in</strong> Momo dafür<br />
nicht benötigt). E<strong>in</strong>geschickte Bilder und Fotos zu den Aufgaben werden <strong>in</strong> die vorhandenen<br />
Seiten <strong>in</strong>tegriert (zum Beispiel U(h)rwald oder Höhlenmalerei). Ferner können sich die Schü-<br />
ler mit eigenen Ideen und Vorschlägen beteiligen. Unser Wunsch für die Zukunft wäre, dass<br />
neben uns „Machern“ zunehmend Ideen, Themen und Aufgaben von Schülern und anderen<br />
Lehrern <strong>in</strong>tegriert werden und unsere Besucher aktive Mitgestalter von Momo werden. Ob-<br />
wohl Momo e<strong>in</strong> unabhängig vom Unterricht e<strong>in</strong>setzbares Lernangebot ist, haben wir uns bei<br />
der Auswahl der Monatsthemen an typischen Inhalten des Unterrichts <strong>in</strong> der Grundschule<br />
orientiert. Als beispielsweise <strong>in</strong> unseren 4. Klassen die Radfahrprüfung anstand, boten wir<br />
das Monatsthema „Rund ums Rad“ an, unter anderem mit e<strong>in</strong>em Onl<strong>in</strong>e-Verkehrsquiz <strong>zur</strong><br />
Vorbereitung auf die theoretische Radfahrprüfung. Momo ist also nicht nur e<strong>in</strong> Angebot für<br />
Schüler, sondern auch für Lehrer, die es <strong>in</strong> ihrem Unterricht e<strong>in</strong>setzen möchten. Für die zu<br />
bearbeitetenden Aufgaben wählten wir Begriffe wie Rätsel oder Quiz, um den Anreiz für die<br />
Schüler zu erhöhen.<br />
Warum ist MoMo auch e<strong>in</strong>e Portalseite?<br />
Lösen Schüler die gestellten Aufgaben richtig, gibt es sogenannte „kle<strong>in</strong>e Überraschungen“ <strong>in</strong><br />
Form von L<strong>in</strong>ks auf thematisch verwandte Seiten im Netz mit Informationen oder Spielen für<br />
K<strong>in</strong>der. Insofern erfährt unser jeweiliges Thema immer auch e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle Erweiterung durch<br />
die Präsentation und Hervorhebung ausgewählter L<strong>in</strong>ks auf andere Internetseiten.<br />
Wie fördert MoMo die Kreativität?<br />
Neben dem Lösen von Aufgaben, die sich eher auf abfragbares Wissen beziehen, gibt es jeden<br />
Monat m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e kreative Aufgabe zum Mitmachen. Das kann die Anregung zum Ma-<br />
len e<strong>in</strong>es Bildes oder aber auch e<strong>in</strong>e Problem se<strong>in</strong>, das nur mit Kreativität gelöst werden kann.<br />
E<strong>in</strong> Beispiel aus dem Thema „Zeit“ soll dies deutlich machen. Nach ausführlicher Darstel-<br />
lung der Situation e<strong>in</strong>es auf e<strong>in</strong>er Insel Gestrandeten lautete die Aufgabe: „Schaffst du es, aus<br />
diesem Krimskrams und mit Wasser, Sand und Sonne e<strong>in</strong>en Zeitmesser zu bauen? Wenn ja,<br />
dann schicke uns de<strong>in</strong>e Zeitmesserbastelanleitung! Am besten mit Zeitmesserbastelanleitungs-<br />
zeichnung! Wer uns e<strong>in</strong>e brauchbare Zeitmesseridee schickt, der kann von der Insel gerettet<br />
werden!!!“<br />
Warum e-Learn<strong>in</strong>g statt fertigem CD-Rom-Lernspiel?<br />
Die Vorteile e<strong>in</strong>er Onl<strong>in</strong>e-Lernumgebung gegenüber e<strong>in</strong>er didaktisch gut gemachten CD-<br />
ROM zum gleichen Thema, liegen auf der Hand. Die Interaktivität und der kommunikativer<br />
Aspekt wird <strong>in</strong> der Arbeit an e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Projekt im Netz deutlich. Die K<strong>in</strong>der be-<br />
teiligen sich und erhalten Rückmeldungen. Parallel dazu wird durch die gezielte Nutzung des<br />
Internet die Medienkompetenz erweitert. Die Schüler greifen auch von zu Hause (wenn dort
e<strong>in</strong> Internetzugang vorhanden) gerne auf MoMo zu, da hier grundschultypische Unterrichts-<br />
themen <strong>in</strong> spielerischer Form verpackt s<strong>in</strong>d. Sie benötigen also ke<strong>in</strong>e besondere Software und<br />
können das Angebot zeit- und ortsunabhängig nutzen. Anders als bei e<strong>in</strong>er CD-Rom wird das<br />
Angebot ständig er<strong>neuer</strong>t, erweitert und aktualisiert. Dabei können die Momo-Besucher aktiv<br />
mitarbeiten!<br />
Schulvision - das Internetportal für Grundschullehrer<br />
www.schulvision.de ist die <strong>in</strong>teraktive Fortsetzung unserer Fortbildungsbauste<strong>in</strong>e im Internet.<br />
Schulvision ist eng verknüpft mit Momo, unserer Internet-Mitmach-Seite, und präsentiert zu-<br />
sätzliche Infos, Tipps und Materialien zum jeweils aktuellen Momo-Thema. Außerdem stellen<br />
wir hier unsere Unterrichtskonzepte und -ideen vor, sammeln geeignete Internet-L<strong>in</strong>ks und<br />
stellen passendes Unterrichtsmaterial zum Download <strong>zur</strong> Verfügung. Für unsere Fortbildungs-<br />
teilnehmer bereiten wir hier unsere Veranstaltungen vor und stehen ihnen anschließend für<br />
ihre Nachfragen und den nötigen Support <strong>zur</strong> Verfügung.<br />
Die Internetpräsenz „MoMo“ f<strong>in</strong>det sich zum Offl<strong>in</strong>e-Browsen auf der<br />
CD (Stand: März 2003).<br />
123
124<br />
Virtueller Fortbildungskontakt<br />
Thomas Kahlki<br />
1 Allgeme<strong>in</strong>e Angaben<br />
Thema Geme<strong>in</strong>same Planung und Vorbereitung des Mediene<strong>in</strong>satzes für e<strong>in</strong> mehrtägiges Badm<strong>in</strong>ton-Projekt<br />
vom 06.05.02 – 08.05.02<br />
Datum 27.04.02 – 08.05.02 Dauer Mehrere Term<strong>in</strong>e unterschiedlicher<br />
Dauer<br />
Fortbildner/<strong>in</strong> Thomas Kahlki Ort z. T. „Präsenzlernen“ an<br />
wechselnden Orten, z. T.<br />
„virtuelles Lernen“ (E-Mail,<br />
Onl<strong>in</strong>e-Forum „lo-net“, Chat,<br />
Telefon, Fax)<br />
Teilnehmer 1 Lehrer<strong>in</strong> der Rübezahl-Grundschule (Berl<strong>in</strong>-Mitte) mit guten Kenntnisse <strong>in</strong> Textverarbeitung<br />
und Internetnutzung <strong>zur</strong> Unterrichtsvorbereitung, aber relativ wenig Erfahrungen<br />
zum E<strong>in</strong>satz von Computern und Internet im Klassenraum.<br />
E<strong>in</strong>gesetzte Medien Computer mit Internet-Anschluss (siehe auch Ort), Drucker, CD-Brenner, digitaler<br />
Fotoapparat, Telefon, Fax<br />
Anlass Nachfrage der Kolleg<strong>in</strong>, wie sie für e<strong>in</strong>en „theoretischen“ Teil ihres Sportprojektes<br />
Computer und Internet mit der Lerngruppe e<strong>in</strong>setzen könne<br />
2 Erwartungen und Ziele der Beteiligten<br />
Erwartungen und<br />
Ziele der Teilnehmer<br />
Siehe auch „Anlass“: Die Kolleg<strong>in</strong> wandte sich <strong>in</strong> der Absicht an mich, Computer und Internet <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em theoretischen Teil ihres Sportprojektes e<strong>in</strong>zusetzen, hatte dazu auch –nicht zuletzt durch<br />
frühere Fortbildungskontakte mit mir- bereits Ideen und Vorschläge und wünschte sich dazu <strong>in</strong>sbesondere<br />
Hilfe bei eher methodischen Fragestellungen (z. B. „Bei uns streikt öfter das Internet<br />
– wie kann ich mit e<strong>in</strong>er solchen Situation umgehen?“ oder „Die K<strong>in</strong>der verzetteln sich beim<br />
Suchen im Internet immer – was kann ich dagegen tun?“<br />
Wurden die Erwartungen und Ziele im Vorfeld abgefragt? X ja O<br />
Ziele des<br />
Fortbildners<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Ziele me<strong>in</strong>er Fortbildungsveranstaltungen:<br />
• Die Teilnehmer werden dazu befähigt, vergleichbare Situationen und Anlässe zukünftig selbständig<br />
bewältigen zu können.<br />
• Während der Veranstaltungen ist der Anteil der Eigenaktivität der Teilnehmer –als wesentlicher<br />
Aspekt e<strong>in</strong>er veränderten Lehr- und Lernkultur - sehr hoch.<br />
• Die Veranstaltungen s<strong>in</strong>d „nachfrageorientiert“, d. h. die Inhalte der Fortbildungen richten sich nach<br />
den von den Teilnehmern im Vorfeld und während der Veranstaltung formulierten Wünschen und<br />
Fragestellungen, so dass Motivation und Interesse sehr hoch s<strong>in</strong>d.<br />
• Durch erprobte Beispiele und Lösungen für den eigenen Schulalltag der Teilnehmer wird für veränderte<br />
Formen des Lehrens und Lernens und deren praxisnahe Umsetzung geworben.<br />
Im E<strong>in</strong>zelnen habe ich das Ziel verfolgt, Methodenbauste<strong>in</strong>e zum Internete<strong>in</strong>satz im Unterricht zu<br />
vermitteln:<br />
• gezielte Fragestellungen und/oder ausgewählte Internetseiten verwenden (z.B. L<strong>in</strong>klisten oder spezielle<br />
Suchmasch<strong>in</strong>en wie z.B. „Bl<strong>in</strong>de Kuh“)<br />
• Fragebögen erarbeiten und ihre Lösbarkeit selber ausprobieren<br />
• Ausgewählte Internetseiten offl<strong>in</strong>e <strong>zur</strong> Verfügung stellen (z.B. auf CD brennen) als Pannenmanagement<br />
• Vorzugsweise mit gemischten Medien (eben „multimedial“) arbeiten: Neben Internet auch Bücher,<br />
Abbildungen, Zeitschriften, Nachschlagewerke o.ä. <strong>zur</strong> Verfügung stellen<br />
• Rechercheergebnisse der K<strong>in</strong>der möglichst immer <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Produkt e<strong>in</strong>fließen lassen: eigener Text,<br />
Präsentation, L<strong>in</strong>kliste, Lesezeichensammlung o.ä.<br />
• Schüler möglichst partnerweise arbeiten lassen<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus war es – auch für me<strong>in</strong>en eigenen Lernprozess - e<strong>in</strong> wichtiges Ziel, die E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten<br />
<strong>neuer</strong> Kommunikationsformen (E-Mail, Onl<strong>in</strong>e-Forum, Chat, „Telegramm“, Fax) als Erweiterung<br />
und Ergänzung des gewohnten „Präsenzlernens“ zu erproben.
3 Ablauf bzw. Vorgehen<br />
Zeit Inhalt Situative Bed<strong>in</strong>gungen<br />
Während mehrerer meist kurzfristig verabredeter Fortbildungskontakte unterschiedlicher<br />
Dauer im Zeitraum von ca. 10 Tagen wurden die folgenden Themen<br />
bzw. methodischen Bauste<strong>in</strong>e (siehe „Ziele“) behandelt:<br />
• Herunterladen ganzer Webseiten, Speichern von Webarchiven unter Mac<strong>in</strong>tosh<br />
bzw. W<strong>in</strong>dows, Brennen von „Notfall-CDs“ mit ganzen Webseiten für den Offl<strong>in</strong>e-<br />
Betrieb<br />
• Erarbeitung e<strong>in</strong>es Fragenkataloges für die Internet-Recherche zum Thema Badm<strong>in</strong>ton<br />
• Entwerfen e<strong>in</strong>es Fragebogens für die Internet-Recherche (Textverarbeitung, E<strong>in</strong>fügen<br />
von Grafiken, Gestaltungs- und Layoutfragen)<br />
• Umgang mit dem digitalen Fotoapparat für die Dokumentation der Projekttage<br />
• Digitale Bildbearbeitung für die Projekttage (Übertragen der Bilder, Bearbeiten<br />
der Bilder für den Ausdruck, Ausdrucken von Bildersammlungen)<br />
• Internet-Recherche für die Projektvorbereitung (z.B. F<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>er geeigneten<br />
Spielstätte, Unterstützung durch Sportvere<strong>in</strong>e etc.)<br />
• Erarbeiten e<strong>in</strong>er L<strong>in</strong>kliste für die Schüler<br />
Da schon aus zeitlichen und räumlichen Gründen bzw. aufgrund kurzfristig entstehender<br />
Fortbildungsbedürfnisse e<strong>in</strong> „reales“ Treffen nur zum Teil möglich war, bot<br />
es sich an, zusätzlich auch die Kommunikationsmöglichkeiten der neuen Medien für<br />
Fortbildungszwecke zu nutzen.<br />
Beispiele dafür s<strong>in</strong>d per E-Mail ausgetauschte Arbeitergebnisse (wie z.B. L<strong>in</strong>klisten,<br />
Fragebögen), <strong>in</strong>struktionale Unterstützung onl<strong>in</strong>e (z. B. Arbeitsanleitungen per<br />
E-Mail, Chat oder „AOL-Telegramm“) oder auch kle<strong>in</strong>schrittiger Telefonsupport<br />
(„Sitze <strong>in</strong> der Schule vor dem Bildschirm, und schaffe es nicht, e<strong>in</strong>e Web-Seite komplett<br />
herunterzuladen – was tun?“).<br />
4 Umsetzung spezieller Projektziele<br />
1. Situationsbezogen u. anhand authentischer<br />
Probleme lernen<br />
2. In vielfältigen Sachzusammenhängen lernen<br />
3. Mit <strong>in</strong>struktionaler Unterstützung lernen<br />
4. Adressatenbezug<br />
5. Medienkompetenz<br />
In dieser Reihe von Fortbildungskontakten wurde mit e<strong>in</strong>em sehr<br />
hohen Eigenaktivitätsanteil an der Lösung von konkreten Problemen<br />
gelernt und gearbeitet, die sich aus der Planung und Erarbeitung e<strong>in</strong>es<br />
unmittelbar bevorstehenden, selbst gewählten Unterrichtsprojektes<br />
der Teilnehmer<strong>in</strong> ergaben.<br />
Die geme<strong>in</strong>sam erarbeiteten Methoden und Problemlösungsstrategien<br />
lassen sich auf jedes zukünftige Unterrichtsprojekt der Teilnehmer<strong>in</strong><br />
übertragen, <strong>in</strong> dem Internet-Recherche, Textverarbeitung und digitale<br />
Fotografie e<strong>in</strong>e Rolle spielen.<br />
Neben schriftlichem Material (z.B. Kurzanleitungen, Beispielmaterial<br />
aus früheren Unterrichtsprojekten und Fortbildungen) war für die<br />
Teilnehmer<strong>in</strong> das Angebot der kurzfristig e<strong>in</strong>holbaren <strong>in</strong>struktionalen<br />
Unterstützung zu gezielten Fragestellungen wichtig. Dabei erwiesen<br />
sich im Fortbildungsbereich noch relativ unübliche neue Kommunikationsformen<br />
(z.B. E-Mail, Chat, „AOL-Telegramm“, Onl<strong>in</strong>e-Forum<br />
„lo-net“) als hilfreich.<br />
Inhalt, Umfang und Schwierigkeitsgrad des Fortbildungsangebotes<br />
orientierten sich jederzeit an den geäußerten Bedürfnissen der Teilnehmer<strong>in</strong>.<br />
Neben der Vertiefung der Kompetenz im eigenen Umgang mit Computern,<br />
Digitalkamera und Internet wurde auch das Methodenrepertoire<br />
beim E<strong>in</strong>satz von Medien <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Lerngruppe (und den<br />
damit verbundenen Problemlösungs- und Pannenmanagement-Strategien)<br />
erweitert.<br />
125
126<br />
5 Ergebnisse des Fortbildungskontakts<br />
Rückmeldung der Teilnehmer Das geplante Unterrichtsprojekt konnte <strong>zur</strong> Zufriedenheit der Teilnehmer<strong>in</strong> durchgeführt<br />
werden. Methodische Bauste<strong>in</strong>e zum Internete<strong>in</strong>satz mit e<strong>in</strong>er Arbeitsgruppe aus<br />
dem geme<strong>in</strong>sam erarbeiteten Projekt wurden auch für nachfolgende Internet-Projekte<br />
e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Eigene E<strong>in</strong>schätzung E<strong>in</strong>e <strong>in</strong> diesem hohen Maße <strong>in</strong>dividualisierte Betreuung von Fortbildungsteilnehmern<br />
bietet -wie das vorliegende Beispiel me<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schätzung nach auch gezeigt hat- e<strong>in</strong>e<br />
hohe Gewähr dafür, dass nachhaltige Effekte erzielt werden können.<br />
Selbst bei e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen Zahl von Teilnehmern stellt diese Fortbildungsform (die ich<br />
als e<strong>in</strong>e Mischung aus „Tutor<strong>in</strong>g“ und „Co-Teach<strong>in</strong>g“ bezeichnen würde) allerd<strong>in</strong>gs<br />
hohe Anforderungen an die zeitlichen Möglichkeiten und die Flexibilität der Fortbildenden.<br />
Als hilfreiche und <strong>in</strong>teressante Ergänzung zum „realen“ Fortbildungskontakt und als<br />
Möglichkeit, die <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Ressourcen möglichst effektiv e<strong>in</strong>zusetzen,<br />
haben sich deshalb die Kommunikationsformen der neuen Medien (wie z.B. E-Mail,<br />
Chat, Onl<strong>in</strong>e-Forum, „Telegramm“/Kurznachricht) erwiesen.<br />
Insbesondere kurzfristig angeforderte und <strong>in</strong>dividuelle <strong>in</strong>struktionale Unterstützung<br />
lässt sich auf diese Weise me<strong>in</strong>es Erachtens sehr gut und vor allem auch über das<br />
unmittelbare Umfeld der Schule h<strong>in</strong>ausgehend vermitteln.<br />
Anlagen zum Fortbildungskontakt f<strong>in</strong>den sich auf der CD-Rom.
10 Darstellungen zum Projekt ForMeL G<br />
Im Laufe der Projektjahre s<strong>in</strong>d Projektpräsentationen, Poster sowie Präsentationen zu Prozes-<br />
schritten entstanden. Ausgewählte Materialien haben wir auf der CD-Rom zusammengestellt:<br />
Präsentationen<br />
Das BLK-Modellvorhaben SEMIK<br />
Präsentation zum BLK-Programm „SEMIK“ auf der Gesamtkonferenz der Kathar<strong>in</strong>a-He<strong>in</strong>-<br />
roth-Grundschule am 12. Dezember 2000 – Dagmar Wilde.<br />
Das Berl<strong>in</strong>er BLK-Projekt ForMeL G<br />
Präsentation zum Projekt FormeL G auf der Gesamtkonferenz der Kathar<strong>in</strong>a-He<strong>in</strong>roth-<br />
Grundschule am 12. Dezember 2000 – Dagmar Wilde.<br />
FormeL G - Projektreview<br />
Präsentation zu <strong>Entwicklung</strong>sschritten und Zwischenergebnissen im Projekt ForMeL G im<br />
SEMIK-Lenkungsausschuss im September 2001 - Dagmar Wilde.<br />
Das Berl<strong>in</strong>er BLK-Projekt ForMeL G<br />
Projektdarstellung, Prozessschritte und Zwischenergebnisse anlässlich des ForMeLG–Tages<br />
„Neue Lernkultur <strong>in</strong> der Grundschule“ an der Mark–Twa<strong>in</strong>–Grundschule im Rahmen des<br />
ARION–Programms für europäische Schulaufsichtsbeamte am 29. Mai 2002 - Dagmar Wil-<br />
de.<br />
ForMeL G – Fortbildungsmodul „Fachforum neue Medien im Deutschunterricht“<br />
Projektpräsentation und Präsentation des Fortbildungsmoduls „Fachforum neue Medien im<br />
Deutschunterricht“ anlässlich des Medienkongresses <strong>in</strong> Hamburg vom 30. September bis 2.<br />
Oktober 2002 – Dagmar Wilde und Doris Lerner.<br />
Das BLK-Projekt ForMeL G und se<strong>in</strong>e Fortbildungsmodule<br />
Projektpräsentation und Präsentation des Fortbildungsmoduls „Fachforum neue Medien im<br />
Deutschunterricht“ auf der Bildungsmesse <strong>in</strong> Nürnberg, April 2003 – Dagmar Wilde, Doris<br />
Lerner.<br />
Präsentationen zu ausgewählten Projektmodulen<br />
<strong>Fortbildungskonzept</strong>e im Projekt ForMeL G<br />
Präsentation zu <strong>Fortbildungskonzept</strong>en des Projekts ForMeL G auf der Bildungsmesse <strong>in</strong><br />
Nürnberg im April 2003 - Frieder Klapp.<br />
Schulentwicklung<br />
Präsentation anlässlich e<strong>in</strong>er Gesamtkonferenz der Schwielowsee-Grundschule im Februar<br />
2003 - Brigitte Meier.<br />
127
128<br />
„Förderung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Deutschunterricht der Grundschule – Lehrer<strong>in</strong>nen<br />
und Lehrer entdecken Potenziale des Lernens mit neuen Medien. Beispiele aus der<br />
Lehrerfortbildung im Rahmen des Berl<strong>in</strong>er SEMIK–Projekts ForMeL G“<br />
Präsentation im Rahmen der Tagung der AG Medien im Symposion Deutschdidaktik <strong>in</strong><br />
Schwäbisch–Gmünd im Juni 2002 - Dagmar Wilde, Doris Lerner.<br />
FormeL G <strong>in</strong> den Regionen - Prozessschritte <strong>in</strong> der Region Neukölln<br />
Präsentation der Projektschritte <strong>in</strong> der Region Neukölln anlässlich der Fachrunde am 17.<br />
April – Axel Schmidt, Hemut Nitschke.<br />
Regionalkonferenzen Neukölln<br />
Präsentation e<strong>in</strong>es regionalen <strong>Fortbildungskonzept</strong>s im Jahr 2000 – Michael Hackenberger.<br />
Vom Rahmenplan zum Lernziel<br />
Präsentation für e<strong>in</strong>en Workshop anlässlich e<strong>in</strong>es regionalen Studientages für die Neuköllner<br />
IT-Betreuer an Grund- und Sonderschulen am 20. Februar 2003 <strong>in</strong> der Michael-Ende-Grund-<br />
schule – Axel Schmidt.<br />
Neue Medien im Deutschunterricht – Praxisbeispiele<br />
Präsentation anlässlich e<strong>in</strong>es Workshops auf der Tagung „Medien-Ecken und Kanten“ <strong>in</strong> der<br />
Werner-Stephan-Oberschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Tempelhof) am 30. April 2003 – Doris Lerner.<br />
Co-Teachung<br />
Präsentation zum FormeLG-<strong>Fortbildungskonzept</strong> „Co-Tech<strong>in</strong>g“ anlässlich e<strong>in</strong>es Fortbildungs-<br />
workshops <strong>in</strong> Dill<strong>in</strong>gen am 7. und 8. Januar 2003 – Brigitte Meier.<br />
Veranstaltungen<br />
Tagungsübersicht<br />
Programm der Fachtagung des Projekts ForMeL G „Neue Lernkultur und neue Medien <strong>in</strong> der<br />
Berl<strong>in</strong>er Grundschule“ am 18./19. Oktober 2001.<br />
Resümee der Fachtagung des Projekts ForMeL G am 18./19. Oktober 2001<br />
Präsentation anlässlich e<strong>in</strong>er Mitarbeiterbesprechung im LISUM – Dagmar Wilde.<br />
Fotoshow zum ARION-Tag an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
E<strong>in</strong>drücke zu den Arbeitsprozessen am 29. Mai 2002 – Dagmar Wilde.<br />
„Neue Lernkultur <strong>in</strong> der Berl<strong>in</strong>er Grundschule: Lehrer/<strong>in</strong>nen und Schüler/<strong>in</strong>nen lernen mit<br />
neuen Medien“<br />
Flyer <strong>zur</strong> Abschlusstagung des Projekts ForMeL G am 12. Juni 2003.
Poster<br />
Posterpräsentation des BLK-Projekts ForMeL G<br />
Beitrag des Projekts <strong>zur</strong> Posterpräsentation der SEMIK-Projekte anlässlich des Medien-<br />
kongresses <strong>in</strong> Hamburg vom 30. September bis 2. Oktober 2002 – Dagmar Wilde.<br />
<strong>Fortbildungskonzept</strong>e der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule und der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule<br />
Poster <strong>zur</strong> Abschlusstagung des Berl<strong>in</strong>er SEMIK-Prpjekts „Erstellung digitaler Lehr- und<br />
Lernmaterialien“ im September 2003 – Thomas Kahlki, Frieder Klapp.<br />
Projektplanung<br />
Projektplanungsmatrix – Übersicht über Projektziele und –schritte<br />
Projektplanung im Februar 2000 - Dagmar Wilde.<br />
Projektzyklus – Februar 2001 – Wilde<br />
Übersicht über die avisierten Projektschritte während der Projektlaufzeit 1999 – 2003.<br />
129
130<br />
11 Neue Medien und neue Lernkultur <strong>in</strong> der Grundschule<br />
- e<strong>in</strong> ABC-Darium<br />
Dagmar Wilde<br />
Alltag<br />
Viele K<strong>in</strong>der s<strong>in</strong>d heute „im Netz“ – fast alle Grundschulen s<strong>in</strong>d es auch. Im Februar 2002<br />
erklärte der Staatssekretär im Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung (BMBF), Uwe<br />
Thomas: „Wir haben e<strong>in</strong>e Revolution <strong>in</strong> der Anwendung <strong>neuer</strong> Computertechniken <strong>in</strong> der Bil-<br />
dung vor uns – vom ‚Learn to use‘ zum ‚Use to learn‘. Computer und Notebooks müssen zum<br />
selbstverständlichen Lernmittel werden. Unser Ziel ist es, dass alle Schüler altersgerecht ihren<br />
Notebook–Computer als ‚elektronische Schiefertafel‘ und zugleich als <strong>in</strong>teraktives Lehrbuch<br />
nutzen.” (1) Anlässlich e<strong>in</strong>er Konferenz zum Thema „Medienkompetenz im 21. Jahrhundert”<br />
(2) plädierte Bundeskanzler Schröder im März 2002 dafür, K<strong>in</strong>dern bereits <strong>in</strong> der Grund-<br />
schule den spielerischen Umgang mit dem Internet beizubr<strong>in</strong>gen (3). 97 Prozent aller Sekun-<br />
darschulen, 95 Prozent aller berufsbildenden Schulen und 77,5 Prozent aller Grundschulen<br />
waren Anfang 2002 mit Computern ausgestattet. (4) Es lässt sich nicht mehr ignorieren:<br />
Der E<strong>in</strong>zug von Computer und Internet <strong>in</strong> die Privathaushalte und <strong>in</strong> die Klassenzimmer der<br />
Grundschulen schreitet <strong>in</strong> Quantensprüngen voran. Viele Lehrer wissen allerd<strong>in</strong>gs nach wie<br />
vor noch wenig über den medialen Alltag ihrer Schüler - das betrifft den Umgang mit neuen<br />
Medien ebenso wie die Lektüregewohnheiten im Bereich der alten Medien (letzteres zeigte<br />
aktuell PISA).<br />
Begleitung<br />
Lernen mit neuen Medien erfordert Begleitung durch kompetente Lehrkräfte. Niemals sollten<br />
K<strong>in</strong>der ziellos mit e<strong>in</strong>em Rechtschreibprogramm „üben“, nur <strong>in</strong> didaktisch begründeten Fäl-<br />
len sollten alle K<strong>in</strong>der denselben Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsbauste<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Lernsoftware bearbeiten. Erst wenn<br />
sie unter Bezug auf den <strong>in</strong>dividuellen Förderbedarf ausgewählt und e<strong>in</strong>gesetzt werden, können<br />
Lernprogramme <strong>in</strong>dividuelles Üben und Tra<strong>in</strong>ieren unterstützen. Übungen <strong>zur</strong> Rechtschreib-<br />
förderung erfordern stets – auch wenn sie am Computer statt f<strong>in</strong>den – Passung zu den <strong>in</strong>divi-<br />
duellen Kompetenzen und Lernbedürfnissen. Beispielsweise müssen Wörterlisten unter Bezug<br />
auf e<strong>in</strong>e Fehlerdiagnose erstellt und Übungsangebote mit Blick auf die Fehlerschwerpunkte<br />
e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des konzipiert se<strong>in</strong>. Textüberarbeitungen erfolgen am Computer unter Bezug auf <strong>in</strong>-<br />
dividuelle Schreibh<strong>in</strong>weise, die die Lehrer<strong>in</strong> <strong>in</strong> den Text gesetzt hat. Die K<strong>in</strong>der können <strong>in</strong> die-<br />
ser vorbereiteten Umgebung dann selbstgesteuert und vom frontalunterrichtlichen Gleichtakt<br />
befreit <strong>in</strong> ihrem persönlichen Zeitrhythmus üben.<br />
Schreibimpulse sollten auch beim Texteverfassen am Computer nicht nur <strong>in</strong>haltlich entfaltet<br />
werden, gleichfalls sollten den K<strong>in</strong>dern – <strong>in</strong> Orientierung an ihren <strong>in</strong>dividuellen Schreibent-<br />
wicklungen – Schreibhilfen <strong>zur</strong> Verfügung stehen, die sie nutzen können (aber nicht nutzen<br />
müssen): E<strong>in</strong>e Wörterkartei, e<strong>in</strong>e Kartei mit spannenden Sätzen, Plakate mit Schreibtipps (die<br />
<strong>in</strong> der Gruppe erarbeitet wurden) und ähnliches. Schreibberatungen mit Partnern sowie <strong>in</strong>di-<br />
viduelle Schreibberatung durch die Lehrer<strong>in</strong> unterstützen den Schreibprozess <strong>in</strong> den Phasen
des Planens, Schreibens und Überarbeitens – auch beim Schreiben am Computer. Lehrer<strong>in</strong><br />
und Mitschüler können als Leser<strong>in</strong>nen Schreibh<strong>in</strong>weise mithilfe der Überarbeitungsfunktion<br />
des Textverarbeitungsprogramms problemlos und spontan beim Lesen <strong>in</strong> den Text e<strong>in</strong>fügen.<br />
Curriculum<br />
Was müssen K<strong>in</strong>der im Umgang mit neuen Medien lernen? Was können K<strong>in</strong>der im Umgang<br />
mit neuen Medien lernen? Die didaktischen Potenziale der neuen Medien s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den immer<br />
zahlreicher publizierten Unterrichtsbeispielen (5) bei weitem noch nicht voll entfaltet. Wir<br />
bef<strong>in</strong>den uns <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Phase des Suchens, des Ausprobierens und Sammelns von gelungenen<br />
Beispielen und des Erforschens von Möglichkeiten. Damit befördern die neuen Medien e<strong>in</strong>mal<br />
mehr reflexive Praxis und forcieren e<strong>in</strong> Nachdenken über das Lehren und Lernen. Die neuen<br />
Medien stellen sich als Werkzeuge für Gestaltungs–, Problemlösungs– und Organisationsauf-<br />
gaben zu Verfügung. (Das reibungslose Funktionieren er Technik sollte natürlich gewährleis-<br />
tet se<strong>in</strong>.) (6) Die damit erzielten Lernergebnisse gilt es zu überprüfen. Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer<br />
s<strong>in</strong>d aufgefordert, diese Werkzeuge unter didaktischem Primat zu nutzen. „Kompetent reali-<br />
sierte Unterrichtsmodelle, sachgerechter und nicht willkürlicher Methodenpluralismus, e<strong>in</strong> fle-<br />
xibles, aber nicht beliebiges pädagogisches Handeln werden auch <strong>in</strong> der künftigen Lernkultur<br />
den guten Lehrer kennzeichnen...“ (7) Es gilt e<strong>in</strong>e Lernkultur zu schaffen, <strong>in</strong> deren Rahmen<br />
neue Medien als Werkzeuge und Inhalte des Lernens ihren klar def<strong>in</strong>ierten Platz haben. Weder<br />
Medieneuphorie noch Medienabst<strong>in</strong>enz s<strong>in</strong>d beim heutigen Diskussionsstand legitim. Viel-<br />
mehr geht es darum, die Qualität des Unterrichts – mit oder ohne neue Medien – kritisch zu<br />
reflektieren. Die Frage lautet stets: „Kann ich das, was ich erreichen will, mit den neuen Me-<br />
dien besser als ohne sie erreichen?“<br />
E<strong>in</strong>e Implementierung der neuen Medien <strong>in</strong> die Lehrpläne steht noch aus. Mediencurricula<br />
greifen zu kurz, wenn sie nicht <strong>in</strong> die Lernbereiche und Fächer <strong>in</strong>tegriert werden. Hieraus er-<br />
wachsen Anforderungen an die Kollegien, die schul<strong>in</strong>terne Mediencurricula konzipieren und<br />
erproben. Was die Veränderung von Unterricht und die Arbeit mit neuen Medien anbelangt,<br />
so sollten wir uns vor Überforderungen hüten. Überforderung mündet leicht <strong>in</strong> Resignation,<br />
die dazu verleitet, alles doch beim Alten zu lassen. Aber: Es s<strong>in</strong>d die kle<strong>in</strong>en Schritte, die zu<br />
e<strong>in</strong>er Veränderung der Lernkultur beitragen – mit und ohne neue Medien. Es s<strong>in</strong>d die kle<strong>in</strong>en<br />
Erfolge, die motivieren, den Weg fortzusetzen.<br />
Die ersten Schritte<br />
Wissen Sie über die Mediennutzungspraxis Ihrer Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler gut genug Be-<br />
scheid? E<strong>in</strong> E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Veränderung der Lernkultur kann dar<strong>in</strong> bestehen, sich mit den<br />
K<strong>in</strong>dern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Unterrichtssequenz über deren Medienpräferenzen und Mediennutzungsge-<br />
wohnheiten auszutauschen. Dazu werden <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>gruppen M<strong>in</strong>dMaps erstellt, die im Plenum<br />
vorgestellt und <strong>in</strong> e<strong>in</strong> „Bild“ der medialen Vorerfahrungen der Lerngruppe überführt werden.<br />
Über Begriffsklärungen lässt sich e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Verständigungsplattform entwickeln. K<strong>in</strong>-<br />
der treten als Experten auf, stellen ihre favorisierten Webseiten am Beamer vor. Lehrer struk-<br />
turieren und erweitern das Vorwissen, <strong>in</strong>dem sie zum Beispiel <strong>in</strong>dividuelle Erfahrungen und<br />
Me<strong>in</strong>ungen abgleichen, gewichten, modifizieren und geme<strong>in</strong>sam mit den K<strong>in</strong>dern <strong>in</strong> Kriterien<br />
an k<strong>in</strong>dgerechte Medienangebote überführen. Kriterien, die <strong>in</strong> altersgerechter Akzentuierung<br />
zu e<strong>in</strong>er selbst bestimmten und gezielten Mediennutzung befähigen. Solche Lernszenarien tra-<br />
131
132<br />
gen dazu bei, die Medienkompetenz sukzessive zu erweitern. Im H<strong>in</strong>blick auf die Beteiligung<br />
der Lernenden am Lehr–Lern–Prozess und die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der Lern<strong>in</strong>halte <strong>in</strong> den Interessen–<br />
und Erfahrungsh<strong>in</strong>tergrund der Lernenden erfolgt so e<strong>in</strong> Schritt h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Veränderung der<br />
Lehr– und Lernkultur.<br />
Erweiterter Lernbegriff<br />
Sachthemen implizieren erweiterte Lernanlässe, die die E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien deutli-<br />
cher zutage treten lässt, als es im traditionellen Unterricht mit „alten“ Medien der Fall se<strong>in</strong><br />
mag. Gibt es Möglichkeiten Computer und Internet <strong>in</strong> die Lernstationenangebote zum Thema<br />
„Wasser“ zu <strong>in</strong>tegrieren? Wenn die sachstrukturelle Passung des Mediene<strong>in</strong>satzes gegeben<br />
ist, stellt sich die Frage, welche Methodenkompetenzen die K<strong>in</strong>der besitzen bzw. erwerben<br />
müssen, um im Internet zu recherchieren, um Quellen zu beurteilen, um Ergebnisse zu doku-<br />
mentieren und/oder zu visualisieren. Im Bereich sozialer Kompetenzen gilt es zu bedenken,<br />
welche Regeln <strong>zur</strong> Partner–/Gruppenarbeit den K<strong>in</strong>dern vertraut se<strong>in</strong> bzw. e<strong>in</strong>geführt werden<br />
müssen, damit kooperatives Lernen an den Stationen möglich wird. Welche Lernhilfen müs-<br />
sen also für das selbständige Arbeiten am Gegenstand bereitgestellt werden, damit die K<strong>in</strong>der<br />
ihre Sach–, Sozial– und Methodenkompetenz erweitern (und nicht nur unter Dom<strong>in</strong>anz e<strong>in</strong>es<br />
selbstbewussten Schülers ziellos <strong>in</strong> URL–Listen herumirren bzw. Bilder herunterladen und<br />
ausdrucken)? Selbstständiges Recherchieren will ebenso gelernt se<strong>in</strong> wie Kooperieren. Dar<strong>in</strong>,<br />
dass Lernen mit neuen Medien den erweiterten Lernbegriff so unübersehbar transportiert,<br />
liegt e<strong>in</strong>e besondere Chance!<br />
<strong>Fortbildungskonzept</strong>e<br />
Lernen – auch Lernen <strong>in</strong> Fortbildungen - heißt Individualisierung und ist auf Kooperation<br />
angewiesen. Wenn Lehrer, die sich entwickeln wollen und die unter Lernen nicht etwas verste-<br />
hen, was man von anderen verlangt, sondern was man auch selbst zu leisten bereit ist, <strong>in</strong> kol-<br />
legialen oder regionalen Fortbildungsnetzwerken arbeiten, entsteht häufig „Fortbildungslust“.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs bedürfen Netzwerke e<strong>in</strong>er ebenso prozessbezogenen wie sachkompetenten Steue-<br />
rung. Lehrer wollen <strong>in</strong> Fortbildungsnetzwerken „(...)nicht nur kommunizieren, <strong>in</strong>teragieren,<br />
reflektieren, sie wollen auch Relevantes, Interessantes, Neues hören und lernen. (…) Auch als<br />
Zuhörer s<strong>in</strong>d sie ke<strong>in</strong>esfalls bloße „Rezipienten“ und „Empfänger“, sondern sie nehmen e<strong>in</strong>e<br />
prüfende, kritische Haltung gegenüber dem Wissensangebot e<strong>in</strong>. Diese Prüfung bezieht sich<br />
weniger auf die „Richtigkeit“ als auf die Anschlussfähigkeit, die Viabilität, die momentane<br />
Verträglichkeit (man ist nicht <strong>in</strong> jeder Lebenssituation für jede Art von Wissen gleichermaßen<br />
empfänglich). Nicht jedes neue Wissen muss reibungslos passen und „verwertbar“ se<strong>in</strong>; oft<br />
wird auch Ungewohntes und Irritierendes wahrgenommen und „gespeichert“.“ (8) Kollegiale<br />
Fortbildungsnetzwerke speisen sich aus <strong>in</strong>dividuellen Kompetenzen, die <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>same Lern-<br />
prozesse überführt werden. Lernende wie Lehrende s<strong>in</strong>d gleichermaßen Lehrende wie Lernen-<br />
de - im Prozess e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen reflexiven Austauschs.<br />
Professionalisierung durch Vernetzung, Partizipation und Austausch im Kollegenkreis,<br />
Eigene Ansätze und gewohnte Vorgehensweisen werden durch Konfrontation mit anderen<br />
Sichtweisen und Problemlösungen <strong>in</strong> Frage gestellt, modifiziert. Das bewirkt Reflexions- und<br />
Veränderungsimpulse, die sich aus der alltäglichen, eigenen Praxis oftmals nicht ergeben.
Grundannahmen im Modellvorhaben ForMeL G<br />
• Medienkompetenz ist mehr als Mediennutzungskompetenz, <strong>in</strong>sofern greifen Lehrgänge <strong>zur</strong><br />
Vermittlung technischer Grundfertigkeiten zu kurz.<br />
• Neue Medien s<strong>in</strong>d Werkzeuge („Tools“), die im Lehr-Lernprozess als Lernmedium und<br />
Lerngegenstand ihren didaktischen Ort haben können.<br />
• Bei der Nutzung <strong>neuer</strong> Medien für <strong>in</strong>haltliche Ziele lernen Schüler wie Lehrer nachhaltiger.<br />
• Für Schüler wie Lehrer gilt es e<strong>in</strong> grundverständnis medialer Ressourcen und Anwendungs-<br />
felder zu entwickeln - mit dem Anliegen um selbständiges und kooperierendes Lernen im<br />
Zuge dieses eigenaktiven Erwerbsprozesses.<br />
• Neue Medien, <strong>neuer</strong>e Erkenntnisse der Lernbiologie, erfordern e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung<br />
tradierter Formen der Wissensvermittlung und Unterrichtsgestaltung, erfordern e<strong>in</strong>e neue<br />
Lernkultur und e<strong>in</strong>e Veränderung der Rollen der Lehrenden und Lernenden.<br />
Handhabungskompetenz<br />
Die „Mediengeneration” hat weder Scheu noch Schwierigkeiten, sich selbstständig die für<br />
Erwachsene mitunter befremdlichen technischen Potenziale zu erschließen und die dafür er-<br />
forderlichen Kompetenzen anzueignen. K<strong>in</strong>der haben ke<strong>in</strong>e Angst Fehler zu machen, sie gehen<br />
explorativ und <strong>in</strong>tuitiv ihre Wege und kommen an Ziele. Ob das immer die gewünschten s<strong>in</strong>d,<br />
das spielt für sie beim Experimentieren erst e<strong>in</strong>mal ke<strong>in</strong>e Rolle. Mit ger<strong>in</strong>gem Aufwand und<br />
mithilfe von Tipps, die im Freundeskreis die Runde machen, erwerben K<strong>in</strong>der – auch ohne<br />
Instruktion durch Erwachsene – rasch die erforderliche Handhabungskompetenz, um Compu-<br />
terspiele zu „cheaten“ und sich im Internet zu bewegen. Aber: Medienkompetenz ist mehr als<br />
Medienhandhabungskompetenz.<br />
Individualisierung<br />
Individuelles Lernen wird durch neue Medien unterstützt. Bei der Arbeit am Computer s<strong>in</strong>d<br />
<strong>in</strong>dividuelle Lernwege, <strong>in</strong>dividuelles Lerntempo und <strong>in</strong>dividuelle Lern<strong>in</strong>halte und -ziele nicht<br />
nur möglich, sie stellen sich vielmehr selbstverständlich e<strong>in</strong>. Die Individualisierung der Lern-<br />
prozesse erfordert Organisationsmuster, die das <strong>in</strong>dividuelle Lernen im sozialen Kontext<br />
der Gruppe zum e<strong>in</strong>en ermöglichen und zum anderen aber auch fruchtbar machen. Dazu<br />
bedarf es gruppen<strong>in</strong>terner Regeln und Rituale – soziales Lernen ist somit stets gefordert und<br />
muss konsequent gefördert werden. Das spiegelt sich im Arbeiten gemäß (selbst)gestellter<br />
Arbeitsaufträge und Ziele, im E<strong>in</strong>halten von zeitlichen, organisatorischen und <strong>in</strong>haltlichen<br />
Absprachen, im Kooperieren mit dem Partner oder <strong>in</strong> der Gruppe, im Veröffentlichen und<br />
Diskutieren von (Zwischen)Ergebnissen, im E<strong>in</strong>halten von Gesprächsregeln etc. wider. Lernen<br />
im Gleichschritt kommt rasch aus dem Takt, wenn siebenundzwanzig K<strong>in</strong>der zwei oder drei<br />
Computer nutzen wollen. Lernen im Gleichschritt kommt auch aus dem Takt, wenn fünfzehn<br />
Computer <strong>zur</strong> Verfügung stehen. Lernen fand jedoch - auch <strong>in</strong> Zeiten als neue Medien noch<br />
nicht existierten - <strong>in</strong> den Köpfen nie im Gleichschritt statt, nur ließ sich das leichter ignorie-<br />
ren. Lernen – <strong>in</strong>dividuelles wie geme<strong>in</strong>sames – will weiterh<strong>in</strong> angestoßen, begleitet und ausge-<br />
wertet werden, um <strong>in</strong> förderliche Lernschritte überführt zu werden.<br />
133
134<br />
Jungen und Mädchen<br />
Mädchen gelten im H<strong>in</strong>blick auf computertechnische Kompetenzen und die Nutzung <strong>neuer</strong><br />
Medien als benachteiligt. Sie schätzen ihre Kompetenzen im Umgang mit den neuen Me-<br />
dien meist auch skeptischer e<strong>in</strong> als Jungen. (Wobei die subjektive Selbste<strong>in</strong>schätzung den<br />
tatsächlichen Fähigkeiten <strong>in</strong> der produktiven Nutzung der Werkzeuge oft nicht entspricht.)<br />
Die Unterschiede reduzieren sich jedoch, wenn neue Medien im Alltagsunterricht e<strong>in</strong>e selbst-<br />
verständliche Rolle spielen. (9) Viele K<strong>in</strong>der verfügen zwar über außerschulische Mediener-<br />
fahrungen, aber nicht alle K<strong>in</strong>der erwerben Kompetenzen im Umgang mit Computer und<br />
Internet automatisch im außerschulischen Bereich. Die Grundschule hat hier die kompensa-<br />
torische Aufgabe, auch weniger technikbegeisterten und <strong>zur</strong>ückhaltenden K<strong>in</strong>dern Zugang<br />
zu den neuen Medien zu erschließen, ihnen Nutzungskompetenzen zu vermitteln, welche die<br />
Hemmschwellen abbauen und Chancen, die Potenziale der neuen Medien aktiv zu nutzen,<br />
erst aufschließen.<br />
PISA machte uns darauf aufmerksam, dass es das Lese–Interesse von Jungen zu wecken und<br />
zu erhalten gilt. Computer, Internet und CD–Rom s<strong>in</strong>d geeignet, Jungen zum Lesen zu ver-<br />
locken, weil Lesen hier <strong>in</strong> Kontexte e<strong>in</strong>gebunden ist, die sie <strong>in</strong>teressieren. Informierendes<br />
Lesen, das <strong>in</strong> medialen Texten e<strong>in</strong>e bedeutende Rolle spielt, orientierendes Lesen, Navigieren<br />
<strong>in</strong> Hypertexten kommt ihren Lese<strong>in</strong>teressen und –haltungen entgegen. Durch die Interaktivi-<br />
tät der Text–Bild–Komb<strong>in</strong>ationen, durch die Möglichkeit kurze Sequenzen zu lesen und über<br />
Hyperl<strong>in</strong>ks durch Texte zu „zappen“, wird Lesen für manche K<strong>in</strong>der eher attraktiv als durch<br />
traditionelle Bemühungen, sie an K<strong>in</strong>derbücher heranzuführen. Etliche Jungen erfahren durch<br />
schulische Leseangebote auf CD–Rom und im Internet erstmals Alternativen zu Computer-<br />
spielen. (10)<br />
K<strong>in</strong>der im Netz<br />
Grundschulk<strong>in</strong>der wachsen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er durch Medien geprägten Welt auf. Sie br<strong>in</strong>gen differen-<br />
zierte Vorerfahrungen im Umgang mit neuen Medien mit. Die neuen Medien s<strong>in</strong>d im Alltag<br />
der K<strong>in</strong>der <strong>in</strong>zwischen fester verankert, als mancher Erwachsene es sich vorstellen kann oder<br />
will. Mitte der 60–er Jahre zeigten sich K<strong>in</strong>der fassungslos, wenn sie hörten, dass ihre Eltern<br />
e<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>dheit ohne Fernseher verlebt hatten. In den 80–er Jahren wunderten sich K<strong>in</strong>der, dass<br />
ihre Eltern e<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>dheit ohne Walkman und Gameboy bestehen konnten. Das Vorstellungs-<br />
vermögen heutiger K<strong>in</strong>der übersteigt es, dass ihre Eltern e<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>dheit ohne Chatroom–Besu-<br />
che und Onl<strong>in</strong>e–Spiele genießen, geschweige denn ihre Hausaufgaben ohne E–Mail–Kontakte<br />
und Internetrecherchen bewältigen konnten. Computer und Internet gehören für etliche K<strong>in</strong>-<br />
der heute <strong>zur</strong> vertrauten Alltagskultur wie Handy und Gameboy. Internet und E–Mail s<strong>in</strong>d<br />
– ebenso wie SMS – Bestandteil ihrer Freizeit– und Kommunikationskultur, s<strong>in</strong>d für sie wich-<br />
tige Medien der Informationsbeschaffung und des Informationsaustauschs.<br />
Mitte 2002 stand <strong>in</strong> zwei Drittel der Haushalte, <strong>in</strong> denen K<strong>in</strong>der aufwachsen, m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong><br />
Computer, <strong>in</strong> 47 Prozent der Haushalte auch e<strong>in</strong> Internet–Zugang <strong>zur</strong> Verfügung. (11)<br />
63 Prozent der 6– bis 13–Jährigen haben nach eigenen Angaben schon e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>en Compu-<br />
ter genutzt. Jungen (67%) geben etwas häufiger Computererfahrung an als Mädchen (59%).<br />
Unter den 6– bis 7–Jährigen saß jedes vierte K<strong>in</strong>d schon e<strong>in</strong>mal am Computer, bei den 12– bis<br />
13–Jährigen nutzen bereits 82 Prozent den Computer regelmäßig. Im Vergleich zum Jahr<br />
2000 ist die Nutzungs<strong>in</strong>tensität angestiegen: Im Jahr 2000 nutzten 75 Prozent der computer-
nutzenden K<strong>in</strong>der m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal pro Woche dieses Medium, im Jahr 2002 bereits 85 Pro-<br />
zent. Den Umgang mit dem Computer haben zwei Drittel der K<strong>in</strong>der von ihren Eltern gelernt,<br />
e<strong>in</strong> Viertel von Freunden.<br />
Zu den häufigsten Anwendungen zählt das Spielen von Computerspielen. K<strong>in</strong>der ab 12 Jah-<br />
ren dürfen zu 44 Prozent selbst auswählen, welche Computerspiele gespielt werden.<br />
43 Prozent geben auch Lernprogramme und das Arbeiten für die Schule als Tätigkeiten, die<br />
m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal pro Woche am Computer verrichtet werden, an. Während sich Jungen<br />
mehr mit Computerspielen befassen, nutzen Mädchen häufiger Lernprogramme.<br />
Der Anteil der Internet–Nutzung ist deutlich angestiegen: 50 Prozent haben bereits e<strong>in</strong>mal das<br />
Internet benutzt. 25 Prozent der computernutzenden K<strong>in</strong>der surfen m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal pro<br />
Woche im Internet, im Jahr 2000 waren es nur 15 Prozent.<br />
Das Versenden und Verschicken von E–Mails, die Suche nach allgeme<strong>in</strong>en Informationen und<br />
die Recherche für die Schule s<strong>in</strong>d Tätigkeiten, die von e<strong>in</strong>em guten Drittel der K<strong>in</strong>der im In-<br />
ternet m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal pro Woche ausgeübt werden.<br />
Für K<strong>in</strong>der s<strong>in</strong>d die neuen Medien vorrangig Unterhaltungsangebot, zunehmend aber auch<br />
Lernplattform. Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler e<strong>in</strong>er vierten Klasse <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> nannten 2002 als be-<br />
vorzugte Internetaktivitäten:<br />
Spielen (z. B. Pokémon),<br />
Informationen über Filme abrufen,<br />
aktuelle Trailer anschauen (Harry Potter, Herr der R<strong>in</strong>ge),<br />
Spielzeughersteller–Seiten besuchen,<br />
Informationen für den Unterricht e<strong>in</strong>holen,<br />
E–Mail nutzen,<br />
Chatten,<br />
Nachrichten lesen.<br />
Lesen - e<strong>in</strong>e Schlüsselkompetenz im Zeitalter <strong>neuer</strong> Medien<br />
K<strong>in</strong>der lesen e<strong>in</strong> Buch, halten ihre Leseerfahrungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Lesetagebuch fest, bearbeiten<br />
Impulse e<strong>in</strong>er von der Lehrer<strong>in</strong> vorbereiteten Lesebegleitkartei, diskutieren ihre Lesarten <strong>in</strong><br />
Lesekonferenzen. Das Szenario ist nicht neu – neue Medien können es anreichern: K<strong>in</strong>der<br />
können Szenen zum Buch spielen und mit der Digitalkamera festhalten, das Lesetagebuch am<br />
Computer führen, Recherchen <strong>zur</strong> Autor<strong>in</strong> im Internet vornehmen, die CD–Rom und das Vi-<br />
deo zum Buch vergleichend untersuchen, Arbeitsergebnisse auf der Webseite der Schule/Klasse<br />
veröffentlichen, Mailkontakte mit anderen Klassen aufnehmen, die bereits Erfahrungen mit<br />
ihrer Lektüre veröffentlicht haben, Leseerfahrungen mit Mitschülern im Chat diskutieren usw.<br />
Am Ende des Unterrichtsvorhabens erfolgt die Rekapitulation der <strong>in</strong>dividuellen Arbeitsschrit-<br />
te und –ergebnisse im persönlichen Lerntagebuch (am Computer).<br />
Potenziale des Internet eröffnen sich im Bereich der Lektüre von Sachtexten. Für das <strong>in</strong>for-<br />
mierende Lesen bietet das Internet e<strong>in</strong>en Fundus an K<strong>in</strong>der <strong>in</strong>teressierenden ebenso wie lehr-<br />
planrelevanten Inhalten. In den neuen Medien (Internet, CD–Roms, E–Mail) begegnen K<strong>in</strong>der<br />
anders strukturierten Texten als <strong>in</strong> Lese–/Sprachbüchern und K<strong>in</strong>derbüchern. Die L<strong>in</strong>earität<br />
der Texte löst sich vielfach auf. Hypertexte befördern e<strong>in</strong>e andere Lesehaltung als l<strong>in</strong>eare Tex-<br />
te – erfordern aber auch Lesestrategien, die beherrscht und geübt werden wollen. “Unter den<br />
Lesemodi ist das <strong>in</strong>formierende Lesen – <strong>in</strong> Balance zwischen Genauigkeit und Geschw<strong>in</strong>dig-<br />
135
136<br />
keit – e<strong>in</strong> meist wenig planvoll geübter Modus. Reichen die Leserfertigkeiten für die Erschlie-<br />
ßung der Arbeitsaufträge im Sprachbuch meist noch aus, scheitern viele K<strong>in</strong>der jedoch bei<br />
Internetrecherchen, da ihnen Strategien der Texterschließung fehlen. Um das <strong>in</strong>formierende,<br />
selektierende Lesen zu üben bietet das Internet weitaus authentischere Lernanlässe als bei-<br />
spielsweise die Bastelanleitungen und Gemüsesuppenrezepte der Lesebücher. Beim Scrollen am<br />
Bildschirm können K<strong>in</strong>der das überfliegende Lesen gezielt üben (schemenhaftes Wahrnehmen<br />
von Informationen bei der Suche nach Kernaussagen, Identifizieren von Ankerwörtern).“ (12)<br />
Medienkompetenz<br />
Immer mehr Grundschulk<strong>in</strong>der verfügen über e<strong>in</strong> weites Spektrum außerschulischer Medie-<br />
nerfahrungen und manche unter ihnen besitzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Gebieten Kompetenzen, die die<br />
ihrer Lehrer übertreffen. Aufgabe der Grundschule ist es – sowohl im H<strong>in</strong>blick auf kompen-<br />
satorische Zielstellungen als auch im H<strong>in</strong>blick auf den Erfahrungs– und Lebensweltbezug<br />
schulischen Lernens, diese heterogenen Erfahrungen aufzugreifen, zu strukturieren sowie<br />
diese Kompetenzen zu entfalten und zu erweitern. Um mit Medien sachgerecht, kreativ und<br />
sozialverantwortlich umgehen zu können, bedarf es der Ausbildung kognitiver und sozial–<br />
emotionaler Kompetenzen. K<strong>in</strong>der befähigt werden, Medienangebote zunehmend selbständig<br />
auswählen und nutzen zu können, eigene Medienbeiträge gestalten und verbreiten zu können,<br />
Mediengestaltungen und ihre Wirkungen zu verstehen und sie bewerten zu können, sie müs-<br />
sen - auf e<strong>in</strong>em altersgemäßen Niveau - <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong>, die Bed<strong>in</strong>gungen der Produktion und<br />
Verbreitung von Medien zu durchschauen und beurteilen zu können. (13)<br />
Um neue Medien im Unterricht e<strong>in</strong>zusetzen, benötigen Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer weiter rei-<br />
chende Kompetenzen als für den Umgang mit dem Computer und den Gebrauch von Office–<br />
Anwendungen erforderlich s<strong>in</strong>d. Sie müssen die Potenziale der neuen Medien auf technischer<br />
sowie auf didaktisch–methodischer Ebene kennen und für Lehr-Lern-Prozesse nutzen lernen.<br />
Dazu gehören die Reflexion des eigenen Medienhandelns, das Wissen um die Medienrezepti-<br />
on bei K<strong>in</strong>dern und Jugendlichen, Wissen und Fähigkeiten, um Medienangebote reflektiert im<br />
Unterricht e<strong>in</strong>setzen und Medien als Thema des Unterrichts angemessen angehen können.<br />
Neue Lernkultur und neue Medien<br />
Es ist nicht mehr zu übersehen: Die neuen Medien haben sich <strong>in</strong> unserem im Alltag etabliert,<br />
wir nutzen sie immer selbstverständlicher. Seitdem sie E<strong>in</strong>zug <strong>in</strong> die Grundschulen und <strong>in</strong> die<br />
Klassenzimmer halten, wird immer offensichtlicher, dass es zwar auch Handhabungskompe-<br />
tenzen aufseiten der Lehrenden und Lernenden, vor allem aber veränderte Konzepte des Leh-<br />
rens und Lernens erfordert, um Computer und Internet zielgerichtet im Unterricht zu nutzen.<br />
Inzwischen ist klar geworden: Es geht für die Schulen nicht alle<strong>in</strong> um Ausstattungsfragen, es<br />
geht für Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer nicht alle<strong>in</strong> um Erwerb oder Erweiterung digitaler Kompe-<br />
tenzen. Es geht vielmehr um Fragen der Qualität von Lehren und Lernen. Es geht um die Ver-<br />
änderung der Rollen von Lehrenden und Lernenden. Und dazu ist anzumerken: Der Wandel<br />
der Lehrerrolle beg<strong>in</strong>nt im Kopf – nicht im Computerraum.<br />
Um Unterricht sach- und k<strong>in</strong>dgerecht unter Bezug auf <strong>neuer</strong>e lerntheoretische Erkenntnisse<br />
zu planen und zu realisieren bedarf es ke<strong>in</strong>es Computers und ke<strong>in</strong>es Internetanschlusses. Das<br />
haben viele Lehrer <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten bewiesen, das legen die pädagogischen Begrün-<br />
dungen und fachdidaktischen Konzepte für e<strong>in</strong>e veränderten Lehr– und Lernkultur im Grund-
schulunterricht überzeugend dar. Aber: Sofern Computer und Internet didaktisch-methodisch<br />
zielgerichtet und an den Lernvoraussetzungen der K<strong>in</strong>der orientiert genutzt werden sollen,<br />
bedarf es ganz zw<strong>in</strong>gend e<strong>in</strong>es veränderten Verständnisses über das Lernen und die Lern-<br />
<strong>in</strong>halte, über die Rolle der Lehrenden und Lernenden im Unterricht, über die Organisation<br />
des Unterrichts. Somit fordern die neuen Medien uns heraus, das Lernen und Lehren neu zu<br />
denken. So gesehen forcieren sie e<strong>in</strong>e Veränderung der Lernkultur und befördern damit Schul-<br />
entwicklungsprozesse. Veränderte Konzepte des Lernens s<strong>in</strong>d gefragt, wenn es <strong>in</strong> immer mehr<br />
Grundschulen darum geht, Konzepte für den Mediene<strong>in</strong>satz zu entwickeln und zu erproben.<br />
Die Veränderung des Unterrichts h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er neuen Lernkultur ist nicht von der E<strong>in</strong>beziehung<br />
<strong>neuer</strong> Medien abhängig – sie wird durch die Integration <strong>neuer</strong> Medien allerd<strong>in</strong>gs oft unter-<br />
stützt: Die Lehrenden sehen sich veranlasst ihre Rollen neu zu def<strong>in</strong>ieren, weil sie im Umgang<br />
mit der Technik selbst Lernende und Experimentierende s<strong>in</strong>d. Dies hat Konsequenzen für das<br />
Lehrer–Schüler–Verhältnis. Wenn Lehrer Fehler machen oder Lösungen suchen, wenn K<strong>in</strong>der<br />
sie beraten können, wenn Lehrende beg<strong>in</strong>nen, sich als Lernende zu verstehen, wenn Lernende<br />
mitunter zu Experten werden – dann verändert das die Lernatmosphäre. Lehrende und Ler-<br />
nende widmen sich geme<strong>in</strong>sam dem „Abenteuer des Lernens“.<br />
Begeben Sie sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ersten Schritt doch erst e<strong>in</strong>mal mit e<strong>in</strong>er Kle<strong>in</strong>gruppe (z. B. im<br />
Förderkurs) auf e<strong>in</strong>e Entdeckungsreise <strong>in</strong>s Internet (z. B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Onl<strong>in</strong>e–Portal für K<strong>in</strong>der wie<br />
www.bl<strong>in</strong>de–kuh.de, www.kidsville.de/ oder www.k<strong>in</strong>dersache.de) und sammeln Sie geme<strong>in</strong>-<br />
sam mit den K<strong>in</strong>dern „Reise–Erlebnisse“ <strong>in</strong> Form Ihrer Entdeckungen und Erfahrungen beim<br />
Besuch der Seiten. Dies kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Übersicht über die Angebote, die Seitenstruktur, <strong>in</strong><br />
Tipps <strong>zur</strong> Navigation münden, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Plakat zusammengefasst werden. Die K<strong>in</strong>der des<br />
Förderkurses tragen der Klasse die Ergebnisse vor. Diese Übersicht kann für die Gesamtgrup-<br />
pe dann Orientierungshilfe für erste Schritte im Internet se<strong>in</strong>. Die K<strong>in</strong>der des Förderkurses<br />
werden zu Experten, die die anderen K<strong>in</strong>der bei ihren ersten Schritten im Internet unterstüt-<br />
zen können. (14)<br />
Organisation<br />
Bestimmte organisatorisch-technische Rahmenbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>en alltäglichen E<strong>in</strong>satz<br />
der neuen Medien <strong>in</strong> Grundschulen unverzichtbar:<br />
• 2–3 Computer <strong>in</strong> den Klassenräumen<br />
• m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> zentraler Computerraum (als „Medien-Werkstatt“ nicht als „IT–Raum“ e<strong>in</strong>-<br />
gerichtet) - alternativ: mobile Medienzentren (Laptop-Lösungen erweisen sich als besonders<br />
praktikabel)<br />
• Vernetzung möglichst vieler Klassenräume (auch hier gilt: mobile Laptop-Lösungen - mit<br />
Funkvernetzung - haben sich besonders bewährt)<br />
• mehrere Computer mit Internetzugang <strong>in</strong> den Lehrerarbeitsräumen<br />
• standortnah - d. h. sowohl im Computerraum als auch <strong>in</strong> den Klassenräumen - verfügbare<br />
Peripherie (zum<strong>in</strong>dest Drucker, Digitalkamera - darüber h<strong>in</strong>aus Scanner, Videokamera).<br />
• verfügbare Peripherie (zum<strong>in</strong>dest Drucker, darüber h<strong>in</strong>aus Scanner, Digitalkamera, Videoka-<br />
mera).<br />
E<strong>in</strong>e Aufhebung der tradierten Zeittakte wird beim Unterricht mit neuen Medien unumgäng-<br />
lich. Schon alle<strong>in</strong> das Procedere der Bereitstellung der technischen Voraussetzungen (Hoch-<br />
fahren der Rechner, Aufstarten der Programme, Aufsuchen der Verzeichnisse zu Beg<strong>in</strong>n sowie<br />
137
138<br />
Speichern der Arbeit und Herunterfahren der Rechner am Ende der Stunde) sprengt den 45-<br />
M<strong>in</strong>uten-Takt, ganz gleich, ob 27 Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler an 16 Rechnern oder sechs K<strong>in</strong>-<br />
der an zwei Rechnern arbeiten wollen. E<strong>in</strong> Wechsel der Inhalte und Arbeitsschwerpunkte im<br />
45-M<strong>in</strong>uten-Takt erweist sich als obsolet, wenn e<strong>in</strong>ige K<strong>in</strong>der im Internet recherchieren und<br />
die Rechercheergebnisse <strong>in</strong> der Gruppe diskutieren, zusammenführen und sie schließlich <strong>in</strong> ei-<br />
ner Powerpo<strong>in</strong>tpräsentation dokumentieren wollen, während andere e<strong>in</strong>e Fotoreportage pla-<br />
nen und durchführen und wieder andere aus Sachbüchern Informationen exzerpieren. Wenn<br />
differenzierend gearbeitet wird, muss der Zeitrahmen darauf abgestimmt se<strong>in</strong>.<br />
Jeder Computerraum muss als Lernumgebung gestaltet se<strong>in</strong>, die offene Unterrichtsformen<br />
ermöglicht, die e<strong>in</strong>e variable Medienumgebung mit Bibliothek und Leseecke, Raum für Ple-<br />
numsgespräche im Stuhlkreis sowie Rückzugsmöglichkeiten für Kle<strong>in</strong>gruppen bietet. Jede<br />
Medienecke im Klassenraum sollte mehr bieten als e<strong>in</strong>ige Computerarbeitsplätze. Die Zahl<br />
der verfügbaren Werkzeuge wirkt sich natürlich auf die Arbeitsorganisation aus. Im Klassen-<br />
raum stehen weniger Arbeitsplätze <strong>zur</strong> Verfügung als im Computerraum. Praxiserfahrungen<br />
legen es nahe: Der Computer mit allen se<strong>in</strong>en Möglichkeiten muss K<strong>in</strong>dern dann <strong>zur</strong> Verfü-<br />
gung stehen, wenn diese Ressourcen bei der Bearbeitung e<strong>in</strong>es Problems, bei der Lösung e<strong>in</strong>er<br />
Aufgabe, bei der Realisierung e<strong>in</strong>er Idee benötigt werden - nicht erst, wenn der Stundenplan<br />
oder der Raumbelegungsplan es zulassen. Computer gehören daher zw<strong>in</strong>gend auch <strong>in</strong> jeden<br />
Klassenraum. E<strong>in</strong>e Medienecke mit zwei Rechnern (besser drei oder vier), Internetanschluss,<br />
Drucker, Scanner, Standardsoftware und verschiedene Lernprogramme und CD–Roms wären<br />
als Standardausstattung zu wünschen. (15)<br />
Mobile Lösungen (Laptops im Pool) erweisen sich als optimal, um die Ausstattungsbedürf-<br />
nisse situativ zu bedienen. (16) Pr<strong>in</strong>zipiell sollten den Lernenden Lernumgebungen <strong>zur</strong> Ver-<br />
fügung stehen, die e<strong>in</strong> breites Medienspektrum umfassen. Daher werden sowohl Räume, <strong>in</strong><br />
denen e<strong>in</strong>e große Zahl von Computern <strong>zur</strong> Verfügung steht, als auch direkte Zugriffsmöglich-<br />
keiten auf Computer und Internet, Drucker und Scanner im Klassenraum benötigt. E<strong>in</strong> Ent-<br />
weder-Oder würde die Lernoptionen e<strong>in</strong>schränken.<br />
Partnerschaftliches Lernen<br />
Kooperatives Arbeiten besteht nicht bereits dar<strong>in</strong>, dass K<strong>in</strong>der sich untere<strong>in</strong>ander bei Bedarf<br />
technische Tipps geben. Partnerarbeit am Computer will organisiert se<strong>in</strong>, das müssen K<strong>in</strong>-<br />
der lernen. Viele Lehrer stellen Regeln geme<strong>in</strong>sam mit den K<strong>in</strong>dern auf und präsentieren die<br />
Regeln auf e<strong>in</strong>em Plakat, das im Klassenraum oder Computerraum gut sichtbar aufgehängt<br />
wird. Zu Beg<strong>in</strong>n jeder Stunde werden nicht nur die <strong>in</strong>haltlichen Vorhaben besprochen bzw.<br />
rekapituliert, sondern auch die Vere<strong>in</strong>barungen zum Mite<strong>in</strong>ander, die Arbeitsmethoden re-<br />
kapituliert - bis alle K<strong>in</strong>der diese Regeln ver<strong>in</strong>nerlicht haben. Am Ende jeder Stunde muss<br />
genügend Zeit <strong>zur</strong> Verfügung stehen, um die Arbeit <strong>in</strong> <strong>in</strong>haltlicher und methodischer H<strong>in</strong>sicht<br />
zu rekapitulieren (Was haben wir erreicht? Wie s<strong>in</strong>d wir dabei vorgegangen? Wie werden<br />
wir weiter arbeiten?) In vielen Lerngruppen hat sich e<strong>in</strong> Helfersystem bewährt und etabliert.<br />
K<strong>in</strong>der, geben ihre Spezialkenntnisse an andere weiter, unterstützen ihre Lehrer bei Handha-<br />
bungsfragen und lernen so von- und mite<strong>in</strong>ander. Diejenigen, die von anderen e<strong>in</strong>gewiesen<br />
wurden, s<strong>in</strong>d bald selbst <strong>in</strong> der Lage, als Helfer zu agieren. E<strong>in</strong> Schneeballeffekt entsteht.<br />
Dieses Helfersystem will allerd<strong>in</strong>gs planmäßig entwickelt und geübt werden. Es muss begleitet<br />
werden. Die geme<strong>in</strong>same Planung der Unterrichtsvorhaben - Bra<strong>in</strong>storm<strong>in</strong>g im Plenum, Ab-
sprachen zum Vorgehen, Zielvere<strong>in</strong>barungen und Aufgabenverteilung - gew<strong>in</strong>nt beim E<strong>in</strong>satz<br />
<strong>neuer</strong> Medien an Stellenwert. (Auch die geme<strong>in</strong>same Planung der an fächerübergreifenden<br />
Vorhaben beteiligten Kollegen.) Der Stellenwert des Gesprächskreis wächst. Unterricht mit<br />
neuen Medien erfordert geme<strong>in</strong>same Planungs-, (Zwischen)Auswertungs-, Reflexions-, Siche-<br />
rungs- und Bewertungsphasen. Die Reflexions- und Rückmeldekultur gew<strong>in</strong>nt an Bedeutung.<br />
Das Vorgehen bei der Texterstellung, der Internetrecherche will rückblickend betrachtet und<br />
im H<strong>in</strong>blick auf die Prozesse und Ergebnisse beurteilt werden, die <strong>in</strong>dividuellen Lernschritte<br />
und das persönliche Arbeitsverhalten geraten <strong>in</strong> den Fokus der rückblickenden Betrachtung.<br />
Damit entwickeln bzw. erweitern K<strong>in</strong>der metakognitive Kompetenzen.<br />
Qualität<br />
Medial gestütztes, nicht aber medial begründetes Lernen ist zielführend für die Arbeit mit<br />
neuen Medien. Es s<strong>in</strong>d die Lernprozesse der K<strong>in</strong>der und die Lern<strong>in</strong>halte, die den E<strong>in</strong>satz <strong>neuer</strong><br />
Medien begründen - nicht die Möglichkeiten, die die Medienausstattung der Schule eröffnet.<br />
Mediene<strong>in</strong>satz beim Lehren und Lernen kann nur so lernförderlich se<strong>in</strong> wie die ihm zugrunde<br />
liegenden Unterrichtskonzepte. Der Mehrwert, den neue Medien für den Lernprozess bieten<br />
können, besteht <strong>in</strong> ihrem Beitrag zum Lernertrag, <strong>in</strong> ihrem Nutzen für das Erreichen bestimm-<br />
ter <strong>in</strong>haltlicher Ziele <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kompetenzbasierten Lernkonzept. Zu fragen ist also <strong>in</strong> Bezug<br />
auf die Qualität von Unterricht mit neuen Medien:<br />
Welche Lernaktivitäten werden ausgelöst?<br />
Was wird gelernt?<br />
Wie wird gelernt?<br />
Was könnte ohne neue Medien nicht bzw. nicht so effizient gelernt werden?<br />
Dies hat Konsequenzen für die Rolle der Lehrer<strong>in</strong>nen und Lehrer. Sie verabschieden sich<br />
davon, Lernen zu erzeugen, statt dessen ermöglichen sie Lernen. Sie verstehen sich als „An-<br />
bieter“ von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten - nicht als Übermittler von Wissen. Sie schaffen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen für die Selbstorganisation der Lernenden und ermöglichen die selbsttätige und<br />
selbstständige Wissenserschließung. Die Aufgabe der Lehreenden besteht dar<strong>in</strong>, die Arbeit zu<br />
begleiten, die Schüler zum Beispiel beim Sammeln des Materials zu unterstützen, sie <strong>in</strong> Kennt-<br />
nis ihrer Lernvoraussetzungen und <strong>in</strong> Kenntnis der Sachstruktur der Inhalte beim Arbeiten zu<br />
beraten, weiterführende Fragen <strong>in</strong> die Gruppen e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen, Impulse für die Gestaltung und<br />
Realisierung der Präsentationen zu bieten und die Auswertungsphase sowie die Reflexion der<br />
Lernprozesse zu moderieren.<br />
Reduktion<br />
Kle<strong>in</strong>e Schritte führen zu e<strong>in</strong>er Integration <strong>neuer</strong> Medien und zu e<strong>in</strong>er Veränderung der Lern-<br />
kultur im Alltagsunterricht: Die E<strong>in</strong>beziehung des Erfahrungsh<strong>in</strong>tergrunds, das Anknüpfen<br />
an Vorkenntnisse, das Aufgreifen der Interessen der Lernenden - auch <strong>in</strong> Bezug auf Computer<br />
und Internet - s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> erster Schritt. Es muss nicht gleich das aufwändige Multimedia-Projekt<br />
realisiert werden.<br />
Selbststeuerung des Lernens<br />
Lernen ist e<strong>in</strong> selbst gesteuerter Prozess, der selbständiges Handeln erfordert, das gelernt se<strong>in</strong><br />
will. Dies erfordert von Lehrern wie Schülern Bereitschaft und Engagement, sich auf das Ler-<br />
139
140<br />
nen des Lernens mit neuen Medien e<strong>in</strong>zulassen. Es gilt Erfahrungen zu sammeln und die neu-<br />
en Medien Schritt für Schritt <strong>in</strong> die regulären Unterrichtsvorhaben zu <strong>in</strong>tegrieren. Selbstorga-<br />
nisation will gelernt se<strong>in</strong>. Absprachen über die Nutzung des Computers <strong>in</strong> der Medienecke,<br />
Absprachen über Kooperationsformen beim Schreiben am Computer mit dem Partner oder <strong>in</strong><br />
der Gruppe sollten geme<strong>in</strong>sam mit den K<strong>in</strong>dern getroffen und schriftlich festgehalten werden.<br />
Von Zeit zu Zeit sollte die Praktikabilität der Regeln überprüft werden. (Starre Zeitlimits mö-<br />
gen am Anfang regelnd wirken, mit der Zeit können sie h<strong>in</strong>derlich se<strong>in</strong>, wenn Arbeitsprozesse<br />
e<strong>in</strong>zelner Gruppen e<strong>in</strong>en flexiblen Zeitrahmen erfordern.)<br />
Je jünger Lernende s<strong>in</strong>d, desto mehr Anleitung <strong>in</strong> Form vorbereiteter Lernumgebungen be-<br />
nötigen sie, um das eigene Lernen zu kontrollieren und zu reflektieren. Lernangebote müssen<br />
Lernhilfen enthalten, die ihre erfolgreiche Bearbeitung ermöglichen.<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>er Internet–Rallye suchen die K<strong>in</strong>der Informationen über den Zielort ihrer<br />
Klassenreise. Die Internet–Recherche erfolgt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er von der Lehrer<strong>in</strong> vorbereiteten Suchum-<br />
gebung, anhand e<strong>in</strong>er Vorauswahl von L<strong>in</strong>ks, mit gezielten Fragen, die auf den gefundenen<br />
Seiten auch beantwortet werden, mit Anleitungstexten zum Dateidownload. Es erfolgen<br />
Gruppenbildungen, die K<strong>in</strong>der mit unterschiedlichen Kompetenzen zu e<strong>in</strong>em Team zusam-<br />
menführen. Trotzdem werden die K<strong>in</strong>der auf den gefundenen Seiten über Hyperl<strong>in</strong>ks unter-<br />
schiedliche Wege e<strong>in</strong>schlagen und unterschiedliche Entdeckungen machen. Mit der Integration<br />
<strong>neuer</strong> Medien als Werkzeuge des Lernens verpufft die Illusion gleichschrittigen Lernens. Die<br />
<strong>in</strong>teraktiven Potenziale von Computer und Internet öffnen Lernenden <strong>in</strong>dividuelle Wege der<br />
Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -gestaltung (auch, aber eben auch nicht nur <strong>in</strong><br />
der Schule). H<strong>in</strong>zu kommt - und das ist <strong>in</strong> unserer so genannten „Informationsgesellschaft“<br />
von besonderer Bedeutung - Informationen s<strong>in</strong>d noch lange nicht Wissen, Wissen ist noch<br />
lange nicht Verstehen. Es geht heute also darum, Lernende zu befähigen Fragen zu stellen,<br />
Informationen zu f<strong>in</strong>den, auszuwählen und zu verarbeiten, um Wissen zu generieren und Ver-<br />
ständnis zu entwickeln. E<strong>in</strong> kompetenter Umgang mit Computer und Internet erfordert die<br />
Fähigkeit zu recherchieren, zu selektieren, zu bewerten und zu gestalten, auszuwählen, zu ent-<br />
scheiden, wann und wozu welche Medienangebote von Nutzen s<strong>in</strong>d etc. Dies müssen Grund-<br />
schulk<strong>in</strong>der <strong>in</strong> vielfältigen Handlungssituationen lernen, Vorstrukturierung bedeutet hier nicht<br />
Engführung. Den Umgang mit Suchmasch<strong>in</strong>en müssen K<strong>in</strong>der auch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Schwierigkeiten<br />
erfahren, jedoch sollten sie sich Unterstützung holen können, wenn sie <strong>in</strong> Sackgassen geraten.<br />
Und vor allem sollten sie sich über ihre Erfahrungen austauschen (Selbstreflexion, Austausch<br />
unterschiedlicher Erfahrungen, Lernen von- und mite<strong>in</strong>ander). Nicht nur Internet-Recherchen<br />
zeigen es: neue Medien fördern Kooperation und Kommunikation und unterstützen die ge-<br />
me<strong>in</strong>same Produktion von Ideen ebenso wie das Öffentlichmachen und den Austausch von<br />
Ideen und Ergebnissen.<br />
Technologie<br />
Zwei Computer und e<strong>in</strong> Internetanschluss im Klassenzimmer verändern erst e<strong>in</strong>mal nur den<br />
Raum. Nicht die Technik unterstützt das Lernen, weder Hard- noch Software bee<strong>in</strong>flussen<br />
Lernprozesse positiv, sondern die didaktische Konzeption ihres E<strong>in</strong>satzes im Lehr-Lern-Pro-<br />
zess. Die Qualität des Unterrichts und den <strong>in</strong>dividuelle Lernertrag jedes K<strong>in</strong>des verantworten<br />
weiterh<strong>in</strong> die Lehrenden, die Lehr-Lern-Sett<strong>in</strong>gs konzipieren und <strong>in</strong> diese auch die neuen
Medien unter Bezug auf die Ziele, die Inhalte und die Lernvoraussetzungen der Lernenden<br />
e<strong>in</strong>beziehen. Bei der Nutzung <strong>neuer</strong> Medien geht es nicht nur um den E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er neuen<br />
Technologie. Es geht darum, die neuen Medien <strong>in</strong> ihren vielfältigen Potenzialen sachbezogen<br />
und zielgerichtet für Lehr-Lern-Prozesse zu nutzen, sie als s<strong>in</strong>nvolle und notwendige Erweite-<br />
rung der vertrauten Kulturtechniken zu verstehen, um K<strong>in</strong>dern Lernoptionen zu eröffnen. Im<br />
herkömmlichen Frontalunterricht lassen sich zwei Computer <strong>in</strong> der Medienecke hier und da<br />
<strong>zur</strong> Beschäftigung e<strong>in</strong>zelner K<strong>in</strong>der parallel zum Klassenunterricht durchaus e<strong>in</strong>setzen, nicht<br />
aber s<strong>in</strong>nvoll für die Unterstützung des Lehrens und Lernens nutzen.<br />
Unterricht planen<br />
Im Zentrum aller Überlegungen <strong>zur</strong> Unterrichtsentwicklung steht e<strong>in</strong> verändertes Verständnis<br />
von Lernen. Lernen vollzieht sich nicht als Reproduzieren des Vorgedachten, als Überneh-<br />
men des Gehörten. Lernen ist ke<strong>in</strong> additiver Zuwachs an Wissensbauste<strong>in</strong>en, die die Ler-<br />
nenden aufe<strong>in</strong>anderstapeln. Lernen ist e<strong>in</strong> Prozess, den jeder Lernende <strong>in</strong>dividuell gestaltet,<br />
denn Lernen beruht im eigenaktiven Aufbau von Erfahrungen - <strong>in</strong> Erweiterung, Ergänzung,<br />
Veränderung vorhandener Erfahrungen. Lernen ist e<strong>in</strong> Vorgang den jeder Lernende selbst<br />
steuert, e<strong>in</strong> Vorgang, der von außen angeregt, aber nicht vorbestimmt werden kann. Lehren<br />
muss demzufolge im Anbieten von Wissen bestehen und im Gestalten von Lernumgebungen,<br />
die die Wissensaneignung unterstützen. Die „Vermittlungsdidaktik“, die suggeriert, dass<br />
Lern<strong>in</strong>halte direkt an die Lernenden „übertragen“ werden können, wird durch e<strong>in</strong>e „Ermög-<br />
lichungsdidaktik“ abgelöst, die verdeutlicht, dass Lehrende - durchaus auch planmäßig und<br />
auf die <strong>in</strong>dividuellen Lernvoraussetzungen abgestimmt - lediglich die Bed<strong>in</strong>gungen für Lernen<br />
herstellen, lediglich Prozesse selbstständiger Wissenserschließung anregen können, nicht aber<br />
das Lernen auch bewirken können. Statt der Frage „Was muss ich tun, um den Lern<strong>in</strong>halt zu<br />
vermitteln?“ gilt es bei der Vorbereitung des Unterrichts die Frage zu stellen „Was können die<br />
K<strong>in</strong>der selbst unternehmen, um sich diesen Inhalt zu erschließen?“ , gilt es zu fragen „Welche<br />
sozialen und methodischen Kompetenzen benötigen die K<strong>in</strong>der dazu, welche müssen e<strong>in</strong>ge-<br />
führt, welche vertieft, welche können wiederholend geübt werden?“<br />
Neue Medien sollten so e<strong>in</strong>gesetzt werden, dass sie die kognitiven Prozesse der Ause<strong>in</strong>ander-<br />
setzung mit den Lern<strong>in</strong>halten unterstützen und den <strong>in</strong>dividuellen Lernprozess und die aktive<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung mit dem Inhalt befördern. Unverzichtbar für die Arbeit mit neuen Me-<br />
dien ist e<strong>in</strong>e klar gegliederte Stundenstruktur, die e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führungsphase (Vorbesprechung,<br />
Zielklärung, Abstimmung des Vorgehens und der Zeitschiene), e<strong>in</strong>e Arbeitsphase und - immer<br />
- e<strong>in</strong>e Phase der Zusammenführung (Rückblick auf die Arbeitsschritte, auf das Vorgehen,<br />
Ausblick auf die weitere Arbeit) ausweist. Diese strukturelle Rahmung gibt den K<strong>in</strong>dern die<br />
Mitverantwortung für den Lernprozess (und macht sie ihnen bewusst). „Gerade medienge-<br />
stützte Lernangebote bedürfen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiven Planung und Vorbereitung, da exploratives<br />
Lernen trotz Begeisterung der Schüler nicht völlig problemlos erfolgt. Die besondere Schwie-<br />
rigkeit liegt <strong>in</strong> der Lernorganisation. Die Schüler müssen die Organisation des eigenen Ler-<br />
nens erst lernen, wobei die Probleme vor allem durch e<strong>in</strong>e ungünstige E<strong>in</strong>teilung der Lernzeit,<br />
durch mangelhafte Vorgehensweisen bei der Strukturierung komplexer Sachverhalte sowie<br />
durch fehlende Übung entstehen.“ (16) Vorstrukturierungen - im S<strong>in</strong>ne von Orientierungshil-<br />
fen für die Lernenden - s<strong>in</strong>d um so unverzichtbarer, je jünger die Schüler s<strong>in</strong>d.<br />
141
142<br />
Veränderung der Rollen von Lehrenden und Lernenden<br />
Schule und Unterricht haben ihre Vorrangstellung bei der Vermittlung von Informationen,<br />
Wissen und Fähigkeiten längst e<strong>in</strong>gebüßt. In e<strong>in</strong>er Welt, <strong>in</strong> der sich Wissen explosionsartig<br />
vermehrt und täglich verändert, <strong>in</strong> Zeiten der „learn<strong>in</strong>g community“ und des „Wissenssha-<br />
r<strong>in</strong>g“ verfügen Lehrer nicht mehr über „Wissenshoheit“. Computer, Multimedia–CDs und<br />
Internet eröffnen bereits jüngeren K<strong>in</strong>dern Zugang zu Informationen, Lernangeboten und<br />
Möglichkeiten für Kontakte, die ihnen ke<strong>in</strong> Medium <strong>in</strong> der Vergangenheit eröffnet hätte. Das<br />
Internet ist das erste „alterslose“ Medium, das es gibt - Lesekompetenz setzt es allerd<strong>in</strong>gs vo-<br />
raus.<br />
Die Aufgaben der Lehrenden verändern sich h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er prozessanregenden, beratenden,<br />
moderierenden Rolle. Das me<strong>in</strong>t nun allerd<strong>in</strong>gs nicht, das die Verantwortung für die Vor-<br />
strukturierung und begleitende Impulssetzung entfällt - diese Verantwortung nimmt vielmehr<br />
zu. Sofern K<strong>in</strong>der mit neuen Medien unbegleitet arbeiten, werden deren Lernpotenziale über-<br />
haupt nicht ausgeschöpft. Zielloses Surfen im Internet und planloses Tra<strong>in</strong>ieren mit e<strong>in</strong>em<br />
Rechtschreib- oder Mathematikprogramm ist nicht mehr als Beschäftigungstherapie - schuli-<br />
sche Lernzeit wird nicht genutzt.<br />
Werkzeuge<br />
Computer können als Medium der Instruktion ebenso wie als Medium der Konstruktion die-<br />
nen. Im traditionellen S<strong>in</strong>n f<strong>in</strong>det der Computer als Instruktionsmedium se<strong>in</strong>en didaktischen<br />
Ort, wenn K<strong>in</strong>der mit e<strong>in</strong>em Lernprogramm Rechtschreiben oder Rechnen üben, im Lexikon<br />
auf e<strong>in</strong>er CD-Rom-Version Informationen nachschlagen. Im simpelsten Fall entspricht das<br />
Programm digitalisierten Arbeitsblättern oder Texten, meist s<strong>in</strong>d die Angebote aber multime-<br />
dial unterstützt.<br />
Im traditionellen Frontalunterricht f<strong>in</strong>den neue Medien ihren Ort, wenn der Lehrer am<br />
Beamer Schritte der Programmnutzung demonstriert (die die Schüler an ihren Computerar-<br />
beitsplätzen nachvollziehen) oder Inhalte e<strong>in</strong>er CD-Rom präsentiert und die K<strong>in</strong>der zuschau-<br />
en. Als kognitives Werkzeug eröffnet der Computer Potenziale für eigenaktive, konstruktive<br />
Lernprozesse, wenn K<strong>in</strong>der Programme und Internet für produktive Zwecke (kooperatives<br />
Schreiben mit e<strong>in</strong>er Textverarbeitung, Internetrecherche, Plakatgestaltung mit e<strong>in</strong>em Layout-<br />
programm) nutzen und ihre Ergebnisse mithilfe des Beamers oder onl<strong>in</strong>e auf e<strong>in</strong>er Webseite<br />
der Klasse präsentieren.<br />
Zuletzt<br />
„Erkenntnisse fallen meist nicht wie Schuppen von den Augen. Erkenntnisse erfordern hart-<br />
näckiges Denken, angestrengtes Lernens, begriffliches Klären, Abstraktion, Versuch und Irr-<br />
tum, Ausdauer! Aber auch: Urteilsvorsicht, vorläufige, korrigierbare E<strong>in</strong>sichten.“ (18)<br />
Anmerkungen<br />
1) http://www.teachersnews.net/News2002/020203_17.htm (22.02.02).<br />
2) 21st Century Literacy Summit, 7.–8. März 2002, Berl<strong>in</strong>.<br />
3) Quelle: Der Tagesspiegel v. 08.03.2002.<br />
4) http://www.teachersnews.net/News2002/020203_17.htm (22.02.02).
5) Hier sei auf die zahlreichen Internetquellen verwiesen, z. B. http://www.lehrer-onl<strong>in</strong>e.de/. Weitere L<strong>in</strong>ks f<strong>in</strong>den<br />
sich unter http://www.dagmarwilde.de/service/l<strong>in</strong>ks/neuemediengs.html<br />
6) Der Perfektionsanspruch sollte daher nicht zu hoch gesetzt werden. Auch der private Computer stürzt mitunter<br />
ab und will gewartet werden. Je höher die Ansprüche, desto höher die Anforderungen an die Adm<strong>in</strong>istration.<br />
Nicht jedes Update muss auf allen Rechnern – so sie denn ihre Funktion gut erfüllen – <strong>in</strong>stalliert werden. Nicht<br />
jedes neue Gerät am Markt muss <strong>in</strong> das schulische Netzwerk e<strong>in</strong>gefügt werden.<br />
7) We<strong>in</strong>ert, Franz E.: Lernkultur im Wandel. In: Beck / Guldimann / Zutavern (Hg.): Lernkultur im Wandel. St.<br />
Gallen 1997. S. 11–27. S. 27.<br />
8) Siebert, Horst; Didaktisches Handeln <strong>in</strong> der Erwachsenenbildung. Didaktik aus konstruktivistischer Sicht. Neu<br />
wied 2000 (3. A.) (Luchterhand). S. 263.<br />
9) Dies zeigten zuletzt die Ergebnisse der Evaluation des Laptop-Projekts am Evangelisch Stiftischen Gymnasium<br />
<strong>in</strong> Gütersloh. Vgl. Iss<strong>in</strong>g / Schaumburg.<br />
10) Vgl. hierzu: Wilde, Dagmar: Schreiben@Mausklick, Lesen@L<strong>in</strong>ks - Lernchancen e<strong>in</strong>es zielgerichteten E<strong>in</strong>satzes<br />
<strong>neuer</strong> Medien im Deutschunterricht. In: Grundschule 1/2003. Wilde, Dagmar: Durch die Texte zappen. Neue<br />
Medien fördern Lesekompetenz - mit neuen Medien Lesekompetenz fördern. In: unterrichten/erziehen 11–12/<br />
2002..<br />
11) Die statistischen Angaben stammen aus der Studie „KIM 2002“ des Medienpädagogischen Forschungsverbund<br />
des Südwest (MpFS), <strong>in</strong> dem die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LfK), die Landeszen<br />
trale für private Rundfunkveranstalter Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz (LPR) und der Südwestrundfunk (SWR) kooperieren.<br />
Hierzu wurden von Mai bis Juli über 1.200 K<strong>in</strong>der und deren Mütter befragt. Im Mittelpunkt der Untersu<br />
chung „KIM 2002“ standen die Medien PC und Internet. Quelle: www.mpfs.de bzw. http://www.wuv.de/daten/<br />
studien/022003/685/summary.html.<br />
12) Wilde, Dagmar: Schreiben@Mausklick, Lesen@L<strong>in</strong>ks - Lernchancen e<strong>in</strong>es zielgerichteten E<strong>in</strong>satzes<br />
<strong>neuer</strong> Medien im Deutschunterricht. In: Grundschule 1/2003.<br />
13) Vgl. Tulodziecki, Gerhard: Medien <strong>in</strong> Erziehung und Bildung. Bad Heilbrunn 1997.<br />
14) Vgl. Wilde, Dagmar: Neue Medien verändern das Lehren und Lernen ... aber nicht von selbst. Das Lehrerhand<br />
buch, C 5.4, Februar 2003. Raabe Verlag.<br />
15) Erforderlich ist e<strong>in</strong> Schulkonzept, das neben <strong>in</strong>haltlichen Zielvere<strong>in</strong>barungen für den Mediene<strong>in</strong>satz auch die<br />
Verantwortlichkeiten regelt. Anschaffungen und Programmupdates s<strong>in</strong>d zu koord<strong>in</strong>ieren. Die Betreuung der<br />
Hardware kann mit wachsendem Ausstattungsstand auch von noch so ambitionierten Kollegen nicht mehr<br />
<strong>in</strong> der Freizeit bewältigt werden. Die Kompetenzen müssen klar geregelt, möglichst <strong>in</strong> bestimmten Bereichen<br />
(Netzwerk, Hardwarewartung) auch extern delegiert werden.<br />
16) Positive Erfahrungen mit dem Laptope<strong>in</strong>satz liegen aus verschiedenen Berl<strong>in</strong>er Grundschulen vor. Vgl. http:<br />
//www.b.shuttle.de/b/l<strong>in</strong>dgrengs/<strong>in</strong>dex.html, http://www.twa<strong>in</strong>web.de/. Allgeme<strong>in</strong>e H<strong>in</strong>weise zum Notebooke<strong>in</strong><br />
satz im Unterricht unter http://www.lernen-mit-notebooks.de<br />
17) Knauder, S. 76.<br />
18) Siebert, Horst: Bildungsoffensive. Bildung ist mehr als Qualifizierung. Frankfurt/M. 2002. S. 60<br />
143
144<br />
Literatur<br />
Arnold, Rolf / Siebert, Horst: Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung <strong>zur</strong><br />
Konstruktion von Wirklichkeit. Baltmannsweiler 1999 (3. A.) (Schneider).<br />
Arnold, Rolf / Schüßler, Ingeborg: Wandel der <strong>Lernkulturen</strong>. Ideen und Bauste<strong>in</strong>e für e<strong>in</strong> le-<br />
bendiges Lernen. Darmstadt 1998.<br />
Aufenanger, Stefan: Medienkompetenz als Aufgabe von Schulentwicklung. In: SchulVerwal-<br />
tung spezial Heft 1/2001, S. 4–6.<br />
Blömeke, Sigrid: Medienpädagogische Kompetenz. Theoretische und empirische Fundierung<br />
e<strong>in</strong>es zentralen Elements der Lehrerausbildung. Erlangen 2000 (KoPäd).<br />
Büchter, A. / Dalmer, R. / Schulz-Zander, R.: Innovative schulische Unterrichtspraxis mit neu-<br />
en Medien. In: Rolff, H.-G. / Holtappels, H. G. / Klemm, K. / Pfeiffer, H. / Schulz-Zander, R.<br />
(Hg.): Jahrbuch der Schulentwicklung 12. We<strong>in</strong>heim und München 2002.<br />
Czwerwanski, A. / Hameyer, U. / Rolff, H.-G.: Schulentwicklung im Netzwerk. In: Rolff,<br />
H.-G. / Holtappels, H. G. / Klemm, K. / Pfeiffer, H. / Schulz-Zander, R. (Hg.): Jahrbuch der<br />
Schulentwicklung 12. We<strong>in</strong>heim und München 2002.<br />
Czwerwanski, Annette (Hg.): Schulentwicklung durch Netzwerkarbeit. Erfahrungen aus dem<br />
„Netzwerk <strong>in</strong>novativer Schulen <strong>in</strong> Deutschland“, Gütersloh 2003.<br />
Kle<strong>in</strong>schmidt-Bräutigam, Mascha: Neue Medien - neues Lernen? Oder: Wie können neue Me-<br />
dien <strong>zur</strong> Schulentwicklung beitragen? In: Grundschulunterricht 2/2000. S. 6-8.<br />
Schaumburg, Heike / Iss<strong>in</strong>g, Ludwig J.: Lernen mit Laptops. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Evaluationsstu-<br />
die. Gütersloh 2002.<br />
Schiersmann, Chr. / Busse, J. / Krause, D.: Medienkompetenz - Kompetenz für Neue Medien.<br />
Forum Bildung. Bonn 2002.<br />
Schnoor, Detlev: Neue Medien: Wie Schulen e<strong>in</strong>e neue Lernkultur entwickeln können. In:<br />
Herzig, Bardo (Hg.): Medien machen Schule. Grundlagen, Konzepte und Erfahrungen <strong>zur</strong><br />
Medienbildung. Bad Heilbrunn/Obb. 2001. S. 205–225.<br />
Spanhel, Dieter: Medienpädagogische Kompetenz als <strong>in</strong>tegraler Bestandteil der Lehrerprofes-<br />
sionalität. In: Herzig, Bardo (Hg.): Medien machen Schule. Grundlagen, Konzepte und Erfah-<br />
rungen <strong>zur</strong> Medienbildung. Bad Heilbrunn/Obb. 2001. S. 267–294.<br />
Schwetz, H. / Zeyr<strong>in</strong>ger, M. / Reiter, A. (Hg.): Konstruktives Lernen mit neuen Medien. Inns-<br />
bruck–Wien–München–Bozen 2001.<br />
Tulodziecki, Gerhard / Blömeke, Sigrid (Hg.): Neue Medien – neue Aufgaben für die Lehrer-<br />
ausbildung. Tagungsdokumentation. Gütersloh 1997.<br />
Tulodziecki, Gerhard: Medien <strong>in</strong> Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele e<strong>in</strong>er<br />
handlungs– und entwicklungsorientierten Medienpädagogik. Bad Heilbrunn/Obb. 1997 (10.<br />
khg).<br />
Weidenmann, Bernd: Instruktionsmedien. In: We<strong>in</strong>ert, F. E. (Hg.): Enzyklopädie der Psycholo-<br />
gie. Psychologie des Lernens und der Instruktion. Serie I, Band 2. Gött<strong>in</strong>gen 1996.<br />
Wilde, Dagmar: Lehren und Lernen mit neuen Medien. In: SchulVerwaltung, Heft 4/2002, S.<br />
137-143.<br />
Wilde, Dagmar: Fortbildungsnetzwerke knüpfen. In: Grundschulunterricht 2/2002. S. 39-43.
Wilde, Dagmar: Regional und kollegial - Fortbildung im Netz. Neue Lernkultur und neue<br />
Medien erfordern neue <strong>Fortbildungskonzept</strong>e. In: Grundschule konkret 17, Januar 2002.<br />
LISUM Berl<strong>in</strong>. S. 49-55.<br />
Wilde, Dagmar: Schreiben@Mausklick, Lesen@L<strong>in</strong>ks - Lernchancen e<strong>in</strong>es zielgerichteten E<strong>in</strong>-<br />
satzes <strong>neuer</strong> Medien im Deutschunterricht. In: Grundschule 01/2003.<br />
Wilde, Dagmar: Neue Medien verändern das Lehren und Lernen... aber nicht von selbst! Klei-<br />
ne Schritte zu <strong>neuer</strong> Lernkultur <strong>in</strong> der Grundschule. In: Das Lehrerhandbuch Februar 2003.<br />
Raabe Verlag.<br />
Wilde, Dagmar: <strong>Fortbildungskonzept</strong> <strong>zur</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>neuer</strong> <strong>Lernkulturen</strong> <strong>in</strong> der Grundschu-<br />
le unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>neuer</strong> Medien im Klassenraum – ForMeL G. In: Jahrbuch der Deutsch-<br />
didaktik 2003.<br />
Onl<strong>in</strong>e–Material aus dem Projekt ForMeL G<br />
www.dagmarwilde.de/semik/<strong>in</strong>troformelg.html<br />
www.dagmarwilde.de/neuemedien.html<br />
www.schulvision.de<br />
www.schulvision.de/netzwerkstatt/<strong>in</strong>dex.html<br />
Unterrichtsbeispiele der Projektschulen<br />
http://www.b.shuttle.de/b/l<strong>in</strong>dgrengs/<br />
www.twa<strong>in</strong>web.de<br />
www.momodo.de<br />
http://home.snafu.de/ottowels/<br />
www.moewensee-grundschule.de<br />
www.schwielowsee-grundschule.de<br />
http://www.5-g-mitte.de/<br />
145
146<br />
Autor<strong>in</strong>nen und Autoren der Beiträge<br />
Thomas Kahlki Lehrer an der Astrid-L<strong>in</strong>dgren-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-<br />
Spandau, Projektmitarbeiter 1999 - 2003<br />
thoka@l<strong>in</strong>dgrenschule.de<br />
Frieder Klapp Lehrer an der Mark-Twa<strong>in</strong>-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-<br />
Re<strong>in</strong>ickendorf, Projektmitarbeiter 1999 - 2003<br />
frieder@klappweb.de<br />
Marianne Kircher Lehrer<strong>in</strong> an der Möwensee-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Mitte,<br />
Projektmitarbeiter<strong>in</strong> 2001 - 2002<br />
Doris Lerner Lehrer<strong>in</strong> an der Tempelherren-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Tempelhof,<br />
Fachsem<strong>in</strong>arleiter<strong>in</strong> für vorfachlichen Unterricht<br />
(D/SK) im 2. SPS Tempelhof (L), Projektmitarbeiter<strong>in</strong> 2001<br />
- 2003<br />
doris.lerner@freenet.de<br />
Brigitte Meier Lehrer<strong>in</strong> an der Schwielowsee-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Schöneberg,<br />
Projektmitarbeiter<strong>in</strong> 1999- 2003<br />
brigitte.meier@berl<strong>in</strong>.de<br />
Ulrich Negraszus Lehrer an der Grundschule im Grünen <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Hohenschönhausen,<br />
Projektmitarbeiter 1999 - 2003<br />
ulrich.negraszus@cityweb.de<br />
Helmut Nitschke Schulleiter der Rose-Oehmichen-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Neukölln,<br />
Projektmitarbeiter 2001 - 2003<br />
helmut.nitschke@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Axel Schmidt Lehrer an der Lisa-Tetzner-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Neukölln,<br />
Fachsem<strong>in</strong>arleiter für den vorfachlichen Unterricht (M/<br />
MÄERZ) im 1. SPS Friedrichsha<strong>in</strong> (L), Projektmitarbeiter<br />
2001 - 2003<br />
axelp.schmidt@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Eva.Maria Sonnick-Rirter Lehrer<strong>in</strong> an der 5. Grundschule Mitte <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Mitte, Projektmitarbeiter<strong>in</strong><br />
2002 - 2003<br />
EmSonnickR@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Berwnard Weber Lehrer an der Otto-Wels-Grundschule <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Kreuzberg,<br />
Projektmitarbeiter 1999 - 2002<br />
bewe@snafu.de<br />
Dagmar Wilde Projektleiter<strong>in</strong> 2000 - 2003, Hauptamtliche Fachsem<strong>in</strong>arleiter<strong>in</strong><br />
für den vorfachlichen Unterricht, Fachsem<strong>in</strong>arleiter<strong>in</strong><br />
für den vorfachlichen Unterricht (D/SK) im 3. SPS Charloittenburg-Wilmersdorf<br />
(L), Lehrer<strong>in</strong> an der Kathar<strong>in</strong>a-He<strong>in</strong>roth-Grundschule<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Wilmersdorf